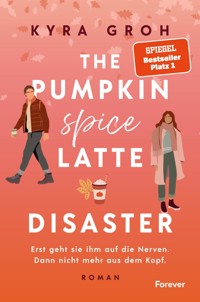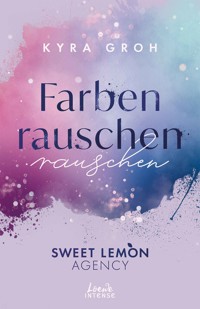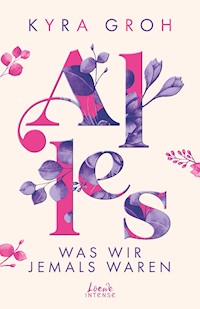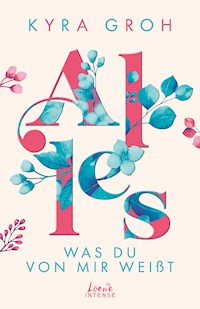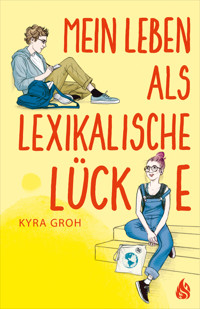9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sweet Lemon Agency
- Sprache: Deutsch
Zeilenflüstern ist SPIEGEL-Bestseller! Seine Stimme bedeutet ihr alles – bis sie ihm begegnet Jede Nacht lässt sich Klara von Noel Carter in den Schlaf flüstern. Dabei kennt sie nur seine Stimme. Alles andere versteckt der Hörbuchsprecher hinter einem Pseudonym. Bis ihr erster Job bei der Sweet Lemon Agency Klara in ein Tonstudio führt, in dem ausgerechnet Noel auf sie wartet. Er soll ihre Werbetexte für eine sinnliche neue Kampagne einsprechen – und hasst jedes Wort davon. Denn für den gescheiterten Schauspieler sind die Aufnahmen ein weiterer Beweis dafür, dass er von niemandem ernstgenommen wird. Von niemandem außer Klara, die ihm zeigt, wie viel zwischen den Zeilen steht. Auftakt einer neuen New Adult-Reihe in der deutschen Werbebranche Autorin Kyra Groh verwebt ihre Leidenschaft für Hörbücher in ihrer neuen New-Adult-Reihe rund um die Sweet Lemon Agency: She fell first but he fell harder ist das Motto, wenn CODA (Child of Deaf Adults) Klara und Hörbuchsprecher Noel für eine spicyWerbekampagne aufeinandertreffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Playlist
Triggerwarnung
1GedankensturmKLARA
2FamilienkisteNOEL
3IdeengeysirKLARA
4TrennungsschmerzNOEL
5SchokoladenprinzKLARA
6SalzschokoladeKLARA
7StimmbruchNOEL
8SelbstzahlerKLARA
9StreichholzpulsNOEL
10BauchplatschermomentKLARA
11SchauspielhändchenNOEL
12GefühlsinjektionKLARA
13DazwischenwahrheitNOEL
14ZufallsfügungKLARA
15SimultanfaszinationNOEL
16ReibeisenlachenKLARA
17GedankenstromNOEL
18SchwimmtrainingKLARA
19OberarztphasenKLARA
20VerzweiflungsmailNOEL
21WahrheitstrefferKLARA
22BastardglückNOEL
23EndorphinstoßKLARA
24VorsilbenchaosNOEL
25TextfehlerKLARA
26MundbekenntnisNOEL
27StörgeräuscheKLARA
28ImpulskontrolleNOEL
29SehnsuchtsflutKLARA
30ErsatzverkehrNOEL
31EtappensiegKLARA
32HerzbruchNOEL
33KühlschranklichtKLARA
34LippenhöheNOEL
35WachshändeKLARA
36GeräuschkulisseNOEL
37PausenbilanzKLARA
38KörperspracheNOEL
39FesttagsbeleuchtungKLARA
40KurznachrichtNOEL
41DrachenmädchenKLARA
42HauptrolleNOEL
43WegfinderKLARA
44KomparsenlebenNOEL
45SchwiegervaterKLARA
46PublikumsleereNOEL
47BabypinkKLARA
48WolkenkopfNOEL
49IdentitätskrisenKLARA
50PastellgelbNOEL
51ÜberraschungspostKLARA
52SelbstsabotageNOEL
53WortlosKLARA
54Nicht-WartenKLARA
55ErinnerungsblitzKLARA
56KlarnameKLARA
57FantasieproduktKLARA
58WechselwirkungNOEL
59ZeilenflüsternKLARA
Danksagung
ContentNote
Für alle, die schon einmal in den Zuschauerraum geblickt und den wichtigsten Platz leer vorgefunden haben.
Play
list
Take Yours, I’ll Take Mine – Matthew Mole
Enchanted (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Smile Like You Mean It – Spanish Love Songs
Sparks Fly (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Dancing on My Own – The Regrettes
Until I Found You – Stephen Sanchez, Em Beihold
rosa rugosa – Lucry & Suena, Blumengarten, 0109, Gustav, Zachi
All Too Well (10Minute Version) (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Let me Down Slowly – Alex Benjamin
No One Can Save You – Elle King
Elephant – Damien Rice
The Funeral – Band of Horses
All Too Well – Dan Campbell
Something in the Orange – Zach Bryan
I Will Follow You Into The Dark – Miya Folick
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält Inhalte, die potenziell triggernd auf euch wirken können, wenn ihr schon einmal in ähnlichen Situationen wart. Deshalb findet ihr am Ende des Buchs eine Content Note. Bitte passt auf euch auf.
Wir wünschen euch das bestmögliche Leseerlebnis.
1
Gedanken
sturm
KLARA
Prinz Arran hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Er bemerkte schon seit einigen Wochen, dass ihm das Drachenmädchen mit den roten Haaren in den Gassen von Old Lal’Leeen auflauerte. Und er wusste, dass sie ihm nach dem Leben trachtete. Sollte er sie einen Versuch wagen lassen? Oder sollte er ihr bei ihrem nächsten Aufeinandertreffen direkt selbst die Kehle durchschneiden?
»Klara?«
Die raue Stimme, die mich bereits im ersten Absatz des Hörbuchs jedes Mal in ihren Bann zieht, wird von einer anderen unterbrochen. Einer, die der von Noel Carter nicht unähnlicher sein könnte. Wo seine kratzig, verführerisch und geheimnisvoll ist, klingt die von meiner Kollegin Amelie feminin und weich. Ein bisschen so, als würde sie singen.
Ich schaue auf und sehe noch, wie Amelie an der gläsernen Wand unseres Büros in ihrem gewohnt schnellen Schritt vorbeitrabt. Sie gibt Franka und mir mit fünf erhobenen Fingern zu verstehen, dass wir in ebenso vielen Minuten ein Meeting haben. Nicht irgendein Meeting. Das Meeting, für das ich eigentlich den ganzen Vormittag Ideen hätte brainstormen müssen.
Ich nehme meine Kopfhörer ab und begutachte ein letztes Mal das unberührte Dokument auf dem Laptop vor mir. Es verhöhnt mich mit seiner lächerlichen Unbeschriebenheit und Ideenlosigkeit. Es führt mir vor Augen, dass ich noch nicht gut genug bin. Dass ich mir mehr Mühe geben muss, wenn ich am Ende meines Trainee-Programms in der Sweet Lemon Agency als Junior Texterin weiterarbeiten möchte. Mein Chef Felix ist der Meinung, dass man Kreativität an- und ausknipsen kann. Wie einen Lichtschalter, der … Oh Mann, wenn Felix wüsste, dass mir für an- und ausknipsen kein besserer Vergleich als ein Lichtschalter einfällt, würde er mich auf der Stelle rauswerfen.
Wieso? Wieso habe ich gedacht, ich hätte Chancen auf eine Karriere in einer mehrfach awardgekrönten Kreativagentur? Nur weil ich ganz passabel mit Worten umgehen kann?
Ich sehe Amelie durch die verglasten Bürowände hinterher. Ich müsste ein bisschen mehr wie sie sein. Perfekt organisiert, perfekt strukturiert, perfekt perfekt für ihren Job als Projektmanagerin. Ich bin für meinen Job als Texterin offenbar bestenfalls … Ich weiß es nicht einmal. Wir wurden bereits letzte Woche über die anstehende Bewerbung bei einem potenziellen neuen Kunden informiert – ein Pitch, wie man es in der Werbung nennt – und hatten somit genug Zeit, mit ersten Ideen um die Ecke zu kommen. Wüthrich Chocolatier will sich komplett neu ausrichten. Statt der altbackenen Oma-Pralinen, die sie die letzten hundert Jahre produziert haben, wollen sie noch dieses Jahr mit hippen Schokoladentafeln an den Start gehen. Etliche deutsche Werbeagenturen wurden dazu eingeladen, ein Marketingkonzept für den Re-Launch vorzustellen. Sweet Lemon Agency ist eine davon. Felix hat gesagt, dieses Projekt wäre so was wie ein feuchter Traum für Kreative. Denkt wild, denkt sexy, tobt euch richtig aus. Und was ist mir dazu eingefallen? Nichts. Stattdessen sitze ich hier und höre heimlich Band eins der Schwingen-Saga, obwohl ich das schon so oft getan habe, dass ich jede Atempause des Sprechers vorhersagen kann. Felix wird denken, dass ich es nicht einmal versucht habe. Und wenn er eines hasst, dann mangelnde Motivation.
»Na? Bist du bereit, dich eine Stunde lang lautstark in der Luft zerreißen zu lassen?« Meine Schreibtischnachbarin Franka ist hinter ihrem Bildschirm aufgetaucht, der mit dem Rücken zu meinem steht. »Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht mal dein eigener Vater je gewagt hat?« Mit der einen Hand hält sie sich einen Notizblock vor die Brust, während sie die andere dramatisch zur Faust ballt. Ich bin verleitet, Franka darauf hinzuweisen, dass mein Vater mich noch nie lautstark angeschrien hat. Aber das hier ist nicht der richtige Rahmen für eine Diskussion über die vielen Dinge, in denen sich mein Leben als Kind gehörloser Eltern von dem anderer Leute unterscheidet.
»Hast du auch nichts?«, frage ich. Mein Puls schießt noch weiter in die Höhe.
»Nada«, entgegnet sie knapp und kommt zu mir herüber, nun beide Arme vor dem Notizbuch verschränkt. »Kann’s kaum erwarten, dass unser Möchtegern-Creative-Director mir die übliche Kassette ins Ohr drückt. Mit schlechten Ideen kann ich arbeiten, mit deinem leeren Papier kann ich mir bestenfalls den Arsch abwischen.« Frankas Imitation von Felix’ dauerhaft gehetztem Bariton ist ein Volltreffer. Die aufsteigende Panik in mir kann ihre Einlage trotzdem nicht mindern.
Ich muss jeden Text, den ich verfasse, im Anschluss mit Felix abstimmen. Und in den letzten Wochen bin ich ein paarmal kurz davor gewesen, ihm ein Lob abzuringen – was bei ihm wirklich nicht leicht ist. Als Kritiker ist er in etwa so feinfühlig wie diese TV-Köche, die im Kabelfernsehen bankrotte Imbissbuden aufmöbeln.
Weil ich in wichtigen Meetings nie ein Wort herausbekomme, traut er mir mehr als simple Newsletter über Naturkosmetik oder Supermarktflyer einfach nicht zu. Aber so bin ich nun mal: Ich kommuniziere entweder mit allem, was ich habe, lege all meine Gedanken und Gefühle offen, während ich mit Händen und Füßen und jedem einzelnen Gesichtsmuskel spreche. Oder gar nicht. Es fällt mir schwer, in Zwischenmenschlichem das Gleichgewicht zu halten. Ich bin entweder einhundert Prozent ich selbst. Oder gar nicht. Bisher habe ich auf der Arbeit keinen eleganten Weg gefunden, wie die wahre Klara aufzutreten. Selbst nach drei Monaten ist hier alles noch sehr neu für mich. In den letzten zwei Jahren bin ich von einer guten, aber ruhigen Schülerin zu einer todtraurigen, überforderten Studentin geworden – und jetzt befinde ich mich plötzlich in diesem stressigen Umfeld, in dem jeder erfahrener und besser ist als ich. In dem Leistung alles und Kreativität nicht länger ein Hobby, sondern deine Legitimationsgrundlage ist. Wann immer ich mich öffnen möchte, holt mich die Angst ein, es könnte genauso werden wie bei meinen letzten ersten Schritten in einer neuen Umgebung. In der WG, die ich während meines Literaturstudiums bewohnt habe, bot meine übersprudelnde, echte Persönlichkeit nur Anlass für Spott. Was ist, wenn ich den Lemons ebenfalls zu naiv, zu laut, zu kindisch – schlichtweg zu viel bin?
Frustriert und enttäuscht von mir selbst lasse ich den Kopf in den Nacken fallen und starre Franka aus dieser Position heraus an. Von hier unten kann ich ihre langen Wimpern sehen, die wie jeden Tag von einem makellosen, weit geschwungenen Lidstrich eingerahmt werden. Wer einmal eines von Frankas Designs gesehen hat, wundert sich nicht mehr über ihre Make-up-Skills. Diese Frau hat ein Händchen für Formen und Farben. Und noch dazu ein Mundwerk, mit dem sie jeden das Fürchten lehrt. Ich liebe es, mit ihr zusammenzuarbeiten, und wünsche mir insgeheim, es würde sich eine Gelegenheit ergeben, unsere Beziehung auch privat zu vertiefen. Nur … Freundschaften zu schließen, ist so verdammt schwer geworden, seit ich abends wach liege und in Gedanken jedes Wort durchgehe, das ich am Tag gesagt habe. Als ich an die Uni gegangen bin, hieß es, ich würde dort endlich Menschen kennenlernen, die genauso sind wie ich. Stattdessen habe ich mein gesamtes Selbstbewusstsein verloren und noch dazu den einzigen Menschen, bei dem ich je wirklich das Gefühl hatte, er würde mich verstehen.
»Das kann ja was werden. Du hast nichts. Ich hab nichts«, resümiert Franka. »Und unser Goldjunge kommt bestimmt wieder mit einem Konzept um die Ecke, für das er sich am liebsten selbst einen Cannes-Löwen verleihen würde.«
Ich muss kichern. Franka verachtet Felix für seine Workaholic-Einstellung. Ständig macht sie sich darüber lustig, dass er kein größeres Ziel zu haben scheint, als so jung wie möglich zum Creative Director befördert zu werden und einen Marketing-Award nach dem anderen zu gewinnen. Die Wortgefechte zwischen den beiden sind allerdings einer meiner liebsten Running Gags in meinem noch so frischen Berufsalltag.
Ich schiebe meinen Stuhl nach hinten, um Franka in den großen Konferenzraum hinter der Gemeinschaftsküche zu folgen, da erinnert mich ein entferntes Knistern daran, dass mein Hörbuch noch läuft. Ich stülpe mir die großen Noise-Cancelling-Headphones über und klicke mich durch die Tracks zurück an die Stelle, an der ich zuvor unterbrochen wurde. Streng genommen habe ich die Geschichte schon so oft abgespielt, dass ich längst nicht mehr auf ein lückenloses Hörerlebnis angewiesen bin, aber ich höre sie trotzdem am liebsten chronologisch. Nicht wegen des mitreißenden Plots. Sondern wegen seiner Stimme. Noel Carter ist der einzige Mann, der es vermag, mir mit einem bloßen Luftholen eine Gänsehaut zu bescheren. Ich möchte baden in seiner Stimme. Sie wie ein Parfüm auftragen. Ich möchte sie in einer Kette um meinen Hals tragen, wie die böse Meerhexe Ursula es mit der von Arielle getan hat.
Wenn es mir schlecht geht, schalte ich automatisch eines der beiden bisher erschienenen Hörbücher der Schwingen-Saga ein. Egal wie sehr mich Versagensängste und Verantwortung niederdrücken – sobald Noel Carter mir mit seiner Stimme auf die beste Weise das Ohr zerkratzt, erfüllt mich dieses aufregende Prickeln. Er spricht so düster und sinnlich und …
»Was hast du gehört?« Der kleine Pfeil, der auf Frankas Zeigefinger tätowiert ist, blitzt vor meiner Nase auf. Ertappt drücke ich auf Stopp – genau in dem Moment, in dem Noel erneut »Kehle durchschneiden« sagt, es aber wie ein lustvolles Angebot klingen lässt. Gooott, dieser Typ könnte selbst eine Einkaufsliste anziehend vorlesen. Sogar wenn darauf Blasenpflaster, Haftcreme und Erwachsenenwindeln stehen würden.
»Ach … nur so ein Hörbuch.« Ich winke ab und rappele mich endlich aus dem Stuhl hoch. Nur so ein Hörbuch. Genau. Als wäre die Schwingen-Saga von Tammy S. Steinfield nicht meine absolute Lieblings-Romantasy-Reihe. Und als würde ich mir nicht regelmäßig ausmalen, wie ihr Sprecher mir nachts Sequenzen aus den pikanten Liebesszenen ins Ohr flüstert.
»Oh, cool! Welches?« Sie wahrt Abstand – Franka wahrt immer ihren Abstand –, aber beugt sich erkennbar vor. Bevor ich sie aufhalten oder den Player des Audiobooks wegklicken kann, hat sie den Titel bereits entdeckt.
»Gassen aus Sturm und Rauch«, liest sie vor. »Ist es gut?«
Kurz bin ich um Worte verlegen. Meine Leidenschaft für die Buchreihe war schon entfacht, bevor ich zum ersten Mal die Vertonung gehört habe. Aber erst durch das Hörbuch bin ich zu einem Hardcore-Fan geworden. Ich kann einem moralisch fragwürdigen Protagonisten mit Flügeln, der wortwörtlich töten würde, um eine aufmüpfige Fremde für sich zu gewinnen, wohl einfach nicht widerstehen.
»Ist ganz okay.« Ich bremse mich bewusst, um Franka nicht mit meiner Begeisterung zu überrollen. Ich musste auf die harte Tour lernen, dass nichts schmerzhafter ist, als für etwas verhöhnt zu werden, wofür man brennt.
»Spricht das ein Mann oder eine Frau?« Sie beugt sich ein kleines Stückchen weiter vor, sodass ich ihr herbes, androgynes Parfüm riechen und die tätowierte Rose auf ihrem Brustbein sehen kann. »Ich hasse es, mich von Männern vollquatschen zu lassen.«
Ich muss auflachen. Typisch Franka. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat sie erklärt, dass kein geistig gesunder Mensch wirklich glauben könne, man suche sich seine Sexualität selbst aus, weil sonst schlicht und ergreifend niemand freiwillig auf Kerle stehen würde.
»Leider ist es ein Mann«, antworte ich.
»Fuck.«
»Aber glaub mir, von dieser Stimme willst du dich vollquatschen lassen!« Die Schwärmerei kommt durch, bevor meine gängigen Filter sie heraussieben können.
»Jetzt bin ich aber gespannt«, sagt sie und zieht einen Hocker neben meinen Bürostuhl.
Mist! Genau deshalb vermeide ich es, mit Menschen über meine Leidenschaft für romantische Fantasyschmöker zu reden. Was, wenn die Person das Buch aufgrund meiner Empfehlung zur Hand nimmt? Und was, wenn sie bei Kapitel einundvierzig ankommt und ihre Ohren genauso glühen wie meine, als ich zum ersten Mal gelesen habe, was Prinz Arran und das Drachenmädchen im Turmzimmer des Eispalastes miteinander anstellen?
Obwohl ich bezweifle, dass Franka von irgendetwas rote Ohren bekommt. Sie geht sehr offen mit Sexualität und Intimität um – und das nicht nur in Gesprächen. Auch die Kunst- und Designprojekte, denen sie sich in ihrer Freizeit widmet, behandeln allesamt Themen wie den weiblichen Körper, Lust, und gesellschaftliche Missstände. Wann immer sie einen neuen Beitrag auf ihrem Blog teilt, verbreiten sich die Bilder explosionsartig im Internet. Schon in meiner ersten Woche bei Sweet Lemon habe ich erfahren, dass sie die Frau ist, deren Foto vor einigen Jahren so viral gegangen ist, dass sogar das Fernsehen und Zeitungen darüber berichtet haben. Für Franka war das nichts. »Da schmiert man sich einmal mit Periodenblut das Wort Nutte auf den Allerwertesten und schon rasten alle aus«, hat sie mir mit einem Schulterzucken erzählt.
»Wir müssen jetzt wirklich zum Meeting«, erinnere ich sie, um von mir abzulenken.
»Felix nimmt uns eh auseinander, da ist es egal, wenn wir ein paar Minuten zu spät sind.« Sie nickt ungeduldig in Richtung meines Laptops, woraufhin ich mich argwöhnisch in unserem Büro umsehe. Eigentlich sitzen wir hier zu fünft. Aber unsere Kollegen Jesse und Ricardo sind heute bei einem Fotoshooting und Dagi macht seit gut einer halben Stunde Zigarettenpause. Wahrscheinlich hat Knut sie in die Finger bekommen. Der findet fast täglich ein anderes Opfer, dem er detailgenau den Inhalt seines wöchentlichen Herr-der-Ringe-Podcasts wiedergeben kann.
»Na gut!« Nervös entkopple ich meine Bluetooth-Kopfhörer, reguliere die Lautstärke des Laptops und drücke dann auf Play.
»Mir scheint, Eure Spionagefähigkeiten weisen erhebliche Mängel auf.« Mit einem Ruck machte Arrran auf dem Absatz kehrt. Er wollte die Rothaarige bloßstellen. Das dunkle Kopfsteinpflaster vor ihm allerdings war … menschenleer.
»Oh.« Franka formt ihre vollen rosa Lippen zu einem verzückten Kreis.
»Dasselbe könnte man wohl von Euren Verkleidungskünsten behaupten, werter Prinz.« Mit einem Geräusch, kaum lauter als das eines Nagetiers, das von einem Baum springt, landete sie hinter ihm. Er rechnete damit, dass sie jeden Augenblick eine Klinge ziehen würde. Doch statt kalten Stahls traf ihr Atem seinen Hals und ein Schauer kroch über seine Wirbelsäule.
Franka lässt einen Pfiff los und fächelt sich mit dem Kragen ihres bauchfreien Shirts Luft zu. »Wer ist dieser Typ? Und wie kann ich mit ihm allein sein?«
»Prinz Arran?«, frage ich mit sich überschlagender Stimme.
»Nein, der …« Franka bricht ab.
Ein Ruf donnert zu uns herüber, der die unverputzten Backsteinwände der Agenturräumlichkeiten zum Beben bringt. »McDOWALL! FISCHER!«
Franka verdreht die Augen und macht sich gelassen in Richtung des Flurs auf, an dessen Ende der Konferenzraum und unser Meeting warten. Ich hingegen eile vollkommen kopflos mit meinem noch aufgeklappten Computer hinter ihr her.
»Entspann dich«, zischt sie mir über die Schulter hinweg zu. »Du weißt doch: Solange er dich noch beim Nachnamen nennt, meint er es nicht wirklich ernst.« Tatsächlich hat Felix mich zum letzten Mal in meinem Vorstellungsgespräch Klara genannt. Seitdem begnügt er sich mit Fischer oder einem mehr oder weniger unfreundlich gebrüllten Hey! Franka dreht sich so schnell zu mir um, dass ihr kastanienrotes Haar in der Bewegung weht. »Jetzt sag schon: Wer ist dieser krasse Hörbuchsprecher? Wenn er noch einmal das Wort Klinge gesagt hätte, hätten meine Eizellen sich selbst befruchtet.«
»Er heißt Noel Carter.« Keine Ahnung, ob ich seinen Namen je laut ausgesprochen habe. Aber jetzt, wo ich es tue, fühlen sich meine Wangen ganz heiß an.
»Noel Carter?« Franka runzelt die Stirn und betont den Namen wie etwas, das offensichtlich eine Lüge ist.
»Ich glaube, es ist ein geschlossenes Pseudonym. Man kann nichts zu ihm finden. Glaub mir, ich hab’s versucht.« Mir entfährt ein Kichern.
»Uuuh, Klara, ich entdecke ganz neue Seiten an dir.« Franka zwinkert. »Aber ist vielleicht auch besser so«, sagt sie, während sie durch die offen stehende Glastür des Konferenzraums tritt. »Was, wenn die Google-Bildersuche ergeben hätte, dass er Ende fünfzig ist und aussieht wie jemand, der auf Facebook die Gender Pay Gap leugnet?«
Dann würde ich Kapitel einundvierzig nie wieder auf dieselbe Weise hören können …
Ich gehe hinter ihr in den Konfi, lächle entschuldigend und suche in den Gesichtern der Anwesenden nach einer Reaktion auf unser verspätetes Eintreffen. Drei Personen sitzen an der langen Tafel, an deren Kopfende ein Flatscreen für Präsentationen in die Wand eingelassen ist: Felix, der die kreative Leitung bei diesem Pitch übernehmen wird, hat an der schmalen Seite Platz genommen. Seine tätowierten Unterarme sind fest vor der Brust verschränkt und er starrt stur geradeaus. Neben ihm sitzt Amelie, die wie immer ihren Laptop vor sich aufgeschlagen hat und gedankenverloren an der Kappe eines Kugelschreibers kaut. Ihr Lippenstift hat bereits einen dunkelroten Ring auf dem Plastik hinterlassen. Zu ihrer Rechten entdecke ich Bastian, den Chef der Technikabteilung. Er ist in den frühen Vierzigern, hat ein freundliches Gesicht mit einer kleinen runden Brille und Geheimratsecken, die kurz vor der Fusion mit einer kahlen Stelle am Hinterkopf stehen.
»Beehrt ihr uns auch mal, ja?« Felix sieht nun doch zu uns auf und tastet dabei, wie so oft, mit den Fingerspitzen nach den Barthaaren über seiner Oberlippe. Obwohl ich durch das Leben mit meinen Eltern wirklich gut im Lesen von Körpersprache bin, habe ich bisher nicht herausfinden können, was diese Marotte auslöst. Stress vielleicht. Ein Workaholic wie Felix steht schließlich ständig unter Strom. »Dann kann es ja losgehen. Amelie hat schon einiges recherchiert. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar gute Ideen dabei.«
Oh Gott. Dieses Meeting wird eine Vollkatastrophe.
2
Familien
kiste
NOEL
Ich ertappe mich mit einer Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger. Spüre, wie meine rechte Hand wie ferngesteuert zu meiner Hosentasche fährt und den Stoff abklopft. Nach Streichhölzern sucht. Ich habe nie Feuerzeuge. Ich mag sie nicht. Vor allem nicht die mit den kleinen Rädchen, an denen man sich ausnahmslos jedes Mal verbrennt. Dann eben Streichhölzer. Sie sind irgendwie klassischer. Und es ist leichter, sich einzureden, dass man kein Raucher ist, wenn man die Kippen aus der von einem Freund geklauten Packung mit einem kurzen Holzstift entzündet, den man aus einem Heftchen mit Tankstellenwerbung herausbrechen muss. Nur … die rote Schachtel, die auf der Balkonbalustrade vor mir liegt, habe ich bei niemandem mitgehen lassen. Sie wurde mir nicht beim Feiern hingehalten oder in der Pause zwischen zwei Theaterakten. Niemand hat mich gefragt, ob ich auch eine will, und ich musste niemandem vorlügen, dass ich eigentlich aufgehört habe. Niemandem – außer mir selbst, als ich sie gekauft habe.
In den letzten drei Monaten habe ich mindestens einmal die Woche mit dem Rauchen aufgehört – die einzige Konstante in meinem Leben. Wäre doch alles so leicht wie Vorsätze brechen …
Ich wende die Zigarette, bis sie zwischen Mittel- und Ringfinger klemmt und ich den Tabak sehen kann. Puste hinein. Verfolge die kleinen Partikel, die daraus hervorstieben, auf ihrem Segelflug gen Boden. Ich weiß, wie scheiße rauchen ist, und hasse so ziemlich alles daran. Nicht nur, dass es mein Risiko zu erblinden erhöht, wie mir die Verpackung unmissverständlich entgegenbrüllt. Hauptsächlich hasse ich, woran es mich erinnert.
An meinen ersten Tag an der Schauspielschule, an dem mich jemand auf eine Kippe und einen Kaffee eingeladen hat. Als ich erklärt habe, dass ich beides nicht mag, meinte er: »Das wird sich ändern, glaub mir.« Und das tat es. Es erinnert mich an Theresa, die mir nie gesagt hat, wie sehr sie das Rauchen hasst, und trotzdem erwartet hat, dass ich es ihr zuliebe einstelle. Es erinnert mich an meinen liebsten Acting Coach Erik, der mir in jeder Zigarettenpause versicherte, aus mir würde mal ein ganz Großer werden. Und an den Typen, mit dem Theresa mich betrogen hat, weil ich in meinen schlechten Phasen nur noch mich selbst sehe und nicht mehr sie. Der Kerl hat Kette geraucht. Ironisch irgendwie.
Statt nach dem Streichholzheftchen greife ich nach der eingedellten Schachtel auf der Balkonbrüstung und schiebe die Kippe zwischen die verbleibenden sieben Stück.
Die Erinnerungen sind schaler als Zigarettenatem nach einer durchfeierten Nacht. Ich kann das nicht mehr. Bin nicht mehr der Typ, der vor gut fünf Jahren dachte, er müsste bloß mit den anderen unter Rauchwolken über die Branche reden und schon würde alles irgendwie klappen. Ich bin einfach nur der Typ, der es nicht einmal hinkriegt, mit dem Rauchen aufzuhören.
Fuck …
Dreimal klopfe ich die Zigarettenschachtel auf der Balkoneinfassung auf, dann schiebe ich sie in meine hintere Hosentasche. Heute Abend, schwöre ich mir, werden all diese acht Kippen noch da sein.
Auf dem Weg hinein und die Treppe hinunter checke ich routinemäßig meine Mails, überfliege Absender und Betreffzeilen und suche nach etwas, von dem ich selbst nicht so genau weiß, was es ist. Statt meine Passion zu finden, habe ich in den letzten eineinhalb Jahren seit dem Abschluss meiner Schauspielausbildung nur gelernt, was ich nicht will. Und auch wenn das Ausschlussverfahren eine legitime Methode sein kann, um den eigenen Pfad zu finden – glücklich macht es nicht. Es ist nervig und hart und ätzend. Es kratzt an dem, von dem Schauspieler gleichzeitig zu viel und zu wenig haben: unserem Ego.
Meine Liste an Dingen, auf die ich keinen Bock habe, wächst mit jeder Casting-Ausschreibung. Ich mache weder Daily Soaps noch Kindertheater, Werbesports oder – Gott bewahre – Reality TV. Am besten gar kein TV. Ich will Menschen vor mir haben. Keine Kameras.
Über Nacht sind Dutzende Alerts von Casting-Plattformen reingekommen. Und obwohl ich meine Suchkriterien dort sorgfältig gefiltert habe, reiht sich in meinem Postfach ein No-Go an das andere. Puppenspieler für eine Inszenierung von Der Kleine Prinz, Komparsen (18-30) für Party-Szene im Frankfurter Tatort, Scripted Reality Format, Rolle: asiatische Haushaltshilfe (40-50). Ich verharre am Treppenabsatz und schnaube so heftig, dass meine Unterlippe vibriert. Man mag mir vorwerfen, zu hohe Ansprüche zu haben. Zu verbissen darauf zu sein, auf der Bühne zu stehen, zu einem festen Theaterensemble zu gehören. Aber wie soll man auch nicht verbissen werden, wenn die Alternative darin besteht, als mitteleuropäischer Mann von vierundzwanzig Jahren und eins vierundachtzig Körpergröße eine Rolle als asiatische Putzfrau angeboten zu bekommen?
Entnervt stecke ich das Smartphone weg und rolle die Ärmel meines Hemdes bis zu den Ellbogen hoch. Die Wendeltreppe in meinem Elternhaus, die die obere Etage mit dem Wohnbereich im Erdgeschoss verbindet, fußt direkt neben der Küchenzeile. Es riecht nach Kaffee, aufgebackenen Brötchen und dem beißenden Geruch von Fuck, ich musste mit Mitte zwanzig zurück zu meinen Eltern ziehen.
Mit einem Seufzen umrunde ich den Kühlschrank und trete vor den Vollautomaten, der den Duft von starken, dunkel gerösteten Bohnen verströmt. Meine Mutter sitzt an dem ovalen Esstisch in der Mitte, die rosa Lesebrille mit extravagant geformten Bügeln tief auf der Nase. Sie hat die Stirn krausgezogen, um über den Rand der halbmondförmigen Gläser auf ihr Handy spähen zu können. Quälend langsam fährt sie mit dem Zeigefinger über den Glasscreen, die Mundwinkel ausdruckslos nach unten gerichtet.
»Morgen«, sage ich träge.
»Ah, Noel … hab dich gar nicht bemerkt, ich war ganz …« Sie schwenkt erklärend das Handy in meine Richtung. »Guten Morgen.«
Wahllos nehme ich eine Tasse aus dem Oberschrank und stelle sie unter den Ausguss. Ihr Aufdruck fällt mir erst auf, als ich den Knopf für einen schwarzen Kaffee drücke. Ein dicker Zeichentrickhase mit Schnurrbart und Malerpinsel, der durch abertausende Spülgänge blass und konturlos geworden ist. Für den besten Papa von Jan steht daneben.
Bei den Zimmermanns gibt es nur einen Sohn, der seinem Vater ein solches Geschenk machen würde. Nur einen Sohn, für den er der beste Papa ist. Nur einen Sohn, der Malermeister der vierten Generation wird.
Der Kaffee beginnt, aus den Düsen zu schießen, und hüllt die Tasse für einen Moment in Dampf, was sich seltsam erleichternd anfühlt. Und mich davon abhält, die Zigarette doch in Erwägung zu ziehen.
»Na, was steht heute an?« Die Stimme meiner Mutter holt mich zurück in die Realität. Zurück in die offene Küche, die – wie jeder Raum meines Elternhauses – in einer komplizierten Wischtechnik in Lachsfarben gestrichen ist, wie sie vor zwanzig Jahren angesagt war. Ich nehme die Tasse und lehne mich mit überkreuzten Beinen an die Arbeitsplatte. Die Kante stößt genau gegen das Kippenpäckchen und ich spüre ihren Inhalt zerbröseln.
»Mal sehen.« Ich denke an die Casting-Alerts in meinem Posteingang, will mich dazu bringen, sie wenigstens in Erwägung zu ziehen. Aber ich kann es einfach nicht.
»Du …« Meine Mutter legt das Handy weg und schiebt die Brille von ihrer Nase. Sie stürzt herunter, ehe sie wie ein Bungee Jumper von einer glitzernden Kette abgefedert wird. Mama rückt ihren Stuhl ein wenig vom Tisch weg und faltet diplomatisch die Hände vor ihrem üppigen Oberkörper. Eine Geste, tausend Erinnerungen. Bei der großen Wir halten ein Schauspielstudium in Hamburg für keine gute Idee-Intervention vor viereinhalb Jahren saß sie genau so da. Immerhin fehlt heute mein Vater, der mit vor Zorn zitterndem Schnurrbart neben ihr auf und ab gegangen ist.
»Der Papa und ich haben uns was überlegt.«
Ich weiß, was der Papa und ich aus dem Mund meiner Mutter bedeutet. Es heißt: Mein Mann hat entschieden und ich muss seine Meinung teilen, weil wir seit dreißig Jahren verheiratet sind. Intuitiv wende ich den Blick ab. Starre die Tasse in meiner Hand an. Für den besten Papa von Jan.
»Aber nimm dir doch erst mal ein Brötchen und setz dich.« Symbolhaft klopft sie auf den Stuhl neben sich. Ich habe zuletzt in der sechsten Klasse gefrühstückt. Frühstück schnürt mir den Magen zu. Macht, dass ich mir tonnenschwer vorkomme. Selbst an guten Tagen. Meine Mutter scheint sich in diesem Moment daran zu erinnern, denn sie ergänzt: »Komm, ausnahmsweise, du siehst ja aus wie ein Skelett.«
Vielleicht wäre alles ein wenig leichter, wenn die Unterschiede zwischen mir und dem Rest meiner Familie nicht so absolut offensichtlich wären. Wenn ich – wie Jan – ein Ebenbild unseres Vaters wäre. Breites Gesicht, helles Haar und ein Körper, der es gewohnt ist, tagein, tagaus Malerequipment durch die Gegend zu schleppen. Der sich von Fleischkäsebrötchen aus der Heißen Theke ernährt und Kaffee mit Sahne trinkt. Stattdessen ähnele ich – wie man sich erzählt – dem Vater meiner Mutter. Groß, hager, mit Wangenknochen, die Casting-Direktoren beeindrucken und die Familie besorgt hochkalorische Gerichte kochen lassen.
»Ihr habt euch was überlegt«, wiederhole ich, um sie an das eigentliche Gesprächsthema zu erinnern.
»Ja, richtig.« Sie pocht mit der eckig zulaufenden Spitze ihrer Acrylnägel einen Rhythmus auf die Tischplatte, wirkt nervös. »Dein Vater, also wir, wir dachten, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn du …« Ausziehst? Dein Leben in den Griff kriegst? Endlich mehr wirst wie Jan? »… in der Firma ein bisschen mithilfst?«
Ich ziehe die Brauen hoch. Das ist neu. Seit ich in der achten Klasse die Theater-AG dem Werkunterricht vorgezogen habe, sind die Fronten bezüglich meiner Talente geklärt. Mein Vater war nie Fan meiner Entscheidung, Schauspieler zu werden. Aber bis sie fiel, war er davon nicht mehr überrascht. Am verblüffendsten ist für ihn bis heute, dass man gleichzeitig ein Mann, Theaterdarsteller und heterosexuell sein kann. Jahrelang dachte er, ich würde ihm verheimlichen, eigentlich schwul zu sein. Weil sein Weltbild so eng ist, dass Männer, die auf der Bühne stehen und dort Emotionen zeigen, keine richtigen Kerle sein können. Die verputzen nämlich Fassaden. Oder verkleben Raufasertapete. Die sie dann dem Weib zuliebe lachsrosa streichen. Das ist das höchste der Gefühle.
»Und was soll ich da eurer Meinung nach tun?«
Mama knibbelt an den Perlen ihrer Brillenkette. »Wir finden schon was. Du kannst mir im Büro helfen. Ich könnte dir ein bisschen Buchhaltung beibringen. Rechnungen schreiben.« Genau. Der einzige Weg, meinen Vater davon zu überzeugen, dass ich meine beiden X-Chromosome nicht verschwende, ist der, bei ihm als Sekretärin einzusteigen.
Ich setze kommentarlos meinen Kaffee an, stürze einen zu großen Schluck herunter und verbrenne mir Zunge und Rachen.
»Jetzt setz dich doch erst mal hi…« Sie bricht mitten im Wort ab. Oder vielmehr: Es wird ihr abgeschnitten. Von dem Geräusch der Haustür. Das Blut rauscht plötzlich durch meine Adern, verteilt auf seinem Weg Unruhe und Alarmbereitschaft in jedem Winkel meines Körpers.
Mein Vater und Bruder kommen zur Tür herein. Sie treten sich geschäftsmäßig die Arbeitsschuhe ab und ächzen und schnaufen dabei, um zu beweisen, dass sie schon schwer zu tun hatten an diesem Morgen. Dass sie aktiv waren, körperliche Arbeit verrichtet haben, bereits seit zwei Stunden wach und damit alles in allem mehr wert sind als ich. Dass ich selbst bis zwei Uhr nachts auf war und eine Stimmübung nach der anderen durchprobiert habe, zählt für sie nicht. Richtige Arbeit ist für meinen Vater, was zwischen sieben Uhr morgens und achtzehn Uhr abends unter dem Schirm einer Handwerksinnung verrichtet wird. Vorzugsweise in einer Kluft von Engelbert Strauß.
»Ah!« Mein Vater erblickt uns und klopft sich die farbbesprenkelten Finger an der Hose ab. »Habt ihr schon …« Der Satz endet mit seinem Zeigefinger, der vielsagend zwischen meiner Mutter und mir hin- und herwedelt.
»Wir wollten gerade.« Mamas Kette wirbelt nun geradezu um ihre manikürten Finger.
»Oh. Gut.« Erneutes Handabklopfen.
Das wird hier ja echt ’ne verdammt große Nummer …
Mein Bruder Jan kommt an mir vorbei in die Küche und entblößt dabei eine am großen Zeh aufgeriebene Tennissocke. »Morsche«, grüßt er und erinnert mich damit an die ersten Einheiten meines Sprechtrainings, in denen ich realisiert habe, dass der hessische Dialekt meiner Familie doch nicht so spurlos an mir vorbeigegangen ist wie gedacht. Mittlerweile ist die lokale Färbung vollständig aus meiner Stimme verschwunden – es sei denn, die Rolle verlangt es. Dialekte, Imitationen und verstellte Stimmen sind meine Spezialitäten. Was mir besonders dann gelegen kommen würde, wenn ich meinen Nebenjob als professioneller Sprecher ausweiten wollen würde. Was ich allerdings nicht tue. Ich will kein Sprecher sein. Wie gesagt: Ich bin unflexibel.
»Morgen«, knurre ich leise. Der Tonfall erinnert mich an meine Performance als Prinz Arran. Dieser blasierte Fantasy-Prinz aus dieser vermaledeiten Fantasy-Saga, die ich eingesprochen habe, als die Geldnot mal wieder größer war als mein Stolz.
Mein Vater lässt sich murrend am Tisch nieder und informiert Mama knapp über einen anstehenden Auftrag. Sie nickt, faltet die Hände wie zum Gebet und sieht zu mir. Ich werde mich ganz sicher nicht an diesen Tisch setzen, aber ich sollte wenigstens ein paar metaphorische Schritte auf sie zugehen. Also umrunde ich die Frühstückstheke, während Jan sich neben Papa fallen lässt und sich dabei ein paar Brösel aus dem Mundwinkel streicht. Wie konnten wir so grundlegend verschieden geraten? Wie kann es Jan erfüllen, mit dem Eintritt in seine Lehre einen Deal für die Ewigkeit eingegangen zu sein? Maler und Lackierer auf Lebenszeit. Erst Lehrling, dann Geselle, Meistertitel und schließlich Chef bei Malerei Zimmermann bis zu dem Tag, an dem er seine Rente antritt.
Ich verurteile ihn nicht dafür. Im Gegenteil. Ich wünschte, ich könnte meinen Job als etwas betrachten, das nicht automatisch mit mir verwoben ist. Eine verpatzte Wohnzimmerwand ist für meinen Vater und Bruder nur das: eine verpatzte Wohnzimmerwand. Für mich ist ein verhauenes Casting wie eine Ohrfeige. Und du kannst nur eine bestimme Anzahl an Ohrfeigen ertragen, bis du dir sicher bist, sie vielleicht einfach verdient zu haben.
Mein Vater sieht Mama erwartungsvoll an und nickt in meine Richtung.
»Ach ja.« Sie räuspert sich. »Der Papa und ich … wir … wie schon gesagt, wir haben überlegt, ob du in der Firma ein bisschen mit aushelfen magst. Ist doch langweilig, so den ganzen …«
»Moment«, donnert mein Vater los. »Genug mit dem verweichlichten Geschwätz. Ich hab in meinem ganzen Leben nicht einen Tag ohne Job rumgesessen. Ich bin aus der Schule in die Ausbildung. Ich hatte keine Auszeit. Weißt du, was meine Auszeit war? Die Bundeswehr!« Papa bohrt seinen fleischigen Zeigefinger regelrecht durch die Tischplatte hindurch.
»Wenn du die Wehrpflicht wieder einführen willst, musst du ein Wörtchen mit dem Verteidgungsminis…«
»Ja, hohooo, der kluge Junge mit dem Abitur«, unterbricht er mich. Rote Farbe schießt durch die fein verästelten Äderchen auf den Wangen meines Vaters – ein klares Zeichen dafür, dass die regelmäßigen Brötchen von der Heißen Theke doch keine so gute Idee sind. »Weißt du, was man mit klugen Worten nicht tun kann, Noel? Seine Rechnungen bezahlen! Weißt du, was Rechnungen bezahlt? Harte Arbeit. Und weißt du auch, wessen harte Arbeit momentan deine Rechnungen bezahlt?« Sein Zeigefinger schnellt zu mir.
Ich gebe mein Bestes, ihm in die Augen zu sehen. Ihm standzuhalten. Nicht einzuknicken. Aber meine Pupillen fokussieren nur die Kuppe dieses Zeigefingers, der schon so oft anklagend auf mich gerichtet war.
»Meine!«
Ich spüre, wie sich die Last der Worte um meinen Hals legt und zudrückt wie ein Händepaar. Instinktiv krallen sich meine Finger um die Tasse.
Für den besten Papa von Jan.
»Ich hab mir das lange genug angeguckt!«
Meine Mutter streichelt über den Arm ihres Mannes, als wollte sie auf diese Weise seine Lautstärke drosseln, die sich von Satz zu Satz gesteigert hat. Doch mein Vater will gar nichts drosseln. Er entzieht sich ihr so ruckartig, dass er Jan neben sich fast eine Ohrfeige mit dem Handrücken verpasst.
»Na, ist doch wahr! Der Spaß in Hamburg hat mich abertausende Euro gekostet. Und wofür? Dafür, dass er mir hier jetzt weiter auf der Tasche liegt!«
»Ingo!«
Ich will schlucken, aber meine zugeschnürte Kehle macht es mir unmöglich. Es ist auch so schon hart genug. Es ist hart, jeden Tag damit konfrontiert zu werden, dass ich es nicht hinkriege. Dass ich keinen Job finde. Dass sich die Jahre der Ausbildung, die durchgelernten Nächte, die unzähligen Male, die ich mich selbst im Spiegel angeschrien habe, verloren anfühlen. Die Zeit in Hamburg, die Beziehung mit Theresa, das Leben, von dem ich dachte, ich würde es mir aufbauen … Dass es rückblickend nichts wert gewesen sein soll. Und dass ich nicht einmal mit irgendwem darüber reden kann, weil es hier keiner versteht. Sie alle kennen nur die Geschichten, in denen der Tellerwäscher zum Millionär wurde. Keiner erzählt die Geschichte vom Tellerwäscher, der ein fucking Tellerwäscher geblieben ist.
»Ingo, Ingo«, äfft mein Vater sie nach. »Mir reicht’s. So läuft das hier nicht mehr.« Sein Kopf schnellt in meine Richtung. »Du bist vierundzwanzig, mein Freund. Als ich vierundzwanzig war, hab ich begonnen, dieses Haus zu bauen. Wenn dein Bruder vierundzwanzig ist, hat er seinen Meistertitel.« Jan schaut teilnahmslos auf die fingerdicke Schicht Nutella auf seiner Brötchenhälfte. »In meiner Familie sitzen Männer nicht tatenlos rum. Wir schaffen was.«
»Mein Job ist anders als deiner.« Ich habe mich schon so oft erklärt, dass mir die Rechtfertigung locker von der Zunge rollen sollte. Aber das, was normalerweise meine Spezialität ist – Aussagen so überzeugend rüberzubringen, dass das Publikum sie mir abkauft –, hat bei meinem Vater noch nie gefruchtet. Nicht bei diesem Thema. Nicht, wenn er mit seinen Anschuldigungen all meine Selbstzweifel nährt.
»Ja, offensichtlich ist er das. Ich mache meinen nämlich.« Er stützt seine Hände auf der Tischplatte ab und wuchtet sich hoch. »In drei Monaten, Noel … In drei Monaten hast du was gefunden. Irgendwas, was dir regelmäßigen Lohn einbringt. Sonst kannst du bei mir einsteigen und zusehen, dass du mir die Kosten deiner ach so wichtigen Schauspielausbildung zurückzahlst. Und bis dahin …« Mit einem unangenehmen Schmatzen löst er seine feuchte Hand von der Glasfläche, hebt sie und richtet den Finger ein letztes Mal auf mich. »… zahlst du hier Miete. Ich will fünfhundert im Monat. Ist mir egal, wie du die aufbringst. Irgendeine Bühne findest du schon, auf der du im Tütü rumspringen kannst.«
3
Ideen
geysir
KLARA
Amelie ist aufgestanden, um die Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren. Als Projektmanagerin bildet sie die Brücke zwischen dem Kunden und der Agentur, schreibt Briefings, koordiniert Feedback und kümmert sich darüber hinaus um Rechnungen und andere Accounting-Aufgaben. Da Amelie der strukturierteste Mensch ist, der je einen Schritt über die Schwelle von Sweet Lemon gemacht hat, übernimmt sie bei ihren Projekten auch einen Großteil der Recherchearbeit. Jeder im Team liebt es, mit Amelie zusammenzuarbeiten, weil sie so gut organisiert ist. Während es im Tagesgeschäft gang und gäbe ist, mal eine Deadline zu überziehen, Rückmeldung von Kunden misszuverstehen und dadurch unnötig Zeit zu verschwenden, sitzt bei Amelie jeder Arbeitsschritt. Und das, obwohl sie nur eine Teilzeitstelle hat und jeden Tag um drei – ohne auch nur eine Sekunde Toleranz – in den Feierabend verschwindet.
Sie koppelt ihr kleines MacBook mit dem Fernseher und wählt auf dem Desktop eine Datei aus. »Gut. Dann wollen wir mal.« Amelie tritt einen Schritt zur Seite und deutet auf den Bildschirm. Auf sattem goldgelbem Grund – der Markenfarbe von Sweet Lemon – steht Wüthrich Chocolatier. Darunter, in den breiten Lettern unserer Hausschrift inklusive zitronenförmigem O, ein Platzhalter für den Konzeptnamen. Ein Konzept, das es noch nicht gibt. Ein Konzept, zu dem mir noch nicht einmal der Ansatz eines Ansatzes eingefallen ist. Meine schwitzigen Hände ballen sich unter der Tischplatte zu Fäusten.
»Ich habe bereits mit der Präsentation begonnen. So oder so ähnlich können wir den strategischen Teil in drei Wochen bei Wüthrich zeigen.« Amelie klickt mit einer Fernbedienung durch die ersten Slides der Präsentation und fasst dabei mithilfe von Statistiken, Tortendiagrammen und Tabellen die Kernprobleme der Marke zusammen. »Ihre Marktanteile schrumpfen und Menschen unter dreißig verbinden mit dem Namen Wüthrich bestenfalls aus der Mode gekommene Schnapspralinen.« Amelie liest das vernichtende Urteil ihrer Kundenanalyse laut und in professionellem Tonfall vor. »Die Oma-Pralinen wird Wüthrich aber nicht so schnell los – die brauchen sie, weil sie dafür bei den Älteren bekannt sind. Wir kümmern uns um die Positionierung der neuen Schokoladentafeln, die sie ab Herbst rausbringen wollen. In eurem Briefing gibt es eine Liste der Sorten.«
»Gut.« Felix klingt kühl wie immer. Aber etwas an der Art, wie er sich nach vorn beugt – die Unterarme, die fast vollständig von schwarzer Tinte überzogen sind, auf dem Tisch aufgestützt –, verrät mir, dass er angefixt ist. »Dass es in ihrer Firma scheiße läuft, wissen sie. Deshalb wollen sie die Marke verjüngen. Aber es ist sicher nicht verkehrt, sie am Anfang der Pitch-Präsentation noch einmal daran zu erinnern, wie nötig sie unsere Hilfe haben.« Felix’ eisblaue Augen wandern von dem Screen zuerst zu Franka und schließlich zu mir. »Dann zeigt mal, was ihr habt.«
Mein Puls legt noch einen Zahn zu. Nein, nein, nein, nein. Ich brauche mehr Zeit, vielleicht kommt mir ja doch eine Idee … Selbst wenn ich keine Aufzeichnungen habe, wenn ich nur etwas aus dem Ärmel …
»Einen Moment«, wirft Amelie ein.
Ein verdächtig lautes Aufatmen neben mir lässt mich vermuten, dass auch Franka gerade ein Stein vom Herzen gefallen ist. Oder dass Amelies Professionalität sie nervt. Die beiden haben grundlegend unterschiedliche Ansichten von kreativem Arbeiten. Für Franka ist Design eine Kunstform, die als solche weder Zeit- noch Budgetvorgaben kennt. Für Amelie und ihre Kunden stehen diese Dinge jedoch an erster Stelle. »Ich habe noch eine kleine Zielgruppenanalyse gefunden.« Mit einem Klicken öffnet Amelie den nächsten Präsentations-Slide. »Aus strategischer Sicht wäre es klug, wenn wir das Kreativkonzept auf einen dieser Pfeiler stützen, dann können wie sie mit Zahlen überzeugen.« Mit einem Laserpointer umkreist sie eine große Fünfundfünfzig. »Aus dieser Studie geht unter anderem hervor, dass fünfundfünfzig Prozent der Vierzehn- bis Dreißigjährigen positiv auf Werbung reagieren, in der ein ihnen bekannter Promi auftritt.«
»Mhm …« Felix runzelt die Stirn. »Könnte schwierig werden, einen Promi aufzutreiben, der bei der gesamten Zielgruppe beliebt genug ist. Die Altersspanne ist sehr groß.«
Bastian kratzt sich an seiner kahlen Stelle und meldet sich erstmals zu Wort. »Ich kenne keinen von den halb nackten Typen, auf die meine Vierzehnjährige zu Hause abfährt.«
»Fischer?«, dröhnt Felix. »Wie alt bist du noch mal?«
»Äh, einundzwanzig«, sage ich stockend.
»Also gar nicht so weit weg von vierzehn.« Aua. »Irgendeine Meinung dazu?«
»Ähm …« Ich schlucke. Wie erkläre ich ihm jetzt, dass ich wahrscheinlich auch keines der halb nackten Idole von Bastians Tochter kenne? Meine gesamte Freizeit dreht sich um Häkel-Tutorials, Taylor Swift, Memes über das Leben als CODA und einen gewissen fiktiven Prinzen mit schwarzen Schwingen. Vorsichtshalber wiederhole ich das »Ähm«, klinge dadurch aber nicht gerade inspiriert.
»Halb nackte Typen sind ein gutes Stichwort«, wirft Amelie ein und verhindert damit gerade noch, dass ich mich vollends zum stotternden Honk machen kann. »Der Spruch Sex sells ist zwar von vorgestern, aber laut meiner Recherche trifft er immer noch zu.« Sie richtet den Laserpointer nun auf das Foto eines knutschenden Paares, neben dem in großen Ziffern 71% steht.
»Lasst uns bitte keine sexistische Kackscheiße machen.« Franka hebt abwehrend beide Hände und macht ein Gesicht, als hätte sie einen Schluck Milch aus einem Tetrapak genommen, der seit drei Wochen offen auf der Heizung steht. »Das Letzte, was die Menschheit braucht, ist eine weitere Kampagne mit nackten Frauen, die irgendetwas bewerben, wofür Nacktheit nicht erforderlich ist.« Sie wirft Felix einen anklagenden Blick zu, als plane dieser bereits den nächsten Wüthrich-Spot mit einem Porno-Star. Ich rechne damit, dass zwischen den beiden nun wieder eine ihrer bekannten Diskussionen losbricht. Doch plötzlich schwillt in mir ein innerer Drang an, der es mir unmöglich macht, der Szene zu folgen.
Etwas in meinem Gehirn hat sich unwiderruflich verknotet. Es ist, als wäre einem meiner Gedanken unterwegs eingefallen, dass er vergessen hat, den Stecker des Bügeleisens aus der Steckdose zu ziehen. Wie vom Donner gerührt hält er inne, kehrt um und rennt dabei aus Versehen in einen anderen hinein. Frankas Kommentar über sexistische Kackscheiße und meine Erinnerung an Noel Carter crashen ineinander, stürzen und verheddern sich. Und als sie sich dann wieder aufrappeln, ist da plötzlich etwas Neues. Etwas, das zuvor nicht da war. Nicht einmal ansatzweise. Neue Materie. Eine neue Idee.
Pure Euphorie fließt durch mich hindurch. Ein unaufhaltsamer Strom aus Aufregung, Kreativität und Stolz. Unbeschreiblich, nicht greifbar und doch … da.
»Ich glaub, mir ist gerade etwas eingefallen.« Und dann sprudelt meine Idee auch schon auf eine Weise aus mir heraus, die ich in Meetings, Prüfungssituationen und ähnlichen einschüchternden Momenten nie zulasse: Ich gebe mich voll und ganz meiner Körpersprache hin. Rede mit weit ausgestreckten Armen und großen Handgesten, wirbele meine Finger durch die Luft und lasse sie nach Begriffen tasten, mit denen ich das, was sich in meinem Kopf zu formen begonnen hat, umschreiben kann. Ich rede und rede und rede. Mit jedem »Und dann könnten wir noch …«, das mir atemlos über die Lippen kommt, fallen meine Hemmungen. Mit jedem Satz, den ich laut ausspreche, wird die Idee umfangreicher, größer, verästelt wie eine alte Eiche.
»Klara.« Da ist er, mein Vorname. Aus Felix’ Mund. Er dringt so scharf durch den Konferenzraum, dass ich mitten im Satz verstumme. »Hol erst mal kurz Luft – und du auch«, ermahnt er Franka gleich darauf, als die dem Anschein nach zu einer Verteidigungsrede ansetzen will.
Felix lehnt sich noch weiter nach vorn. »Du denkst also an eine Art Online-Plattform. Und in jeder Tafel der neuen, hipperen Wüthrich-Schokolade ist ein Code, mit dem ich dort was freischalten kann.«
»Genau!« Ich schnappe nach Luft. »Und zwar …« Ich schlucke, bevor ich das Wort wiederhole, das mir eben, als ich im Flow war, noch mühelos von der Zunge gesprungen ist. »… verführerische Kurzgeschichten. Vertont von professionellen Sprechern, die … ähm … unterschiedliche … Geschmäcker bedienen.« Vier fragende Augenpaare treffen mich. »Man sagt doch immer, dass niemand Schokolade widerstehen kann. Wir könnten also … wortwörtlich die Schokolade zum Verführer machen.«
»Also so eine Art Schokoladenporno zum Hören?«, fragt Bastian mit einem Glucksen.
»Ich will nicht ketzerisch sein«, unterbricht Amelie und tippt sich mit der Fernbedienung gegen die Schläfen. »Aber ist das nicht auch – wie hast du es genannt, Franka? – sexistische Kackscheiße?«
Franka braust sofort auf. »Nicht alles, was hot ist, ist frauenfeindlich. Wir machen das geschmackvoll! Und sex positive.«
»Am Ende ist es nur eine Frage des Storytellings«, überlegt Felix und klopft zweimal mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte. »Wir brauchen einen guten Rahmen. Eine gute Headline.« Er schaut in meine Richtung.
»Wie wäre es, wenn wir … also, wir könnten doch … Wenn wir einen Slogan hätten, der so etwas besagt wie …« Ich komme mir vor wie die arme Sau in einem Katastrophenfilm, die unter Deck des sinkenden Schiffes gefangen ist und sich irgendwie über Wasser halten muss. »So verführerisch wie Wüthrich Chocolatier.« Oh nein. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht und abgegriffen und …
»So verführerisch wie Wüthrich Chocolatier …« Felix probiert den Slogan aus. Schiebt ihn mit der Zunge in seinem Mund hin und her.
»Im Briefing steht«, sagt Bastian und schüttelt das dreiseitige, an einer Ecke zusammengeheftete Dokument auf, »der Kunde will seine Online-Präsenz ausbauen. ’ne Plattform klingt clever.« Die Sache mit den sex-positiven Kurzgeschichten, die so verführerisch sein sollen wie Schokolade, scheint er völlig auszublenden. Der Mann will einfach nur eine Website bauen.
»Es könnte zu riskant für Wüthrich sein.« Amelie verschränkt die Arme, was ihre große Oberweite ein wenig zusammendrückt. »Der neue Geschäftsführer ist zwar jung, aber der konservative Senior sitzt noch immer im Vorstand …«
Felix bringt sie mit einem simplen Kopfschütteln zum Schweigen. Seine Stirn liegt in Falten, so angestrengt scheint er nachzudenken.
»Das Konzept ist der Shit!« Franka klopft mit der flachen Hand auf den Tisch, was einer ihrer breiten Silberringe mit einem dröhnenden Klonk! quittiert. »Wag dich, was dagegen zu sagen, nur weil …«
»Wie wär’s, wenn du mal kurz die Klappe hältst, McDowall. Manche von uns versuchen hier zu denken!« Felix’ dunkelblonde Augenbrauen ziehen sich eng zusammen und seine Fingerspitzen suchen erneut die Barthaare über seiner Oberlippe. Lippen, auf denen ich gerade ein weiteres Mal den Satz »So verführerisch wie Wüthrich Chocolatier« lesen kann.
Ich bin verleitet, ihm zu sagen, dass das natürlich kein spruchreifer Slogan war, sondern eine verzweifelte Eingebung. Aber ich bin zu eingeschüchtert von seiner Reaktion auf Franka und will erst recht keine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass ich außer dieser spontanen Gedankengrütze nichts vorbereitet habe.
»Der Slogan ist Schrott. Und der Name Wüthrich Chocolatier ist einfach nicht sexy genug.« Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Gleich wird er mir sagen, dass auch mein Einfall absoluter Unsinn ist und komplett an der Realität des Kunden vorbeigeht. »Das müssen wir ändern. Fischer, du fängst sofort an, einen gescheiten Slogan zu brainstormen. Dann schreib mir die erste Kurzgeschichte. Oder nein: Schreib am besten gleich zwei – ich will sehen, wie du dir das mit den unterschiedlichen Geschmäckern vorstellst. McDowall, Moodboards und erste Skizzen für die Online-Plattform. Amelie, schreibst du uns ein Protokoll von diesem Meeting?« Die Frage ist überflüssig, Amelie hat bereits begonnen, auf die Tastatur ihres Laptops einzuhauen. Felix stemmt sich hoch und streicht den Stoff seines T-Shirts glatt.
Was … ähm … wie bitte?
»Moment …«, stammele ich. »Heißt das … heißt das, ich … ich soll das jetzt machen?«
Felix dreht sich zu mir um. »Was dachtest du? Dass du mir mal eben so eine geniale Idee pitchen kannst und dann ohne Arbeit aus dem Meeting gehst?« Irgendwo in seinem strengen Gesicht erkenne ich einen Glanz, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist Felix Mattuschek – der Senior Texter mit dem Herzen aus Stein, der lobende Worte nur für seinen Hund übrig hat – gerade etwa stolz auf mich?
In meinen Wangen steigt Hitze auf. Beflügelt von diesem seltenen Gefühl der Bestätigung schwebe ich förmlich hinter meinen Kollegen in Richtung Flur.
»Ach ja«, Felix dreht sich noch einmal zu mir und Franka um, »ihr müsst übrigens nicht denken, ich hätte nicht gemerkt, dass ihr mit exakt null Ideen in dieses Meeting gekommen seid.« Er zieht seinen Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen hoch, dann klopft er gegen den Türrahmen und geht.
4
Trennungs
schmerz
NOEL
Ich gebe auf.
Für heute. Und für morgen wahrscheinlich auch.
Seit drei Monaten gebe ich täglich auf. Selbst davor schon, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin …
Sobald meine Eltern und Jan weg sind, fliehe ich auf den Balkon, lehne mich an die hellblau gestrichene Fassade und nehme den ersten Zug von meiner Zigarette. Ihren Qualm stoße ich aus wie einen Fluch.
So richtig fassen kann ich es noch immer nicht, dass ich wieder hier bin. An dem Ort, von dem ich vor viereinhalb Jahren unbedingt wegwollte.
Ich habe immer gern in Hamburg gewohnt. Mochte die Mentalität, die Rauheit, das kühlere Wetter. Und natürlich das neue Leben, das ich mir dort aufgebaut habe … aufgebaut hatte, bevor alles so grandios gescheitert ist. Bevor meine Karriere, meine Freunde, meine Beziehung einfach unter mir weggebrochen sind.
Meine Beziehung!
Ich merke erst, wie frustriert ich auf dieses Wort reagiere, als ich es sprichwörtlich zwischen meinen Zähnen zermalme. Meine Kiefermuskeln ziehen sich zusammen, werden hart, zerren an einer Verspannung in meinem Nackenbereich, die von genau dieser permanenten Verbissenheit herrührt.
Theresa. Mein erster und vorerst letzter Versuch, eine Beziehung zu führen …
Aus Hamburg wegzugehen, war aus vielerlei Gründen hart. Und dass Theresa der am wenigsten schlimme von ihnen war, ist wohl Aussage genug darüber, wie wir auseinandergegangen sind. Sich von jemandem zu trennen, mit dem man drei Jahre zusammen war, sollte sich doch wenigstens ein kleines bisschen wie ein Verlust anfühlen. Stattdessen war es für uns beide, als hätten wir einen Ballast abgeworfen.
Wir haben uns in meinem zweiten Jahr auf der Schauspielschule kennengelernt. Ich war energiegeladen und euphorisch und hatte ein Ego so groß wie die Elbphilharmonie. Kein Wunder, dass mir Flirten damals so erschreckend leichtgefallen ist. Flirten ist, wenn man mal ehrlich ist, auch nur Schauspielerei. Du spielst eine Version von dir, von der du glaubst, sie könnte anziehend wirken. Und darin war ich wirklich gut.
Durch meinen Lehrer Erik hatte ich Kontakte zu einem Schauspielkollektiv geknüpft, mit dem ich – je nach Engagement – einige Male im Monat auftrat. Theresa hatte mit Darstellenden Künsten nichts am Hut, war aber von einer Freundin in eine meiner Vorstellungen von George Bernard Shaws Pygmalion geschleppt worden. In einer an Ironie kaum zu überbietenden Wendung des Schicksals verliebte Theresa sich in meine Interpretation des Henry Higgins, die mir – zugegeben – damals gut zu Gesicht stand. Es erfüllte mich mit Selbstbewusstsein, auf der Bühne zu stehen. Das tut es immer noch. Nur damals war alles größer, gewaltiger, bedeutender. Weil es so neu war. Weil ich endlich ich war. Weil sich jede Darbietung wie ein Mittelfinger an meine Familie anfühlte. Jeder Schritt, den ich auf der Bühne tat, war ein Schritt weg von den Vorurteilen meines Vaters. Ein Gegenbeweis zu seinen Thesen und eine Legitimation für meinen eigenen Weg.
Theresa verliebte sich in diesen Noel. Den, der auf den Highs seiner ersten Erfolge schwebte. Der überzeugt war, das Richtige zu tun. Selbstbewusst und auch ein kleines bisschen selbstgerecht. Doch genau wie die Gefühle von Henry Higgins zu der von ihm erschaffenen Pseudo-Herzogin Eliza Doolittle starb auch Theresas Liebe zu mir, als ihr klar wurde, dass ich gar nicht wirklich dieser Noel war. Nicht, nachdem die Anfangseuphorie verklungen war und ich mich dem niederschmetternden Alltag eines arbeitslosen Schauspielers stellen musste. Nicht, seit unser Leben bloß noch aus unzähligen Diskussionen über unsere unterschiedlichen Tagesrhythmen, Streits wegen zu wenig gemeinsamer Zeit oder dem Gefälle in unseren Einkünften bestand.
Als Künstler hat man stets Phasen, in denen man sich für den Größten hält – und die braucht es, um jene zu überstehen, in denen man sich einfach nur wie ein Versager vorkommt. Aber dass die erste Person, die ich je geliebt habe, mich nur mit übersteigertem Ego wollte und sich kaum mehr im selben Raum mit mir aufhalten konnte, als es bergab ging, hat mich fertiggemacht. Ich wäre damit klargekommen, dass ich mich selbst nicht mehr leiden konnte. Doch dass Theresa diese Version von mir ebenfalls abstoßend fand, war der ultimative Treibstoff für unsere Abwärtsspirale. Wir wollten beide die Trennung, lange bevor sie mich betrogen und mir die Schuld daran gegeben hat.
Als sie mir gebeichtet hat, dass sie mit dem Barista unseres Stammcafés im Bett war – einem aufstrebenden DJ, der noch genug von jenem Charisma versprühte, das sie früher auch an mir bewundert hatte –, kam mir alles wie eine logische Konsequenz vor. Natürlich hatte sie sich jemand anderen gesucht. Natürlich wollte sie lieber Zeit mit jemandem verbringen, der an sich glaubte. Ich war zu sauer auf mich selbst, um sauer auf sie zu sein.
Drei oder vier Wochen konnte ich bei Freunden unterkommen, während ich dabei zusehen durfte, wie meine Performance bei Castings immer schlechter und das Geld auf meinem Konto immer weniger wurde. Doch bei Freunden zu leben und sich von ihnen durchfüttern zu lassen, ist absolut erniedrigend. Ich wusste, dass ich ein Zuhause brauchte. Weil irgendetwas beständig sein muss, wenn du schon keinen beständigen Job hast. Und wenn dieser unbeständige Job ausgerechnet aus Schauspielerei besteht, willst du nicht auch noch die komplette restliche Zeit eine Rolle spielen müssen. Ich wollte meinen Freunden nicht vorgaukeln, dass es mir gut geht. Dass ich optimistisch bleibe. Ich wollte in meinem Selbstmitleid baden.
Also bin ich an den einzigen Ort zurückgekehrt, an dem mich sowieso schon jeder für einen Versager hält …
Ein kurzer zwickender Schmerz an meinem Ringfinger reißt mich aus meinen Gedanken und katapultiert mich zurück auf den Balkon meiner Eltern. Ein langer Stängel abgebrannten Tabaks zittert an der Spitze meiner Zigarette. Sie ist bis zum Filter runtergebrannt und hat mir die Haut versengt. Fuck …
Ich werfe sie in meinen Rest Kaffee und schüttele die Hand aus.
Bevor mich die niedrigen Temperaturen des frühen Märzvormittags zurück ins Haus zwingen – dieses verfluchte Haus mit der verfluchten Wischtechnik an den Wänden –, kontrolliere ich ein letztes Mal meine Mails. Keine Ahnung, woher ich manchmal noch die Hoffnung nehme, dass meine Agentin mich schon bald mit einem passenden Jobangebot aus der Misere holen wird. Momentan sollte ich wohl eher fürchten, dass sie mich aus ihrer Kartei wirft, wenn ich weiterhin alles ablehne, was nicht in mein Profil passt, und sie an mir keine Provision mehr verdient. Wenn es nach Frederike ginge, hätte ich jede Woche einen Gastauftritt bei Notruf Hafenkante oder würde mich bei GZSZ langsam vom Statisten zum Regular hocharbeiten. Doch wie soll ich bitte je wieder auf einer ernst zu nehmenden Theaterbühne stehen, wenn ich als Jo Gerners verloren geglaubter Großneffe in die Geschichte eingehe? Schlimm genug, dass sie mich damals zu der Sache mit dem Hörbuch überredet hat …
Ich ziehe die Brauen zusammen. Mein Handy verzeichnet keine E-Mail von Frederike, dafür aber eine WhatsApp von meiner ältesten Freundin Manoush. Und schon deren Vorschau auf dem Sperrbildschirm lässt eine ungute Vorahnung in mir aufkeimen. Was zur …?
Manoush (09:17) Äääh, wann genau wolltest du mir DAS erzählen?
Mit unruhigem Daumen öffne ich die Nachricht und gehe dabei durch die Balkontür nach drinnen. Dort setze ich mich an den Platz, auf dem eben noch mein Vater gesessen und mir sämtliche Lebensentscheidungen vorgehalten hat.
Manoush (09:17) NOEL!!!!! Wann bitte hast du angefangen, versaute Fantasy-Pornos aufzunehmen???
Der angehängte Screenshot bestätigt meine Befürchtungen. Mein Puls beginnt zu rasen, als ich die Spotify-Oberfläche erkenne. Das anthrazitfarbene Cover. Die silberne, rauchumnebelte Schrift, über der mein Name steht. Beziehungsweise der Name, der mein Kompromiss war, um mich auf diese Sache einzulassen. Aber immer noch mein fucking Vorname.
Noel Carter liest Gassen aus Sturm und Rauch – Teil 1 der Schwingen-Saga von Tammy S. Steinfield.
Zwei Jahre ist es her, dass der erste Teil auf Deutsch erschienen und als Hörbuch veröffentlicht wurde. Im letzten Jahr habe ich den zweiten Band eingesprochen und diesen Juni steht der dritte und letzte an. Er wird zeitgleich mit dem englischen Original herauskommen und ich habe mich gefühlt wie ein FBI-Agent, weil ich beim Unterzeichnen meines Sprechervertrags in einem Extrapassus garantieren musste, niemandem ein Wort über den Inhalt des Finales zu verraten. Der offizielle Release der Geschichte ist im August – ich will gar nicht wissen, was so manches Fangirl zu geben bereit wäre, um schon zwei Monate früher zu erfahren, wie es mit dem aufgeblasenen Prinz Arran und seinem sogenannten Drachenmädchen ausgeht.
Ich lese Manoushs Nachricht ein zweites Mal. Versaute Fantasy-Pornos … Selten habe ich eine passendere Umschreibung für die Schwingen-Saga gelesen. Zwar wird in dem Epos auch das Geheimnis um die Abstammung des Prinzen diskutiert – die ledernen Flügel auf seinem Rücken passen so gar nicht zur genetischen Linie seines Vaters – und eifrig um die Zukunft des Reiches gekämpft, dessen Herrscher Arran einmal werden soll. Aber die Liebesgeschichte und die detailreich beschriebenen Sexszenen sind das, worauf die Fans der Reihe wirklich abfahren.
Und damit genau das nicht zu meinem unfreiwilligen Erbe wird, steht dort nicht Noel Zimmermann liest … Noel Carter ist ein Pseudonym, das für immer eines bleiben sollte. Ich war mir sicher, dass es so schnell niemand in meinem Bekanntenkreis aufdecken würde. Meine Lesestimme ist nicht zu einhundert Prozent deckungsgleich mit meiner Sprechstimme. Vor allem nicht, wenn ich den eingebildeten Fantasy-Prinzen mit der Kratzstimme gebe. Selbst als die Reihe in Deutschland zu einem Mega-Bestseller wurde, konnte ich mich immer in Sicherheit wiegen. In meinen Hamburger Kreisen interessierte sich niemand für geflügelte Thronfolger, die es mit rothaarigen Auftragskillerinnen treiben. Bei meinen älteren Freunden und meiner Familie habe ich schlichtweg darauf gesetzt, dass es ihnen niemals zu Ohren kommen würde. Oder dass sie mich und meine Stimme sowieso längst vergessen haben.
Aber Manoush hat mich nicht vergessen. Nie. Nicht in der elften Klasse, als sie mit Jonathan zusammengekommen ist und ich mir sicher war, dass das der Todesstoß für unsere platonische Freundschaft sein würde. Nicht als ich nach Hamburg gezogen bin. Nicht als ich Theresa kennengelernt habe, die sich die größte Mühe gegeben hat, unsere Freundschaft auf die Probe zu stellen. Unser Kontakt ist seltener geworden, aber nie weniger intensiv. Wenn Leute sagen, dass jede Freundschaft, die länger als sieben Jahre hält, die Chance auf ewigen Bestand hat – dann glaube ich ihnen, weil es Manoush in meinem Leben gibt.
Manoush (09:20) Freundchen. Ich kann sehen, dass du online bist. Erzähl mir, wieso ich 33% des Buches hören musste, um zu checken, dass da mein bester Freund spricht?
Manoush (09:21) Du bist es doch, oder?
Manoush (09:21) Also … der Sprecher. Nicht mein bester Freund. Das bist du.
Manoush (09:22) Du bist doch noch mein bester Freund?? Ich meine, wenn ich das nicht über dich wusste, was hast du mir noch verschwiegen?
Manoush (09:23) Hast du auf der Reeperbahn gestrippt, um die hungrigen Mäuler deiner unehelichen Kinder zu stopfen?
Ich muss grinsen. Trotz allem. Weil Manoush wie ein Beweis dafür ist, dass hier zwar alles noch immer wie früher ist, aber dass früher nicht alles schlecht war. Sie war schon immer gut. Überdreht und nervig und ohne jegliches Taktgefühl. Aber von Grund auf gut.
Ich werde von einer Welle der Sehnsucht nach ihr und Jonathan überrollt. Zum ersten Mal seit Monaten steht mir der Sinn nach Gesellschaft, also beginne ich zu tippen.
Noel (09:24) Darf ich zum Frühstück zu euch kommen, wenn wir schon darüber reden müssen?
Manoush (09:26)