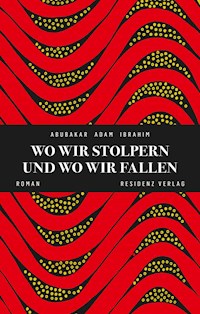Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman aus Nigeria verbindet übernatürliche und reale Welt in einer Geschichte über Liebe, Tod und Erlösung. Der Maler Yarima Lalo wird plötzlich von lebhaften, schmerzhaften Erinnerungen an gewaltsame Tode in seinen eigenen früheren Leben verfolgt. Doch woher kommen diese verstörenden Bilder? Zweimal, so scheint es, wurde er bereits um der Liebe willen ermordet, aber seine Geliebte Aziza will er nicht verlieren. Mit ihr gemeinsam begibt sich Lalo auf eine Reise quer durch Nigeria und dessen gewaltvolle Geschichte, um die Spuren seiner früheren Leben zu suchen. Er findet Rat bei einem geheimnisvollen Kind, das sich als Verbindung zur Geisterwelt herausstellt – zu den "Glühwürmchen", den Geistern der im Krieg getöteten Kinder. Und Lalo versteht, was vielleicht auch für sein Land gilt: Wer Rache sucht, wird stets nur den Tod finden, doch wer vergibt, wird leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abubakar Adam Ibrahim
Zeit der Glühwürmchen
Roman
Aus dem Englischen übersetzt
von Susann Urban
Die Originalausgabe dieses Werks erschien 2023 unter dem Titel
»When we were fireflies« im Verlag Masobe, Lagos, Nigeria.
© AbubakarAdam Ibrahim 2023
© 2025 Residenz Verlag GmbH
Mühlstraße 7, 5023 Salzburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Thomas Kussin/buero 8
Lektorat: Jessica Beer
ISBN Print 978 3 7017 1800 9
ISBN eBook 978 3 7017 4742 9
Für die Junikäfer
und
für all jene, die selbst angesichts des überwältigenden Hasses lieben,
dort, wo die Flammen der Feindseligkeit züngeln, am Leben, das sich nach Liebe sehnt.
1 Rot
Rot ist die erste Farbe des Frühlings. Es ist die wahre Farbe der Wiedergeburt, des Anfangs.
Ally Condie
Künstler trifft Zug
Als Yarima Lalo an einem heißen Junitag zum ersten Mal einen Zug in die Idu Station von Abuja einzuckeln sah, fiel ihm auch zum ersten Mal ein, dass er vor vielen Jahren in einer alten Eisenbahn mit abgenutzten, seegrasgrünen Sitzen ermordet worden war.
In dem Moment, als er in der Ferne den Signalpfiff der Lokomotive und das Rattern der Räder hörte, wusste er mit absoluter Sicherheit, dass ihm in einem anderen Leben, an das er bis zu diesem Augenblick keine Erinnerung gehabt hatte, ein wütender, untersetzter Mann mit einem Knüppel den Kopf eingeschlagen hatte. Erinnerungen an dieses Ereignis – der metallische Geschmack des eigenen Bluts im Mund, der feine, rote Tropfenregen auf den Sitzpolstern des Zugs – rollten so bedrohlich brüllend und mit überwältigender Gewissheit auf ihn zu wie der Dämon aus chinesischer Produktion, der soeben herankeuchte. Die Wucht der Erinnerung zog ihn dicht an die Bahnsteigkante, bis ein Angestellter der Eisenbahn an seinem Hemd zerrte, ihn anfunkelte und fragte, ob er verrückt sei oder bloß die neuen Schienen mit seinem Blut verdrecken wolle.
»Kai! Wer, glaubst du, muss die Sauerei dann wegputzen?« Der dicke Schnurrbart des Mannes sträubte sich aggressiv und seine buschigen Augenbrauen zogen sich finster zusammen. »Seit dreißig Jahren fährt zum ersten Mal in diesem Land ein Zug und schon will irgendein soko ihn besudeln.« Er spuckte auf die Gleise und wandte sich ab, genau in dem Moment, als der Luftzug des einfahrenden Zugs Lalo streifte, dem immer noch das Erinnerungskonfetti durch den Kopf wirbelte.
Vor diesem Freitag hatte Lalo, soweit er sich entsinnen konnte, noch nie einen fahrenden Zug gesehen. Entschlossen, dieses Manko zu beheben, war er zum Bahnhof gegangen, hatte in der Mitte der Halle gestanden und den immer noch berauschenden Geruch frischer Farbe eingeatmet. Er durchquerte die Halle, sein Spiegelbild auf den Fliesen wurde von den LED-Lampen an der hohen Decke verzerrt. Lalo wollte unbedingt die traurige Erinnerung an die verfallenden Eisenbahnwagen vertreiben, die er vor Jahren im Bahnhof von Jos gesehen hatte. Damals hatte er, ein Rekrut, der noch grün hinter den Ohren war, den Bahnhof erkundet und stand plötzlich vor grauen Güterwaggons, die vor dreißig Jahren hereingeschlittert waren und nun verrotteten. Räder, die der Rost mit den Schienen hatte verschmelzen lassen, klaffende Öffnungen, in denen Türen und Fensterscheiben fehlten, elektrische Apparaturen, die an Kabeln und Drähten baumelten und im schwachen Luftzug gespenstisch gegen die Schalttafeln schlugen. Jedem Fitzelchen des abblätternden Lacks, das wie die Schuppen einer abgestreiften Schlangenhaut von der Harmattanbrise davongetragen wurde, war ein kleiner Teil Geschichte eingeschrieben.
Dieses Bild war in den Schatten seiner Erinnerung geglitten, tauchte jedoch von Zeit zu Zeit auf. Das letzte Mal zwei Tage vor seinem Geburtstag; er stellte in einer Ecke seines kleinen, chaotischen Ateliers in der Kolda Street die Staffelei auf, setzte, wie so oft bei der Arbeit, Kopfhörer auf und kleckste dieses graue, ihn verfolgende Bild auf die Leinwand, während er unaufhörlich rhythmisch den Kopf zur Musik bewegte. Er rieb gerade mit den Fingern einen grauen Himmel über die Güterwaggons, da klingelten die Silberglöckchen an der Tür und sein Sammler Ben Bangos kam herein, ein Mann, nicht größer als ein ausgewachsener Orang-Utan mit einem Afro wie ein umgedrehtes Adlernest. Ihm folgte sein Fahrer, dessen Schmerbauch und wallender Kaftan den falschen Eindruck erweckten, er wäre der Kunde, zumal Bangos Jeansshorts und ein schlichtes weißes T-Shirt trug.
Lalo stellte die beiden verpackten Gemälde, die Bangos abholen wollte, vor diesen hin und der Mann verschwand bis auf Kopf und Schultern hinter den Bildern. Seit der Eröffnung des Ateliers vor drei Jahren war Bangos sein größter Sammler geworden und hatte über ein Dutzend Gemälde erworben, die häufig größer waren als er selbst. Gemälde, nicht unähnlich jenen, die sein Fahrer nun zum Auto trug, wobei er mit dem Bauch gegen die oberen Rahmenkanten stieß. Während Bangos Lalo die Hand schüttelte, schweifte sein Blick durch das Atelier.
»Die hast du alle bereits gesehen, Meister«, sagte Lalo.
»Das da nicht.« Bangos zeigte auf die Leinwand, an der Lalo bis eben gearbeitet hatte. Er bewegte seine 142 Zentimeter zur Staffelei und stellte sich breitbeinig hin, die Hände auf dem Rücken gefaltet, und betrachtete das Werk.
Lalo, der den Mann um gute dreißig Zentimeter überragte, erzählte von den aufgegebenen Waggons, die er in Jos gesehen hatte, und dem Vorhang aus Spinnweben, der vor einer der leeren Türöffnungen hing, die von zwei gigantischen Seidenspinnen bewacht wurde, den größten, die er je gesehen hatte.
»Das ist Vergangenheit«, sagte Bangos, wedelte Lalo mit der Hand vor dem Gesicht herum und seine mächtige Stimme erfüllte das Atelier. »Es gibt neue Züge. Du solltest am Freitag zum Bahnhof gehen und einen Blick drauf werfen. Wir machen gerade Probefahrten. Du musst kommen und dir ansehen, was mein Ausschuss erreicht hat.«
»Natürlich, Meister«, sagte Lalo.
Der Mann nickte, drehte sich um und ging.
Zwei Tage später stand Lalo auf dem Bahnsteig in Idu, einem Stadtteil von Abuja, von dem er noch nie gehört und den er nur mit Mühe gefunden hatte. Niemand, den er gefragt hatte, kannte den Weg zu diesem Viertel. Warum man beschlossen hatte, den Bahnhof in einer Gegend zu bauen, in die sich offenbar niemand verirrte, erschloss sich ihm nicht. Schließlich erreichte er sein Ziel und war erstaunt über die Menge, die sich dort versammelt hatte; alle warteten ganz begierig auf den Zug, auf die erste Bahnfahrt, von der sie Freunden und Geliebten erzählen würden.
Lalo mischte sich unter die Menschen und gemeinsam schlurften sie wie ein vielbeiniges Tier über die Fliesen der Bahnhofshalle, angetrieben und im Zaum gehalten von den Angestellten der Eisenbahn, bis sie den Bahnsteig erreichten und auf den ankommenden Zug warteten.
»Entschuldigung, wie viel Uhr ist es?«, fragte eine Frauenstimme.
Er drehte sich um und erblickte eine Frau mit glatter Haut und großen, erwartungsvollen Augen, die zu lächeln schienen.
Mit einem Blick auf seinen klobigen Zeitmesser sagte er: »Zwei Uhr vierzehn.«
Das Lächeln erreichte ihre Mundwinkel, sie nickte und wedelte mit ihrem Handy. »Akku leer«, sagte sie geradezu entschuldigend.
Lalo schenkte ihr ein flüchtiges Lächeln und betrachtete sie näher. Sie konnte Anfang dreißig oder Ende zwanzig sein, er war sich nicht sicher. Sie kam ihm bekannt vor und er überlegte, wo er sie gesehen haben könnte.
»Die Uhr ist aber groß«, sagte sie.
Sie hatte eine angenehme Ausstrahlung, warm und freundlich – die Art, wie sie sprach, wie ihr die Worte aus dem Mund flossen, wie ihre Augen erwartungsvoll aufleuchteten und wie sich ihr Körper bewegte, als würde sie zu einem inneren Rhythmus tanzen.
»Ich weiß, aber ich mag sie groß.«
»Ich auch«, platzte sie heraus. »Uhren, meine ich.«
»Und trotzdem tragen Sie keine.« Er lächelte spitzbübisch.
»Ich mag groß. Uhren an Männern, meine ich. Große Uhren an Männern.« Peinlich berührt schlug sie die Hand vors Gesicht.
»Ich hab’s kapiert.« Lalo lachte. Als es versiegte, suchte er nach den richtigen Worten, Worten, die nicht wie eine abgedroschene Anmache klangen, musste aber feststellen, dass sein Kopf einer Wüste ähnelte. Die junge Frau drückte auf den Einschaltknopf ihres Mobiltelefons, doch es blieb schwarz. Sie zuckte mit den Schultern. Ihr Blick wanderte zu seinen Sancho-Boots aus Pythonleder. »Ungewöhnliche Schuhe«, meinte sie, »solche habe ich noch nie gesehen.«
»Ich auch nicht. Bis meine Mutter mir diese hier gekauft hat«, erklärte er, »und jetzt trage ich die Stiefel für sie.« Er war dankbar, dass ihr Augenmerk auf seinen Stiefeln lag und sie den Schatten nicht sah, den die Trauer auf sein Gesicht warf.
»Das ist ja süß«, sagte sie, »ehrlich.«
Ihre Augen leuchteten geradezu kindlich begeistert, doch ihre Stimme war brüchig, als hätten seine Worte etwas in ihr angerührt, was seit langem zerbrochen war. Lalo räusperte sich und drehte sich erst wieder dem Gleis zu, nachdem die Frau einen iPod herausgeholt, ihre Kopfhörer eingestöpselt hatte und weggegangen war, die Treppe hoch und über die Brücke auf den gegenüberliegenden Bahnsteig. Da stand sie nun, allein, und wiegte sich leicht in den Schultern.
Sie grinste ihn über die Gleise hinweg an. Er grinste zurück. Unvermittelt fiel ihm ein, dass er sie etliche Male an seiner Galerie hatte vorbeigehen sehen. Einen Augenblick lang verglich er sie beide mit zwei Tieren, die sich links und rechts einer aus Holz und Eisen geflochtenen Cornrow befanden. Das könnte er irgendwann in einem Gemälde umsetzen. Ob er das ihr gegenüber erwähnen sollte, wenn sie herüberkam? Oder wenn er hinüberging?
In der Ferne tutete ein Signalhorn, gefolgt vom Rattern des herannahenden Zugs, und in die Menge kam Bewegung. Köpfe drehten sich hin und her, Gesichter strahlten, Hände wurden gerungen oder flogen in die Höhe. Lalo fühlte sich wie ein Kind und sein Herz flatterte, als der Zug um die Kurve bog. Doch gleich darauf legte sich eine Schwere auf ihn. Wie konnte es sein, dass er und die meisten Menschen hier zum ersten Mal in ihrem Leben einen fahrenden Zug sahen?
Als der Zug näherkam, wurde Lalo pechschwarz vor Augen und er sah einzig Dunkelheit. Dann blitzte, geweckt vom Brüllen der Lokomotive, vor seinem inneren Auge die erste Erinnerung auf. Dann noch eine. Und noch eine und ein Durcheinander von verwirrenden Bildern, bis ihn der wütende Schnauzbärtige zurückzerrte.
Bis zu diesem Augenblick hatte Lalo sich stets für einen kleinen Künstler mit einem chaotischen Atelier und bescheidenen Ambitionen gehalten, der Rennpferde malte, die ihm in seinen Träumen erschienen, und Seerosen, die in verzauberten Sümpfen wuchsen. Dann war der Zug eingefahren und hatte unbekannte Erinnerungen mit sich gebracht.
Laubsturm
Yarima Lalo stand am Fenster und sah auf die Straße hinaus, wo ein Wirbelwind eine Spirale aus toten Blättern über den Asphalt tanzen ließ. Der ersterbende Tornado klatschte eine Handvoll Blätter gegen die Fassade seines Ateliers und drückte das Blatt eines Eukalyptusbaums, der ganz in der Nähe stand, gegen die Scheibe. Er betrachtete die Aderung, als wäre das Blatt eine Kreatur, die aus den Tiefen seiner Phantasie oder seiner Albträume hervorgekrochen war, um ihn zu quälen. Längst tot, längst vertrocknet, blieb das Blatt hängen, ehe es sich wieder dem Sturm überließ, der es davontrug.
Kopfschüttelnd ging Lalo zur Glastür und schloss sie, doch der Staub hatte sich bereits hereingestohlen und den erdigen Geruch nach Regen und ein Gefühl der Vorahnung mitgebracht. Er spürte, noch etwas anderes würde kommen, etwas, was er nicht benennen konnte.
Draußen verursachte der Sturm Chaos – Ladenbesitzer schlossen ihre Türen, Markisen blähten sich, auf der anderen Straßenseite fiel an dem Stand mit den Prepaid-Handy-Karten der rote Sonnenschirm um und flog durch die Luft. Die Verkäuferin jagte ihm hinterher. Ein Radfahrer, der wie eine Schildkröte aussah, sauste vorbei, die Vorderseite seines grünen Kaftans presste sich an seine Brust, die luftgefüllte Rückseite wölbte sich wie eine Muschel. Eine Frau kämpfte um ihren Wickelrock, ein gelb-blaues Flattern, und um ihre Würde – offenbar hatte es der Sturm auf beides abgesehen. Ein Mann mit windgebauschter Dschellaba rannte seinem bestickten Käppchen nach. Lalo erinnerte sich, wie er als Kind in den Stürmen gespielt hatte, die der Regenzeit vorausgingen. Wie er mit einer Schüssel den Sandteufeln hinterherjagte und versuchte, die winzigen Dschinns, die in ihnen herumwirbelten, einzufangen. Wie sie die schrillen Stimmen ihrer Mütter ignorierten, die ihnen verboten, sich mit Dämonen und anderen boshaften übernatürlichen Wesen anzulegen. Sie trällerten Allah kawo ruwa da kifi soyayye, ihre Stimmen klar und euphorisch, sie sangen mit Begeisterung und im festen Glauben, dass tatsächlich gebratener Fisch vom Himmel fallen würde. Er erinnerte sich weder an die Gesichter noch an die Namen seiner damaligen Spielgefährten. Auch nicht daran, aus welchem seiner Leben diese Erinnerungen kamen. In den Wochen seit seiner Begegnung mit dem Zug hatten die Erinnerungen, die aus seinen früheren Leben auftauchten, und die Sorgen, die diese ihm bereiteten, Lalo einen bescheidenen Bart wachsen lassen und einen Schatten auf sein Herz geworfen.
Riesige Regentropfen trafen die Fensterscheiben, Lalo wich zurück und beobachtete, wie sie sich in Spritzer verwandelten, die kurz verweilten, ehe sie das Glas hinabrannen. Erstaunt stellte er fest, dass er zitterte. Aus einer Kommode beim Fenster holte er einen Staubwedel und machte sich über den Staub her, der seine Gemälde überzog, sich wie ein Schleier aus Spitze auf die Leinwand gelegt und in den Ecken der Rahmen festgesetzt hatte. Er arbeitete mit Feuereifer, drehte den Staubwedel, rollte den Griff zwischen Daumen und Zeigefinger und fuhr über die Rahmenecken. Als könnte er durch das Entfernen des Staubs das Bild einer Leiche, die im Regen in einem Maisfeld lag, aus seinem Kopf wischen. Je mehr er sich anstrengte, desto mächtiger wurde das Bild, bis er schließlich aufhörte und die Augen schloss. Seufzend fuhr er sich mit der Hand über den Bart und öffnete die Augen. Hungergefühl knabberte an ihm. Wäre er doch nur vor dem Regen mittagessen gegangen. Schwer zu sagen, wie lange er nun warten musste.
Beim Blick zur Uhr hoch machte sein Herz einen Satz. Zwei Uhr vierzehn. Um diese Zeit war er in den vergangenen Wochen aus den Albträumen aufgewacht, die seinen Schlaf mit spritzendem Blut und auferstandenen Erinnerungen an Liebe und Verlust färbten. Die gleiche Zeit, zu der sich im Wachzustand sein Herz, seitdem er den Zug gesehen hatte, jeden Tag dreimal zusammenzog.
Ein Rütteln an der Tür ließ ihn zusammenfahren. Hinter der Glasscheibe hob eine Frau die Hände zum Himmel und legte sie dann bittend aneinander. Ihre Schultern waren ungleichmäßig nass; die Bluse lag eng um ihre Brüste. Sie war jung. Ihre Gesichtszüge – große Augen, seidige Brauen, die sich an die feuchte Haut schmiegten, und eine fein geformte Nase, die ein Piercing zierte – empfand er als verführerisch. Und das Kleid, das korallenrot und schwarz an ihrer schlanken Figur klebte, erinnerte ihn an seine liebste Jahreszeit – mit blühenden Bäumen und blumenübersäten Straßen. Wenn sie sich, durchnässt, wie sie war, bloß nicht erkältete. Gleichzeitig zog sich sein Herz zusammen. Von einer Frau wie ihr hielt er sich besser fern. Lalo wandte sich wieder seinen Gemälden zu. Hoffentlich war sie weg, wenn er wieder zur Tür sehen würde. Aber sie stand immer noch da, die Handtasche über den Kopf haltend, mit fragendem Gesichtsausdruck, warum er nicht helfen wollte, geradezu schockiert, dass er sich weigerte. Als er im Begriff war, sich erneut dem Gemälde zuzuwenden, kam ihm die Erleuchtung, dass er diese Augen schon einmal gesehen hatte, groß, strahlend, von kindlichem Glanz erfüllt – an jenem Tag am Bahnhof. Das Nasenpiercing hatte ihn verwirrt, das hatte sie damals nicht getragen, zudem veränderte das Make-up ihr Aussehen. Blitzschnell wandte er sich um, doch sie war fort.
Pechschwarz explodierte Schuldgefühl in seinem Herzen, nahm es in Besitz wie ein arglos dargebotenes Land, zog seine Brust zusammen. Er eilte zur Tür, riss sie auf und sah erleichtert, dass sich die junge Frau in eine Nische des Nebengebäudes geflüchtet hatte, den Rücken gegen die Mauer gepresst. Ihr Kopf war vor dem Regen geschützt, aber ihre strassbesetzten, silbernen Schuhe wurden ganz nass. Wenn der Wind seine Richtung änderte, würde sie eine Dusche abbekommen. Er winkte sie herein.
»Danke.« Sie klang ein wenig irritiert, als sie an ihm, der ihr die Tür aufhielt, vorbeiging. »Tut mir leid. Ich dachte, ich schaffe es noch zum Supermarkt, bevor der Regen kommt. Dass es so bald schütten würde, damit hatte ich nicht gerechnet.«
Lächelnd und mit einer gewissen Zärtlichkeit erinnerte er sich, dass sich ihre Worte oft überstürzten. Er hatte gehofft, sie wiederzusehen, aber in den letzten Wochen waren seine Gedanken mit anderem beschäftigt gewesen. Auch bei ihrer Begegnung war er mit seinen Gedanken woanders gewesen. Er hielt den Blick auf ihre über die Fliesen klackenden Absätze gerichtet, mit denen sie beinahe so groß war wie er, größer, als er sie in Erinnerung hatte. Die junge Frau blieb am Fenster an der Stelle stehen, wo er wenige Minuten zuvor gestanden hatte, und sah auf die Straße hinaus. Sie ging auf und ab, als müsste sie nur die Hand ausstrecken, um den Regen wegzuwedeln.
»Der Supermarkt ist nicht weit weg. Aber vom Regen durchnässt werden, ist nicht gut. Wenn Sie es eilig haben, könnte ich wahrscheinlich einen Schirm auftreiben.« Am besten machte er sich gleich auf die Suche nach dem Schirm, den vor Wochen ein Kunde vergessen hatte und der sich irgendwo im Durcheinander der winzigen Abstellkammer befand, in der er seine Leinwandrollen, Rahmen, Pinsel und farbbeklecksten Lappen aufbewahrte.
»Ich habe gerade eine Erkältung hinter mir«, sagte sie und holte ihr Mobiltelefon aus der Handtasche. »Mein Kopf sollte nicht nass werden.«
»Bleiben Sie gern so lange wie nötig.« Sie hatte etwas Beunruhigendes an sich; sie war gleichzeitig anziehend und unheimlich, ja gefährlich. Im tiefsten Inneren wusste er jedoch, dass es seine Unsicherheit, seine Bedenken waren, die ihn in Alarmbereitschaft versetzten.
»Ich sollte besser gehen«, sagte sie und blickte von ihrem Handy auf. »Verzeihung, dass ich Sie behelligt habe.«
»Aber es regnet doch noch.« Er sah durch die Glasscheibe der Tür. Aus der grauen Wolkendecke fiel ein steter Schauer. Auf der Straße bildeten sich Rinnsale, die im Abflusskanal verschwanden. Ein wütender, weißer Lichtstrahl gabelte sich in Form eines gemarterten Y am düsteren Himmel. Lalo zählte leise vor sich hin und bei zehn grollte der Donner. »Ich habe Sie zuerst gar nicht erkannt«, sagte er. »Sie sind die Frau vom Bahnhof.«
Mit fragendem Blick sah sie ihn an.
»Der Tag der Probefahrt«, erläuterte er. »Sie haben mich nach der Uhrzeit gefragt.«
Sie runzelte kurz die Stirn und sah ihn an, betrachtete ihn vielleicht zum ersten Mal richtig. Ihr Blick wanderte zu seinen Schuhen und ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Ah, jetzt erinnere ich mich. Sie sind der Schlangenleder-Sancho-Typ!« Sie schlug die Hände vor den Mund. »So sind Sie mir in Erinnerung geblieben. Ich habe Sie tatsächlich nach der Uhrzeit gefragt.«
Er sah auf das Schlangenledermuster seiner Boots hinunter, deren Braun fast mit dem der Fliesen übereinstimmte. Nicht immer hatte er diese Stiefel geliebt. Er wollte nicht wie ein verirrter Cowboy aussehen, aber jetzt liebte er sie, liebte das Gefühl, das sie ihm gaben: geliebt zu werden. Liebte, wie er sich auf den Absätzen drehen konnte.
»Zwei Uhr vierzehn. Genau um diese Zeit haben Sie heute an meine Tür geklopft.«
»Es hat also jetzt keinen Sinn, Sie zu fragen, wie spät es ist.« Hell erklang ihr Lachen. »Wie seltsam aber auch! Was für ein Zufall!«
»Glauben Sie?« Er lächelte. Ihm gefiel, dass sie lachte. Ihm gefiel, wie sie lachte – ein schrilles, helles Lachen, rückhaltlos und ungekünstelt. Weder war es angenehm noch passte es zu ihrem reizvollen Aussehen, es war einfach nur laut und ungezügelt, wie wild davonflatternde Vögel. Wenn er doch auch nur so ungehemmt lachen könnte.
Dann lächelte auch sie. »Sie sehen anders aus, melancholischer. Und Sie haben sich einen Bart wachsen lassen.«
Lalo strich über seinen Bart, wie um sich zu vergewissern, dass er da war. Ihre Direktheit brachte ihn erneut zum Lächeln.
»Verzeihung, manchmal bin ich zu forsch«, sie legte den Kopf schief und fügte fast im selben Atemzug hinzu: »Und Sie tragen wieder diese Schuhe. Ein Geschenk Ihrer Mutter, haben Sie gesagt.«
»Daran erinnern Sie sich?«
»Natürlich. Ich fand es süß. Ein Mann, der solche Schuhe trägt, um das Andenken seiner Mutter zu feiern, muss einfach reizend sein. Das hat mir gefallen«, sie räusperte sich neckisch. »Solche Schuhe sieht man nicht jeden Tag. Ihre Mutter hat … einen besonderen Geschmack.«
Er hätte nie das Wort süß verwendet, um sich zu beschreiben. Er fand es lustig, dass sie es benutzte. Süß war ein Begriff, den er mit Stofftieren und Kleinkindern in Verbindung brachte. Nicht mit einem erwachsenen, bärtigen Mann, der fast sein ganzes Leben lang gearbeitet, Körper und Geist gestählt hatte, um jeglicher Art von Schwäche keine Angriffsfläche zu bieten. »Ich weiß. Anfangs mochte ich sie auch nicht. Selbst hätte ich sie mir nie ausgesucht. Aber jetzt bedeuten sie mir alles.«
»Ihre Mutter ist aber nicht …« Sie brachte die Worte nicht über die Lippen.
»Nein, nein«, sagte er. »Sie ist quicklebendig. Schläft lediglich. Sie ist krank und schläft manchmal wochenlang.«
Als sie merkte, dass er es ernst meinte, hörte sie auf zu lachen. »Oh, Verzeihung. Ich habe das für einen Scherz gehalten.«
»Schon gut. Die meisten verstehen es nicht. Sie fühlte sich gut, dann ging sie eines Abends ins Bett und wachte tagelang nicht mehr auf. Mittlerweile ist das schon mehrmals vorgekommen. Wenn sie schläft, fühlen sich diese Stiefel wie die einzige Verbindung zu ihr an, wie ein Teil von ihr, den ich überallhin mitnehmen kann.«
Ihre Augen verschleierten sich, sie blickte auf die Boots hinunter und legte die Hand aufs Herz. Als sie sprach, zitterte ihre Stimme leicht. »Das tut mir leid. Hoffentlich wird sie wieder gesund.«
Er murmelte ein Amen.
Unbeholfenes Schweigen breitete sich wie Unkraut zwischen ihnen aus. In der Zeit, die das Schweigen benötigte, um Wurzeln zu schlagen und durch die Oberfläche zu brechen, beschäftigte sie sich wieder mit ihrem Handy. Ihr Blick wich seinem aus und Lalo ahnte, dass die leise Traurigkeit, die in ihrer Stimme lag, auch in ihren Augen schimmerte.
»Wohnen Sie in der Nähe?«, fragte er. »Ich meine, ich hätte Sie einige Mal vorbeischlendern gesehen.«
»Eigentlich nicht. Ich habe einen Hennasalon die Straße runter, im Ademola Adetokunbo Crescent. Und ich gehe sehr gern zu Fuß. Aber diese blöde Stadt ist nicht für Fußgänger geeignet«, sagte sie.
»Wem sagen Sie das. Das fehlt mir hier. In Jos, wo ich eine Zeitlang gelebt habe, ist das anders. Wenn ich mich dort mit Freunden verabredet habe, bin ich immer zu Fuß gegangen«, sagte er. Mit zwei Fingern ahmte er auf der Glasscheibe eine Gehbewegung nach. »Manchmal überlege ich mir, die Gehwege in Abuja zu bemalen. Jeden Stein in einer anderen Farbe. Lange würde ich dazu nicht brauchen.«
»Was für eine verrückte Idee. Würde diesem Ort hier etwas Charakter verleihen und Sie wahrscheinlich ins Gefängnis bringen.«
Lalo lachte.
»Also«, sie sah sich im Atelier um, »nachdem ich keine Fremde mehr bin, wollen Sie mir nicht einen Stuhl anbieten?«
Er deutete auf den Tisch, der im hinteren Teil des Raums stand, ein Stück entfernt von den gerahmten Bildern an der Wand. Wie klein doch sein Atelier oder vielmehr wie vollgestellt es mittlerweile war. Die lebhaften Farben seiner Werke hoben sich von den weißen Wänden ab. Unter manchen Bildern lehnten einige seiner älteren Werke an der Wand. In den letzten Wochen, seit dem Zug, hatte er mehr gemalt als verkauft. Was in seiner neuen, aus einem Fiebernebel geborenen Phase entstand, war für ihn selbst. Diese Gemälde waren Verkörperungen, Erinnerungsfragmente, die er für sich selbst festgehalten hatte, und es war ihm egal, ob sie verkäuflich waren.
Sie ging durchs Atelier und setzte sich auf einen hohen Holzschemel am Fenster. Aus ihrer Handtasche holte sie ein Taschentuch, tupfte sich mit einer Ecke die Augen und wischte dann über ihre Schuhe. Anschließend beschäftigte sie sich wieder mit ihrem Mobiltelefon.
Lalo trat von der Fensterscheibe, vom Regen zurück in seinen Arbeitsbereich. Seine Hände zitterten, als er eine Leinwand auf die Staffelei stellen wollte. Nach dem zweiten, geglückten Versuch setzte er sich auf die Tischkante und betrachtete die leere Fläche, wollte die Inspiration herbeizwingen, damit Bilder aus dem Gewebe wuchsen und flüsternd zu ihm sprachen, doch er sah einzig einen Körper, der in einem Maisfeld lag und vom Regen durchnässt wurde.
Sein Mobiltelefon, das auf dem Tisch lag, klingelte, ein schriller, mehrstimmiger Ton, der die junge Frau aufrechter sitzen ließ. Lalo durchquerte das Atelier und hielt sich das Handy ans Ohr. Es war Chioma, die Galeristin. Er unterhielt sich geraume Zeit mit ihr über die Details einer geplanten Einzelausstellung. Nach dem Gespräch legte er das Gerät zurück auf den Tisch.
Er bemerkte, dass die Frau das kleine, schwarze Handy anstarrte. Lächelnd zuckte er die Achseln. »Ich weiß, man benutzt heutzutage keine solchen Mobiltelefone mehr.«
»So eines habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen.«
»Schon klar«, lachte er. »Früher hatte ich ein Smartphone. Aber dann ging mir eines Tages auf, dass wir zu viel Zeit damit verbringen, durch dieses kleine Gerät in unseren Händen auf die Welt zu sehen, und daher die Welt um uns herum gar nicht mehr richtig wahrnehmen.«
»Hmm«, sagte sie. »Wie bleiben Sie dann mit der Welt in Verbindung?«
»Ich lebe nicht hinterm Mond«, entgegnete er. »Natürlich habe ich einen Laptop und eine E-Mail-Adresse. Ich möchte einfach nicht mehr alle fünf Minuten auf das Mobiltelefon in meiner Hand glotzen. Es gibt so viel mehr zu sehen, so viel Schönes und auch so viel Hässliches. Die Kleinigkeiten, die man sonst verpasst.«
Sie nickte seufzend. »Ich fürchte, ich bin süchtig nach Instagram und TikTok. Klar, fürs Geschäft ist Social Media gut. Und nur zum Spaß auch. Es ist sehr schwer, nicht ständig am Mobiltelefon zu hängen«, sagte sie und steckte ihres in die Handtasche. Sie sah sich im Atelier um. Die Gemälde weckten ihre Neugier; sie stellte ihre Tasche ab und stand auf, um sie genauer zu betrachten. Das Porträt eines kleinen Mädchens mit Pferdeschwanz, ein Rennpferd, das durch einen Staubnebel galoppierte, eine Frau, deren Gesicht eine Collage aus bunten Würfeln war, leuchtend und zurückhaltend zugleich.
Aus dem Augenwinkel beobachtete Lalo, wie sie strahlend und nickend vor den Gemälden stand. Sie berührte eines, fuhr zart über die Farben, die Struktur.
Er schüttelte den Kopf. Welcher Mensch weiß denn nicht, dass man Kunst nicht anfassen darf?
Als die junge Frau vor seinem neuesten Werk stand, registrierte er mit einer gewissen Genugtuung, dass sie zurückzuckte, den Kopf abwandte. Im nächsten Augenblick beugte sie sich vor und studierte das Gemälde abermals, dann wandte sie sich ihm zu.
»Sind Sie das?«, wollte sie wissen.
»Ja.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist … interessant.«
Er verschränkte die Arme, ließ sie gleich wieder sinken und griff sich an den Bart. Ihre Wortwahl ließ ihn stolpern und er schmunzelte darüber, wie getroffen er sich fühlte. Interessant. Ein Wort, das zwischen gut und katastrophal schwankte. In welche Richtung das Wort kippte, hatte mit dem Werk selbst oftmals nichts zu tun. Seit er vor Wochen angefangen hatte, diese Gemälde zu erschaffen, war dies das erste Mal, dass er innehalten und versuchen würde, Worte dafür zu finden, Worte, die sie als Kunstwerke beschrieben, und nicht nur wie bisher als Bruchstücke seines Lebens oder vielmehr als die Enden seiner früheren Leben.
»Ich bin nicht der erste Künstler, der in seinem eigenen Werk auftaucht«, sagte er. Auch war er nicht der erste, der sein eigenes Ende malte. Ob sie wohl Caravaggio kannte, je seine Werke gesehen und, wenn ja, seine morbide Obsession mit Enthauptungen wahrgenommen hatte? Sicher nicht.
»Die … sind sehr fesselnd, auf eine verstörende Art und Weise«, meinte sie.
Lalo runzelte die Stirn. Eher melancholisch und düster. Verstörend, ja. Aber fesselnd? Zumindest hatte er das während des Malens so nicht wahrgenommen. Er hatte sich ausschließlich auf die Bilder in seinem Kopf konzentriert und auf die damit verbundenen Gefühle. Kinder des Nebels nannte er die Werke aus dieser Phase gelegentlich. Geboren aus dem Fieberdunst, in dem sie zu ihm gekommen waren, aus dem er, seit er den Zug gesehen hatte, jede Nacht genau um zwei Uhr vierzehn aufwachte, seine zitternden Hände beruhigte, indem er mit farbverschmierten Fingern über die Leinwand fuhr. Jedem Punkt, jeder Linie, jedem Pinselstrich waren Erinnerungen ans Sterben eingeschrieben, als erlebte er diesen Augenblick immer wieder. Im Delirium beendete er das Gemälde, ließ sich aufs Sofa fallen und durchlitt nochmals die Ereignisse, die zu dem auf Leinwand festgehaltenen Moment geführt hatten. Soweit er sich an sie erinnern konnte.
In jener ersten Nacht nach dem Fieber war Lalo zu sich gekommen, weil er ein ihm zunächst fremdes Geräusch gehört hatte. Zwei gelbe Knopfaugen in einem kreideweißen Gesicht starrten ihn an. Er hatte schreien wollen, in der nächsten Sekunde jedoch begriffen, dass es nur Diallo, sein Papagei, war. Dessen schrilles Kreischen hatte ihn geweckt und er stellte fest, dass er auf dem Sofa in seinem eigenen Wohnzimmer eingeschlafen oder womöglich ohnmächtig geworden war. Lalo hatte sich mühsam vom Sofa aufgerappelt und die Fenster geöffnet, worauf Luft ins Zimmer flutete und die Schwaden seines plötzlichen Unwohlseins vertrieb. Als er sich wieder umdrehte, da sprach ihn ein Gemälde an, an dessen Entstehung er sich zuerst nicht erinnern konnte. Er machte einen Satz rückwärts und stieß ein auf dem Boden stehendes Glas um, Wasser ergoss sich über den Teppich und löste einen Schnappschuss, eine Erinnerung aus: Blut hatte sich um seinen Kopf ausgebreitet und versickerte in der schwarzen Erde, auf der er lag. Er sprang über Wasser und Glas und setzte sich aufs Sofa, betrachtete das Werk, als hätte sich jemand anders in der Nacht hereingeschlichen und es geschaffen, obwohl seine Hände noch mit der Pastellkreide beschmiert waren, die er mit den Händen als Bildhintergrund aufgetragen hatte.
Die Leinwand vor ihm zeigte den Augenblick, bevor er niedergeschlagen wurde, er saß in den Eisenbahnsitz gepresst da, die Arme erhoben, als wollte er seinen Kopf vor dem Knüppel schützen, der auf ihn zurauschte, seine Bewegung war in schwarzer Farbe festgehalten. Was ihn verwunderte, waren nicht nur der Stil und die Erdtöne – beispielsweise der Sand, in dem er begraben gewesen war –, so anders als die grellen Farben seiner früheren Werke, sondern auch, wie lebensecht die Angst und der Schock in seinen Augen wirkten, in seinen Gesichtszügen, als habe er sich selbst für das Gemälde Modell gestanden.
»Dieser Gesichtsausdruck, ich weiß nicht, wie Sie den eingefangen haben«, sagte sie. »Haben Sie davon ein Foto gemacht oder ihn vorm Spiegel geübt …«
Lalo senkte den Kopf. »Das ist keine Übung.«
Er ging zu dem Gemälde, bewegte es ein wenig nach links, dann nach rechts. Er stellte fest, dass sie ihn musterte, als könnte sie dort, wo ihn der Knüppel getroffen hatte, eine Narbe entdecken. Lalo richtete sich auf, fuhr sich über die Schläfe und zog sein Hemd nach unten.
»Sie haben schlechte Laune.« Die junge Frau entfernte sich von ihm und den Gemälden, stellte sich ans Fenster und sah seufzend hinaus ins Grau. Ein Regenvorhang fiel, sein Saum tänzelte neckisch an die Scheiben.
Wieder zauberte ihm ihre Unverblümtheit ein Lächeln aufs Gesicht. »Entschuldigung«, sagte er, »diese Serie bedrückt mich irgendwie.« Er verstummte, wägte seine Worte ab. »Ich mache nämlich gerade eine Phase durch … etwas geht in mir vor. Mein Bruder hält mich für verrückt.« Er tippte sich gegen die Schläfe, riss die Augen auf, streckte die Zunge heraus und wackelte mit dem Kopf. Sie musste lachen. »Aber ich bin nicht verrückt.« Lächelnd sah er sich um. Ihm gefiel, wie ihr Lächeln langsam schwand, wie verglühende Asche. »Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen auch die anderen zeigen.« Er kam sich albern vor, wie er dastand, die Hände gefaltet, eine Grimasse auf dem Gesicht. Da er bisher niemandem die Serie gezeigt hatte, hatte er keine Ahnung, wie ihre Reaktion ausfallen würde. Lächelnd zuckte sie die Achseln. »Es regnet ja sowieso.«
»Yi hakuri, Verzeihung, ich hatte mich noch nicht vorgestellt. Meistens nennt man mich Lalo. Yarima Lalo«, sagte er in einem entschuldigenden Tonfall, in den sich ein Hauch Mutwillen mischte. »Wie Sie sich denken können, bin ich der Maler. Bestimmt haben Sie auch einen Namen, außer es stört Sie nicht, wenn ich Sie die Zwei-Uhr-vierzehn-Frau nenne.«
Sie lachte. »Aziza.«
»Aziza«, wiederholte er und verbeugte sich leicht spöttisch. »Ich entschuldige mich nochmals für mein … Verhalten. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was genau in mir vorgeht.«
»Schon in Ordnung.«
Fünf, sechs Gemälde zeigten Lalos Antlitz, erfüllt von Schock, Angst, der Gewissheit zu sterben, und im Augenblick danach.
»Diese drei«, mit ausladender Bewegung zeigte sie darauf, »wirken, als wären sie miteinander verbunden. Durch den Zug.« Im Ersten, das sie gesehen hatte, hielt er schützend die Arme über dem Kopf. Dahinter ein anderes, auf dem sein Kopf eingeschlagen war, Blut spritzte, sein Körper war gegen die Rückenlehne des Sitzes gesunken, sein Gesicht nur zum Teil sichtbar.
»Das ist richtig.«
Es gab ein weiteres Bild von ihm, auf dem er sich, in Erwartung eines Schlages, in einem Maisfeld zusammenkauerte. Auf dem nächsten nur ein blutiger Stein zwischen den Stängeln. Schwarze Erde. Grüner Mais. Tiefrotes Blut. Im letzten Gemälde drohte ein weiterer Schlag, die Ränder seiner Augen verschwommen, die Schläge kraftlos, des Lebens müde, des Sterbens, der Unausweichlichkeit von allem. Kleiner wirkte er darauf, geradezu geschrumpft.
»Was stellen die Bilder dar?«
»Natürlich einen Mann, der umgebracht wird.«
»Und der Mann sind Sie?«
Er nickte.
»Auf allen Bildern?«
»Das letzte zeigt einen Mann, der wahrscheinlich gleich umgebracht wird.«
Sie drehte sich dem Bild zu, auf dem besagter Mann vor einem düsteren Hintergrund kauerte. »Moment, ban gane ba, ich verstehe nicht. Wollen Sie sagen, das ist wirklich passiert?«
Er wandte sich ab, murmelte etwas über andere Gemälde, die nichts mit dem Zyklus zu tun hatten; draußen ließ der Regen nach, die Straße war übersät vom Müll, den die Sturzbäche herausgeschwemmt hatten.
»Wollen Sie damit sagen, dass das tatsächlich passiert ist?«
Er seufzte. »Schwer zu erklären.« Er kratzte sich den Bart und verzog das Gesicht. »Es ergibt überhaupt keinen Sinn, ich weiß.«
»Erklären Sie mir die Bilder doch bitte, dan Allah.«
Während des darauffolgenden Schweigens überlegte er, ob er erwähnen sollte, wie irrational alle seine Gedanken waren, seit der Zug in ihm Erinnerungen an ein früheres Leben wachgerufen hatte. Fragte sich, ob diese Fremde wohl über ihn lachen würde. Sie wirkte wie eine Romantikerin auf ihn – mit dem Nasenpiercing, ihrer Gier auf das Leben und auf Freundschaften, ihrer Affinität zu Instagram und TikTok. Vermutlich hatte sie eine Vorliebe für das Schöne und Unerreichbare, für Bilder von Blumen, von Liebespaaren, hingegossen im Mondlicht, und Ähnliches, nicht für den harschen Realismus dieser Bilder. Zuneigung für diese ihre Haltung erfasste ihn. Für sie. Für die Art, wie sie sich zu den Gemälden beugte, konzentriert die Stirn runzelte, vor sich hin murmelte.
Draußen grollte der Donner erneut wie ein hungriges Tier. Lalo schlenderte zum Fenster und betrachtete die Wasserströme, die das Fenster hinabglitten. Die Straße war dem Regen überlassen worden, ein paar geparkte Autos und der umgestürzte Plastiktisch der Handykartenverkäuferin waren die einzigen menschlichen Spuren. Kurz ging ihm die Frage durch den Kopf, warum der Tisch wohl nicht vom Wind weggefegt worden war.
»Diese Tode, die Sie malen, haben Sie die miterlebt?« Zwischen ihnen befand sich der Tisch, um den sie herumgegangen war, und die kleine offene Fläche des Ateliers. Sie spielte mit ihren Fingern.
»Ja, so könnte man womöglich sagen. Ich habe sie … erfahren.« Er drehte sich um und ertappte Aziza dabei, wie ihr der Mund offen stand. Dabei sah sie weder so jung noch so gutgläubig aus, wie er anfänglich angenommen hatte. An ihren angespannten Kiefermuskeln, ihren sich verengenden Augen ließ sich ablesen, dass sie seinem Geisteszustand misstraute. Sie umklammerte die Ecke des Tischs, als könnte sie ihn als Schild benutzen, um sich vor ihm zu schützen, vor seinen Trugbildern und eventuell seinem Wahnsinn, sollte dieser ausbrechen.
Einen Augenblick lang musterten sie einander. Sie, eine skeptische Inquisitorin, er, ein Kind, das beim Lügen erwischt wird.
Doch es war keine Lüge.
»Toh fa! Babban magana, große Worte«, entfuhr es ihr schließlich, ihr Blick huschte durchs Atelier, blieb kurz an schweren Objekten innerhalb ihrer Reichweite hängen, wie der dreißig Zentimeter großen Bronzestatue eines Fulani-Milchmädchens, das auf einem Sockel zu ihrer Linken stand, einer gesichtslosen Figurine aus verkohltem Holz zu ihrer Rechten, eine Hälfte dunkler als die andere. »Und Sie sind bei diesen … Vorfällen gestorben?«
»Hören Sie, es tut mir leid.« Rasch ging er zu den Gemälden, stapelte sie aufeinander und lehnte sie gegen die Wand. »Wie gesagt, es lässt sich nur schlecht erklären. Bestimmt sind Sie der Meinung, dass ich Sie verarsche.«
Aziza nickte, ihr Blick huschte immer noch hin und her. »Sie sind wunderschön. Wunderschön gemacht, will ich damit sagen. Bestimmt gibt es dafür ziemlich viel Geld.«
»Sie stehen nicht zum Verkauf.«
»Oh!«
»Das ist keine Kunst«, sagte er und machte eine Geste der Hilflosigkeit. »Soll heißen, das ist das Leben, verstehen Sie? Leben. Und Tod.« Das letzte Wort stieg auf wie das Rauchfädchen einer ausgeblasenen Kerze.
»Oh.«
Sie nickte und trat, Interesse heuchelnd, nach einer angemessenen Pause vor die anderen Gemälde. Er hatte recht gehabt, sie hielt sich länger vor einem kubistischen Bild auf, das einen lesenden weiblichen Akt darstellte.
Lalo zögerte, sollte er etwas sagen oder die Unterstellung, er habe gelogen, einfach vom Regen davonspülen lassen? Er wollte sich nicht mehr entschuldigen, aber aus irgendeinem Grund wollte er auch nicht, dass sie mit dem Eindruck ging, er wäre geistig nicht gesund.
»Diese Gemälde werden wahrscheinlich bei einer Ausstellung gezeigt.« Diese Idee war ihm gerade eben erst gekommen. »Aber sie stehen nicht zum Verkauf. Zumindest nicht diese.«
»Verstehe.« Sie verzog das Gesicht. »Jedenfalls danke, dass Sie mir Ihre Arbeiten gezeigt haben. Es hat anscheinend aufgehört zu regnen. Ich muss heim zu meiner Tochter.«
»Eine Tochter? Wie alt?«
»Fünf.«
Er nickte.
»Allah ya raya, möge Gott ihr ein langes Leben schenken.« Er wollte hinzufügen, dass sie bestimmt so schön war wie ihre Mutter, doch ließ die Worte stattdessen in seinem Kopf herumwirbeln.
»Amen. Danke. Und danke, dass ich bleiben durfte. Ich hätte eine Massenmörderin sein können oder eine Diebin.« Sie gluckste.
Er lächelte. »Oder einfach nur eine Muse.«
Sie lächelte gleichfalls und ordnete den Schleier über ihrer Brust. An der Tür drehte sie sich mit erhobenem Zeigefinger um, als wäre sie eine Schülerin, die im Unterricht aufzeigt. »Entschuldigen Sie meine Frage, wer war der Mörder in Ihren Gemälden?«
»Ein verschmähter Rivale. Oder in einem Fall ein Ehemann.«
Aziza nickte, ihre Augen wanderten von seinem Kopf über das schwarze T-Shirt und die rote Hose bis hinunter zu den Schuhen und hinterließen bei dieser Reise die Spuren ihres Zweifels – an seiner Erzählung, seiner geistigen Gesundheit. »Also, nagode, danke. Sai anjima, auf Wiedersehen.«
»Gern geschehen«, sagte er. »Sai anjima.«
»Übrigens eine hübsche Idee, das Kind reinzumalen.«
»Welches Kind?«
»Das mit dem Karren. In allen Gemälden. Rechts oben. Ist mir gleich aufgefallen«, sagte sie.
Lalo wandte sich seinen Gemälden zu und richtig, oben rechts fand sich in allen die Gestalt eines Kindes mit einem Karren. Manchmal ein Schatten oder eine Wolke, eine Silhouette, manchmal eine Lücke im Laub, aber alle zeigten die gleiche Form, ein geheimes Motiv, das er in seine Kunst eingebaut hatte. Bis auf die Tatsache, dass er die Gestalt zum ersten Mal wahrnahm. Er trat näher und sah genauer hin.
Da hörte er die Silberglöckchen an seiner Tür klingeln, die verkündeten, dass die Frau ging, die um zwei Uhr vierzehn nachmittags, eingehüllt in einen Laubsturm, gekommen war.
Das Kind
An diesem Abend, lange nach den Regenfällen, als die umgekippten Sonnenschirme wieder an ihren Platz gestellt worden waren und die Menschen die Straßen nach dem Sturm der Elemente zurückerobert hatten, als die Tagesgeschäfte erledigt waren und die Ladenbesitzer über Nacht schlossen, sah Lalo aus dem Fenster und erblickte das Kind, dessen Gestalt und Gesicht in seinen Gemälden aufgetaucht war, auf der anderen Straßenseite bei ihrem Karren stehen. Das Mädchen schien ganz versunken in die Beschilderung eines Kinderbekleidungsgeschäfts, als wäre sie eine Kartografin, die sämtliche Buchstaben nachzeichnen musste.
Erstaunt riss Lalo die Augen auf. Verblüfft blickte er mehrmals von dem Kind zu den Gemälden und jedes Mal drang die Erkenntnis tiefer, dass sie ein und dasselbe waren. Sogar sein skeptischer Geist musste akzeptieren, dass die Gestalt, die er unbewusst in seine Bilder eingearbeitet hatte, auf der anderen Straßenseite stand und die Leuchtreklame eines Ladens betrachtete.
Lalo, der gerade Feierabend machen und die Jalousie seines Schaufensters herunterlassen wollte, spürte, wie sich sein Herz in etwas Wildes verwandelte, das verzweifelt der Enge seines Brustkorbs zu entkommen suchte. Die Malerschürze, die er ausgezogen hatte, entglitt seinen Fingern und fiel auf den Boden. Er bemerkte es so wenig wie den vorbeiströmenden Verkehr. Alles bis auf das Kind auf der anderen Straßenseite verschwamm. Das Kind schien ungerührt von der Hektik ringsum, der Welt, die heimwärts oder in einen der vielen Gastgärten der Stadt hastete, vom Verkehr, der sich hinaus in die Vorstädte schlängelte. Ein Kind, das anscheinend alle Zeit der Welt hatte.
Endlich, und dazu schien die gesamte Ewigkeit nötig, hatte das Mädchen offenbar die Buchstabenkontinente kartiert und nickte, als wäre sie von der eigenen Leistung beeindruckt. Sie drehte sich vom Laden weg und Lalo erhaschte einen Blick auf ihr Profil. Selbst aus dieser Entfernung konnte er sehen, wie glatt ihre Haut war. Ihr Gesicht war ein kleiner, geradezu leuchtender, von einem Kopftuch eingerahmter Mond. Sie hüpfte und sprang die Straße hinab, schob dabei ihren Karren elegant um die Passanten herum. Bis sie Libyas Stand mit den golden frittierten Köstlichkeiten erreichte, dort blieb sie stehen und betrachtete die glänzenden Hügel aus knusprigen Yams-, Kartoffel- und Hühnerstücken, die in Ei und Öl herausgebacken waren. Libya, der Riese, hob mit einem gigantischen Sieb eine frische Ladung frittierter Yams aus seinem Wok und kippte sie auf den Hügel, der sich bereits auf dem Tisch erhob.
Lalo selbst hatte nie etwas bei Libya gekauft, der unvermittelt eines Morgens an der Straßenecke erschienen war, samt Tisch, Dreifuß und einem schwarzen, fast badewannengroßen Stahlwok, und wie ein Strommast zur festen Institution geworden war. Lalo hatte nie erlebt, dass er seinen Stand verließ, nicht einmal, um auf dem Markt Nachschub einzukaufen, und doch holte er unter seinem Tisch immer wieder etwas hervor – eine Yamsknolle, eine Handvoll Kartoffeln oder Hähnchenflügel. Manchmal betete er in der wenige Meter entfernten Musallah. Abends hockten die Leute auf den Bänken rund um seinen Verkaufstisch und redeten über Politik und Fußball, die Proteste der Schiiten, Boko Haram und andere Banditen, die im Norden wüteten.
An diesem Abend saßen nur einige Männer da. Das Kind blieb stehen und starrte sehnsüchtig Libyas frittiertes Gold an. So klein und so einsam. Lalo, den plötzlich der Wunsch packte, dass sie so viel Gebackenes bekommen sollte, wie sie essen konnte, griff nach dem Türknauf. Als er die Straße überqueren wollte, fiel ihm ein, dass er seinen Geldbeutel auf dem Tisch vergessen hatte. Rasch ging er ins Atelier zurück, nahm ihn an sich, hastete nach draußen und überquerte die Straße im Laufschritt. Doch das Kind war fort. Stirnrunzelnd sah er auf die Straße, ehe er sich an Libya wandte.
»Sannu, malam, hallo, Meister«, grüßte er. »Gerade eben war hier noch ein Mädchen mit einem Karren. Ich bin nur schnell zurück und habe meinen Geldbeutel geholt, doch jetzt ist sie weg. Wissen Sie, wohin sie gegangen ist?«
Libya schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, mir ist sie nicht aufgefallen. Hat sie Ihren Geldbeutel geklaut?«
»O nein«, Lalo hielt den Geldbeutel hoch, »sie hat Ihr Frittiertes betrachtet und ich habe mir überlegt, ob sie wohl was will und ich ihr eine Portion kaufen soll.«
Libya schob die Lippen vor und schüttelte den Kopf.
Lalo ließ den Blick links und rechts die Straße entlangschweifen. Auch er schüttelte den Kopf und holte einen Schein aus dem Geldbeutel, den er Libya hinhielt. »Ich möchte ihr im Voraus eine Portion kaufen, für den Fall, dass sie zurückkommt und gern eine hätte. Sie ist ungefähr so groß«, Lalo hielt die Hand in Höhe seines Oberschenkels, »und auf dem Kopf trägt sie ein Tuch.«
»Und hat einen Karren?«
»Ja.«
Libya sah Lalo in die Augen, nickte und griff nach dem Geld.
Flügelsturm
Fliegende Termiten drehten im Verandalicht ihre Pirouetten und stießen gegen die Glühbirne; ihre durchsichtigen Flügel brachten den Lichtstrahl zum Zwinkern und kitzelten Lalos Gesicht. Der Regen hatte sie aus ihrer Bewusstlosigkeit geweckt und das Licht auf der Veranda seiner Mutter zog sie an. Lächelnd erinnerte sich Lalo, wie er und sein Bruder Nura sie als Kinder in Schüsseln gesammelt hatten, die halb mit Wasser gefüllt waren, und ihre Schwester Habiba, die Jüngste von ihnen, sie anschließend salzte und röstete. Dann stellten sie stets einen großen Teller mit knusprigen Chinge vor ihre Mutter Kande, die auf dem Gebetsteppich saß und mit klickender tasbaha ihre Gebete zählte. Sie standen nebeneinander an der Wand und warteten, während durch Kandes erhobene, zur Schale gewölbte Hände leise die Gebete flossen. Manchmal zogen sich die Gebete hin und Lalo stellte sie sich als Spulen mit seidigen, blaugrünen Bändern vor, die sich von ihrem ernsten Herzen den ganzen Weg bis zum Rand der Welt entrollten und von dort in Gottes großen Schoß fielen. Nachdem Kande sich auf Gesicht und Herz geklopft hatte und die drei Kinder ihr Ameen wiederholt hatten, lächelte die Mutter sie an und führte eine Handvoll Chinge zum Mund.
Tage der Unschuld.
Vorbei, vorbei.
Habiba, die verheiratet und Mutter war und in Port Harcourt lebte, hatte er seit drei Jahren nicht gesehen. Nuras Gesicht war mittlerweile zur Hälfte von wildem Bartwuchs überwuchert, der dichter war als seiner, die andere Hälfte war faltenzerfurcht, weil er sich um alle Sorgen machte, um ihre Mutter, seine Frau, seine Kinder und um Lalo, dem er ein Vater sein wollte. Seine Hauptsorge galt Kande, die leidend war.
Lalo beobachtete die Hunderten von Insekten, die sich im Licht tummelten, ihre Flügel abwarfen und ins Dunkel krochen, ins Ungewisse. Mit einem Seufzer betrat er die Veranda und dann das Zimmer seiner Mutter. Sie lag auf dem Bett und schlief tief und fest; vom Fenster wehte ein Luftzug herein. Lalo schloss das Fenster und die Gardinenringe pfiffen über die Schiene, als er die Vorhänge zuzog. Kande schlief fast immer, so auch während der vergangenen drei Tage. Er setzte sich neben sie und zog die Decke bis zu ihrer Brust hoch. Ihre Hände fühlten sich warm, schwach und klein in seinen an. Er küsste ihre Fingerknöchel und schob ihre Hand unter die Decke.
Vor fünf Jahren hatte sich seine Mutter schlafen gelegt und war siebzehn Tage lang nicht aufgewacht. Nach dem ersten Tag, als sie weder auf direkte Ansprache noch auf Schütteln und Wassergüsse reagiert hatte, waren sie alarmiert gewesen und hatten Kande in ein Krankenhaus gebracht. Abgesehen von ihrem Tiefschlaf war laut den Ärzten alles in Ordnung. Während der Woche im Krankenhaus zeigten die Krankenschwestern der Familie, wie sie Kande mittels einer Spritze flüssige Nahrung einflößen konnten und wie sie gewaschen werden musste. Den Söhnen war es allerdings unangenehm, sie zu windeln. Als Habiba von Kandes Krankheit erfuhr, reiste sie durchs halbe Land ans Bett der Mutter. Sie blieb zwei Jahre.
Als Kande damals an einem wolkenverhangenen Tag das erste Mal aufwachte, betrachtete sie stirnrunzelnd die Windel und ihre Arme, die so schwach waren, dass sie sich nicht vom Bett abstoßen konnte, sowie ihre Beine, die unter ihr wegzuknicken drohten, nachdem sie endlich stand. Sie begriff nicht, dass sie siebzehn Tage, neunzehn Stunden und vierzehn Minuten lang geschlafen hatte, konnte sich an diese Zeit überhaupt nicht erinnern. Sie konnte sich auch kaum daran erinnern, dass die ängstlichen Gesichter um sie herum ihren Kindern gehörten.
»Kein Wunder, dass ich so müde bin«, hatte sie schließlich gegähnt.
Fast einen Monat später war sie erneut in einen Schlummer gefallen, der diesmal drei Tage dauerte. Die Hoffnung, die ihnen die kürzere Dauer dieses Anfalls gab, schwand rasch wieder. Der nächste Anfall zog sich einundzwanzig Tage hin, und als sie endlich aufwachte, waren ihre Kinder völlig außer sich. Im Laufe der Jahre verschlief sie wichtige Ereignisse in deren Leben. Nuras Hochzeit wurde zweimal verschoben. Beim dritten Mal fand sie trotzdem statt. Einmal wachte sie nach vierzehntägigem Schlaf auf und entdeckte, dass Habiba ihr ein weiteres Enkelkind geschenkt hatte.
Lalo saß an Kandes Bett und zerbrach sich den Kopf über ihr verblühtes Gesicht. In den gesamten neunundzwanzig Jahren seines Lebens war seine Mutter nie mollig gewesen, doch noch nie hatte sich ihre Haut so straff über den Wangenknochen gespannt, nicht einmal, nachdem die ewig hungrige Schnellstraße, die Abuja mit Lokoja verband, ihren Mann verschlungen hatte. Das Auto, in dem er saß, war von einem Lastwagen zerquetscht worden, der Zement transportierte.
Damals war Lalo siebzehn gewesen, hatte sich einen Afro wachsen lassen und trug stets einen Kamm in der Gesäßtasche seiner Jeans. Nachdem sie seinen Vater begraben hatten, ging er zum Friseur, warf sich auf den Stuhl und sagte zu dem verblüfften Mann: »Scheren Sie mir eine Glatze.« Während der Haarschneider seinen Afro hinwegfegte, konnte er immer noch nicht fassen, wie viel Zement sie aus dem Haar seines Vaters gespült hatten, ehe sie ihn in das Leichentuch hüllten. An diesem Tag zerbrach er seinen Kamm und hatte sich seitdem keinen anderen gekauft. Als er ein knappes Jahr später zum Militär ging, war er, angesichts der Rücksichtslosigkeit, mit welcher der Ausbildungsoffizier mit der Schere durchs Haar seiner Mitrekruten fuhr, dankbar für seinen Bürstenschnitt.
Kande war die ganze Zeit über stoisch gewesen. Sie zog den Schleier über die Schultern und kauerte sich zusammen, während das Kondolenzkonfetti um sie herum niederging. Angesichts der Tatsache, wie sehr sie seinen Vater geliebt und wie stark er ihr im Gegenzug seine Liebe gezeigt hatte, war Lalo überzeugt gewesen, dass man Kandes Einzelteile zusammensammeln und mit Liebe und Geduld wieder zusammenfügen müsste. Doch ihre Augen hatten sich lediglich tiefer in ihr Gesicht zurückgezogen, während sich die Jahre in ihre Stirn gruben. Wenn sie sich zum Abendessen hinsetzte, das sie bislang immer mit seinem Vater zu sich genommen hatte, wobei sich ihre Finger stets berührten, wenn sie nach dem Essen griffen, das sich auf einem gemeinsamen Teller befand, starrte sie nur vor sich hin, das Gesicht lang wie ein Stadttor, und seufzte ihren Hunger fort.
Ansonsten war sie bei guter Gesundheit gewesen, bis zum Tag, an dem sie über Fieber und Kopfschmerzen geklagt, sich ins Bett gelegt und siebzehn Tage lang geschlafen hatte.
»Ich habe dich gar nicht kommen hören«, drang Ummitas unverwechselbare, piepsige Stimme in seine Gedanken. Mit der Windel in der Hand stand die Frau seines Bruders an der Tür. Seit seine Schwester zu ihrer Familie zurückgekehrt war, war es Ummita, die Kande pflegte und windelte. Bei seinen Besuchen bekam er gelegentlich mit, dass Nura sie feucht abrieb oder ihr Zimmer putzte. Lalo bestand darauf, seinem Bruder das Handtuch oder den Mopp abzunehmen, was dieser einigermaßen widerwillig zuließ. Für ihn war das Wischen der Teil, den er beitragen musste, etwas, was er tun musste, nicht nur für seine Mutter, sondern auch für das Haus. Zumindest für dessen Erscheinungsbild.
Es hatte ihrem Vater gehört. Nachdem er gestorben war und Nura heiraten wollte, bestand Kande darauf, ihre Zimmer aufzugeben und in den Gästebereich zu ziehen, als wäre sie nur ein Untermieter im Leben ihrer Kinder. Nura hatte diese Geste abgelehnt, bis seine Mutter die Ältesten beauftragt hatte, ihm Gehorsam beizubringen.
Jetzt sah Lalo die Frau an, die im ehemaligen Trakt seiner Mutter lebte. »Tante Ummita, ich bin gerade eben gekommen. Ich dachte, du bist beschäftigt, und wollte dich nicht stören.«
»Ich habe dich erwartet. Und dir etwas vom Abendessen beiseitegestellt.«
»Hast du? Vielen Dank.«
»Natürlich.« Sie lächelte. »Wenn sie schläft, kommst du doch jeden Abend zu Besuch.« Sie hielt die Windel hinter ihrem Rücken versteckt und betrat das Zimmer.
Lalo stand auf und wich zur Wand zurück, vergrößerte den Abstand zwischen ihnen. Von seinem kurzen Ausflug in die Armee hatte er nur weniges mitgenommen. Jeden Tag wachte er im Morgengrauen auf, sprach seine Gebete, schnürte seine Laufschuhe und jagte hinter der aufgehenden Sonne her. Und ja, Ummita hatte recht. Wenn seine Mutter schlief, lenkten ihn seine Sancho-Boots allabendlich an ihr Bett. Er mochte einen geregelten Tagesablauf. Aber vorhersehbar mochte er nicht sein. Ein Widerspruch, das gab er zu.
»Manchmal habe ich den Verdacht, du bist der Meinung, dass wir nicht gut für sie sorgen«, sagte Ummita, verstummte aber, als sie bemerkte, dass er zurückwich. »Geht es dir gut?«
Er bejahte, sah auf seine Füße hinunter und deutete dann zu den Gardinen. »Als ich reinkam, zog es, daher habe ich das Fenster geschlossen.«
»Ja, ich habe es offen gelassen. Seltsam, obwohl es regnet, schmilzt die Hitze die Schneemoskitos weg.«
»Schneemoskitos?«
Sie lächelte. »Die haben deine Neffen und ich uns ausgedacht. Sie haben eine lebhafte Phantasie. Wir wissen, woher das kommt.«
»Ich bekenne mich schuldig, gaskiya.« Er hob die Hände.
»Ich wollte das Fenster schließen und ihre Windel wechseln.«
Auf dem Bett drehte Kande sich um, steckte den Daumen in den Mund und machte saugende Geräusche.
»Dann ziehe ich mich wohl lieber zurück«, sagte er.
»Nein, keine Sorge, das kann ich später erledigen. Soll ich dir dein Abendessen hierherbringen, weil du bei ihr bleiben willst? Oder möchtest du zum Essen rüber ins Haus kommen? Die Kinder würden sich freuen.«
»Ich mich auch. Ich komme gleich.«
Ummita legte die Windel in die Nachttischschublade. An der Tür blieb sie stehen und nickte ihm zu. Grinsend nickte Lalo zurück und seufzte, als der Vorhang hinter ihr herflatterte. Einmal hatte er ihr einen Armreifen aus Elfenbein gekauft, als Dankeschön für die Freundlichkeit, die sie seiner Mutter und ihm entgegenbrachte. Er beneidete seinen Bruder um sein Glück, und wenn er an Ehe dachte, hatte er das Bild von Nura und Ummita vor Augen. Nicht, dass Heirat eine realistische Option für ihn war. Seit er den Zug gesehen hatte, war er ohnehin sicher, dass er vor jeder möglichen Eheschließung sterben würde, ganz zu schweigen von seinem Zustand, von dem nicht einmal sein Bruder wusste.
Er ging durchs Zimmer, setzte sich auf die Bettkante und zog seiner Mutter den Daumen aus dem Mund. Er legte seine Hand auf ihre. In ihrem Schlaf war sie wie ein Kind, unberührt von der Trauer und dem Herzeleid, die sie seit Jahren mit stiller Würde erduldete.
Ein leises Klopfen kündigte Nura an, der in der Tür stand und seinen Bruder anlächelte.
»Yaya, in wuni, wie war dein Tag?«, begrüßte Lalo ihn.
»Lafiya, gut«, antwortete Nura und seine sonore Stimme füllte das Zimmer. Er blieb an der Tür stehen, eine Faust in die Hüfte gestemmt, sein bescheidener Bauch wölbte sich unter dem Kaftan. Mit einem sorglosen Gesicht wäre sein weicher, knuddeliger Bruder in die Kategorie »süß« gefallen. Der Begriff, den Aziza benutzt hatte. »Ummita hat mir gesagt, dass du da bist. Ich bin davon ausgegangen, du schaust zuerst im Haus vorbei.«
Unbewusst zog Lalo seinen flachen Bauch ein. Das morgendliche Joggen war eher eine Flucht vor den wiederkehrenden Erinnerungen, ansonsten tat er wenig für seine Fitness. Schließlich atmete er aus. Sein Bauch war noch weit davon entfernt, mit dem des Bruders gleichzuziehen. Er sah ihre Mutter an. »Ich dachte, ich sollte zuerst zu ihr gehen.«
»Ja, unser Dornröschen. Angesichts der Umstände geht es ihr gut. Wie steht’s bei dir? Erzähl, was treibt unser Künstler so?«
Lalo bemerkte, dass die Augen seines Bruders ihn musterten, sah die Sorge und Müdigkeit in ihnen.
»Mir geht’s gut.«
»Wirklich?«
»Ja.«
»Keine weiteren Vorfälle? Visionen? Erinnerungen?«
Lalo schüttelte den Kopf.
Seit er seinem Bruder von den Erinnerungen erzählt hatte, die ihn seit kurzem heimsuchten, merkte Lalo, wie sehr Nura diese als Stress oder mögliche Auswirkungen von Lalos kurzer Armeezeit abtun wollte, wie die von Schüssen untermalten Albträume, die seinen Schlaf geplagt hatten, bevor der Zug kam, vor diesen neuen Bildern.
Nura wackelte mit dem Kopf, trat ans Bett seiner Mutter und setzte sich auf die Kante, dabei stieß sein Knie gegen das seines Bruders. »Ummita sagt, du hast offenbar Angst vor ihr. Nervös war wohl das Wort, das sie benutzt hat.«
Seit kurzem macht Lalo vieles nervös. Der fette Gecko, der auf Fliegenjagd über seine Veranda huschte, die Blauschwanzechse, die sich vom Mangobaum in seinem Innenhof ernährte, das Prasseln des Regens, das Krächzen seines Papageis Diallo. Und Menschen. Seit ihn die Erinnerungen heimsuchten, war es schlimmer geworden.
»Nein. Bin ich nicht. Das muss sie sich eingebildet haben.«
Nura nickte. »Ihr beiden habt euch immer gut verstanden. Hoffentlich gibt es keine Probleme.«
»Definitiv nicht.«
»Ich mache mir übrigens Sorgen um dich.«
»Du machst dir um alle und alles Sorgen, Bruder.«
Nura stieß ein Lachen aus, das in einem Jammern endete. »Das gehört dazu, wenn man der große Bruder ist, weißt du.« Wieder sah er Lalo tief in die Augen. »Musst du immer noch an diese … Sachen denken?«
»Erinnerungen, meinst du.«
»Ja, Erinnerungen.«
Lalo bejahte und schwieg eine Weile. »Manchmal habe ich nur einen einzigen Gedanken, wie ich die Menschen ausfindig machen kann, die mich in meinen früheren Leben ermordet haben und …« Er betrachtete seine verkrampften Finger, als wären sie ihm fremd.
Nura packte Lalos Hand. »Hör zu, kleiner Bruder.« Er betrachtete ihre Mutter und sprach leiser. »Ich kann diese Last nicht allein tragen. Du darfst mir jetzt nicht zusammenbrechen. Das alles wird mir zu viel.«
»Musst du nicht. Ich bin da. Mir geht’s gut.« Er drückte Nuras Hand und ließ sie los. Als er in der Tür stand und sich umdrehte, wirkte das Gesicht seines Bruders bedrückter denn je.
»Und versetz meine Frau nicht in Panik. Ihr fehlt dein früheres, heiteres Ich. Genau wie mir.«
»Ich weiß. Mir fehlt mein früheres Ich auch.«
»Ich würde mir übrigens weniger Sorgen machen, wenn ich wüsste, dass stets jemand an deiner Seite ist.«
»Ach, Bruder. Müssen wir wieder über dieses Heiratsthema reden? Ich bin schon ganz begierig auf Ummitas tolles Essen.« Lalo lachte.
»Mir ist es ernst.«
»Weiß ich. Aber kann ich nicht einfach meine Nichte und meinen Neffen in Ruhe besuchen und mich an den grandiosen Kochkünsten deiner Frau erfreuen? Du weißt doch, dass ich vor allem deswegen komme.«
Lachend stand Nura auf. »Demnächst werde ich dir Tischverbot erteilen. Dich zwingen, dir eine eigene Frau zu suchen.«
Er legte seinem Bruder den Arm um die Schultern. Gemeinsam ließen sie das leise Schnarchen ihrer Mutter hinter sich und gingen hinaus ins nächtliche Summen der fliegenden Termiten.
Der Geschmack der Farbe Gelb
Das leere Oval auf der Leinwand neckte ihn, forderte ihn heraus. Er sah das Gesicht seiner Mutter vor sich, den Ausdruck, den er hoffentlich einfangen konnte, aber seine Finger, aufmüpfige Anhängsel, wollten seiner Phantasie nicht gehorchen. Jedes Mal, wenn er den Pinsel ablegte und seine Finger mit dem Mallappen reinigte, klebte ihm der Geschmack der Niederlage auf der Zunge. Er schmeckte wie die Farbe Gelb – unangenehm süßes Saccharin in Kombination mit saurer Milch.
Im Lauf der vergangenen Woche hatte er den Bleistiftentwurf ihrer schlafenden Gestalt vom Skizzenblock auf die Leinwand übertragen. Er hatte viel Zeit damit verbracht, das Licht in ihrem Zimmer einzufangen, die Falten im Laken, die kleinen roten Glyzinien auf ihrem weißen Pullover, jeweils drei Blütentrauben zusammen, die graue Bordüre ihres kleinen, weißen Blusenkragens und die wilde Flora und Fauna auf dem Bezug ihrer mintgrünen Bettwäsche. Aber ihr Gesicht blieb leer, bis auf die Augenbrauen, die er ins Oval gemalt hatte. So leer, wie sein Kopf wurde, sobald er den Pinsel in die Hand nahm und an ihrem Gesicht arbeiten wollte. Aus ein, zwei Metern Entfernung sah sie wie eine Außerirdische aus. Selbst die Köpfe der tänzelnden Miniaturantilopen auf ihrer Bettdecke waren detaillierter ausgeführt als ihr Gesicht.
Er legte den Pinsel beiseite, riss sich die Schürze herunter, ballte sie zusammen und warf sie gegen die Wand. Mit in die Hüften gestemmten Armen starrte er das Bild an, bis der Hunger an seinen Eingeweiden nagte. Vielleicht würde er beim Mittagessen die Inspiration finden, die ihn bisher geflohen hatte. Er drehte sich auf dem Absatz um und sah erstaunt vor seinem Atelier eine Frau stehen, die durch das Fenster spähte. Sie winkte ihm lächelnd zu. Er kniff die Augen zusammen und kratzte sich den Bart. Aziza.
Sie kam herein, die Silberglöckchen an seiner Tür klingelten dazu, und blieb mitten im Atelier stehen, als wäre sie unsicher geworden. Sie sah schlanker aus, weniger imposant als beim letzten Mal. Vielleicht lag es an ihrem Kleid. An diesem Tag hatte sie sich einen schwarzen Schleier als Kopfputz um den Kopf geschlungen, und als sie sich bewegte, glitzerte ihr Nasenpiercing.
»Ina yini, guten Tag, wie geht’s«, grüßte sie.
»Lafiya lau, bestens. Kwana biyu, lange nicht mehr gesehen.« Er lächelte.
»Stimmt. Ich bin länger nicht in der Nähe gewesen. Ich dachte, ich sollte mal vorbeikommen und mich für unlängst bedanken.«