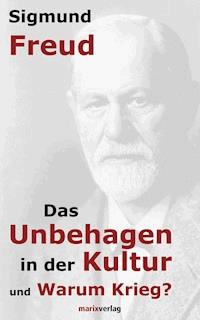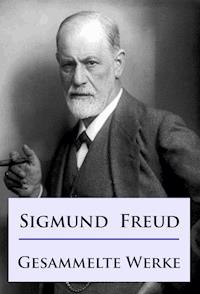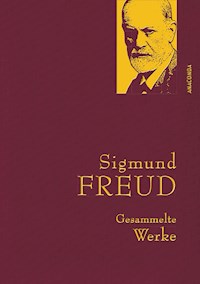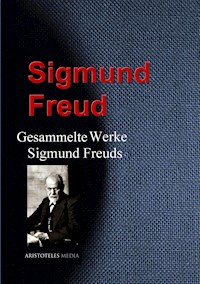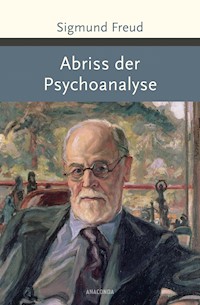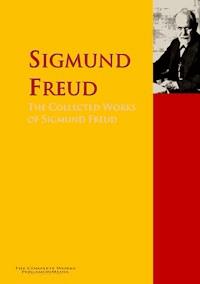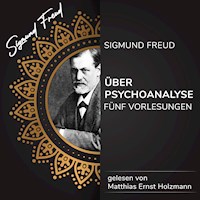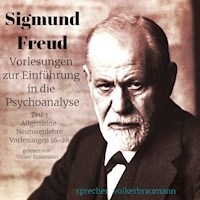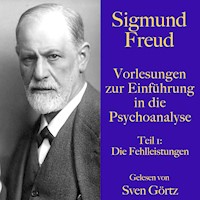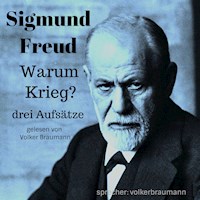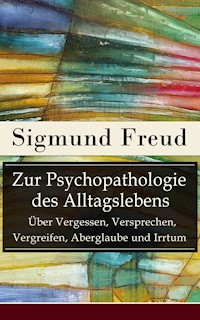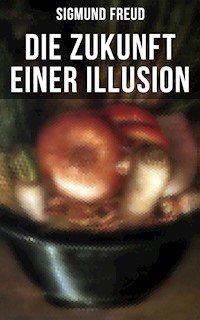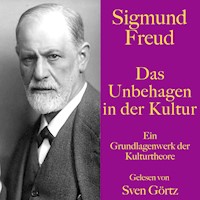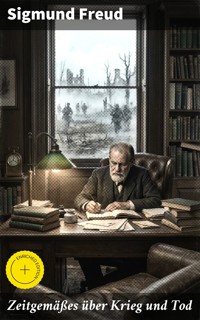
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Zeitgemäßes über Krieg und Tod" beleuchtet Sigmund Freud die psychologischen Dimensionen von Krieg und Sterblichkeit, zwei Themen, die sowohl individueller als auch kollektiver Natur sind. Durch eine tiefgreifende Analyse der menschlichen Psyche und deren Reaktionen auf Trauma und Verlust entblößt Freud nicht nur die psychologischen Mechanismen, die in Zeiten des Krieges wirken, sondern bietet auch einen literarischen Stil, der sowohl analytisch als auch poetisch ist. In einem zeitgenössischen Kontext, geprägt von den Schrecken des Ersten Weltkriegs, gelingt es Freud, manch gesellschaftliches Tabu über den Tod zu thematisieren und dessen Auswirkungen auf das menschliche Verhalten und den sozialen Zusammenhalt zu reflektieren. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, war nicht nur ein bedeutender Psychologe, sondern auch ein scharfer Beobachter der menschlichen Zivilisation. Ängste und Konflikte, die während seiner Zeit schwelten, inspirierten ihn dazu, die Verbindung zwischen inneren psychologischen Konflikten und äußeren gesellschaftlichen Ereignissen zu erforschen. Seine umfassende Kenntnis der menschlichen Natur und seine Erfahrung mit den Folgen des Krieges prägen seine Analyse in diesem Werk. "Zeitgemäßes über Krieg und Tod" ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der sich mit der psychologischen Dimension von Gesellschaftskonflikten auseinandersetzen möchte. Freuds fundierte Einsichten bieten nicht nur Erklärungen für die menschliche Veranlagung zum Krieg, sondern regen auch zur Reflexion über den Tod und dessen Bedeutung im Leben an. Eine tiefgehende Lektüre, die sowohl Fachleute als auch interessierte Laien fesseln wird. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zeitgemäßes über Krieg und Tod
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Sammlung versammelt Schriften eines einzelnen Autors unter dem Titel Zeitgemäßes über Krieg und Tod und konzentriert sich auf zwei eng verwandte Texte von Sigmund Freud. Ziel ist nicht die Präsentation eines Gesamtwerks, sondern die geordnete Zusammenstellung eines thematischen Kernbestands. Indem beide Stücke gemeinsam angeboten werden, soll die gedankliche Spannweite sichtbar werden, mit der Freud den Schock kriegerischer Erfahrung und die Herausforderung des Todes für das moderne Bewusstsein reflektiert. Die Sammlung versteht sich als Einladung zu einer konzentrierten Lektüre, die historische Lage und theoretische Einsicht miteinander ins Gespräch bringt, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen.
Im Umfang bewusst schlank, führt die Edition die Leserschaft durch einen kompakten Parcours aus zwei Texten, die sich gegenseitig erhellen. Sie richtet sich an Leserinnen und Leser, die Freud nicht in der Breite seiner klinischen Schriften, sondern in prägnanten kulturtheoretischen Interventionen kennenlernen möchten. Die Auswahl will zeigen, wie eine psychologische Perspektive auf öffentliche Verwerfungen und individuelle Krisen angewandt werden kann. Zugleich begreift sie Freud als Autor, dessen Stimme über den unmittelbaren Anlass hinausweist. Es geht um Verständigung: über Erwartungen, die Krieg erzeugt, und über Einstellungen zum Tod, die das eigene Leben ordnen oder verdrängen.
Die Sammlung umfasst die Texte Die Enttäuschung des Krieges und Unser Verhältnis zum Tode. Ihre Zusammenführung verfolgt die Absicht, einen gedanklich stringent aufgebauten Leseraum zu eröffnen: Zuerst tritt der Bruch zwischen zivilisatorischer Erwartung und kriegerischer Realität hervor, anschließend die Frage nach der inneren Disposition zum Sterben. Diese Abfolge lädt dazu ein, das eine im Licht des anderen zu lesen und die wechselseitigen Bezüge wahrzunehmen. Wer beiden Stücken folgt, erkennt, wie die Diagnose des öffentlichen Geschehens in eine Selbstbefragung umschlägt, die das Verhältnis zu Endlichkeit, Verletzbarkeit und Verantwortung neu konfiguriert.
Zielsetzung dieser Edition ist es, die Texte so zu präsentieren, dass ihre argumentative Genauigkeit und ihr nachdenklicher Ton zur Geltung kommen. Sie will die Leserinnen und Leser weder historisieren noch moralisieren, sondern ihnen ermöglichen, Freuds Überlegungen als nüchterne, zugleich engagierte Intervention zu erproben. Die Sammlung versteht sich als zuverlässige Grundlage für Studium, Unterricht und eigenständige Lektüre. Sie betont den Zusammenhang von individueller Psyche und öffentlicher Ordnung, ohne eine der beiden Ebenen zu übervorteilen. Dadurch entsteht ein Rahmen, in dem aus kritischer Distanz eine Haltung zur Gegenwart gewonnen werden kann.
Bei den hier versammelten Stücken handelt es sich um Essays. Sie sind weder fiktionale Erzählungen noch Briefe oder Tagebuchnotate, sondern ausgearbeitete argumentative Texte, die Beobachtung, Deutung und begriffliche Klärung verbinden. Der Essay erlaubt Freud, offene Fragen zu stellen, Spannungen auszuhalten und dennoch klare Positionen zu formulieren. Stilistisch stehen diese Texte zwischen kulturkritischer Betrachtung und psychologischer Analyse; sie wenden sich an eine gebildete Öffentlichkeit, die bereit ist, Selbstbilder zu prüfen. Die Form ist präzise, doch nicht akademisch verschlossen: Evidenz entsteht aus begrifflicher Strenge, anschaulichen Beispielen und konsequenter Folgerichtigkeit.
Die Enttäuschung des Krieges entfaltet eine Betrachtung darüber, wie kriegerische Ereignisse Maßstäbe erschüttern, auf die sich moderne Gesellschaften verlassen. Erwartete Sicherheiten erweisen sich als brüchig; moralische und rechtliche Selbstverständlichkeiten geraten in Konflikt mit den Tatsachen. Der Text nimmt eine beobachtende, prüfende Haltung ein. Er zeigt, wie öffentlich wirksame Ideale unter Druck geraten und wie sich aus der Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität ein Gefühl der Ernüchterung speist. Die Darlegung bleibt analytisch: Sie sucht keine tröstlichen Auswege, sondern arbeitet die Struktur der Enttäuschung frei, um deren Erkenntnispotenzial nutzbar zu machen.
Unser Verhältnis zum Tode wendet den Blick auf die innere Landschaft. Im Zentrum steht die Frage, wie Individuen und Kollektive den Tod geistig handhaben: als ferngehaltenes Tabu, als Grenze des Sagbaren oder als radikale Tatsache, die Lebensführung und Urteilskraft prägt. Der Essay beschreibt Tendenzen der Verdrängung ebenso wie Momente der Konfrontation. Er untersucht, wie Einstellungen zum Sterben Gefühle, Bindungen und Handlungen beeinflussen. Dabei entsteht ein Bild von Ambivalenzen: zwischen Nähe und Distanz, Angst und Klarheit, Bewahrung und Veränderung. Der Ton bleibt sachlich, der Anspruch ist aufklärerisch, ohne die Zumutungen der Endlichkeit zu beschönigen.
Gemeinsam zeichnen beide Texte ein Panorama grundlegender Themen: die Fragilität kultureller Ordnungen, die Spannkraft von Idealen, die Macht kollektiver Affekte und die Ausweichbewegungen des Einzelnen angesichts der Todesgewissheit. War und Tod erscheinen nicht als isolierte Phänomene, sondern als Prüfsteine für Selbstverständnisse. Was Menschen sich über sich selbst erzählen, wird am Ernstfall gemessen. Aus der Zusammenstellung entsteht ein Dialog von Außen- und Innenperspektive: Der Krieg stört die Welt, der Tod stört die Seele – und beides zwingt zur Klärung von Motiven, Maßstäben und Grenzen, die in ruhigeren Zeiten verborgen bleiben könnten.
Stilistisch kennzeichnet die Texte eine Verbindung aus Klarheit und Zurückhaltung. Die Argumentation schreitet Schritt für Schritt voran, vermeidet Überredung, sucht aber Entschiedenheit. Beispiele dienen der Erhellung, nicht der Ausschmückung. Metaphorik bleibt maßvoll und trägt die begriffliche Arbeit, anstatt sie zu ersetzen. Die Sätze sind so gebaut, dass sie Differenzen offenlegen: zwischen Wunsch und Realität, Ideal und Praxis, Gefühl und Urteil. Diese Nüchternheit ist keine Kälte, sondern eine Form der Sorgfalt. Sie erlaubt, schwierige Gegenstände so zu behandeln, dass Leserinnen und Leser ihre eigenen Kriterien in Prüfung nehmen können.
Die bleibende Bedeutung dieser Texte liegt in ihrer Fähigkeit, aktuelle Lagen verständlich zu machen, ohne an einen einzigen historischen Anlass gebunden zu sein. Kriegserfahrungen verändern sich, doch die Mechanismen der Erschütterung, der Ernüchterung und der Sinnsuche kehren wieder. Ebenso bleibt der Tod eine Grenze, an der Weltdeutungen sich bewähren oder scheitern. Die Essays bieten keine Therapie und keinen Trost, sondern Orientierung: Sie lehren, genauer hinzusehen und das Unbequeme nicht zu überspringen. Damit fördern sie eine Haltung, die sowohl für politisches Urteilen als auch für persönliche Entscheidungen tragfähig ist.
Inhaltlich verknüpfen die Texte individuelle Seelenvorgänge mit sozialen Prozessen. Sie zeigen, wie private Abwehrmechanismen öffentliche Wahrnehmungen färben und wie kollektive Erregung persönliche Maßstäbe verschiebt. Diese Verschränkung macht die Lektüre für verschiedene Felder fruchtbar: für psychologische Reflexion, historische Betrachtung, philosophische Ethik und kulturwissenschaftliche Analyse. Die Essays eröffnen kein abgeschlossenes System, sondern eine Methode des Fragens: Was trage ich bei zu den Bildern, die mich bestimmen? Wo täuschen mich affektive Bedürfnisse, wo schärfen sie meinen Blick? Aus solchen Fragen entsteht ein kritisches Bewusstsein, das Selbstbezug und Welterfahrung zusammen denkt.
Diese Einleitung ermutigt, die Texte langsam und im Zusammenhang zu lesen. Wer mit Die Enttäuschung des Krieges beginnt, gewinnt eine Außenansicht auf verletzte Ordnungen; wer mit Unser Verhältnis zum Tode fortfährt, vertieft die Innenansicht auf verletzliche Subjekte. Beide Perspektiven ergänzen sich. Die Sammlung will einen Raum der konzentrierten Aufmerksamkeit schaffen: ohne Ablenkung, ohne vorschnelle Vereinfachung. Sie schlägt vor, das Eigengewicht von Erfahrung anzuerkennen und dennoch auf begriffliche Klärung zu bestehen. So verstanden, sind die Essays nicht nur Dokumente ihrer Zeit, sondern Werkzeuge für Gegenwart und Zukunft – nüchtern, präzise, offen für Prüfung.
Autorenbiografie
Einleitung
Sigmund Freud (1856–1939) war ein österreichischer Neurologe und der Begründer der Psychoanalyse, einer Methode zur Erforschung und Behandlung seelischer Prozesse. Mit Schriften wie Die Traumdeutung, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, Totem und Tabu, Das Ich und das Es sowie Das Unbehagen in der Kultur prägte er das Verständnis des Unbewussten, der Trieb- und Konfliktdynamik und der Sprache der Symptome. Seine Begriffe und Deutungsweisen durchdrangen Medizin, Geisteswissenschaften und Kunst. Trotz anhaltender Kontroversen über Geltungsbereich und Wissenschaftlichkeit bleibt Freud eine zentrale Figur der Moderne, deren Werk Debatten über Subjektivität, Erinnerung und Kultur bis heute anregt.
Bildung und literarische Einflüsse
Freud wuchs in Wien auf und studierte ab den 1870er-Jahren Medizin an der Universität Wien. In den Laboren von Ernst Brücke erlernte er eine streng naturwissenschaftliche Methodik und publizierte neuroanatomische Studien, bevor er in die klinische Neurologie wechselte. Erfahrungen am Allgemeinen Krankenhaus und bei Theodor Meynert schärften sein Interesse an Hirn und Psyche. Ein Studienaufenthalt bei Jean-Martin Charcot in Paris machte ihn mit Hypnose und Hysterie vertraut und lenkte den Blick auf psychische Ursachen körperlicher Symptome. Zurück in Wien eröffnete er eine Praxis für Nervenkrankheiten und begann, Hypnose durch freie Assoziation und Gespräch zu ersetzen.
Sein Denken verband physiologische Strenge mit kulturkundlicher Belesenheit. Von Gustav Theodor Fechners Psychophysik und dem Helmholtz-Kreis übernahm er energetische Modelle; Charles Darwins Evolutionstheorie schärfte seinen Blick auf Anpassung, Triebe und Entwicklung. Philosophisch beeinflussten ihn Autoren, die über Bewusstsein und Wille nachdachten, während er literarische Stoffe als Deutungsfolie nutzte. Besonders Sophokles und Shakespeare lieferten Beispiele für Konflikt, Schuld und Verdrängung, die seine Fallgeschichten strukturieren. Freuds Stil ist zugleich klinisch und essayistisch: nüchterne Beobachtung, begriffliche Präzision und eine Vorliebe für Analogien aus Archäologie und Mythologie, die seine theoretischen Argumente anschaulich, aber nicht spekulativ begründen sollten.
Literarische Laufbahn
Die Anfänge seiner schriftstellerischen Laufbahn lagen in der Klinik: Studien über Hysterie, verfasst zusammen mit Josef Breuer, führte die Idee ein, dass Symptome eine psychische Geschichte haben. Daraus entwickelte Freud die Technik der freien Assoziation und das Konzept der Übertragung, die er fortan systematisch dokumentierte. Eine Phase intensiver Selbstanalyse begleitete diese theoretischen Schritte und lieferte Stoff für spätere Fallberichte. Zugleich löste er sich von der Hypnose, weil sie die Autonomie des Patienten begrenzte. In diesen frühen Texten verband sich ärztliche Protokollführung mit einer narrativen Darstellung, die innere Konflikte hinter sichtbaren Handlungen herausarbeitete.
Mit Die Traumdeutung setzte er um 1900 einen Markstein. Träume wurden nicht mehr als Reste zufälliger Erregungen gelesen, sondern als psychische Gebilde mit latentem Sinn, verdichtet und verschoben durch unbewusste Arbeit. Das Buch verband klinisches Material, Selbstbeobachtung und eine Theorie der Symbolik; es formulierte den Grundsatz, dass Träume die Erfüllung von Wünschen darstellen können. Die anfängliche Resonanz blieb begrenzt, doch im Kreis interessierter Ärztinnen und Ärzte galt es bald als kühner Paradigmenwechsel. Der nüchtern-analytische Ton, durchsetzt mit literarischen Beispielen, zeigt die Doppelrolle Freuds als Forscher und Stilist.
Es folgten Schriften, die den Alltag und die Sexualität neu deuteten. Zur Psychopathologie des Alltagslebens erklärte Fehlleistungen, Vergessen und Versprechen als Sinnträger. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten untersuchte komische Entlastungen. Besonders umstritten wurden die Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, die Entwicklungsstufen, infantile Sexualität und Perversionen systematisierten. Diese Texte stießen auf Ablehnung in Teilen der Medizin und der Öffentlichkeit, beförderten aber das Interesse an psychoanalytischer Behandlung. Zugleich verfeinerte Freud Technik und Rahmen der Analyse, dokumentierte Fälle und legte methodische Regeln für Abstinenz, Deutung und Übertragungsarbeit fest.
In den 1900er-Jahren formierte sich um Freud eine Diskussionsgemeinschaft, aus der die Wiener Psychoanalytische Vereinigung und internationale Verbünde hervorgingen. Kongresse, Zeitschriften und Lehranalysen gaben dem neuen Fach Konturen. Mit den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse präsentierte er seine Lehre einem größeren Publikum und systematisierte Themen von Träumen bis Neurosenlehre. Der Stil blieb bewusst didaktisch, doch durch Fallvignetten anschaulich. Die Ausbreitung der Bewegung brachte Übersetzungen, Anhängerinnen und Gegner. Öffentliche Debatten über Suggestion, Therapieerfolg und Ethik begleiteten die Institutionalisierung, während Freud an der theoretischen Kohärenz arbeitete und Abgrenzungen gegenüber konkurrierenden Schulen formulierte.
Nach dem Ersten Weltkrieg verdichtete Freud sein System zu metapsychologischen Modellen. Jenseits des Lustprinzips führte er neben dem Lustprinzip Wiederholungszwang und Todestrieb als Grenzbegriffe ein. Das Ich und das Es beschrieb die Instanzen Ich, Es und Über-Ich und bot eine neue Karte innerer Konflikte. Kulturtheoretische Arbeiten wie Totem und Tabu sowie Das Unbehagen in der Kultur erweiterten den Blick von der Klinik zur Gesellschaft. Die Resonanz reichte von begeisterter Rezeption in Geistes- und Kulturwissenschaften bis zu skeptischen Einwänden experimenteller Psychologie, die Replizierbarkeit und Belegbarkeit der Befunde bestritten.
Überzeugungen und Engagement
Freuds Überzeugungen wurzelten im Anspruch, psychische Phänomene gesetzmäßig zu erklären. Er hielt am Determinismus der Seelenvorgänge fest, betonte das Unbewusste als wirksame Ebene und sah Sexualität als zentral für Entwicklung und Symptomatik. Zugleich verstand er seine Arbeit als Aufklärung: Analyse sollte Leid durch Einsicht mindern und Selbsttäuschungen aufdecken. In Die Zukunft einer Illusion kritisierte er religiöse Heilsversprechen und plädierte für intellektuelle Redlichkeit. Als Kliniker bestand er auf Setting, Abstinenzregel und Vertraulichkeit. Organisatorisch förderte er Ausbildung, Supervision und internationale Vernetzung, um die Methode gegen Mode, Dogma und unkontrollierte Anwendung zu schützen.
Öffentlich bezog er Stellung, wenn es um Fehlrepräsentationen der Psychoanalyse, um Zensur oder um wissenschaftliche Standards ging. Er beteiligte sich an Kontroversen innerhalb der Bewegung, verteidigte Kernannahmen und tolerierte zugleich Weiterentwicklungen, solange sie mit dem klinischen Material korrespondierten. Konflikte mit abweichenden Schulen führten zu Abspaltungen, machten aber die Konturen seines Projekts deutlicher. In Aufsätzen und Vorträgen betonte er Verantwortung gegenüber Patientinnen und Patienten sowie die Notwendigkeit methodischer Nüchternheit. So verband sich sein theoretisches Programm mit einem praktischen Ethos der Sorgfalt, das die Ausbildung von Analytikerinnen und Analytikern nachhaltig prägte.
Letzte Jahre und Vermächtnis
In den späten 1920er- und 1930er-Jahren schrieb Freud trotz schwerer Erkrankung weiter. Eine Krebserkrankung im Mund- und Kieferbereich erforderte zahlreiche Eingriffe, ohne seine Produktivität völlig zu bremsen. Er veröffentlichte Das Unbehagen in der Kultur und Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; in Der Mann Moses und die monotheistische Religion kehrte er kultur- und religionspsychologischen Fragen zu. Nach der politischen Umwälzung in Österreich emigrierte er 1938 nach London, wo er seine Arbeit in reduziertem Umfang fortsetzte. Der Abriss der Psychoanalyse erschien kurz nach seinem Tod und bündelte zentrale Lehren.
Freud starb 1939 in London. Zeitgenössische Nachrufe würdigten Pionierarbeit und intellektuellen Mut, während Kritiker die Prüf- und Vorhersagekraft seiner Theorien bezweifelten. Langfristig prägte sein Werk Psychiatrie, Psychotherapie und Pädagogik ebenso wie Literaturwissenschaft, Anthropologie, Film- und Kulturtheorie. Begriffe wie Verdrängung, Übertragung, Abwehr, Ich und Es sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Spätere Schulen modifizierten Annahmen, doch die Idee eines dynamischen Unbewussten blieb wirkmächtig. Debatten über Evidenz, Hermeneutik und Ethik halten an. In der Gegenwart gilt Freud als Gründungsfigur, deren Schriften weiterhin gelesen, kritisiert und in interdisziplinären Kontexten produktiv genutzt werden.
Historischer Kontext
Die Entstehungszeit der hier betrachteten Texte fällt in eine Epoche tiefgreifender Umbrüche. Sigmund Freud, geboren am 6. Mai 1856 in Freiberg in Mähren (heute Příbor, Tschechien), lebte und arbeitete seit 1860 überwiegend in Wien, dem Zentrum der Habsburgermonarchie. Die Stadt war um 1900 ein Laboratorium der Moderne, geprägt von kultureller Blüte und politischer Polarisierung. Als jüdischer Intellektueller erlebte Freud den Widerspruch zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und gesellschaftlicher Reaktion. Der Krieg von 1914–1918 erschütterte die universalistischen Hoffnungen der Belle Époque und bildet den unmittelbaren Hintergrund für seine zeitdiagnostischen Überlegungen zu Gewalt, Enttäuschung und Vergänglichkeit.
Freuds wissenschaftliche Laufbahn wurzelt im medizinischen und naturwissenschaftlichen Milieu der Universität Wien. Nach dem Medizinstudium (Promotion 1881) arbeitete er bei Ernst Brücke am Physiologischen Institut und im neurologischen Umfeld von Theodor Meynert. Entscheidende Impulse erhielt er 1885/86 an der Pariser Salpêtrière unter Jean-Martin Charcot, wo er die Suggestion und die Dynamik hysterischer Symptome studierte. Diese Begegnungen prägten sein Verständnis unbewusster Prozesse und seelischer Konflikte. Die Verbindung von klinischer Beobachtung, kulturwissenschaftlicher Lektüre und skeptischer Aufklärung bildete die intellektuelle Grundlage, auf der Freud später gesellschaftliche Krisen, kollektive Affekte und Todeserfahrungen deutete.
Zwischen 1895 und 1905 konsolidierte Freud die Grundbegriffe der Psychoanalyse. Mit Josef Breuer publizierte er 1895 die Studien über Hysterie; 1900 erschien Die Traumdeutung, 1905 Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten sowie die Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Ab 1902 traf sich der Wiener Mittwoch-Verein, der 1908 als Wiener Psychoanalytische Vereinigung firmierte. Diese intellektuelle Infrastruktur erlaubte, individuelle Pathologien als Ausdruck universaler Konflikte zu erkennen. Noch vor dem Krieg verband Freud individuelle Ängste mit kulturellen Symbolisierungen; diese Perspektive erleichterte es, später kollektive Erschütterungen wie Kriegstraumata, Massenstimmungen und Todesnähe nicht nur politisch, sondern psychologisch zu interpretieren.
Das mitteleuropäische Fin de Siècle oszillierte zwischen Fortschrittsglauben und Dekadenzgefühl. Wien erlebte die Secession (gegründet 1897 mit Gustav Klimt), eine neue Architektur und eine Kaffeehauskultur, in der Debatten zwischen Naturwissenschaften, Philosophie und Literatur stattfanden. Gleichzeitig verschoben sich Machtkonstellationen: die Nationalitätenkonflikte der Habsburgermonarchie, der technische Militarismus und imperiale Rivalitäten bereiteten die Katastrophe vor. Die Illusion einer kontinuierlichen Zivilisierung Europas, genährt durch Industrialisierung, Medizin und bürgerliche Bildung, stand im Widerspruch zu den aggressiven Energien, die sich 1914 entluden. Diese Spannung prägte die Rezeption psychologischer Deutungen von Aggression, Trauer und gesellschaftlicher Desillusionierung.
Die politische Kultur Wiens war von Antisemitismus und Modernisierungskonflikten gezeichnet. Bürgermeister Karl Lueger (Amtszeit 1897–1910) verband soziale Rhetorik mit konfessioneller Ausgrenzung. Jüdische Bürgerinnen und Bürger erfuhren zugleich Aufstieg und Anfeindung. Für Freud bedeutete dies eine intellektuelle Selbstpositionierung zwischen Anpassung und Kritik. Der liberale Presse- und Verlagsraum – etwa die Neue Freie Presse – sowie die universalistische Bildungstradition ermöglichten Verbreitung, aber auch Polarisierung psychoanalytischer Ideen. Diese gesellschaftliche Gemengelage, in der kollektive Feindbilder und Integration konkurrierten, bildet einen wesentlichen Hintergrund für Überlegungen zu den Grenzen der Kultur und zur Fragilität zivilisatorischer Selbstbilder.
Vor 1914 internationalisierte sich die Psychoanalyse schnell. 1909 hielt Freud auf Einladung von G. Stanley Hall Vorträge an der Clark University in Worcester, Massachusetts; anwesend waren unter anderem Carl Gustav Jung und Sándor Ferenczi. 1910 wurde in Nürnberg die Internationale Psychoanalytische Vereinigung gegründet, deren erster Präsident Jung war. Frühzeitige Spaltungen – Alfred Adler verließ die Gruppe 1911, Jung trennte sich 1913 – zeigten die Spannweite theoretischer Deutungen. Gleichwohl entstand ein transnationales Netzwerk von Zeitschriften und Zirkeln, das während des Krieges belastet wurde. Dieser institutionelle Rahmen machte es möglich, Erfahrungen von Leid, Verlust und Gewalt in einen breiteren Diskurs einzubetten.
Die Vorkriegsjahre waren von Krisen begleitet, die den europäischen Frieden aushöhlten: die bosnische Annexionskrise 1908, die Balkankriege 1912–1913, das Wettrüsten zwischen Dreibund und Entente. Der Mord an Erzherzog Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo und die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli 1914 lösten eine Kettenreaktion aus. Der Übergang von einer rituellen Diplomatie zu industriell geführten Massenkriegen zeigte die Macht anonymer Strukturen über individuelle Rationalität. Diese Entgrenzung der Gewalt konfrontierte Intellektuelle mit der Frage, wie kulturelle Ideale gegenüber elementaren Triebkräften und massenpsychologischen Dynamiken bestehen können.
Wien erlebte ab 1914 Mobilmachung, Zensur und schrittweise Verarmung des zivilen Lebens. Das k.u.k. Kriegsüberwachungsamt regulierte die Presse; Nahrungsmittelrationierungen verschärften sich, besonders im Hungerwinter 1916/17. Verwundete aus den Fronten Galiziens oder vom Isonzo prägten das Stadtbild; Flüchtlingsbewegungen und Trauerfälle wurden alltäglich. Die neue Waffentechnik – Maschinengewehre, Artillerie, ab 1915 auch Giftgas an der Westfront – machte Massentod zum Normalfall. Die Diskrepanz zwischen heroischer Kriegspropaganda und der Erfahrung sinnlosen Sterbens unterminierte bürgerliche Sinnhorizonte. In dieser Atmosphäre gewann jede Reflexion über Enttäuschung, Todesnähe und kollektive Illusionen eine akute, existenzielle Relevanz.
Die Medizin sah sich mit Kriegsneurosen und Traumata konfrontiert. Debatten unter Neurologen und Psychiatern in Österreich, Deutschland und Großbritannien kreisten um Ursachen, Behandlung und soziale Anerkennung der Leiden. Begriffe wie Schreckneurose oder shell shock bezeichneten Symptome, die nicht durch organische Befunde erklärbar waren. Freud hatte bereits 1914 die Schrift Zur Einführung des Narzißmus vorgelegt und 1917 Trauer und Melancholie publiziert; 1920 folgte Jenseits des Lustprinzips. Diese Arbeiten ordneten Wiederholungszwang, Trauerarbeit und Aggression in ein größeres theoretisches Feld ein, das klinische Beobachtung mit kulturtheoretischen Thesen zur Todesproblematik verband.
Krieg und Zensur veränderten die Bedingungen wissenschaftlicher Öffentlichkeit. Psychoanalytische Zeitschriften wie Imago (gegründet 1912) und die Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse (seit 1913) mussten Logistikeinbrüche, Papiermangel und behördliche Kontrollen bewältigen. Gleichwohl zirkulierten Ideen im Netzwerk von Zürich, Budapest, Berlin, Wien und später auch London. Korrespondenzen wurden durch Postüberwachung verzögert. Die Kriegsjahre zwangen viele Autoren in einen nüchternen, oft essayistischen Ton, der kulturelle Beobachtung und klinische Evidenz verknüpfte. Diese Form der reflektierten Gegenwartsdiagnose trug dazu bei, persönliche Erfahrungen des Verlusts mit allgemeinen, auch politisch vermittelten Strukturen des Leidens in Beziehung zu setzen.
Das kulturelle Klima Mitteleuropas spiegelte die Katastrophe facettenreich. Karl Kraus arbeitete an Die letzten Tage der Menschheit (1918–1922), Thomas Mann verfasste Betrachtungen eines Unpolitischen (1918), Romain Rolland plädierte 1914 in Au-dessus de la mêlée für geistige Unabhängigkeit. An der Kunstfront starben 1918 Gustav Klimt (6. Februar) und Egon Schiele (31. Oktober, Spanische Grippe). Der Komponist Alban Berg begann 1914 an Wozzeck, einer Oper der Zerrissenheit. Diese intellektuelle und künstlerische Resonanz verstärkte das Bewusstsein, dass die Krise nicht nur militärisch, sondern zivilisatorisch war. Psychoanalytische Deutungen fanden in diesem Resonanzraum offene, aber kontroverse Aufnahme.
Der Staatszerfall 1918 veränderte alle Lebensbereiche. Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand unterzeichnet; am 12. November proklamierte Wien die Republik Deutschösterreich. Der Vertrag von Saint-Germain (10. September 1919) besiegelte die Auflösung der Habsburgermonarchie. Hyperinflation, Wohnungsnot und politische Polarisierung prägten die frühen 1920er Jahre. In einer Gesellschaft, die von Kriegsversehrten, Witwen, Waisen und massiver Arbeitslosigkeit geprägt war, verschob sich der öffentliche Diskurs von patriotischem Pathos zu sozialer Fürsorge und Erinnerungspolitik. Diese Umstände vertieften die Fragen nach dem Umgang mit Tod, Trauer und enttäuschten Erwartungen, die bereits während des Krieges virulent geworden waren.
Institutionell expandierte die Psychoanalyse nach 1918. 1919 entstand in Wien der Internationale Psychoanalytische Verlag, wesentlich getragen von Otto Rank; in Berlin wurde 1920 das Psychoanalytische Institut um Max Eitingon und Karl Abraham zum Zentrum klinischer Ausbildung. 1922 eröffnete in Wien das Ambulatorium, das psychoanalytische Behandlung auch sozial schwächeren Gruppen zugänglich machte. Der Patientenkreis veränderte sich: Kriegsneurosen, Verlusterfahrungen und soziale Not rückten in den Vordergrund. Die internationale Diskussion vertiefte die Verknüpfung individueller Konflikte mit kulturellen Rahmenbedingungen und lenkte den Blick auf die symbolischen Formen, mit denen Gesellschaften Gewalt und Tod zu bewältigen suchen.
In den 1920er und frühen 1930er Jahren verknüpfte Freud anthropologische und kulturkritische Perspektiven. Jenseits des Lustprinzips (1920) postulierte einen Todestrieb als Gegenpol zum Lebenstrieb; Das Unbehagen in der Kultur (1930) diskutierte die Spannungen zwischen Triebverzicht, Schuld und Aggression. 1932 tauschte Freud mit Albert Einstein im Rahmen des Völkerbund-Instituts in Paris Briefe unter dem Titel Warum Krieg, in denen die psychologischen Bedingungen kollektiver Gewalt reflektiert wurden. Diese Schriften bilden einen Kontinuumskontext, der die Erfahrungen der Kriegsjahre theoretisch bündelte und die Frage nach der Verletzbarkeit zivilisatorischer Ordnungen und der Persistenz destruktiver Impulse vertiefte.
Die politische Radikalisierung in Österreich und Deutschland gab den Fragen nach Gewalt und Tod eine neue Dringlichkeit. In Wien eskalierte 1934 der Bürgerkrieg; Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wurde am 25. Juli 1934 ermordet. Die autoritären Regime und der Antisemitismus prägten das öffentliche Leben. In Deutschland brannten am 10. Mai 1933 auch Freuds Bücher auf Scheiterhaufen. Diese Entwicklungen zeigten, wie fragile demokratische Institutionen und kulturelle Normen gegenüber massenpsychologischen Dynamiken und autoritären Mobilisierungen sind. Die psychoanalytische Diagnose der Ambivalenz von Kultur und Aggression erhielt so einen bedrückenden Realitätsbezug, der über die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs hinausreichte.
Mit dem Anschluss Österreichs am 12. März 1938 verschärfte sich die Verfolgung. Die Gestapo durchsuchte die Berggasse 19; Anna Freud wurde verhört. Dank Unterstützung von Ernest Jones und Prinzessin Marie Bonaparte emigrierte Freud am 4. Juni 1938 nach London. Dort starb er am 23. September 1939, kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, an den Folgen seiner Krebserkrankung. Die Emigration der Wiener Schule zerstreute das psychoanalytische Netzwerk, ermöglichte aber zugleich eine globale Rezeption. Der biografische Bogen von Wien nach London schärft den Blick dafür, wie eng persönliche Erfahrungen politischer Katastrophen und theoretische Fragestellungen verschränkt sind.
Die Rezeption psychoanalytischer Kriegs- und Todesreflexionen verlief vielstimmig. Zwischen den Weltkriegen und nach 1945 wurden Freuds Schriften in zahlreiche Sprachen übertragen, während totalitäre Regime sie bekämpften. Die Konzepte von Trauerarbeit, Aggression und kultureller Ambivalenz beeinflussten Debatten über Denkmalkultur, den Unbekannten Soldaten, kollektive Erinnerung und spätere Traumata, bis hin zu Analysen von Genozid und Exil. Die historischen Daten – 1914–1918, 1918–1920, 1932, 1938–1939 – markieren eine Erfahrungsspur, auf der Freuds Überlegungen zum Zerfall von Illusionen und zur Nähe des Todes ihre bleibende Aktualität erhielten und bis in die Gegenwart nachwirken.
Synopsis (Auswahl)
I. Die Enttäuschung des Krieges.
Freud beschreibt, wie der Krieg die Illusionen bürgerlicher Kultur zerstört: moralischer Fortschritt, Rechtsnormen und Humanität erweisen sich als fragil gegenüber Täuschung, Brutalisierung und Kollektivhass, gespeist aus elementaren aggressiven Trieben. Er deutet diese Enttäuschung als Konflikt zwischen kulturellen Forderungen und verdrängten Triebregungen und plädiert für eine illusionslose psychologische Betrachtung des Krieges.
II. Unser Verhältnis zum Tode.
Freud analysiert die Tendenz, den eigenen Tod psychisch zu verleugnen und Sterblichkeit im Alltag zu verdrängen, während der Krieg diese Abwehr durch die Allgegenwart des Sterbens durchkreuzt. Dadurch werden moralische Maßstäbe verschoben und ambivalente, oft verdrängte Todeswünsche gegenüber Fremden und Nahestehenden sichtbar.
Zeitgemäßes über Krieg und Tod
I. Die Enttäuschung des Krieges.
Von dem Wirbel dieser Kriegszeit gepackt[1q], einseitig unterrichtet, ohne Distanz von den großen Veränderungen[2q], die sich bereits vollzogen haben oder zu vollziehen beginnen, und ohne Witterung der sich gestaltenden Zukunft, werden wir selbst irre an der Bedeutung der Eindrücke, die sich uns aufdrängen, und an dem Wert der Urteile, die wir bilden. Es will uns scheinen, als hätte noch niemals ein Ereignis soviel kostbares Gemeingut der Menschheit zerstört, soviele der klarsten Intelligenzen verwirrt, so gründlich das Hohe erniedrigt. Selbst die Wissenschaft hat ihre leidenschaftslose Unparteilichkeit verloren;[3q] ihre aufs tiefste erbitterten Diener suchen ihr Waffen zu entnehmen, um einen Beitrag zur Bekämpfung des Feindes zu leisten. Der Anthropologe muß den Gegner für minderwertig und degeneriert erklären, der Psychiater die Diagnose seiner Geistes- oder Seelenstörung verkünden. Aber wahrscheinlich empfinden wir das Böse dieser Zeit unmäßig stark und haben kein Recht, es mit dem Bösen anderer Zeiten zu vergleichen, die wir nicht erlebt haben.
Der Einzelne, der nicht selbst ein Kämpfer und somit ein Partikelchen der riesigen Kriegsmaschinerie geworden ist, fühlt sich in seiner Orientierung verwirrt und in seiner Leistungsfähigkeit gehemmt. Ich meine, ihm wird jeder kleine Wink willkommen sein, der es ihm erleichtert, sich wenigstens in seinem eigenen Innern zurechtzufinden. Unter den Momenten, welche das seelische Elend der Daheimgebliebenen verschuldet haben[4q], und deren Bewältigung ihnen so schwierige Aufgaben stellt, möchte ich zwei hervorheben und an dieser Stelle behandeln: Die Enttäuschung, die dieser Krieg hervorgerufen hat[5q], und die veränderte Einstellung zum Tode, zu der er uns – wie alle anderen Kriege – nötigt.
Wenn ich von Enttäuschung rede, weiß jedermann sofort, was damit gemeint ist. Man braucht kein Mitleidsschwärmer zu sein, man kann die biologische und psychologische Notwendigkeit des Leidens für die Ökonomie des Menschenlebens einsehen und darf doch den Krieg in seinen Mitteln und Zielen verurteilen und das Aufhören der Kriege herbeisehnen. Man sagte sich zwar, die Kriege könnten nicht aufhören[6q], so lange die Völker unter so verschiedenartigen Existenzbedingungen leben, so lange die Wertungen des Einzellebens bei ihnen weit auseinandergehen, und so lange die Gehässigkeiten, welche sie trennen, so starke seelische Triebkräfte repräsentieren. Man war also darauf vorbereitet, daß Kriege zwischen den primitiven und den zivilisierten Völkern, zwischen den Menschenrassen, die durch die Hautfarbe voneinander geschieden werden, ja Kriege mit und unter den wenig entwickelten oder verwilderten Völkerindividuen Europas die Menschheit noch durch geraume Zeit in Anspruch nehmen werden. Aber man getraute sich etwas anderes zu hoffen. Von den großen weltbeherrschenden Nationen weißer Rasse[7q], denen die Führung des Menschengeschlechtes zugefallen ist, die man mit der Pflege weltumspannender Interessen beschäftigt wußte, deren Schöpfungen die technischen Fortschritte in der Beherrschung der Natur wie die künstlerischen und wissenschaftlichen Kulturwerte sind, von diesen Völkern hatte man erwartet, daß sie es verstehen würden, Mißhelligkeiten und Interessenkonflikte auf anderem Wege zum Austrag zu bringen. Innerhalb jeder dieser Nationen waren hohe sittliche Normen für den Einzelnen aufgestellt worden, nach denen er seine Lebensführung einzurichten hatte, wenn er an der Kulturgemeinschaft teilnehmen wollte. Diese oft überstrengen Vorschriften forderten viel von ihm, eine ausgiebige Selbstbeschränkung, einen weitgehenden Verzicht auf Triebbefriedigung. Es war ihm vor allem versagt, sich der außerordentlichen Vorteile zu bedienen, die der Gebrauch von Lüge und Betrug im Wettkampf mit den Nebenmenschen schafft. Der Kulturstaat hielt diese sittlichen Normen für die Grundlage seines Bestandes, er schritt ernsthaft ein, wenn man sie anzutasten wagte, erklärte es oft für untunlich, sie auch nur einer Prüfung durch den kritischen Verstand zu unterziehen. Es war also anzunehmen, daß er sie selbst respektieren wolle und nichts gegen sie zu unternehmen gedenke, wodurch er der Begründung seiner eigenen Existenz widersprochen hätte. Endlich konnte man zwar die Wahrnehmung machen, daß es innerhalb dieser Kulturnationen gewisse eingesprengte Völkerreste gäbe, die ganz allgemein unliebsam wären und darum nur widerwillig, auch nicht im vollen Umfange, zur Teilnahme an der gemeinsamen Kulturarbeit zugelassen würden, für die sie sich als genug geeignet erwiesen hatten. Aber die großen Völker selbst, konnte man meinen, hätten soviel Verständnis für ihre Gemeinsamkeiten und soviel Toleranz für ihre Verschiedenheiten erworben, daß »fremd« und »feindlich« nicht mehr wie noch im klassischen Altertum für sie zu einem Begriff verschmelzen durften.
Vertrauend auf diese Einigung der Kulturvölker haben ungezählte Menschen ihren Wohnort in der Heimat gegen den Aufenthalt in der Fremde eingetauscht und ihre Existenz an die Verkehrsbeziehungen zwischen den befreundeten Völkern geknüpft. Wen aber die Not des Lebens nicht ständig an die nämliche Stelle bannte, der konnte sich aus allen Vorzügen und Reizen der Kulturländer ein neues größeres Vaterland zusammensetzen, in dem er sich ungehemmt und unverdächtigt erging. Er genoß so das blaue und das graue Meer, die Schönheit der Schneeberge und die der grünen Wiesenflächen, den Zauber des nordischen Waldes und die Pracht der südlichen Vegetation, die Stimmung der Landschaften, auf denen große historische Erinnerungen ruhen, und die Stille der unberührten Natur. Dies neue Vaterland war für ihn auch ein Museum[8q], erfüllt mit allen Schätzen, welche die Künstler der Kulturmenschheit seit vielen Jahrhunderten geschaffen und hinterlassen hatten. Während er von einem Saal dieses Museums in einen anderen wanderte, konnte er in parteiloser Anerkennung feststellen, was für verschiedene Typen von Vollkommenheit Blutmischung, Geschichte und die Eigenart der Mutter Erde an seinen weiteren Kompatrioten ausgebildet hatten. Hier war die kühle unbeugsame Energie aufs höchste entwickelt, dort die graziöse Kunst, das Leben zu verschönern, anderswo der Sinn für Ordnung und Gesetz oder andere der Eigenschaften, die den Menschen zum Herrn der Erde gemacht haben.
Vergessen wir auch nicht daran, daß jeder Kulturweltbürger sich einen besonderen »Parnaß« und eine »Schule von Athen« geschaffen hatte. Unter den großen Denkern, Dichtern, Künstlern aller Nationen, hatte er die ausgewählt, denen er das Beste zu schulden vermeinte, was ihm an Lebensgenuß und Lebensverständnis zugänglich geworden war, und sie den unsterblichen Alten in seiner Verehrung zugesellt wie den vertrauten Meistern seiner eigenen Zunge. Keiner von diesen Großen war ihm darum fremd erschienen[9q], weil er in anderer Sprache geredet hatte, weder der unvergleichliche Ergründer der menschlichen Leidenschaften, noch der schönheitstrunkene Schwärmer oder der gewaltig drohende Prophet, der feinsinnige Spötter, und niemals warf er sich dabei vor, abtrünnig geworden zu sein der eigenen Nation und der geliebten Muttersprache.
Der Genuß der Kulturgemeinschaft wurde gelegentlich durch Stimmen gestört[10q], welche warnten, daß infolge altüberkommener Differenzen Kriege auch unter den Mitgliedern derselben unvermeidlich wären. Man wollte nicht daran glauben, aber wie stellte man sich einen solchen Krieg vor, wenn es dazu kommen sollte? Als eine Gelegenheit die Fortschritte im Gemeingefühl der Menschen aufzuzeigen seit jener Zeit, da die griechischen Amphiktyonien verboten hatten, eine dem Bündnis angehörige Stadt zu zerstören, ihre Ölbäume umzuhauen und ihr das Wasser abzuschneiden. Als einen ritterlichen Waffengang, der sich darauf beschränken wollte, die Überlegenheit des einen Teils festzustellen, unter möglichster Vermeidung schwerer Leiden, die zu dieser Entscheidung nichts beitragen könnten, mit voller Schonung für den Verwundeten, der aus dem Kampf ausscheiden muß, und für den Arzt und Pfleger, der sich seiner Herstellung widmet. Natürlich mit allen Rücksichten für den nicht kriegführenden Teil der Bevölkerung, für die Frauen, die dem Kriegshandwerk ferne bleiben, und für die Kinder, die, herangewachsen, einander von beiden Seiten Freunde und Mithelfer werden sollen. Auch mit Erhaltung all der internationalen Unternehmungen und Institutionen, in denen sich die Kulturgemeinschaft der Friedenszeit verkörpert hatte.
Ein solcher Krieg hätte immer noch genug des Schrecklichen und schwer zu Ertragenden enthalten, aber er hätte die Entwicklung ethischer Beziehungen zwischen den Großindividuen der Menschheit, den Völkern und Staaten, nicht unterbrochen.
Der Krieg, an den wir nicht glauben wollten, brach nun aus und er brachte die – Enttäuschung[11q]. Er ist nicht nur blutiger und verlustreicher als einer der Kriege vorher, infolge der mächtig vervollkommneten Waffen des Angriffs und der Verteidigung, sondern mindestens ebenso grausam, erbittert, schonungslos wie irgend ein früherer. Er setzt sich über alle Einschränkungen hinaus[12q], zu denen man sich in friedlichen Zeiten verpflichtet, die man das Völkerrecht genannt hatte, anerkennt nicht die Vorrechte des Verwundeten und des Arztes, die Unterscheidung des friedlichen und des kämpfenden Teils der Bevölkerung, die Ansprüche des Privateigentums. Er wirft nieder, was ihm im Wege steht, in blinder Wut, als sollte es keine Zukunft und keinen Frieden unter den Menschen nach ihm geben. Er zerreißt alle Bande der Gemeinschaft unter den miteinander ringenden Völkern und droht eine Erbitterung zu hinterlassen, welche eine Wiederanknüpfung derselben für lange Zeit unmöglich machen wird.
Er brachte auch das kaum begreifliche Phänomen zum Vorschein, daß die Kulturvölker einander so wenig kennen und verstehen, daß sich das eine mit Haß und Abscheu gegen das andere wenden kann. Ja daß eine der großen Kulturnationen so allgemein mißliebig ist, daß der Versuch gewagt werden kann, sie als »barbarisch« von der Kulturgemeinschaft auszuschließen, obwohl sie ihre Eignung durch die großartigsten Beitragsleistungen längst erwiesen hat. Wir leben der Hoffnung, eine unparteiische Geschichtsschreibung werde den Nachweis erbringen, daß gerade diese Nation, die, in deren Sprache wir schreiben, für deren Sieg unsere Lieben kämpfen, sich am wenigsten gegen die Gesetze der menschlichen Gesittung vergangen habe, aber wer darf in solcher Zeit als Richter auftreten in eigener Sache?
Völker werden ungefähr durch die Staaten, die sie bilden, repräsentiert; diese Staaten durch die Regierungen, die sie leiten. Der einzelne Volksangehörige kann in diesem Krieg mit Schreck feststellen, was sich ihm gelegentlich schon in Friedenszeiten aufdrängen wollte, daß der Staat dem Einzelnen den Gebrauch des Unrechts untersagt hat, nicht weil er es abschaffen, sondern weil er es monopolisieren will wie Salz und Tabak. Der kriegführende Staat gibt sich jedes Unrecht, jede Gewalttätigkeit frei, die den Einzelnen entehren würde. Er bedient sich nicht nur der erlaubten List, sondern auch der bewußten Lüge und des absichtlichen Betruges gegen den Feind, und dies zwar in einem Maße, welches das in früheren Kriegen Gebräuchliche zu übersteigen scheint. Der Staat fordert das Äußerste an Gehorsam und Aufopferung von seinen Bürgern, entmündigt sie aber dabei durch ein Übermaß von Verheimlichung und eine Zensur der Mitteilung und Meinungsäußerung, welche die Stimmung der so intellektuell Unterdrückten wehrlos macht gegen jede ungünstige Situation und jedes wüste Gerücht. Er löst sich los von Zusicherungen und Verträgen, durch die er sich gegen andere Staaten gebunden hatte, bekennt sich ungescheut zu seiner Habgier und seinem Machtstreben, die dann der Einzelne aus Patriotismus gutheißen soll.
Man wende nicht ein, daß der Staat auf den Gebrauch des Unrechts nicht verzichten kann, weil er sich dadurch in Nachteil setzte. Auch für den Einzelnen ist die Befolgung der sittlichen Normen, der Verzicht auf brutale Machtbetätigung in der Regel sehr unvorteilhaft, und der Staat zeigt sich nur selten dazu fähig, den Einzelnen für das Opfer zu entschädigen, das er von ihm gefordert hat. Man darf sich auch nicht darüber verwundern, daß die Lockerung aller sittlichen Beziehungen zwischen den Großindividuen der Menschheit eine Rückwirkung auf die Sittlichkeit der Einzelnen geäußert hat, denn unser Gewissen ist nicht der unbeugsame Richter, für den die Ethiker es ausgeben, es ist in seinem Ursprunge »soziale Angst« und nichts anderes. Wo die Gemeinschaft den Vorwurf aufhebt, hört auch die Unterdrückung der bösen Gelüste auf, und die Menschen begehen Taten von Grausamkeit, Tücke, Verrat und Roheit, deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Niveau für unvereinbar gehalten hätte.
So mag der Kulturweltbürger, den ich vorhin eingeführt habe, ratlos dastehen in der ihm fremd gewordenen Welt, sein großes Vaterland zerfallen, die gemeinsamen Besitztümer verwüstet, die Mitbürger entzweit und erniedrigt!
Zur Kritik seiner Enttäuschung wäre einiges zu bemerken. Sie ist, strenge genommen, nicht berechtigt, denn sie besteht in der Zerstörung einer Illusion. Illusionen empfehlen sich uns dadurch, daß sie Unlustgefühle ersparen und uns an ihrer Statt Befriedigungen genießen lassen. Wir müssen es dann ohne Klage hinnehmen, daß sie irgend einmal mit einem Stück der Wirklichkeit zusammenstoßen, an dem sie zerschellen.
Zweierlei in diesem Kriege hat unsere Enttäuschung rege gemacht: die geringe Sittlichkeit der Staaten nach außen, die sich nach innen als die Wächter der sittlichen Normen gebärden, und die Brutalität im Benehmen der Einzelnen, denen man als Teilnehmer an der höchsten menschlichen Kultur ähnliches nicht zugetraut hat.
Beginnen wir mit dem zweiten Punkt und versuchen wir es, die Anschauung, die wir kritisieren wollen, in einen einzigen knappen Satz zu fassen. Wie stellt man sich denn eigentlich den Vorgang vor, durch welchen ein einzelner Mensch zu einer höheren Stufe von Sittlichkeit gelangt? Die erste Antwort wird wohl lauten: Er ist eben von Geburt und von Anfang an gut und edel. Sie soll hier weiter nicht berücksichtigt werden. Eine zweite Antwort wird auf die Anregung eingehen, daß hier ein Entwicklungsvorgang vorliegen müsse, und wird wohl annehmen, diese Entwicklung bestehe darin, daß die bösen Neigungen des Menschen in ihm ausgerottet und unter dem Einfluß von Erziehung und Kulturumgebung durch Neigungen zum Guten ersetzt werden. Dann darf man sich allerdings verwundern, daß bei dem so Erzogenen das Böse wieder so tatkräftig zum Vorschein kommt.
Aber diese Antwort enthält auch den Satz, dem wir widersprechen wollen. In Wirklichkeit gibt es keine »Ausrottung« des Bösen. Die psychologische – im strengeren Sinne die psychoanalytische – Untersuchung zeigt vielmehr, daß das tiefste Wesen des Menschen in Triebregungen besteht, die elementarer Natur, bei allen Menschen gleichartig sind und auf die Befriedigung gewisser ursprünglicher Bedürfnisse zielen. Diese Triebregungen sind an sich weder gut noch böse. Wir klassifizieren sie und ihre Äußerungen in solcher Weise je nach ihrer Beziehung zu den Bedürfnissen und Anforderungen der menschlichen Gemeinschaft. Zuzugeben ist, daß alle die Regungen, welche von der Gesellschaft als böse verpönt werden – nehmen wir als Vertretung derselben die eigensüchtigen und die grausamen – sich unter diesen primitiven befinden.
Diese primitiven Regungen legen einen langen Entwicklungsweg zurück, bis sie zur Betätigung beim Erwachsenen zugelassen werden. Sie werden gehemmt, auf andere Ziele und Gebiete gelenkt, gehen Verschmelzungen miteinander ein, wechseln ihre Objekte, wenden sich zum Teil gegen die eigene Person. Reaktionsbildungen gegen gewisse Triebe täuschen die inhaltliche Verwandlung derselben vor, als ob aus Egoismus – Altruismus, aus Grausamkeit – Mitleid geworden wäre. Diesen Reaktionsbildungen kommt zugute, daß manche Triebregungen fast von Anfang an in Gegensatzpaaren auftreten, ein sehr merkwürdiges und der populären Kenntnis fremdes Verhältnis, das man die »Gefühlsambivalenz« benannt hat. Am leichtesten zu beobachten und vom Verständnis zu bewältigen ist die Tatsache, daß starkes Lieben und starkes Hassen so häufig miteinander bei derselben Person vereint vorkommen. Die Psychoanalyse fügt dem hinzu, daß die beiden entgegengesetzten Gefühlsregungen nicht selten auch die nämliche Person zum Objekt nehmen.
Erst nach Überwindung all solcher »Triebschicksale« stellt sich das heraus, was man den Charakter eines Menschen nennt, und was mit »gut« oder »böse« bekanntlich nur sehr unzureichend klassifiziert werden kann. Der Mensch ist selten im ganzen gut oder böse, meist »gut« in dieser Relation, böse in einer anderen oder »gut« unter solchen äußeren Bedingungen, unter anderen entschieden »böse«. Interessant ist die Erfahrung, daß die kindliche Präexistenz starker »böser« Regungen oft geradezu die Bedingung wird für eine besonders deutliche Wendung des Erwachsenen zum »Guten«. Die stärksten kindlichen Egoisten können die hilfreichsten und aufopferungsfähigsten Bürger werden; die meisten Mitleidschwärmer, Menschenfreunde, Tierschützer haben sich aus kleinen Sadisten und Tierquälern entwickelt.
Die Umbildung der »bösen« Triebe ist das Werk zweier im gleichen Sinne wirkenden Faktoren, eines inneren und eines äußeren. Der innere Faktor besteht in der Beeinflussung der bösen – sagen wir: eigensüchtigen – Triebe durch die Erotik, das Liebesbedürfnis des Menschen im weitesten Sinne genommen. Durch die Zumischung der erotischen Komponenten werden die eigensüchtigen Triebe in soziale umgewandelt. Man lernt das Geliebtwerden als einen Vorteil schätzen, wegen dessen man auf andere Vorteile verzichten darf. Der äußere Faktor ist der Zwang der Erziehung, welche die Ansprüche der kulturellen Umgebung vertritt, und die dann durch die direkte Einwirkung des Kulturmilieus fortgesetzt wird. Kultur ist durch Verzicht auf Triebbefriedigung gewonnen worden und fordert von jedem neu Ankommenden, daß er denselben Triebverzicht leiste. Während des individuellen Lebens findet eine beständige Umsetzung von äußerem Zwang in inneren Zwang statt. Die Kultureinflüsse leiten dazu an, daß immer mehr von den eigensüchtigen Strebungen durch erotische Zusätze in altruistische, soziale verwandelt werden. Man darf endlich annehmen, daß aller innere Zwang, der sich in der Entwicklung des Menschen geltend macht, ursprünglich, d.h. in der Menschheitsgeschichte nur äußerer Zwang war. Die Menschen, die heute geboren werden, bringen ein Stück Neigung (Disposition) zur Umwandlung der egoistischen in soziale Triebe als ererbte Organisation mit, die auf leichte Anstöße hin diese Umwandlung durchführt. Ein anderes Stück dieser Triebumwandlung muß im Leben selbst geleistet werden. In solcher Art steht der einzelne Mensch nicht nur unter der Einwirkung seines gegenwärtigen Kulturmilieus, sondern unterliegt auch dem Einflusse der Kulturgeschichte seiner Vorfahren.
Heißen wir die einem Menschen zukommende Fähigkeit zur Umbildung der egoistischen Triebe unter dem Einfluß der Erotik seine Kultureignung, so können wir aussagen, daß dieselbe aus zwei Anteilen besteht, einem angeborenen und einem im Leben erworbenen, und daß das Verhältnis der beiden zueinander und zu dem unverwandelt gebliebenen Anteil des Trieblebens ein sehr variables ist.
Im allgemeinen sind wir geneigt, den angeborenen Anteil zu hoch zu veranschlagen, und überdies laufen wir Gefahr, die gesamte Kultureignung in ihrem Verhältnis zum primitiv gebliebenen Triebleben zu überschätzen, d.h. wir werden dazu verleitet, die Menschen »besser« zu beurteilen, als sie in Wirklichkeit sind. Es besteht nämlich noch ein anderes Moment, welches unser Urteil trübt und das Ergebnis im günstigen Sinne verfälscht.
Die Triebregungen eines anderen Menschen sind unserer Wahrnehmung natürlich entrückt. Wir schließen auf sie aus seinen Handlungen und seinem Benehmen, welche wir auf Motive aus seinem Triebleben zurückführen. Ein solcher Schluß geht notwendigerweise in einer Anzahl von Fällen irre. Die nämlichen, kulturell »guten« Handlungen können das einemal von »edlen« Motiven herstammen, das anderemal nicht. Die theoretischen Ethiker heißen nur solche Handlungen »gut«, welche der Ausdruck guter Triebregungen sind, den anderen versagen sie ihre Anerkennung. Die von praktischen Absichten geleitete Gesellschaft kümmert sich aber im ganzen um diese Unterscheidung nicht; sie begnügt sich damit, daß ein Mensch sein Benehmen und seine Handlungen nach den kulturellen Vorschriften richte, und fragt wenig nach seinen Motiven.
Wir haben gehört, daß der äußere Zwang, den Erziehung und Umgebung auf den Menschen üben, eine weitere Umbildung seines Trieblebens zum Guten, eine Wendung vom Egoismus zum Altruismus herbeiführt. Aber dies ist nicht die notwendige oder regelmäßige Wirkung des äußeren Zwanges. Erziehung und Umgebung haben nicht nur Liebesprämien anzubieten, sondern arbeiten auch mit Vorteilsprämien anderer Art, mit Lohn und Strafen. Sie können also die Wirkung äußern, daß der ihrem Einfluß Unterliegende sich zum guten Handeln im kulturellen Sinne entschließt, ohne daß sich eine Triebveredlung, eine Umsetzung egoistischer in soziale Neigungen, in ihm vollzogen hat. Der Erfolg wird im groben derselbe sein; erst unter besonderen Verhältnissen wird es sich zeigen, daß der eine immer gut handelt, weil ihn seine Triebneigungen dazu nötigen, der andere nur gut ist, weil, insolange und insoweit dies kulturelle Verhalten seinen eigensüchtigen Absichten Vorteile bringt. Wir aber werden bei oberflächlicher Bekanntschaft mit den Einzelnen kein Mittel haben, die beiden Fälle zu unterscheiden, und gewiß durch unseren Optimismus verführt werden, die Anzahl der kulturell veränderten Menschen arg zu überschätzen.
Die Kulturgesellschaft, die die gute Handlung fordert und sich um die Triebbegründung derselben nicht kümmert, hat also eine große Zahl von Menschen zum Kulturgehorsam gewonnen, die dabei nicht ihrer Natur folgen. Durch diesen Erfolg ermutigt, hat sie sich verleiten lassen, die sittlichen Anforderungen möglichst hoch zu spannen und so ihre Teilnehmer zu noch weiterer Entfernung von ihrer Triebveranlagung gezwungen. Diesen ist nun eine fortgesetzte Triebunterdrückung auferlegt, deren Spannung sich in den merkwürdigsten Reaktions- und Kompensationserscheinungen kundgibt. Auf dem Gebiete der Sexualität, wo solche Unterdrückung am wenigsten durchzuführen ist, kommt es so zu den Reaktionserscheinungen der neurotischen Erkrankungen. Der sonstige Druck der Kultur zeitigt zwar keine pathologische Folgen, äußert sich aber in Charakterverbildungen und in der steten Bereitschaft der gehemmten Triebe, bei passender Gelegenheit zur Befriedigung durchzubrechen. Wer so genötigt wird, dauernd im Sinne von Vorschriften zu reagieren, die nicht der Ausdruck seiner Triebneigungen sind, der lebt, psychologisch verstanden, über seine Mittel und darf objektiv als Heuchler bezeichnet werden, gleichgiltig ob ihm diese Differenz klar bewußt worden ist oder nicht. Es ist unleugbar, daß unsere gegenwärtige Kultur die Ausbildung dieser Art von Heuchelei in außerordentlichem Umfange begünstigt. Man könnte die Behauptung wagen, sie sei auf solcher Heuchelei aufgebaut und müßte sich tiefgreifende Abänderungen gefallen lassen, wenn es die Menschen unternehmen würden, der psychologischen Wahrheit nachzuleben. Es gibt also ungleich mehr Kulturheuchler als wirklich kulturelle Menschen, ja man kann den Standpunkt diskutieren, ob ein gewisses Maß von Kulturheuchelei nicht zur Aufrechthaltung der Kultur unerläßlich sei, weil die bereits organisierte Kultureignung der heute lebenden Menschen vielleicht für diese Leistung nicht zureichen würde. Anderseits bietet die Aufrechthaltung der Kultur auch auf so bedenklicher Grundlage die Aussicht, bei jeder neuen Generation eine weitergehende Triebumbildung als Trägerin einer besseren Kultur anzubahnen.
Den bisherigen Erörterungen entnehmen wir bereits den einen Trost, daß unsere Kränkung und schmerzliche Enttäuschung wegen des unkulturellen Benehmens unserer Weltmitbürger in diesem Kriege unberechtigt waren. Sie beruhten auf einer Illusion, der wir uns gefangen gaben. In Wirklichkeit sind sie nicht so tief gesunken, wie wir fürchten, weil sie gar nicht so hoch gestiegen waren, wie wirs von ihnen glaubten. Daß die menschlichen Großindividuen, die Völker und Staaten, die sittlichen Beschränkungen gegeneinander fallen ließen, wurde ihnen zur begreiflichen Anregung, sich für eine Weile dem bestehenden Drucke der Kultur zu entziehen und ihren zurückgehaltenen Trieben vorübergehend Befriedigung zu gönnen. Dabei geschah ihrer relativen Sittlichkeit innerhalb des eigenen Volkstums wahrscheinlich kein Abbruch.
Wir können uns aber das Verständnis der Veränderung, die der Krieg an unseren früheren Kompatrioten zeigt, noch vertiefen und empfangen dabei eine Warnung, kein Unrecht an ihnen zu begehen. Seelische Entwicklungen besitzen nämlich eine Eigentümlichkeit, welche sich bei keinem anderen Entwicklungsvorgang mehr vorfindet. Wenn ein Dorf zur Stadt, ein Kind zum Mann heranwächst, so gehen dabei Dorf und Kind in Stadt und Mann unter. Nur die Erinnerung kann die alten Züge in das neue Bild einzeichnen; in Wirklichkeit sind die alten Materialien oder Formen beseitigt und durch neue ersetzt worden. Anders geht es bei einer seelischen Entwicklung zu. Man kann den nicht zu vergleichenden Sachverhalt nicht anders beschreiben als durch die Behauptung, daß jede frühere Entwicklungsstufe neben der späteren, die aus ihr geworden ist, erhalten bleibt; die Sukzession bedingt eine Koexistenz mit, obwohl es doch dieselben Materialien sind, an denen die ganze Reihenfolge von Veränderungen abgelaufen ist. Der frühere seelische Zustand mag sich jahrelang nicht geäußert haben, er bleibt doch soweit bestehen, daß er eines Tages wiederum die Äußerungsform der seelischen Kräfte werden kann, und zwar die einzige, als ob alle späteren Entwicklungen annulliert, rückgängig gemacht worden wären. Diese außerordentliche Plastizität der seelischen Entwicklungen ist in ihrer Richtung nicht unbeschränkt; man kann sie als eine besondere Fähigkeit zur Rückbildung – Regression – bezeichnen, denn es kommt wohl vor, daß eine spätere und höhere Entwicklungsstufe, die verlassen wurde, nicht wieder erreicht werden kann. Aber die primitiven Zustände können immer wieder hergestellt werden; das primitive Seelische ist im vollsten Sinne unvergänglich.
Die sogenannten Geisteskrankheiten müssen beim Laien den Eindruck hervorrufen, daß das Geistes- und Seelenleben der Zerstörung anheimgefallen sei. In Wirklichkeit betrifft die Zerstörung nur spätere Erwerbungen und Entwicklungen. Das Wesen der Geisteskrankheit besteht in der Rückkehr zu früheren Zuständen des Affektlebens und der Funktion. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die Plastizität des Seelenlebens gibt der Schlafzustand, den wir allnächtlich anstreben. Seitdem wir auch tolle und verworrene Träume zu übersetzen verstehen, wissen wir, daß wir mit jedem Einschlafen unsere mühsam erworbene Sittlichkeit wie ein Gewand von uns werfen – um es am Morgen wieder anzutun. Diese Entblößung ist natürlich ungefährlich, weil wir durch den Schlafzustand gelähmt, zur Inaktivität verurteilt sind. Nur der Traum kann von der Regression unseres Gefühllebens auf eine der frühesten Entwicklungsstufen Kunde geben. So ist es z.B. bemerkenswert, daß alle unsere Träume von rein egoistischen Motiven beherrscht werden. Einer meiner englischen Freunde vertrat einmal diesen Satz vor einer wissenschaftlichen Versammlung in Amerika, worauf ihm eine anwesende Dame die Bemerkung machte, das möge vielleicht für Österreich richtig sein, aber sie dürfe von sich und ihren Freunden behaupten, daß sie auch noch im Traume altruistisch fühlen. Mein Freund, obwohl selbst ein Angehöriger der englischen Rasse, mußte auf Grund seiner eigenen Erfahrungen in der Traumanalyse der Dame energisch widersprechen: Im Traume sei auch die edle Amerikanerin ebenso egoistisch wie der Österreicher.
Es kann also auch die Triebumbildung, auf welcher unsere Kultureignung beruht, durch Einwirkungen des Lebens – dauernd oder zeitweilig – rückgängig gemacht werden. Ohne Zweifel gehören die Einflüsse des Krieges zu den Mächten, welche solche Rückbildung erzeugen können, und darum brauchen wir nicht allen jenen, die sich gegenwärtig unkulturell benehmen, die Kultureignung abzusprechen, und dürfen erwarten, daß sich ihre Triebveredlung in ruhigeren Zeiten wieder herstellen wird.
Vielleicht hat uns aber ein anderes Symptom bei unseren Weltmitbürgern nicht weniger überrascht und geschreckt als das so schmerzlich empfundene Herabsinken von ihrer ethischen Höhe. Ich meine die Einsichtslosigkeit, die sich bei den besten Köpfen zeigt, ihre Verstocktheit, Unzugänglichkeit gegen die eindringlichsten Argumente, ihre kritiklose Leichtgläubigkeit für die anfechtbarsten Behauptungen. Dies ergibt freilich ein trauriges Bild, und ich will ausdrücklich betonen, daß ich keineswegs als verblendeter Parteigänger alle intellektuelle Verfehlungen nur auf einer der beiden Seiten finde. Allein diese Erscheinung ist noch leichter zu erklären und weit weniger bedenklich als die vorhin gewürdigte. Menschenkenner und Philosophen haben uns längst belehrt, daß wir Unrecht daran tun, unsere Intelligenz als selbständige Macht zu schätzen und ihre Abhängigkeit vom Gefühlsleben zu übersehen. Unser Intellekt könne nur verläßlich arbeiten, wenn er den Einwirkungen starker Gefühlsregungen entrückt sei; im gegenteiligen Falle benehme er sich einfach wie ein Instrument zu Handen eines Willens und liefere das Resultat, das ihm von diesem aufgetragen sei. Logische Argumente seien also ohnmächtig gegen affektive Interessen, und darum sei das Streiten mit Gründen, die nach Falstaffs Wort so gemein sind wie Brombeeren, in der Welt der Interessen so unfruchtbar. Die psychoanalytische Erfahrung hat diese Behauptung womöglich noch unterstrichen. Sie kann alle Tage zeigen, daß sich die scharfsinnigsten Menschen plötzlich einsichtslos wie Schwachsinnige benehmen, sobald die verlangte Einsicht einem Gefühlswiderstand bei ihnen begegnet, aber auch alles Verständnis wieder erlangen, wenn dieser Widerstand überwunden ist. Die logische Verblendung, die dieser Krieg oft gerade bei den besten unserer Mitbürger hervorgezaubert hat, ist also ein sekundäres Phänomen, eine Folge der Gefühlserregung, und hoffentlich dazu bestimmt, mit ihr zu verschwinden.
Wenn wir solcher Art unsere uns entfremdeten Mitbürger wieder verstehen, werden wir die Enttäuschung, die uns die Großindividuen der Menschheit, die Völker, bereitet haben, um vieles leichter ertragen, denn an diese dürfen wir nur weit bescheidenere Ansprüche stellen. Dieselben wiederholen vielleicht die Entwicklung der Individuen und treten uns heute noch auf sehr primitiven Stufen der Organisation, der Bildung höherer Einheiten, entgegen. Dem entsprechend ist das erziehliche Moment des äußeren Zwanges zur Sittlichkeit, welches wir beim Einzelnen so wirksam fanden, bei ihnen noch kaum nachweisbar. Wir hatten zwar gehofft, daß die großartige, durch Verkehr und Produktion hergestellte Interessengemeinschaft den Anfang eines solchen Zwanges ergeben werde, allein es scheint, die Völker gehorchen ihren Leidenschaften derzeit weit mehr als ihren Interessen. Sie bedienen sich höchstens der Interessen, um die Leidenschaften zu rationalisieren; sie schieben ihre Interessen vor, um die Befriedigung ihrer Leidenschaften begründen zu können. Warum die Völkerindividuen einander eigentlich geringschätzen, hassen, verabscheuen, und zwar auch in Friedenszeiten, und jede Nation die andere, das ist freilich rätselhaft. Ich weiß es nicht zu sagen. Es ist in diesem Falle gerade so, als ob sich alle sittlichen Erwerbungen der Einzelnen auslöschten, wenn man eine Mehrheit oder gar Millionen Menschen zusammennimmt, und nur die primitivsten, ältesten und rohesten, seelischen Einstellungen übrig blieben. An diesen bedauerlichen Verhältnissen werden vielleicht erst späte Entwicklungen etwas ändern können. Aber etwas mehr Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit allerseits, in den Beziehungen der Menschen zueinander und zwischen ihnen und den sie Regierenden dürfte auch für diese Umwandlung die Wege ebnen.
II. Unser Verhältnis zum Tode.
Das zweite Moment, von dem ich es ableite, daß wir uns so befremdet fühlen[14q] in dieser einst so schönen und trauten Welt, ist die Störung des bisher von uns festgehaltenen Verhältnisses zum Tode.
Dies Verhältnis war kein aufrichtiges. Wenn man uns anhörte, so waren wir natürlich bereit zu vertreten, daß der Tod der notwendige Ausgang alles Lebens sei, daß jeder von uns der Natur einen Tod schulde und vorbereitet sein müsse, die Schuld zu bezahlen, kurz, daß der Tod natürlich sei, unableugbar und unvermeidlich. In Wirklichkeit pflegten wir uns aber zu benehmen, als ob es anders wäre. Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt, den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem Leben zu eliminieren. Wir haben versucht, ihn totzuschweigen; wir besitzen ja auch das Sprichwort: man denke an etwas wie an den Tod. Wie an den eigenen natürlich. Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, daß wir eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben. So konnte in der psychoanalytischen Schule der Ausspruch gewagt werden: Im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod[15q] oder, was dasselbe ist: Im Unbewußten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.
Was den Tod eines anderen betrifft, so wird der Kulturmensch es sorgfältig vermeiden, von dieser Möglichkeit zu sprechen, wenn der zum Tode Bestimmte es hören kann. Nur Kinder setzen sich über diese Beschränkung hinweg; sie drohen einander ungescheut mit den Chancen des Sterbens und bringen es auch zustande, einer geliebten Person dergleichen ins Gesicht zu sagen, wie z.B.: Liebe Mama, wenn du leider gestorben sein wirst, werde ich dies oder jenes. Der erwachsene Kultivierte wird den Tod eines anderen auch nicht gerne in seine Gedanken einsetzen, ohne sich hart oder böse zu erscheinen; es sei denn, daß er berufsmäßig als Arzt, Advokat u.dgl. mit dem Tode zu tun habe. Am wenigsten wird er sich gestatten, an den Tod des anderen zu denken, wenn mit diesem Ereignis ein Gewinn an Freiheit, Besitz, Stellung verbunden ist. Natürlich lassen sich Todesfälle durch dies unser Zartgefühl nicht zurückhalten; wenn sie sich ereignet haben, sind wir jedesmal tief ergriffen und wie in unseren Erwartungen erschüttert. Wir betonen regelmäßig die zufällige Veranlassung des Todes, den Unfall, die Erkrankung, die Infektion, das hohe Alter, und verraten so unser Bestreben, den Tod von einer Notwendigkeit zu einer Zufälligkeit herabzudrücken. Eine Häufung von Todesfällen erscheint uns als etwas überaus Schreckliches. Dem Verstorbenen selbst bringen wir ein besonderes Verhalten entgegen, fast wie eine Bewunderung für einen, der etwas sehr Schwieriges zustande gebracht hat. Wir stellen die Kritik gegen ihn ein, sehen ihm sein etwaiges Unrecht nach, geben den Befehl aus: De mortuis nil nisi bene, und finden es gerechtfertigt, daß man ihm in der Leichenrede und auf dem Grabstein das Vorteilhafteste nachrühmt. Die Rücksicht auf den Toten, deren er doch nicht mehr bedarf, steht uns über der Wahrheit, den meisten von uns gewiß auch über der Rücksicht für den Lebenden.
Diese kulturell-konventionelle Einstellung gegen den Tod ergänzt sich nun durch unseren völligen Zusammenbruch, wenn das Sterben eine der uns nahestehenden Personen, einen Eltern- oder Gattenteil, ein Geschwister, Kind oder teuren Freund getroffen hat. Wir begraben mit ihm unsere Hoffnungen, Ansprüche, Genüsse, lassen uns nicht trösten und weigern uns, den Verlorenen zu ersetzen. Wir benehmen uns dann wie eine Art von Asra, welche mitsterben, wenn die sterben, die sie lieben.
Dies unser Verhältnis zum Tode hat aber eine starke Wirkung auf unser Leben. Das Leben verarmt, es verliert an Interesse, wenn der höchste Einsatz in den Lebensspielen, eben das Leben selbst, nicht gewagt werden darf. Es wird so schal, gehaltlos wie etwa ein amerikanischer Flirt, bei dem es von vorneherein feststeht, daß nichts vorfallen darf, zum Unterschied von einer kontinentalen Liebesbeziehung, bei welcher beide Partner stets der ernsten Konsequenzen eingedenk bleiben müssen. Unsere Gefühlsbindungen, die unerträgliche Intensität unserer Trauer, machen uns abgeneigt, für uns und die unserigen Gefahren aufzusuchen. Wir getrauen uns nicht, eine Anzahl von Unternehmungen in Betracht zu ziehen, die gefährlich, aber eigentlich unerläßlich sind wie Flugversuche, Expeditionen in ferne Länder, Experimente mit explodierbaren Substanzen. Uns lähmt dabei das Bedenken, wer der Mutter den Sohn, der Gattin den Mann, den Kindern den Vater ersetzen soll, wenn ein Unglück geschieht. Die Neigung, den Tod aus der Lebensrechnung auszuschließen, hat so viele andere Verzichte und Ausschließungen im Gefolge. Und doch hat der Wahlspruch der Hansa gelautet: Navigare necesse est, vivere non necesse! (Seefahren muß man, leben muß man nicht.)
Es kann dann nicht anders kommen, als daß wir in der Welt der Fiktion, in der Literatur, im Theater Ersatz suchen für die Einbuße des Lebens. Dort finden wir noch Menschen, die zu sterben verstehen, ja die es auch zustande bringen, einen anderen zu töten. Dort allein erfüllt sich uns auch die Bedingung, unter welcher wir uns mit dem Tod versöhnen könnten, wenn wir nämlich hinter allen Wechselfällen des Lebens noch ein unantastbares Leben übrig behielten. Es ist doch zu traurig, daß es im Leben zugehen kann wie im Schachspiel, wo ein falscher Zug uns zwingen kann, die Partie verloren zu geben, mit dem Unterschied aber, daß wir keine zweite, keine Revanchepartie beginnen können. Auf dem Gebiete der Fiktion finden wir jene Mehrheit von Leben, deren wir bedürfen. Wir sterben in der Identifizierung mit dem einen Helden, überleben ihn aber doch und sind bereit, ebenso ungeschädigt ein zweites Mal mit einem anderen Helden zu sterben.
Es ist evident, daß der Krieg diese konventionelle Behandlung des Todes hinwegfegen muß. Der Tod läßt sich jetzt nicht mehr verleugnen; man muß an ihn glauben. Die Menschen sterben wirklich, auch nicht mehr einzeln, sondern viele, oft Zehntausende an einem Tag. Er ist auch kein Zufall mehr. Es scheint freilich noch zufällig, ob diese Kugel den einen trifft oder den andern; aber diesen anderen mag leicht eine zweite Kugel treffen, die Häufung macht dem Eindruck des Zufälligen ein Ende. Das Leben ist freilich wieder interessant geworden, es hat seinen vollen Inhalt wieder bekommen.
Man müßte hier eine Scheidung in zwei Gruppen vornehmen, diejenigen, die selbst im Kampf ihr Leben preisgeben, trennen von den anderen, die zu Hause geblieben sind und nur zu erwarten haben, einen ihrer Lieben an den Tod durch Verletzung, Krankheit oder Infektion zu verlieren. Es wäre gewiß sehr interessant, die Veränderungen in der Psychologie der Kämpfer zu studieren, aber ich weiß zu wenig darüber. Wir müssen uns an die zweite Gruppe halten, zu der wir selbst gehören. Ich sagte schon, daß ich meine, die Verwirrung und die Lähmung unserer Leistungsfähigkeit, unter denen wir leiden, seien wesentlich mitbestimmt durch den Umstand, daß wir unser bisheriges Verhältnis zum Tode nicht aufrecht halten können und ein neues noch nicht gefunden haben. Vielleicht hilft es uns dazu, wenn wir unsere psychologische Untersuchung auf zwei andere Beziehungen zum Tode richten, auf jene, die wir dem Urmenschen, dem Menschen der Vorzeit zuschreiben dürfen, und jene andere, die in jedem von uns noch erhalten ist, aber sich unsichtbar für unser Bewußtsein in tieferen Schichten unseres Seelenlebens verbirgt.
Wie sich der Mensch der Vorzeit gegen den Tod verhalten, wissen wir natürlich nur durch Rückschlüsse und Konstruktionen, aber ich meine, daß diese Mittel uns ziemlich vertrauenswürdige Auskünfte ergeben haben.
Der Urmensch hat sich in sehr merkwürdiger Weise zum Tode eingestellt. Gar nicht einheitlich, vielmehr recht widerspruchsvoll. Er hat einerseits den Tod ernst genommen, ihn als Aufhebung des Lebens anerkannt und sich seiner in diesem Sinne bedient, anderseits aber auch den Tod geleugnet, ihn zu nichts herabgedrückt. Dieser Widerspruch wurde durch den Umstand ermöglicht, daß er zum Tode des anderen, des Fremden, des Feindes eine radikal andere Stellung einnahm als zu seinem eigenen. Der Tod des anderen war ihm recht, galt ihm als Vernichtung des Verhaßten, und der Urmensch kannte kein Bedenken, ihn herbeizuführen. Er war gewiß ein sehr leidenschaftliches Wesen, grausamer und bösartiger als andere Tiere[13q]. Er mordete gerne und wie selbstverständlich. Den Instinkt, der andere Tiere davon abhalten soll, Wesen der gleichen Art zu töten und zu verzehren, brauchen wir ihm nicht zuzuschreiben.
Die Urgeschichte der Menschheit ist denn auch vom Morde erfüllt. Noch heute ist das, was unsere Kinder in der Schule als Weltgeschichte lernen, im wesentlichen eine Reihenfolge von Völkermorden. Das dunkle Schuldgefühl, unter dem die Menschheit seit Urzeiten steht, das sich in manchen Religionen zur Annahme einer Urschuld, einer Erbsünde, verdichtet hat, ist wahrscheinlich der Ausdruck einer Blutschuld, mit welcher sich die urzeitliche Menschheit beladen hat. Ich habe in meinem Buche »Totem und Tabu« (1913), den Winken von W. Robertson Smith, Atkinson und Ch. Darwin folgend, die Natur dieser alten Schuld erraten wollen, und meine, daß noch die heutige christliche Lehre uns den Rückschluß auf sie ermöglicht. Wenn Gottes Sohn sein Leben opfern mußte, um die Menschheit von der Erbsünde zu erlösen, so muß nach der Regel der Talion, der Vergeltung durch Gleiches, diese Sünde eine Tötung, ein Mord gewesen sein. Nur dies konnte zu seiner Sühne das Opfer eines Lebens erfordern. Und wenn die Erbsünde ein Verschulden gegen Gott-Vater war, so muß das älteste Verbrechen der Menschheit ein Vatermord gewesen sein, die Tötung des Urvaters der primitiven Menschenhorde, dessen Erinnerungsbild später zur Gottheit verklärt wurde[1].