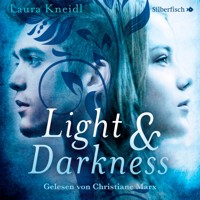9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berühre mich nicht Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie will ihn nicht mehr lieben. Aber ihn zu vergessen ist unmöglich
Nach fünf Jahren ist Gavin plötzlich zurück in Aprils Leben. Damals war er der Junge, an den sie ihr Herz verlor, heute ist er der Mann, dem sie es ein zweites Mal geschenkt hat. April glaubte, mit Gavin endlich die Liebe gefunden zu haben, nach der sie sich sehnte. Doch was so perfekt schien, endete für sie erneut in Liebeskummer. Ihr bleibt keine andere Wahl, als ihre Gefühle für Gavin endgültig zu vergessen. Das ist allerdings gar nicht so leicht, denn unerwartet müssen die beiden für ein Projekt zusammenarbeiten, und Gavins Anblick lässt Aprils verräterisches Herz immer noch viel zu schnell schlagen. Nur wie kann sie ihm verzeihen, wenn sie ihm nicht mehr vertraut?
»Laura Kneidl beweist wieder einmal, wie man sich einfühlsam in die Herzen der Lesenden schreibt. Aprils und Gavins Geschichte ist eine emotionale Achterbahnfahrt ̶ steig unbedingt ein!« ANABELLE STEHL, SPIEGEL-Bestseller-Autorin
Die BERÜHRE MICH. NICHT.-Reihe:
Band 1: BERÜHRE MICH. NICHT.
Band 2: VERLIERE MICH. NICHT.
Band 3: VERGISS UNS. NICHT.
Band 4: ZERBRICH UNS. NICHT.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Epilog I
Epilog II
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Laura Kneidl bei LYX
Impressum
LAURA KNEIDL
Zerbrich uns. Nicht.
Roman
Zu diesem Buch
Vor fünf Jahren hat Gavin Aprils Herz gebrochen. Völlig unerwartet kündigte er ihr damals die Freundschaft. April hat lange Zeit gebraucht, um über ihre Gefühle für ihn hinwegzukommen. Doch dann war Gavin plötzlich zurück in ihrem Leben – und in ihrem Herzen. Aprils Wunsch, endlich die große Liebe zu finden, schien mit Gavin in Erfüllung zu gehen. Aber was zu Beginn so perfekt war, endete für sie in Verrat und erneutem Liebeskummer. April bleibt keine andere Wahl, als ihre Gefühle für Gavin endgültig zu vergessen. Das ist allerdings gar nicht so leicht, denn Gavin wird von seinem Dozenten dazu verdonnert, in Aprils Studierendenorganisation zu arbeiten. Ihm aus dem Weg zu gehen ist unmöglich, und ihr verräterisches Herz schlägt bei Gavins Anblick immer noch viel zu schnell. Doch selbst wenn April ihm verzeihen würde, weiß sie nicht, ob eine gemeinsame Zukunft möglich wäre. Denn wie kann sie mit Gavin zusammen sein, wenn sie ihm einfach nicht mehr vertraut?
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Laura und euer LYX-Verlag
Für Steffi und Sarah
Playlist
Sleep Token – Atlantic
Sleep Token – Hypnosis
Sleep Token – Mine
Sleep Token – Like That
Sleep Token – The Love You Want
Sleep Token – Fall For Me
Sleep Token – Alkaline
Sleep Token – Distraction
Sleep Token – Descending
Sleep Token – Telomeres
Sleep Token – High Water
Sleep Token – Missing Limbs
1. Kapitel
APRIL
Laut prustete ich in das Taschentuch, knüllte es zusammen und warf es neben meinem Bett auf den Boden, der bereits mit weißen Knäueln bedeckt war. Könnte Luca das sehen, hätte er empört den Kopf geschüttelt und mir anschließend einen Mülleimer hingestellt, aber Luca war nicht da. Niemand war da. Ich war seit Stunden allein in meinem Zimmer und heulte mir die Augen aus dem Kopf. Meine Nase war zugeschwollen, und mein Hals fühlte sich ganz dick und wund vom vielen Weinen an. Alles tat weh.
Mein Kopf.
Mein Hals.
Meine Brust, aber vor allem mein Herz, das nicht begreifen konnte, dass es Gavin gewesen war. Er war der Junge, der mir damals vor fünf Jahren auf der Party die Unschuld genommen hatte. Und um ein Haar hätte ich auch mein zweites erstes Mal an ihn verschwendet. Zum Glück war er mit der Wahrheit rausgerückt, bevor es so weit hatte kommen können.
Bei der Erinnerung daran wurde der Druck auf meine Brust noch größer, sodass ich das Gefühl hatte, jeden Moment platzen zu müssen – vor Wut, vor Trauer, vor Enttäuschung, weil Gavin nicht der Mann war, für den ich ihn gehalten hatte. Und mir wurde übel, wenn ich mir vorstellte, wie die Sache damals abgelaufen sein musste. Der Gedanke, dass ein namenloser Fremder, dem ich nichts bedeutet hatte, mich gevögelt und anschließend allein zurückgelassen hatte, war schlimm gewesen; aber das Wissen, dass es Gavin gewesen war, der mich so behandelt hatte, war um einiges schlimmer.
Wir waren Freunde gewesen – beste Freunde und noch mehr. Ich hatte Gavin schon damals geliebt. Wie hätte ich mich auch nicht in diesen wundervollen Jungen verlieben können? Er hatte mich getröstet, wenn es mir schlecht ging. Mir zugehört, als ich geglaubt hatte, mit niemandem sonst reden zu können. Während unserer gemeinsamen Filmabende hatten wir miteinander gekuschelt, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Und wir hatten unzählige Nächte im Bett des jeweils anderen verbracht, nur um nebeneinander zu schlafen. Ich kannte die kleinen Laute, die Gavin machte, wenn er träumte. Und wusste, dass sein Lächeln schief war, wenn er mich im Halbschlaf angrinste.
Und trotz alledem hatte er mich in jener Nacht behandelt wie eine Fremde, als wäre ich nur irgendein Mädchen. Warum hatte er das getan? Warum war er gegangen? Warum hatte er mich zurückgelassen, als würde ich ihm nichts bedeuten?
Es tut mir leid, April.
Gavins letzte Worte kreisten noch immer in meinem Kopf. Ich versuchte, seine Stimme aus meinem Verstand zu verbannen, weil ich sie nicht hören wollte. Aber ich konnte seine Worte ebenso wenig vergessen wie seinen gequälten Gesichtsausdruck, als er nackt aus meinem Zimmer gestolpert war. Das Geräusch der Glasscherben, die unter seinen Fußsohlen knirschten, hallte mir nach wie vor in den Ohren.
Und doch hatte ich kein Mitleid mit ihm …
Es tut mir leid, April.
Was genau tat ihm leid? Tat es ihm leid, dass er mich entjungfert hatte? Tat es ihm leid, dass ich betrunken gewesen war? Tat es ihm leid, dass er damals wortlos verschwunden war und mich allein hatte sitzen lassen? Tat es ihm leid, dass er all die Jahre nichts gesagt hatte? Und dass ich es heute auf diese Weise erfahren hatte? Oder tat ihm in Wirklichkeit nichts davon leid. War seine Entschuldigung womöglich nur eine leere Phrase gewesen, um mich zu besänftigen, weil er erkannt hatte, wie aufgebracht ich war?
Denn wenn es ihm wirklich leidtat, wie all das abgelaufen war, warum hatte er unsere gemeinsame Nacht dann die ganzen Jahre totgeschwiegen wie ein dunkles Geheimnis?
Ich hatte mir immer gewünscht, dass ich mein erstes Mal mit Gavin erlebte und dass es romantisch, liebevoll und zärtlich werden würde, wie ich es mir auch für heute gewünscht hatte. Aber es war nichts davon gewesen. Und er hatte es gewusst. Die ganze verdammte Zeit hatte er es gewusst und nichts gesagt. Kein Sterbenswörtchen. Nicht einmal eine Andeutung hatte er gemacht. Und als Luca ihn vergangenes Silvester gefragt hatte, mit wem er sein erstes Mal gehabt hatte, und er es nicht hatte sagen wollen, hatte ich ihn sogar noch in Schutz genommen. Auch damals hatte er es gewusst.
Er hatte es gewusst …
All die Jahre hatte Gavin gewusst, wie ich nackt aussah, wie ich mich anfühlte, wie es war, mich zu küssen, und er hatte sich entschieden, nichts zu sagen. Stattdessen hatte er unsere Freundschaft beendet. An Lucas Geburtstagsfeier im Zelt hatte er sich entschuldigt und beteuert, dass er diese Entscheidung bereute, aber wenn es ihm wirklich so leidtat, hätte er dann nicht spätestens an diesem Abend die Chance ergreifen sollen, mit mir über alles zu reden? Stattdessen hatte er sich ein weiteres Mal dafür entschieden, mich im Unwissen zu lassen.
Erneut brach ein gequältes Wimmern aus mir hervor. Explodierte in meiner Brust und sorgte dafür, dass sich alles in mir verkrampfte. Ich presste mir die Hand vor den Mund, um das Schluchzen zurückzuhalten, aber es half nichts. Laut und ungehalten quoll der Schmerz aus mir hervor, denn es tat weh.
Es.
Tat.
So.
Weh.
In diesem Moment konnte ich mir nicht vorstellen, dass es jemals wieder nicht wehtun würde. Und fast noch schmerzhafter als sein Schweigen all die Jahre war, dass ich ihm vertraut hatte. Selbst in den Jahren, in denen wir keine Freunde gewesen waren, hatte ein Teil von mir Gavin vertraut und darauf, dass er dennoch ein guter Mensch war. Jetzt war ich mir dessen nicht mehr so sicher.
Ich rollte mich unter meiner Decke zu einer Kugel zusammen und schlang die Arme um meine Knie, um mich zusammenzuhalten, weil ich Angst hatte, unter dem Schmerz anderenfalls zerbrechen zu müssen.
Schniefend und schluchzend tastete ich nach den Taschentüchern auf meinem Nachttisch, aber die Box war leer. Mist. Ich schob die Beine über die Bettkante. Kalte Luft streifte meine nackte Haut, weil ich noch nicht die Kraft gehabt hatte, mich anzuziehen. Und nun, da ich den schützenden Kokon meiner Decke verließ, fühlte ich mich entblößt und verletzlich. Ich schnappte mir ein altes T-Shirt vom Boden und zog es mir über, bevor ich zu meinem Schreibtisch lief, um mir die Taschentücher zu holen, die ich dort bunkerte.
Mit der vollen Box wollte ich zurück ins Bett, als mein Blick in den Spiegel fiel. Ich sah furchtbar aus. Das Shirt war zerknittert mit einem Fleck darauf. Mein Gesicht war aufgedunsen. Getrocknete Tränen klebten mir verkrustet auf den Wangen, und meine Augen waren rot und verquollen. Doch es war nicht mein Anblick, der mir eine Gänsehaut bescherte, sondern die Kette mit Gavins Sternzeichen, die mir noch immer um den Hals baumelte. Mit zittrigen Händen tastete ich danach. Fast schon panisch, als könnte mich die Kette erdrosseln, versuchte ich sie loszuwerden, aber meine Finger bebten zu stark, um den Verschluss zu öffnen. Mein Herz raste. Und dann platzte mir der Kragen. Ich packte die Kette und zerrte sie mir vom Hals. Der billige Verschluss riss ohne Widerstand.
Erleichtert atmete ich auf und starrte auf den Anhänger in meiner Hand.
So denkst du immer an mich.
Und ich denk immer an dich.
Aber ich wollte nicht mehr an Gavin denken. Er und ich, wir waren Geschichte. Ein für alle Mal. Unser Film hatte sein Ende erreicht. Und es gab kein Happy End. Ich ging in die Knie und stopfte die Kette in den Mülleimer, nach ganz tief unten, um sie nicht mehr sehen zu müssen – nie wieder. Sie loszuwerden brachte mir allerdings nicht den Frieden, auf den ich gehofft hatte, denn ich konnte Gavin noch immer spüren.
Seine Finger, die mich zärtlich berührten.
Seine Lippen, die meine Haut liebkosten.
Und seinen Körper, der sich verlangend an meinen drängte.
Ich hatte ihn so sehr gewollt. So, wie ich keinen anderen Mann je gewollt hatte. Doch alles, was ich jetzt noch wollte, war, Gavin zu vergessen, wie ich ihn damals vergessen hatte. Denn vielleicht, nur vielleicht, würde es dann weniger wehtun. Vielleicht könnte ich dann wieder klar denken und aufhören zu weinen.
Ich wusste, dass es keine gute Idee war. Womöglich war es sogar eine ziemlich beschissene Idee, aber der Schmerz lähmte meinen Verstand und beraubte mich jeder Vernunft. Ich wollte nur noch vergessen. Und sehnte mich nach diesem süßen Nichts aus jener Nacht vor fünf Jahren.
Ich zog mir eine auf dem Boden liegende Hose über und verließ mein Zimmer, wobei ich einen großen Bogen um die Scherben auf der anderen Seite meines Bettes machte. Auf dem Weg in die Küche entging mir nicht, dass die Tür zu Lucas Zimmer offen stand und Gavins Sachen weg waren, genauso wie die von Jack. Mein Herz verkrampfte sich einmal mehr, aber ich zwang mich weiterzugehen. Vor der Spüle ging ich in die Hocke. Hinter Glasreiniger und Putzlappen versteckt standen mehrere Flaschen Alkohol. Ich griff nach der erstbesten; eine halb volle Flasche Whisky. Ich schraubte den Deckel ab und schnüffelte an der Flüssigkeit. Der beißende Geruch ließ mich die Nase rümpfen, aber es war genau das, was ich brauchte, um Gavin aus meinem Verstand zu brennen, und sei es nur für ein paar Stunden.
Ich holte tief Luft, setzte die Flasche an meinen Mund und –
– nichts.
»Komm schon«, redete ich mir selbst Mut zu und presste die Flasche an meine Lippen. Es ging nicht. Ich konnte dieses Zeug nicht trinken. Ich wollte. Aber ich konnte nicht. Sosehr ich mir wünschte zu vergessen. Sosehr ich mir wünschte, den Schmerz betäuben zu können. Das hier war nicht der richtige Weg, denn egal wie abgrundtief ich Gavin in diesem Moment auch hasste, das konnte ich ihm nicht antun. Ich konnte meinen Kummer nicht auf dieselbe Art und Weise bekämpfen, wie seine Mom es tat.
Mit einem Seufzen schraubte ich die Flasche zu, stellte sie zurück und öffnete stattdessen das Eisfach vom Kühlschrank. Ich nahm mir einen der Eisbecher und einen Löffel und schleppte mich rüber ins Wohnzimmer auf die Couch, um mich dort für den Rest des Tages meiner Lieblingsserie und dem Schmerz hinzugeben.
2. Kapitel
GAVIN
Du bist stark. Gott, gibt dir nicht mehr zu tragen, als du ertragen kannst, las ich den Sticker, den jemand auf den Kaffeeautomaten im Krankenhaus geklebt hatte, direkt über den Münzschlitz.
Was für ein Unsinn! Was war mit Leuten wie meinem Dad, die es offenbar nicht ertragen hatten? Denen es zu viel geworden war? Was war mit ihnen? Hatte Gott bei ihnen einen Fehler begangen? Hatte er sich verkalkuliert? Oder sollte ich ihm dafür dankbar sein, dass mein Leben in diesen Tagen einem großen Haufen Scheiße glich, weil es eine Herausforderung war, an der ich wachsen konnte? Bestimmt nicht!
Früher war Mom sonntags öfter mit mir in die Kirche gegangen, aber nach dem Tod meines Dads hatten die Besuche aufgehört. Ich wusste nicht, ob sie ihren Glauben verloren oder schlichtweg das Getuschel der anderen Gemeindemitglieder nicht mehr ertragen hatte. Ich hingegen hatte die Existenz von Gott seit jeher infrage gestellt, und heute mehr denn je, vor allem wenn ich einen solchen Bullshit las.
Ich hob die Hand, um den Aufkleber abzuknibbeln und anderen Leuten diesen Müll zu ersparen. Doch das Ding schien mit dem Metall verschmolzen zu sein. Es gingen immer nur einzelne Fetzen ab, und meine abgekauten Fingernägel machten es nicht leichter. Ich hatte sie in den letzten Stunden abgeknabbert, weil ich irgendetwas hatte tun müssen, um diese angespannte, verzweifelte Energie loszuwerden, die in mir steckte.
»Wird’s heute noch was?«, blaffte jemand hinter mir.
Ich drehte mich um und entdeckte einen Mann mittleren Alters mit tiefen Augenringen, die darauf schließen ließen, dass er bereits den ganzen Tag, vielleicht auch die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht hatte. Vermutlich sah ich keinen Deut besser aus. Ich hatte in den letzten zwei Tagen etwa drei Stunden geschlafen, andererseits war ich das gewohnt. Meistens nahm ich die Müdigkeit gar nicht mehr als solche wahr. Es handelte sich eher um einen Zustand der Dauererschöpfung, den ich mit Kaffee, Cola und Energydrinks bekämpfte. In meiner frühen Jugend, als meine Mom ihr Leben noch halbwegs im Griff gehabt hatte, hatte sie mich wegen meiner Schlafprobleme zum Arzt geschleppt. Er hatte mir Tabletten verschrieben, die wahre Wunder gewirkt hatten. Doch sie hatten mich auch tagsüber oft träge gemacht und meinen Verstand vernebelt, das konnte ich mir heute nicht mehr erlauben. Ich musste funktionieren.
»Sorry«, murmelte ich dem müde dreinblickenden Mann zu und wandte mich wieder der Kaffeemaschine zu. Ich unterließ mein Vorhaben, den Aufkleber abzuknibbeln, obwohl es mir bereits zur Hälfte gelungen war. Jetzt stand dort … bist … Gott … nicht mehr … ertragen kannst.
Ich drückte auf die Tasten und die Maschine bereitete mir einen Latte macchiato zu, oder zumindest ein Getränk, das einem Latte macchiato ähnelte. Er war nicht vegan, aber das war mir egal. Außerdem wollte ich mich in einem Krankenhaus nicht über den Mangel an veganen Milchalternativen beschweren. Ich schnappte mir den braunen Pappbecher und machte Platz für den Mann. Noch im Gehen nippte ich an dem Kaffee. Er schmeckte bitter und zugleich verwässert.
Weißt du, wer guten Kaffee macht?
April.
Der Gedanke an sie löste ein schmerzhaftes Ziehen in mir aus, das von meinem Herzen bis zu meinem Magen reichte. Aber ich wollte jetzt nicht an sie und den Mist denken, den ich verzapft hatte. Ich musste für meine Mom da sein, denn ich konnte unmöglich alle Brände in meinem Leben gleichzeitig löschen. Und selbst wenn es mir gelang, was sollte das bringen? Alles, was übrig blieb, war verkohlte, unfruchtbare Erde, und genauso fühlte sich meine Beziehung zu April an. Das erste Feuer zwischen uns hatte vor fünf Jahren gewütet, und in den letzten Wochen hatten wir es geschafft, es zu löschen. Doch wir … nein, ich hatte ein paar Funken übersehen, die ausgereicht hatten, um erneut alles in Brand zu stecken. Und dieses Mal schien das Feuer noch verheerender, worunter April leiden musste.
Ich nippte an meinem widerlichen Kaffee und versuchte, die Gedanken an sie zu verdrängen, aber sie fanden immer wieder einen Weg zurück in meinen Verstand. Ich konnte ihren gequälten Gesichtsausdruck, als sie die Wahrheit erfahren hatte, einfach nicht vergessen. Seit sie mich rausgeschmissen hatte, hatte ich mindestens hundertmal darüber nachgedacht, sie anzurufen oder ihr zu schreiben. Mehrmals hatte ich mein Handy bereits in der Hand gehabt, aber entweder hatten mir die Worte gefehlt oder ich war vom Krankenhauspersonal unterbrochen worden.
Ich folgte dem langen deprimierenden Flur bis zum Zimmer meiner Mom. Bei ihrer Einlieferung hatte sie es für sich gehabt, inzwischen allerdings nicht mehr. In einem der anderen Betten lag ein Mann, der von Schmerzmitteln ausgeknockt war. Das Bett daneben gehörte einer älteren Frau, die unaufhörlich strickte. Nur das vierte Bett war weiterhin leer – vermutlich würde es nicht lange so bleiben.
Ich setzte mich auf den unbequemen Stuhl neben dem Bett meiner Mom. Sie war nicht länger an einen Herzmonitor angeschlossen, was ich als gutes Zeichen wertete. Allerdings steckte nach wie vor eine Nadel in ihrem Handrücken, die mit einer Transfusion verbunden war. Ihre Haut war blass mit Ausnahme der Blutergüsse, die ihren Körper von dem Unfall zeichneten. Sie schlief noch immer. Oder eher wieder. Gegen Mittag war sie einmal kurz aufgewacht. Der Pfleger meinte, dass dies nicht ungewöhnlich sei. Die Schmerzmittel gepaart mit dem Rausch, den sie ausschlief, und den Verletzungen – die Schürfwunden und Prellungen, aber vor allem die leichte Gehirnerschütterung, die ausgekugelte Schulter und die gebrochenen Rippen – schwächten ihren Körper. Es würde wohl noch etwas dauern, bis sie wieder vollständig bei sich war. Erst dann könnte sie bedenkenlos entlassen werden; und ich hoffte, dass das bald war – sehr bald, denn ich hatte keine Ahnung, wie wir diesen Krankenhausaufenthalt bezahlen sollten. Ich wünschte mir, nicht an so etwas denken zu müssen. Alles, was ich wollte, war, dass meine Mom wieder gesund wurde. Aber ich musste daran denken, weil es sonst niemand tat.
Ich war vorhin, in einer ruhigen Minute, an den Empfang gegangen und hatte mich nach den Kosten erkundigt. Die Frau hinter der Theke hatte mir keine genaue Summe nennen können, aber bereits der geschätzte Betrag hatte mir kurzfristigen Schwindel bereitet, da weder ich noch meine Mom versichert waren. Allein die Einlieferung und die Behandlung in der Notaufnahme beliefen sich zusammen auf um die zweitausend Dollar. Dazu kamen die Behandlungskosten und der Krankenhausaufenthalt. Jede weitere Nacht, die meine Mom hier verbrachte, kostete mich zusätzliches Geld, das ich nicht hatte.
Ich spürte ein Stechen in der Brust wie von einer Nadel, die sich durch mein Herz bohrte. Es war ein mir bekannter Schmerz. Als ich ihn das erste Mal vor einigen Monaten wahrgenommen hatte, kurz nachdem ich meine Mom nach Melview geholt hatte, hatte ich geglaubt, ich hätte einen Herzinfarkt. Ein Teil von mir hatte sich beinahe gewünscht, es wäre einer, denn ein Herzinfarkt hätte eine erzwungene Auszeit bedeutet, die ich mir selbst niemals erlaubt hätte. Der Kardiologe hatte allerdings schnell Entwarnung gegeben. Mein Herz war gesund. Es war meine Psyche, um die ich mir Sorgen machen musste. Das Herzstechen war ein Symptom meiner Depression, meiner Angst und des Stresses. Mein Körper ermahnte mich, es ruhiger angehen zu lassen.
Wenig hilfreich hatte mir der Arzt geraten, den Stress zu reduzieren, mehr an die frische Luft zu gehen, zu entspannen und mir weniger Sorgen zu machen. Aber wie genau ich das anstellen sollte mit einer alkoholkranken Mutter, zwei Jobs, einem Studium, das gefährlich auf der Kippe stand, meiner Verantwortung Jack gegenüber und keinem Geld auf dem Konto, hatte er mir nicht sagen können.
Ich rieb mir über die Brust und redete mir selbst gut zu, um mich zu beruhigen. Ich durfte jetzt nicht die Fassung verlieren, denn alles hing an mir. Wer würde sich um meine Mom und Jack kümmern, wenn nicht ich? Ich bezweifelte, dass ich nach der Aktion von heute Morgen und der Scheiße, die ich gebaut hatte, noch auf April zählen konnte. Und vermutlich war es lediglich eine Frage der Zeit, bis auch Luca mich zum Teufel wünschen würde.
Bevor sich mein Verstand in diese dunkle Gedankenspirale hineinbegeben konnte, wurde die Tür zum Krankenzimmer aufgeschoben und Dr. Wheeler betrat den Raum. Die Ärztin hatte das Krankenhaus seit der Einlieferung meiner Mom anscheinend nicht verlassen. Bei unserem Kennenlernen vor ein paar Stunden war ihr braunes Haar zu einem straffen Zopf gebunden gewesen, der nun nicht mehr annähernd so streng und akkurat saß wie zu Beginn ihrer Schicht. Einzelne Strähnen hatten sich daraus gelöst, und der Kajal unter ihrem linken Auge war verschmiert. Ob ich sie darauf ansprechen sollte?
»Wie geht es Ihrer Mom?«, fragte Dr. Wheeler zur Begrüßung.
»Unverändert. Sie ist heute Mittag kurz aufgewacht, aber seitdem schläft sie.«
Die Ärztin nickte wenig überrascht. »Und wie geht es Ihnen?«
»Den Umständen entsprechend«, antwortete ich ausweichend. Nicht nur, weil ich Dr. Wheelers wertvolle Zeit nicht verschwenden wollte. Sondern auch weil ich Angst hatte, dass, wenn ich die Worte aussprach, die Fassade zerbröckeln würde, die ich so krampfhaft versuchte aufrecht zu halten. Denn in Wirklichkeit fühlte ich mich so beschissen, hilflos und betäubt wie seit Langem nicht mehr. Ich tat alles, was in meiner Macht stand, und doch war ich machtlos.
»Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ihre Mutter wird wieder gesund«, erwiderte Dr. Wheeler mit einem aufmunternden Lächeln, das sie bis ins letzte Zucken ihrer Mundwinkel perfektioniert hatte.
Ich erwiderte es halbherzig und dachte, damit wäre die Sache erledigt, aber Dr. Wheeler war noch nicht fertig. Sie schloss den Vorhang, der alles an Privatsphäre war, die man in diesem Zimmer bekam, und nahm sich den Hocker, der auf der anderen Seite des Bettes stand. Sie zog ihn zu mir und setzte sich neben mich, wobei sie nach wie vor lächelte, aber es war eine andere Art von Lächeln. Eines, das mir geradewegs in den Magen fuhr und meine Übelkeit verstärkte. Sie griff in die Tasche ihres Kittels, um eine Broschüre herauszuholen. Ich kannte das Gesicht des verzweifelten Mannes, das darauf abgebildet war, bereits.
»Danke, die hab ich schon.«
Dr. Wheeler stockte kurz und stopfte die Broschüre über Alkoholismus anschließend zurück in ihre Tasche. Ich hatte meiner Mom mindestens ein Dutzend dieser Flyer mitgebracht, ihr Ratgeber gekauft, und gefühlt alle paar Wochen versuchte ich, sie von einem Treffen der Anonymen Alkoholiker zu überzeugen. Aber meine Mom wollte davon nichts hören. Sie sah ihr Problem nicht als Problem an. In ihren Augen war es die Lösung, um den Schmerz, der sie seit Jahren quälte, besser zu ertragen. Sie konnte die Trauer über den Verlust meines Dads nicht anders bewältigen. Doch sie steckte zu tief in ihrer Sucht, um zu erkennen, was diese Taubheit sie kostete.
»Sie sagten, Ihre Mom trinkt bereits seit ein paar Jahren?«
Ich nickte. »Ja, seit dem Selbstmord meines Dads.«
»Wie lange ist das her?«
»Fast vierzehn Jahre. Die erste Zeit waren es nur ein, zwei Gläser Wein am Tag, das harte Zeug trinkt sie erst seit drei Jahren; und seitdem wird es stetig mehr.«
»Kümmern Sie sich allein um Ihre Mom?«
»Ja.«
»Das ist viel Verantwortung für jemanden in Ihrem Alter.«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Haben Sie schon mal versucht, ihr Hilfe zu holen?«
»Was denken Sie?«, antwortete ich, bissiger als beabsichtigt, immerhin versuchte Dr. Wheeler nur zu helfen. Ich seufzte und fuhr mir mit der Hand durch das knotige Haar, da ich es nach meiner Dusche mit April nicht gekämmt hatte. »Entschuldigung, ich wollte nicht patzig sein.«
Die Ärztin lächelte. »Entschuldigung angenommen.«
Ein paar Sekunden verfielen wir in einträchtiges Schweigen, ehe ich erneut das Wort ergriff. »Könnten Sie vielleicht mit ihr reden, wenn sie wach ist? Auf mich hört sie nicht, aber womöglich können Sie sie zur Vernunft bringen.«
»Ich kann es versuchen.«
»Danke.«
Dr. Wheeler nickte. »Darf ich Ihnen noch einen Rat geben?«
Abwartend sah ich die Ärztin an. Sie erhob sich von ihrem Platz, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Gehen Sie nach Hause, Gavin. Ruhen Sie sich aus. Essen Sie was. Wir haben ein Auge auf Ihre Mom, und sollte sich etwas an ihrem Zustand gravierend verändern, rufen wir Sie an.« Mit diesen Worten zog Dr. Wheeler den Vorhang auf und wanderte weiter zu der strickenden Frau im Bett nebenan.
Ich seufzte. Mir war klar, dass Dr. Wheeler recht hatte, aber ich wollte nicht nach Hause. Denn ich hatte kein Zuhause. Alles, was ich hatte, war eine schäbige Einzimmerwohnung, die nicht mir gehörte, obwohl ich die Miete bezahlte. Doch hier gab es nichts für mich zu tun, und Jack wartete auf mich. Ich stand auf und trat zu meiner Mom ans Bett. Trotz der Prellungen und Verbände an ihrem Körper wirkte sie in diesem Moment friedlicher als in all den Monaten zuvor. Als hätten ihre Dämonen endlich für ein paar Stunden von ihr abgelassen.
Ich beugte mich zu ihr und gab ihr zum Abschied einen Kuss auf die Stirn. »Ich bin bald zurück.«
Der Regen trommelte auf das Dach des Busses und rann in Rinnsalen die Fenster hinab. Die Welt hinter der Scheibe war trüb und grau. Ich suchte mir einen der Tropfen aus und verfolgte mit meinem Blick seinen Weg über das Glas, bis er im Nichts verschwand oder sich mit einem anderen Tropfen zusammenschloss, um größer, schwerer und schneller zu werden. Mich auf den Regen zu konzentrieren half mir dabei, mich von den Gedanken fernzuhalten, die in meinem Kopf lauerten und mich überfallen würden, sobald ich ihnen eine Chance dazu gab.
Der Bus kam an einer Ampel zum Stehen.
»Nächster Halt: Bridgewater Street.«
Ich schnappte mir meinen Rucksack, rutschte vom Sitz und ging zur Tür, die sich kurz darauf mit einem Quietschen aufschob. Seufzend trat ich in den Regen hinaus. Die Leute, die mit mir ausstiegen, huschten mit hochgezogenen Schultern davon, um schnell ins Trockene zu kommen. Doch ich hatte es nicht eilig. Ich zog die Kapuze meines Hoodies über und stapfte los. Obwohl es nur zwei Straßen von der Haltestelle bis zum Apartmentkomplex meiner Mom waren, war ich vollkommen durchnässt, als ich ankam. Vor der Wohnungstür blieb ich stehen und holte tief Luft, um mich zu wappnen, bevor ich die Tür entriegelte.
Ich wurde von zwei Dingen begrüßt: Jack und dem beißenden Gestank nach abgestandenem Rauch. Meine Mom lebte erst seit ein paar Monaten hier, aber in der Zeit hatte sie es geschafft, die Bude komplett vollzuqualmen. Der Rauch war in die Tapete, die Couchpolster, einfach alles eingezogen. Ich hatte die Fenster aufgerissen, durchgelüftet und ein Raumspray benutzt, nichts davon hatte geholfen.
Ich ging in die Hocke, um Jack zu begrüßen. Er freute sich, mich zu sehen, während ich mit einem Naserümpfen realisierte, dass sein Fell ebenfalls bereits den Gestank angenommen hatte. Das hielt mich jedoch nicht davon ab, ihn in die Arme zu schließen. Er wackelte mit dem Schwanz und leckte mir den Regen vom Hals, was mich trotz allem zum Lachen brachte. Ich liebte diesen Hund.
Zu meinen Füßen hatte sich eine Pfütze aus Regenwasser gebildet. Ich richtete mich auf, schlüpfte mit einem schmatzenden Geräusch aus meinen Schuhen und ging ins Bad. Jack folgte mir. Ich zog mir den Hoodie aus, der wie eine zweite Haut an meinem Körper klebte, und legte ihn ins Waschbecken, meine Jeans und Boxershorts folgten. In den letzten Monaten hatte ich mir antrainiert, kalt zu duschen, nicht nur weil es gesund war, sondern auch weil es Kosten sparte, aber da ich bereits vom Regen ausgekühlt war, stellte ich das Thermostat diesmal auf warm.
Die ersten Tropfen, die mich trafen, waren dennoch eiskalt, erst nach einer Weile erhitzte sich das Wasser und wärmte mich. Meine Muskeln entspannten sich trotzdem nicht. Ich entspannte mich nicht. Alles in mir war verkrampft. Mein Körper befand sich in Alarmbereitschaft, so schnell wie gerade alles den Bach runterging.
Reglos blieb ich unter der Dusche stehen, bis die Scheiben der Kabine vom Dampf beschlagen waren und ich Jacks Silhouette dahinter nur noch verschwommen sehen konnte. Ich hatte kein eigenes Waschzeug mitgebracht, also benutzte ich das Shampoo und Duschgel meiner Mom, das einen fast schon penetrant fruchtigen Duft verströmte. Vermutlich spekulierte sie darauf, den Gestank nach Alkohol und Rauch damit übertünchen zu können, der ihr immerzu anhaftete.
Fünf Minuten später stieg ich aus der Dusche. Ich schlang mir ein Handtuch um die Hüften und lief ins Wohnzimmer, wo meine Tasche auf mich wartete. In Windeseile hatte ich meine Sachen gepackt, bevor ich Aprils und Lucas Wohnung verlassen hatte. Ich griff in die Tasche und zog das Erste an, was ich zu fassen bekam: eine Jogginghose und das alte Jurassic-Park-Shirt, das früher meinem Dad gehört hatte.
Ich strich mit der Hand über den knittrigen Stoff mit dem bröckligen Logo, das zu viele Wäschen hinter sich hatte, und fragte mich, was er wohl über Mom und mich denken würde, könnte er uns sehen. Wäre er enttäuscht? Ich jedenfalls war es. Denn hätte mich vor fünfzehn Jahren jemand gefragt, wo ich mich heute sah, dann wäre das ganz gewiss nicht hier gewesen.
Ich ließ meinen Blick durch die Wohnung gleiten, deren Miete ich in den letzten Monaten nur mit Ach und Krach hatte bezahlen können. Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer bildeten einen Raum. Der Kühlschrank surrte direkt neben dem Bett, und mit nur fünf Schritten war man von der Couch am Herd. Ein Großteil der Möbel stammte aus meiner alten Wohnung. Ich hatte sie meiner Mom überlassen, weil ich es mir nicht hatte leisten können, ihr neue Sachen zu kaufen. Und ihre Möbel aus Brinson hatte ich dort verscherbelt oder weggeschmissen, weil sie so dreckig, abgenutzt und heruntergekommen gewesen waren, dass sie das Geld für den Transporter, um sie nach Melview zu bringen, nicht wert gewesen waren.
Das Sofa hatte ich gebraucht von dem Geld erstanden, das ich mit dem Verkauf meiner PlayStation-Spiele verdient hatte. Es hatte noch ziemlich gut ausgesehen, als ich es abgeholt hatte. Nun wies es etliche Brandlöcher von den Zigaretten meiner Mom auf, war voller Flecken von ausgekippten Drinks, und an einer Stelle quoll die Füllung hervor. Auch mein alter Couchtisch war inzwischen von ihren Kippen gezeichnet. Dreckiges Geschirr türmte sich darauf, genau wie im Rest der Wohnung. Wohin ich sah, entdeckte ich Müll, volle Aschenbecher, alte Verpackungen und schmutzige Teller. Als würde meine Mom die Dinge einfach liegen lassen, wo es ihr gerade in den Sinn kam.
Alles, was ich wollte, war, mich hinzulegen und auszuruhen, selbst wenn an Schlaf nicht zu denken war, aber zuerst musste ich Ordnung schaffen. Schließlich würde das hier für unbestimmte Zeit auch mein Zuhause sein. Bei dem Gedanken daran wurde mir aus allerlei Gründen eng in der Kehle. Vor zwei Tagen hatte es sich noch angefühlt, als würde es endlich bergauf gehen. April hatte mir das erste Mal seit langer Zeit Hoffnung gemacht, alles irgendwie überstehen zu können, aber ich hätte wissen müssen, das so was passieren würde. Glück war in meinem Leben nie von Dauer, und je schneller ich das akzeptierte, umso eher könnte ich das Gefühl der Enttäuschung abschütteln, das als Kloß in meinem Hals festsaß.
Ich schnappte mir einen schmutzigen Topf, um ihn in die Spüle zu bringen, kam allerdings nur zwei Schritte weit, als mich mit einem Schlag sämtliche Kraft verließ. Keine Ahnung, was das auslöste. Vielleicht lag es daran, dass ich endlich allein war und für niemanden mehr stark sein musste. Vielleicht war es die Erkenntnis, dass es niemanden gab, der für mich da war, der sich um mich kümmerte. Oder womöglich nur die anhaltende Müdigkeit. Aber plötzlich konnte ich nicht mehr.
Es ging einfach nicht.
Ich war am Ende.
Ich taumelte zur Seite und ließ mich an der Wand nach unten gleiten, während mein Körper von einem ersten lauten Schluchzen erschüttert wurde. Nach Luft japsend stellte ich den Topf neben mir ab, während das Stechen in meine Brust zurückkehrte. Ich hob eine Hand, als könnte ich den Schmerz greifen und aus mir herauszerren, aber so funktionierte das leider nicht.
Atme, Gavin. Atme, ermahnte ich mich und kniff die Augen zusammen. Ich zog die Beine an meinen Körper. Die Arme um meine Knie geschlungen versuchte ich, mich selbst festzuhalten – zusammenzuhalten, zumindest den Teil von mir, der noch nicht vollständig gebrochen war, denn genauso fühlte ich mich. Gebrochen und kaputt. Wie eine Marionette, die vom Leben hin und her geschleudert worden war.
Zittrig holte ich Luft. Doch der Druck in meiner Brust machte es mir schwer. Jeder Atemzug tat weh, wie eine Klinge, die sich durch mein Herz bohrte. Dennoch zwang ich mich, gegen den Schmerz zu atmen, der nur in meinem Kopf existierte. Ich schluckte gegen die Tränen, die Enttäuschung und die Verzweiflung an und ließ meinen Kopf nach hinten fallen, sodass er gegen die Wand knallte. Ich rief mir die Achtsamkeitsübung ins Gedächtnis, die uns Professor Erikson bereits im ersten Semester Psychologie beigebracht hatte und die mir schon einige Male dabei geholfen hatte, wieder zu mir zu finden, nachdem ich von meinen Gefühlen übermannt worden war. Denn das Wichtigste in einem solchen Moment war, die Gedanken im Hier und Jetzt zu verankern, anstatt sie in eine ungewisse Zukunft schweifen zu lassen.
Schauen Sie sich um und benennen Sie fünf Dinge, die Sie sehen können, hörte ich Eriksons Stimme und ließ meinen Blick schweifen.
Was ich sah, war der volle Aschenbecher auf dem Couchtisch, die Hausschuhe meiner Mom mit dem gerissenen Riemen, den alten Fernseher mit der dicken Staubschicht, den Regen, der gegen die Scheibe prasselte, und Jack, der auf mich zukam, um nachzusehen, wie es mir ging.
Laut Übung folgten nun vier Dinge, die ich berühren konnte.
Drei Dinge, die ich hören konnte.
Zwei Dinge, die ich riechen konnte.
Und zuletzt eine Sache, die ich schmecken konnte: meine Tränen.
Ich wischte sie mir von den Wangen und sah auf Jack hinab, der sich neben mich gehockt hatte und mich mit seinen großen Hundeaugen ansah. Meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, Jack war das einzig Gute, was mir geblieben war. Die einzige andere gute Sache in meinem Leben hatte ich heute Morgen kaputt gemacht. Aber ich sollte nicht überrascht sein. April und ich – wir beide zusammen war einfach zu gut gewesen, um wahr zu sein.
Allerdings konnte ich dieses Mal niemandem die Schuld geben außer mir selbst. Ich hatte, was April betraf, mehr falsche Entscheidungen getroffen, als ich an einer Hand abzählen konnte. Wobei ich mir selbst nicht ganz erklären konnte, wie das hatte passieren können, denn April an meiner Seite zu haben fühlte sich absolut richtig an. Ich zweifelte an vielen Dingen in meinem Leben, aber nicht an ihr.
Niemals an ihr.
Ich liebte April, hatte sie schon damals geliebt, als wir nur Freunde gewesen waren. Sie war immer mein Lieblingsmensch gewesen. Jeden Witz, jedes Erlebnis, jeden Gedanken und jedes Geheimnis hatte ich zuerst mit ihr teilen wollen. Zwar war Luca mein bester Freund, aber April … April war … Ich hatte keine Worte dafür. Sie machte mich glücklich wie kaum etwas anderes auf der Welt. Und ich hatte geglaubt, dass das, was wir miteinander hatten, für immer halten würde, denn unsere Freundschaft hatte mir die Welt bedeutet.
Sie hatte mir die Welt bedeutet …
… bis ich alles kaputt gemacht hatte.
Und dafür hasste ich mich. Heute mehr denn je.
Noch schlimmer als mein eigener Schmerz war nur die Erkenntnis, wie sehr ich April verletzt hatte. Mir wurde übel, wenn ich an den Ausdruck in ihren Augen dachte, kurz bevor sie mich aus ihrem Zimmer geschmissen hatte. Die Erinnerung an das blanke Entsetzen in ihrem Blick, als sie realisiert hatte, dass wir schon einmal miteinander geschlafen hatten, jagte mir erneut einen Schauder über den Rücken.
All die Jahre hatte ich angenommen, ihr wäre es zu peinlich, über das zu reden, was auf der Party damals geschehen war, oder dass sie es bereute. Doch niemals, nicht in meinen wildesten Träumen, war mir der Gedanke gekommen, April könnte sich nicht an unsere gemeinsame Nacht erinnern. Denn ich erinnerte mich an jede Minute, jede Sekunde, jede Millisekunde. An ihre Küsse und Berührungen, an die sanften Laute aus ihrem Mund und an ihre Hände, die mich an Stellen berührt hatten, an denen ich noch nie zuvor berührt worden war. All das würde ich niemals vergessen. Und ich würde April niemals vergessen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, wie beängstigend und erschreckend es für sie sein musste, keine Erinnerungen an diese Nacht und ihr erstes Mal zu haben. Ich konnte nur erahnen, wie es ihr am Morgen danach ergangen sein musste, und ich wünschte mir, die Zeit zurückdrehen zu können, um klügere Entscheidungen zu treffen. Um bei ihr zu bleiben, sie in den Armen zu halten und die Lücken in ihrer Erinnerung zu füllen.
Lücken, die noch immer da waren.
Lücken, die ich auch heute nicht geschlossen hatte, weil ich erneut gegangen war, ohne etwas zu sagen. Zwar war es dieses Mal April gewesen, die mich weggeschickt hatte, aber sie hatte unter Schock gestanden, was ich ihr nicht verdenken konnte. An ihrer Stelle hätte ich vermutlich ähnlich reagiert und einen Moment für mich gebraucht, um mich zu sammeln. Nun war der Moment vorüber und sie wieder allein, ohne zu wissen, was geschehen war. Ich schuldete ihr nicht nur eine Entschuldigung, sondern auch eine Erklärung. Sie hatte ein Recht darauf zu erfahren, was in jener Nacht zwischen uns passiert war.
3. Kapitel
APRIL
Ich saß zusammengesunken auf der Couch. Es war Abend geworden. Der Eisbecher war schon lange leer, und das einzige Licht kam vom Flackern des Fernsehers. Immer wieder versuchte ich, mich auf meine Lieblingsserie zu konzentrieren, doch meine Gedanken wanderten ständig zurück zu Gavin, zu den letzten Wochen, Tagen und Stunden, aber vor allem zu jener Nacht vor fünf Jahren. Ich durchwühlte mein Gedächtnis nach Erinnerungen, denn es war mir unbegreiflich, wie ich Gavin hatte vergessen können.
Ja, ich hatte etwas getrunken, aber ich hatte ihn geliebt und mir in meiner unschuldigen Vernarrtheit bereits ausgemalt, wie es sein würde, all die ersten Male mit ihm zu erleben. Den ersten Kuss. Das erste Date. Den ersten Sex. Den ersten Streit. Den ersten Versöhnungssex. Ich hatte mir so viel für Gavin und mich gewünscht, vor allem eine gemeinsame Zukunft. Was ich stattdessen bekommen hatte, war eine zertrümmerte Vergangenheit, und ich hatte keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Der Schmerz über Gavins Verrat fraß mich innerlich auf. Wie sollte ich ihm jemals wieder vertrauen können nach dem, was er getan hatte?
Oder eher nicht getan hatte.
Er hatte nicht geredet. Kein einziges Mal in den vergangenen Jahren hatte er unsere gemeinsame Nacht angesprochen. Ich konnte nur spekulieren, was seine Gründe dafür waren, aber ich kehrte immer wieder zu dieser einen Erkenntnis zurück: Es hatte ihm nichts bedeutet.
Oder zumindest nicht genug.
Wenn ich ihm auch nur im Ansatz so viel bedeutete wie er mir, hätte er mit mir geredet, mir seine Gefühle gestanden und auf eine Wiederholung jener Nacht gehofft, oder nicht? Ich jedenfalls hätte niemals genug von ihm bekommen können.
Und ich trauerte nicht nur um das, was gewesen war, sondern auch um das, was hätte sein können. Hätte Gavin nur mit mir gesprochen, anstatt unsere Freundschaft zu beenden – wir hätten so glücklich sein können! Und wie viele der ersten Male, welche sich die vierzehnjährige April vorgestellt hatte, wir gemeinsam hätten erleben können. Doch stattdessen hatten wir nichts. Gar nichts!
Tränen liefen mir leise über die Wangen und hinterließen eine feuchte Spur auf dem Kissen, das ich mir unter den Kopf geschoben hatte. Ich griff nach der Fernbedienung und spulte ein paar Minuten zurück, weil ich erneut nichts von meiner Serie mitbekommen hatte, als es an der Tür klingelte.
Das musste mein bestelltes Sushi sein.
Ich pausierte, sprang von der Couch auf und wischte mir eilig über die Augen, auch wenn das nichts brachte. Ich hatte so viel geweint, dass es sich anfühlte, als hätten sich die Tränenbäche bereits in meine Gesichtszüge eingegraben. Ich schniefte erneut, bevor ich den Knopf für die Gegensprechanlage drückte. »Hallo?«
»April …«
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Gavins Stimme klang verzerrt und mechanisch durch die Anlage, dennoch erkannte ich sie – und die Tränen, die ich so mühevoll zurückgedrängt hatte, kehrten zurück. Was machte er hier?
»Lass mich rein.«
»Nein«, krächzte ich.
»Bitte. Ich muss mit dir reden.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich will aber nicht mit dir reden.«
»April, bitte …«
»Verschwinde!«, fauchte ich und ließ den Knopf der Gegensprechanlage los. Ich konnte mir jetzt nicht anhören, was Gavin zu sagen hatte; stattdessen lehnte ich meine Stirn gegen die Wand und wartete darauf, dass er erneut klingelte, aber es blieb ruhig.
Meine zittrige Atmung war das einzige Geräusch in der Wohnung, die mir auf einmal unheimlich leer erschien. Ohne Gavin. Ohne Jack. Und ohne Luca. Er hatte mir eine Nachricht geschrieben, weil ich nicht zum Brunch mit Dad und Joan gekommen war, aber ich hatte ihn abgewimmelt. In diesem Moment wünschte ich mir allerdings, er wäre hier, um mich in den Arm zu nehmen und mich zu trösten.
Es klopfte an der Tür.
Ich erstarrte.
Es klopfte erneut.
»Lass mich rein, April.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Bitte.«
»Nein!«
»Lass es mich erklären.« Die Verzweiflung war Gavin anzuhören, doch sie reichte nicht aus, um meine Meinung zu ändern. Ich konnte nicht mit ihm reden. Es ging nicht. Ich war nicht bereit! Ich konnte mir keine beschissenen Ausreden und Ausflüchte von ihm anhören. Und erst recht wollte ich keine Entschuldigung, denn was immer er mir zu sagen hatte, es war nicht genug. Und vielleicht wäre es niemals genug. Manchmal reichten Reue und Bedauern nicht aus, um einen Fehler wiedergutzumachen.
»Ich will keine Erklärung. Ich will, dass du gehst!«
Gavin antwortete nicht. Ich hörte einen dumpfen Schlag, als hätte er seine Stirn gegen die Tür fallen lassen. »Ich verstehe, dass du sauer und enttäuscht von mir bist, aber wenn ich jetzt gehe, lass ich dich nur wieder im Stich, wie damals, und das will ich nicht. Lass mich für dich da sein.«
Ich presste die Hände vor den Mund, um ein Wimmern zu unterdrücken. Mir war unerklärlich, wie es möglich sein konnte, so viele verschiedene Gefühle gleichzeitig für eine einzige Person zu empfinden. Da waren allein vier verschiedene Arten von Schmerz, die meinen Magen in einen Klumpen verwandelten. Dazu gesellten sich Sehnsucht, Verbundenheit und Zuneigung. Ich hätte mich gern von Gavin trösten lassen, aber wie konnte er mir Trost spenden, wo er doch für all diesen Schmerz verantwortlich war?
»Bitte«, flehte ich.
»April …«
Meine Stimme brach. »Geh.«
»May …«
Meine Sehnsucht löste sich bei der Erwähnung des liebevollen Kosenamens mit einem Schlag in Luft aus. Er erschien mir dermaßen falsch und verlogen, dass aus meinem Schmerz urplötzlich Wut wurde. Ich klammerte mich an dieser Wut fest. Sie gab mir den Halt und die Kraft, die Tür zu öffnen. Ich riss sie auf und starrte Gavin an. Er sah genauso furchtbar aus, wie ich mich fühlte. Sein schwarzes Haar war zerzaust, dunkle Schatten lagen unter seinen rot unterlaufenen Augen. Doch in diesem Moment war es mir egal.
»Nenn mich nicht so!«, fuhr ich ihn durch zusammengebissene Zähne an. »Nenn mich nie wieder so!« Meine Hände zitterten, Tränen des Zorns liefen mir über die Wangen. Ich versuchte nicht, sie zu verstecken. Er sollte sehen, was er angerichtet hatte. »Und jetzt verschwinde!«
Ich holte aus, um die Tür zuzuschlagen, aber Gavin schob blitzschnell seinen Fuß dazwischen. Der Aufschlag musste wehtun, dennoch verzog er keine Miene. Da war nur der Schmerz, der bereits von Anfang an in seinen Augen gelegen hatte.
»Bitte … April. Ich brauche nur fünf Minuten.«
Ich schüttelte den Kopf. Erst langsam, dann heftig. »Es ist mir scheißegal, was du willst oder brauchst. Damals wollte ich nicht allein sein, aber jetzt will ich es. Und du hast kein Recht herzukommen, um dein Gewissen zu erleichtern, weil du dich jetzt danach fühlst. Ich will dich nicht mehr sehen. Und nichts mehr von dir hören. Ich will, dass du gehst und mich in Ruhe lässt!«
Erneut holte ich mit der Tür aus, bereit, sie zuzuschlagen oder ein weiteres Mal gegen Gavins Fuß zu donnern. Seine Entscheidung. Ich hielt seinen schmerzerfüllten Blick fest, auch wenn ich mir damit selbst nur mehr wehtat. Flehend sah er mich an, und kurz wirkte es, als wollte er noch etwas sagen, doch dann zog er seinen Fuß zurück.
Erleichterung durchflutete mich, und ich ließ die Tür zufallen, so fest, dass der Schlag einige Sekunden nachhallte. Einige Herzschläge lang war es still, dann erklangen Gavins Schritte. Er ging und ließ mich mit meiner neu gefunden Wut allein.
Als ich hörte, wie ein Schlüssel im Schloss der Wohnungstür herumgedreht wurde, erstarrte ich in der Bewegung und mein Puls schnellte für eine panische Sekunde in die Höhe – bis ich erkannte, dass es Luca war, der zur Tür hereinkam. Meine Schultern sackten vor Erleichterung nach unten, und ich ließ mich zurück auf die Couch sinken.
»Hey. Gavin hat mir geschrieben, dass ich mal nach dir sehen soll, weil es dir nicht gut geht? Ist alles …« Luca verstummte, als er mich sah. Wie angewurzelt blieb er stehen und starrte mich an. Die Wut, die Gavin in mir ausgelöst hatte, hatte ganze fünf Minuten gehalten, ehe sie wieder zu Trauer und Schmerz geworden war, was ich nicht vor Luca verbergen konnte.
»Was ist los?«, fragte er und kam auf mich zu.
Ich schüttelte den Kopf, weil sich meine Kehle gefährlich eng anfühlte, aber es war offensichtlich, dass das Luca nicht reichte, also rang ich mir ein gequältes »Nichts« ab.
»Sehr glaubhaft, vor allem mit dem Rotz an der Nase«, sagte er und reichte mir ein Taschentuch, das er aus seiner Jackentasche gezogen hatte. Ich putzte mir die Nase, bemüht, nicht zu weinen, während er sich neben mich auf die Couch setzte und mich musterte. Sein Tonfall war warm und mitfühlend und stand in starkem Kontrast zu seinem düsteren Gesichtsausdruck. »Was ist passiert?«
»Ich …«, war alles, was ich herausbrachte, bevor ich erneut zu weinen begann. Ich schlug die Hände vors Gesicht, aber konnte meine Tränen nicht zurückhalten.
Luca seufzte und nahm mich in den Arm.
Ich ließ mich gegen ihn sinken. Es fühlte sich verdammt gut an, gehalten zu werden, nachdem ich in den letzten Stunden allein zerbrochen war. Ich drückte mich an Lucas Brust, und das Einzige, was meine Tränen davon abhielt, in seinen Pullover zu sickern, waren meine Hände, die ich noch immer vor mein Gesicht gepresst hielt.
»Pssst«, säuselte Luca in mein Ohr und rieb mir über den Rücken. »Alles wird gut.«
Nein, wird es nicht. Denn ich sah keine Chance mehr für Gavin und mich. Ich hatte wirklich geglaubt, dass wir es dieses Mal schaffen könnten. Dass wir wieder Freunde sein könnten – mehr als Freunde –, aber diese Hoffnungen gehörten der Vergangenheit an.
»Was ist passiert?«, fragte Luca erneut.
Ich antwortete nicht.
»Ist es wegen der SHS?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ist es, weil Jennifer nicht zur Eröffnung gekommen ist?«
Ich verneinte abermals.
Er atmete tief ein und wieder aus. »Hat es etwas mit Gavin zu tun?«
Ein ungewolltes Wimmern brach aus mir hervor, das Luca anscheinend Antwort genug war. Er stieß einen Fluch aus und drückte mich noch fester an sich. Beruhigend streichelte er mir über den Rücken, während ich hemmungslos an seiner Brust weinte.
Keine Ahnung, wie lange er mich festhielt, aber ich weinte, bis ich nicht mehr konnte. Langsam, weil mir jede Bewegung wie ein Kraftakt erschien, löste ich mich von Luca. Eine tiefe Furche war auf seine Stirn getreten, und der besorgte Blick, mit dem er mich bedachte, hätte mich möglicherweise abermals zum Weinen gebracht, wäre ich nicht vollkommen ausgetrocknet gewesen.
Luca strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr und reichte mir ein weiteres Taschentuch, mit dem ich mir erneut die Nase putzte. Erwartungsvoll sah er mich an. Ich hatte keine Lust, mich zu erklären. Doch nach meiner Heulattacke war ich ihm eine Antwort schuldig.
»Wo ist Gavin?«, fragte er, so vorsichtig, als würde er die Antwort bereits kennen.
»Weg.«
»Wie meinst du das?«
Ich schluckte. »Ich … Ich habe ihn weggeschickt.«
»Habt ihr Schluss gemacht?«
»Sozusagen«, antwortete ich ausweichend, weil ich nicht einmal sicher war, ob Gavin und ich jemals richtig zusammen gewesen waren. Es hatte sich so angefühlt, aber wir hatten nicht einmal genug Zeit miteinander gehabt, um darüber zu reden.
»Was ist passiert?«
Ich verzog die Lippen. »Das willst du nicht wissen.«
»Wenn dem so wäre, würde ich dich nicht fragen.«
»Ehrlich Luca, das willst du nicht hören.«
Er hielt meinen Blick unbeirrt fest. »Hör auf mit dem Mist. Gestern war noch alles okay. Wir hatten einen tollen Abend. Dann schickst du Dad in aller Früh eine ominöse Nachricht, dass du nicht zum Brunch kommen kannst, und plötzlich schreibt mir Gavin, dass ich nach dir sehen soll. Worauf ich dich in diesem Zustand vorfinde.« Er zeigte bedeutungsschwer auf mich. »Was erwartest du von mir? Dass ich gehe und so tue, als wäre nichts? Sorry, aber so funktioniert das nicht. Ich habe bereits einen besten Freund, der nicht mit mir redet. Bitte fang du nicht auch noch damit an.«
Flehend legte er mir eine Hand aufs Knie. Seine Augen so voller Sorge und Verständnis, dass ich nicht anders konnte, als ihm die Wahrheit zu erzählen. Die ganze Wahrheit. Denn Luca wusste von nichts. Er wusste weder, wie Gavins und meine Freundschaft geendet hatte, noch dass ich damals auf seiner Party nach zu viel Tequila meine Jungfräulichkeit verloren hatte.
Ihm davon zu erzählen war zuerst befremdlich und unbequem, und die Worte verließen meinen Mund nur zögerlich, weil der erste Sex nicht gerade etwas war, worüber man gern mit seinem Bruder redete. Vor allem, wenn es unwissentlich mit dessen bestem Freund passiert war. Aber nach den ersten steifen Sätzen sprudelten die Worte nur so aus mir heraus, weil ich all das viel zu lange für mich behalten hatte. Hier und da hatte ich meinen Freunden verwässerte Versionen der Wahrheit erzählt, noch nie hatte ich jemandem offenbart, wie es mir in dieser Nacht wirklich ergangen war, weil ich mich geschämt hatte.
Ich gestand Luca, dass ich schon damals in Gavin verliebt gewesen war und wie weh es getan hatte, ihn mit einer anderen auf der Party zu sehen. Was mich überhaupt erst dazu gebracht hatte, mich zu betrinken. Ich offenbarte ihm, dass ich mich nicht daran hatte erinnern können, mit wem ich in jener Nacht Sex gehabt hatte, bis Gavin es mir vor wenigen Stunden gesagt hatte, nur wenige Momente bevor ich geplant hatte, erneut mit ihm zu schlafen.
Luca war anzusehen, dass ihm nicht gefiel, was er hörte. Ein harter Zug umspielte seine Lippen, die er fest aufeinanderpresste, wie um sich davon abzuhalten, mich zu unterbrechen. Ich erzählte ihm auch, wie Gavin damals unsere Freundschaft beendet hatte. Rückblickend konnte ich nicht glauben, dass ich die Verbindung zwischen jener Nacht und dem Ende unserer Freundschaft nie hergestellt hatte. Auf einmal erschien es mir so offensichtlich, aber ich hatte es damals wohl nicht sehen wollen.
»… also habe ich ihn weggeschickt«, endete ich und wischte mir mit dem Handrücken die stummen Tränen weg, die mir erneut über die Wangen liefen. Erwartungsvoll sah ich Luca an. Seine Augenbrauen waren fest zusammengezogen und sein Blick war so eindringlich, dass er jemand anderem vielleicht Angst eingejagt hätte.
»Ich kann nicht glauben, dass Gavin und du … dass ihr … du weißt schon«, sagte Luca und schüttelte resigniert den Kopf. Er hatte die Hände in seinem Schoß zu Fäusten geballt. Die Haut spannte blass über den Fingerknöcheln. »Würde es dir nicht so beschissen gehen, wäre ich echt wütend auf dich, weil du nicht früher mit mir darüber gesprochen hast. Ich hab damals bemerkt, dass du dich nach der Party komisch verhalten hast, aber ich dachte, mit all den fremden Leuten wäre es dir einfach zu viel gewesen. Warum hast du nichts gesagt?«
»Weil es nichts geändert hätte.«
»Ich hätte dir helfen können.«
»Womit?«
»Ich weiß nicht. Irgendwas!«
»Du hättest damals nichts für mich oder uns tun können«, versicherte ich ihm. Ich hatte in der Vergangenheit des Öfteren darüber nachgedacht, mit Luca über alles zu sprechen. Aber ich hatte es nie getan, eben weil es nichts gab, womit er uns hätte helfen können, und das Wissen ihm nur Sorgen und Kummer bereitet hätte – wie jetzt.
»Und heute?«, fragte Luca. Zögerlich öffnete er seine Faust und griff nach meiner Hand. Meine Finger waren eiskalt und schwitzig, aber das schien ihn nicht zu stören. »Kann ich heute irgendetwas für dich tun?«
»Ich glaube nicht.«
Sein Blick wurde weicher. »Weißt du, wo Gavin jetzt ist?«
»Keine Ahnung. Und es ist mir auch egal.«
»Glaubst du, er kommt noch mal zurück?«
»Ich hoffe nicht.«
Luca sah mich an, und ich erkannte in seinen Augen aufrichtige Sorge und dazu etwas anderes, das ich nicht greifen konnte, mir aber das Herz zusammenschnürte.
»Was hältst du davon, dich umzuziehen und mit mir zu Sage zu fahren?«, schlug er mit einem aufmunternden Lächeln vor. »Wir holen mein Zeug, und ich zieh wieder ein. Wir können den Rest des Wochenendes Filme schauen. Und sollte Gavin doch wieder auftauchen, kümmere ich mich um ihn. Wie klingt das?«
»Gut«, antwortete ich, selbst wenn es eine Lüge war.
Nichts hörte sich gut an. Denn nichts war gut. Aber es spielte auch keine Rolle, womit ich den restlichen Tag, das restliche Wochenende oder die nächste Woche verbrachte. Alles würde jetzt für eine Weile scheiße sein – und schmerzvoll.
Scheiße schmerzvoll.
4. Kapitel
APRIL
Gavin war überall.
Ich hatte fünf Jahre gebraucht, um ihn aus meinem Herzen zu verbannen, und er nur fünf Wochen, um wieder einen Platz darin zu finden. Ich konnte nirgendwo sein, ohne an ihn erinnert zu werden.
Im Wohnzimmer lagen noch zwei seiner Bücher aus der Bibliothek.
In der Küche war der Kühlschrank voll mit seinen veganen Snacks.
Im Bad war das Handtuch, mit dem er mich abgetrocknet hatte.
Und in meinem Schlafzimmer entdeckte ich immer neue Scherben der Lampe, die er umgestoßen hatte. Ich hatte schon zweimal gestaubsaugt, dennoch war ich am Morgen beim Anziehen in einen Splitter getreten. Sofort hatte ich angefangen zu weinen, nicht wegen des körperlichen Schmerzes, sondern wegen der Erinnerung an Samstag.
Nachdem ich mich ausgeheult hatte, hatte ich wie in Trance die Scherbe entfernt und mich für den Tag fertig gemacht. Die Minuten danach waren verschwommen. Ich hatte keine Erinnerung daran, wie ich zur MVU gefahren war, trotzdem saß ich nun in meinem Wagen und beobachtete durch die Windschutzscheibe die Studierenden, die an mir vorbei in Richtung der Fakultäten schlenderten, als hätte sich nichts verändert.
Doch ich hatte mich verändert. Ich war nicht mehr die Person, die am Freitag den Campus verlassen hatte. Zumindest fühlte ich mich nicht länger wie diese Person. Die April von Freitag war stark und unerschrocken gewesen, stolz auf das, was sie mit der SHS geschaffen hatte, und unglaublich glücklich und verliebt in ihren besten Freund. Die April von heute hingegen fühlte sich wie gelähmt, wenn sie sich vorstellte, besagtem Freund möglicherweise über den Weg zu laufen.
Nachdem Gavin unsere Freundschaft beendet hatte, hatte ich auch nicht gewusst, wie ich mit ihm umgehen sollte. Damals hatte ich mir eingeredet, dass alles leichter und besser zu verkraften wäre, wenn ich den Grund für seine Entscheidung kennen würde. Nun kannte ich ihn und nichts war besser. Ganz im Gegenteil, es war noch viel schlimmer.
»Kommst du?«
Ich blinzelte und drehte den Kopf zur Seite. Luca war ausgestiegen, beugte sich aber nun wieder zurück ins Innere des Wagens. Er hatte die Lippen fest aufeinandergepresst, und in seinem Blick spiegelte sich Sorge, wie ich sie bei ihm bisher nur selten erlebt hatte.
»Ich … Ich glaub, ich will nicht aussteigen«, gestand ich. Meine Stimme zitterte, weil ich schon wieder mit den Tränen kämpfte. Das war doch nicht normal, oder? Ich hatte mir bereits das ganze Wochenende die Augen aus dem Kopf geheult.
Luca seufzte. »Oh, April …«
Er kletterte zurück in den Wagen, schloss die Tür hinter sich und beugte sich über die Konsole, um mich zu umarmen. Das hatte er in den letzten zwei Tagen öfter getan als in all den Monaten zuvor. Gemeinsam mit Sage hatte er am Wochenende alles darangesetzt, mich aufzumuntern, aber nichts hatte geholfen, weder der Game-of-Thrones-Marathon noch die heiße Schokolade oder die vielen Süßigkeiten.
Nichts fühlte sich mehr gut an.
»Wenn du wirklich nach Hause willst, können wir gern wieder fahren. Ich komm mit, dann chillen wir den Rest des Tages auf der Couch«, sagte Luca, nachdem er mich losgelassen hatte. »Aber früher oder später musst du zurück an die Uni. Und ich glaube nicht, dass es morgen oder übermorgen leichter sein wird als heute. Der einzige Unterschied wird sein, dass du den ersten Tag der SHS verpasst, und ich denke, dass würdest du später bereuen.«
Ich würgte meine Tränen runter. »Du hast vermutlich recht.«
»Ich weiß, ich hab nämlich immer recht.«
»Du bist so ein Klugscheißer.«
»Und trotzdem liebst du mich.« Luca verpasste mir einen sanften Stoß gegen die Schulter. Ich brachte ein trauriges Lächeln zustande. »Und jetzt komm. Ich bring dich zu deiner Vorlesung.«
Luca schnappte sich meinen Rucksack von der Rückbank, um ihn für mich zu tragen, während ich die Sonnenblende nach unten klappte, um mein Gesicht im Spiegel zu prüfen. In weiser Voraussicht hatte ich wasserfeste Mascara aufgetragen, dennoch war nicht zu übersehen, dass ich geweint hatte. Meine Augen waren rot geschwollen, und mein Gesicht wirkte aufgedunsen. Ich hasste es. Nachdem ich aus dem Wagen gestiegen war, setzte ich trotz des bewölkten Himmels meine Sonnenbrille auf.
Schweigend liefen Luca und ich nebeneinanderher, wobei jeder meiner Schritte von der Angst begleitet wurde, möglicherweise Gavin zu begegnen. Doch trotz dieser Angst suchte mein Blick in der Menge instinktiv nach ihm. Und jedes Mal, wenn ich einen Kerl mit dunklen Haaren um die eins achtzig entdeckte, oder sogar einen, der eine Mütze trug, zuckte ich innerlich zusammen.
Wir erreichten meine Fakultät. Vor dem Eingang blieben wir stehen.
»Kommst du allein klar?«, fragte Luca.
Nein.
»Ja.«
Er nickte skeptisch. »Okay, aber schreib mir, wenn was ist.«
»Mach ich.«
»Gut. Viel Erfolg mit der SHS. Sage und ich schauen später vorbei.«
»Danke.«
Luca gab mir meinen Rucksack zurück, drückte mir zum Abschied einen Kuss auf die Stirn, was mich erneut den Tränen nahebrachte, und wartete anschließend, bis ich reinging.
Ich folgte dem langen Flur bis zum Hörsaal, dabei hielt ich nach Aaron Ausschau. Da ich ihn nirgendwo entdecken konnte, suchte ich uns zwei freie Plätze. Mit einem erleichterten Seufzen ließ ich mich auf den Stuhl fallen. Zumindest hier musste ich keine Angst haben, ungewollt Gavin zu begegnen. Seine Fakultät lag auf der anderen Seite des Campus und ich glaubte nicht, dass er dreist genug war, hier aufzutauchen.
Ich war gerade dabei, meinen Laptop zu entsperren, als Aaron so schwungvoll auf den Stuhl neben mir plumpste, dass das Holz knackte und knarzte. »Oh. Mein. Gott! Du wirst nicht glauben, was am Wochenende passiert ist. Connor und …« Er brach mitten im Satz ab, als sein Blick auf meine verheulten Augen traf. »Was ist los?«
»Gavin und ich haben Schluss gemacht.«
Einen Moment wirkte Aaron sprachlos. »Du warst mit Gavin zusammen?«
Gott, wie ätzend war das? Gavins und meine Beziehung, falls man es so nennen wollte, hatte nicht einmal lange genug gehalten, dass ich Aaron schwärmerisch davon hatte erzählen können. Wir hatten uns bedeckt gehalten, um etwas Zeit nur für uns zu haben und die Sache vor Luca geheim zu halten. Auf der Halloweenparty im Le Petit hatte er uns dennoch zusammen erwischt, weshalb wir uns auf dem SHS-Empfang am Freitag nicht mehr versteckt hatten, aber wir hatten unsere Liebe auch nicht lauthals hinausposaunt. Vermutlich war Aaron bei beiden Events zu sehr auf Connor und Derek fixiert gewesen, um auf uns zu achten.
»Ja, war ich … sozusagen.«
»Oh Mann, tut mir leid. Was ist passiert?«
Auf diese Frage gab es keine leichte Antwort und erst recht keine kurze. Und mir stand auch nicht der Sinn danach, vor den Augen meiner Kommilitonen abermals in Tränen auszubrechen, denn das würde ohne Zweifel geschehen, wenn ich Aaron in aller Ausführlichkeit erzählte, was sich zwischen Gavin und mir abgespielt hatte. Glücklicherweise kam ich vorerst um eine Antwort herum, da Professor Sinclair den Raum betrat und unsere Aufmerksamkeit forderte.