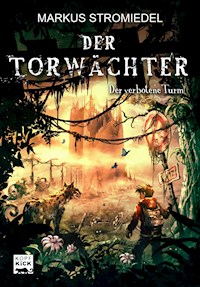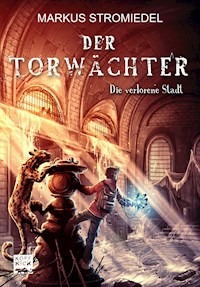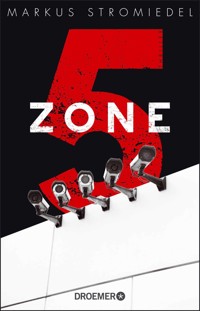
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Um 2060 ist Deutschland in Zonen aufgeteilt. Auch Köln ist eine geteilte Stadt, abhängig von einem indischen Pharmamulti, geschieden in streng voneinander abgeschottete Bezirke. Die Reichen leben in luxuriösen Bereichen im Stadtzentrum, während jenseits der Grenzmauern die Armen in den Slums um ihr Überleben kämpfen. Alex, eine junge Frau aus der Zone 4, begehrt gegen das System auf. Ihre lebensbedrohlich erkrankte Zwillingsschwester braucht ein Medikament, das es nur in der ersten Zone gibt. Der Versuch, dort dieses Medikament zu beschaffen, wird Alex zum Verhängnis. Sie wird gefasst – auf unerlaubten Grenzübertritt steht die Todesstrafe. David, ein junger privilegierter Anwalt der Zone 1, übernimmt ihre Verteidigung und setzt eine Eskalation in Gang, mit der niemand gerechnet hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Markus Stromiedel
Zone 5
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Um 2060 ist Deutschland in Zonen aufgeteilt. Auch Köln ist eine geteilte Stadt, abhängig von einem indischen Pharmamulti, geschieden in streng voneinander abgeschottete Bezirke. Die Reichen leben in luxuriösen Bereichen im Stadtzentrum, während jenseits der Grenzmauern die Armen in den Slums um ihr Überleben kämpfen. Alex, eine junge Frau aus der Zone 4, begehrt gegen das System auf. Ihre lebensbedrohlich erkrankte Zwillingsschwester braucht ein Medikament, das es nur in der ersten Zone gibt. Der Versuch, dort dieses Medikament zu beschaffen, wird Alex zum Verhängnis. Sie wird gefasst – auf unerlaubten Grenzübertritt steht die Todesstrafe. David, ein junger privilegierter Anwalt der Zone 1, übernimmt ihre Verteidigung und setzt eine Eskalation in Gang, mit der niemand gerechnet hat …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
Neun Tage zuvor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Danksagung
Vom Autor empfohlene Lektüre
»Neues schaffen heißt
Widerstand leisten.
Widerstand leisten heißt
Neues schaffen.«
Stéphane Hessel, Empört Euch!
Prolog
Der Tag, an dem der Kölner Dom einstürzte, war bis zu jenen Minuten kurz vor Sonnenuntergang bedrückend gewöhnlich gewesen. Die Unwetter der vergangenen Tage hatten sich gen Osten verzogen, es war wieder heiß und trocken, und so strömten die Besucher aufgeregt und erwartungsvoll plaudernd aus dem Bahnhofsgebäude hinüber zur Domplatte, dem Platz vor dem Westportal der Kathedrale. Der Zwischenstopp in Köln war für die meisten von ihnen der Höhepunkt ihrer Rundreise, die Stadt am Rhein war ein »Hotspot«, seitdem die Slums jenseits der Sperrmauer abgeriegelt worden waren. Nur ein kleiner Teil der Touristen vertraute sich den bunt uniformierten Führern an, die sie in das Innere der Kathedrale zu den Kopien längst ausgelagerter Kunstwerke führten. Die weitaus größere Zahl der Besucher stieg auf den Südturm, um von dort mit einem wohligen Grusel einen Blick auf die Stadt zu werfen. Dass sie zu den letzten Menschen gehörten, die den Schwarzen Dom am Rhein besuchten, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand.
Noch Tage später konnten alle, die das Unglück miterlebt hatten, nicht fassen, was geschehen war. Nichts hatte das Drama angekündigt, das zumindest behauptete der Net-Jockey, der auf die Gleise der IZE-Strecke stürmte und von der Rheinbrücke aus die ersten Bilder des schwelenden Schuttberges hinaus in die Welt sendete. Dass diese Einschätzung falsch war und mehr von der Unwissenheit des Reporters denn von den tatsächlichen Ereignissen zeugte, interessierte das schockierte Publikum nicht.
Dann fluteten die Bilder der Portcams das Netz: das Zittern der Häuser, als eine Detonation die Domplatte bersten ließ, der schwankende Südturm mit dem dumpf läutenden Dicken Pitter, das einbrechende Strebewerk am Langhaus, die durch die Wände des Hauptschiffes peitschenden Risse. Schließlich sackte die Westfassade ab, sie schien im Boden zu versinken, und schleuderte eine gewaltige Wolke aus Mörtel und Staub in den Himmel, eine Höllenfaust, die aus der Unterwelt emporfuhr und die beiden kippenden Türme mit sich riss. Minutenlang brach das W-Net zusammen, weil User in der ganzen Welt auf die Spots und Tracks zugriffen und in einer Mischung aus Entsetzen und Faszination der Kathedrale beim Einstürzen zusahen.
Was in den Minuten danach geschah, im Schutz der Staubglocke, die den Dom und die umliegenden Straßen verhüllte, bemerkte kaum jemand. Zeugen hörten Rufe, das Dröhnen schwerer Motoren, eine Reihe kleinerer Explosionen. Dann war es still, bis auf das Geräusch herabstürzender Steine und Mauerbrocken. Ihr Poltern vermischte sich mit den überraschten Schreien der Augenzeugen, die mit zitternden Fingern die Speicher ihrer Portcams abriefen und ihre Tracks in die Welt hinausschickten.
Der Staub über dem Schuttberg hatte sich noch nicht gesenkt, als schon die ersten Spekulationen durch das W-Net geisterten: Es war ein Anschlag der Exterritorialen, eine christlich-fundamentalistische Verschwörung, eine ungebändigte Naturgewalt, die gerechte Gottesstrafe oder der Angriff einer außerterrestrischen Intelligenz, die sich die Stadt am Rhein ausgesucht hatte, um ihre Macht zu demonstrieren. Andere Stimmen behaupteten, der europäische Präsident habe die Sprengung des Doms angeordnet, um sie den Terroristen der fünften Zone in die Schuhe zu schieben und sich fortan als heroischer Kämpfer gegen das Böse zu inszenieren.
In der Tat gab es viele Fragen, die den Verschwörungstheoretikern in der ganzen Welt für Monate Nahrung gaben: Warum war das gesamte Stadtzentrum eine Stunde zuvor geräumt worden? Wie konnte es unterhalb der Westfassade zu einer Explosion kommen, obwohl das Fundament der Kathedrale massiv sein sollte? Warum kreisten nur Minuten später zwei Hubschrauber des ESS über der Unglücksstelle, wo es doch kaum genug Einsatzkräfte gab, um die Grenzen der Zonen zu sichern? Warum umstellte die bereitstehende Private Task Force der Medical Ind Corporation den Unglücksort und hielt jeden, der dem Dom zu nahe kommen wollte, zurück?
Der Sprecher des Präsidenten versicherte, niemand in Brüssel habe geahnt, was in Köln geschehen würde. Hätte man es gewusst, wäre alles nur Denkbare unternommen worden, das Unglück zu verhindern. Wer würde, fragte er in Unkenntnis der deutschen Geschichte, sehenden Auges ein UNESCO-Weltkulturerbe aufgeben und die Zerstörung eines der beeindruckendsten Monumente der Welt riskieren?
Erst Monate später wurde bekannt, dass die Ereignisse, die zu der Explosion im Untergrund geführt hatten, von den Geheimdiensten der Allianzen bis in das letzte Detail dokumentiert worden waren. Nur wusste nicht jeder alles, die konkurrierenden Dienste sprachen nicht miteinander. Und so nahmen die Ereignisse ungehindert ihren Lauf, bis der Kölner Dom nicht mehr stand.
Es war ein guter Tag für Köln.
Neun Tage zuvor
1
Ein leises Summen ließ die Fahrgäste des IZE955 aufmerken. Der VI-Projektor in der Decke des Waggons flackerte auf und projizierte den Chef der Train-Security in den Gang. Der Uniformierte versuchte ein Lächeln, was angesichts seines bedrohlichen Aussehens und der schweren Waffe in seiner Hand seltsam wirkte. Noch zehn Minuten bis zum Zielbahnhof, verkündete er und bleckte die Zähne, der InterZonenExpress aus Frankfurt werde Köln sicher und pünktlich erreichen.
David ließ das Display seines FlexComs zusammenschnurren und stellte die Rückenlehne seines Sitzes aufrecht. Kritisch betrachtete er sein Spiegelbild im Glas der dunkel getönten Fensterscheibe. Der Anblick war ungewohnt: David sah einen Anzugträger, einen jener Typen, denen er bisher mit einer Mischung aus Abscheu und heimlicher Anerkennung begegnet war. Der Anzug saß perfekt, sein dunkles Haar war akkurat geschnitten, und er trug eine stylishe Brille, ein Geschenk seiner Eltern, die nicht ahnten, wo er sein Anerkennungsjahr verbringen würde. David seufzte.
Sonnenlicht verdrängte das Spiegelbild, die Schutzschilde vor den Fenstern glitten zur Seite und gaben den Blick nach draußen frei. Geblendet kniff David die Augen zusammen. Sie näherten sich Köln, der Zug durchquerte gerade das Firmengelände der Medical Ind Corporation, ein Medizintechnologiekonzern, dessen gewaltige Produktionsanlagen sich bis in das ehemalige Kölner Stadtgebiet am Ostufer des Rheins ausgebreitet hatten. Der Fluss blitzte durch das Gewirr aus Tanks und Stahlrohren herüber. Wenig später entdeckte David die Streben der alten Rheinbrücke, die den Strom überspannte, direkt dahinter ragte das Wahrzeichen der Stadt in den Himmel: der Schwarze Dom. Die Slums der Zone 4 umklammerten das Zentrum Kölns wie eine graue, amorphe Masse.
»Na, freust du dich?« Patrick, der im Sessel neben ihm saß, hatte so wie David aus dem Fenster gesehen, jetzt grinste er ihn spöttisch an. »Traumhaft, nicht wahr?«
Der Zug verlangsamte sein Tempo und glitt in die Grenzanlage. Lautlos schlossen sich die Tore der Sicherheitsschleuse, während Scanner die Daten der Fahrgäste lasen und nach blinden Passagieren suchten. Nach einiger Zeit öffneten sich die Tore wieder, und der Zug setzte sich in Bewegung, um langsam die Rheinbrücke zu passieren.
David stand auf und griff sich seine Reisetasche.
Patrick war ernst geworden. »Mensch, David, mach keinen Scheiß! Was du vorhast, ist total bescheuert.« Er wies aus dem Fenster. »Wen willst du hier als Anwalt verteidigen? Taschendiebe? Oder Komasäufer?«
David antwortete nicht.
Auffordernd legte Patrick die Hand auf seinen Arm. »Komm mit mir nach Paris! Ich rede mit den Leuten bei der MIC, dann kannst du dich dort bewerben. Oder geh in Gottes Namen nach Brüssel, wenn du unbedingt die Welt verbessern willst.«
»Lass gut sein, Patrick. Ich bleibe hier.« David zwang sich zu einem Lächeln.
Patrick starrte ihn fassungslos an. »Du willst das wirklich durchziehen?«
»Ja, klar. Was denkst du denn?«
Patrick schwieg einen Moment, dann zuckte er mit seinen Schultern. »Na ja, wenn du dir wirklich sicher bist …«
David war sich nicht sicher. An der Uni in Frankfurt hatte es sich gut angefühlt, den Rebell zu geben und sich um eine Stelle in der Kanzlei von Dr. Andreas Schoop zu bemühen. Schoops Ruf als Anwalt war legendär, und viele der Verfahren, die er in der Vergangenheit angestrengt hatte, galten in der Fachwelt als richtungsweisende Präzedenzfälle. Nächtelang hatte David in der juristischen Bibliothek vor dem Bildschirm gesessen und die Protokolle und Aufzeichnungen der Verhandlungen studiert, fasziniert von dem Geschick und der Raffinesse, mit der Schoop vor Gericht seine Verteidigungslinien aufgebaut hatte. In seiner Begeisterung für Schoop und seine Arbeit hatte David nicht wahrhaben wollen, dass der Anwalt schon seit Jahren mit keinem Auftritt mehr von sich reden machte. Sein letztes großes Verfahren als Strafverteidiger war ein Prozess gegen eine Menschenrechtsaktivistin gewesen, nach deren Hinrichtung er abgetaucht zu sein schien. Schoops große Zeiten waren vorbei. David war das endgültig klargeworden, als nur wenige Tage nach dem Versand seines Bewerbungsspots eine Zusage von Schoops Kanzlei gekommen war. Die Studienkollegen, die sich um Plätze in den großen Kanzleien von Frankfurt, Singapur oder São Paulo bemüht hatten oder die in die Firmenzentralen der multinationalen Konzerne gingen, mussten nach ihren Bewerbungen wochenlange Aufnahmeverfahren über sich ergehen lassen.
Schweigend stopfte David sein FlexCom in seine Tasche. Er konnte nicht mehr zurück. Er hätte den Spott seiner Kommilitonen nicht ertragen.
Sie fuhren in den Bahnhof ein, Gleis 1, wie angekündigt, die Gepäckträger standen bereit. Der Zug stoppte mit einem sanften Ruck, zischend öffneten sich die Türen. David zog den Verschluss seiner Tasche zu. Er grinste seinen Freund an. »Grüß die Pariserinnen von mir.«
»Was hätten wir zusammen für Spaß haben können! Du Sturkopf.«
»Sturkopf! Das hat zuletzt meine Mutter zu mir gesagt.«
»Und sie hat recht. Oder soll ich lieber Idiot zu dir sagen?«
Statt einer Antwort knuffte David Patrick in die Seite. Die beiden umarmten sich kurz, dann warf sich David seine Reisetasche über die Schulter und ging zum Ausgang. In der Tür drehte er sich noch einmal um. »Ich schick dir einen Track. Ich sag dir, das wird großartig.«
Patrick winkte ab. »Ich trink ein Glas Rotwein auf dich, heute Abend auf den Champs-Élysées. Das wird großartig.«
David wusste nicht, was er antworten sollte. Patrick hatte recht. Er winkte ein letztes Mal und verließ den Zug.
Auf den Bahnsteig war es voll und heiß. Milde lächelte das Konterfei des Präsidenten von der Hallenwand auf das Gewimmel der Menschen herab. Viele der Passagiere waren ausgestiegen, um vor ihrer Weiterreise nach Paris für ein paar Stunden in Köln zu bleiben, und genauso viele drängten nach ihrem Zwischenstopp in der Domstadt wieder in den Zug. Alle hatten es eilig, der offenen Plattform zu entkommen, die Hitze, die auf der Stadt lastete, war unerträglich. Auch David beeilte sich, den Bahnsteig zu verlassen. Eine japanische Reisegruppe staute sich an der Rolltreppe, die hinab in die Tiefe führte, hinein in das Herz des Einkaufszentrums, das Kühle versprach. David wischte sich den Schweiß von der Stirn, während er der Gruppe folgte.
Der Kältevorhang strich über ihn hinweg, und David glitt hinein in ein Gewirr aus lauten Stimmen, schrillen Farben und penetranten Gerüchen. Genervt kniff er die Augen zusammen. Ihn störte die aufdringliche Nervosität, die in den Gängen des Bahnhofs herrschte. Die Flagstores der Konzerne drängten sich dicht an dicht, und während Hunderte Scanner seine Daten auslasen, sprangen ihm von allen Seiten die Werbebotschaften entgegen: von Displayfolien, Duftsäulen und VI-Projektoren, deren dreidimensionale Bilder sich ihm in den Weg stellten und ihn aufzuhalten versuchten. Lichter glitzerten, Waren funkelten wie Edelsteine, Musik kroch schmeichelnd in sein Ohr, und einem Mantra gleich wiederholte eine leise Stimme die Merksätze, die es zu befolgen galt, wollte man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein. David versuchte, das grelle Durcheinander nicht zu beachten. Es gelang ihm nur leidlich, da ihn jede zweite Werbung mit seinem Namen ansprach und Produkte anbot, die zu seinem gespeicherten oder errechneten Käuferprofil passten. Doch Davids Widerwille war größer als seine Neugier, und so erreichte er den Ausgang und verließ erleichtert das Gebäude.
Nach der klimatisierten Kühle traf ihn die Frühjahrshitze mit voller Wucht. Die von der Sonne aufgeheizten Steine des Bahnhofsvorplatzes schienen zu glühen. David eilte in den Schatten, den der direkt neben dem Bahnhofsgebäude aufragende Schwarze Dom auf den Platz warf. Das himmelsstrebende Bauwerk war gigantisch, eine Wirkung, die durch die tiefschwarze Färbung des Sandsteins noch betont wurde. Beeindruckt sah David an der Fassade der Kathedrale hinauf. Eigentlich hatte er vorgehabt, erst sein Hotel aufzusuchen und sein Zimmer zu beziehen. Doch nun, kurz entschlossen, ging er zurück in die Bahnhofshalle und mietete sich eine Box in der Schließfachanlage, die seine Tasche und seine Anzugjacke in die Katakomben unter dem Bahnhofsgebäude transportierte. Dann reihte er sich in den Strom der Touristen ein und stieg die Stufen zur Domplatte hinauf.
Der Platz vor der Kathedrale war voller Menschen, eine nervös durcheinanderströmende Masse, deren Bewegung keiner Ordnung zu folgen schien. Erst als David näher kam und einzelne Personen beobachtete, erkannte er Sinn in dem Gewimmel: Hier sammelte ein Gaukler sein Publikum, dort folgte eine Reisegruppe dem Fähnchen eines Stadtführers. Pflastermaler schufen Kreidebilder, fliegende Händler verkauften Wurst und Biotic-Snacks, Polizisten patrouillierten durch die Menge, ihre Elektroschocker griffbereit im Gürtelholster. Vor dem Eingang zum Südturm warb eine mobile VI-Einheit für Spendenprojekte der Einheitskirche, daneben hockte eine Gruppe von Rucksacktouristen und sang zur Gitarre. Und über allem leuchtete das Porträt des europäischen Präsidenten, ein alter weiser Mann, der einem gütigen Hirten gleich über seine Schäfchen wachte. Die gigantische VI-Projektion schwebte direkt über dem Hauptportal des Doms.
»Aandach oder grusele?«
David brauchte einen Moment, bis er die Frage begriff. Vor ihm stand ein verschmitzt grinsender Mann, er trug die Uniform der Domwächter und im Gesicht einen gezwirbelten Schnurrbart, so, wie es ihn nur noch in Köln gab. Der Mann wiederholte seine Frage in breitestem Dialekt, während er erst auf den Eingang des Doms wies und dann auf die Stufen, die zum Aufgang des Südturms führten. David entschied sich für die Turmbesteigung, ließ sich 25 Digits von seinem Tagger abbuchen und reihte sich in die Reihe der Wartenden ein, der Andrang war groß. Eine halbe Stunde später war er bis zur Spitze der Schlange vorgerückt und stand nun in einem düsteren Gewölbe im Fundament der Kathedrale, in das man vor Jahren schon den Turmeingang verlegt hatte. David wählte die alte Wendeltreppe für den Aufstieg, trotz der Warnung des Domwächters, der vor den Türen der beiden Fahrstühle stand und nicht begreifen konnte, wieso jemand freiwillig über 500 Stufen auf sich nahm. David war schweißgebadet, als er die Aussichtsplattform erreichte.
Es war still hier oben, bis auf das leise Pfeifen des Windes, der sich an den Streben, Kapitellen und Simsen der Kathedrale brach. Schweigend standen die Besucher an der Brüstung und blickten über die Stadt. Ein Falke umkreiste die Plattform, jetzt legte er die Flügel an und stieß mit einem Schrei herab, um eine Dohle zu jagen. Niemand beachtete das Schauspiel, alle waren gebannt von der Aussicht, die sich ihnen bot.
David suchte sich eine Lücke in der Menge und trat an die Brüstung, gespannt auf die Stadt, in der er das kommende Jahr verbringen würde. Obwohl er wusste, was ihn erwartete, schockierte ihn der Anblick: Das farbenfrohe Durcheinander rund um den Dom, das er bei seiner Ankunft durchquert hatte, war nicht mehr als eine bunte Insel in einem schmutzig grauen Meer aus Zelten, Baracken und heruntergekommenen Häusern. Eine Stahlwand schützte das Stadtzentrum vor den Slums der vierten Zone. David erinnerte das Chaos jenseits der Einfassung an eine heranbrandende, auf ihrem Höhepunkt eingefrorene Welle. Jeden Moment, so schien es, konnte die Flut über den Schutzwall schwappen und jenen lichten, bunten Fleck rund um den Dom unter sich begraben.
Köln bestand aus Slums, seit kurz nach den Unruhen zur Zweitausendjahrfeier der größte Teil der Stadt aufgegeben und sich selbst überlassen worden war. Die ehemalige innere Ringstraße, einst auf den Ruinen der Kölner Stadtmauer errichtet, war zur Zonengrenze ausgebaut worden, eine acht Meter hohe Wand aus Beton und Stahl umgab das Stadtzentrum. Während rund um den Dom das Leben seinen gewohnten Gang ging, hatte sich hinter dem Wall die Struktur der Stadt aufgelöst. Die früheren Straßen und Plätze waren nur noch zu ahnen, jede freie Lücke war mit Häusern, Verschlägen und Baracken bebaut. Dazwischen zwängten sich Zelte und provisorische Hütten, errichtet von den in die Stadt flüchtenden Menschen. Wer schnell ein Dach über dem Kopf brauchte, zimmerte sich aus Holz und Plastikabfällen eine Unterkunft, wer schon länger in der vierten Zone lebte und sich in dem Chaos zurechtgefunden hatte, fledderte Abbruchhäuser und mauerte sich aus den herausgeschlagenen Steinen eine Bleibe. In die Ruinen der ausgeweideten Häuser wiederum zogen die Neuankömmlinge, die hier auf Arbeit hofften. Köln sog sie alle auf, Tag für Tag, die Slums wurden immer voller, immer größer. In weniger als zehn Jahren hatte sich das Bild der Domstadt komplett verändert.
Erst als David genauer hinsah, entdeckte er Unterschiede in der grauen Flut. Während manche Stadtviertel jenseits der Mauer dreckig und chaotisch wirkten, schienen andere Gebiete geordneter zu sein. Sogar grüne Flecken entdeckte er in einigen der Veedel, so die kölsche Bezeichnung der Stadtviertel. Kirchturmspitzen überragten das Meer aus Baracken, im Westen leuchteten die betongrauen Minarette der Zentralmoschee in der Sonne. Daneben, in einem abgezäunten Rest des einstigen Grüngürtels, stand die Kaserne der Eingreiftruppe, die der Staatsschutz hier stationiert hatte. Weit dahinter, am westlichen Stadtrand, blinkte in der Sonne eine jener gigantischen Kuppeln, die es inzwischen überall in Europa gab und in die sich all jene Menschen der ersten und zweiten Zone flüchteten, die genug von ihrem Leben hatten oder zu alt waren, um alleine zurechtzukommen.
Ein Windstoß trieb eine Wolke aus Dunst und Staub zu ihnen herüber. David kniff die Augen zusammen und ging zur gegenüberliegenden Seite der Plattform. Umspielt von Qualmwolken, die aus Rohren und Schornsteinen schossen, funkelte am Ostufer des Rheins eine gewaltige Fabrikanlage in der Sonne. Es war die Produktionsstätte der MIC, der Medical Ind Corporation, eine der weltweit größten multinationalen Firmengruppen, spezialisiert auf Molekulargenetik, Biotechnik und Pharmazie.
Es war eine Verzweiflungstat der Regionalregierung gewesen, vor mehr als zwei Jahrzehnten den Bebauungsplan zu ändern und das gesamte Ostufer des Rheins ohne Auflagen zum Gewerbegebiet zu erklären. Der Abstieg der Stadt hatte schleichend begonnen: Zunächst hatten alle Dax-Konzerne Köln verlassen, dann, noch vor der zweiten Bankenkrise, verlegten auch die nicht an der Börse notierten Großunternehmen ihre Zentralen in andere Regionen Europas. Als Nächstes schlossen die Sender und die Verlage, so wie überall in Europa nach der Machtübernahme des Präsidenten während des großen Blackouts. Zuletzt, als Unruhen Köln erschütterten, verließen auch die Mittelständler die Stadt. Bald gab es kaum noch Steuereinnahmen, mit denen das öffentliche Leben aufrechterhalten werden konnte. Die Medical Ind Corporation schien die Rettung zu sein. Seit der Freigabe des Ostufers durch die Regionalregierung fraß sich der Fabrikkomplex wie ein Geschwür vom Norden in das Stadtgebiet und verdrängte die Wohnviertel von Mühlheim, Kalk und Deutz. Mit einer Fläche von mehr als 30 Quadratmeilen, zwölf Flusskilometer entlang des Rheins, war der Kölner Produktionsstandort der MIC inzwischen einer der weltweit größten des Konzerns geworden.
Davids Tagger vibrierte, es war Patrick, er hatte sich einen Whiskey geleistet und fläzte sich in einen der Sessel im Speisewagen des IZE. Zufrieden grinste er in seine Portcam, während er auf Davids Antwort wartete.
David lehnte den Call ab. Das Bild auf seiner Netzhaut verlosch. Er wollte jetzt nicht reden, und schon gar nicht brauchte er Patricks Spott.
Bedrückt schaute er auf die Stadt.
War es mutig gewesen, hierherzukommen, oder war er einfach nur ein Idiot? David wusste es nicht.
Sein Tagger vibrierte, es war ein automatisch generierter Call des Buchungssystems seines Hotels. Die Scanner am Bahnhof hatten seine ID ausgelesen und dem Cologne Zone One seine Ankunft angekündigt, jetzt begrüßte ihn das System und teilte ihm mit, dass seine Suite für ihn personalisiert sei.
David starrte auf das Logo. Eine Suite im besten Hotel der Stadt war selbst für ihn etwas Besonderes. Doch er freute sich nicht.
Nach einem letzten Blick auf die in der Sonnenglut brütenden Slums verließ er die Plattform.
2
Syd Mohan Chandran schloss die Augen und stieß sich vom Beckenrand ab. Kühle Stille umgab ihn, das Wasser, in das er hinabgetaucht war, schluckte jedes Geräusch. Nur das Klopfen seines Herzens tönte in seinen Ohren. Einen Moment lang genoss er die Schwerelosigkeit, dann tauchte er wieder auf und begann zu schwimmen.
Es war ein unbeschreiblicher Luxus. Obwohl er ihn täglich nutzte, war sich Chandran bewusst, dass dieser Pool der wertvollste Ort in seinem Anwesen in der Pariser Rue du Faubourg Saint-Honoré war. Er hatte sich das Schwimmbecken einbauen lassen, als er die Konzernzentrale der MIC vom indischen Subkontinent nach Europa verlegt hatte. In Zeiten moderner Kommunikationstechnologien spielte es keine Rolle mehr, ob er die Medical Ind Corporation von Mumbai oder von Paris aus führte, und so war er seiner Vorliebe für die französische Kultur und Architektur gefolgt und hatte von der Société de Fiducie das Anwesen mit der Hausnummer 55 gekauft. Es war nicht günstig gewesen, obwohl es heruntergekommen war, doch er bezahlte für die Geschichte des Hauses.
Der Pool war für ihn nur die folgerichtige Krönung des Deals. Chandran ließ das Becken täglich neu befüllen, nicht mit aufbereitetem Brauchwasser, wie es seine Nachbarn in den großbürgerlichen Stadthäusern des 8. Arrondissements taten. Stattdessen ließ er sich das Wasser aus einer eigenen Quelle in den Pyrenäen kommen, sein Konzern hatte sie vor Jahren als Beifang erworben, als man einen spanischen Biotechnik-Konzern übernommen hatte. Die Tanklastwagen befüllten das Becken jeden Morgen, nachdem in der Nacht zuvor mit dem Poolwasser der Garten gesprengt worden war.
Chandran erreichte das Ende der Bahn, er berührte den Beckenrand, drehte den Körper und stieß sich von der Wand des Pools ab, um zurückzuschwimmen. Er tat es mit kraftvollen Bewegungen, er genoss es, seinen trainierten Körper zu spüren. Kaum jemand wusste, dass er weit über 70 war, er sah aus wie 40 dank der Forschung seiner Firma, und Chandran wollte seinen Teil dazutun, dass das möglichst lange noch so blieb.
Schritte ertönten, sein persönlicher Assistent betrat die Terrasse, Marc Ferris, promovierter Wirtschaftswissenschaftler und vor seinem Wechsel zur MIC jüngster Philosophie-Dozent am Auguste-Comte-Institut der UST. Chandran war Ferris’ messerscharfer Verstand bei einer Tagung in Bern aufgefallen, und er hatte den Wissenschaftler für eine beträchtliche Summe von der UST, der Universität São Paulos, abgeworben. Der Chef der MIC hasste es, von dummen Menschen umgeben zu sein.
Ferris räusperte sich und sprach erst, als Chandran seine Bahn unterbrach und ihn ungehalten ansah. »Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie haben Besuch. Dr. Uwe Rosner aus Köln.«
Chandran runzelte die Stirn. In Köln befand sich eine der Produktionsstätten seines Konzerns, sie hatten den Standort inzwischen zu einem der wichtigsten der Firma ausgebaut. Das Medikament, das in Deutschland hergestellt wurde, brachte der MIC große Gewinne. Uwe Rosner war, soweit Chandran sich erinnerte, der Leiter der kleinen Forschungsabteilung, sie hatten die Arbeitsgruppe damals nach der Übernahme des Werks durch die MIC an ihrem Ort belassen.
Die Daten von Rosner, die sein Assistent in die Projektionsebene seiner Kontaktlinsen einspielte, bestätigten seine Annahme.
»Hat er gesagt, worum es geht?«
»Nein. Nur, dass es sehr wichtig sei. Er will nur mit Ihnen sprechen.«
»Na gut. In zehn Minuten. Legen Sie das Gespräch in den Konferenzraum.« Und er wandte sich ab, um weiterzuschwimmen.
Ferris’ Stimme hielt ihn zurück. »Er ist persönlich hier.«
»Er ist selber nach Paris gekommen?« Chandran war verblüfft. Erst jetzt sah er die Kleidung, die sein Assistent mitgebracht hatte und nun auf einem Liegestuhl ablegte.
Es war Jahre her, dass er ein persönliches Meeting mit einem seiner Mitarbeiter gehabt hatte. Kaum jemand nahm noch die Mühe auf sich, für ein Geschäftstreffen zu verreisen, jeder zog es vor, sich in den virtuellen Konferenzräumen der Firma zu treffen. Die Technik war inzwischen so perfekt, dass der Unterschied zwischen einer realen Person und einer Projektion nicht mehr zu sehen war. Nur das Händeschütteln ging nicht, ein archaisches Ritual, auf das Chandran in Zeiten von mutierten RNA-Viren leicht verzichten konnte.
»Bereiten Sie alles vor. Ich komme in das Büro im Palais.« Chandran bedeutete Ferris, dass er gehen könne.
Mit einer leichten Verbeugung verließ der Assistent die Terrasse.
Nachdenklich stieg der Chef der MIC aus dem Wasser. Er nahm das bereitliegende Handtuch und trocknete sich ab, dann loggte er sich in das Intranet ein und checkte die Daten, die Köln in das Firmennetzwerk einspielte. Alles lief normal, es war kein Unfall geschehen. Auch die Börsenwerte der MIC an den einzelnen Handelsplätzen rund um den Erdball waren unauffällig. Chandran entdeckte nichts in den Nachrichten, und die Berichte seiner Informanten, die er in seinem Konzern an systemrelevanten Punkten eingeschleust hatte, waren unauffällig.
Was konnte so Außergewöhnliches geschehen sein, dass Rosner es ihm persönlich sagen wollte? Gespannt zog er sich an.
Fünfzehn Minuten später ging Chandran durch den Verbindungsgang in das Hauptgebäude. So, wie die früheren Bewohner, hatte er sich den Ostflügel als Wohntrakt ausbauen lassen, eine standesgemäße Residenz, die seinen Ansprüchen genügte. Im Hauptgebäude des Palais mit seinen Büros und prachtvollen Sälen war er nur selten. Der große Büroraum im ersten Stock des Gebäudes diente allein repräsentativen Zwecken.
Die altmodischen Lampen an der Wand und der Decke leuchteten, und eine Tasse mit heißem Kaffee stand schon bereit, als er das Büro betrat und sich an den Arbeitsplatz setzte, ein zierlicher Schreibtisch mit geschwungenen Beinen. Der Tisch war vergoldet und mit Ornamenten geschmückt, genau wie die Wände des Raumes, ein prachtvolles Gesamtensemble, das jedoch in Chandrans Augen vollkommen unpraktisch war. Weder gab es ein Interface noch einen VI-Projektor, auch waren die Wände nicht mit Displayfolien bespannt, wie es zum Standard eines modernen Büros gehörte. Nur ein altmodisches Telefon stand auf einem Beistelltisch. Doch der Raum war von dem früheren Bewohner genau so eingerichtet worden, und das allein reichte als Grund, ihn zu nutzen, wie er zurückgelassen worden war. Es gab Besucher, die es beeindruckte, im ehemaligen Arbeitszimmer des französischen Staatspräsidenten zu stehen.
Der Mann, der von seinem Assistenten hereingeführt wurde, schenkte der Pracht des Zimmers keine Aufmerksamkeit. Den Blick auf Chandran gerichtet, ging er mit zügigen Schritten auf ihn zu. Chandran musterte den Näherkommenden: Er war schlank, fast mager, und seine kantigen Bewegungen wirkten unbeholfen. Sein graumeliertes Haar hätte einen Schnitt gebraucht. Er wirkte erschöpft. Unter seinen Augen prangten dunkle Ringe, und seine Kleidung war zerknittert, so, als habe er die zurückliegenden Nächte darin verbracht. Dennoch war der Wissenschaftler voller Energie. Rosner streckte die Hand aus und lächelte. »Schön, dass Sie sofort Zeit gefunden haben, Mr. Chandran.«
Chandran wies auf einen der Stühle, ohne Rosners Hand zu ergreifen. Er setzte sich und wartete, bis auch der Besucher aus Deutschland Platz genommen hatte. »Was ist so wichtig, dass Sie mich persönlich sprechen wollen?«
Rosner zögerte. »Wird das Gespräch aufgezeichnet?«
»Ist das von Bedeutung?«
»Ich glaube, es wäre besser, wenn wir zunächst unter vier Augen reden würden.«
Chandran sah sein Gegenüber nachdenklich an. Dann deaktivierte er die Portcam seiner Kontaktlinsen.
Langsam wurde die Sache interessant.
»Also?«
»Wir haben es geschafft!« Rosner lehnte sich zufrieden in seinem Stuhl zurück.
»Was haben Sie geschafft?«
»Das Verfahren, an dem wir arbeiten. Wir haben es in den Griff bekommen. Wir können es anwenden!«
Chandran versuchte sich zu erinnern, woran Rosner geforscht hatte. Dass in Köln das Antiangiogenese-Mittel Fluctuasin hergestellt wurde, wusste er natürlich, immerhin war das Krebsmedikament einer der Verkaufsschlager seines Konzerns. Doch welches Projekt die Forschungsgruppe am Rhein vorangetrieben hatte, war ihm entfallen. Unauffällig aktivierte Chandran das Memory-System, doch er hatte zwangsläufig die Verbindung zum Firmennetzwerk gekappt, als er die Portcam deaktiviert hatte, so dass er nicht auf seine Cloud zurückgreifen konnte. »Helfen Sie mir bitte. Welches Verfahren meinen Sie?«
»Die Bindung von Nanopartikeln an Nanobodys. Wir haben einen Weg gefunden, den Herstellungsprozess zu vereinfachen. Wir können es auf den Markt bringen.«
Jetzt erinnerte sich Chandran an die Arbeit der Kölner, sie basierte auf den Forschungen der MIC in Shanghai. Den dortigen Wissenschaftlern war es gelungen, eine Krebstherapie zu entwickeln, die auf Antikörperfragmente und daran gekoppelte Nanopartikel setzte. Die sogenannten Nanobodys transportierten die Nanopartikel gezielt zu Krebszellen, reicherten sich in ihnen an und vernichteten sie von innen, sobald der Körper mit einem Magnetfeld bestrahlt wurde. Das Problem war der aufwendige Herstellungsprozess der Nanobodys, der es unwahrscheinlich machte, dass das Verfahren jemals kommerziell nutzbar wäre. Wenn es Rosner und seinem Team gelungen sein sollte, diesen Prozess zu vereinfachen, war das eine Sensation.
Rosner hatte Chandran genau beobachtet. Er öffnete die Tasche, die er bei sich trug, und holte einen Aktenordner hervor. »Hier sind unsere Ergebnisse. Alle Tests sind doppelt abgesichert und reproduzierbar.« Er reichte den Ordner weiter.
Schweigend blätterte Chandran die Unterlagen durch. Es war lange her, dass er Papier in den Händen gehalten hatte, das Gefühl war eigenartig, der Ordner kam ihm seltsam vergänglich vor. Viele der Protokolle waren handschriftlich geführt worden. Doch wenn diese Daten stimmten, war es eine weitsichtige Entscheidung gewesen, sie keinem elektronischen Speichersystem anzuvertrauen.
Er blickte auf. »Wer weiß davon?«
»Niemand außer mir und meinem Team.«
Chandran las weiter. Was dort stand, war unglaublich. Die Tests waren sorgfältig dokumentiert und die Ergebnisse eindeutig. Chandran spürte die leise Unruhe, die in ihm aufzusteigen begann. Eisen muss man schmieden, solange es heiß ist, hatte sein Großvater gesagt, und dieses Eisen hier glühte. Weltweit jeder Vierte starb an Krebs, der Bedarf war gewaltig. Das neue Medikament und die angeschlossenen Behandlungsverfahren würden die Umsätze der MIC explodieren lassen.
Plötzlich stutzte er. Ihm fiel etwas in der Akte auf, ein Name, der dort nicht hätte stehen dürfen. Er zeigte ihn Rosner.
Der Wissenschaftler nickte. »Der zentrale Baustein. Wir haben jahrelang in die falsche Richtung geschaut und immer wieder versucht, die Nanopartikel an die Antikörper zu binden. Dr. Esombas Verfahren hilft uns, es genau andersherum anzugehen: Wir regen die Antikörperfragmente an, die Nanopartikel aktiv in ihre Struktur einzubauen.« Rosner reckte sich stolz. »Es funktioniert zuverlässig. Und es ist total einfach. Farbe zusammenrühren ist schwerer.«
Chandran antwortete nicht. Er betrachtete die Seite, ohne die Schrift und die Grafiken darauf wahrzunehmen. Langsam schloss er den Aktendeckel. Er sah auf. »Sie bleiben heute Nacht hier. Kein Wort zu irgendjemandem. Ruhen Sie sich aus, wir reden morgen weiter. Herr Ferris wird Ihnen ein Gästezimmer geben.« Chandran wies auf die Akte. »Das behalte ich.«
Rosner nickte und ergriff die Hand, die Chandran ihm jetzt hinhielt. Er zögerte.
Chandran fiel ein, was er vergessen hatte. »Gute Arbeit, Dr. Rosner. Sehr gute Arbeit. Sie hören von mir.« Er lächelte sein Business-Lächeln, er konnte es an- und abschalten wie seine Portcam.
Rosners Körper straffte sich, bevor er sich umdrehte und den Raum verließ.
Chandran wartete damit, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen, bis sich die Tür hinter Rosner geschlossen hatte. Er schickte ein Signal an seinen Assistenten. Augenblicke später öffnete sich eine Tür in der Wandverkleidung, Ferris musste in der Nähe gewartet haben. »Ja, bitte?«
»Rosner bekommt ein Zimmer im Gästetrakt. Wo ist Dr. Lee?«
»Unser Patentanwalt?«
Chandran runzelte ungehalten die Stirn. »Kennen Sie noch einen anderen Dr. Lee in unserer Firma?«
»Er ist in Kapstadt«, antwortete Ferris. »Die Verhandlungen mit der South Nanotec Alliance.«
»Ich muss ihn sprechen. In einer halben Stunde im Konferenzraum.«
»Was ist mit Ihrem Vortrag an der MIC-Führungsakademie?«
»Den übernehmen Sie. Sie finden das Manuskript in meiner Cloud.«
Der Assistent nickte und schloss leise die Tür.
Nachdenklich lehnte sich Chandran in seinem Stuhl zurück. Er mochte die Tage, an denen er am Morgen noch nicht wusste, wie der Abend enden würde.
Das Spiel hatte begonnen.
3
Es hatte etwas gedauert, bis das Transportsystem seine Reisetasche aus den Tiefen der Gepäckaufbewahrung im Untergrund des Bahnhofs zurück an die Oberfläche geholt hatte. Es musste kalt dort unten sein, der Griff der Tasche lag kühl in seiner Hand.
Mit schnellen Schritten überquerte David den Bahnhofsvorplatz, er ging direkt auf die Grenzmauer zu, die das dahinterliegende Viertel von der Zone 2 abtrennte. Das Licht der Sonne spiegelte sich in der funkelnden Stahlwand, geblendet kniff David die Augen zusammen. Eine Gruppe von koreanischen Touristen stand im Schatten der Grenzanlage, gerade erklärte die Stadtführerin den Besuchern das europäische Zonensystem: Hier am Bahnhofsplatz befand sich hinter der Grenzmauer die erste Zone der Stadt, der Rückzugsort jener Menschen, die genug Geld und Einfluss hatten, um dem Gewöhnlichen zu entfliehen. In der zweiten Zone, in der auch der Dom stand, lebte die Mittelschicht, in der dritten Zone wurden industrielle Waren und landwirtschaftliche Produkte hergestellt. Die vierte Zone nahm das Prekariat der Gesellschaft auf.
Die Reisegruppe murmelte angeregt, während sie der Stadtführerin folgte.
Ein Tonsignal ertönte, die Scanner hatten David erfasst. Lautlos glitt die Tür der Sicherheitsschleuse zur Seite. David spürte die Blicke der Passanten, die auf ihn aufmerksam wurden: Es gab nicht viele Menschen, die die Grenzen der Zonen passieren durften, und der Kreis derer, denen es erlaubt war, die Zone 1 zu betreten, war noch kleiner. David ignorierte die Blicke und betrat die Schleuse. Er hielt den Atem an, als sich die Tür hinter ihm schloss. Kurz hatte er die Vision, dass die Tore der Sicherheitsschleuse fest verriegelt blieben, bis die uniformierten Männer des Staatsschutzes kamen und ihn als illegalen Grenzgänger festnahmen. Doch dann glitt die gegenüberliegende Tür zur Seite: Die Scanner hatten seine Daten, die der in seinen Arm implantierte Chip aussandte, mit den Daten im Zentralcomputer abgeglichen und ihn als zugangsberechtigt erkannt.
Erst vor wenigen Tagen hatte David das Recht erworben, alle Zonen betreten zu dürfen – als Absolvent der Frankfurter »Elite School of Justice and Law« zählte er zu der kleinen Elite, für die es in Europa keine Grenzen gab. Er war jetzt wichtig für das System, es galt, ihn bei Laune zu halten, damit er nach seinem Examen in Europa blieb und nicht nach Asien oder in die nordische Allianz abwanderte. Der freie Zugang zu jenen Inseln der Ruhe und des Komforts, die sich die wirtschaftliche Elite der Gesellschaft überall in Europa eingerichtet hatte, war eine der angenehmen Folgen seines bestandenen Examens. Gleich nach der Absolventenfeier und der Übergabe der Urkunde in der Alten Oper war David mit seinen Kommilitonen durch die von Villen gesäumten Straßen des Frankfurter Westends gestrichen und hatte den Reichtum bestaunt, den die Bewohner der ersten Zone hier angehäuft hatten. Dass der Unterschied zwischen Arm und Reich so krass war, hatte er nicht gewusst.
In der Domstadt am Rhein hatte man das ehemalige Bankenviertel westlich des Bahnhofs zur Zone 1 erklärt. Neugierig sah David sich um. Das Viertel war ruhig, heiß und leer, die Menschen hatten sich in die klimatisierte Kühle ihrer Häuser und Apartments zurückgezogen. Der Lärm vom Bahnhofsplatz war nur noch gedämpft zu hören. David war überrascht: Das Viertel wirkte unspektakulär, ganz anders als das Westend in Frankfurt. Manche der Häuser schienen unbewohnt. Köln war nicht sehr beliebt seit den Unruhen der vergangenen Jahre, die meisten Reichen, erinnerte er sich, hatten aus Furcht vor neuen Ausschreitungen die Stadt verlassen.
David aktivierte den Navigationsmodus seines Taggers, um sich den Weg zum Hotel anzeigen zu lassen. Er hatte eine Reservierung im besten Haus am Platz, was nicht viel sagte, denn es gab nur ein einziges Fünf-Sterne-Quartier in Köln. Das Cologne Zone One lag nicht weit von der Sicherheitsschleuse entfernt, es befand sich auf der Rückseite des Häuserblocks, der an die Domplatte grenzte. Die gläserne Front war aufwendig gestaltet, wie ein gefrorener Wasserfall hingen Zehntausende Glassplitter an der Fassade. Zwei Techniker waren damit beschäftigt, den VI-Projektor über dem Eingang zu reparieren.
David betrat die Hotelhalle. Es war angenehm kühl im Inneren des Gebäudes, leise Musik schwebte durch den Raum. Die Luft roch frisch und war gut. Dankbar nahm David den eisgekühlten Biotic-Drink, den ihm ein Service-Droide reichte. Er trank einen Schluck, während er sich neugierig umsah.
Ein Hüsteln ließ ihn aufmerken. »Darf ich Ihnen helfen?« Ein junger Mann war hinter die Rezeption getreten, er lächelte freundlich. Kurz glaubte David, mit einer VI-Projektion zu sprechen, gesteuert von einem Operator in einem View-Call-Center, doch dann begriff er, dass tatsächlich ein lebender Mensch hinter dem Tresen stand. Der Rezeptionist lud die Reservierung aus Davids Tagger, verglich sie mit seinen Daten im Hotelsystem und generierte den Schlüsselcode, um ihn in Davids Memristor zu überspielen. Dann programmierte er den Droiden mit dem Zimmercode und übergab der knuddelig aussehenden Maschine Davids Gepäck.
David dankte und folgte dem Droiden durch das Hotel. Das Haus war elegant und sichtbar teuer ausgestattet, mit Teppichen aus echter Wolle und filigran designten Möbeln, die zu schweben schienen. In den Brunnen plätscherte klares Wasser, eine Verschwendung, die fast schon dekadent wirkte. Die Wände der Gänge bestanden aus Lichtfolien, sie leuchteten in allen Farben des Regenbogens, je nach Tageszeit und Stimmung des Gastes, der an ihnen vorbeischritt.
David war beeindruckt. Doch zugleich fühlte er sich fehl am Platz. Wäre es nach ihm gegangen, hätte ein Hotel in der zweiten Zone gereicht. Sein Vater hatte jedoch auf das Zone One bestanden, der Aufenthalt in dem Luxushotel war sein Geschenk für das bestandene Examen. Er war stolz darauf, dass sein Sohn geschafft hatte, was ihm verwehrt geblieben war. Vergeblich hatte David versucht, das Geschenk abzulehnen, und schließlich heimlich das Zimmer im Pariser Zone One auf die Kölner Dependance der Hotelkette umgebucht, in der Hoffnung, sein Vater würde die wöchentliche Abrechnung seiner Transaktionen nicht genauer studieren. Noch immer dachten seine Eltern, dass David die nächsten Monate in Paris verbringen würde.
Ein leises Fiepen ertönte, der Droide stoppte und schob die Reisetasche vor eine Zimmertür. Dann legte er seinen Kopf schräg und wackelte mit seinen mechanischen Ohren. Intuitiv kraulte David die fellbespannte Außenhülle des Roboters, bevor er mit seinem Tagger die Tür des Hotelzimmers öffnete.
Er hatte tatsächlich eine kleine Suite bekommen, die beiden Räume, durch eine transparente Trennwand strukturiert, waren licht und großzügig. Eine VI-Projektion begrüßte ihn mit einem freundlichen Lächeln, es war eine brünette junge Frau mit nussbraunen Rehaugen, vermutlich entsprechend seinem persönlichen Geschmack generiert. David schaltete den Projektor aus und öffnete den Durchgang zur Wet-Zone. Kurz entschlossen warf er seine Kleidung ab, duschte und föhnte sich und legte sich anschließend in den Regenerator. Zwanzig Minuten später fühlte er sich frisch und ausgeruht.
Eingewickelt in den Hotelbademantel, ging David zurück in den Wohnraum und deaktivierte den Sichtschutz der Fenster. Die Kristalle im Glas verblassten, Sonnenstrahlen fluteten die Suite. Geblendet blinzelte David in das Licht. Sein Apartment lag auf der Domseite des Hauses, der Blick hinaus auf die schwarze Kathedrale war überwältigend. Obwohl der Platz draußen vor dem Portal des Doms voller Menschen war, drang kein Laut durch die Fenster nach innen. Die Hotelwand war Teil der Zonengrenze, die verspiegelten Panzerglasscheiben hielten mehr als nur den Lärm, die Hitze und die Blicke der Menschen zurück.
David aktivierte die Vergrößerungsfunktion des Fensters, um sich das Wahrzeichen der Stadt genauer anzusehen. Nun konnte er auch die Details erkennen: den Figurenschmuck in den Portalbögen und auf den Wimpergen, die Kreuzblumen auf den Firsten und Türmen, die filigranen Ornamente an den Streben und Pfeilern. Am meisten faszinierten ihn die als Dämonen, Drachen und Teufel geformten Wasserspeier, die sich mit weitgeöffnetem Maul über die Stadt reckten. Inmitten dieser beeindruckenden Komposition schwebte die VI-Projektion des europäischen Präsidenten, darunter der sanft pulsierende Merksatz des Tages, der die Sicherheit der Bürger innerhalb der Grenzen der Stadt pries.
Ein Tonsignal erinnerte David daran, dass er immer noch nicht online war, er hatte sich aus dem Zentralsystem ausgeloggt, nachdem er Patricks Call abgelehnt hatte. David schickte seine ID-Sequenz ins W-Net und aktivierte die Displayfolie, die in der transparenten Trennwand zwischen den Räumen eingelassen war. Dann rief er seine Nachrichten ab. In der Trackliste stand ein Call ganz oben, er kam aus dem Büro von Dr. Andreas Schoop. Als David die Aufzeichnung des Calls startete, blickte ihm eine freundlich aussehende Frau entgegen. Sie wirkte verlegen. »Also, hallo, ich bin Verena Bahrs. Ich muss für heute leider absagen, Herr Dr. Schoop ist verhindert. Wir sehen uns morgen früh, dann wird er wieder da sein.« Sie lächelte noch einmal, bevor sie die Verbindung unterbrach. Das Bild verschwand.
David war ärgerlich: Hätte ihn der Call rechtzeitig erreicht, hätte er noch eine Nacht länger in Frankfurt bleiben können. Die kurzfristige Absage sprach nicht für eine professionelle Terminplanung. Außerdem: Selbst wenn die Anwaltslegende nicht im Büro war, hätte er dennoch seinen neuen Job antreten können.
Einer spontanen Idee folgend, diktierte David die Adresse von Schoops Kanzlei in die Suchmaske des Systems. Der Stadtplan tauchte auf dem Display auf, der VI-Projektor warf ein dreidimensionales Abbild der Straße in den Raum. Das Haus, in dem Schoop lebte, war ein düster wirkender Bau in der Nähe einer verfallenen romanischen Kirche, St. Pantaleon im Süden der Zone 2 unweit der Grenze. David speicherte die Daten in seiner Cloud, bevor er sich ausloggte und an das Fenster trat. Er spürte, dass er unruhig war.
Ein Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken. Der Rezeptionist lächelte ihm vom Display neben der Türeinfassung entgegen. David zog seinen Bademantel zurecht, bevor er die Tür zur Seite gleiten ließ.
Der junge Mann in der Hoteluniform grinste, als er ihn sah. »Entschuldigen Sie die Störung. Ich bringe Ihnen einen Gruß des Hauses.« Er hatte einen Rollwagen vor die Tür geschoben, darauf ein gläserner Kühler mit geschäumten Brennivin und dazu ein paar hauchdünn geschnittene Scheiben Hákarl auf gefrostetem Moos. »Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Examen!« Offenbar hatte das Hotelsystem die Information über Davids erfolgreichen Abschluss an das Management weitergeleitet.
Stirnrunzelnd blickte David auf den Rollwagen. Er hatte die Werbung für die isländischen Wochen des Hotels auf der Screenwall gesehen, als er die Hotelhalle betreten hatte. Die Vorstellung, vom Fleisch eines Grönlandhais zu essen, das monatelang in einer Erdhöhle vor sich hin gegammelt hatte, zog ihm den Magen zusammen.
Der Rezeptionist betrachtete ihn mitleidig. Er war kaum älter als David, eine kleine Tätowierung blitzte unter dem Kragen seines Hemds hervor. Jetzt zwinkerte er David zu. »Eklig, oder?« Vorsichtig sah sich der junge Mann um, bevor er sich etwas drehte und einen Schritt zur Seite trat – er schien genau zu wissen, wo die Überwachungskameras versteckt waren. »Willst du einen Tipp von mir?« Verschwörerisch beugte er sich vor. »Ich weiß, wo es Steak gibt«, raunte er. »Aus richtigem Fleisch! Nicht das synthetische Zeug, das sie überall anbieten. Du hast doch die Berechtigung für die vierte Zone, oder?«
David nickte.
»Perfekt!« Der Rezeptionist zwinkerte ihm zu. »Ich versprech dir, das wird gigantisch! Und vorher gehen wir in die Helios-Halle, zur Schwarzen Krake!« Er erklärte David, dass der Schwarze Krake ein Ringkämpfer war, der seit fast einem Jahr keinen Kampf verloren hatte. Jeder könne ihn herausfordern, jede Woche trete er an. »Der Typ ist der Hammer! Den musst du gesehen haben, sonst kennst du Köln nicht!« Der Abend koste nur 400 Digits, ein Schnäppchen, beteuerte der Rezeptionist. Wahrscheinlich dealte er nicht zum ersten Mal. »Ich hol dich um acht ab. Bist du dabei?« Und er streckte seine Hand aus.
David überlegte. Besser, als alleine im Hotelzimmer zu sitzen, dachte er.
Er schlug ein.
4
Die Luft war verbraucht und zum Schneiden dick, es roch nach Schweiß, Rauch und ranzigem Fett. Bis auf die Spotlights, die von der Decke herabstrahlten, war es im Inneren der Fabrikhalle dunkel. Wie Säulen standen die Lichtkegel der Scheinwerfer im Raum.
Am Rand der Helios-Halle stand eine junge Frau, sie wirkte ruhig und konzentriert, während sie den Ring musterte. Dass sie angespannt war, verrieten allein ihre Finger, die mit dem Gürtel ihrer Shorts spielten.
Ein junger Mann, kaum älter als sie, stand neben ihr; in der Hand hielt er zwei Metalleimer. Er war nervös. »Lass uns abhauen, Alex!«
Die Frau reagierte nicht.
»Alex, du hast keine Chance!«
Spöttisch grinsend wandte sie sich ihm zu. »Was ist los mit dir, Ben? Ich dachte, du bist hier, um mir Mut zu machen.« Sie knuffte ihn, während sie ihm eines der Gefäße abnahm und öffnete.
Ein nervöses Raunen ging durch die Menge, die Menschen, die sich in dem heruntergekommenen Bau drängelten, waren unruhig. Keiner beachtete Alex und Ben, alle starrten zu der freien Fläche im Zentrum der Halle. Plötzlich, niemand wusste, wer begonnen hatte, entlud sich die Anspannung in einem gewaltigen Schrei: Die Menschenmasse hatte sich geteilt, ein fetter Mann mit schwarz geschminktem Gesicht betrat die Arena.
»Und hier kommt, unbesiegt und unschlagbar: die Schwarze Krake!« Der Moderator brüllte in sein Mikrofon, und seine Stimme überschlug sich vor Aufregung. Die Masse tobte.
Der Mann, den der Moderator angekündigt hatte, warf seinen Umhang zur Seite und riss die Arme hoch, eine Bewegung, die mit einem weiteren Aufschrei der Zuschauer begrüßt wurde. Aufgeputscht stampfte der Fette durch den Ring. Auf seinem nackten Oberkörper perlten Schweißtropfen.
Alex würdigte den Auftritt des Kämpfers mit keinem Blick, sie war dabei, ihre Beine dick mit Talg einzuschmieren. Sie schaufelte das Fett mit ihren Händen aus dem Eimer und bestrich damit sorgfältig ihre Haut, bis jeder Zentimeter bedeckt war. Danach zog sie ihr Shirt über den Kopf, so dass sie bis auf ihre Shorts nackt war, und rieb sich den Oberkörper ein. Eine Strähne ihres schulterlangen dunkelblonden Haars fiel ihr ins Gesicht, sie schob sie mit dem Oberarm zur Seite. »Gib mir den anderen Eimer.«
Ben tat, was Alex von ihm verlangte. Er betrachtete sie besorgt. »Das ist Wahnsinn! Lass es, bitte!«
Die junge Frau ignorierte seine Worte. Unbeirrt öffnete sie den zweiten Fettbehälter und rieb sich den Talg in ihre Haare. Ben seufzte und half ihr, auch den Rücken einzuschmieren. Zuletzt verteilten sie das restliche Fett auf dem Stoff ihrer kurzen Hose, bis Alex von Kopf bis Fuß mit einer schillernden Schicht bedeckt war. Ihr schlanker Körper glänzte.
Die Umstehenden bemerkten nicht, was hinter ihnen geschah: Der erste Herausforderer hatte die Arena betreten, ein durchtrainierter Glatzkopf mit Lederkleidung und Angst im Blick. Der Kampf dauerte keine zwölf Sekunden. Dann nahm sich die Krake den nächsten Herausforderer vor.
Schweigend stellte Ben den leeren Eimer zur Seite und reichte Alex ein Tuch, das er mit Alkohol getränkt hatte und mit dem sie sich nun sorgfältig die Hände reinigte.
Im Ring wurde der zweite Herausforderer niedergeschlagen, der dritte, der vom Rand zugesehen hatte, kniff unter den wütenden Pfiffen der Zuschauer und tauchte in der Menge ab.
»Wer wagt es, die Schwarze Krake herauszufordern?« Der Moderator brüllte mit schriller Stimme. »Im Jackpot sind 48000 Digits, für 48 Kämpfe, in denen die Krake unbesiegt geblieben ist. Wer ist der Nächste?«
Niemand meldete sich.
Der Fette im Ring riss die Arme hoch und brüllte, ein Ruf, der von der Menge erwidert wurde.
»Ich leg noch was drauf«, schrie der Moderator, »49000 Digits für den Gewinner. Wer wagt es? Niemand? Ich geb euch 50000! Los, Leute, traut euch!«
Ein paar Männer am Rand der Arena traten nervös von einem Bein auf das andere.
Plötzlich ertönten in einer Ecke der Halle aufgeregte Rufe, die ersten Zuschauer hatten Alex bemerkt und machten ihre Nachbarn auf sie aufmerksam. Die Menge teilte sich. Jetzt entdeckten auch die Männer oben auf den Scheinwerferbrücken unter der Hallendecke, was unter ihnen geschah, und sie rissen ihre Spotlights herum und lenkten die Lichtkegel auf die Gestalt, die den Gang entlangschritt. Alle verstummten verblüfft, niemand mochte glauben, was er sah.
Dann begannen die Ersten zu lachen.
Unbeirrt, die Lippen fest zusammengepresst, ging Alex auf die Arena zu. Sie wirkte schmal, eine ängstliche junge Frau Anfang 20, die ihrer Vernichtung entgegenschritt. Und doch war ihr Blick entschlossen. Sie musste diesen Kampf gewinnen! Jetzt hatte auch der Moderator sie entdeckt. Mit vor Begeisterung überschnappender Stimme begrüßte er die Herausforderin. Die Masse tobte. Alex’ nackter Körper heizte die Stimmung noch weiter an.
Der Moderator zog das transparente Trennband, das die Kampfzone begrenzte, zur Seite und ließ Alex in die Arena hinauf. »Dich schickt der Himmel, Goldstück, du bist die Krönung heute Abend.« Er lächelte abschätzig, während er sich zu ihr beugte. »Keine Angst, ich sorg dafür, dass es nicht so weh tut. Wir wollen ja nicht, dass der Kampf zu schnell zu Ende ist.« Ohne ihre Antwort abzuwarten, drehte er sich um und riss das Mikrofon hoch. »Und hier ist sie«, brüllte er, »die Königin der Nacht!«
Ein Schrei wie aus einer Kehle antwortete ihm.
Im Licht der Scheinwerfer trat Alex in die Mitte des Ringes. Der Moderator sprach ein paar Worte mit dem Fetten, dann gab er seinem Assistenten ein Zeichen. Der Gong ertönte. Jubelnd begrüßte die Menge den Beginn des Kampfes.
Alex spannte den Körper an. Ihren Gegner nicht aus den Augen lassend, tänzelte sie durch den Ring. Der Fette beachtete sie nicht. Er hob die Arme und schrie, während er seine Fäuste schüttelte. Sein Schrei endete abrupt. Den Mund weit aufgerissen, taumelte er zurück, überrascht von dem plötzlichen Angriff: Alex hatte ihre Chance genutzt und mit all ihrer Kraft ihren Fuß gegen seinen Brustkorb gerammt.
Die Menge johlte.
Den Kopf zwischen ihre Schultern gezogen, beobachtete Alex ihren Gegner. Der Überraschungsangriff war ihre Chance gewesen, vielleicht ihre einzige Chance. Erschrocken sah sie, dass der Tritt, so kräftig er auch gewesen war, dem Fetten wenig zusetzte. Nur seine Wut war jetzt echt, und der Schrei, der aus seiner Kehle drang, war lauter als zuvor. Brüllend stürzte der Fettsack auf sie zu. Alex versuchte, unter seinen Armen hindurchzutauchen, doch ihr Gegner war ein erfahrener Kämpfer und durchschaute ihre Finte. Wütend packte er ihren Arm, um sie herumzureißen, aber er glitt an ihrem Fettfilm auf der Haut ab und taumelte zur Seite. Alex stürzte zu Boden und rollte sich ab, gerade noch rechtzeitig, bevor der heranstürzende Körper des Fetten sie zerquetschen konnte.
Jubelnd und schreiend begleiteten die Zuschauer den Kampf.
Die Augenlider zusammengekniffen, sprang Alex wieder auf die Beine. Ihre Augen brannten, der Talg aus den Haaren war ihr in die Augenwinkel geflossen. Orientierungslos stolperte sie durch den Ring. Vergeblich versuchte sie etwas zu erkennen, während sie hörte, wie der Dicke auf sie zustürmte.
»Alex!« Bens Stimme drang durch den Lärm zu ihr. Sie wich dem Dicken aus und rannte an den Rand der Kampfzone. »Alex, hierher!« Ben war auf die Kante der Arena geklettert, er hielt sich am Absperrband fest und streckte ihr ein Tuch entgegen. Es war mit Alkohol getränkt, der scharfe Geruch stieg ihr in die Nase. Sie griff sich das Tuch und warf sich zur Seite, als der Fette heranraste, sie hörte seine Schritte auf dem Podest. Diesmal gelang es ihr, unter seinen Armen hindurchzutauchen. So schnell sie konnte, rannte sie auf die andere Seite der Arena, während sie sich den tropfenden Talg aus den Augen rieb. Der Dicke stürmte ihr nach, wütend, dass sie sich ihm entzog. Erneut wich Alex dem Angreifer aus, wie ein Hase, der hakenschlagend einem Fuchs zu entkommen versuchte. Der Dicke wirbelte herum und stürzte hinterher. Die Menge lachte und johlte.
Außer Atem hielt sich Alex an der Absperrung fest. Sie wusste, lange würde sie den Kampf nicht durchhalten: So fett ihr Gegner auch war, schien er dennoch weitaus trainierter und wendiger als sie. Doch sie brauchte diesen Sieg. Sie musste seinen Schwachpunkt finden.
Es gab nur einen, von dem sie wusste.
Der Dicke war stehen geblieben und hatte seine Arme weit geöffnet, um ihre Flucht zu verhindern. Langsam kam er näher. Alex tat, als wolle sie so wie bisher fliehen. Doch plötzlich, der Fette war gerade losgelaufen, drehte sie sich zu ihm. Blitzschnell warf sie sich auf den Boden und rollte auf ihn zu. Der Dicke versuchte zu reagieren, doch es war zu spät: Ächzend stolperte er über ihren Körper und stürzte auf die Matte. Im selben Moment war Alex wieder auf den Beinen, sie sprang auf ihren bäuchlings auf dem Boden liegenden Gegner und griff in seinen Hosenbund. Die Menge johlte auf. Mit aller Kraft zerrte Alex den Gurt seines Tiefschutzes hervor und zog an dem Band, bis es an der Naht aufriss und die Hartschale, die den Genitalbereich des Fetten schützte, freigab.
Außer sich vor Wut wälzte der Dicke sich herum. In letzter Sekunde gelang es Alex, von seinem Rücken zu springen. Der Kämpfer schrie und erhob sich. Seine Hose hing schief an seiner unförmigen Hüfte. Er stampfte auf Alex zu und versuchte sie zu fassen, doch erneut glitt er an ihrem fettbedeckten Körper ab. Diesmal jedoch verlor er nicht das Gleichgewicht, sondern setzte ihr nach, die Arme weit geöffnet. Hilflos wich Alex zurück, immer weiter in die Ecke hinein, in die er sie trieb. Der Dicke begann nach ihr zu schlagen. Alex duckte sich, doch seine Fäuste trafen sie, links, rechts, links, rechts, wie eine Maschine, die nicht zu stoppen war. Mit letzter Kraft warf sie sich in seine Arme und klammerte sich an ihn. Für einen Moment war der Fette überrascht. In der gleichen Sekunde verzerrte sich sein Gesicht, er riss den Mund auf, als wolle er schreien, doch es drang nicht mehr als ein Ächzen aus seiner Kehle: Alex hatte ihr Knie angezogen und mit aller Kraft zwischen seine Beine gerammt. Der Dicke wurde blass, er wankte und drohte zu Boden zu gehen. Er schrie auf, vor Wut und vor Schmerzen, und wuchtete sich hoch. Auch Alex schrie, und im Schrei trat sie noch einmal zu.
Die Menge kreischte auf.
Dann wurde es still.
Der Dicke stand regungslos, wie im Schock, die Hände auf seinen Schritt gepresst. Langsam kippte er um, wie ein Felsbrocken, der zu Boden fällt.
Die Anspannung, die in der Halle geherrscht hatte, entlud sich in einem Jubel, lauter als zuvor.
Schwer atmend verharrte Alex im Ring und versuchte zu fassen, was geschehen war. Ihr Herz raste, das pulsierende Klopfen dröhnte in ihren Ohren. Erst jetzt sah sie, dass der Fette regungslos auf dem Boden lag. Der Moderator war zu ihm gestürzt und beugte sich über ihn, doch so sehr er auch rüttelte, der Bewusstlose rührte sich nicht.
Langsam begriff Alex: Sie hatte gewonnen. Wie in Zeitlupe hob sie ihre Arme, während die Menge um sie herum tobte.
»Das war nicht schlecht.« Der Moderator war zu ihr gekommen. Er grinste ärgerlich. »Aber das war kein Sieg. Du hast nicht fair gekämpft.«
Aufgeputscht durch den Kampf, fuhr Alex herum. Ohne nachzudenken, stieß sie ihn an den Rand der Arena. »Du verkündest jetzt, dass ich gewonnen habe«, zischte sie in sein Ohr, »oder ich werfe dich in die Menge und sage allen, dass du mich nicht bezahlen willst.«
Der Moderator war blass geworden. »Das wirst du nicht tun.«
»Ich tu noch ganz andere Dinge.« Ohne nachzudenken, griff sie in seinen Schritt und packte durch den Stoff der Hose seinen Hoden. Sie drückte zu.
Jaulend hob der Moderator sein Mikro und tat, was sie ihm befohlen hatte.
»Und jetzt mein Geld. 50000 Digits.« Misstrauisch beobachtete sie, wie er die Summe in eine E-Cash-Folie eintippte und das Plättchen versiegelte. Unter dem Jubel der Zuschauer reichte er ihr das Geld.
Alex nahm es zögernd. »Ich traue dir nicht. Deine Uhr, als Sicherheit. Du kriegst sie wieder, wenn ich die EC eingelöst habe.«
Der Moderator wollte protestieren, doch als Alex erneut zupackte, fingerte er hastig seine Uhr vom Handgelenk. Es war ein altes goldenes Modell, es funktionierte noch, wie sie am zuckenden Sekundenzeiger sah.
Alex nahm die Uhr, dann stieß sie den Moderator zur Seite und flüchtete. Die vom Kampf aufgeheizten Zuschauer versuchten nach ihr zu greifen, Alex sah gierige Gesichter, die ihren nackten Körper anstarrten. Erst jetzt sah sie, dass ihre Shorts aufgerissen waren. Ben klammerte sich an das Trennband am Rand des Rings, um von der wogenden Menge nicht weggerissen zu werden. Er warf Alex den Mantel zu, den sie mitgebracht hatten. »Du musst raus hier! Schnell!« Die ersten Männer kletterten über die Absperrung.
Alex warf sich den Mantel über und rannte auf die andere Seite des Rings zu einer der Stützstreben, auf denen die Scheinwerferbrücken ruhten. So schnell sie konnte, kletterte Alex das Gitterwerk der Strebe hinauf, verfolgt von den Lichtkegeln der Scheinwerfer. Die Menschen in der Halle johlten. Immer mehr Zuschauer durchbrachen die Absperrung und stürmten der Fliehenden nach. Dem Moderator war es derweil gelungen, seinen Kämpfer aus der Bewusstlosigkeit zu reißen, der Dicke hatte sich aufgerappelt und stand nun schwankend im Sturm der in den Ring drängenden Masse, während sich der Moderator hinter seinem breiten Rücken verbarg.
Alex erreichte das Ende der Stütze und schwang sich auf die Scheinwerferbrücke. Von oben sah sie überrascht, dass einige der Zuschauer ihr nachkletterten. So schnell es die schwankende Metallkonstruktion erlaubte, rannte sie über die Brücke hinüber zur anderen Seite. Doch auch dort kletterten ein paar Männer die Stützstreben hinauf. Gehetzt sah sich Alex um. Sie entdeckte keinen Fluchtweg – außer einer Öffnung in der Decke über sich. Daumendicke Kabel führten durch ein aufgeklapptes Dachfenster nach draußen, der Strom für die Scheinwerfer wurde auf diesem Weg in das Innere des Gebäudes geleitet. Ohne zu zögern, packte Alex eines der Kabel und zog sich hinauf. Sie hatte Mühe, sich festzuhalten, der tropfende Talg auf ihrem Körper hatte ihre Handflächen verschmiert und ließ sie immer wieder abrutschen. Endlich gelang es ihr, den Rand der Fensteröffnung zu greifen. Mit letzter Kraft zog sie sich über die Kante und ließ sich auf das Dach der Halle fallen. Schwer atmend blieb sie liegen.
Doch ihr blieb keine Zeit, sich auszuruhen, Schritte und Stimmen waren zu hören, ihre Verfolger auf der Scheinwerferbrücke hatten das Dachfenster erreicht. Es polterte, dann krallte sich eine Hand an den Rand der Öffnung, und ein gieriges Gesicht schob sich ihr entgegen. Hastig trat Alex gegen die Stütze, die das Fenster offen hielt. Der Metallstab sprang zur Seite, und mit einem lauten Krachen schlug der schwere Metalldeckel zu. Der Mann schrie auf und stürzte hinab, Alex hörte seinen Körper auf die Schweinwerferbrücke prallen. Wütende Rufe drangen zu ihr herauf. Schnell griff sie eines der Kabel und zerrte daran, bis sie eine Schlaufe biegen konnte. Sie schob die Schlinge über den verrotteten Riegel und zog sie fest. Jetzt konnte niemand mehr von unten die Klappe aufstoßen, zumindest, solange keiner das Kabel zerschnitt.
Alex wartete, bis sie wieder zu Atem gekommen war. In der Halle schrien und tobten die Menschen, die Stimmung war aufgeputscht wie in den Sekunden ihres Sieges. Alex musste grinsen. Sie griff in die Tasche ihrer Shorts und holte das EC-Plättchen und die Uhr hervor. Stolz blickte sie auf die Trophäen ihres Kampfes: Sie hatte es geschafft!
Sorgfältig verstaute sie Uhr und EC in der Tasche ihres Mantels. Kurze Zeit später war sie in der Dunkelheit verschwunden.
5
Marc Ferris, Chefassistent der MIC, trat an das Fenster und stieß die beiden Flügel auf. Paris glitzerte in der Dunkelheit. Die Nacht war lau, die Steine der Straßen und Paläste hatten die Wärme der Sonne gespeichert und gaben sie nun der Stadt zurück. Ein Windhauch strich über den Fluss, leise plätschernd brachen sich die Wellen an den Brücken und Kaimauern.
Die Führungsakademie der Medical Ind Corporation war im Seitenflügel des Louvre untergebracht, direkt am Ufer der Seine, eine großzügige Flucht aus Büros und prachtvollen Sälen mit Blick auf die Tuilerien-Gärten und den Innenhof des Palais. Das Logo der MIC, das über der Glaspyramide im Zentrum der Anlage schwebte, leuchtete kalt und blau in der Dunkelheit. Angeregt plaudernde Menschengruppen flanierten durch den Park oder strömten durch den gläsernen Eingang in das Museum, es war Mitarbeitertag der MIC, die vom Konzern finanzierte Kunstsammlung war die ganze Nacht über geöffnet.