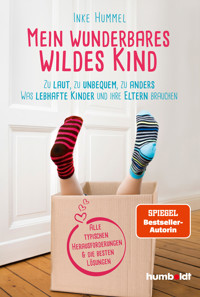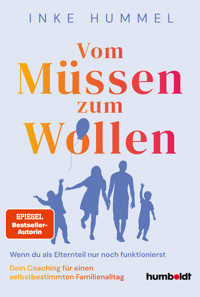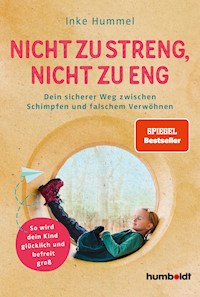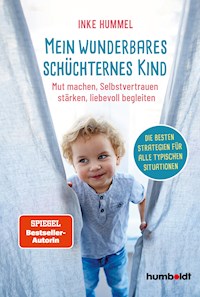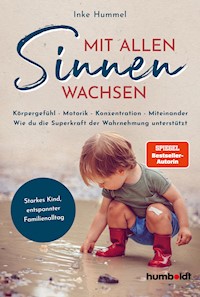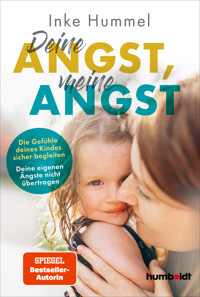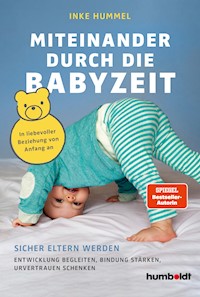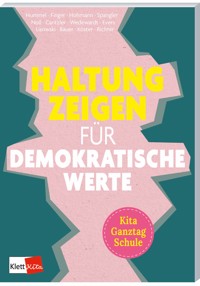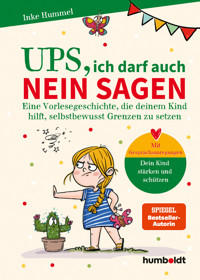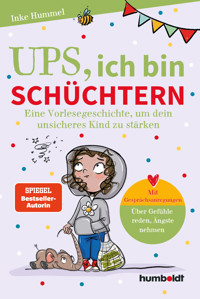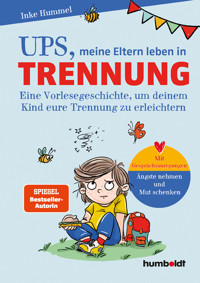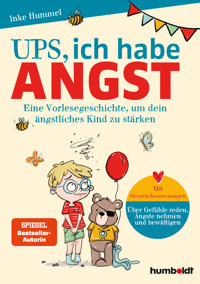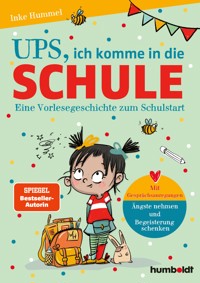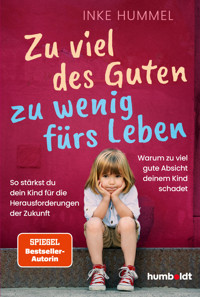
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die bindungsorientierte Erziehung musste sich lange vorwerfen lassen, dass Kinder durch sie überbehütet werden und ihren Eltern auf der Nase herumtanzen. Heute ist erwiesen, dass sie für die gesunde Entwicklung und für eine starke Eltern-Kind-Beziehung der beste Weg ist. Das bewusste, liebevolle Elternsein übersieht jedoch häufig eines: Kinder werden nicht stark dafür gemacht, mit Langeweile sinnvoll umzugehen, Stress zu bewältigen, digitale Medien gesund zu nutzen, kleine Hürden zu meistern und großen Krisen mit Zuversicht zu begegnen. In ihrem neuen Buch zeigt Inke Hummel, wie Eltern ihr Kind dabei unterstützen, von ihnen unabhängig zu werden, Selbstwirksamkeit zu erfahren und dadurch gut gerüstet zu sein für Herausforderungen, die in der Zukunft auf sie warten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zu viele Kinder sind nicht richtig aufs Leben vorbereitet
Kinder sind psychisch belastet
Stress und Angst
Fehlende Zuversicht und Kompetenz
Wie es dazu kommen konnte
Gesellschaftliche Ursachen
Individuelle Ursachen
Erzieherische Ursachen
Was das konkret bedeutet
Kinder mit geringer Selbstwirksamkeit
Kinder mit geringer Orientierung
Kinder mit geringer Stressregulation
Kinder mit wenig Optimismus
Kinder mit wenig Konfliktchancen
Eltern mit starker Überforderung
Eltern mit wenig sinnhaftem Engagement
Eltern mit falscher Absolution
Eltern-Kind-Beziehungen mit wenig Sicherheit
Wie wir das ändern können
Falsche Wege zurück
Dein Weg nach vorn
So machst du dein Kind stark fürs Leben
Bindungssicherheit – zu wichtig genommen und falsch verstanden
Nur Bindungssicherheit
Nur Lustgewinn
Keine Kompetenz
Kein Selbstwert
Du verhilfst deinem Kind zu Bewältigungskraft
Allseitige Bedürfniswahrnehmung
Couragierte Begleitung
Sinnvolle Stressbewältigung
Nachhaltige Konfliktbewältigung
Überanimierte Kinder – zu ruhelos und abhängig
Kein Alleinspiel
Keine Langeweile
Keine Pausen
Keine Sicherheit
Du verhilfst deinem Kind zu Unabhängigkeit
Unabhängigkeit von den Eltern
Unabhängigkeit von äußerer Motivation
Unabhängigkeit von Animation
Unabhängigkeit von digitalen Medien
Überanimierte Kinder – zu antriebslos und unzufrieden
Keine Lust
Keine Frustbewältigung
Keine Zufriedenheit
Kein Wachsen
Du lässt dein Kind los und verhilfst ihm zu Selbstständigkeit
Sichere Reifeschritte
Neue Komfortzonen
Erste Eigenständigkeit
Erste Verantwortung
Überanimierte Kinder – zu fordernd und unangenehm
Kein Maß
Keine Freunde
Keine Zuneigung
Keine Verbesserung
Du verhilfst deinem Kind zu sozialer Kompetenz
Fremde Bedürfnisse
Echte Empathie
Gute Kommunikation
Erste Teamfähigkeit
Überanimierte Kinder – zu schwach und gefährdet
Keine Stärken
Kein Selbstwert
Keine Motivation
Keine Gesundheit
Du lässt dein Kind gesund aufwachsen
Familiengesundheit jetzt
Körperliche Gesundheit jetzt
Psychische Gesundheit jetzt
Psychische Gesundheit später
Dein Kind hat eine große Chance auf eine gesunde Zukunft
Zu viele Kinder sind nicht richtig aufs Leben vorbereitet
Ich bin beunruhigt: Kindern fehlen heute wichtige Fähigkeiten, die in diesen Zeiten unabdingbar sind. Das fällt den Eltern auf, die zu mir in die Beratung kommen: Sie erzählen beispielsweise von unselbstständigen, unzufriedenen, überforderten, teilweise auch selbst sehr fordernden Kindern, die nicht so richtig glücklich wirken. Von Kindern mit Angst, mit Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern oder im Umgang mit Frust und Scheitern. Von Kindern, die mit unangenehmen Gefühlen nicht gut umgehen können, besonders nicht mit Langeweile. Ähnliches zeigen auch Berichte von Personen, die mit Kindern arbeiten, und die mir in Fortbildungen oder der Allgemeinheit in Presseberichten davon erzählen. Statistiken bestätigen das.
Vielen Kindern fehlt es an einigen Fähigkeiten, die für ganz Vieles in ihrem Alltag grundlegend sind: Sie sind nicht lebensfit, wenn es um den Umgang mit Stress oder Langeweile geht oder auch um ein Durchstehen von Krisen. Denn sich „nur“ geliebt zu fühlen, reicht dafür nicht aus. Dann ist man vielleicht irgendwie sicher, aber nicht stark. Das eigene Kinderzimmer wirkt verlockend und schön, die Welt vor der Kinderzimmertür aber überhaupt nicht.
Nur „großlieben“ reicht nicht, weil das nicht hilft, wenn ein Kind sich mit sich selbst und dem Erlebten überfordert fühlt. Ein Zurechtkommen mit der Welt und den anderen Menschen braucht eine starke Ich-Kompetenz: „Ich weiß, wer ich bin, was ich brauche und wie ich handeln kann.“ Fehlt diese, kann das allein zu unglücklicheren Kindern führen – sogar zu scheinbar unempathischeren, weil sie sehr mit sich selbst zu tun haben, sodass keine Ressourcen für die anderen übrig sind.
Davor möchte ich mit diesem Buch warnen und dir unbedingt gleichzeitig Lösungen aufzeigen. Denn es warnen auch andere, die nicht hinter der Beziehungsorientierung stehen. Dementsprechend bleiben die Warnungen entweder destruktiv und zeigen keine Wege nach vorn auf, oder aber sie preisen Lösungen an, die Familien und Erziehung wieder Jahrzehnte in die Vergangenheit katapultieren können.
Ich bin aber auch stolz: Seit etwa 20 Jahren sind die Stimmen aus der Pädagogik in Deutschland laut, die Beziehungsorientierung in Familien tragen, und sie haben viel erreicht. Sicher auch in deiner Familie. Es ist viel mehr Wärme im Leben von Kindern.
Eltern sind heute intensiver Eltern, als sie es jemals zuvor waren. Sie begleiten ihre Kinder mehr, diskutieren mit ihnen, anstatt sofort zu bestimmen oder zu bestrafen. Sie kennen sich aus mit individuellen Unterschieden, mit Bedürfnissen und mit Entwicklungsphasen, manchmal besser als die Fachkräfte in Kitas oder Schulen. Sie suchen beständig Hilfe oder Fördermöglichkeiten, kennen den Freundeskreis ihrer Kinder, besprechen irgendwann sogar den Weg zur ersten Praktikumsstelle mit ihnen. Auch du bist deinem Kind vermutlich näher, als du es selbst in deiner Kindheit erleben durftest.
Die pädagogische Forschung weiß schon deutlich länger, dass das der Weg ist, auf dem Kinder die sinnvollste Erziehung erfahren. Diesen gehe ich voller Überzeugung mit: in meinen Beratungen, meinen Büchern, meinen Impulsen, die ich dir und anderen Eltern in den sozialen Medien gebe.
Ich bin deshalb sicher: Wir müssen auf diesem Weg weitergehen und nicht zurück zur alten Härte Kindern gegenüber. Aber der Weg darf auch nicht in eine Welt führen, die Kinder und ihre Bedürfnisse anderweitig übersieht.
Doch wie genau beziehungsorientiertes Elternsein in der heutigen Welt aussehen muss, das steht noch nirgendwo als klares To-do geschrieben. Dafür ist das alles doch noch zu neu, zu ungewohnt. Und dafür dreht sich die Welt auch um dich herum zu schnell. Sicher ist leider: Einfach nur „großlieben“ reicht in der Regel nicht, wie du weiter vorne schon gelesen hast. Denn in dem Wunsch nach Wärme, Fröhlichkeit und Glück können andere Notwendigkeiten leicht vergessen werden.
Ich bin überzeugt: Wir müssen darüber streiten, was sinnvolle Beziehungsorientierung ist. Es könnte allen Familien, allen Kindern theoretisch wirklich sehr gut gehen auf dem beziehungsorientierten Weg. Große Chancen liegen darin. Doch die Wahrheit sieht eben doch nicht ganz so rosig aus. Es gibt Probleme! Und die siehst du ja wahrscheinlich auch.
Ich möchte deshalb Fragen stellen und auch Antworten geben:
Wie sollte Erziehung heute aussehen, auch in Anbetracht der sich stetig und schnell verändernden Umstände wie Kitakrise, Ganztagsschulen oder Mediennutzung?
Der Gedanke an eine sichere Bindung, an ein „glückliches“ Kind steht stark im Fokus. Doch nur Wärme und Nähe zu geben, möglichst konfliktarm und behütet aufzuwachsen, macht nicht glücklich. Damit übernehmen Eltern nicht die vollumfängliche Erziehungsverantwortung für das, was ihr Kind braucht. Die ganz intensive Elternschaft von heute hat oftmals blinde Flecken! Dadurch ist etwas in Schieflage geraten.
Ich erkenne, was zu tun ist: Ich möchte mit dir darauf schauen, welche Veränderungen es gesellschaftlich gibt, die zu mehr Stress und Krisen führen oder auch dazu, dass Kindern Langeweile so schrecklich vorkommt. Ich möchte mit dir den Blick auch darauf lenken, wie du unter Stress- und Krisengefühlen leicht dazu neigen kannst, deinem Kind nicht das zu geben, was es benötigt.
Aber vor allem möchte ich auch auf dich und deine Kompetenzen schauen: Wie kannst du dazu beitragen, dass dein Kind weniger abhängig von dir und selbstwirksamer wird? Was kannst du dafür tun, dass es sich weniger unglücklich, deutlich lebensfitter fühlt, obwohl die Welt ist, wie sie ist? Dafür musst du nicht unbedingt mehr tun als bisher, aber deine Anstrengungen vielleicht etwas anders verteilen. Davon profitiert nicht nur dein Kind, sondern auf lange Sicht auch du und sogar deine Partnerschaft, weil euer Alltag einfacher wird.
Ich habe einen Plan: Ich scheue die Diskussion nicht, die oftmals unbequem ist. Ich zeige dir in diesem Buch die Missstände, aber vor allem auch, was du tun kannst und wie ihr als Familie davon profitiert, Beziehungsorientierung auf einem neuen Level zu leben.
Kinder sind psychisch belastet
Du spürst ja schon, dass es Probleme gibt, sonst hättest du dieses Buch nicht zur Hand genommen. Dieses wahrscheinlich etwas diffuse Gefühl möchte ich gern etwas auffächern, denn es hat Berechtigung und du bist damit echt nicht allein. Also lass uns mal hinschauen, was bei den Kindern heute so los ist:
Wenn ich mit Beratungsfamilien spreche, Studienergebnisse lese oder auch Zeitungsartikel verfolge, in denen Fachleute berichten oder Kinder und Jugendliche selbst zu Wort kommen, wird deutlich, dass unter den Kindern viel Unwohlsein herrscht. Zwar beschreiben sie sich in der Mehrzahl noch als optimistisch, aber häufig schwingt noch ein anderes Gefühl mit: „Irgendwas ist nicht gut, irgendwas muss sich ändern.“
Der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die über Stress klagen und mit ihm und anderen unangenehmen Gefühlen nicht gut umgehen können, steigt tatsächlich. Ihnen fehlen oft die Fähigkeiten, sich selbst bei Langeweile, Stress oder großen Anforderungen und Krisen gut zu regulieren. Viele klagen darüber, dass sie Ängste (besonders Zukunftsängste), Konzentrations-, Schlaf-, Ess- und seelische Probleme entwickeln und große Hoffnungslosigkeit verspüren. Das merken sie selbst und das merken die Erwachsenen, die sie begleiten. Auch die Zahlen in Bezug auf psychische Risiken sagen das Gleiche:
Das Risiko, dass auch dein Kind besondere psychische Herausforderungen meistern muss, ist heute deutlich höher als vor vierzig oder auch nur vor zehn Jahren.
Trotz der Beziehungsorientierung.
Ich möchte dir ein paar konkretere Zahlen mitgeben, die verschiedenen Studien entstammen, die du im Anhang findest. Damit will ich dir keine Angst machen, obwohl manche Zahlen besorgniserregend wirken. Ich möchte aber dein Gefühl einordnen: Dein Kind ist nicht allein, wenn es sich mit Stress, Langeweile, Krisen und Druck nachhaltig und auffallend schwertut.
Stress und Angst
Es gibt zahlreiche Studien zur kindlichen Psyche mit Blick auf die Bedingungen während der Corona-Pandemie. Das ist wichtig, denn während dieser Jahre, in denen so vieles für Kinder und Jugendliche anders war, hat sich der psychische Zustand bei etwa 21 Prozent der drei- bis 15-Jährigen deutlich verschlechtert. Das hat auch heute noch Auswirkungen.
Doch einen Abwärtstrend gab es schon davor: Bei Angsterkrankungen, Essstörungen und Depressionen zeigte sich bereits vor Corona ein deutlicher Anstieg. Besonders bei den Mädchen: Die Zahl der diagnostizierten Depressionen stieg von 2018 bis 2019, also innerhalb nur eines Jahres, um bis zu fünf Prozent unter den weiblichen zehn- bis 17-Jährigen.
Und auch die Zahl der psychiatrisch bedingten Klinikaufenthalte bei Kindern und Jugendlichen nimmt bereits deutlich länger kontinuierlich zu. Beispielsweise hat sich die Anzahl der Einweisungen aufgrund von Depressionen bei Kindern unter 15 Jahren seit dem Jahr 2000 verzehnfacht. Und bei manchen Einrichtungen stehen siebenmal so viele junge Patientinnen und Patienten auf der Warteliste, als es freie Plätze gibt. Manchmal ist eine Einweisung daher nur möglich bei akuter Suizidalität – alles andere muss warten.
Wenn man die Statistiken auswertet, lässt sich sagen, dass sich fast 50 von 100 deutschen Kindern unangenehm gestresst fühlen und körperliche Symptome sowie mindestens einmal pro Woche übermäßige Erschöpfung beschreiben. Jedes zweite Kind!
Befragt man Kinder, scheinen sie sich insgesamt zwar nicht gestresster zu fühlen als Kinder, die in früheren Jahren interviewt wurden. Diejenigen, die sich heute gestresst fühlen, spüren jedoch viel mehr Stress, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Ängste oder Depressionen sind mögliche Auswüchse dieses übermäßigen Stresses und mangelnder Resilienz, also Widerstandskraft.
Als Folge des zunehmenden Stresserlebens fällt Kindern der Umgang mit Herausforderungen und Niederlagen oft schwer und ihr Gefühl von Hoffnungslosigkeit nimmt zu. Zu viel ist an zu vielen Fronten zu tun. Vermehrte Überforderungsgefühle durch verschiedenartigen Stress überlasten bei allen Menschen das System, das für die Lebensbewältigung zuständig ist. Für Kinder, die neben ihrem Alltag noch etliche Entwicklungsaufgaben zu meistern haben, ist das besonders fatal. Stress und seine Bewältigung müssen also mehr in den Blick genommen werden, auch in den Familien.
Auch die körperliche Gesundheit leidet darunter, was zu einem Teufelskreis führen kann. Je älter Kinder werden, desto schlechter ist ihr körperlicher Gesundheitszustand – die Tendenz ist hier steigend. Schlechte Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten tragen dazu bei und auch das Elternhaus spielt eine große Rolle. Kommt es zu Übergewicht bis hin zu Adipositas, beeinflusst dies häufig die Psyche, sodass sich auch der psychische gesundheitliche Zustand mit steigendem Alter der Kinder und Jugendlichen verschlechtert. Von Übergewicht betroffen sind in einer Schulklasse mit 30 Kindern im Schnitt mindestens vier.
Fehlende Zuversicht und Kompetenz
Wenn Herausforderungen und Niederlagen derartig überfordern, bedeutet das: Auch ein optimistischer Blick in die Zukunft gelingt den Kindern seltener. Fehlende Zuversicht und mangelhafte Bewältigungskraft können dann zu weiteren Komplikationen führen.
Hat ein Kind also beispielsweise den Eindruck, dass es in seinem Leben immer wieder nicht dazu imstande ist, beschwerliche Situationen nach und nach selbstständiger anzugehen, durchzuhalten und zu bewältigen, hat das unter Umständen psychische Folgen.
Von 100 Kindern erkranken im Laufe ihres Kinderlebens 20 psychisch. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, ist das schon bedrückend. Diese Zahl ist relativ konstant, doch die Arten der Erkrankungen verändern sich, Angst oder Konzentrationsstörungen nehmen zu. Betroffene Kinder haben außerdem oft mehrere Auffälligkeiten, die gleichzeitig auftreten.
Zehn von diesen 100 Kindern benötigen dann länger als ein Jahr psychotherapeutische oder ärztliche Hilfe. Das ist ebenfalls ein bedrückendes Bild. Und nicht jedes von ihnen bekommt überhaupt inhaltlich und dauerhaft die Hilfe, die es braucht.
Die Zahl der Kinder, die wegen Konzentrationsschwierigkeiten, Ängsten oder störendem Sozialverhalten in Schulen Unterstützung an ihrer Seite haben, um am Unterricht teilhaben zu können, ist zwischen 2014 und 2023 deutschlandweit von 150.000 auf 250.000 angestiegen. Eine Viertelmillion Schülerinnen und Schüler benötigt also Lernbegleitung – das entspricht der Gesamtschülerzahl im Bundesland Thüringen. Diese Entwicklung lässt auch am System Schule zweifeln, ein Thema, das ich hier auch am Rande streifen werde. Und da ist noch mehr.
Das Risiko für psychische Erkrankungen ist erhöht, wenn ein Kind oder Jugendlicher mehrere Belastungsfaktoren erlebt und seine Eltern beispielsweise über weniger Geld, Zeit und Kraft verfügen als andere Familien. Das kann dir je nachdem vielleicht das Gefühl geben, dein Kind sei weniger gefährdet, weil es bei euch vielleicht ganz okay ist. Doch zum einen zeigt sich der Negativtrend bei stressbedingten psychischen Herausforderungen bei allen Kindern und Jugendlichen, nur die Wahrscheinlichkeit ist bei Mehrfachbelastung höher. Und zum anderen sind belastende Faktoren zunehmend nicht nur erzieherische Gewalt, wenig anwesende Eltern, geringe finanzielle Mittel und Ähnliches, was typischerweise als erschwerend angesehen wird. Es gibt weitere, die ich dir im folgenden Ursachen-Kapitel ab Seite 15 noch zeigen werde. Sie können jeden treffen, und wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, wird es haarig.
Die zuständigen Praxen erleben ihre jungen Patienten und Patientinnen – wenn sie nach durchschnittlich sechsmonatiger Wartezeit endlich einen Termin bekommen (erst einmal für Diagnostik, dann irgendwann vielleicht für Therapie) – als zunehmend hoffnungslos und ohnmächtig: ohne Zuversicht, ohne Handwerkszeug, ohne Tatkraft.
Mir ist bewusst, dass Statistiken immer so eine Sache sind: Von wem stammen sie? Welche Fragestellung stand hinter der Erfassung der Daten? Wie werden die Ergebnisse interpretiert? Sind überhaupt allgemeine Rückschlüsse möglich? Da ist immer Vorsicht geboten. Manche Warnende erstellen sich ihre Studien gleich selbst.
Ich möchte daher nichts zu Unrecht skandalisieren oder negativer darstellen, als es ist. Und keinesfalls möchte ich dir als Elternteil Angst machen! Denn ich weiß, dass Angst Druck erzeugt und häufig dazu führt, dass man dann unbedacht, überstürzt und nicht besonders sinnvoll handelt. Ich möchte Eltern (und Fachkräften) auch auf gar keinen Fall ihre erzieherischen Fähigkeiten absprechen, wie es Autoren und Autorinnen pädagogisch-populistischer Veröffentlichungen so gern tun. Denn die erzieherischen Kompetenzen haben sie oftmals auf jeden Fall. Ganz bestimmt auch du.
Doch ich bin sicher, dass es allen Grund gibt, davor zu warnen, dass wir in vielen Fällen noch keinen beziehungsorientierten Umgang mit Kindern leben, der auf alle wichtigen Themen achtgibt und Kindern zu allen notwendigen Kompetenzen verhilft. Darum möchte ich Ideen vorstellen, was du verändern kannst.
Wichtig ist sicher noch, dass nicht jedes Kind, das auffällige Verhaltensänderungen wie beispielsweise Rückzug oder vermehrte Aggressionen zeigt, psychisch krank ist. Möglicherweise macht es nur gerade eine fordernde Entwicklungsphase durch. Aber alle Auffälligkeiten brauchen eine genaue Untersuchung und Unterstützung. Und über Erschöpfung, emotionale Probleme, Schlafstörungen, Rücken-, Bauch- oder Kopfschmerzen ohne körperliche Ursache klagen zu viele Kinder, als dass wir diese Symptome ignorieren könnten. Nach spaßiger Kindheit und lockerer Jugend klingt das nicht. Kinderseelen sind belastet. In Familien und Schulen, in Beratungsstellen und Arztpraxen wird es deutlich. Was steckt dahinter?
Wie es dazu kommen konnte
Kinder nennen selbst am häufigsten die Schule als Auslöser. Kein Wunder, wenn an vielen Stellen Noten wichtiger erscheinen als Freude am Lernen oder Inhalte, die jedem Kind individuell gerecht werden. Doch Studien zeigen, dass die Ursachen breiter gestreut sind, als die Kinder es wahrnehmen:
Erstens entsteht der Druck oft schon in den Kleinkindjahren vor der Einschulung aufgrund früher und langer Gruppentage in der Kita. Zweitens kommt hinzu, dass das Leben heute anders funktioniert als noch vor 20 Jahren, und damit ist auch die Kindheit eine andere. Und drittens trägt auch die Erziehung zum Stressempfinden bei.
Meine Sicht ist die: Gesellschaft und Institutionen orientieren sich zu wenig an den Bedürfnissen der Kinder.
Das bringt Leidensdruck und Stress für die Kinder und ihre Familie mit sich. Eltern versuchen gegenzusteuern, orientieren sich dabei aber auch nicht wirklich am Kind (das wirst du gleich verstehen) und geben vor allem auch keine Stressbewältigungskompetenz mit. Teilweise können sie Stressoren nicht nehmen, teilweise sorgen sie noch für weiteren Stress. Das ist die Problematik, mit teilweise massiven Folgen. Im Folgenden erkläre ich dir das genauer.
Gesellschaftliche Ursachen
Erst einmal sind die Voraussetzungen dafür nicht gut, dass Kinder und ihre Bedürfnisse wirklich gesehen werden können. Das hat mehrere Gründe:
Immer weniger Kinder und immer mehr alte Menschen. Diese Gesellschaftsstruktur hat zur Folge, dass die Anliegen der Jugend auch politisch immer weniger Mittel und Raum bekommen. Das fängt bei unterfinanzierten Kitas an und hört bei überforderten Schulsystemen und immer mehr kinderunfreundlichen Orten noch lange nicht auf.
Stell dir unsere Gesellschaft als großen Saal vor. Darin sitzen 100 Menschen. Im hinteren Teil sitzen 30 Senioren ab 60 Jahren und vorn nur 17 Kinder und Jugendliche – und das sind die Zahlen von 2023, das Ungleichgewicht vergrößert sich stetig.
Immer mehr Menschen in Deutschland leben in der Stadt. Ihr vielleicht auch. Folgen davon sind immer mehr nicht-entwicklungsgerechte Räume für Kinder. Wenn du wieder an den Saal mit 100 Personen denkst, dann sitzen da 77 Städter. In der Stadt ist es stellenweise laut und eng und es gibt weniger Rückzugsmöglichkeiten. Je nachdem, wo ihr wohnt, kann das den Alltag erschweren, sicher auch deinen und den deiner Familie.
Immer mehr Familien sind bunt. Diese Entwicklung ist wichtig und großartig, denn immer mehr Menschen können so leben, wie sie möchten. Allerdings sind die Rahmenbedingungen dafür noch nicht immer gut. Lebensgemeinschaften sind nicht-ehelich, manchmal kurzlebig, Kinder leben bei Alleinerziehenden oder in Patchworksituationen, ein Elternteil hat Migrationshintergrund und bringt neue Einflüsse mit in die Familie, nichtelterliche Bezugspersonen übernehmen Betreuungsaufgaben, Bezugspersonen wechseln schneller und vieles mehr. Diese Veränderungen bringen Herausforderungen mit sich, auf die unsere Gesellschaft an vielen Stellen noch nicht eingestellt ist und die gerade Kinder belasten können. Wer ist zuständig nach einer Trennung? Wer ist zuständig bei Sprachproblemen? Wie können wir mit kulturellen Unterschieden so umgehen, dass sie Kinder nicht belasten? Wie können sich Kinder aus Regenbogenfamilien nicht diskriminiert fühlen? Diese und viele weitere Fragen sind nicht beantwortet.
Es gibt wenig kindgerechte Strukturen. Konsens ist, dass Kinder heute ernster genommen werden sollen als früher. Aber es mangelt in der Umsetzung an Gleichwürdigkeit, finanziellen Mitteln, Personal, entsprechenden Strukturen. Trotz besonderer Förderprojekte des Familienministeriums erwartet die Politik beispielsweise noch für 2030 einen Fachkräftemangel von mehreren Zehntausend Personen.
Kinderrechte, kindgerechtere Schulen, Kinderarmut und mehr werden öffentlich diskutiert, doch wirklich verändern tut sich wenig. Denn Kinder sind in der Politik keine relevante Zielgruppe. Wer sich für sie einsetzt, kann das schließlich nicht in raschen finanziellen Erleichterungen für die breite Masse messen – oder in gute Wahlergebnisse ummünzen. Insgesamt bewerten Familien es positiv und zuversichtlich, dass sich die Politik um viele familiäre Belange kümmert, dennoch beklagen sie das Fehlen staatlicher Unterstützung noch an zu vielen Stellen.
Nicht zuletzt der demografische Wandel, also die aktuelle Überalterung der Gesellschaft, hat zur Folge, dass wir viele Arbeitsplätze bald nicht mehr besetzen können. Da scheint das Interesse von Politik und Gesellschaft logisch, Teile der Kindheit quasi aus den Familien auszulagern, um jedem Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, sich nach seinem Talent an der Erwerbswelt zu beteiligen. Kinder sind daher immer früher und immer zahlreicher in der Außer-Haus-Betreuung. Doch es gibt starke Betreuungsmängel, denn es fehlen Strukturen und Fachkräfte, um alle Kinder an Orten zu wissen, an denen sie gut begleitet werden können. Wie es den Kindern geht, fragt die Politik nicht.
Vermutlich hast auch du die Kita- oder Schulkrise schon gespürt. Keine Berufsgruppe hat so viele Krankentage wie Erzieher und Erzieherinnen. Die Folge: Viele Kinder verbringen ihre Betreuungszeit nicht ausreichend begleitet. Und vor allem Mütter haben dadurch nicht nur mehr Erwerbs-, sondern auch mehr Betreuungsarbeit – wenn die Kita mal wieder unerwartet schließen muss. Diese sind nämlich nach wie vor meistens für das Managen des Alltags mit den Kindern zuständig. Das bedeutet Stress für alle Beteiligten, auch für die Kinder.
Zudem genießen pädagogische Fachkräfte in unserer Gesellschaft leider kein hohes Ansehen, und ihre Kompetenzen und Leistungen werden häufig grundsätzlich infrage gestellt. Begleiten sie ein Kind „nur“ und bieten keine Entwicklungsgelegenheiten, heißt es, sie seien „faul“. Sinnvolle Außer-Haus-Betreuung funktioniert aber ohnehin nur mit den Eltern: Oftmals ergreifen alle Beteiligten die große Chance, die pädagogisches Miteinander bedeuten kann, im Alltag nicht oder machen sie gar nicht erst möglich.
Das Tempo der Digitalisierung belastet Familien zusätzlich. Die Welt wird immer „kleiner“ und immer digitaler. Kinder passen mit ihren Bedürfnissen nicht in diese digitale Welt und müssen im Kindes- und Jugendalter erst langsam dort hineinwachsen. Eltern und Fachkräften fehlen aber oftmals Kompetenzen und Möglichkeiten, Kinder in Sachen Smartphone und Internet ausreichend gut und in einem Tempo zu begleiten, das den Veränderungen entspricht. Fast jede meiner Beratungsfamilien äußert Ängste: Mediensucht? Gefährliche Postings? Cybermobbing? Nahezu jeder Vortrag von mir, egal zu welchem Thema, endet damit, dass Eltern Fragen zur Mediennutzung ihrer Kinder stellen. Dieses Themenfeld belastet Familien stark, vermutlich auch deine, nicht zuletzt, weil dauernde bedrohliche Eilmeldungen das Gefühl entstehen lassen, wir lebten in einer feindlichen Welt.
Erwachsene erleben insgesamt immer mehr Stress. Sie berichten ähnlich belastet davon wie Kinder und Jugendliche. Daraus resultieren oft ungesunde Lebensgewohnheiten, zum Beispiel beim Essen, Schlafen oder Bewegen. Gründe dafür können – neben alltäglichen Zwängen – sein, dass sie sich selbst überfordern, zum Beispiel durch Perfektionismus oder unverhältnismäßig starkes Kümmern um ihre Kinder. Eine weitere Ursache ist die oftmals erwartete Dauererreichbarkeit.
Meine Beratungsfamilien stöhnen häufig, und das erst einmal absolut zu Recht, denn ohne ein genaues Hinsehen stehen Eltern rasch und relativ unverschuldet in einem Wust aus Anforderungen und Druck, hohen Zielen und Eile, wie die Kinder auch. Fehlen auch bei den Erwachsenen Regulationsmechanismen, um mit Stress umzugehen, und fehlt ihnen sowieso die gemeinsame Zeit mit den Kindern, sind sie eine zusätzliche Belastung für die Kleinen und können keine sinnvollen Vorbilder im Umgang mit Stress sein.
Das ständige Gefühl von Krise und Hoffnungslosigkeit in verschiedensten Lebensbereichen, teilweise noch befeuert durch einen sehr destruktiven Journalismus, lähmt viele Menschen. Es erschwert Zuversicht, auch schon bei unseren Kindern: Die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns alle nachweislich weniger optimistisch gemacht.
Auch du als Elternteil musst mit all diesen Umständen zurechtkommen. Ihr als Familie seid herausgefordert. Wie steht es um deine Stressbelastung und deine Bewältigungskraft?
All diese Bereiche machen Druck, alle Bereiche lösen Getriebenheit aus. Manchmal spricht die Forschung vom „Hurried Child Syndrome“. Es beschreibt, was passiert, wenn Kinder kontinuierlich zur Eile angetrieben werden und keine Zeit für Entwicklung bekommen. Forscher und Forscherinnen kritisieren dabei vor allem, wie sehr Erwachsene (nicht nur die Eltern) Kinderleben durchplanen und sie geistig überfordern, während Spiel und Wachsen gar nicht echt und im Kindertempo passieren können. Kinder werden passiv. Mit ihnen wird etwas gemacht. Sie werden zerrieben, weil alles schnell gehen soll und so viel in einen Tag passen muss. Für Muße und gesunde Veränderungsprozesse ist gar kein Platz mehr.
Durch zu viel Druck und Eile kann in einem Kind das Gefühl entstehen, dem Leben nicht gewachsen zu sein.
Das muss nicht mal den Tatsachen entsprechen: Vielmehr reicht es, wenn das Kind selbst diesen Eindruck hat. Und der kann sich entwickeln, wenn es zu viele Belastungen spürt und zu selten erleben darf, dass es ihnen standhalten kann.
Individuelle Ursachen
Die Belastungen ergeben sich also stark aus dem veränderten Umfeld, in dem Kinder heute aufwachsen. Das wird aber von recht unerwarteter Seite „befeuert“: der veränderten pädagogischen Haltung, die doch eigentlich mehr aufs Kind schauen möchte. Die Beziehungsorientierung mit dem blinden Fleck!
Fragt man Eltern mit ganz verschiedenen pädagogischen Haltungen, welche Ziele sie für ihr Kind haben, fällt immer wieder der Begriff „glücklich“. Doch was meint das genau? Nicht unbedingt die steile Karriere. Ein erfüllender Job irgendwann würde auch reichen. Und eine nette Familie, ein hübsches Zuhause, ein guter Freundeskreis, ein kraftvolles Selbstbild, selbstverständlich keine psychische Erkrankung, und für den Anfang eine prima Schulzeit … Und jetzt gerade, heute, ein fröhliches Kinderlächeln auf den Lippen.
Doch all das ist in unserer Gesellschaft, wie gerade dargestellt, schwieriger geworden. Deshalb bemühen sich die Eltern um Wiedergutmachung: „Mein Kind erlebt viel Druck,muss da durch, wir als ganze Familie haben es nicht leicht, also machen wir es uns auf der anderen Seite leicht, wo es nur geht.“
Das ist total verständlich und in einigen Momenten absolut okay und wichtig. Eine solche Einstellung ist liebevoll und warm. Doch es fehlt ein entscheidender Teil. Denn „glücklich“ zu sein, nachhaltig lebensfit zu werden, Druckerfahrungen gut auszugleichen, psychisch gesund zu sein – all das ist ohne Bewältigungskraft nicht gut möglich.
Erziehung ist immer dann sicher schädlich, wenn sie keine Widerstands- und Bewältigungskraft fördert.
Das ist der Fall, wenn Eltern herrisch und strafend vorgehen oder sich gar nicht groß um ihr Kind kümmern, also wenn sie so handeln, wie die beziehungsorientierte Elternschaft es nicht machen möchte. Aber auch Überfürsorglichkeit macht ein Kind nicht stark und kompetent, und sie ist leider ein Auswuchs der Beziehungsorientierung, der im Alltag ganz leicht passiert. Warum? Oftmals weil Eltern den gesellschaftlichen und institutionellen Druck, der Kinder und Jugendliche wie mit einem dicken Daumen kleinhält und beschwert, ausgleichen wollen, indem sie ihren Nachwuchs sehr, sehr „hochheben“, es ihm sehr leicht machen, Stress aus dem Weg räumen.
Doch meine Fähigkeiten im Englischen werden nicht besser, wenn du die Vokabeln für mich lernst. Meine Möglichkeiten, einen Hürdenlauf zu gewinnen steigen nicht, wenn du das Lauftraining für mich absolvierst oder mir die Hürden von der Tartanbahn räumst. Und genauso wird die Bewältigungskraft deines Kindes nicht stärker, wenn du ihm keine Herausforderungen zumutest und ihm nicht zeigst, wie es nach und nach selbst damit umgehen kann.
Wenn von Leistungsförderung die Rede ist, geht es meist um Fachkompetenzen wie Mathe oder Englisch, nicht um emotionale Stärkung, die allem zugrunde liegen muss. Dabei ist es so entscheidend dafür, wie ein Kind im weiteren Verlauf seines Lebens mit Stress umgehen kann, ob es von dir Widerstands- und Bewältigungskraft lernen durfte. Und in dem Bereich ist die Beziehungsorientierung immer wieder blind.
Kognitiv entwickeln sich Kinder heute übrigens häufig sehr gut. Sie hier zu unterstützen, gelingt im modernen Alltag nämlich viel leichter als die emotional-soziale Seite. Auch dir fällt das gemeinsame Lesen eines Dino-Buches eventuell leichter als ein Gespräch darüber, wie der Streit mit dem fremden Kind eben auf dem Spielplatz ablief und anders hätte gelöst werden können, oder als ein Gespräch darüber, dass es nicht okay ist, bei Langeweile immer gleich Animation einzufordern. Doch Wissen ansammeln und geistig rege sein allein reicht nicht als Basis für eine gesunde Entwicklung und Psyche.
Wie du dein Kind zu Hause erziehst, ist nicht unbedingt dafür verantwortlich, wie es Stress empfindet und damit umgeht. Du bist nicht schuld! Und vor allem sind Eltern nicht allein dafür verantwortlich, wie ihr Kind beispielsweise im Einschulungsalter psychisch aufgestellt ist. Das zeigte schon die Auflistung der Belastungen im vorangegangenen Abschnitt. Doch Eltern bestimmen die Stressmenge im Leben ihres Kindes mit.
Und damit bestimmen sie den Verlauf der Entwicklung ihres Kindes, seine Fähigkeiten im Umgang mit Stress und seine Fähigkeit zu Optimismus, seine Zuversicht mit. Die Ausbildung von Selbstdisziplin hängt ebenfalls damit zusammen. Da ist der Erziehungsstil dann schon von Bedeutung. Und hier gilt:
Kinder sollten von ihren Eltern nachhaltig bestärkt, aber nicht überfürsorglich kurzfristig besänftigt werden.
Durch überfürsorgliche Besänftigung lernen Kinder zu wenig Bewältigungskraft. Und sie sollten Raum für ihr Tempo, ihre eigenen Erfahrungen haben. Unter Umständen kann das hier und da wirken, als würdest du dich zu wenig um dein Kind kümmern, du ermöglichst ihm damit aber Reifen ohne Eile.
Und damit sind wir nochmal mittendrin im blinden Fleck der Beziehungsorientierung. Denn wir beobachten in der heutigen Kindererziehung leider häufig eine fehlgeleitete intensive Elternschaft, in der Mütter und Väter viel tun, aber nicht immer sinnvoll, nachhaltig oder am Kind ausgerichtet. Eine insgesamt schiefe Kind-Orientierung, bei der das Kind nur scheinbar gut im Blick der Eltern ist, aber eigentlich eher „überhöht“ wird. Was meint das?
Ich kann es bei so vielen Familien sehen: Sie wissen um kindliche Bedürfnisse und bemühen sich, diese im Alltag zu berücksichtigen, und eben auch darum, Leidensdruck durch Schule oder anderes anderswo auszugleichen. Dabei schauen sie allerdings ganz besonders auf deren Bindungssicherheit. Urvertrauen über allem, Bindung vor Bildung, klar! Der Begriff aus der wissenschaftlichen Theorie ist eingesickert in Familienberatungen, Elternzeitschriften, Literatur und Social-Media-Angebote für Eltern. „Bindung“ prangt über allem.
Dieser Fokus hat viel Positives bewirkt, besonders in Bezug auf erzieherisches Gewaltbewusstsein. Eltern üben heute weniger Härte und weniger Bestrafungen aus, zeigen sich weniger distanziert zu ihren Kindern und lassen sie viel mitentscheiden. Kinder werden mehr beachtet und mehr gehört. In den Familien und auch in Institutionen wie Kita und Schule soll endlich ein stärkeres Miteinander herrschen. Auch dein Kind lebt sicherlich in einem wärmeren, kindgerechteren Zuhause, als Kinder es früher erlebt haben.
Doch die Entwicklungen bringen auch große Probleme mit sich. Für eine gute Bindung zu sorgen, ist einfacher, als auf die anderen Bedürfnisse zu achten.
Beim genaueren Hinsehen zeigt sich nämlich, dass das Kind in dem warmen Setting gar nicht immer wirklich gesehen, sondern tatsächlich eher übergangen wird – gesellschaftlich und familiär.
Und vielleicht auch bei euch zu Hause. Bindung mag da sein und sie ist enorm wichtig. Dass sie sicher ist, ist relevant.
Aber was ist mit den anderen Bedürfnissen? Auch für deren Entwicklung tragen Eltern Verantwortung.
Erzieherische Ursachen
Fehlende Kind-Orientierung
Verantwortung ist überhaupt der entscheidende Begriff, wenn wir über Kinder sprechen. Die Gesellschaft hat Verantwortung für die Jüngsten und übernimmt diese leider oft nicht, das habe ich bereits gezeigt. Wenn Kinderrechte keine Beachtung finden und wichtige Bereiche im Leben von Kindern immer schlechter finanziert sind, ist das ein politisches Problem, das wir nicht totschweigen dürfen.