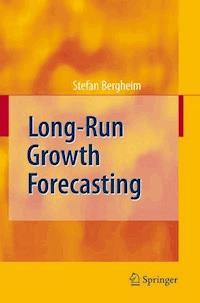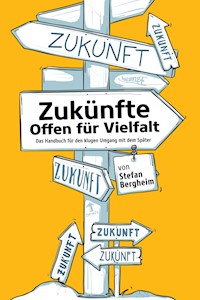
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Zukünfte – Offen für Vielfalt ist das leicht lesbare Handbuch für den klugen Umgang mit dem Später. Es will Ihnen Lust auf eigene Zukunftsarbeit machen und bietet viele konkrete Anregungen dafür. Das Buch stellt neue Methoden der Zukünftebildung erstmals in deutscher Sprache dar und lässt Sie an den praktischen Erfahrungen des Autors aus seinen vielen Projekten teilhaben. Aussagekräftige Illustrationen und persönliche Begegnungen begleiten Ihren Weg zu mehr Zukünftekompetenz. Inhaltsverzeichnis: Einleitung: Zukünfte in den Blick nehmen 1. Miteinander reden – der Dialog 2. Kraftvolle Fragen stellen 3. Der Komplexität gerecht werden 4. Viele unterschiedliche Menschen einbinden 5. Verschiedene Systeme berücksichtigen 6. Der Trend ist nur manchmal dein Freund 7. Szenarien öffnen das Denken 8. Visionen: Bilder wünschenswerter Zukünfte 9. Wo wir stehen: Indikatoren 10. Eine gemeinsame Zukunft suchen 11. Mehrere Ebenen in den Blick nehmen 12. Neues aus dem Zukünftelabor 13. Wertschätzend erkunden 14. Zukünfte spielerisch entdecken 15. Digitale Zukunftswerkzeuge 16. Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin 17. Zukünfte von Städten 18. Regierungsstrategie "Gut leben in Deutschland" 19. Digitalisierung gestalten #gutlebendigital Ausblick: Zukünftebildung stärken
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZukünfteOffen für Vielfalt
Das Handbuch für den klugen Umgang mit dem Später
Stefan Bergheim
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung, die nicht ausdrücklich durch das Urheberrecht vorgesehen ist, ist ohne die Zustimmung des Verlegers unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzungen sowie die Speicherung und Verarbeitung in und durch elektronische Systeme.
© Copyright 2020 Stefan Bergheim
Verlag: ZGF Verlag Dr. Stefan Bergheim Wilhelm-Busch-Str. 45 60431 Frankfurt am Main
stefan.bergheim@zukünfte.org
Umschlag und Illustrationen:Heike Jane Zimmermann
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Für Carla und Felix
Einleitung:Zukünfte in den Blick nehmen
Leben ist Veränderung. Es lässt viele Möglichkeiten zu und eine große Offenheit für das was kommen könnte. Zum Glück. Sonst wäre alles vorherbestimmt und wir Menschen wären nur ausführende Organe irgendeines Planes. Jede Organisation, jede Gesellschaft besteht aus vielen lebendigen Menschen, die eine große Zahl von Möglichkeiten sehen und täglich Entscheidungen treffen. Diese Menschen haben jeweils eigene Bilder von möglichen, wahrscheinlichen und wünschenswerten künftigen Entwicklungen im Kopf. Daher verwende ich in diesem Buch den Plural: Zukünfte. Viele Menschen haben viele Vorstellungen von Zukünften. Und die Offenheit der künftigen Entwicklungen bedeutet ebenfalls, dass wir in vielen Zukünften denken sollten. Natürlich wird nur eine dieser Zukünfte später Wirklichkeit werden. Dann ist sie allerdings nicht mehr Zukunft, sondern Gegenwart.
Dieses Buch richtet sich an alle, die sich mit der Zukunft befassen. Also eigentlich an alle Menschen. Denn selbst wenn Sie über die Straße gehen, befassen Sie sich mit der Zukunft. Wird der Fahrradfahrer von rechts gleichzeitig mit Ihnen an einem bestimmten Punkt sein? Dann sollten Sie ihren Plan zur Überquerung der Straße entsprechend anpassen. Für diese Anpassung benötigen Sie dieses Buch nicht. Oft lässt sich die künftige Entwicklung allerdings nicht so leicht vorhersagen und entsprechend belastbare Pläne lassen sich nicht aufstellen.
Diese Sicherheit und Planbarkeit wünschen wir uns vielleicht. Allzu oft ist sie unrealistisch. Die großen Verwerfungen des Jahres 2020 haben die Unsicherheit und die Offenheit der Zukunft für alle sichtbar gemacht.
Für einen souveränen Umgang mit dem Später
Schon vor Covid-19 fühlten sich viele Menschen vom Umgang mit den offenen, ungewissen Zukünften überfordert. Ihnen bietet dieses Buch einige Wegweiser, Hintergründe, Erfahrungen und Handlungsideen für einen souveränen Umgang mit dem Später. Es soll ihnen ermöglichen die verschiedenen Bilder und Annahmen über die Zukunft schon in der Gegenwart sichtbar und nutzbar zu machen.
Dafür gibt es eine große Zahl von Zugängen und Methoden. Die Kompetenz diese Methoden für verschiedene Zwecke einzusetzen, nenne ich Zukünftebildung. Es könnte eine der wichtigsten Kompetenzen der Menschheit im 21. Jahrhundert sein. So wie Lesen und Schreiben zu können seit dem 19. Jahrhundert eine zunehmend wichtige Kompetenz ist.
Als Menschheit haben wir entschieden, dass nicht nur einige wenige Menschen lesen und schreiben können sollten, sondern möglichst viele. Dieses Buch will einen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Menschen kompetent mit der Zukunft umgehen können. Nicht jeder, der lesen und schreiben kann, wird Gedichte oder eine Dissertation verfassen. Es hat sich aber als hilfreich und wichtig herausgestellt, dass Menschen zum Beispiel die Zeitung oder eine Gebrauchsanweisung lesen oder einen Brief an Verwandte schreiben können. Ähnliches gilt für die Zukünftebildung: Sie sollte eine Kompetenz für alle Menschen werden, auch wenn dort nicht jeder als Prozessdesigner oder Autor von Forschungspapieren aktiv werden wird. Jeder kann diese Kompetenz im Alltag nutzen. Dafür bietet das Buch konkrete Anregungen.
Leicht wird das nicht und wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung. Viele Menschen sehnen sich nach größtmöglicher Stabilität und Sicherheit in allen Lebensbereichen, nach umfassender Planbarkeit. Sie suchen nach eindeutigen Zusammenhängen zwischen Ursache und Wirkung. Sie möchten klare Lösungen für die großen Probleme und sie wollen exakte Antworten auf ihre Fragen. Manche Führungskraft in Politik, Wirtschaft, Presse und sogar der Wissenschaft verspricht diese Klarheit, diese Sicherheit. In unseren modernen, komplexen Gesellschaften ist dies für viele wichtige Themen eine Illusion – oder mit gewaltigen Einschränkungen von Freiheit, Vielfalt und Lebendigkeit verbunden.
Offenheit und Ungewissheit als Geschenk
Dieses Buch zeigt einen anderen Weg auf. Es ist eine Einladung dazu, die Offenheit und die Ungewissheit der Zukunft als Geschenk anzunehmen, neue Möglichkeiten zu entdecken und mit ihnen kompetent umzugehen. Aus einer tiefsitzenden Angst vor der Zukunft kann so neue Hoffnung, neue Zuversicht, neues Handeln entstehen. Das Buch soll das Verständnis für die Zusammenhänge stärken und Lust auf eigene Aktivitäten machen. Durch die eigene Anwendung neuer Ideen lernen wir intensiver und verbessern unsere Fähigkeiten. Lesen und Schreiben haben wir nicht gelernt, indem wir lediglich Vorträge gehört haben.
Wir haben es selbst gemacht. Wir haben klein angefangen, zunächst mit einzelnen Buchstaben, dann Wörtern, später stockend ganze Texte, irgendwann fließend.
Auch Zukünftebildung lässt sich Schritt für Schritt durch eigenes Tun stärken. Langfristig werden Sie mit vielen unterschiedlichen Zukünften experimentieren können. Sie werden Ihre Vorstellungskraft stärken, innovativer sein. Zudem werden Sie besser mit der kollektiven Intelligenz ihrer Organisation arbeiten können. Sie werden kraftvollere Fragen entwickeln. Sie werden die Bedeutung von Improvisation, Spontaneität und Spielen entdecken oder wiederentdecken. Vermutlich werden Sie auch demütiger, gelassener, entspannter.
Falls Sie all das bereits machen oder können, dann bietet dieses Buch hoffentlich auch Ihnen noch relevante Hintergründe und weitere Inspiration. Falls Sie einiges davon schon länger gerne machen würden, dann bietet dieses Buch einige Argumente und viele Ideen für erste konkrete Schritte zu mehr Zukunftsarbeit. Sollten Sie mit einigen der genannten Begriffe nicht viel anfangen können, dann ist das kein Problem. Wer Lesen lernt, der muss für den nächsten eigenen Schritt auch nicht wissen, was eine Ode oder eine Dissertation ist, wer Shakespeare oder Goethe waren.
Zwei Säulen
Das Buch steht auf zwei Säulen. Erstens, meine eigenen praktischen Erfahrungen mit großen Zukunftsprozessen, die ich in den vergangenen 10 Jahren begleitet oder selbst organisiert habe. Das beginnt mit dem Prozess zur Zukunft der Sozialen
Marktwirtschaft, geht über meine Tätigkeit als Kernexperte im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin und im wissenschaftlichen Beirat der Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland“ bis zu den Prozessen „Schöne Aussichten – Forum für Frankfurt“ und #gutlebendigital des von mir geleiteten gemeinnützigen Vereins „ZGF – Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt“. Diese Prozesse sind im dritten Teil des Buches beschrieben. Über sie habe ich viele wunderbare Menschen getroffen und enorm viel über Inhalte und Methoden gelernt.
Die zweite Säule des Buches ist die enge Zusammenarbeit mit Zukünfteforschern wie Riel Miller in der UNESCO, der das Thema „Futures Literacy“ (Zukünftebildung) vorantreibt. In seinem Buchprojekt „Transforming the Future – Anticipation in the 21st Century“ konnte ich den Analyserahmen "Futures Literacy Framework” mitentwickeln, die Fallbeispiele editieren und unseren Prozess „Schöne Aussichten – Forum für Frankfurt“ als „Extended Futures Literacy Process“ vorstellen. Mit Riel habe ich „Futures Literacy Labs“ in Dubai und Dublin durchgeführt, das „Global Futures Literacy Design Forum“ in Paris mit kuratiert und 2020 den „High-Level Futures Literacy Summit“ vorbereitet. Die Einblicke und Erfahrungen aus dieser Zusammenarbeit finden sich im Buch in hoffentlich leicht verständlichem Deutsch wieder.
Basis – Werkzeuge – Anwendungen
Das Buch bietet in seinen drei Abschnitten zunächst grundsätzliche Überlegungen, dann konkrete Werkzeuge und Methoden und zum Schluss meine eigenen Erfahrungen aus größeren Zukunftsprozessen. Wer besonders an diesen praktischen Erfahrungen und Ergebnissen interessiert ist, springe zu den Kapiteln 16 bis 19 und kann sich später den etwas theoretischeren Kapiteln 1 bis 5 zuwenden.
Wer nützliche Werkzeuge für den Umgang mit eigenen Zukunftsthemen sucht, beginne im mittleren Teil ab Kapitel 6 und schaue dann rechts oder links davon. Und natürlich kann man das Buch auch in der hier aufgeschriebenen Abfolge lesen: Theorie, Werkzeuge, Anwendung. Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und erfordert keine Kenntnisse der früheren Kapitel. Es endet mit konkreten Ideen für nächste Schritte der Leser, damit sie ihre eigene Zukünftebildung aktiv stärken können.
Mein großer Dank gilt allen Menschen, die meinen Zukünfteweg in den letzten 15 Jahren geprägt und begleitet haben, die die Prozesse und Studien durch ihr Engagement ermöglicht haben, die mich in ihre Prozesse und Veranstaltungen eingeladen haben, mit denen ich diskutieren durfte, von denen ich lernen durfte, die mit ihren Empfehlungen meine Bibliothek anwachsen ließen, die kritisch hinterfragten. Einige dieser Menschen werden in diesem Buch erwähnt. Ich entschuldige mich bei allen, die nicht namentlich genannt werden.
1 Miteinander reden – der Dialog
Ein graues Telefon mit Drehscheibe, dick umwickelt mit einer Mullbinde. Ein Kassettenspieler, ebenfalls umwickelt, sodass die Töne nur noch schwer zu hören sind. So stellt die Künstlerin Barbara Meisner die Schwierigkeiten der Kommunikation in ihrer Kindheit dar. Über viele wichtige Themen wurde in ihrer Familie und ganz allgemein in Deutschland kaum gesprochen. Dazu gehören die traumatischen Erfahrungen der geburtenstarken Jahrgänge um 1940. Sie erlebten als kleine Kinder Krieg, Hunger, Tod, Flucht und Vertreibung in zerbombten Städten, auf dem Land oder auf endlosen Wanderungen in Richtung Westen. Nach dem Krieg prägten die Kriegskinder mit diesen schrecklichen Erfahrungen Deutschland. Sie bauten Institutionen der Sicherheit und Stabilität auf, für die wir alle dankbar sein können. Manchen jüngeren Menschen mit anderen Prägungen erscheinen sie heute als zu wenig flexibel.
Wie wenig über diese Traumata gesprochen wurde, das zeigte uns Barbara Meisner mit ihrer künstlerischen Darstellung auf einem Treffen der Kriegsenkel, also der Kinder der Kriegskinder. Da wurde mir klar, warum mir miteinander zu reden so wichtig ist und warum es manchmal schwer ist, dafür die passenden Foren und Mitstreiter zu finden.
Intensive, vertrauensvolle Gespräche
Das Schweigen über diese traumatische Zeit, auch über Schuld und Verantwortung der Großeltern, hat dazu beigetragen, dass wir in Deutschland und vermutlich anderswo den Dialog nicht praktiziert und erlebt haben. Mit Dialog meine ich aufbauend auf Sokrates, David Bohm, Martin Buber und William Isaacs ein intensives, vertrauensvolles Gespräch zwischen Menschen, das zu einem tieferen Verständnis füreinander führt und neue Möglichkeiten eröffnet. Dieser Dialog hat sich in meinen Projekten der letzten Jahre als Basis herauskristallisiert.
Zusätzlich zur Kriegserfahrung gibt es weitere Erklärungen dafür, warum echter Dialog in Deutschland und anderswo nicht leicht ist. In den letzten Jahrzehnten hat eine wissenschaftliche Disziplin die Gesellschaft hierzulande und weltweit besonders stark geprägt: die Volkswirtschaftslehre, die Disziplin, in der ich ein Diplom und einen Doktorgrad erhalten habe. Dort gibt es keinen Bedarf für Dialog. Nötig ist lediglich, dass die Marktteilnehmer ihre Preise, verfügbaren Mengen und Qualitäten sichtbar machen. Dann stellt jeder den passenden Warenkorb zusammen, Geld und Ware wechseln den Besitzer. Fertig. Wer nichts oder zu wenig verkauft hat, der scheidet aus dem Markt aus. Wer viel verkauft hat, hebt die Preise im nächsten Durchgang wahrscheinlich an. Ein Dialog über individuelle oder gesellschaftliche Bedürfnisse ist nicht notwendig. Über wünschenswerte Zukünfte muss nicht gesprochen werden, da in dieser Theorie der freie Markt die Wünsche der Menschen sichtbar macht. Der beste Weg in die Zukunft ist in dieser Erzählung eine Ausweitung des Marktes auf immer mehr Bereiche: Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung.
Das war das Mantra einer wachsenden Zahl von Volkswirten spätestens seit den 1980er Jahren. Als neoklassisch ausgebildeter Volkswirt war ich von 1997 bis 2008 bei der Investmentbank Merrill Lynch und in der Deutschen Bank mittendrin in dieser Erzählung. Und bin geflohen, da diese Grundideen in vielen wichtigen gesellschaftlichen Themen zu kurz greifen. Wir können unser Bildungssystem nicht allein vom Markt organisieren lassen, unsere Demokratie ebenso wenig und schon gar nicht unser so wichtiges Zusammenleben in Familie, Nachbarschaft und in den Städten. Gleiches gilt für Sicherheit, Umwelt, Kultur und Mobilität. Alles das sind die wichtigen Themen für die Lebensqualität der Menschen und die Zukunft unserer Gesellschaften. Ohne Dialog können wir diese Themen nicht zufriedenstellend angehen, können wir nicht herausfinden, was uns Menschen wirklich wichtig ist und wo Handlungsbedarf besteht.
Dialog und Hierarchie
Ein weiterer Punkt erschwert in Deutschland das offene, ehrliche Gespräch auf Augenhöhe: die Hierarchie. Manche Personen halten Dialog für nicht so wichtig, da sie an hervorgehobener Stelle sitzen und über die Zukunft entscheiden können. Hier wirken Prägungen aus dem Kaiserreich und den autoritären Regimen bis 1945 oder im östlichen Teil Deutschlands bis 1990 nach. Diese Prägungen setzen sich bewusst oder unbewusst bis in die Unternehmen und in die politischen Parteien hinein fort. Zugespitzt gefragt: Warum mit den einfachen Arbeitskräften reden, was wissen die schon? Warum im Gespräch mit der Wählerschaft bleiben, schließlich hat diese mich ja für fünf Jahre zu ihrem Repräsentanten gewählt?
Ein anderes Vorgehen sind wir noch nicht gewohnt, haben wir nicht geübt. Hierarchische Strukturen sind dann stabil, wenn die Anweisungen von oben weiter unten umgesetzt werden. So wollen sich heute immer weniger Mitarbeiter und Menschen verhalten. Sie sehen selbst, was funktioniert und was nicht. Sie haben reichhaltige Erfahrungen, die für den Erfolg einer Organisation und einer ganzen Gesellschaft wichtig sind. Diese Menschen wollen sich einbringen. Das heißt nicht, dass jeder über alles mitreden sollte. Rechtschreibung lernen Kinder nicht im Dialog. Fakten zum Klimawandel stehen nicht zur Diskussion. Das Potential des Dialogs ist aber noch lange nicht ausgeschöpft.
Die Kunst, gemeinsam zu denken
Die Tür zum Dialog hat für mich Heiko Roehl aufgemacht, nachdem er 2009 zur Eröffnungsfeier des Zentrums für gesellschaftlichen Fortschritt gekommen war. Dort skizzierte ich unser Vorhaben, dem Thema Lebensqualität in Deutschland eine höhere Sichtbarkeit und mehr gesellschaftliche Relevanz zu verschaffen. Daraufhin sagte er mir: „Stefan, was Du hier vor hast, ist ein Veränderungsprozess auf der gesellschaftlichen Ebene. Schau Dir an, welche Methoden dazu auf der Ebene der Organisationen eingesetzt werden.“ Er verwies mich auf sein eigenes Buch zu „Mapping Dialogue“ und auf die bereits erwähnten Vordenker wie David Bohm und William Isaacs.
Für William Isaacs ist der Dialog die Kunst, gemeinsam zu denken und eine Konversation mit einer Mitte statt mit Seiten zu führen. Deshalb wird er üblicherweise in Kreisen abgehalten, wo niemand eine hervorgehobene Position hat. Issacs unterscheidet den Dialog von anderen Formen der Konversation. Für den kompetenten Umgang mit der Zukunft ist es wichtig zu wissen, welche Form man vorfindet oder gestalten möchte. Will man eine Debatte (von französisch débattre „(nieder-) schlagen“) haben, in der die Redner den jeweils eigenen Standpunkt geschickt in Worte kleiden und verteidigen? Den meisten Applaus erhält dort der mächtigere, lautere, eloquentere oder auch der witzigere Redner. Man hört nicht zu, um zu verstehen, sondern um an der eigenen Gegenrede zu feilen. Orte für Debatten sind Parlamente, Debattierclubs, Podiumsdiskussionen und abendliche Talkshows im Fernsehen. Die Rollen und der Ablauf sind klar, viel Neues kann so allerdings nicht entstehen. Zudem überzeugt man in einem solchen Format ohnehin nur selten sein Gegenüber. Vielleicht einige der Zuhörenden. Oder will man wenigstens eine Diskussion, in der man gemeinsam ein Thema untersucht und vielleicht zu einer Synthese der ursprünglichen Standpunkte kommt? Dann besteht mehr Offenheit dafür, vom anderen etwas zu lernen, dessen Argumente und Daten zumindest anzuerkennen und zu betrachten.
Isaacs geht es vor allem um die Möglichkeiten eines reflektiven und generativen Dialogs, in dem neue Ideen aus der kollektiven Intelligenz der Teilnehmenden entstehen. Er möchte den unterliegenden Ursachen, Regeln und Annahmen eines Themas nachgehen, um tieferliegende Fragen sichtbar zu machen. Isaacs bezieht sich auf den Physiker David Bohm. Dieser sieht im Dialog eine Möglichkeit, um gemeinsam zu denken und so „auf intelligente Weise tun zu können, was auch immer getan werden muss“.
Ein zentraler Untersuchungsgegenstand im Bohmschen Dialog sind Annahmen, also nicht bewiesene oder sogar nicht beweisbare Aussagen oder Zusammenhänge. Sie werden sichtbar gemacht und man geht den wirklichen oder vermeintlichen Zwängen dahinter nach. Diese Annahmen der verschiedenen Teilnehmenden werden nicht beurteilt, sondern in der Schwebe gehalten. Das Ziel ist es, im Fluss der Worte neuen Sinn sichtbar zu machen, wenn alle gemeinsam den Annahmen nachgehen.
So kann Neues entstehen, Innovation wird auf einer soliden Basis möglich. Für Isaacs sind die wichtigsten Teile einer Konversation diejenigen, die sich keiner der Beteiligten vorab hätte vorstellen können. Natürlich ist es schwer, genau zu bestimmen, welcher Teil nun wirklich völlig neu ist. Hinterher werden viele meinen, dass sie diesen Gedanken schon vor Jahren hatten oder sogar schon aufgeschrieben hatten.
Der Dialog in der Praxis
Bohm bevorzugt ein einfaches Format: Man setzt sich in einen Kreis, ohne Gesprächsleitung, ohne Tagesordnung, ohne Zielsetzung und schaut, was entstehen will. Das ist ein Experiment, also der Versuch etwas neu oder anders zu machen. Es ist ungewohnt, es kann sogar Angst machen. Anfangs bleibt die Gruppe vermutlich recht oberflächlich und spricht über das Format. Mit etwas Übung kann man dann nach und nach tiefer gehen.
So schön und wichtig der generative, reflexive Dialog auch klingt, in der Praxis wird er selten so gelebt. Zudem wird der Begriff des Dialogs mittlerweile oft falsch verwendet und damit beschädigt:
„Dialogpost“ ist Werbung, viele „Dialogforen“ sind vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Das lässt sich leicht erkennen. Schwierig ist es, echten Dialog in Zukunftsprojekten einzusetzen. Zu den eingangs genannten Herausforderungen mangelnder Praxis und hierarchischer Strukturen kommt die grundlegende Anforderung der Ergebnisoffenheit von Dialogen hinzu. Nur so kann Neues entstehen. Diese Offenheit widerspricht dem weit verbreitetem Verfolgen von vorab feststehenden Eigeninteressen. Warum sollte ich mich in einen Dialog einbringen, wenn nicht sicher ist, dass meine Standpunkte, meine Produkte oder meine Politik dadurch mehr Sichtbarkeit erhalten? Offenheit und Eigeninteresse sind keine guten Freunde. In komplexen menschlichen Systemen gilt es Wege zu finden, um mit beidem umzugehen.
Einen Dialog selbst anstoßen
Bei Ihnen hat dieses Kapitel vermutlich einiges Nachdenken bewirkt. Vielleicht haben Sie bereits Ideen, wie und mit wem Sie den Dialog in Ihrem Umfeld lebendiger werden lassen können.
Hier ein paar Vorschläge von meiner Seite:
Suchen Sie mit den Argumenten dieses Kapitels das offene, hierarchiefreie Gespräch zu relevanten Themen am Arbeitsplatz oder in ihrer Organisation.
Regen Sie in ihrem Umfeld Veranstaltungen mit mehr Dialogelementen an, um die üblichen Vortragsformate und Podiumsdiskussionen zu ergänzen.
Organisieren Sie einen eigenen Salon im Format eines Dialogs, egal ob nach Bohm oder Isaacs oder wem auch immer.
Weisen Sie in Gesprächen mit Politikern auf die Bedeutung des fortlaufenden Dialogs hin, machen Sie Themen- und Formatvorschläge dafür.
Lesen Sie von David Bohm „Der Dialog – Das offene Gespräch am Ende der Diskussion“ oder von William Isaacs „Dialog als Kunst gemeinsam zu denken“.
2 Kraftvolle Fragen stellen
Früher hatte ich Antworten, heute stelle ich Fragen. Das beschreibt meinen Wandel vom Volkswirt, der um die Welt reist und den Investoren die Lage in Europa erklärt, zum Zukünfteforscher, der gemeinsam mit vielen anderen Menschen neue Ideen für die Zukunft erarbeitet.