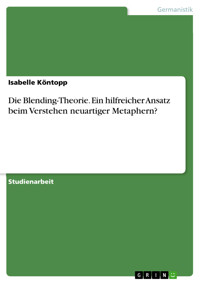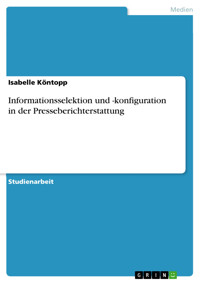Zur sprachlichen Realisierung geschlechtsspezifischer Stereotype in der Presseberichterstattung E-Book
Isabelle Köntopp
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Technische Universität Berlin (Kommunikation und Sprache), Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Masterarbeit wird die sprachliche Darstellung von Geschlechterstereotypen in der deutschsprachigen Presseberichterstattung untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berichterstattung über Frauen in Führungspositionen in Politik und Industrie – zwei Bereiche, die stark von Männern geprägt sind, in denen sich jedoch seit geraumer Zeit ein Wandel abzeichnet. Es wird herausgearbeitet, welche Perspektivierungen und Evaluierungen gegenwärtig von TextproduzentInnen in der Boulevard- sowie der seriösen Presse vorgenommen werden. Damit einhergehend werden persuasive Aspekte der Berichterstattung betrachtet. Bestandteile der Arbeit sind ein Überblick über den interdisziplinären Forschungsstand, die linguistische Einordnung der Thematik, eine terminologische Abgrenzung sowie die Analyse und Auswertung von Textbeispielen. Übergeordnet steht die Frage nach der potenziellen Wirkung sprachlich inszenierter Stereotype auf die Einstellungen von RezipientInnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Abstract
In der vorliegenden Masterarbeit wird die sprachliche Darstellung von Geschlechter-stereotypen in der deutschsprachigen Presseberichterstattung untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berichterstattung über Frauen in Führungspositionen in Politik und In-dustrie – zwei Bereiche, die stark von Männern geprägt sind, in denen sich jedoch seit gerau-mer Zeit ein Wandel abzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Vorwort
0. Einleitung
0.1 Erkenntnisinteresse
0.2 Thesen
1. Zum Forschungsstand
1.1 Geschlechterstereotype im interdisziplinären Kontext
1.2 Inhalte geschlechtsstereotyper Vorstellungen
1.3 Zur Abgrenzung von Stereotyp, Vorurteil und Klischee aus kognitionslinguistischer Sicht
1.4 Beitrag der Presseberichterstattung zur Etablierung und Aufrechterhaltung
1.5 Kapitelzusammenfassung
2. Informationsselektion, Perspektivierung, Evaluierung und persuasives
2.1 Informationsselektion und Perspektivierung/ Evaluierung
2.2 Informationsselektion und persuasive Aspekte
2.2.1 Persuasive Strategien
2.2.2 Formen der Ereignisdarstellung
2.2.3 Schein-Evidenz
2.2.4 Analogien
2.3 Kapitelzusammenfassung
3. Korpus
3.1 Auswahl des Textkorpus
3.2 Vorgehen
4. Formen geschlechtsspezifischer Perspektivierung und Evaluierung als Ausdruck von Stereotypen in der Presseberichterstattung
4.1 Realisierung geschlechtsspezifischer Stereotype
4.1.1 Globalstereotyp und eiserne jungfrau
4.1.2 hausfrau und sonnyboy
4.1.3 Zwischenfazit
4.2 Vorurteilsverbalisierungen
4.2.1 Eine Frau als Verteidigungsministerin?
4.2.2 Zuschreibung von Inkompetenz: kind und kavalier
4.2.3 Zwischenfazit
4.3 Geschlechtsspezifische Informationsselektion: personen- vs. themenbezogene
4.3.1 Als erste Frau…
4.3.2 und trotz der Kinder
4.3.3 Das schöne Geschlecht?
4.3.4 Zwischenfazit
4.4 Perspektivierung und Evaluierung durch männliche und weibliche
4.4.1 Darstellung von Frauen in Führungspositionen der Industrie
4.4.2 Darstellung von Politikerinnen
4.4.3 Zwischenfazit
4.5 Kapitelzusammenfassung
5. Diskussion
6. Fazit und Ausblick
7. Bibliographie
7.1 Literaturverzeichnis
Vorwort
0. Einleitung
„Die Definition des Exzellenten steckt auf allen Gebieten voller männlicher Implikationen, deren Eigenart es ist, nicht als solche in Erscheinung zu treten. Die Definition einer Stelle, besonders einer solchen mit Machtbefug-nissen, umfasst lauter mit geschlechtlichen Konnotationen versehene Eignungen und Befähigungen. Viele Positionen sind für Frauen deshalb so schwer erreichbar, weil sie maßgeschneidert sind für Männer, deren Männlichkeit durch Entgegensetzung zu den heutigen Frauen konstruiert wurde.“ (Pierre Bourdieu)
Geschlechterforschung wird seit Jahrzehnten in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie in den Sozial-, Kultur-, Medien- und Kommunikationswissenschaften, der Sozialanthropologie (bzw. Ethnografie), der Psychologie oder den Gender-Studies vorangetrieben. Die linguistische Forschung zum Zusammenhang von Sprache und Geschlecht ist ebenfalls vielfältig und lässt sich bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen. Bislang ist sie vor allem auf die Analyse des geschlechtsspezifischen Sprechens und Kommunikationsverhaltens ausgerichtet und somit Teil der Sozio- und Diskurslinguistik, der Gesprächsanalyse oder auch der Dialektologie. In diesem Zusammenhang hat sich als eigenständiger Zweig die Feministische Linguistik etabliert (s. Pusch 1983). Diese befasst sich seit Ende der siebziger Jahre mit sexistischem Sprachgebrauch und mit geschlechts-spezifischem Sprechen (s. Samel 2000: 20). Dabei spielen beispielsweise die textuelle Repräsentation der Geschlechter und die Durchsetzung einer geschlechtergerechten Sprache eine wesentliche Rolle (s. Kotthoff 2008: 2495).
Die vorliegende Arbeit grenzt sich von diesen Ansätzen dahingehend ab, dass es sich um eine deskriptive, kognitionslinguistische Betrachtung sprachlicher Realisierungen von Geschlechterstereotypen handelt. Die Kognitive Linguistik greift dabei „auf die Ergebnisse sprachpsychologischer Forschung zurück, um dem Kriterium der kognitiven Plausibilität […] gerecht zu werden“ (Schwarz 2008: 232 f.). In den Massenmedien wird die Kategorie gender, d. h. das soziale Geschlecht, fast immer bedeutsam gemacht und stereotyp inszeniert (s. Kotthoff 2008: 2515 f.). Dieser Aspekt wird anhand der Presseberichterstattung über Frauen, die gegenwärtig in hohen politischen Ämtern und Posten in der Industrie tätig sind, aus kognitionslinguistischer Perspektive untersucht. Eine durchgehende, mehr oder weniger subtile Diskriminierung von Frauen in den Medien wurde in der Vergangenheit in unterschiedlichster Hinsicht festgestellt:
„Die Diskriminierung besteht gerade sehr oft darin, wie eine Frau angeredet oder nicht angeredet wird, wie ihr Redebeitrag abgetan, nicht gehört, mißverstanden, falsch paraphrasiert, unterbrochen und ignoriert wird, wie sie lächerlich gemacht, bevormundet oder entwertet wird, und nicht zuletzt darin, wie man über sie redet“ (Trömel-Plötz 1978: 50).
Bislang wird die Darstellung von Frauen in der Presse vor allem in medien- und kommunikationswissenschaftlichen Aufsätzen (bspw. im Rahmen des media framing) thematisiert.[1] Ob sich diskriminierendes Verhalten, wie es im obigen Zitat beschrieben wird, als Ausdruck von Stereotypen und Vorurteilen auch in der schriftlichen Bericht-erstattung über Frauen widerspiegelt und ob diese Feststellung gegenwärtig Bestand hat, soll in dieser Arbeit qualitativ untersucht werden. Vorurteile und stereotype Vorstellungen sind häufig die Grundlage für eine geschlechtsspezifische Diskriminierung und können laut Carlin/ Winfrey (2009: 329) durch den Einsatz von Sprache verstärkt werden. Dies wird insbesondere durch die Presseberichterstattung möglich: „Die Rezeption massenmedialer Texte kann dazu führen, dass globale Einstellungen in Form von stereotypen Pauschalurteilen, aber auch bestimmte Wertevorstellungen […] evoziert bzw. verfestigt werden […]“ (Schwarz-Friesel 2013: 233). Für den englischen Sprachraum belegen Studien, dass Medien eine geschlechtsspezifische Berichterstattung über Politikerinnen vornehmen, die über sexistischen Sprachgebrauch oder stereotype Porträtierungen hinaus geht. So bestehen bspw. Unterschiede bezüglich der Quantität, der Qualität sowie der Bewertungen durch die Medienberichterstattung, die die Glaubwürdigkeit von Wahl-kampf-Kandidatinnen beschädigen können (vgl. Aday/Devitt 2001; Banwart/Bystrom & Robertson 2003; Devitt 2002; Kahn 1994; Kahn/ Goldenberg 1991).
Auch im 2013 gewählten 18. Deutschen Bundestag sind Frauen unterrepräsentiert. 229 Frauen zogen in den Bundestag ein, was einem Anteil von 36,3 Prozent entspricht. Jedoch ist der Frauenanteil im Deutschen Bundestag damit so hoch wie nie zuvor.[2] Angesichts dieser Feststellung sowie des Anbruchs der mittlerweile dritten Legislaturperiode von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dürfte außer Frage stehen, dass Frauen in der Politik eine stetig wachsende Rolle einnehmen und damit verstärkt in den Fokus der Pressebericht-erstattung geraten. Auch in Industrie und Wirtschaft nimmt die Zahl von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten zu, wenngleich sie noch immer verschwindend gering erscheint (2013 betrug der Anteil der Frauen in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen 4,8 Prozent).[3] Dabei gilt in der Berichterstattung: „Je höher das Prestige und je umfassender der Kompetenzbereich innerhalb der jeweiligen Machteliten ist, umso bedeutender wird eine Person für die Nachrichtenherstellung“ (Huhnke 1996: 62). Hinzu kommen im öffentlichen Diskurs geführte Debatten zu gesetzlichen Quotenregelungen in Unternehmensvorständen sowie verbesserten Möglichkeiten der Vereinbarung von Familie und Beruf für Mütter und Väter.
Darüber, wie die „Inszenierung“ geschlechtsspezifischer Stereotype in der Pressebericht-erstattung auf Textebene genau erfolgt, existieren aus kognitionslinguistischer Sicht bisher kaum Publikationen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kognitionslinguistische Textanalyse der Darstellung von Frauen in Führungspositionen durch die Pressebericht-erstattung. Es soll untersucht werden, wie die Presse über Frauen berichtet, die in (vormals) männlich dominierten Arbeitsfeldern, wie Politik und Industrie, tätig sind. Dabei soll punktuell ein Vergleich zur Berichterstattung über Männer in ähnlichen Positionen erfolgen. Des Weiteren wird analysiert, ob männliche und weibliche TextproduzentInnen unterschiedliche Perspektivierungen und Evaluierungen vornehmen.
Nachfolgend wird das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit anhand spezifischer Fragestellungen und Thesen näher ausgeführt. In den Kapiteln 1 und 2 erfolgt ein Abriss über den umfangreichen interdisziplinären Forschungsstand sowie die terminologische Abgrenzung der für die bearbeitete Thematik relevanten Fachbegriffe. Nachdem der theoretische Rahmen auf diese Weise eingegrenzt wurde, finden sich in Kapitel 3 Erläuterungen zum verwendeten Korpusmaterial. In Kapitel 4 soll die Präsentation und Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Untersuchung des Korpusmaterials anhand ausgewählter Textbelege erfolgen. Abschließend werden die Ergebnisse im Diskussionsteil erörtert und im Fazit zusammengefasst.
0.1 Erkenntnisinteresse
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, inwiefern Stereotype bzw. Vorurteile gegenüber Frauen in Spitzenpositionen der Politik und Industrie in Deutschland gegenwärtig verbalisiert werden: Wie spiegeln sich stereotype Konzeptualisierungen im sprachlichen Ausdruck wider? Mit welchen sprachlichen Mitteln intendieren TextproduzentInnen in dieser Hinsicht eine persuasive Wirkung, eine spezifische Einstellung bei den RezipientInnen? Die kognitionslinguistische Auseinandersetzung erfolgt mit dem Ziel, „die Konzeptualisierungsstrukturen der Sprachproduzenten zu rekonstruieren […]“ und „die Intention ihrer Verfasser (sowie das Persuasionspotenzial in Bezug auf die Rezipienten) transparent zu machen“ (Schwarz 2008: 233). In diesem Sinne wird versucht, „Sprachproduktionsdaten (als Spuren der kognitiven Aktivität der Benutzer) so zu erklären, dass sie Aufschluss über die Interaktion sprachlicher und konzeptueller Kompetenz geben“ (Schwarz 2008: 233). Es erfolgt ein punktueller Vergleich zur Berichterstattung über Männer in äquivalenten Führungspositionen.[4]
In diesem Zusammenhang ist relevant, welche Informationen über Frauen in Führungs-positionen durch die Presse in den Fokus gerückt und welche Perspektivierungen dabei vorgenommen werden. Finden Evaluierungen vermehrt auf der Sachebene, d. h. hin-sichtlich der geleisteten Arbeit, oder auf der persönlichen Ebene statt? Des Weiteren ist zu fragen, inwiefern männliche und weibliche JournalistInnen unterschiedliche geschlechts-spezifische Perspektivierungen realisieren und damit ggf. verschiedene Intentionen sichtbar werden.
0.2 Thesen
Es wird auf der Basis bestehender Forschung (s. Kap. 1) von der Grundannahme aus-gegangen, dass eine geschlechtsspezifische Berichterstattung in der Presse erfolgt. Darauf basieren folgende Vorüberlegungen und Thesen:
Es werden vielfältige persuasive Strategien eingesetzt, die dazu beitragen können, dass sich Geschlechterstereotype und Vorurteile bei RezipientInnen manifestieren bzw. dass spezifische Einstellungen gegenüber bestimmten Frauen oder auch Frauen im Allge-meinen evoziert werden.
Der Einsatz persuasiver Mittel bei der Darstellung von Frauen in Führungspositionen, durch welchen Einfluss auf Einstellungen und Urteile der RezipientInnen intendiert wird, wird übergreifend (d. h. in der Boulevard- und der seriösen Presse) erwartet.[5] Zu den verwendeten Strategien werden sicherlich das Berufen auf regelhafte Beziehungen (und damit der Bezug zu tradierten Geschlechterrollen), Spekulationen sowie der Gebrauch von Metaphern und Vergleichen für Evaluierungen und eine geschlechtsspezifische Charakterisierung gehören.
Die sprachliche Realisierung von Geschlechterstereotypen unterscheidet sich sowohl zwischen der Boulevard- und der seriösen Presse, als auch zwischen männlichen und weiblichen TextproduzentInnen.
In der seriösen Berichterstattung werden sprachlich repräsentierte Vorurteile und Stereo-type hintergründig platziert und damit indirekt vermittelt. Hinsichtlich der Informations-selektion über Frauen in Führungspositionen wird angenommen, dass sich die seriöse Presse vorrangig auf die Wiedergabe sachbezogener Informationen fokussiert: Bewer-tungen werden vermutlich hinsichtlich der geleisteten Arbeit der Frauen vorgenommen und weniger auf die Person, ihren Charakter oder ihr Äußeres bezogen sein, als dies in der Boulevardpresse erwartet wird. In der Boulevardpresse werden sich größere Unterschiede zwischen den Berichten über Frauen und Männer nachweisen lassen. Das „Frau-Sein“ in hohen beruflichen Stellungen wird expliziter thematisiert und vorurteilsbehaftet sein. Es ist eine vordergründige Selektion persönlicher Informationen zu erwarten.
Des Weiteren ist zu vermuten, dass Textproduzenten andere Perspektivierungen und Evaluierungen vornehmen, als Produzentinnen. Möglicherweise werden von männlichen Journalisten geschlechtsspezifische Vorurteile in größerem Ausmaß und expliziter formuliert, da Frauen in Männerdomänen aufgrund verschiedener, teils unbewusster Faktoren (z. B. sozialisationsbedingt) eine geringere Akzeptanz erfahren. Hingegen werden Autorinnen Frauen in Führungspositionen tendenziell positiv evaluieren und versuchen, ein hohes Identifikationspotenzial für RezipientInnen herzustellen.
1. Zum Forschungsstand
In diesem Kapitel sollen die Erkenntnisse von Publikationen zusammengefasst werden, die aufzeigen, wie Frauen im Allgemeinen und insbesondere die berufstätigen durch die Presse dargestellt werden. Um linguistisch fundierte Aussagen darüber machen zu können, wie auf beruflich erfolgreiche Frauen gegenwärtig in der Presse referiert wird, ist es unerlässlich, auch die Erkenntnisse aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu dieser Thematik zu betrachten. Vor allem die Soziologie und Sozialpsychologie, aber auch die Medien- und Kommunikationswissenschaften befassen sich mit Geschlechterstereotypen als kognitivem Phänomen sowie in Zusammenhang mit sprachlichen Manifestationen. Diese Erkenntnisse werden in Relation zur kognitionslinguistischen Sichtweise auf die behandelte Thematik gesetzt. Auf diese Weise kann die vorliegende Bestandsaufnahme in den interdisziplinären Kontext bisheriger Forschung zu Geschlechterstereotypen und geschlechtsspezifischen Vorurteilsverbalisierungen eingeordnet werden. Zugleich wird eine Abgrenzung der unterschiedlichen Termini, die mit (Geschlechter-) Stereotypen in Verbindung stehen, vorgenommen. In diesem Zusammenhang werden interdisziplinäre Forschungsergebnisse darüber vorgestellt, welche stereotypen Vorstellungen über Frauen existieren.
1.1 Geschlechterstereotype im interdisziplinären Kontext
Der Terminus Stereotyp existiert mittlerweile seit über 90 Jahren und wurde zunächst von Lippmann (1922; 1964: 9) sehr allgemein als „Bilder in unseren Köpfen“ definiert. Huhnke (1996: 200) beschreibt geschlechtsspezifische Stereotype und Klischees aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive unter weitgehend synonymer Verwendung als Realitätssurrogate, durch die „Informationen über Frauen auf ein beschränktes Repertoire von Bildern und Vorstellungen komprimiert werden“. Stereotype bezieht sie hinsichtlich geschlechtsspezifischer Presseberichterstattung recht unspezifisch und vage auf „nicht-argumentativ begründete ‚Erzählungen‘ über soziale und politische Sachverhalte, die Frauen betreffen“ (Huhnke 1996: 200). Aus einer soziologischen Perspektive auf berufstätige Frauen stellt Kanter (1977: 232) fest, dass diese auch in Spitzenpositionen auf geschlechtsspezifische Rollen reduziert werden: „There was also a tendency to encapsulate women and to maintain generalizations by defining special roles for women, even on the managerial and professional levels […]”.
Nach Schwarz-Friesel (2013: 340) wird der Terminus Stereotyp meist generell „im sozialpsychologischen Sinne verwendet, um in einer Gesellschaft verbreitete Vor-stellungen von charakteristischen Zügen und Verhaltensweisen der Mitglieder sozialer und ethnischer Gruppen zu beschreiben“. Ein Stereotyp „hat die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional-wertender Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften zu- oder ab-spricht“ (Quasthoff 1973: 28). Demnach handelt es sich bei Geschlechterstereotypen um die als charakteristisch betrachteten Eigenschaften und Merkmale, die Männern und Frauen jeweils zugeschrieben werden. Diese Definition genügt zwar noch nicht dem Zweck einer kognitionslinguistischen Auseinandersetzung mit der Thematik (s. Kap. 1.2), dient aber als erste Verständnisgrundlage für die durchaus maßgeblichen Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie.