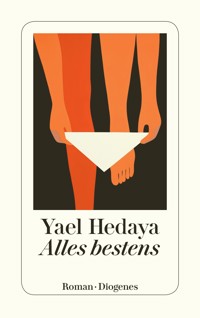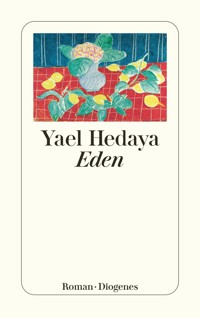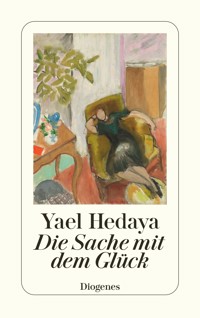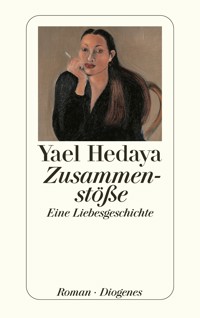
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, ein Mann, ein Problem: Jonathan, alleinerziehender Vater einer zehnjährigen Tochter, und Schira, beide Schriftsteller, beide Singles. Sie verlieben sich, scheinen irgendwie füreinander geschaffen, doch eine neue Beziehung anzufangen ist genauso schwierig, wie ein Buch fertig zu schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1064
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Yael Hedaya
Zusammenstöβe
EineLiebesgeschichte
Roman
Aus dem Hebräischen vonRuth Melcer
Titel der 2001 bei
AmOved Publishers Ltd., Tel Aviv,
erschienenen Originalausgabe ›Te’ unot‹
Copyright © 2001 by Yael Hedaya
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Anna Keel,
›Fabienne sitzend, mit Tischchen und
Kaffeetasse und Apfel‹, 1979
(Ausschnitt)
Für
meine Mutter
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23397 3 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60378 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Erster Teil
[7] 1
Dana saß auf einem Stuhl im Zimmer der Schulkrankenschwester und wartete. Die Krankenschwester saß ihr gegenüber hinter dem Schreibtisch und tat beschäftigt. Sie sah ihre Unterlagen durch und grübelte, ob sie irgendwelche Telefonate zu erledigen habe, etwas, das wichtig klänge oder zumindest glaubwürdig, denn ihr war klar: Wenn sie ein Telefonat nur vortäuschte, hätte das Kind dies im Nu durchschaut. Leider fiel ihr niemand ein, den sie hätte anrufen können, und um Danas Blick auszublenden, der am Fußboden klebte und den sie allein schon aus diesem Grund als sekkant und ärgerlich empfand, nahm die Krankenschwester einen Stift und Papier zur Hand und fing an zu kritzeln.
Eine halbe Stunde später nahm Jonathan Luria seine Tochter in Empfang. Er trug verblichene Cordhosen und dieselbe braune Wildlederjacke, in der die Krankenschwester ihn seit der Einschulung seiner Tochter jeden Winter sah, an all den Vormittagen, an denen sie ihn ins Krankenzimmer der Schule bestellte, und nachdem sie die beiden über den breiten Flur zum Schuleingang geleitet hatte, kehrte sie in ihr Zimmer zurück, setzte sich an den Schreibtisch und warf einen Blick auf ihr Schmierblatt. Was da stand, war in ihren Augen nicht mehr witzig, im Gegenteil, eher beunruhigend. ›Jonathan Luria‹ hatte sie gekritzelt, wieder und wieder, wie ein Teenager, und eine halbe Seite gefüllt.
Sie beneidete das kleine Mädchen um die tägliche Nähe zu diesem Mann, und wenn sie Dana in der Abgeschirmtheit des Zimmers, in dem es nach Jod und Pflaster roch, Fieber maß und ihr [8] den Spatel in den Mund schob, um einen Blick in ihren Rachen zu werfen, hätte sie sie schon des öfteren gern ausgefragt – über den Mann, der in der Schule stets ›Danas Papa‹ hieß und den sie selbst in Gedanken lieber ›Jonathan Luria‹ nannte, denn über ›Danas Papa‹ zu phantasieren, das war ihr doch irgendwie zuviel.
Er war stets höflich, stellte Fragen zum Gesundheitszustand seiner Tochter und hörte schweigend zu, während die Krankenschwester ihm Ratschläge zur Behandlung von Danas jeweiliger Krankheit erteilte und ihre Ansicht darüber äußerte, ob ein Arztbesuch nötig sei, um ein neues Antibiotikum verschreiben zu lassen, oder ob das Arsenal an Medikamenten, das Danas Vater ohnehin im Haus hatte, ausreichte. Was bei ihm im Arzneischränkchen stand, war der Krankenschwester hinreichend bekannt, doch sie wollte andere Dinge in Erfahrung bringen, und obwohl sie wußte, daß sie über die jeweilige Behandlung nicht eigenmächtig entscheiden durfte, suchte sie immer nach Mitteln und Wegen, um das Gespräch mit Jonathan Luria in die Länge zu ziehen, wenn er, am Schuleingang angelangt, seiner Tochter, die mit gesenktem Blick neben ihm stand, die Hand auf die Schulter legte und sich mit den Worten: »Na, dann – tschüs, Esthi, und noch mal vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns diesen Winter nicht wieder« verabschiedete.
Die Krankenschwester dagegen hatte keinen Zweifel, daß sie sich wiedersähen. Während der Pausen auf dem Schulhof oder auf den belebten Gängen, wo es im Winter, wenn die Fenster geschlossen blieben, säuerlich nach Obst und feuchten Quarkbroten roch, die in Tüten vor sich hin schwitzten, behielt sie Dana stets im Auge. Sowie sie sie ertappte, daß sie die Nase hochzog oder ihre Augen verdächtig glänzten, fühlte sie der Kleinen die Stirn und fragte sanft, ob es ihr denn auch gutgehe, und bisweilen sah sie berechtigten Anlaß, das Mädchen mit ebenso sanfter Bestimmtheit zum Fiebermessen zu zitieren. Und da Fieber eine relative Angelegenheit ist, man in Danas Fall jedoch [9] keinerlei Risiken eingehen durfte, rief die Krankenschwester ohne zu zögern, aber mit Schmetterlingen im Bauch Jonathan Luria an und vergaß jedesmal aufs neue, daß es mindestens zwanzig Minuten dauern würde, bis er seine Tochter abholte – zwanzig lange Minuten, in denen sie mit dem kleinen Mädchen in ihrem Zimmer festsaß.
Dana folgte ihrem Vater schweigend zum Wagen. Er schritt zügig voran, wie immer, insbesondere wenn seine vormittäglichen Gedanken ihn umtrieben – als könnte sein Gang ihn davor bewahren, daß der Faden, den er in Gedanken spann, ein weiteres Mal riß; dabei wußte Jonathan nur zu gut, daß dieser Faden ohnehin bereits gerissen war, und das schon vor geraumer Zeit. Da die regelmäßigen Anrufe vom Krankenzimmer der Schule jedoch inzwischen fester Bestandteil seines neuen Lebens geworden waren, ein eigener Gedankengang, der sich nahezu reibungslos in die belebten Bahnen seiner übrigen Gedanken einfädelte, machte Jonathan sich nicht mehr die Mühe, seinen forschen Gang zu drosseln wie in der ersten Zeit, nachdem Nira, die Schwester seiner toten Frau, ihn vorsichtig, aber im Brustton der Überzeugung, daß er aus Unbedarftheit und nicht etwa aus Mangel an Liebe handle, gerügt hatte, er gehe zu schnell (so oder so hatte ihr Wink ihn damals verletzt). Das sehe ja aus, als wollte er dem Kind davonlaufen, und um es ihm zu veranschaulichen, hatte Jonathans Schwägerin mehrmals im Laufschritt das Wohnzimmer durchquert und erklärt, das sei das letzte, was die Kleine jetzt brauche: Angst zu haben, daß ihr auch der Vater abhanden käme.
Wenn Jonathan seine inzwischen zehnjährige Tochter mit Schüttelfrost, Schnupfen und geschwollenem Hals von der Schule abholte, ebnete Dana ihm nicht mehr den Weg, indem sie ein Gespräch anknüpfte oder versuchte, den Vater zu besänftigen, weil sie ihn wieder einmal behelligt hatte und er deshalb [10] nicht zum Arbeiten kam. Sie wußte: Auch seine Schriftstellerei litt an einer Krankheit, die bereits vor dem Tod ihrer Mutter ausgebrochen war und sich danach verschlimmert hatte. Was ihr Vater empfand, wenn er in dem kleinen Arbeitszimmer zwischen seinem Schlaf- und ihrem Kinderzimmer am Computer saß und keinen Satz zustande brachte, ähnelte in Danas Phantasie dem Muskelkater, den sie vom Turnunterricht in den Beinen bekam; sie fand Turnen öde, aber zu anstrengend, als daß sie dabei über irgendwelche Dinge hätte nachdenken können, und so war ihr dieses Fach besonders zuwider.
Schmerz von dieser Sorte war Dana bestens vertraut. Er hatte für sie nichts Beängstigendes, denn er kam schleichend und war nach einiger Zeit schlagartig wieder weg, und sie fragte sich, ob das, was ihr Vater verspürte, ähnlich geartet war, und wenn ja, wo es saß. In der Brust vielleicht, wo die Fausthiebe des Schmerzes bei ihr einschlugen, wenn sie weinte oder ihre Tränen unterdrückte. Sie grübelte darüber nach, was geschähe, wenn das, woran Jonathan litt, nicht verschwände, weder schleichend noch schlagartig; sie sah ihn schon geraume Zeit verkrampft am Computer sitzen, und der Gedanke, daß er auf Dauer gelähmt sein könnte wie der Vater einer Klassenkameradin, der bei einer militärischen Übung verunglückt war, jagte ihr Angst ein. Zumal es sich im Fall ihres Vaters nicht um dieselbe Art von Lähmung handeln würde; sie wäre seelischer Natur und somit schlimmer als die des anderen Vaters, der ein fröhlicher, humorvoller Mensch war und vor seinem Unfall mit allen möglichen Zaubertricks ehrenamtlich an Schulveranstaltungen mitgewirkt hatte.
Dana belästigte ihren Vater nicht mit Fragen; er sollte sich keine Sorgen machen und ja nicht merken, daß sie Bescheid wußte, das hätte ihn nur noch trauriger gestimmt. Sie ging davon aus, daß er sich seines Zustands bewußt war, und machte sich gelegentlich Mut, indem sie sich sagte, die Starre erwecke nur den Anschein einer Lähmung. Dahinter gebe es eine verborgene [11] Bewegung, die sie nur deshalb nicht wahrnehmen könne, weil sie zu jung sei und als seine Tochter vielleicht zuwenig außenstehend; er wußte schließlich auch nicht, was in ihr vorging. Wahrscheinlich sprudelten in seinem Kopf ausgerechnet dann die Wörter hervor, wenn er stundenlang reglos dasaß, und er hatte Angst, daß eine falsche Bewegung sie in die Flucht jagte, und wartete folglich auf den geeigneten Moment, um sie einzufangen und loszulegen.
Gleichzeitig wußte Dana noch gut, daß sie früher, als sie drei oder vier war, stets das flinke Tippen auf der Tastatur und gelegentlich auch das sanfte Rollen von Jonathans Bürostuhl vernommen hatte, wenn sie an der verschlossenen Tür seines Arbeitszimmers lauschte und ihre Mutter sie wiederholt ermahnte, woanders zu spielen, damit sie ihren Papa nicht beim Arbeiten störte. Daraus hatte Dana gelernt, daß Tipp- und Rollgeräusche Schreiben bedeuteten, und ihre Mutter hatte im Laufe der Zeit gelernt, daß der Reiz des Spiels für Dana darin bestand, dem Vater bei der Arbeit zuzuhören. Von da an hatte sie an der Tür stehen dürfen, Hauptsache, sie war leise.
Jede Form von Lärm, der über seine Schreibgeräusche hinausging, brachte Jonathan auf die Palme, außer er verursachte ihn selbst. Wenn er zum Beispiel zwischen zwei Absätzen ruhelos durch die Wohnung lief – raus aus dem Arbeitszimmer, rein ins Arbeitszimmer –, klassische Musik hörte und die Lautstärke, je nachdem, wie er mit seinem Buch gerade vorankam, herauf- oder herunterdrehte, ließen hohe Dezibel darauf schließen, daß er sich beflügelt fühlte. Schlechte Tage waren eher leise, doch je mehr Krach Jonathan um sich herum erzeugte, desto besser war er gelaunt. Sowohl seine Frau als auch seine Tochter wußten das und freuten sich für ihn.
Aber Ilana hatte oft gesagt: »Menschen verändern sich«, und genau das ließ Dana jetzt hoffen, daß irgend etwas in ihrem Vater sich allmählich wandelte. Immerhin redete er in den letzten [12] Jahren leiser, wie sie auch, er kochte und aß schweigend, wie sie auch, und tat überhaupt alles, was er tat, leise; selbst beim Autofahren war er stiller geworden, regte sich nicht mehr auf und überschüttete niemanden mit Flüchen. So fand Dana es durchaus einleuchtend, daß Jonathan jetzt in absoluter Grabesstille an dem Buch arbeitete, das zu schreiben er vor fünf Jahren begonnen hatte.
Wenn die Eltern anderer Kinder oder Lehrerinnen in der Schule sich bei Dana erkundigten, ob ihr Vater an einem neuen Buch arbeite, sagte sie ja, obwohl sie ihnen schon am Tonfall anhörte, daß das Buch sie weit weniger brennend interessierte als die Frage, wie ihr Vater ohne Frau zurechtkam.
Auch die Krankenschwester hatte Dana ein paarmal auf den Zahn gefühlt. Ob sie eigentlich wisse, worum es in dem Buch gehe, ob es auch diesmal ein Roman werde wie die beiden anderen? Dana antwortete, sie glaube schon, woraufhin die Krankenschwester sagte: »Ganz die Tochter eines Schriftstellers, kann schon einen Roman von einem Nicht-Roman unterscheiden.«
Dana nickte.
»Bestimmt erzählt er niemandem, worüber er schreibt, auch dir nicht«, fuhr die Krankenschwester fort.
»Doch, mir schon«, gab Dana zurück, und da sagte die Krankenschwester: »Dein Vater ist einer, der nicht gern viele Worte macht, stimmt’s?«
Als Dana schwieg, lächelte die Krankenschwester und fügte, wie für sich selbst, hinzu: »Dein Vater ist ein fanatischer Hüter seiner Privatsphäre.«
Das Wort ›Privatsphäre‹ war Dana durch den Kopf gegangen, bis er sich ganz benebelt anfühlte. Und mitten in diesem Nebel, den sie plötzlich bewußt wahrgenommen hatte, war ihr der Gedanke gekommen, daß dieses Benebeltsein der gegenwärtigen Verfassung ihres Vaters vermutlich sehr nahekam.
Jonathan erzählte Dana nicht, woran er arbeitete, und sie vermied es, ihn darauf anzusprechen, aus Angst, das [13] stillschweigende Einvernehmen anzukratzen, das aufzubauen sie vier Jahre gebraucht hatten. Im Kummerkasten einer Zeitung hatte sie gelesen, wenn man jemanden liebe, solle man es tunlichst vermeiden, ihn mit Fragen zu löchern, und ihr Vater fragte sie ja auch nur das Allernötigste. Das stillschweigende Einvernehmen zwischen Dana und ihrem Vater funktionierte in beide Richtungen und führte sie unweigerlich in eine Sackgasse – den jungen Witwer, dem durchaus bewußt war, daß er von seiner zehnjährigen Tochter nicht abwenden konnte, was ihr bereits widerfahren war, ebenso wie die besorgte Kleine, die den schweigsamen Vater – er hatte im Herbst seinen fünfundvierzigsten Geburtstag gefeiert, und sie hatte ihn mit ihrem hart ersparten Taschengeld ins Kino und auf eine Pizza im Einkaufscenter ausführen dürfen – gern besser verstanden hätte.
2
Dana stieg in den Wagen und legte den Sicherheitsgurt an. Noch im Krankenzimmer der Schule hatte sie sich eine Reihe von Fragen zurechtgelegt, über die sie während der Fahrt nachdenken wollte; in den letzten vier Jahren hatte sie gelernt, das Schweigen zu nutzen, statt es zu fürchten. Aufgrund der Staus und weil ihr Vater, wenn er sie mitnahm, immer langsam fuhr, demonstrativ langsam, dauerte der Heimweg mindestens zwanzig Minuten. Der erste Teil der Fahrt verlief stets schweigsamer als der letzte, wenn sie anfing zu fragen, was es zu essen gab und was im Fernsehen kam, und ihren Vater daran erinnerte, noch Saft zu besorgen oder zur Apotheke zu gehen, und während Jonathan, den Fuß auf dem Gaspedal, den Motor anließ und mit dem Saum des Sweatshirts seine Sonnenbrille putzte, überlegte Dana, welches Thema sie zuerst in Angriff nehmen sollte: ihren Wunsch, sowohl den Klavierunterricht als auch die Pfadfinder aufzugeben, [14] oder die Pyjamaparty am Wochenende, auf der ihre Grippe sich im Grunde schon angekündigt hatte.
Dana mochte Lilach Kahana nicht sonderlich, aber als sie von ihr eingeladen worden war, hatte sie sich gefreut, daß das Auswahlteam in Erwägung zog, sie als Mitglied aufzunehmen.
Jeder Kandidatin, die eine solche Einladung annahm – und sie nahmen alle an, ausnahmslos, selbst die, die nur aus Mitleid eingeladen wurden und das auch ganz genau wußten (die Anführerin des Auswahlteams hatte den Beschluß gefaßt, hin und wieder eine Klassenkameradin aus Mitleid einzuladen und sie dann wegen Unverträglichkeit nicht aufzunehmen) –, wurde in der Pause unbemerkt eine Liste zugesteckt, die Orit Segall von Hand geschrieben hatte. Orit war Lilachs Stellvertreterin; sie saß eine Bankreihe hinter ihrer Anführerin, spielte unentwegt mit deren Haaren und malte ihr mit dem Finger auf dem Rükken herum, während Lilach aufrecht dahockte und sich wand vor Genuß.
Die Liste beinhaltete alles, was die Kandidatin mitzubringen hatte, um ihre Verträglichkeit zu testen, wobei die Vorgaben absichtlich so ausgelegt waren, daß man sie unmöglich erfüllen konnte. Gefordert wurde ein Kuchen, selbst gebacken oder aus einer guten Konditorei, ein Gegenstand von sentimentalem Wert aus irgendeiner Sammlung, den zu opfern die Kandidatin bereit war – alle hatten Sammlungen, und alle waren willens, ein Stück daraus zu opfern –, ein Babyfoto der Anwärterin, ohne Eltern oder Geschwister – für das Album des Auswahlteams, falls die Betreffende tatsächlich auserwählt wurde –, sowie ein persönliches Geschenk – klein, aber nicht symbolisch, wie Orit mit einem Leuchtstift hervorgehoben hatte – für jedes Mitglied des Auswahlteams, das aus fünf Mädchen bestand, und Dana hatte sich gefragt, ob sie aus Mitleid eingeladen worden war.
[15] Jonathan waren Gruppen ein Greuel. Nach Ilanas Tod hatte er hart an sich arbeiten müssen, um weniger kritisch und etwas nachsichtiger mit den kindlichen Ritualen umzugehen, deren Bedeutung er längst vergessen oder, wenn er es recht bedachte, gar nie gekannt hatte – was ihm natürlich erst bewußt wurde, als er mit seiner Tochter allein dastand. Er selbst war, wie seine Mutter stets kokettierend und jetzt auch ihrer Enkelin glucksend erzählte, ›nie so richtig Kind‹ gewesen. Als Dana wissen wollte, was das heißen solle, und nicht lockerließ – Jonathan wußte es genau, und früher hatte ihm die Antwort geschmeichelt –, erklärte die Großmutter: »Kein richtiges Kind eben«, doch als hätte diese Diagnose mehr mit ihrer Zukunft als mit der Vergangenheit ihres Vaters zu tun, ließ Dana sich mit dieser Antwort nicht abspeisen.
»Ja, aber was bedeutet das genau?« bohrte sie weiter, und die Großmutter streckte sogleich widerstandslos die Waffen.
»Wenn du’s unbedingt wissen mußt – es ist nicht schön, so was zu sagen, aber: Dein Vater war als Kind unerträglich.«
Damit nahm das Kreuzverhör, dessen Dana nie müde wurde, seinen Anfang, und je älter Jonathans Mutter wurde, desto größer war das Vergnügen, das sie an den Fragen ihrer Enkelin fand.
»War er ein Lausbub?«
»Nein. Im Gegenteil.«
Doch als Dana wissen wollte, was das Gegenteil von einem Lausbuben sei, sagte die Großmutter, dafür gebe es keine Bezeichnung.
Ob er frech gewesen sei? Gelegentlich, wenn er schlechte Laune gehabt habe, sei er auch frech geworden, vor allem seinem Vater gegenüber, der sehr unter ihm gelitten habe.
Ob er oft schlechte Laune gehabt habe? Er sei schon mit schlechter Laune zur Welt gekommen, gab Jonathans Mutter bereitwillig Auskunft, und Dana, die gern gewußt hätte, mit [16] welcher Laune sie selbst zur Welt gekommen war, fragte als nächstes, ob ihr Vater deshalb unerträglich gewesen sei.
»Nicht nur«, entgegnete die Großmutter. »Aber ich hab mich inzwischen an seine Grimassen gewöhnt.«
»War er ein trauriges Kind?«
Die Großmutter zwinkerte Jonathan zu, was ihn in den letzten Jahren zunehmend als Tick anmutete; er saß da und rauchte schweigend, aber es war ihm anzusehen, daß er das Spielchen genoß.
»Ja«, nickte die Großmutter, »dein Papa war eindeutig ein trauriges Kind.«
Warum denn niemand versucht habe, ihn aufzuheitern, wollte Dana wissen.
»Aber das haben wir doch«, entgegnete Jonathans Mutter. »Auf Schritt und Tritt. Bloß – er war eben von Anfang an ein hoffnungsloser Fall.« Dana sah aus dem Augenwinkel, daß ihr Vater Rauchringe in die Luft blies und in sich hineinlächelte.
Als Ilana noch am Leben war, hatte Dana das Frage-und-Antwort-Spiel zu Hause fortgesetzt, immer mehr Antworten hatte sie gefordert, und Ilana, die mit ihren Tätigkeiten fortfuhr, als handle es sich hier nicht um eine ernsthafte Angelegenheit, erklärte ihr, sie habe Danas Papa zwar als Kind nicht gekannt, aber Großmama wolle mit all ihren Antworten nur sagen, daß Jonathan eben ein besonderes Kind gewesen sei.
»So wie ich?« fragte Dana, und Ilana, die wußte, wie sehr Dana ihren Papa bewunderte, erwiderte: »Ja, genauso besonders wie du.«
Diese Äußerung, die Dana damals so gerne gehört hatte und die jetzt, wo niemand mehr da war, der sie hätte zurücknehmen können, so quälend an ihr nagte, ließ in Dana mit der Zeit die Erkenntnis reifen, sie sei genau wie ihr Vater ein unerträgliches und trauriges Kind, ein besonderes, aber kein richtiges Kind, und möglicherweise ein ebenso hoffnungsloser Fall.
[17] Dana und Jonathan saßen in der Küche und gingen zusammen die Liste durch; das leuchtende Pink der Handschrift mutete Jonathan brutal an, aber er sagte nichts und hakte mit seiner Tochter jede Forderung mit einem großen V ab. Er fragte, an welches Foto sie gedacht habe. Dana sagte, sie habe eines herausgesucht, das sie im Swimmingpool zeige, im Alter von drei Jahren, mit Schwimmflügeln an den Armen, die Haare zu zwei nassen Rattenschwänzen gebunden, im Wasser treibend und über die Schulter nach hinten in die Kamera lächelnd. Jonathan hatte das Foto während eines Besuchs bei seinen Schwiegereltern in New Jersey geknipst, wo Ilana und ihre Schwester Nira geboren waren und wo Maxine und Jerry Fisher nach einem achtzehn Jahre andauernden, gescheiterten Versuch, in Israel Fuß zu fassen, nun wieder wohnten. Sie hatten eine starke Abneigung gegen das Land mitgenommen, ihre beiden Töchter, die damals in ihren Zwanzigern waren, aber dagelassen: die eine verheiratet, die andere ledig und Studentin für Fernöstliche Studien.
Jonathan sagte, das sei ein richtig gutes Foto. Er fragte, ob Dana es nach der Pyjamaparty oder der Aufnahmeprüfung, oder wie sich das nenne, zurückbekomme, und bereute sofort seinen zynischen Ton. Das wisse sie nicht, erwiderte Dana, sie habe nicht nachgefragt. Jonathan sah, daß diese Frage ihr zu schaffen machte, und um das Thema zu wechseln, erkundigte er sich, was sie an Geschenken besorgt habe. Er hatte Dana am Morgen fünfzig Schekel mitgegeben, damit sie nach der Schule im Spielzeugladen in der King-George-Straße für jedes der fünf Mädchen, die er inzwischen allesamt haßte, ein ›kleines, aber nicht symbolisches‹ Geschenk kaufen konnte.
Dana lief in ihr Zimmer und kam mit einer Tüte zurück, deren Inhalt sie auf den Tisch kippte. Sie ordnete die kleinen Gegenstände in einer Reihe an, deutete auf jeden einzelnen mit dem Finger und erzählte ihrem Vater, was er gekostet habe und für wen er bestimmt sei. Obwohl Jonathan die Geschenke in ihrer [18] billigen Plastikmachart identisch und durchaus symbolisch vorkamen, fragte er bei jedem Gegenstand, wieso er gerade für dieses Mädchen vorgesehen sei; er wußte, daß Dana nichts lieber wollte, als ihm alles haarklein zu erklären. Sie hielt ihm einen kurzen Vortrag über den Charakter eines jeden Mitglieds im Auswahlteam, und während Jonathan amüsiert Danas Erkenntnissen folgte, in denen er ein klein wenig von seinem eigenen Zynismus entdeckte, wuchs seine Sorge. Diese fünf Mädchen – allen voran Lilach und Orit, deren Geschenke größer und teurer waren als die der anderen – stellten sich ihm jetzt als Minenfeld dar, das unbeschadet zu durchqueren seine Tochter keine Chance hatte.
Er konnte nicht nachvollziehen, wozu sie dieses fragwürdige Pauschalangebot von fünf Freundinnen brauchte und wieso sie sich nicht einfach mit einer oder zwei Klassenkameradinnen anfreundete. Zwar behielt er seine Frage für sich, doch als könnte sie die Gedanken ihres Vaters lesen, meinte Dana trocken: »Sie werden mich sowieso nicht aufnehmen.«
»Und wieso?«
»Weil ich nicht dazupasse.«
Jonathan hätte gern gewußt, weshalb Dana dann überhaupt zu der Party gehen wollte, bat seine Tochter jedoch nur, ihm bitte schön zu erklären, inwiefern sie nicht dazupasse.
»Mir ist das piepegal«, gab Dana ihm zur Antwort, und Jonathan verkniff sich die Frage, wieso sie sich dann bemühe, aufgenommen zu werden.
»Aber warum denkst du, daß du nicht dazupaßt?«
Dana erwiderte, diese Mädchen lägen ihr einfach nicht – Tamar ausgenommen.
Jonathan kannte Tamar Peretz. Er fand sie nett, ebenso wie ihre Mutter, Rona, eine Psychologin, die in einer großen, mietergeschützten Altbauwohnung in der nahe gelegenen Hess-Straße wohnte und ihre Tochter allein aufzog. Er überlegte, ob Dana Tamar mochte, weil auch sie nur einen Elternteil hatte.
[19] »Tamar ist die Gescheiteste und Einfühlsamste von allen, außerdem findet sie Partys auch doof«, sagte Dana.
»So wie du?«
»Ja«, erwiderte Dana knapp.
Als Jonathan Dana bat, ihm zu erklären, wieso Tamar dann im Auswahlteam sei – sie machte auf ihn nicht den Eindruck, als hätte sie es nötig, um jemandes Gunst zu werben –, erwiderte Dana, das wisse sie auch nicht, vielleicht werde sie bei denen dafür bemitleidet, daß sie ohne Vater aufwachsen müsse. Die Frage, ob Dana eingeladen worden war, weil sie ohne Mutter aufwachsen mußte, lag Jonathan zwar auf der Zunge, aber er begnügte sich damit, noch einmal zu fragen, weshalb sich Tamar dem Auswahlteam angeschlossen habe; dabei wußte er genau, daß man im Alter von zehn Jahren auf Fragen dieser Art keine Antwort hat und sich daran auch später, wenn man älter ist, nichts ändert.
Und wenngleich es ihn stolz machte, daß Dana Gruppen ebenso verabscheute wie er selbst und sie sich lieber mit anderen Gruppenverweigerern anfreundete, hätte er gern erfahren, was mit den Pfadfindern war, an deren Unternehmungen sie nun schon seit Wochen nicht mehr teilgenommen hatte. Doch Jonathan verkniff sich auch diese Frage; er ahnte, daß seine Tochter sich dort nicht wohl fühlte, und sah schon jetzt lebhaft vor sich, wie es ihr auf der Party ergehen würde – auch dies eine Erfahrung, vor der er sie nicht zu bewahren vermochte. Er konnte ihr nicht einmal versprechen, daß sie den mühsamen Versuchen, sich trotz aller Widrigkeiten einer Gruppe anzuschließen, erst mit zunehmender Reife entwachsen würde, wenn sie eines Tages so weit wäre wie er; ihm war bewußt, daß das gelogen wäre, ebenso wie ihm bewußt war, daß seine Tochter nie werden würde wie er. Denn sosehr sie ihm glich und ihn und seine Verhaltensmuster von Freude und Trauer nachahmte – schon jetzt war zu beobachten, wie geschickt Dana darin war, und er konnte nichts tun, um es zu verhindern –, sie war doch eine eigene Person, und eines Tages wäre sie ihm völlig fremd.
[20] Dana seufzte, sammelte die Bestechungsartikel wieder ein und sagte, jetzt müsse sie die Sachen nur noch verpacken. Sie zeigte ihrem Vater das Geschenkpapier, das sie vom Restgeld erstanden hatte – goldene Bärchen in Pyjamas und Schlafmützen auf einem blauglänzenden Hintergrund –, und Jonathan bot an, ihr zu helfen.
»Spinnst du? Du bist darin so was von schlecht«, rief sie mit gespielter Entrüstung, und Jonathan mußte lachen, obwohl er Danas Reaktion auch ein klein wenig beleidigend fand.
3
Zwei linke Hände und mangelnde Ausdauer sorgten dafür, daß Jonathan mit allen kleineren Tätigkeiten wie Schnürsenkel binden, Ärmel hochkrempeln, Dornen herausziehen oder Geschenke verpacken überfordert war, ja, eher Schaden anrichtete. Ilana war genauso unbeholfen gewesen wie er, hatte sich aber dank ihrer Geduld nur selten aus der Ruhe bringen lassen. Wenn Jonathan verärgert war, hatte er sich manchmal gefragt, ob es sich tatsächlich um innere Gelassenheit handelte oder, wie bei großen, sehr gutmütigen Hunden, um eine Form von Apathie, doch auch wenn er Ilana in seiner Wut Ähnlichkeit mit Tieren zuschrieb, war er sich stets darüber im klaren, daß er sie im Grunde beneidete. Ob wahrhaftige Gelassenheit oder gesegnete Unzivilisiertheit – er jedenfalls besaß die geforderte Qualität nicht, und nach Danas Geburt, vor allem aber nach Ilanas Tod überkam ihn das dringende Bedürfnis, das Leben zu genießen, als gehörte Lebensfreude mit zu den neuen Verantwortungsbereichen, die er nun notgedrungen übernehmen mußte.
Als Single hatte Jonathan von seiner ›Frau fürs Leben‹ ganz bestimmte Vorstellungen gehabt. Er war überzeugt, seine Wahl fiele auf eine weibliche Version seiner selbst, eine eineiige [21] Zwillingsschwester, wenn so etwas denn existierte. Stürmisch, geistig brillant und unvorhersehbar sollte sie sein, denn so sah er sich selbst. Doch zu seiner Überraschung fand Jonathan dermaßen viele Kopien von sich – oder zumindest nicht wenige Frauen, die vorgaben, Kopien von ihm zu sein –, daß er erschrak und den Kontakt abbrach, noch ehe daraus eine richtige Beziehung erwachsen konnte.
Mit dreißig reichte Jonathan bei einem renommierten Verlag die ersten fünfzig Seiten seines Erstlingswerks ein, und der Verlag erklärte sich bereit, den Roman zu veröffentlichen. Vor lauter Triumphgefühl und Stolz schloß sich Jonathan in seiner Mietwohnung ein und schrieb. Er war ein junger Schriftsteller am Anfang seines Weges und benahm sich entsprechend: Anspruchsvoll und zur Launenhaftigkeit neigend, machte er den Frauen, mit denen er ausging, unmißverständlich klar, daß es für ihn im Leben nur eine wahre Verpflichtung gebe, das Schreiben, und daß sich daran auch niemals etwas ändern würde, obwohl ihm schon damals bewußt war, daß diese Phrase eher aus einer Parodie über das Leben junger Schriftsteller stammte und außerdem keine Aussage war, hinter der er tatsächlich stand oder auch nur stehen wollte.
Trunken vom Erfolg seines Erstlingswerks, merkte Jonathan erst nach einigen Jahren, daß er sich von seinen ehemaligen Kommilitonen entfernt hatte. Während sie inzwischen überwiegend verheiratet waren und Kinder in die Welt gesetzt hatten, hatte er sich mit eingefleischten Junggesellen und Geschiedenen in ihren Vierzigern und Fünfzigern angefreundet, darunter zwei Schreiberlinge – einer, dessen Buch ein Flop gewesen war, und einer, der behauptete, von vornherein nur für die Schublade zu schreiben –, ein ehemals mäßig erfolgreicher Theaterschauspieler und ein Historiker, dessen Ansichten zu radikal waren, als daß irgendeine Universität ihn eingestellt hätte. Die vier hielten sich für Bohemiens; daß es gar keine richtige Boheme mehr gab, störte sie nicht weiter.
[22] Jonathan hockte mit ihnen in Cafés und Bars, hörte sich ihr Gegeifer über die Bourgeoisie an – in seinen Augen auch dies ein Begriff, der sich totgelaufen hatte – und fand, daß die Bourgeoisie, die sie mit solcher Verve abqualifizierten, im Grunde die neue Form von Boheme darstelle. Seinen Kumpels dagegen waren verheiratete Künstler, die von beiden Welten, der bürgerlichen Beständigkeit und dem unsteten Künstlerdasein, profitierten, ein Dorn im Auge: Wer Häuslichkeit pflege, Kinder und Schulden habe und dazu warme Mahlzeiten und regelmäßigen Sex, höhnten sie, sei als Künstler nicht ernst zu nehmen. Jonathan trank mit den vieren Bier und rauchte Marihuana, widersprach ihnen nicht offen und tat, als verfolgte er dieselben Ziele im Leben wie sie. Und er gab vor, seinen Erfolg geringzuschätzen, doch in Wirklichkeit waren es seine Kumpels, die er geringschätzte: Er bemitleidete sie. Sie langweilten ihn.
Ungefähr zeitgleich mit dem Beschluß, dem Unglücklichsein als Lebensweg abzuschwören, trat auf leisen Sohlen Ilana in Jonathans Leben – als hätte sie die ganze Zeit über in seinen Stammlokalen hinter den Kulissen gestanden, gelangweilt die Gespräche belauscht, die sich immerzu im Kreis drehten und von denen ihm inzwischen nur noch der Schädel brummte, und den geeigneten Moment abgepaßt, um Jonathan erst sich selbst vorzustellen und anschließend stufenweise, mit der Gerissenheit eines Kaufmanns, ihren Plan von Häuslichkeit, Kindern, Schulden, warmen Mahlzeiten und regelmäßigem Sex aus der Schublade zu ziehen.
Ilana war im sechsten Semester Fernöstlicher Studien und schwärmte von der Farbenpracht Asiens, vor allem von der Küche und den Gewürzen. Jonathan hatte mitten in der Doktorarbeit sein Studium in Hebräischer Literatur an den Nagel gehängt, um sein zweites Buch zu schreiben. Ein Schritt, den Ilana unterstützte, und die erste gewichtige Entscheidung, in die Jonathan sie einbezog.
[23] Obwohl sie erst drei Monate zusammen waren, wußte Ilana genau, was Jonathan hören wollte. Sie wußte, daß er den Unibetrieb satt hatte und sich nichts mehr wünschte, als zu Hause zu sitzen und zu schreiben, doch er wollte die Erlaubnis dazu, und zwar nicht nur vom Verlag, der ihn nach dem Erfolg seines Erstlings sofort für ein weiteres Buch unter Vertrag genommen und ihm einen stattlichen Vorschuß gewährt hatte, sondern auch von ihr, und Ilana hatte Jonathan diesen Wunsch gern erfüllt. Anfangs argwöhnte er, sie wolle es ihm leichtmachen, um ihm zu gefallen; er befürchtete, daß sie keine eigene Meinung habe und für seine Vorstellungen womöglich doch etwas zu simpel gestrickt sei.
Bevor er ihr begegnet war – und selbst noch in der ersten Zeit mit ihr –, hatte er andere Frauen gehabt, deren Wortgewandtheit ihn faszinierte und zugleich anstrengte. Ein gut Teil der Anziehungskraft hatte für ihn in den knallharten Schlagabtauschen bestanden, die sie sich mit ihm lieferten, und es wäre Jonathan nie in den Sinn gekommen, daß er sich von einer Frau angezogen fühlen könnte, die so sehr hinter ihm stand wie Ilana.
Unter anderem aus diesem Grund war er überzeugt, die Beziehung mit ihr sei eine Affäre auf Zeit, ein gemütliches Plätzchen, um sich zurückzulehnen und darauf zu warten, daß die nächste aufregende Beziehung daherkäme. Doch Jonathan merkte schnell, wie sehr er auf Ilanas Rückhalt angewiesen war und daß er sich nach und nach in sie verliebte. Seine Kritik wich einem stillen Staunen über ihre Art zu leben und über ihren Rhythmus; er verglich Ilana mit der linken Hand beim Klavierspielen – in seinen Augen gewissermaßen der musikalische Babysitter der rechten Hand. Er bewunderte Ilanas Kraft, die sich, anders als er das von sich kannte, nicht aus Ehrgeiz oder Angst speiste, sondern aus Optimismus.
Überrascht stellte Jonathan fest, daß er sich mit Ilana wohl fühlte und sie sich von ihm nicht unglücklich machen ließ. Was [24] ihn jedoch geradezu verblüffte, war der Umstand, daß er von der ersten Begegnung an, in der Cafeteria, als Ilana mit ihrem Tablett an seinen Tisch trat, fragte, ob sie sich setzen dürfe, und es einfach tat, ohne seine Antwort abzuwarten, nicht einmal Anstrengungen in dieser Richtung unternahm.
Anfangs hatte er Ilana belauert, jede Bewegung, jedes Wort aus ihrem Mund, überzeugt, sie im nächsten Augenblick aufs Glatteis führen zu können. Sie redeten über das Essen in der Cafeteria. Jonathan bezeichnete es als ungenießbar und ging davon aus, daß Ilana ihm zustimmte, doch sie fand den Mensafraß lecker, besonders die Schnitzel, von denen sie, wie sie sich beklagte, keines mehr abgekriegt habe, so daß sie sich mit Frikadellen habe begnügen müssen. Er habe gerade noch das letzte erwischt, sagte Jonathan, und als er Ilana anbot, sie könne es gern haben, da er nicht mehr hungrig sei, spießte sie es auf ihre Gabel, angelte es zu sich auf den Teller, tränkte es in Ketchup und verschlang es mit einer kindlich-naiven Freude, die Jonathan abschreckte und zugleich neugierig machte. Anschließend vertilgte sie auch die Frikadellen, die sie sich geholt hatte, und als Jonathan lachte und eine anzügliche Bemerkung über ihren Appetit machte, erklärte Ilana, Frikadellen hätten für sie etwas Unwiderstehliches. Jonathan sagte, für ihn auch, aber nur wenn sie richtig zubereitet seien, und da lud Ilana ihn für den folgenden Freitag zu ihrer Schwester ein, die sie als ›Meisterin der Frikadellen‹ bezeichnete. Er nahm die Einladung an; es war das denkwürdigste Angebot, das er von einer Frau, die er nicht kannte, je bekommen hatte.
So lernte Jonathan an einem Freitagabend im Winter Nira, Zwi und den kleinen Ewjatar kennen, der damals noch ein Baby war. Nira war ihm sofort sympathisch, im Gegensatz zu ihrem Mann, Zwi, der Chemiker war und Jonathan an der Wohnungstür mit einem Händedruck und der trockenen Bemerkung: »Wie man hört, bist du Schriftsteller, dann stehst du bestimmt links« begrüßte. Daß er sich jedoch von Ilana, die als Nachspeise einen [25] selbstgebackenen Kuchen mitgebracht hatte, der sich als Reinfall erwies, auf eine sehr leise Art angezogen fühlte, das merkte Jonathan erst später, als er sich genüßlich über die Frikadellen hermachte.
Sie war das absolute Gegenteil von ihm; etwas in seinem Innern erkannte das und begehrte dagegen auf, aber er war hinreichend vernünftig – und auch einsam genug –, um die Beziehung nicht gleich abzuwürgen. Er brauchte Jahre, um zu begreifen, daß er und Ilana nicht zusammen an einem Klavier saßen und er die rechte Hand und sie die linke spielte, sondern jeder für sich ein anderes Instrument, wie zwei Musiker, die am Konservatorium getrennt voneinander in angrenzenden Räumen üben.
Jetzt fehlte sie ihm. Er sehnte sich nach ihrer Stimme mit dem Hauch eines amerikanischen Akzents, nach ihrem Geruch und ihrem Körper, gelegentlich sehnte er sich auch nach ihrem Kleidungsstil, doch mehr als alles andere vermißte er ihre Begabung, das Leben zu erleben, anstatt es zu Tode zu denken. Wie ein Körperteil, der Schmerzen in einen anderen Körperteil ausstrahlt, hatte Ilana zehn Jahre lang täglich eine gleichbleibende Dosis des absoluten Gegenteils von Schmerz, des absoluten Gegenteils seiner eigenen Empfindungen auf ihn abgegeben. Das verloren zu haben war für Jonathan die Quintessenz seines Witwerdaseins.
4
Jonathan dachte zurück an das erste Treffen mit der Selbsthilfegruppe für verwitwete Männer, die er im Sommer nach Ilanas Tod aufgesucht hatte. Den ganzen Nachmittag hatte er hin und her überlegt, was er anziehen sollte, und das hatte ihn stutzig gemacht, weil ihn Fragen dieser Art früher nie umgetrieben hatten. Er hielt sich nicht für gutaussehend, obwohl er sich seiner erotischen Ausstrahlung durchaus bewußt war, was seiner eigenen [26] Auffassung nach allerdings irgendwie an seinem Gesicht liegen mußte. An guten Tagen konnte er sich einreden, daß auch sein Körper eine gewisse Rolle spielen mochte, doch normalerweise beschäftigte sich Jonathan – zunächst seinem Naturell entsprechend, später beinahe zwanghaft – nicht mit seinem Äußeren.
Jedenfalls merkte er an jenem glühendheißen Nachmittag plötzlich, daß er sich den Kopf darüber zerbrach, was seine Kleidung über ihn aussagte – in seinen Augen eine geradezu peinliche Frage, nicht weil er zum ersten Mal im Leben über derlei Belanglosigkeiten nachdachte, sondern weil das Zielpublikum seiner Überlegungen Männer waren, und zwar verwitwete Männer. Von dieser Erkenntnis war es nicht weit zu seiner nächsten Frage: ob er, Jonathan, möglicherweise nicht bei ihnen gut ankommen wollte, sondern bei ihren verstorbenen Ehefrauen. Die Idee, mit Leichen zu flirten, gefiel Jonathan so gut, daß er sie im Arbeitszimmer schnell auf einen Zettel schrieb – er wollte sie unbedingt in dem neuen Roman verwerten, den er vor einem Jahr angefangen hatte zu schreiben. Dann stellte er sich im Schlafzimmer abermals der Qual der Wahl vor dem Kleiderschrank.
Dana, zu jener Zeit sechs Jahre alt, saß bei ihm auf dem Bett und summte Lieder aus dem Dschungelbuch vor sich hin, ihrem damaligen Lieblingsvideo. Sie schnappte sich die T-Shirts, die Jonathan aus dem Schrank zog und aufs Bett warf, und machte sich ein Spiel daraus, sie wieder ordentlich zu falten. Indem sie die Handgriffe ihrer Mutter nachzuahmen suchte, die die Ärmel zur Rückseite hin eingeschlagen und das Shirt in zwei weiteren Schritten so zusammengelegt hatte, daß es aussah wie frisch vom Ladenregal, gelang es Dana nach einigen Anläufen, einen Ärmel auf das richtige Maß einzuschlagen. Dann krabbelte sie auf allen vieren um das T-Shirt herum, um mit dem anderen Ärmel gegengleich zu verfahren. Beim Versuch, das T-Shirt anschließend zum Rechteck zu falten, klappten die Ärmel jedoch wieder auseinander, und Dana mußte mehrere Male von vorne beginnen. Ihr an- [27] und abschwellendes Gesumme zeugte abwechselnd von Frust und unverwüstlichem Optimismus. Am Ende verwarf Dana die Methode ihrer Mutter und erfand ihre eigene: Damit die Ärmel keine Chance hätten, sich zu sträuben, faltete sie das Shirt erst quer und dann längs je zur Hälfte und rollte es schnell auf. Nun hatte es sich zwar gefügt, sah aber nicht aus wie neu gekauft, sondern eher wie nach einem Kampf. Jonathan fand die Methode seiner Tochter rührend; sie war seiner eigenen nicht unähnlich.
Dana hatte inzwischen die T-Shirts zu einem Berg gestapelt, den sie mit den Armen umschlang, als wollte sie abschätzen, wie lange es dauern würde, bis alle wieder gefaltet wären. Jonathan setzte sich ans Bettende, zog sein T-Shirt aus, hielt es sich an die Nase, schnupperte kurz daran und warf es Dana an den Kopf. Sie kugelte sich vor Lachen, und Jonathan schloß sie in die Arme und knabberte durch den Stoff an ihrer Nase.
»Stinkt es?« fragte er, und als sie nickte, zog er das T-Shirt wieder an und brummelte vor sich hin, was der ganze Zirkus überhaupt solle, die Witwer hätten ihn gefälligst zu nehmen, wie er war, leicht muffelnd eben. Dann ging er ins Wohnzimmer, steckte sich eine Zigarette an und wartete auf Nira.
Früher hatten sie Siw, den pubertierenden Sohn von Nachbarn, zum Babysitter gehabt; er war stets barfuß und mit zwei, drei Zigaretten im Hosenbund, die er während seiner Schicht heimlich zu rauchen gedachte, zu ihnen heruntergekommen, bis er kurze Zeit vor Ilanas Unfall seinen Militärdienst antreten mußte. Als Zeichen seines guten Willens oder weil er die Verlegenheit überspielen wollte, die ihn befiel, wenn er dem frischgebackenen Witwer im Treppenhaus begegnete, bot Siw Jonathan an, von Zeit zu Zeit, wenn er auf Urlaub nach Hause komme, Dana zu hüten – ohne Bezahlung, wie er großzügig betonte. Doch das war in der Rekrutenzeit gewesen, als Siw noch nichts davon ahnte, daß man ihn aufgrund eines unerwarteten Herzfehlers im Hauptquartier in Tel Aviv stationieren würde und er [28] sowieso all seine Abende völlig ohne Beschäftigung zu Hause verbringen würde. Dennoch kam Jonathan nie auf das Angebot zurück, und Siw sprach ihn von sich aus nicht wieder darauf an; beide wußten, daß der Babysittervertrag mit Ilanas Tod ausgelaufen war. Wenn sie einander im Treppenhaus begegneten, lächelten sie höflich, Siw erkundigte sich nach Dana, und Jonathan fragte, wie es Siw gehe. Könnte schlimmer sein, kam, stets von einem Seufzen begleitet, die Antwort eines alten Mannes, und dann lief Siw eilig von dannen, auf zu neuen Taten, die zweifellos die eines jungen Mannes waren. Jedenfalls hörte Jonathan im ersten Sommer ohne Ilana, als Siws Eltern auf Safari in Kenia weilten, wenn er Dana ins Bett gebracht hatte – aufgrund der Serie von Fragen, die sie zur damaligen Zeit zum Thema Tod und auch über den neuen Aufenthaltsort ihrer Mutter in der Welt stellte, eine langwierige Zeremonie – und nachts noch rauchend auf dem Balkon saß, wie Siw im Bett seiner Eltern, deren Schlafzimmer hofwärts lag, vögelte: kurze, sehr geräuschvolle Ficks, hier und da schallendes Mädchengelächter und zum krönenden Abschluß ein röhrender Stöhner. Etwas später folgte das Tapsen nackter Füße, das Jonathan noch aus Siws Babysitterzeit kannte und das damals entschieden nach siebzig und ein paar Kilo Geilheit geklungen hatte, die Siws Beine in die Küche oder ins Bad trugen.
Nun sprang Nira ein, wenn Dana gehütet werden mußte. Ewjatar und Michal waren inzwischen alt genug, um ohne sie zu Hause zu bleiben, zumal Zwi, der schweigsame Chemiker, ohnehin ständig da war; er hockte, in seine Forschungen vertieft, in seinem Arbeitszimmer, einem verglasten Balkon in Fortsetzung des Wohnzimmers. Manchmal hatte Jonathan den Eindruck, daß Nira sich nicht nur aus Pflichtbewußtsein so großzügig als Babysitter bei ihm andiente; sie schien es zu genießen, daß sie die Stille in ihrer eigenen Wohnung von Zeit zu Zeit gegen die Stille einer anderen Wohnung eintauschen konnte.
[29] Jonathan hätte zu gern gewußt, ob sie in ihrer Ehe glücklich war, denn es überstieg seine Vorstellungskraft, wie jemand mit Zwi glücklich sein konnte, zumal sein Schwager nicht nur ein großer Schweiger, sondern in der gesamten Familie der einzige Verfechter einer rechtsgerichteten Politik war. Ilana hatte über das Eheleben ihrer Schwester nichts durchblicken lassen, und Jonathan hatte sie nie darüber befragt. Wenn er jetzt Dana bei seiner Schwägerin ablieferte oder sie von dort abholte, wechselte er mit Zwi lediglich ein paar höfliche Worte zur Begrüßung und zum Abschied. Zwi dagegen hatte sich zumindest im ersten Jahr von Jonathans Witwerdasein umständlich von seinem Schreibtisch erhoben und war auf Jonathan zugekommen, um ihm die Hand zu drücken oder ihm auf die Schulter zu klopfen, und hatte sich überdies eine ziemlich nervige Beileidsgeste angeeignet: Er offerierte Jonathan selbst am Morgen oder Mittag ein Gläschen einheimischen Kognaks aus einer verstaubten Flasche, die er neben seinen Chemiebüchern im Regal verwahrte.
Jonathan lehnte den Drink stets ab, ließ sich aber zu seiner eigenen Überraschung aus Höflichkeit hin und wieder auf ein einsilbiges Gespräch mit seinem Schwager ein, doch sie klangen dann eher wie zwei Tiere, die sich aus Angst voreinander anknurren. Beide waren peinlich darauf bedacht, weder von dem Unfall noch über Politik zu reden, was Zwi außerordentlich schwerfiel, denn zu diesen beiden Themen hatte er immer etwas zu sagen, und wenn man die Sache recht betrachtete, war nicht auszumachen, wen er mehr haßte: den typischen israelischen Autofahrer oder die politische Linke. Obwohl Jonathan sich keineswegs scheute, über Ilana zu reden, und auch in politischen Diskussionen keinerlei Entwürdigung seiner Trauer sah, genoß er die diplomatischen Verrenkungen seines Schwagers und die Zurückhaltung, die dieser sich auferlegt hatte, in vollen Zügen und hütete sich auch ein oder zwei Jahre später noch, Zwi ein Zeichen zu geben, daß er seine Lieblingsthemen gern wieder beackern [30] dürfe; Jonathan hatten die Diskussionen mit seinem Schwager immer zu Tode gelangweilt, und er sah keinerlei Anlaß, sich auf eigene Initiative hin um die Freistellung zu bringen, die sein Schwager ihm unversehens gewährt hatte.
Einmal allerdings hatte Zwi sich nicht beherrschen können und sein selbstauferlegtes Redeverbot gebrochen. Wenige Monate nach dem Unfall, als Jonathan mit Dana zum Freitagabendessen kam, bat sein Schwager ihn auf den verglasten Balkon. Dort rollte er einen Bristolbogen auf und zeigte Jonathan schüchtern, aber mit unverhohlenem Stolz eine plakatgroße Skizze von der Straße, auf der Ilana zu Tode gequetscht worden war – einschließlich Maßangaben und Pfeilen –, und dazu, kleinkindgerecht stilisiert, die beiden beteiligten Fahrzeuge: hier der Lastwagen, dort ihr Subaru, einer auf der bergabwärts, der andere auf der bergaufwärts führenden Straßenseite, einer rot, der andere grün.
»Eine Kleinigkeit, die ich für dich gemacht habe«, verkündete Zwi und musterte abwechselnd seine Skizze und Jonathans Gesicht. Als er keinerlei Anzeichen von Neugier oder Lob entdecken konnte, sah er sich frei, fortzufahren. Er breitete den Bristolbogen auf dem Tisch aus und beschwerte die Ecken mit irgendwelchen Gegenständen, die ihm gerade unterkamen.
»Wenn du gestattest, würde ich dir das gern mal erklären, ganz unkompliziert.« Zwi hieß ihn mit ausladender Geste Platz nehmen, doch Jonathan zog es vor zu stehen.
In der ihm eigenen Gründlichkeit hatte sein Schwager von der Polizei und vom Verkehrsministerium Daten über sämtliche Unfälle eingeholt, die sich in den vergangenen fünf Jahren auf dieser Straße ereignet hatten: siebenunddreißig an der Zahl, davon neun mit Toten. Und eines schönen Vormittags, so gestand er nun, sei er selbst hinaufgefahren und habe Vermessungen vorgenommen. Jonathan hörte zu, wie sein Schwager von physikalischen Kräften, von Geschwindigkeiten, Bremswegen und statistischen Wahrscheinlichkeiten faselte, bis er merkte, daß ihm Zwis Stimme, die, [31] wie immer, begeistert und monoton zugleich klang, unversehens abhanden kam und er nur noch wie hypnotisiert den belehrenden Zeigefinger verfolgte, dem der abgeknabberte Fingernagel und die entzündete Nagelhaut zwischenzeitlich die Schau stahlen. In Kreisen und Zickzacklinien skizzierte der Finger gelassen den Hergang des Unfalls auf dem Bristolbogen, und in das Gefühl von Schläfrigkeit, das Jonathan überkam, mischte sich nach und nach Wut. Er konnte nicht nachvollziehen, weshalb sein Schwager es sich in den Kopf gesetzt hatte, den Unfall nachzukonstruieren, und daß er den gräßlichen Gegenstand seiner Betrachtungen zu allem Überfluß mit einer wissenschaftlichen Erklärung versah, kam Jonathan vor wie eine doppelte Mißhandlung. Als er jedoch den verstümmelten Finger, begleitet von Zwis Stimme: »Das hätte niemand überlebt, Jonathan, glaub mir, niemand!«, entschlossen auf das Dach des grünen Fahrzeugs – Ilanas und seinen Subaru – klopfen sah, begriff Jonathan plötzlich, daß das ›Attentat‹ seines Schwagers darauf abzielte, seinen, Jonathans, Schmerz zu lindern. Dieses Projekt mitsamt dem enormen damit verbundenen Aufwand – Bristolbogen, Lineale, Farbstifte, die geheime Fahrt in den Norden – war nicht nur Selbstzweck; über seinen Hang zur Methodik und seine zwanghafte Rechthaberei hinaus verfolgte Zwi damit eine weitere Absicht: Jonathan einen wahren, einen wissenschaftlich belegten Trost zu bieten, etwas, was dieser nicht ablehnen konnte und was überdies weit wirkungsvoller war als das Gläschen Kognak mitten am Tag – doch, wie Jonathan fand, während ihm Tränen in die Augen stiegen, genauso billig.
Von da an eignete sich Jonathan einen nachsichtigeren Umgang mit seinem Schwager an, dessen Bemühungen, ihn aufzubauen, er ungefähr im selben Maße würdigte wie Eltern die nutzlosen Bastelgeschenke ihrer Kinder. Um Zwi nicht zu beleidigen, nahm Jonathan die Skizze von ihm entgegen – für den Fall, daß er sie noch mal studieren wolle, wie Zwi sagte, obwohl Jonathan [32] nicht vorhatte, je wieder einen Blick darauf zu werfen –, und dann lag der Bristolbogen, von Zwi säuberlich aufgerollt und mit einem Gummiband versehen, fast ein Jahr im Kofferraum des neuen Subaru, bis Jonathan eines Tages das Reserverad herausholen mußte und ihm eine zerdellte, völlig eingestaubte Papierrolle in die Hände fiel, die er umgehend in die Mülltonne warf.
Mit Nira dagegen gab es keine Irritationen, und Jonathan hatte sie richtig gern. Im ersten Jahr ohne Ilana hatte sie ihm geholfen, mit den Belastungen des Alltags fertigzuwerden; worin diese genau bestanden, erfaßte er erst später, nachdem sie festgestellt hatte, daß er allein zurechtkam, und sich aus seinem Alltag wieder zurückzog. Er war zutiefst dankbar, daß sie sein Leben vorübergehend in die Hand genommen hatte, und verspürte gelegentlich eine gewisse Sehnsucht nach jener ersten Zeit, als Nira ihn behandelt hatte wie einen hilfsbedürftigen, seelisch angeknacksten Menschen.
Wahrscheinlich mochte er sie auch, weil sie seiner Frau so ähnlich sah. Ilana war fünf Jahre jünger gewesen als Nira, aber sie hatten fast dasselbe Gesicht: dieselben hellbraunen Augen, dieselben dünnen Augenbrauen und nahezu durchsichtigen Wimpern, dasselbe gewellte, blondbraune Haar und dieselbe Frisur. Beide Schwestern besaßen helle, sommersprossige Haut, sehr schmale Lippen und eine kleine, ganz und gar unjüdische Stupsnase, die sie im Spaß gern als ›unsere wasp-Nase‹ bezeichneten.
Das einzige, worin die beiden Schwestern sich grundsätzlich unterschieden, war ihr Verhältnis zu Kleidung. Ilana stand auf farbenfrohe, weit geschnittene Sachen aus Chiffon oder indischen Stoffen mit Mustern, die das Auge verwirrten, und als Batik wieder in Mode kam, kaufte sie sich Röcke und Oberteile mit Mustern, die Jonathan wie Zielscheiben anmuteten. Ganz anders Nira: Sie betrachtete Kleidung als notwendiges Übel und war damit Jonathan nicht unähnlich. Aber beide Schwestern hatten genau dieselbe Figur.
[33] Wenn Nira bei ihm kochte oder putzte, aber vor allem wenn sie Wäsche aufhängte und sich dabei auf die Zehenspitzen stellen und ihren Oberkörper aus dem Schlafzimmerfenster und über die Wäscheleinen lehnen mußte, dann sah Jonathan Ilana vor sich und fühlte sich an etwas erinnert, was er gleich in der ersten Sekunde wahrgenommen, in seiner Verliebtheit jedoch nach und nach verdrängt hatte: daß Ilanas Körper keineswegs seinem Geschmack entsprach.
Als er sie zum ersten Mal sah, stand sie, auf Zehenspitzen und mit einem Tablett in der Hand, in der Cafeteria der Universität, und lehnte sich über die Theke, um nachzusehen, was in den Trögen aus rostfreiem Stahl lag, obwohl sie es, wie Jonathan und alle anderen Studenten, eigentlich wußte. Ilana war eben optimistisch. Sie stand genauso da wie ein paar Jahre später beim Wäscheaufhängen und wie auch Nira dastand, wenn sie in diesem ersten langen Jahr nach Ilanas Tod die Wäsche aufhängte. Damals in der Cafeteria hatte Jonathan Ilana für sich als klein verbucht – zwar nicht in Wirklichkeit zu kurz geraten, denn im Grunde entsprach sie dem Durchschnitt, aber ihre Körpersprache war die einer kleinen Person: bescheiden und doch sehr energisch.
Sie hatte einen merkwürdigen Po, flach und praktisch nicht vorhanden, und wenn sie irgendwo einfach nur dastand, versuchte sie stets, ihn zu betonen, indem sie die Hände in die Hüften stemmte und ein Hohlkreuz machte. Jonathan war noch nicht lange mit Ilana zusammen, da gestand sie ihm, daß sie ihren Hintern doof fand, was ihn allerdings nicht im mindesten beeindruckte, da er noch keine Frau erlebt hatte, die mit ihrem Po zufrieden gewesen wäre.
Während er jetzt darüber nachdachte, bereute Jonathan, daß er Ilana sein Kompliment vorenthalten hatte, das sie gewiß gern gehört hätte und das sie ihm doch nie hatte abringen können: Eins a, dieser Arsch, hatte er jedesmal gedacht, wenn Ilana nackt vor ihm stand, aber er hatte es ihr nie offen gesagt, und nun fragte [34] er sich, wie das sein konnte, wo sie doch immerhin zehn Jahre lang Tisch und Bett miteinander geteilt hatten.
Er mußte an seine erste Einschätzung denken, damals, an dem klebrigen Tisch in der Cafeteria, als er Ilana gegenübersaß und mit der Gabel in einer Pfütze Kartoffelpüree stocherte: ›ausgeschlossen‹. Wenige Minuten davor hatte er sie und die anderen Studentinnen, die mit ihr in der Schlange standen, taxiert und sie im Geiste einzeln nach ihrem Attraktivitätsgrad eingestuft. Seine vier Kategorien lauteten: ›unbedingt‹, ›je nachdem‹, ›eher weniger‹, ›ausgeschlossen‹, und das Urteil für Ilana hatte zwischen Kategorie drei und vier geschwankt. Wenige Wochen später schlief er mit ihr auf dem Rücksitz seines Citroën ds.
Lange bevor sie sich in ihn verguckt habe, behauptete Ilana später, sei sie bereits in seinen Wagen verliebt gewesen; er habe sie irgendwie neugierig gemacht, und der Neugier seien Spekulationen gefolgt: Sie habe unbedingt herausfinden wollen, wem er gehörte, und beschlossen – wieso, könne sie sich selbst nicht erklären –, einem Mann. Wenn sie draußen vor dem Campus an dem Citroën vorbeigekommen sei, habe sie sich jedesmal gefragt, was dessen Halter wohl studierte; bestimmt Geisteswissenschaften, habe sie gedacht, oder das zumindest gehofft und darauf wetten mögen, daß es sich entweder um einen jungen Schnösel oder um jemanden vom Typ brotloser Künstler handelte, der gar nicht kapierte, was für ein geiles Auto er fuhr, und dem das auch piepegal war. Daß dieser Jemand allerdings beides in einem sein könnte, fügte Ilana hinzu, das habe sie für ausgeschlossen gehalten.
Ilana hatte also lange, bevor Jonathan in der Cafeteria auf sie aufmerksam wurde, Erkundigungen eingezogen, und eines Tages hatte jemand auf Jonathan gezeigt: Das sei der lang gesuchte Besitzer des Citroën. Jonathan dagegen war völlig ahnungslos gewesen, als er Ilana beim Essenfassen beobachtete; er wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, daß sie ihn längst im Visier [35] hatte und es mit ihrer Art, sich zu bewegen, bewußt darauf anlegte, ihm aufzufallen.
Nira kam, stellte ihre Tasche auf dem Sofa ab, stöhnte über die Temperatur in der Wohnung, erzählte etwas von Klimaanlagen im Sonderangebot und befand, daß Jonathan, alles in allem, gut aussehe – als führte sie über seine Fortschritte seit dem verhängnisvollen Vormittag im Dezember pedantisch Buch. Dann ging sie in die Küche, um die Plastikdose mit Frikadellen, die sie mitgebracht hatte, ins Tiefkühlfach zu stellen, und erkundigte sich, ob Dana schon gegessen habe.
»Ich brate ihr ein Omelett«, erklärte sie, ohne Jonathans Antwort abzuwarten.
»Ist gut«, sagte er und verharrte unschlüssig in der Nähe des Kühlschranks.
»Du solltest jetzt besser losgehen, sonst kommst du noch zu spät«, warnte Nira, doch ehe sie die Wohnungstür hinter ihm schloß – Dana stand neben ihrer Tante und klammerte sich an eines von Jonathans T-Shirts, das sie aus dem Schlafzimmer angeschleppt hatte –, entschärfte sie ihre Mahnung: Jonathan brauche sich nicht zu überschlagen, er habe alle Zeit der Welt.
Obwohl er wußte, daß sie damit das Treffen der Selbsthilfegruppe gemeint hatte, ging Jonathan Niras letzter Satz auf der ganzen Fahrt nicht aus dem Sinn, und er beschloß, ihn anzubringen, falls man ihn nötigte zu reden. Ich, würde er auf die Frage des Gruppenleiters, wie er mit seiner Situation umgehe, antworten, habe alle Zeit der Welt, ich brauche mich nicht zu überschlagen. Er wußte, das würde Eindruck machen: Es war eine von diesen Phrasen, die in Selbsthilfegruppen gut ankamen.
Aber woher wollte er eigentlich wissen, was in Selbsthilfegruppen gut ankam, und wozu dieser Zynismus? Schließlich ging er nicht für sich da hin, sondern für Dana, und während er sich beim Einparken und Aussteigen kurz fragte, ob die anderen [36] Wagen vor dem Haus irgendwelchen Anwohnern gehörten oder den Witwern aus der Gruppe, sann er darüber nach, ob das auch wirklich stimmte, ob er tatsächlich nur seiner Tochter wegen die Selbsthilfegruppe aufsuchte.
Im Grunde war er sich durchaus darüber im klaren, daß er nicht nur um Danas willen hier war und womöglich sogar überhaupt nicht um ihretwillen, sondern allein und ausschließlich um seiner selbst willen – und in der Gruppe würde man ihn garantiert ›aufklären‹, daß es nicht verboten sei, egoistisch zu denken. Sechs Monate waren es nun her, seit Ilana tödlich verunglückt war, und Jonathan fühlte sich verloren und geradezu kindisch in seiner Wut; ihm war, als lebte er im Untergrund und führte ein Doppelleben, wie Danas früherer Babysitter Siw, nur ohne dessen Hormone und Zukunftsaussichten.
Jonathan trudelte als letzter ein, mit einer Verspätung von zwanzig Minuten. Er hatte das Gefühl, alle hätten nur auf ihn gewartet und seien nun verärgert, schließlich hatten sie ebenfalls kleine Kinder und waren trotzdem pünktlich gekommen. Gleichzeitig wußte er natürlich, daß es arrogant war, sich einzubilden, die traurige Stimmung im Raum rühre allein von seiner Verspätung. Als hätte ihm seine Eigenschaft als Schriftsteller – er ging davon aus, daß die Mitglieder der Gruppe über seinen Beruf informiert waren – einen Sonderstatus verliehen, als wäre er eine Art Oberwitwer, der sich besser mit dem Leben auskennt und über den Tod etwas Bedeutsames zu sagen weiß.
5
Ilana glaubte an Gott. Sie war nicht fromm, aber aus ihrer Kindheit in einem amerikanischen jüdischen Haushalt hatte sie ein paar Angewohnheiten mitgebracht, die Jonathan nervten: Sie zündete am Freitagabend Kerzen an, und an Jom Kippur fastete [37] sie und besuchte einen Reformgottesdienst. Als sie zu ihm in die geräumige Mietwohnung in der Montefiori-Straße gezogen war, hatte er sie für die ›paganen Neigungen‹, wie er ihre Gewohnheiten nannte, geneckt und ihr belustigt zugesehen, wenn sie die Kerzen anzündete, die Hände vors Gesicht legte und den Segen rezitierte. Gelegentlich machte sich Jonathan einen Spaß daraus, Ilana abzulenken, indem er zwischen ihren Fingern hindurch ihren Blick suchte und ihr Grimassen schnitt, oder er störte sie, indem er ihr Rauch ins Gesicht blies oder sie von hinten umarmte und sie kitzelte, um sie anschließend ins Bett zu zerren und mit ihr zu schlafen, als könnte er damit die letzten Krümel ihrer Traditionsverbundenheit aus ihr herausschütteln.
Als sie von Hochzeit sprachen, machte Jonathan unmißverständlich klar, daß ihm eine religiöse Zeremonie nicht in die Tüte komme, doch Ilana und Nira schmiedeten telefonisch eine Koalition mit seinen zukünftigen Schwiegereltern Jerry und Maxine in New Jersey und mit seiner Mutter in Jerusalem – sie plädierte wohl für das Rabbinat, da sie in dieser Angelegenheit ein Mittel gegen die Langeweile witterte – und zwangen Jonathan mit vereinten Kräften schließlich in die Knie.
»Was bist du doch für ein Nazi!« fauchte Nira, die zur damaligen Zeit mit ihrer Tochter Michal schwanger war, als er sich gerade wieder einmal in der geräumigen Wohnküche mit Ilana in dieser leidigen Frage fetzte. Jonathan setzte seinen arroganten Blick auf.
»Ich – ein Nazi? Mich schimpfst du einen Nazi?« bellte er zurück. »Du und deine Schwester, ihr seid in New Jersey und Ramat Hascharon aufgewachsen. Ihr wißt ja gar nicht, was es heißt, unter religiösem Zwang zu leben! Ich bin aus Jerusalem, ich kann ein Lied davon singen. Meint ihr etwa, ich wohne freiwillig in Tel Aviv? Ich hasse Tel Aviv! Ich finde Tel Aviv zum Kotzen, aber ich hatte keine andere Wahl – ich mußte raus, weg aus Jerusalem, wo die Orthodoxen bestimmen, wie man zu leben hat.«
»Und wo ist da der Zusammenhang?« fragte Nira.
[38] »Genau, Jonathan«, sagte Ilana ruhig. »Ich verstehe nicht, was das mit der Frage ›Jüdische Hochzeit – ja oder nein?‹ zu tun hat. Wieso mußt du immer gleich eine dermaßen extreme Position beziehen?«
»Du willst wissen, wieso? Hab ich diese extremen Positionen etwa erfunden? Die Zeiten, wo man einen gemäßigten Standpunkt einnehmen konnte, sind vorbei! Damals konnte man sein Judentum auf einem harmlosen Minimalniveau ausleben und in aller Unschuld genießen, aber auch das: tempi passati. Glaubt mir, ich wäre rasend gern gemäßigt, bloß – es funktioniert nicht. Der Markt gibt keine nichtextremen Positionen mehr her.«
Nira sagte, Jonathans Einstellung habe mit Religion wenig zu tun, bei ihm sei das eine Frage des Charakters. Von Ilana kam sofort ein ›Übertreib nicht, Nira‹, mit ihrem amerikanischen R, das Jonathan bewußt werden ließ, weshalb er sie liebte und was er an ihr nicht ausstehen konnte. Im stillen fand er, Nira habe keineswegs übertrieben: Er war in der Tat als Extremist zur Welt gekommen. Das war sozusagen genetisch bei ihm, von seinem Vater, der ein Leben lang ›strengstens weltlich‹ war, wie er selbst gern von sich behauptet hatte. Nicht einmal eine Bar-Mizwa hatte er für Jonathan abhalten wollen, sich jedoch am Ende dem Wunsch von Jonathans Mutter gebeugt. Der Vater war es auch, der Jonathan, als er im Stabsdienst in Jerusalem seinen Militärdienst ableistete, ans Herz legte: »Bring die Armee hinter dich, und sieh zu, daß du von hier wegkommst, wir sind doch schon jetzt die Verlierer in diesem Krieg!«
Jonathan konnte seinem Vater nie verzeihen, daß er ihm plötzlich drei Monate vor seinem Tod – im Alter von neunundsiebzig Jahren und ausgerechnet von seinem Bett im Altersheim aus, von wo er stets voller Verachtung auf den orthodoxen Pfleger herabblickte, der ihn während der letzten Lebensmonate wusch und ihm das Bettzeug wechselte – befohlen hatte, sich rabbinisch trauen zu lassen.
[39] »Aber wieso um alles in der Welt?« hatte sich Jonathan entrüstet.
»Weil es nie schaden kann.«
Jonathan erkannte, daß die Tage seines Vaters gezählt waren, und fand es in jenem Moment besonders schade, daß er keine Geschwister hatte, die ihn hätten unterstützen oder ihn auf dem gewundenen Pfad des Verrats, den der Vater eingeschlagen hatte, zumindest hätten begleiten können. Als er nachfragte, ob er das alles nur sage, um die Mutter zu besänftigen – und Jonathan wünschte sich nichts sehnlicher als ein Ja zur Antwort –, seufzte der Vater: »Was spielt das jetzt noch für eine Rolle?«
Da schwor sich Jonathan, nie nur ein Einzelkind zu haben.
In den Augen des Vaters lag der Blick des Besiegten, und obwohl Jonathan wußte, daß dieser Blick nun nichts mehr mit dem Krieg der Religiösen gegen die Nichtreligiösen zu tun hatte, betete er, der orthodoxe Pfleger möge das Zimmer betreten, in das von der Küche her der Geruch fettiger Hühnersuppe drang, und der Vater möge sich in seinem Bett aufrichten und in der vertrauten Zeichensprache mit dem Kinn auf den Mann deuten, als wollte er sagen: Sieh sie dir doch an, diese Kerle. Aber der Pfleger kam nicht, und der Vater ließ das spitze, von weißen Bartstoppeln übersäte Kinn, das Jonathan an einen kleinen Kaktus erinnerte, auf die Brust sinken und schlief ein.
Er starb an einem Septembermorgen drei Monate nach der Hochzeit, die er, im Rollstuhl – unentgeltliche Leihgabe einer gemeinnützigen Organisation – vor sich hin dämmernd, unbeteiligt beobachtet hatte, während ständig Gratulanten auf ihn zukamen und behutsam seine Hand unter der Wolldecke des staatlichen Pflegeheims hervorzogen, um sie zu drücken.
Ilana nahm die Benachrichtigung am Telefon entgegen. Sie wartete Jonathans Rückkehr ab, und als er die Tür aufmachte, wies sie ihn an, die Tüten auf dem Boden abzustellen. Dann [40] nahm sie sich aus ihrer Schachtel eine Time, zündete sie an und sagte: »Dein Vater ist gestorben.«
Ehe Jonathan einen Ton über die Lippen bringen konnte, drückte Ilana ihre Zigarette wieder aus, lief zu ihm hin und schlang die Arme um ihn.
»Ich muß mit meiner Mutter telefonieren«, sagte er tonlos. Ilana nickte an seinem Hals.
»Und anschließend mit der Chewre Kadische, damit sie sich um die Beerdigung kümmern«, fuhr Jonathan fort, während Ilana ihn fester an sich drückte. »Aber ich weiß gar nicht, wo man die erreicht.« Ilana streichelte ihm den Rücken. Er spürte, daß sie gespannt auf etwas wartete.
»Komm«, sagte sie, »wir setzen uns ein bißchen ins Wohnzimmer.«
Jonathan folgte ihr zum Sofa. Nachdem er eine Weile lang auf die schwarze Mattscheibe des Fernsehers gestarrt hatte, sah er Ilana ins Gesicht. Sie wirkte immer noch erwartungsvoll gespannt.
»Meinst du, diese Beerdigungsbrüder stehen in den Gelben Seiten?«
Ilana gab keine Antwort, aber als Jonathan brummte, sie hätten sowieso keine Telefonbücher von Jerusalem im Haus, erklärte sie, sie könnten die Nummer auch bei der Auskunft erfragen.