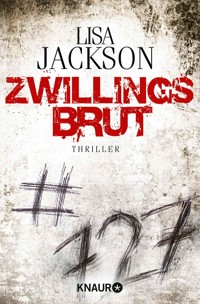
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Alvarez und Pescoli
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Detective Regan Pescoli und Selena Alvarez! Dasselbe hübsche Gesicht, dieselben grünen Augen, dasselbe rotbraune Haar. Ärztin Kacey Lambert ist schockiert: Die Frau, die schwer verletzt in die Klinik eingeliefert wurde, ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Und sie stirbt. Kurz darauf gibt es weitere Tote, die Kacey verblüffend ähneln. Detective Regan Pescoli und Selena Alvarez ermitteln. Doch auch Kacey stellt Nachforschungen zu ihren Doppelgängerinnen an und schwebt schon bald, ohne es zu ahnen, in höchster Gefahr … »Nervenkitzel in geballter Form!« Literaturmarkt.info »Dieses Buch ist wie eine Droge.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lisa Jackson
Zwillingsbrut
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dasselbe hübsche Gesicht, dieselben grünen Augen, dasselbe rotbraune Haar. Ärztin Kacey Lambert ist schockiert: Die Frau, die schwer verletzt in die Klinik eingeliefert wurde, ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten. Und sie stirbt. Kurz darauf gibt es weitere Tote, die Kacey verblüffend ähneln. Detective Regan Pescoli und Selena Alvarez ermitteln. Doch auch Kacey stellt Nachforschungen zu ihren Doppelgängerinnen an und schwebt bald schon, ohne es zu ahnen, in höchster Gefahr …
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Epilog
Dank
Prolog
Mal gewinnt man, mal verliert man.
Heute Abend, so dachte Shelly Bonaventure, war sie die Verliererin gewesen, das lag mehr als klar auf der Hand.
Frustriert schloss sie die Tür zu ihrem Apartment auf, warf ihre Handtasche auf den Tisch in der Diele und verspürte auf einmal einen brennenden Schmerz in der Bauchgegend.
Sie schnappte nach Luft und krümmte sich zusammen; ihre Eingeweide schienen in Flammen zu stehen. Ganz plötzlich, wie aus heiterem Himmel.
»Auuu«, stöhnte sie. Der Schmerz ließ gerade ein wenig nach, so dass sie sich zur Couch schleppen konnte. »Was ist denn?« Mit einem flauen Gefühl im Magen atmete sie ein paarmal tief ein und aus. War das Brennen so stark, dass sie den Notruf wählen sollte, oder sollte sie selbst in die Notaufnahme fahren?
»Jetzt sei nicht albern«, rief sie sich flüsternd zur Ordnung, doch das ungute Gefühl, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte, wollte nicht weichen. »Reiß dich zusammen«, sagte sie zu sich selbst, lauter nun, und streifte ihre High-Heels ab. Entweder hatte sie zu viel getrunken, etwas Falsches gegessen, oder ihre Periode kam ein paar Tage zu früh.
Nein, das konnte nicht sein. Nicht mit solchen Schmerzen!
Für eine Sekunde schloss sie die Augen, Schweißperlen sammelten sich auf ihrer Oberlippe. Sie würde ein Magenmittel nehmen, wenn sie denn eins im Haus hätte, und wenn nicht, würde sie eben bis zum Morgen leiden. Noch während sie sich den Schweiß abwischte, schaute sie sich suchend nach ihrer Katze um. »Lana?«
Keine Antwort.
Merkwürdig. Für gewöhnlich kam die mehrfarbige Glückskatze aus jedwedem Schlupfwinkel hervorgeschossen, sobald sie hörte, dass das Schloss der Wohnungstür aufschnappte.
Hm.
»Lana? Komm her, Kätzchen …« Sie horchte, doch noch immer kein Maunzen, kein Tapsen, nichts. Oh, na schön, Lana trieb mal wieder ihre Spielchen mit ihr. Dennoch …
Mühsam schleppte sich Shelly zum Badezimmer, wobei sie fast über den Teppich gestolpert wäre, den sie vor … war das wirklich schon so lange her? … sieben Jahren gekauft hatte. »Nun zeig dich schon, komm heraus, wo immer du stecken magst!«, rief sie lockend. »Mommy ist zu Hause!«
Knack!
Das Geräusch kam von draußen. Erschrocken fuhr Shelly herum. War da ein Schatten auf der Veranda?
Ihr Herz schlug bis zum Hals, als sie vorsichtig an die Glasschiebetür trat und in die Dunkelheit hinausspähte. Der Schatten, so erkannte sie jetzt, war nur ein Palmwedel, der vor der Verandabeleuchtung im Wind tanzte.
»Alberne Gans! Nun hör schon auf mit deiner Paranoia!«
Aber was hatte dann den Lärm verursacht …?
Die Katze? Wo steckte sie bloß?
Es ist alles in Ordnung, redete Shelly sich ein, doch sie blieb angespannt. Vielleicht hatte sie den Alten im Apartment darunter gehört … Bob oder wie immer er hieß. Der ließ doch ständig etwas fallen.
Eine weitere Welle der Übelkeit durchflutete sie, ihr Unterleib verkrampfte sich. Sie biss die Zähne zusammen und wartete darauf, dass der Schmerz nachließ. Was war denn nur los mit ihr?
An die Rückenlehne der Couch geklammert, atmete sie tief durch, dann schweiften ihre Augen durchs Wohnzimmer. Seit fast zehn Jahren lebte sie nun schon in diesem Zwei-Zimmer-Apartment, sah, wie die Jahre verstrichen, die Falten in ihrem Gesicht tiefer wurden und ihr die unzähligen Rollen bei Film und Fernsehen, die sie so gern an Land gezogen hätte, durch die Finger rannen.
Seit ihrer Scheidung von Donovan …
Nein, mit diesem uralten Stück Geschichte würde sie sich nicht näher befassen. Nicht heute Abend. Eine positive Einstellung – das war es, was sie brauchte. Und vielleicht etwas, um ihren Magen zu beruhigen. Sie hatte einfach ein bisschen zu viel getrunken im Lizards, der Bar, die keine zwei Blocks von ihrer Wohnung entfernt lag und die ihren Namen wohl eher den leicht anrüchigen Gästen zu verdanken hatte als einer Eidechse.
Heute Abend war sie losgezogen in der Hoffnung, ihre Kontakte zu den großen und kleineren Filmstudios aufzufrischen, die es hier in L.A. zuhauf gab. Diese Sache brannte ihr ziemlich auf der Seele, weshalb sie es ganz schön übertrieben hatte.
Doch was konnte sie schon dafür, dass der Typ, den sie in der Bar kennengelernt hatte, von ihrem kurz bevorstehenden fünfunddreißigsten Geburtstag wusste und ihr mehrere Mai Tais spendierte? Er hatte interessiert gewirkt, wirklich interessiert, und er sah gut aus, sexy. Seine Stimme war so sonor, dass sie ihr einen Schauder das Rückgrat hinabjagte. Er war ihr vage bekannt vorgekommen, und als er ihren Handrücken berührte, hatte sie eine prickelnde Vorfreude verspürt. Seine stahlblauen Augen, die zu einem tiefen Mitternachtsblau wechseln konnten, blickten durchdringend; seine Lippen waren dünn wie Rasiermesser, und der leichte Bartschatten auf seinem Kinn unterstrich noch seine Männlichkeit. Wie er das Gesicht zu einem aufreizend schiefen Lächeln verzog, wenn er mit ihr sprach! Ja, der Kerl hatte die Böser-Junge-Masche absolut drauf! Sie hatte ihn auf sein mörderisches Lächeln angesprochen, was ihn amüsierte. Das hätte noch nie jemand zu ihm gesagt, behauptete er und stieß ein leises, kehliges Lachen aus.
Sie hatte sich vorgestellt, wie er ohne Hemd aussehen würde, wie es sich anfühlen mochte, seine Lippen heiß und drängend auf ihren zu spüren, wie sie mit ihm ins Bett taumelte, während er sie in seinen starken Armen hielt.
Ja, aber du hast die Bar ohne ihn verlassen, nicht wahr? Und das nur, um hierher zurückzukehren. Allein.
Natürlich war sie gegangen, schließlich kannte sie ihn gar nicht. Vermutlich war es gut gewesen, rechtzeitig abzuhauen, vor allem in Anbetracht dessen, dass sie sich sowieso schon krank fühlte und morgen früh um fünf vom telefonischen Weckdienst geweckt werden würde – ein Anruf, den sie auf keinen Fall verpassen durfte.
Ihre Agentin hatte um sieben Ecken einen Casting-Termin für sie organisiert – eine Rolle in einer Serie, die im Herbst auf Fox ausgestrahlt werden sollte. Sie würde gleich morgen früh vorsprechen müssen, und sie hatte vor, so gut dabei auszusehen wie eben möglich. Sie würde sich selbst übertreffen. Wenn ihr diese Rolle durch die Lappen ging, wäre es vorbei … nun, es sei denn, sie würde einen Platz bei Dancing with the Stars oder in einer anderen Realityshow ergattern können, die ihre vor sich hin dümpelnde Karriere wieder in Schwung bringen könnte.
Wenn sie sich nur nicht so elend fühlen würde! Meine Güte, schwitzte sie etwa? Das war gar nicht gut.
Diese Fernsehserie könnte ihre letzte Chance sein, wenn man Hollywoods Haltung zum Thema Älterwerden bedachte. Was überaus deprimierend war.
Shelly Bonaventure musste es schaffen, unbedingt. Sie könnte nicht einfach mit eingekniffenem Schwanz in das Hinterwäldlerstädtchen in Montana zurückkehren, dem sie einst den Rücken gekehrt hatte, um hier in L.A. Karriere zu machen. War sie nicht die Ballkönigin der Sycamore Highschool gewesen und in ihrem Abschlussjahr zur verheißungsvollsten Schülerin gewählt worden? Hatte sie nicht alles versucht, um so schnell wie möglich den Kleinstadtstaub abzuschütteln? Und tatsächlich – am Anfang hatte ihr Stern hell geleuchtet, als sie mit ein paar vielversprechenden Nebenrollen zum Firmament aufgestiegen war. Ein Part in einer Seifenoper, noch bevor sie zwanzig geworden war! Und hatte sie etwa nicht mit den beiden Toms gearbeitet – Cruise und Hanks – und mit Gwyneth und Meryl und … sogar mit Brad Pitt? Gut, es waren kleine Rollen gewesen, aber immerhin! Außerdem hatte sie Julia Roberts gedoubelt, und dann war da noch diese Vampirserie auf Kabel gewesen, Blutige Küsse. Sie hatte einiges vorzuweisen, aber diese Momente des Ruhms lagen eine Weile zurück, und in letzter Zeit hatte man sie bloß noch als Leiche bei Serien wie CSI eingesetzt oder in diversen Werbespots. Ab und an bekam sie auch eine Rolle als Synchronsprecherin in billigen Zeichentrickproduktionen.
Wenn sie nicht die Estelle in dieser neuen Serie spielen durfte, wäre es endgültig mit ihrer Karriere in Hollywoods B-Liga vorbei, und sie würde geradewegs in einer Realityshow für abgehalfterte C-Ligisten landen. Dieser Gedanke ließ sie erschaudern.
Hollywood, dachte sie verzagt, das Land der durchgesessenen Casting-Sofas und zerbrochenen Träume.
Eine weitere Schmerzwelle zwang sie beinahe in die Knie. »Allmächtiger«, keuchte sie und taumelte zusammengekrümmt in ihre kleine kombüsenartige Küche, wo sie die Kühlschranktür öffnete, die kärglichen Vorräte betrachtete und eine weitere Welle der Depression aufkommen fühlte. Sie stieß auf eine halb volle Flasche Pepto, schraubte den Verschluss auf und nahm einen Schluck von der zähen, quietschrosa Medizin, die man frei verkäuflich in jedem Drugstore bekam und die so gut gegen Magenbeschwerden half. Mit zittrigen Fingern drehte sie sie wieder zu und stellte sie zurück ins Kühlschrankfach. Dann klappte sie die Tür zu, ließ sich auf den Fußboden gleiten, streckte die Beine von sich und atmete tief ein und aus.
Wie war ihr übel!
Vielleicht sollte sie ihren Arzt anrufen oder ihm zumindest eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Langsam rappelte sie sich hoch und fragte sich wieder, wo um alles in der Welt Lana, ihre Katze, stecken mochte.
Nun, auf alle Fälle nicht auf dem Küchentresen, auf dessen verkratzter Arbeitsfläche sich seit drei Tagen benutzte Kaffeetassen, schmutzige Gläser und die Packungen von kalorienreduzierten Fertigmahlzeiten stapelten.
Ihr Magen schmerzte immer mehr. Shelly schleppte sich zum Badezimmer und sprach sich Mut zu. Sie würde sich von dieser Stadt nicht unterkriegen lassen.
Hatte sie etwa nicht unter Bulimie gelitten? Hatte sie etwa nicht alles für ihre Karriere getan? Und obwohl sie keine klassische Schönheit war, so hatte man ihr doch gesagt, ihr Gesicht zeige »Charakter« und »Intelligenz«. Ihr kastanienbraunes Haar leuchtete nach wie vor, und die Haut um ihre grünen Augen und die vollen Lippen wiesen noch nicht allzu viele verräterische Falten auf.
Sie quetschte sich in das winzige Badezimmer. Ein Blick in den Spiegel über dem Waschbecken ließ sie zusammenzucken. Aller Schönrederei zum Trotz fingen die Jahre an, ihre Spuren zu hinterlassen. Zwar benutzte sie tonnenweise Produkte, die ihren Teint makellos halten sollten, doch zu Botox hatte sie bislang nicht gegriffen. Noch nicht. Sie wollte da nichts ausschließen, wollte gar nichts ausschließen, was die Zeit ein wenig zurückdrehen konnte.
Doch die Zeit war ein unerbittliches Übel, dachte sie und hob ihre Kinnkonturen an, um zu sehen, ob sie wirklich gestrafft werden mussten.
Noch nicht, Gott sei Dank. Ihr fehlte das Geld für diese Art von »Schönheitstuning«, und sie hatte auch nicht vor, irgendein künstlich aufgebauschtes Enthüllungsbuch auf den Markt zu bringen, wie ihre Agentin vorgeschlagen hatte. Sie war noch keine fünfunddreißig – bis zu ihrem Geburtstag blieben ihr noch ein paar Tage –, was sollte sie bei einem solchen Seelenstriptease schreiben? Verglichen mit anderen Frauen ihres Alters war ihr Leben bisher ziemlich langweilig verlaufen.
Das Weiße in ihren Augen wirkte ein wenig blutunterlaufen. Shelly nahm die Kontaktlinsen heraus und holte das Fläschchen mit Augentropfen aus dem Medizinschrank. Mit zurückgelegtem Kopf hielt sie die Pipette nacheinander über beide Augen und blinzelte, um die Tropfen besser zu verteilen. Dann stellte sie das Fläschchen in den Schrank zurück. Als sie die Spiegeltür schloss, bemerkte sie aus dem Augenwinkel einen Schatten hinter sich.
Was war das?
Mit hämmerndem Herzen fuhr sie herum. Das winzige Badezimmer war leer, die Tür stand offen.
Ihre Haut kribbelte.
»Lana? Bist du es?«, rief sie und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Ohne ihre Kontaktlinsen und wegen der Augentropfen, die noch immer einen trüben Film bildeten, nahm sie die Zimmerecken nur verschwommen wahr. »Kätzchen?« Wo hatte sich diese Glückskatze versteckt, die sie nach ihrer Lieblingsfilmikone Lana Turner benannt hatte? »Komm raus, zeig dich, wo immer du dich versteckt hast«, säuselte sie, doch zweifelsohne lauerte die Katze wieder irgendwo an einem dunklen Fleckchen. Mehr als einmal war Lana hinter den gerahmten Fotos auf dem Bücherregal hervorgeschossen, hatte sämtliche Bilder umgeworfen, dabei die Gläser zerschmettert und sich zu doppelter Größe aufgeplustert, um Shelly zu Tode zu erschrecken. Das war ohnehin Lanas Lieblingszeitvertreib. »Hierher, Kätzchen, Kätzchen …«
Doch wie bei ihrem unabhängigen Naturell nicht anders zu erwarten, tauchte die Katze nicht auf.
Barfuß stand Shelly im Wohnzimmer. Irgendetwas sagte ihr, dass die Katze nicht da war. Obwohl das keinen Sinn machte.
Als sie die Wohnung verlassen hatte, hatte Lana dösend auf der Rückenlehne der Couch gelegen und halbherzig mit dem Schwanz gezuckt.
Warum also fühlten sich die Räume so leer an? Draußen trieb der Wind trockene Blätter über die Veranda, ein gespenstischer Tanz aus braunen und rostroten Farbtupfern.
Du lieber Himmel, was stimmte bloß nicht mit ihr? Daran war doch nichts Unheimliches! Trotzdem stellten sich ihr die Härchen auf den Armen auf.
»Hör endlich auf damit!«, befahl sie sich noch einmal, als sie von einem weiteren Krampf überwältigt wurde. »Auuu!« Der Schmerz war diesmal noch heftiger. Sie wartete nicht länger, kroch zu ihrer Handtasche und tastete nach ihrem Handy.
Das dumme Ding steckte nicht in seinem üblichen Fach. »Komm schon, komm schon!« Das war wahrlich nicht der richtige Zeitpunkt, um nach dem Mobiltelefon zu suchen. Mit zitternden Fingern durchwühlte sie den Inhalt ihrer Handtasche, und als der Schmerz noch stärker wurde, kippte sie einfach alles auf den Fußboden. Schlüssel, Brillenetui, Brieftasche, Quittungen, Münzen, eine Schachtel Zigaretten, Tampontäschchen und eine kleine Dose Pfefferspray schlitterten über die Fliesen.
Kein Handy.
Wieso nicht?
In der Bar hatte sie es doch noch bei sich gehabt. Sie erinnerte sich, den Vibrationsmodus eingeschaltet zu haben, und … Hatte sie es etwa nicht in die Tasche zurückgesteckt, sondern im Lizards liegen gelassen, auf dem Tresen, dessen Oberfläche aussah wie eine Schlangenhaut?
»O Gott«, flüsterte sie und spürte, wie ihr der Schweiß auf der Stirn ausbrach. Ihr Puls raste. Sie hatte keinen Festnetzanschluss, was bedeutete, dass sie keine Hilfe holen konnte, es sei denn …
Plötzlich hörte sie ein lautes Scharren.
Was zum Teufel war das? Die Katze?
»Lana?«, fragte sie nervös, dann bemerkte sie, dass die Glasschiebetür offen stand, wenn auch nur einen winzigen Spalt.
Hatte sie sie etwa nicht geschlossen? – Doch, mit Sicherheit. Sie erinnerte sich genau daran. Vermutlich war das Schloss nicht eingeschnappt, weil Merlin, dieser dämliche Hauswart, immer noch nicht vorbeigekommen war, um es zu reparieren.
Ihre Kopfhaut kribbelte, und ihr Herz begann heftig zu pochen, auch wenn sie sich gut zuredete, dass sie gerade völlig übertrieben reagierte. Niemand hatte sich in ihrem Apartment versteckt, um ihr aufzulauern. Sei nicht paranoid. Du hast einfach zu oft für die Opferrolle in diesen billigen Horrorstreifen vorgesprochen.
Trotzdem …
Angestrengt lauschend und mit rasendem Herzen blickte sie zur Schlafzimmertür, die ebenfalls einen Spaltbreit offen stand. Sie hatte noch keine zwei Schritte in diese Richtung gemacht, als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf der Veranda wahrnahm, eine dunkle Gestalt am Schiebegriff der Glastür.
Ein Einbrecher!
Sie öffnete den Mund, um zu schreien, doch dann klappte sie ihn erstaunt wieder zu. Es war der Typ aus der Bar. In der Hand hielt er ihr Mobiltelefon. Erleichtert schlug sie die Hand vor die Brust und rief: »Du hast mich fast zu Tode erschreckt!«, dann eilte sie zur Tür und schob sie auf. »Woher hast du mein –«
Doch sie kannte die Antwort, noch bevor sie zu Ende gesprochen hatte.
»Du hast es in der Bar liegen gelassen.«
»Und wie hast du mich gefunden?«
Wieder dieses schiefe, sexy Grinsen. »Deine Adresse ist unter ›Kontakte‹ gespeichert.«
»Oh. Richtig.«
Er war ein echter Hingucker mit seinem markanten Kinn, dem dunklen Haar und den Augen, in deren dunkelblauen Tiefen etwas Abgründiges schimmerte.
»Die meisten Leute kommen zur Wohnungstür und klopfen«, bemerkte sie ein wenig verwirrt.
Seine Lippen zuckten. »Vielleicht bin ich nicht wie die meisten Leute.«
Das konnte sie kaum abstreiten. Plötzlich durchfuhr sie ein weiterer schmerzhafter Krampf, so heftig, dass sie sich mit einer Hand auf den Glastisch stützen musste. »Oh … oh …«, stammelte sie und zog scharf die Luft ein. Wieder brach ihr der Schweiß aus, diesmal fühlte sie sich einer Ohnmacht nahe.
»Geht es dir gut?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Es ist besser, du gehst. Es tut mir leid – au!« Sie keuchte. Ihre Knie gaben nach. Er fing sie auf, als sie zu Boden sinken wollte, griff mit seinen kräftigen Armen nach ihr.
»Du brauchst Hilfe.«
Bevor sie widersprechen konnte, hob er sie hoch und trug sie zielsicher ins Schlafzimmer. »He, warte …«
»Leg dich einfach hin«, befahl er ihr mit ruhiger Stimme.
Ihr blieb keine Wahl. Das Schlafzimmer drehte sich, die Nachttischlampe wirbelte vor ihren Augen. Sie fühlte sich schrecklich elend …
Augenblick mal … Erneut stieg Panik in ihr auf, als er sie auf die zerwühlten Laken legte. Die Matratze gab unter ihrem Gewicht nach. Kurz dachte sie an Flucht. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht, das wusste sie trotz ihrer schier unerträglichen Schmerzen. Ihre Begegnung in der Bar, ihre Übelkeit, sein überraschendes Aufkreuzen auf ihrer Veranda …
Jetzt verließ er das Zimmer. Mein Gott, stellte er etwa die Dusche an? Sie hörte Wasser rauschen, die alten Rohre quietschten, als der Hahn wieder zugedreht wurde. Was sollte das alles?
Doch noch bevor sie sich rühren konnte, war er wieder zurück und reichte ihr das Handy. »Ich hab schon den Notruf gewählt«, sagte er. Sie wollte die Hand ausstrecken, doch es gelang ihr nicht. Ihre Finger waren völlig taub und ließen sich ebenso wenig bewegen wie ihr Arm.
Sie musste um Himmels willen hier wegkommen … Die ganze Sache war absolut faul.
Er legte das Handy dicht neben ihr Gesicht auf die Patchworkdecke, die ihre Großmutter für sie genäht hatte, als sie zehn gewesen war …
Shelly blickte zu ihm auf und sah wieder sein Grinsen, doch diesmal war sie sich sicher, dass keine Fröhlichkeit darin lag, nur kalte, tödliche Zufriedenheit. Sein zuvor so attraktives Gesicht hatte dämonische Züge angenommen.
»Was hast du getan?«, wollte sie fragen, doch die Worte kamen nur undeutlich aus ihrem Mund.
»Träum was Schönes.« Er wandte sich zum Gehen. In der Schlafzimmertür blieb er stehen, und sie spürte ein Frösteln, eisig wie der Tod.
»Hier ist die Neun-eins-eins«, meldete sich eine Beamtin. »Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und was für einen Notfall –«
»Hilfe!«, stieß Shelly verzweifelt hervor. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern; ihre Lippen wollten sich nicht bewegen, ihre Zunge war dick geschwollen und gehorchte nicht.
»Entschuldigung?«
»Ich brauche Hilfe«, versuchte sie es erneut, lauter jetzt, doch ihre Worte klangen unverständlich, sogar in ihren eigenen Ohren.
»Es tut mir leid. Ich kann Sie nicht hören. Bitte sprechen Sie lauter. Was für einen Notfall möchten Sie melden?«
»Helfen Sie mir, bitte! Schicken Sie jemanden her!«, versuchte Shelly voller Panik zu rufen, doch der Raum verschwamm vor ihren Augen, kein Laut drang über ihre Lippen. Es gelang ihr noch, den Arm in Richtung Handy zu schieben, doch es rutschte vom Bett auf den Fußboden.
Ihr Kopf fiel zur Seite, ihr Blick auf die Tür. Dort stand er und starrte sie an. Das »mörderische« Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden und hatte einem mordlüsternen Ausdruck Platz gemacht; in seinen Augen lag purer, unverstellter Hass.
Warum? Warum ich?
Seine Augen, die sie noch vor wenigen Stunden für so anziehend gehalten hatte, glitzerten böse.
In diesem Moment wusste sie, dass ihre Begegnung in der Bar geplant gewesen war. Ihr Tod war kein Zufall; aus irgendeinem unerklärlichen Grund hatte er es auf sie abgesehen.
Lieber Gott, bitte hilf mir, flehte sie. Sie würde sterben müssen, das wurde ihr jetzt schlagartig klar. Eine Träne rollte aus ihrem Augenwinkel. Im Türrahmen lehnte der mysteriöse Fremde und verfolgte mit seinem verstörenden Grinsen, wie sie einen mühsamen, flachen Atemzug tat.
Aus dem Handy auf dem Fußboden quäkte die Stimme der Vermittlungsbeamtin, doch sie schien Millionen von Meilen entfernt zu sein. Shelly beobachtete, wie er zu ihr trat und ein Tablettenröhrchen auf ihren Nachttisch stellte. Dann blickte er ihr fest in die Augen, teilte ihr ruhig mit, dass er sie umbringen würde, und fing an, sie bedächtig und voller Methode zu entkleiden …
Kapitel 1
Eine Tasse Kaffee und einen Schoko-Macadamianuss-Cookie von Joltz, dem nahe gelegenen Coffeeshop, in einer Hand, in der anderen ihre Laptop-Tasche, eilte Dr. Acacia »Kacey« Lambert den Gehsteig entlang. Obwohl schon der Morgen heraufzog, waren die Straßenlaternen noch an; die Weihnachtsbeleuchtung strahlte hell, die Lichter tanzten im eisigen Novemberwind, der durch die Kleinstadt Grizzly Falls pfiff.
Der Winter war früh und mit gewaltigen Stürmen hereingebrochen, die Schnee und Eis und damit jede Menge Stromausfälle und Verkehrsprobleme mit sich brachten.
Genau wie letztes Jahr, dachte sie. So viel zum Thema globale Erwärmung.
Ein beständiger Strom von Pendlern schob sich um diese Tageszeit über die Landstraßen zum Highway – Rushhour. Fußgänger in dicken Jacken, Schals, Wollmützen und festen Stiefeln marschierten entschlossen voran, weiße Atemwölkchen vor dem Mund, die Wangen vor Kälte gerötet.
Die Winter hier waren hart, viel kälter als in Seattle, aber Kacey liebte diesen Teil des Landes und bedauerte nicht eine Sekunde, dass sie wieder in die kleine Stadt gezogen war, in der sie ihre Kindheit verbracht hatte.
An der Poliklinik angekommen, die im unteren Teil des Städtchens ganz in der Nähe des Gerichtsgebäudes lag, nicht weit von dem Fluss entfernt, dessen spektakuläre Wasserfälle Grizzly Falls zu seinem Namen verholfen hatten, jonglierte sie mit ihren Schlüsseln und schloss den Haupteingang auf. Die Poliklinik, in der Patienten tagsüber ambulant behandelt wurden, war Bestandteil eines größeren, aus mehreren Gebäuden bestehenden, frisch renovierten und vor kurzem neu eröffneten Krankenhauskomplexes, dem St. Bartholomew Hospital. Eine eisige Bö fuhr Kacey unter die Daunenjacke und rüttelte an den umliegenden Ladenfronten.
Kälter als eine Hexentitte, hätte ihr Großvater jetzt gesagt. Alfred Collins, dessen schelmische blaue Augen hinter einer Drahtgestellbrille funkelten, hatte nie seine deftige Ausdrucksweise abgelegt, obwohl ihm seine Frau, Kaceys Großmutter Ada, ständig deswegen über den Mund gefahren war.
Mitunter vermisste sie die beiden nahezu schmerzhaft. Kacey wohnte in dem Farmhaus, in dem ihre Großeltern über fünfzig Jahre miteinander gelebt hatten, und natürlich dachte sie oft an die zwei.
Ein Lastwagen rollte vorbei. Trotz der Kälte war das Beifahrerfenster ein Stück heruntergekurbelt, eine Hundenase ragte heraus, Fetzen von »Jingle Bell Rock« ertönten.
»Das ist wirklich noch zu früh«, murmelte sie, drückte die Tür auf und schlüpfte in den leeren Empfangsbereich der Klinik. Zwei Reihen leicht abgenutzter Stühle säumten die Wände, Magazine lagen auf den zerschrammten Tischen aus, in einer Ecke stand eine fast vertrocknete Betelnusspalme, neben dem Fenster, bei dem man sich anmelden konnte, waren ein paar Spielzeuge für die kleinen Patienten ordentlich aufgestapelt.
Durch eine Glaswand schien Licht; Heather Ramsey, die Rezeptionistin, saß bereits an der langen Empfangstheke auf der anderen Seite des Anmeldefensters. Heather war ganz auf den Bildschirm ihres Computers konzentriert; ihre Augen flogen über die aufgerufenen Seiten vor ihr.
Ganz bestimmt handelte es sich weder um Patientenakten noch um Aufnahmelisten noch um etwas, das auch nur annähernd mit der Klinik zu tun hatte.
Wie gewöhnlich las Heather die neuesten Internet-Klatschkolumnen und Blogs, bevor sie sich ihrer täglichen Arbeitsroutine zuwandte. »Mach dich auf was gefasst«, sagte sie, ohne aufzublicken.
»Worauf?«
»Deine Zwillingsschwester ist tot«, verkündete Heather mit betrübter Stimme. »Selbstmord.«
»Meine Zwillingsschwester?«, wiederholte Kacey und zog eine Augenbraue in die Höhe. »Und wer genau soll das sein? Schließlich bin ich ein Einzelkind!«
»Shelly Bonaventure!«
»Shelly wer? Ach, die Schauspielerin, die in … ach, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt … mitgewirkt hat.« Sie erinnerte sich an Shelly Bonaventure – eine attraktive Frau mit einem hübschen, ebenmäßigen Gesicht mit großen grünen Augen, einer Stupsnase, einem ausgeprägten Kinn und hohen Wangenknochen. Heathers Vergleich war definitiv ein Kompliment.
»Sie hat in vielen Filmen mitgespielt, wenn auch nicht in Hauptrollen. So aus dem Stegreif fallen mir Viel Rauch um nichts und Sorority Night ein, aber die liegen ja schon ein paar Jahre zurück, und, ach ja, war sie nicht auch in Dreißig über Nacht zu sehen?« Heather rief einen Artikel in einem Webzine auf. »Hauptsächlich ist sie durch ihre Rolle in Blutige Küsse bekannt geworden. Du weißt schon, die Vampirserie, mit der dieser süße Typ, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, seinen Durchbruch hatte.«
»Hab ich nie gesehen«, gab Kacey zu, doch das war keine große Überraschung. Sie schaute kaum fern, da sie nicht unbedingt viel Freizeit hatte. Während sie sich durchs College, das Medizinstudium, ihre Zeit als Assistenzärztin im Krankenhaus und ihr Berufspraktikum gekämpft hatte, hatte sie offenbar die Popkultur einer ganzen Generation verpasst.
»Wow, da hast du echt was versäumt! Aber das gibt’s ja alles auf DVD und Blu-ray. Die komplette Serie, inklusive Pilotfilm. Blutige Küsse war einfach toll. Sie war toll.« Die Rezeptionistin kam jetzt richtig in Fahrt. »Sie kommt hier aus der Gegend und heißt mit richtigem Namen Michelle Bentley.« Heather blickte auf und blinzelte ins grelle Licht. »Sie war erst fünfunddreißig oder vielmehr: Sie wäre nächste Woche fünfunddreißig geworden.«
Noch eine Gemeinsamkeit. »Und sie hat Selbstmord begangen?«, fragte Kacey. »Wie schade!«
»Ja, sie hat aber keinen Abschiedsbrief hinterlassen, zumindest hat die Polizei bislang nichts gefunden …«
»Wirklich zu schade«, wiederholte Kacey, drehte sich um und ging in Richtung der Behandlungsräume, wobei sie die Lichter in dem kurzen Gang anknipste.
»Tja … merkwürdig. Aber sie sieht – sah – wirklich aus wie du.«
»Ja, ja, ich weiß«, sagte Kacey und betrat ihr Büro, ein kleines Zimmer voller Bücherregale mit Blick auf den Parkplatz. Graupel fiel aus dem immer noch finsteren Himmel, prasselte gegen das Fenster und hinterließ nasse Spuren auf der Scheibe. Kacey zog ihren Laptop aus der Tasche, stellte ihn auf ihren Schreibtisch, dann klappte sie ihn auf und schaltete ihn an. Während er hochfuhr, richtete sie die Lamellenjalousie so ein, dass sie hinaus-, aber niemand in ihr Büro hineinblicken konnte, anschließend setzte sie sich auf ihren Schreibtischstuhl, knabberte an ihrem Frühstückscookie und trank mit kleinen Schlückchen den mitgebrachten Kaffee. Dabei ging sie ihre E-Mails durch.
Frühestens in einer Stunde würden die ersten Patienten eintreffen, so dass sie in aller Ruhe Papierkram aufarbeiten, E-Mails beantworten und sich auf einen weiteren Tag inmitten der Grippesaison einstellen konnte. Sie erledigte ein paar Telefonate, hörte, wie der Rest des Personals eintraf, und sah stahlgraue Wolken über den Bitterroot Mountains aufziehen, an deren Fuß Grizzly Falls lag.
Sie hatte gerade ein Gespräch mit einem Kollegen in Spokane über eine Brustkrebspatientin beendet, als Heather den Kopf zur Tür hereinsteckte, die Kacey die meiste Zeit ein Stück weit offen stehen ließ. »Mrs. Ingles hat angerufen und ihren Termin abgesagt, ihr Neffe braucht einen Babysitter.«
»Okay.« Helen Ingles litt an Diabetes, Typ 2, und hätte zur Blutabnahme für den Labortest kommen sollen.
»Oh, hier ist noch etwas. Ich hab den Artikel über Shelly Bonaventure für dich ausgedruckt.«
Kacey blickte sie über den Rand ihrer Lesebrille an.
Heather trat ein und ließ mehrere Blätter auf Kaceys Schreibtisch fallen. »Ja, ja, ich weiß, es ist Zeit, sich an die Arbeit zu machen, aber« – sie zuckte ihre schmalen Schultern – »sie war eine lokale Berühmtheit, und sieh doch nur, wie sehr sie dir ähnelt!«
»Bitte, Heather, jetzt ist aber Schluss!«, sagte Kacey kopfschüttelnd und schob den Artikel zur Seite. Seit Jahren hörte sie nun schon, wie sehr sie verschiedenen Hollywood-Schauspielerinnen ähnlich sehe. Ihr breites Lächeln war mit dem von Julia Roberts verglichen worden, und sogar ihr Ex-Mann, Jeffrey Charles Lambert – oh, pardon, für seine Freunde nur JC –, hatte behauptet, sie habe dieselbe Gesichtsform wie Jennifer Garner, was ganz und gar nicht stimmte. Und was Shelly Bonaventure anging: Die einzigen Ähnlichkeiten, die Kacey auf den ausgedruckten Bildern erkennen konnte, waren vielleicht die Haarfarbe und die Form und die Farbe ihrer Augen, vorausgesetzt, Shelly hatte keine farbigen Kontaktlinsen getragen.
»Schon gut, schon gut, ich hab’s kapiert.« Heather streckte beschwichtigend die Handflächen nach vorn und verließ das kleine Büro. »Mrs. Whitaker ist da.«
»Na großartig.« Constance Whitaker war eine typische Hypochonderin mit zu viel Zeit – Zeit, die sie damit verbrachte, im Internet über Krankheiten zu recherchieren. Anschließend geriet sie in Panik, da sie jedes Mal sicher war, selbst von diesem Leiden befallen zu sein. »Was ist mit Dr. Cortez?«, fragte Kacey und zog ihren Arztkittel über.
»Er hat vor fünfzehn Minuten angerufen. Ist noch unterwegs«, sagte Heather. In diesem Augenblick fiel Scheinwerferlicht durchs Fenster, und Dr. Martin Cortez’ Range Rover bog auf den Parkplatz. »Rekordzeit.«
Kacey schüttelte den Kopf. »Er war schon schneller. Als er noch den Porsche hatte.«
Heather seufzte. »Ja, ich erinnere mich.«
Der Sportwagen hatte einen Winter überstanden, dann hatte Cortez ihn gegen einen exklusiven Allradwagen eingetauscht, der besser mit dem bergigen Terrain und den strengen Wintern zurechtkam.
Als das Telefon am Empfang klingelte, eilte Heather zurück zur Rezeption. Im selben Augenblick öffnete sich die Hintertür und fiel mit einem lauten Knall wieder zu. Dr. Martin Cortez war eingetroffen.
Kacey schaute sich noch einmal das Foto von Shelly Bonaventure an. Ja, sie musste zugeben, dass eine leichte Ähnlichkeit bestand, doch diese war wirklich minimal.
Sie warf den Artikel gerade in den Müll, als Martin hereinschaute. Er hatte bereits seinen Arztkittel angezogen und ein warmherziges Lächeln aufgesetzt. »Und, hast du mir heute Morgen einen dreifachen Karamellmokka mit extra Schlagsahne mitgebracht?«, fragte er jetzt.
»Träum weiter.« Diesen Scherz machten sie jeden Morgen. Ab und zu überraschte Kacey ihn mit einem ausgefallenen Kaffeegetränk mit übertrieben vielen Extras, aber heute nicht.
»Oh, wie soll ich das nur überstehen?« Er spreizte eine Hand vor der Brust und blickte zur Decke, als warte er auf eine göttliche Eingebung.
»Es wird schwer werden, aber du wirst es schon schaffen«, neckte sie ihn. »Sei tapfer, okay?«
»Ich werde es versuchen.« Sein Lächeln, das weiße Zahnreihen vor seiner gebräunten Haut aufblitzen ließ, war ansteckend. Kein Wunder, dass die Hälfte aller Singlefrauen im County auf ihn abfuhr. Jetzt legte er seine oscarreife Pose ab und wurde wieder ernst. Ganz Allgemeinmediziner. »Hast du einen Blick in Amelia Hornsbys Patientenakte geworfen?« Martin kannte so gut wie jeden, der in die Klinik kam. Amelia war ein achtjähriges Mädchen, dessen Halsinfektion trotz mehrerer Antibiotika-Kuren nicht abheilen wollte.
Randy Yates, ein medizinisch-technischer Assistent, der gerade erst seine Ausbildung beendet hatte, schaute zur Tür herein. »He, Docs, auf geht’s!«, rief er grinsend. Sein braunes Haar war so kurz geschoren, dass der Schädel durchschimmerte, doch dafür trug er einen sorgfältig getrimmten Ziegenbart. »In Behandlungszimmer eins, zwei und vier ist alles vorbereitet. Vitalwerte sind auch schon gemessen.«
»Ich übernehme Mrs. Whitaker«, sagte Martin.
Kacey warf einen Blick auf die Karteikarte für Behandlungszimmer zwei. Elmer Grimes. »Ich bin in Nummer zwei«, rief sie dem MTA zu und machte sich auf den Weg zu ihrem ersten Patienten.
Detective Jonas Hayes vom LAPD traute dem Ganzen nicht, genauso wenig wie letzte Nacht, als er dem eingegangenen Notruf gefolgt und zu Shelly Bonaventures Apartment gefahren war. Er saß an seinem Schreibtisch vor dem Computer und klickte sich durch die Tatortfotos. Im Department war einiges los, Telefone schrillten, Gesprächsfetzen wehten zu ihm herüber, Kollegen eilten hin und her, Computertastaturen klapperten, und irgendwo spuckte ein Drucker Kopien aus.
Hayes nahm einen Schluck von dem Kaffee, den er sich bei einem Starbucks ein paar Straßen weiter gekauft hatte, und arbeitete sich durch die Aussagen von gestern Nacht. Wieder einmal. Er war sie gegen vier Uhr in der Früh schon einmal durchgegangen, und jetzt, fünf Stunden später, wollte er sie gründlicher unter die Lupe nehmen.
Seit er gestern Nacht Shelly Bonaventures Apartment betreten hatte, hatte er das Gefühl, dass nichts so war, wie es sein sollte. Der Tatort wirkte inszeniert und erinnerte an Marilyn Monroes mysteriösen Selbstmord von vor über fünfzig Jahren. Noch ein halbes Jahrhundert später kursierten Verschwörungstheorien, und der Verdacht, Marilyn sei ermordet worden, hielt sich hartnäckig. Eine solche Kontroverse wollte er bei Shelly Bonaventure vermeiden. Während seiner Dienstzeit würde so etwas nicht passieren.
Aber am Tatort war etwas faul gewesen, das hatte er deutlich gespürt. Und dieses Gefühl wollte nicht weichen.
Hayes, ein Rationalist, ließ nichts anderes als die harten Fakten gelten. Auf Bauchgefühle oder Ahnungen gab er nicht viel. Seiner Überzeugung nach konnte man allein anhand von Beweisen zum Kern eines Verbrechens vordringen.
Doch bei diesem Fall war das anders: Zum einen glaubte er nicht, dass Shelly, egal, in welcher geistigen Verfassung, völlig nackt den Notruf wählen würde. Wenn sie ihre Sinne noch so weit beisammenhatte, dass sie einen Anruf tätigen konnte, hätte sie sich zumindest einen Bademantel oder Ähnliches übergezogen. Oder war das ein Publicity-Trick? Heizte ihre Nacktheit die Neugier der Öffentlichkeit an? Hatte sie medienwirksam sterben wollen?
Aber wo zum Teufel war dann der Abschiedsbrief?
Hayes rieb sich den Nacken. Er sehnte sich nach einer Zigarette, aber er hatte auf Drängen seiner Ex-Frau Delilah schon vor Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Mein Gott, wie er die Kippen vermisste! Fast so sehr wie Delilah.
Stirnrunzelnd wandte er sich wieder dem Fall zu. Vermutlich würde der toxikologische Befund ergeben, dass sie einen Mix aus Tabletten und Alkohol im Blut hatte. Xanax, ein Mittel gegen Angst- und Panikstörungen, sollte sie ihre eigenen Medikamente genommen haben. Ein Röhrchen davon hatte direkt neben ihr auf dem Nachttisch gestanden. Nur drei Tabletten waren noch darin gewesen, und laut Etikettaufkleber war es erst letzten Samstag verschrieben worden.
Ganz offensichtlich hatte sie eine Überdosis genommen. Doch warum glaubte er nicht daran? Es war durchaus möglich, dass sie die Tabletten auf ihrem Nachttisch aufbewahrt hatte anstatt im Medizinschrank, und nackt könnte sie gewesen sein, weil sie gerade geduscht hatte. Die Duschkabine und der Duschvorhang waren nass gewesen.
Dagegen sprach, dass ihr Haar und ihre Haut knochentrocken waren; auch ihr Make-up war nur leicht verwischt, nicht so, als wäre es abgewaschen worden. Die Duschhaube an einem Haken neben der Kabine war dagegen feucht gewesen, vielleicht hatte sie ihr Haar so sorgfältig daruntergesteckt, dass nicht einmal die feinen Härchen am Stirnansatz Wasser abbekommen hatten … vielleicht.
Ihre Katze war nicht in der Wohnung gewesen, sondern draußen. Hätte sie das verhätschelte Tier wirklich auf die Veranda gelassen, wenn sie vorhatte, sich umzubringen? Das konnte er sich kaum vorstellen, aber natürlich war alles möglich. Vielleicht wollte sie nicht, dass die Katze mit einem verwesenden Leichnam eingesperrt wäre.
Nachdenklich tippte er mit einem Radiergummi auf seinen Schreibtisch, in die Tatortfotos vertieft. Shelly lag ausgestreckt auf dem Bett, das Handy, mit dem sie vor ihrem Drogendelirium die Neun-eins-eins angerufen hatte, rechts daneben auf dem Fußboden.
Während er sich seinen verspannten Nacken rieb, ging Jonas in Gedanken die vergangenen zwölf Stunden durch. Der Anruf war gegen Mitternacht eingegangen. Unmittelbar danach hatte er sich auf den Weg zu Shelly Bonaventures Apartment gemacht, wo ein Beamter bereits damit beschäftigt war, den Tatort zu sichern. Hayes und Gail Harding, seine Juniorpartnerin, hatten noch auf die Jungs von der Spurensicherung und den Leichenbeschauer gewartet.
Später brachte man Shellys Leichnam in die Pathologie, und die nächsten Angehörigen wurden benachrichtigt. Der Beamte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei gab eine Pressemitteilung, fertig für die Morgennachrichten, heraus. Die Boulevardzeitungen hatten bereits angerufen, denn tot war Ms. Bonaventure weit faszinierender als lebendig. Shellys Agentin verfasste einen kurzen Nachruf, worin sie Shellys Talent und ihre Karriere lobte und betonte, was für ein gutes Herz sie gehabt habe. Darin bat sie auch die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren.
Jeder, der sie kannte und den Hayes befragt hatte, hatte ausgesagt, sie sei voller Leben gewesen, eine Kämpferin, von echten Depressionen keine Spur. In einer Stadt, deren Bewohner Aufputsch- und Beruhigungsmittel schluckten wie Schokodrops und in der der Besuch einer Entzugsklinik beinahe schon zum guten Ton gehörte, schien Shelly relativ medikamenten- und drogenfrei gelebt zu haben; Skandale hatte es auch keine gegeben.
Hayes blickte auf die Mitschriften der Zeugenaussagen, die sie aufgenommen hatten. Der Nachbar von oben hatte gegen dreiundzwanzig Uhr die Wohnungstür ins Schloss fallen und Shelly nach ihrer Katze rufen gehört, eine knappe halbe Stunde vor dem Notruf.
Vierzig Minuten später hatte sie schon nicht mehr gelebt.
Diese Selbstmordtheorie erschien Hayes einfach zu glatt. Zu oberflächlich.
Außerdem war sie ein wenig zu schnell gestorben, wenn sie die Tabletten erst nach ihrer Rückkehr geschluckt hatte. Doch vielleicht irrte er sich auch; schließlich musste er noch einige Telefonlisten überprüfen und Freunde, Nachbarn und ehemalige Liebhaber anrufen. Der Detective des LAPD lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und betrachtete das 13-mal-18-Foto seiner Tochter Maren, die mittlerweile die Highschool besuchte. Gesegnet mit dem blendenden Aussehen ihrer Mutter und deren breitem Lächeln, hatte sie ihm anvertraut, dass sie Schauspielerin werden wolle. Sie sah sich schon als neue Angela Bassett, Halle Berry oder Jada Pinkett Smith.
Und sie war gut, wirklich. Aber Hollywood? Sein kleines Mädchen wollte nach Hollywood?
Er riss den Blick von Marens Bild los und wandte sich dem Bildschirm mit Shelly Bonaventures Foto zu: graue Haut, blaue Lippen, tot. Was, so fragte er sich, hatte Hollywood damit zu tun?
Vielleicht nichts. Vielleicht alles.
Hayes stand auf. Er hörte das leise Gluckern der kaum benutzten Heizungen, denn selbst mitten im Winter war es hier nur selten nötig, die Temperatur in dem Gebäude, in dem die Kommission für Mord und bewaffnete Raubüberfälle untergebracht war, zu erhöhen.
Er hörte Hardings Absätze klappern, noch bevor er sie um die Ecke biegen sah. Sie hatte die Stirn gerunzelt, die gezupften Augenbrauen waren nachdenklich gefurcht.
»Hast du was rausgefunden?«
»Nicht viel«, sagte sie. »Immerhin hab ich den Barkeeper ausfindig gemacht, der im Lizards die Spätschicht hatte – diese Bar, in der Shelly zuletzt gesehen wurde.«
»Und?«
»Sie muss ziemlich betrunken gewesen sein«, erklärte Harding. »Der Typ, mit dem sie dort war, hat ihr einige Drinks ausgegeben, um auf ihren bevorstehenden Geburtstag anzustoßen.«
»Ein Freund?«
»Irgendein Kerl. Möglicherweise eine Zufallsbekanntschaft. Der Barkeeper war sich nicht sicher, obwohl er sich an den Typen erinnerte. Mitte bis Ende dreißig, gutaussehend, dunkles Haar, durchschnittlich groß. Ein Weißer, wenn auch mit dunklerer Haut, vermutlich sonnengebräunt. Die Augenfarbe oder irgendwelche besonderen Kennzeichen konnte er nicht nennen, aber er zeigte sich ziemlich interessiert an Shelly. Der Barmann hat sich gewundert, dass sie nicht gemeinsam gegangen sind. Müssen ganz schön geflirtet haben!«
»Ich nehme nicht an, dass der Typ mit Kreditkarte bezahlt hat?«
Harding lächelte und zeigte dabei ihre leicht nach vorn stehenden Schneidezähne. »So viel Glück werden wir wohl nicht haben.«
»Vermutlich nicht.«
»Außerdem gehen wir doch davon aus, dass es sich um Selbstmord handelt, oder etwa nicht?«, hakte die jüngere Kollegin nach.
»Doch, doch«, erwiderte Jonas ohne rechte Überzeugung. Auf jeden Fall würde er die letzten Tage in Shelly Bonaventures Leben durchgehen und all ihre Beziehungen unter die Lupe nehmen. Auch interessierte ihn, wer von ihrem Tod profitieren würde. Es hieß, sie sei für eine Rolle in einer Fernsehserie vorgesehen gewesen, außerdem ging das Gerücht, sie habe vor, ein Enthüllungsbuch zu schreiben. Doch zunächst einmal wollte er sich die Person vornehmen, die sie zuletzt lebendig gesehen hatte.
»Dann glaubst du also an eine versehentliche Überdosis?«, bohrte Harding mit zusammengekniffenen Augen weiter. Als Hayes nicht antwortete, nickte sie, wie um sich selbst und ihren zuvor gezogenen Schlüssen zuzustimmen. »Du denkst nach wie vor an Mord, hab ich recht?«, fragte sie dann.
»Ich weiß nicht, was ich denken soll. Noch nicht«, gab er zu. »Ich möchte nur nichts ausschließen. Lass uns mit dem Barmann reden, persönlich. Vielleicht können wir seiner Erinnerung an den geheimnisvollen Unbekannten noch ein wenig mehr auf die Sprünge helfen.«
»Du bist der Boss«, sagte sie, wobei ein Hauch von Sarkasmus in ihrer Stimme mitschwang.
»Da hast du recht«, neckte er sie, nahm seine Jacke vom Haken neben dem Schreibtisch und steckte seine Glock ins Schulterholster. »Dass du das bloß nicht vergisst.«
»Wie könnte ich, wo du mich doch jeden Tag daran erinnerst?«
»Das ist jetzt kein Grund, die Mimose zu spielen.«
»Hm«, sagte sie. »Dann lass uns gehen.«
Die alte Treppe knarrte unter seinen Füßen, als er langsam in den Keller stieg, der unterhalb der nachträglich angebauten Garage lag. Das Haus selbst war noch vor der Jahrhundertwende erbaut worden. Der vorletzten Jahrhundertwende.
Kühl und luftdicht, war der Keller einst zur Einlagerung von Ofenholz verwendet worden, jetzt wurden dort vorwiegend nicht länger benötigte Gegenstände abgestellt. Kisten, alte Möbel, kaputte Lampen, Weckgläser und Bilder längst vergangener Zeiten verstaubten dort.
Niemand verirrte sich je hier runter.
Außer ihm.
Und das auch nur, wenn außer ihm niemand im Haus war.
Spinnweben hingen von den offenen Balken der darüberliegenden Garage herab, wo er seinen silbernen Lexus abzustellen pflegte. Er ignorierte das Kratzen winziger Krallen auf dem Steinfußboden – Mäuse, Ratten, Eichhörnchen oder welche Nagetiere sich auch immer hier unten häuslich niedergelassen haben mochten. Ein, zwei Klapperschlangen könnten nicht schaden.
Er ging an Kisten voll altem Werkzeug vorbei zu seinem ganz privaten Reich, der alten Kammer, wo einst den Winter über Wurzelgemüse und Äpfel gelagert worden waren. Der alte Milchentrahmer seiner Urgroßmutter, ein Gerät, das seit über fünfzig Jahren nicht mehr benutzt worden war, hielt noch immer an der schweren, mit einem Vorhängeschloss gesicherten Tür Wache. Die uralte Waschmaschine, die früher in der Ecke gestanden hatte, gab es schon längst nicht mehr, nur der Rost an den Wänden verriet, wo die zugehörigen Wasserrohre geendet hatten. Er musste sich ducken, um sich nicht in den Leinen zu verheddern, auf denen vor langer, langer Zeit im Winter die Laken zum Trocknen aufgehängt worden waren.
Er öffnete das Vorhängeschloss und drückte die Tür zu der alten Kühlkammer auf, die sein Ururgroßvater gebaut hatte. Die Tür war fast dreißig Zentimeter dick und voller Sägemehl. Wenn sie geschlossen war, drang aus der Kammer kein Geräusch mehr nach draußen.
Drinnen schaltete er das Neonlicht ein und zog die Tür hinter sich zu. Sofort war der Raum in ein flackerndes bläuliches Licht getaucht, und es hatte den Anschein, als hätte er von einer Sekunde auf die andere eineinhalb Jahrhunderte übersprungen und wäre in einem völlig anderen Zeitalter gelandet. Oberflächen aus rostfreiem Edelstahl glänzten vor drei Wänden; eine Computerzentrale, komplett mit drahtlosem Modem und Fünfundzwanzig-Zoll-Bildschirm, sowie eine umfassende elektronische Ausrüstung, um seine ganz persönlichen Angelegenheiten unter Verschluss zu halten, nahmen die eine Ecke des Zimmers ein.
Eine übergroße Karte von Nordamerika war an einer Pinnwand befestigt, die über eine ganze Wand reichte. Es handelte sich um eine politische Landkarte, auf der Bundesgrenzen, Städte und Straßen eingezeichnet waren. Über die ganze Oberfläche waren rote Reißzwecken verteilt. Siebenunddreißig insgesamt. Jede markierte einen Ort, an dem eine der Frauen lebte, die er die »Unwissenden« nannte, und jede heftete das Foto einer solchen Frau auf die Karte. Wie Blutflecken ruinierten sie die glatte Oberfläche und erinnerten ihn daran, wie viel Arbeit noch vor ihm lag. Arbeit, die bald erledigt werden musste.
Sie bereiteten ihm Sorgen, diese Reißzwecken, ernsthafte Sorgen.
Es waren einfach zu viele, fand er. Es gab noch weitere Reißzwecken, mit schwarzen Köpfen. Sie standen für den Tod. Mit den schwarzen Reißzwecken befestigte er ebenfalls Fotos auf der Landkarte, andere Aufnahmen, mit der Bildseite nach unten, so dass nur noch weiße Rechtecke mit ordentlich geschriebenen Geburts- und Todesdaten zu sehen waren. Es gab zwölf davon, verteilt über die gesamten Vereinigten Staaten.
Doch er machte Fortschritte – stetige Fortschritte. Zwar kam er nur langsam voran, da er sich auf niemand anderen als auf sich selbst verlassen konnte, doch diese Lektion hatte er auf die harte Tour lernen müssen.
Lächelnd zog er eine rote Reißzwecke aus dem Gebiet von Südkalifornien, dann ging er zum Drucker und entnahm ihm ein bereits ausgedrucktes Digitalfoto. Shelly Bonaventure starrte ihm zu Tode verängstigt entgegen. Zufrieden über den Ausdruck nackten Entsetzens auf ihrem Gesicht, verzerrte sich sein Lächeln zu einem breiten Grinsen. In jenem Augenblick hatte sie gewusst, dass sie sterben würde. Er hatte die Aufnahme mit seiner Handykamera gemacht, bevor er durch die Verandatür verschwunden war, und sie hierher auf seinen PC geschickt.
Er hatte sich zu viel Zeit gelassen; als er über die Straße geeilt war, hatte er bereits Sirenengeheul vernommen, das rasch näher gekommen war.
Doch er war ihnen entwischt. Wieder einmal.
Er nahm die Schere zur Hand, die er in einer Schublade aufbewahrte, und schnitt das kleine Foto aus, dann notierte er sorgfältig Shelly Bonaventures Geburts- und Sterbedatum auf der Rückseite. Jetzt konnte er endlich das Porträtfoto, das er mit Photoshop aus ihrer Sedcard ausgeschnitten hatte, abnehmen und seine eigene Aufnahme anbringen, mit einer schwarzen Reißzwecke und der Bildseite nach unten. Das Foto, das sie lebendig zeigte, legte er auf einen Stapel in der Schublade. Perfekt.
Sein Blick glitt über sein Werk, blieb an den anderen schwarzen Reißzwecken hängen – Frauen, die vor Shelly gestorben waren – und an den roten – »Unwissenden«, denen die Strafe noch bevorstand. Jede Frau war auf ihre eigene Art und Weise bemerkenswert, und sie alle waren zwischen achtundzwanzig und sechsunddreißig. Die meisten hatten brünettes Haar, doch es gab auch ein paar gefärbte Blondinen und mehrere Rotschöpfe.
Die Fotos ballten sich hauptsächlich im Nordwesten. Zwei hingen in der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien, beide nahe Vancouver Island, eine in Alberta, mehrere in Washington State, eine ganze Menge in Oregon, und ein paar waren über Kalifornien verteilt. Drei in Nevada, zwei in Arizona, eine Handvoll in Montana, eine weit weg in Delaware. Sechs der Frauen lebten im Mittleren Westen. Drei in Chicago.
Diejenigen, die sich in einer bestimmten Gegend oder einem Bundesstaat häuften, bereiteten ihm die meisten Sorgen, denn wenn er nicht absolut vorsichtig war, könnte ihr Tod mit den anderen in Zusammenhang gebracht werden und dadurch verdächtig wirken. Shellys »Selbstmord« war ein Risiko gewesen. Die anderen waren bei »Unfällen« ums Leben gekommen; niemand hatte Fragen gestellt.
Alles war bisher perfekt, wie geplant, abgelaufen. Doch es gab noch so viele andere!
Er betrachtete die Anhäufung von Reißzwecken um Missoula und Grizzly Falls. Zugang zu diesen »Unwissenden« würde er leicht finden, waren sie doch ganz in der Nähe.
Doch wenn mehrere Frauen Ende zwanzig, Anfang dreißig plötzlich tödlich verunglückten, würden die Behörden aufmerksam werden.
Es sei denn, es gäbe eine große Katastrophe und sie kämen alle miteinander ums Leben. Eine solche Katastrophe müsste weitere Opfer fordern, natürlich, schon um jedem Verdacht vorzubeugen. Er selbst würde nicht betroffen sein oder – besser noch – dem Ganzen um Haaresbreite und nur leicht verletzt entrinnen.
Eine solche Inszenierung wäre kompliziert, doch allein bei der Vorstellung verspürte er ein freudiges Prickeln. Was für eine clevere Idee! Er würde die Polizei austricksen, sich als Held feiern lassen und … nein! Er musste im Hintergrund bleiben, durfte es sich nicht leisten, plötzlich im Rampenlicht zu stehen, nur damit irgendein dämlicher Reporter anfing, Nachforschungen anzustellen …
Er ging zu einem Aktenschrank hinüber und öffnete ihn. Drinnen standen akkurat geführte Ordner – voller Informationen, die er im Laufe der Zeit über jede einzelne »Unwissende« zusammengetragen hatte.
Er nahm den ersten heraus und klappte ihn auf. Sein Magen machte einen Satz, als er das Foto betrachtete, das zwischen seinen Notizen steckte.
Dr. Acacia Collins Lambert.
Sie war etwas Besonderes. Ein Mädchen aus einer Kleinstadt in Montana, intelligent genug, um es bis aufs College und auf die medizinische Fakultät zu schaffen. Kurze Zeit mit Jeffrey Charles Lambert verheiratet, einem Herzchirurgen, der nach wie vor in Seattle, Washington, lebte und arbeitete.
Auch sie hatte dort gelebt, war an einer Klinik in Seattle tätig gewesen.
Bis zu seinem Fehler. Bis er zu blutrünstig, zu begierig darauf geworden war, die eine Person zu vernichten, die alles zerstören konnte.
Er hatte versagt. Und Kacey hatte überlebt. Ihre Ehe war in die Brüche gegangen, und nach der Trennung hatte sie beschlossen, sich als Ärztin für Allgemeinmedizin in der Kleinstadt am Fuße der Bitterroot Mountains niederzulassen, wo ihre Großeltern ihr ganzes Leben verbracht hatten.
Herzergreifend. Und perfekt.
Sie hatte zwar seinen ursprünglichen Plan überlebt, war ihm so aber direkt in die wartenden Arme gelaufen.
Und diesmal würde er keinen Fehler machen, er würde das Problem endgültig aus der Welt schaffen.
Dunkel glimmender Zorn loderte durch seine Adern, als er ihr dichtes, rotbraunes Haar betrachtete, die hohen Wangenknochen, ihre vollen Lippen und die grünen Augen, die vor Intelligenz sprühten, selbst auf diesem kleinen Schnappschuss.
Er hatte sie beobachtet. War ihr gefolgt. Hatte ihren Alltag ausspioniert.
Sie wohnte in dem alten Farmhaus ihrer Großeltern, ein kleines Stück außerhalb der Stadt. Das Gebäude lag abseits der Straße am Ende einer langen, baumbestandenen Auffahrt, was die Sache sehr viel einfacher machte …
Doch sie würde warten müssen. Denn es gab andere, die vorrangig waren. Wenn er sich Kacey vorknöpfte, wollte er sich Zeit nehmen, um sicherzugehen, dass sie ihre Sünden erkannte.
Er blätterte durch weitere Ordner und sortierte sie. Die betreffenden Frauen lebten allesamt in Kaceys Nähe; keine von ihnen hatte bemerkt, dass er sie beobachtete.
Er fragte sich, ob die Frauen sich schon mal über den Weg gelaufen waren. Wenn ja, so hatten sie wahrscheinlich nicht im Traum daran gedacht, dass sie eine Gemeinsamkeit hatten: Jede von ihnen war geboren, um lange vor ihrer Zeit zu sterben.
Und es war seine Aufgabe, genau dafür zu sorgen.
Kapitel 2
Ihr Sohn oder Ihre Tochter ist heute einer oder mehreren Unterrichtsstunden ferngeblieben …«
Detective Regan Pescoli spürte, wie ihr Blut anfing zu kochen, als sie auf dem Anrufbeantworter die aufgezeichnete Nachricht von Biancas Highschool abhörte. »Und warum, zum Teufel?«, murmelte sie und drückte die Aus-Taste. Sie hatte ihre Tochter höchstpersönlich vor der Schule abgesetzt. Bianca war noch zu jung, um Auto zu fahren.
Regan wählte die Nummer von Biancas Handy und wurde mit der Mailbox verbunden. Wie sollte es auch anders sein? Keines ihrer Kinder nahm einen ihrer Anrufe direkt entgegen. Sie schrieb eine SMS: Wo bist du? Die Schule hat angerufen, du würdest blaumachen. Melde dich!
»Großartig«, brummte sie und rollte mit ihrem Schreibtischstuhl nach hinten. Nachdem sie einen Blick auf die Uhr geworfen hatte, stand sie auf und ging zu Selena Alvarez’ Arbeitsplatz im Großraumbüro des Sheriffs von Pinewood County. Ihre Partnerin hockte zusammengekauert vor ihrem Schreibtisch. Den Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt, sah sie die ordentlichen Papierstapel durch, die sich vor ihr auftürmten. Alvarez’ dichtes schwarzes Haar war zu einem dicken Knoten am Hinterkopf zusammengebunden und glänzte bläulich unter der Deckenbeleuchtung.
Als Pescoli näher kam, blickte sie auf und hob einen Finger.
»Ja, ich weiß, aber ich warte jetzt schon seit einigen Wochen auf diese Testergebnisse«, sprach sie mit fester Stimme in den Hörer, einen ungehaltenen Ausdruck im Gesicht. Wenn Alvarez eines nicht ertragen konnte, so war es Inkompetenz. »Hm-hm … ja, nun, wir sind alle unterbesetzt. Ich bekomme die Ergebnisse in … Wie bitte? Wenn das das Beste ist, was Sie tun können … einverstanden … morgen ist in Ordnung.« Sie legte auf, schäumend vor Zorn. »Wollen wir wetten, dass ich auch morgen noch nicht weiß, was in Donna McKinleys Blutkreislauf war?« Regans Partnerin lehnte sich zurück und blickte finster auf ihren Computermonitor, auf dem das Foto einer Frau zu sehen war. »Ich würde das einfach gern vom Schreibtisch haben, verstehst du?«
Pescoli verstand. Sie beide hätten gern bestätigt bekommen, dass es sich bei Donna McKinleys Tod um einen Unfall handelte, dass sie am Steuer eingeschlafen und von der Straße abgekommen war. Dass sie nicht irgendeiner schändlichen Tat ihres Ex-Knackis von Lebensgefährten, Barclay Simms, zum Opfer gefallen war, der vor gerade mal drei Wochen eine Hunderttausend-Dollar-Lebensversicherung auf Donna abgeschlossen hatte. Dabei bezog er Arbeitslosengeld.
Alvarez seufzte laut. »Entschuldige.«
»Kein Problem. Ich wollte dir ohnehin nur sagen, dass ich unterwegs bin. Muss meine Tochter aufspüren.«
»Schwänzt sie die Schule?«
»Sieht ganz danach aus«, erwiderte Pescoli kopfschüttelnd. Bis vor einem Jahr war Bianca eine hervorragende Schülerin gewesen, hatte immer die besten Leistungen erbracht und war stolz darauf gewesen. Doch dann, in ihrem letzten Jahr auf der Junior High, war es mit ihren Noten plötzlich bergab gegangen. Sie hatte versprochen, dass sich das ändern würde, wäre sie erst auf der Highschool, »wo es wirklich drauf ankam«. Doch bislang hielt sie ihr Wort nicht.
»Ich halte die Stellung«, sagte Alvarez, was in der Tat stimmte. Sie war ein echter Workaholic, der sich selten an die normalen Arbeitszeiten hielt. Pescolis Partnerin war alleinstehend und ging völlig in ihrem Job auf. Mitunter hatte Regan den Eindruck, ihre jüngere Kollegin habe keinerlei Sozialleben, was schade war. Doch heute blieb ihr keine Zeit, um darüber nachzudenken.
»Ich schulde dir was.«
Alvarez schnaubte. »Ich werde dich daran erinnern.«
Genau wie an die anderen hundert Male, dachte Pescoli, während sie sich Jacke, Schal und Mütze schnappte und aus dem Büro hinauseilte. Auf dem Weg nach draußen kam sie am Aufenthaltsraum vorbei, wo Joelle Fisher, die Empfangssekretärin des Dezernats, Schachteln voller Weihnachtsschmuck öffnete. Silberne Sterne, glitzerndes Lametta, künstliche Zuckerstangen, Lichterketten, ein sich drehender Miniaturtannenbaum und sogar ein etwas lüstern dreinblickender Santa Claus, der Pescoli noch nie ganz geheuer gewesen war, sammelten sich auf den leeren Tischen, während Joelle überlegte, wie sie das Department »ein bisschen weihnachtlich« gestalten sollte. Warum Sheriff Dan Grayson diesem Unsinn keinen Riegel vorschob, entzog sich Pescolis Verständnis. Der stets überschäumenden Joelle mit ihren kurzen blonden Locken, den riesigen Ohrringen und den Zehn-Zentimeter-Absätzen schien nicht aufzufallen, dass ihre Kollegen dem Geist der Weihnacht nicht mit derselben Überzeugung und Begeisterung anhingen wie sie.
»He, Regan!«, rief Joelle ihr hinterher. Pescoli blieb stehen, warf einen Blick in den Aufenthaltsraum und stellte fest, dass Joelle bereits eine Rudolph-Brosche mit blinkender roter Nase trug. »Du weißt doch sicher, dass wir Montag früh auslosen, wer wen beim Wichteln beschenkt, oder?«
»Und du weißt sicher, dass es bis Weihnachten noch über sechs Wochen sind.«
»Das geht schneller, als du denkst«, entgegnete Joelle gelassen. »Nächsten Dienstag ist schon Thanksgiving, und warum sollten wir die festliche Zeit nicht so lange genießen wie möglich?«
»Weihnachten im Juli? Ohne mich!«
»Jetzt sei doch nicht so eine Spielverderberin!«, schmollte Joelle, doch ihre Mundwinkel zuckten. »Am Montag um acht. Du kommst, oder?«
»Mit Glöckchenklang, klingelingeling«, brummte Pescoli. Sie konnte wahrhaftig keinerlei wie auch immer geartete weihnachtliche Gefühle aufbringen, solange sie nicht wusste, wo ihre Tochter steckte.
»Schlittenglöckchenklang, wenn ich bitten darf!« Joelle kicherte über ihren eigenen Scherz und wandte sich glücklicherweise wieder dem Aufenthaltsraum und ihrer Weihnachtsdekoration zu.
Verrückt, dachte Pescoli, während sie die Außentüren am Ende des Gangs aufdrückte und einen schmalen Weg entlanghastete, der die spröde Grasfläche durchschnitt. Hätten die vereinzelten kleinen Schneeflächen sie nicht daran erinnert, dass es in West Montana bereits Winter war, dann hätte es mit Sicherheit der eisige Wind getan, der an der Kette der Fahnenstange riss.
Am Jeep angekommen, stieg sie ein und ermahnte sich, nicht nach der Schachtel Marlboro Lights zu suchen, die sie »für den äußersten Notfall« im Handschuhfach versteckte. Offiziell hatte sie im vergangenen Januar mit dem Rauchen aufgehört, nachdem ein gemeingefährlicher Irrer sie beinahe umgebracht hatte, doch ab und zu, wenn es einfach zu hart kam, steckte sie sich heimlich eine an. Und sie hatte sich geschworen, dass sie deswegen kein schlechtes Gewissen haben würde.
Dass ihre Tochter blaumachte, war kein Notfall, der sie zur Zigarette greifen ließ, aber der Tag war noch nicht vorbei. Womöglich steckte Bianca in Schwierigkeiten. Bei ihrer Arbeit bekam Regan genug Schreckliches zu Gesicht – Opfer grauenhafter Unfälle, ausrastende Ehemänner, durchgeknallte Psychopathen –, aber sie verdrängte, was alles passiert sein könnte, stellte die Automatik auf R und wartete, bis Cort Brewster, der stellvertretende Sheriff, hinter ihrem Jeep vorbeigerollt war. Brewster und sie waren sich noch nie ganz grün gewesen, und schon gar nicht, seit Regans Sohn Jeremy mit Brewsters kleiner Prinzessin Heidi zusammen war und Jeremy für jedes noch so kleine Problem verantwortlich machte, das Heidi betraf.
»Dass ich nicht lache«, murmelte Pescoli und setzte, ohne Brewster zu grüßen, aus der Parklücke. Ihrer Meinung nach war der Kerl ein arroganter Heuchler, und sie betete inbrünstig, dass sie nicht seinen Namen zog, wenn Joelle am Montag ihre alberne Wichtelauslosung veranstaltete. Loszugehen und nette kleine Geschenke für ihn zu kaufen, die sie dann in seinem Schreibtisch oder Wagen versteckte, war mehr, als sie ertragen konnte.
Oder war sie einfach nur kleinlich? Regan konzentrierte sich auf den Verkehr und versuchte erneut, ihre Tochter anzurufen. Der Anrufbeantworter meldete sich. Natürlich. »Komm schon, Bianca, geh dran«, drängte sie.
Obwohl es nicht mal Abend war, wurde es bereits dunkel.
Sie rief zu Hause an, wo sie immer noch einen Festnetzanschluss hatten. Es klingelte viermal, dann wurde der Hörer abgenommen. »Hallo?«, meldete sich ihr Sohn gleichgültig, und Pescoli, die vor einer roten Ampel abbremste, verspürte für einen kurzen Augenblick Erleichterung. Wenngleich sie sich wunderte, was Jeremy, der im Sommer ausgezogen war, zu Hause machte, doch dafür war jetzt keine Zeit. Noch nicht.
»Hier spricht Mom. Ist Bianca da?«
»Ja.«
Gott sei Dank. »Ist alles in Ordnung mit ihr?«
»Ähm … ja, ich denke schon.«
»Hol sie ans Telefon.«
»Sie schläft.«
»Das ist mir egal!«
»Verdammt, du musst doch nicht gleich schreien!«
»Und du musst nicht fluchen.«
»Na schön, ich geh ja schon.«
Die Ampel sprang auf Grün. Als sie Richtung Boxer Bluff fuhr, einem ziemlich steilen Berg, auf dem der obere Teil der Stadt lag und an dessen Hängen sich die Besserbetuchten von Grizzly Falls niedergelassen hatten, hörte sie gedämpfte Stimmen, bis sich ihre Tochter endlich mit einem verschlafenen »Ja?« meldete.
»Was ist los?«, fragte Pescoli scharf.
»Was soll schon los sein?«, fragte Bianca zurück.
»Die Schule hat angerufen, um mir mitzuteilen, dass du nicht zum Unterricht erschienen bist.«
»Es ging mir beschissen.«
»Schlecht«, korrigierte Pescoli automatisch, während sie auf die Straße einbog, die aus der Stadt hinausführte. »Es ging dir schlecht.«
»Wie auch immer.«
»Wie bist du nach Hause gekommen?«
»Mit Chris.«
Er war Biancas Immer-mal-wieder-Freund. »Er hat keinen Führerschein.«
»Sein Bruder Gene hat uns gefahren.«
Der Siebzehnjährige war bereits in einen Totalschaden verwickelt gewesen. Pescoli wusste alles darüber, hatte gesehen, was von dem Honda Accord, Baujahr 1990, übrig geblieben war, nachdem dieser zunächst gegen einen Briefkasten, dann gegen einen Baum geprallt war. Es war ein Wunder, dass der Junge überlebt hatte und mit einem gebrochenen Schlüsselbein sowie ein paar Kratzern davongekommen war. »Ich bin auf dem Weg nach Hause. Wir unterhalten uns später.« Sie sah in den Rückspiegel, dann wechselte sie die Spur, um Bauarbeitern auszuweichen, die dabei waren, die Straße aufzureißen.
»Ich habe mich schon mit Dad ›unterhalten‹.«
Noch mehr gute Nachrichten. »Und was hat dein Vater gesagt?«, fragte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Luke »Lucky« Pescoli war kaum der Inbegriff eines elterlichen Vorbilds.
»Ich solle mich ausruhen.«
Wunderbar. »Ich bin in fünfzehn Minuten da. Jetzt hol mir deinen Bruder ans Telefon.«
»Sie will dich sprechen.« Biancas Stimme klang, als sei sie glücklich, den Hörer an Jeremy zurückgeben zu können.
Wieder überlegte Pescoli, ob sie sich doch eine anstecken sollte, aber entschied sich dagegen. Mittlerweile wichen die Geschäfte an der Straße Wohnhäusern.
»Hm?«, meldete sich ihr Sohn.
»Ich frage mich, was du daheim machst?« Als er diesen Sommer ihr kleines Haus in den Hügeln gut fünf Meilen außerhalb von Grizzly Falls verlassen hatte, war sein Auszug sowohl ein Segen als auch ein Fluch gewesen.
»Ähm … ich bin hier doch zu Hause?«
»Du bist ausgezogen. Ich hatte dich nicht darum gebeten, du selbst hast darauf bestanden«, erinnerte sie ihn. »Ich dachte, du wärst bei der Arbeit.«
»Sie haben das Gas in meiner Wohnung abgestellt. Die Heizung funktioniert nicht. Ich schätze, der Scheck ist nicht rechtzeitig angekommen, dabei hab ich ihn gestern abgeschickt. Es ist schließlich nicht meine Schuld, dass einer meiner Mitbewohner das Geld nicht rausgerückt hat.«
»Und dein Job?«, fragte sie geduldig.
Zögern. »Lou braucht mich heute nicht an der Tankstelle.«
»Tatsächlich?« Seit neun Monaten arbeitete Jeremy als Tankwart bei Corky’s Gas and Go, während er überlegte, ob er doch noch weiter zur Schule gehen sollte. »Jeremy?«, hakte Regan nach, als er nicht gleich antwortete. »Sag mir einfach, dass du deinen Job nicht los bist.«
»Okay.« Er klang abwehrend. Kurz angebunden.
Verdammt noch mal. Wenn nur Joe noch am Leben wäre! Jeremys Vater, ebenfalls ein Cop, hatte in Krisensituationen stets großartig reagiert. Bis er während des Dienstes ums Leben gekommen war. Sein Sohn war noch zu jung gewesen, um sich wirklich an seinen Vater zu erinnern. Also war Pescoli dem Jungen Mutter und Vater zugleich gewesen, doch dann hatte sie den Fehler gemacht, Luke zu heiraten, der zwar versucht hatte, Joe zu vertreten, was aber komplett schiefgegangen war.
»Warte auf mich. Ich bin gleich zu Hause. Und würdest du vorher bitte dafür sorgen, dass Cisco sein Abendessen bekommt?«
»Wir haben kein Hundefutter mehr.«
»Dann kauf welches.«
»Ich, ähm, ich habe kein Geld.«
»Na fabelhaft.«
»Ich muss auflegen. Heidi hat mir gerade eine SMS geschickt.«





























