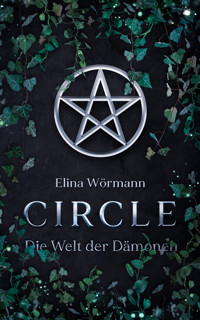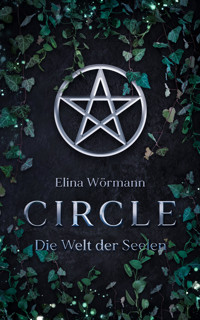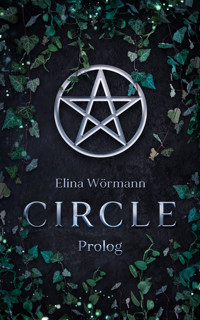Zwischen dem Nebel
Elina Wörmann
Impressum © 2025 Elina Wörmann
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter:Elina Wörmannc/o WirFinden.EsNaß und Hellie GbRKirchgasse 1965817 EppsteinLektorat:Lektorat Lynxwww.lektorat-lynx.deUmschlaggestaltung und Illustrationen:inspirited books Grafikdesignwww.inspiritedbooks.atNacho Illustration:Jana Stehrwww.janastehr.art
Kapitel 1
Eine feine Schneeschicht bedeckte die gepflasterten Straßen der Stadt; legte sich auf die Dächer der traditionell gehaltenen Natursteinhäuschen, die allesamt wunderschöne Fassaden aufwiesen.
Sie waren graugemauert, doch jede Tür war in einem kunstvollen Bogen eingefasst und lud geradewegs dazu ein, die dahinterliegenden Geschäfte, Restaurants, oder Galerien zu betreten. Fensterläden mit unterschiedlichsten Musterungen schmückten das Gestein und unter fast jedem dieser Fenster hingen Blumenkästen, in denen immergrüne Pflanzen blühten – darunter auch winzige, liebevoll dekorierte Tannenbäume.
Die Krönung dieses Anblicks stellten allerdings die Lichterketten und Zweige dar, die zwischen den flachen Dächern der Gebäude gespannt worden waren und die Weihnachtszeit ankündigten. Ihr Leuchten schimmerte zwischen dem Schneegestöber hindurch und tauchten die Stadt in einen geradezu märchenhaften Mantel der Harmonie. Dem hinzu gesellte sich heiteres Stimmengewirr, das aus einigen offenen Fenstern und Türen auf die Straße hinausdrang und den frühen Abend zum Leben erweckte.
Voller Faszination betrachtete Sara die vielen Details, die sich ihr boten. Fast suchte sie nach einem Makel, aber selbst die rustikalen Straßenlaternen und die verzierten Gullydeckel fügten sich mit einer Eleganz in das Stadtbild, dass sie den Anblick in keiner Weise störten.
Alles hier war perfekt, mit Ausnahme einer winzigen Kleinigkeit: Es war arschkalt.
In Strickpulli, Jeans und Turnschuhen ließen sich die winterlichen Temperaturen nur schwer ertragen, und genau diese Dinge trug Sara. Vorhin, als die Sonne noch am Himmel gestanden hatte, war die Kälte gut auszuhalten gewesen. Doch jetzt, da die Dunkelheit hereingebrochen war, blieb ihr nichts anderes übrig, als sich die Ärmel ihres Pullis über die Finger zu ziehen, damit diese nicht zu Eisklumpen gefroren. Außerdem hatte sie ihren Zopf geöffnet, um ihre Ohren zu schützen.
Beides half kaum.
Somit blieb ihr nichts weiter, als sich in regelmäßigen Abständen in die Hände zu hauchen und einen Weg zurückzufinden.
Zurück nach Hause.
Die Welt, in der sie sich befand, war nicht ihre. Und wenn sie ehrlich war, verstand sie nicht einmal, wie sie überhaupt hergekommen war. Sie bezweifelte sogar, hier sein zu dürfen; in einer Welt, deren Existenz sie nur aus Geschichtsbüchern kannte.
Deswegen hatte sie sich bisher auch nicht getraut, jemanden auf ihre missliche Lage anzusprechen.
Deswegen, und weil sie kein Wort von dem verstand, was die Leute hier sprachen. Alle Gesprächsfetzen, die sie aufschnappte, kamen ihr spanisch vor. Nur war es kein Spanisch, so viel wusste sie.
Im Licht einer Straßenlaterne, neben einem eidechsenartigen Wasserspeier, der an diesem kalten Abend kein Wasser mehr spuckte, blieb Sara letztlich stehen.
Verzweifelt.
Sie hatte Durst, aber außer ihrer Kamera und ihrem Handy nichts dabei, und diese Dinge halfen ihr gerade eher weniger. Hätte sie geahnt, dass sie sich nach am Ende ihres Spaziergang in einer anderen Welt wiederfinden würde, hätte sie wenigstens Bargeld mitgenommen. Wobei das wahrscheinlich keine Gültigkeit besaß.
Fröstelnd friemelte Sara ihr Handy aus der Hosentasche und starrte auf den Bildschirm. Kein Empfang, wie schon die letzten hundert Male. Es würde sie wundern, mal ein anderes Bild zu sehen.
Ein frustriertes Seufzen entfuhr ihr, als sie sich gegen die Hauswand lehnte und den Weg zurückblickte, den sie gekommen war. Es half nichts, sie musste mit jemandem sprechen. Nur waren kaum Leute unterwegs und ein jeder erschien ihr weniger hilfreich als der andere.
Einen Augenblick lang betrachtete sie das Paar, das eng umschlungen von ihr weg schlenderte und alle paar Meter stehen blieb, um intensive Küsse auszutauschen.
Schnell entschied sie, die beiden nicht zu stören.
Stattdessen wanderte ihr Blick zu der kleinen Gruppe, die sich vor einem der Restaurants zusammengefunden hatte. Sie schienen nett, nur fehlte Sara der Mut, gleich mehrere Leute auf einmal anzusprechen.
Blieb nur noch die Mutter, die kläglich versuchte, ihr Kind zu beruhigen, das im Kinderwagen lag und bitterlich weinte. Ebenfalls keine gute Idee. Die Frau hatte sicher keine Nerven für eine verirrte Studentin, die sich nicht einmal anständig verständigen konnte.
Sara schlang die Arme um ihren Körper und betrachtete ihre letzte Option, die sie eigentlich nicht als solche angesehen hatte: einen Mann, der schnellen Schrittes die Straße entlang marschierte, ohne seiner Umgebung nur einen Hauch von Aufmerksamkeit zu schenken.
Sie schluckte.
Suspekt erschien er ihr nicht, allerdings überragte er sie um einen ganzen Kopf und sein Gang sowie seine ernste Miene sprachen Bände darüber, wie eilig er es hatte. Stünde Sara nicht kurz vor dem Erfrieren, würde sie länger auf eine geeignete Gelegenheit warten. So hingegen blieb ihr kaum eine andere Wahl, als sich von der Wand zu lösen und auf den Mann zuzugehen.
»Entschuldigung?«
Er blieb stehen. Mit einer Miene, die aussah, als wolle er ihr im nächsten Moment den Kopf abreißen.
Sarah rutschte das Herz in die Hose.
»I-ich brauche Hilfe«, stammelte sie. »Ich habe mich verlaufen und weiß nicht wie–« Weiter kam sie nicht.
Die ohnehin finsteren Gesichtszüge des Mannes verhärteten sich mit jedem Wort, das sie über die Lippen brachte – und dann brüllte er sie an.
Worte, die Sara unmöglich verstehen konnte, flogen ihr in einer Lautstärke entgegen, die sie zurücktaumeln ließ.
Er folgte ihr.
Erst einen Schritt, dann zwei, ohne mit seinen wüsten Beschimpfungen aufzuhören. Seine Hände fuchtelten dabei so wild durch die Luft, dass Sara befürchtete, sie würden gleich in ihrem Gesicht landen.
Sie fuhr herum.
Wie von selbst setzten ihre Füße sich in Bewegung.
So schnell wie die glatten Steine unter ihren Sohlen es zuließen, sprintete sie die Straße hinunter. Vorbei an dem Paar, das sich erschrocken zu ihnen umdrehte, und vorbei an der Mutter, die das Schauspiel entsetzt beobachtete.
Sara hingegen beachtete keinen von ihnen.
Sie schlitterte um die nächste Kurve, stolperte einige Stufen hinab und folgte von dort an jeder Abzweigung, die sie finden konnte. Immer tiefer führte ihr Weg sie in das Gewirr aus schmalen und breiten, dunklen und hellen Gassen. Plätze mit Brunnen und Plastiken, Steintischen und Treppen zogen an ihr vorüber, bis sie in einer Kreuzung endgültig den Halt verlor. Ein Stechen durchzog ihre Hüfte und ihren Ellenbogen, als sie der Länge nach auf dem Gehweg landete – irgendwo in der Einsamkeit, mittig zwischen drei der immer gleichaussehenden Gassen und einer Treppe, die sich endlos weit in den schwarzen Nachthimmel zu erheben schien.
Keuchend rappelte Sara sich auf.
Ihre Lunge brannte vor Kälte und Anstrengung, und auf ihrer Zunge lag der Geschmack von Eisen. Sie sah sich um, doch ihr Verfolger war nicht zu entdecken.
Erleichtert schleppte sie sich zur Treppe, wo sie sich auf eine der Stufen niederließ. Sie lehnte sich an das steinerne Geländer, schlang die Arme um ihren Körper und legte den Kopf in den Nacken; blickte hinauf zu den Sternen, die ihr allesamt bekannt vorkamen.
Als sie klein war, hatte ihr Vater ihr jede erdenkliche Konstellation gezeigt. Sie war fasziniert gewesen. Wie ein Schwamm hatte sie jede Information darüber aufgesaugt und so fiel es ihr selbst heute, viele Jahre später, leicht, die Sternenbilder zu benennen. Und hier, in der fremden Welt, fand sie jedes einzelne davon wieder. Die Sprache und die Ortschaften waren vollkommen anders, aber der Himmel war derselbe wie zu Hause.
Wie konnte das sein? Sara wusste es nicht.
Sie hatte keine Antwort auf die Frage.
Vielleicht hätte sie eine, wenn sie damals im Unterricht aufgepasst hätte, aber in der siebten Klasse hatte man Besseres zu tun, als seinen Lehrern zuzuhören.
Sie hob den Arm und wischte sich die Tränen aus den Augen, die ihr Wind und Panik hineingetrieben hatten. Dabei lauschte sie der Stille. Wo auch immer sie war, der Ort war menschenleer. Wenn sie sitzen blieb, würde sie keine Möglichkeit mehr bekommen, Hilfe zu finden. Wobei sie sich nach der heftigen Reaktion des Fremden ohnehin nicht sicher war, ob sie sich noch einmal traute, jemanden anzusprechen.
Aber was blieb ihr sonst?
Länger hierzubleiben war keine gute Idee. Durch den Sturz hatte ihre Kleidung sich mit nassem Schnee vollgesogen und nun lag der Stoff eisig auf ihrer Haut. Die Kälte war ihr längst bis in die Knochen gekrochen und sie zitterte am ganzen Körper.
Also hatte sie keine andere Wahl.
Sie musste mit jemandem reden, denn sie würde niemals den Wald wiederfinden, aus dem sie hergekommen war. Dort hätte immerhin noch die Chance bestanden, dass der Nebel, durch den sie ursprünglich hier gelandet war, sich ihr ein zweites Mal zeigte.
Obwohl es ihr unwahrscheinlich vorkam.
Der lilafarbene Schleier hatte sich gleich nach ihrem Durchqueren in Luft aufgelöst, und wer wusste schon, ob er aus eigener Kraft heraus entstand.
Ganz abgesehen davon reichte es bestimmt nicht aus, den Wald zu erreichen. Sie müsste sich bis zur Felsformation vorarbeiten, und das war angesichts der Finsternis schier unmöglich. In dem Unterholz würde sie sich höchstens das Genick brechen.
Blieb ihr nur die Hoffnung, von einer freundlichen Person aufgelesen zu werden.
In ihrer Angst war sie blind drauflosgelaufen. Immer tiefer in das Labyrinth aus immer gleich aussehenden Häusern und Gassen hinein, das sie eigentlich gar nicht hatte betreten wollen. Fensterläden, Blumenkästen, Lichterketten – wohin sie auch blickte, überall zeigte sich ihr dasselbe Bild, und die Gebäude überwiegend Wohnhäuser zu sein schienen, war niemand unterwegs.
Sollte sie einfach an einer der vielen Türen klopfen?
Sara ließ ihr Kinn auf die Knie sinken und starrte auf den verschneiten Boden. Eine andere Lösung fand sie nicht.
Verzweiflung nistete sich in ihrem Brustkorb ein.
Wie lange mochte sie schon hier sein?
Drei Stunden? Vier?
Sie hatte keine Ahnung.
Zu lange war sie durch den Wald geirrt. Der Himmel hatte sich allmählich rot gefärbt, weshalb sie sich überhaupt erst beeilt hatte, eine Stadt zu finden. Andernfalls wäre sie einfach zu den Felsen zurück gegangen und hätte darauf gewartet, dass der Nebel zurückkehrte.
Wie lange dauerte es wohl, bis man erfror?
Bis vorhin hatte sie sich keine Gedanken über diese Frage gemacht. Im Gegenteil. Dieser Ort hier hatte ihr so sehr gefallen, dass sie sich überhaupt keine Gedanken gemacht hatte. Vielmehr war sie damit beschäftigt gewesen, jeden Meter ihres Weges zu fotografieren. Zu schön war das Schneegestöber und zu anders der Wald ihr vorgekommen. In völliger Stille, ohne Hinweise auf Tiere oder nahe gelegene Zivilisation. Bis plötzlich diese wunderbare kleine Stadt aufgetaucht war…
Hätten ihre Finger sich nicht von ihr verabschiedet, hätte sie ewig weiterfotografieren können.
Sie schloss die Augen.
Ihr war klar, dass sie langsam aufstehen musste, doch so sehr sie auch darüber nachdachte, sie tat es nicht.
Ob das ihr Ende war? Erfroren in einer fremden Welt, nachdem sie einen winzigen Blick auf die herrliche Hülle ihrer Geheimnisse erhaschen durfte?
Ein schöner, wenngleich schmerzhafter Gedanke, der durchbrochen wurde von gehetzten Schritten, die geradewegs in ihre Richtung eilten.
»Nacho!«
Sara hob den Kopf in dem Moment, in dem der Mann an ihr vorbeilief, der das einzige Wort gerufen hatte, das ihr in dieser Welt bekannt vorkam. Es war nicht das, was sie in einer solchen Situation erwartet hätte, aber besser als nichts.
Sie starrte ihn an, wie er an ihr vorbeihastete.
»Hilfe.« Das Wort kam über ihre Lippen, bevor sie es selbst realisierte. Es war leise, aber reichte aus. Schlitternd kam der Mann auf den Stufen zum Stehen und drehte sich zu ihr um.
Seine Augen weiteten sich.
Sara hörte, wie er etwas vor sich hin murmelte und im nächsten Augenblick stand er direkt vor ihr. In Windeseile hatte er seine Jacke ausgezogen und über ihre Beine gelegt. Dabei redete er unentwegt auf sie ein, in dieser fremden Sprache, die sie nicht verstand.
War das, was sie gehört hatte, Einbildung gewesen?
Ein Streich ihres Gehirns?
Ein Wunsch?
Oder Zufall?
Abermals sammelten sich die Tränen in ihren Augen. Schneller, als Sara sie wegblinzeln konnte.
»Ich verstehe dich nicht«, schluchzte sie und vergrub das Gesicht in der warmen Jacke. Ihre letzte Hoffnung darauf, diese Welt verlassen zu können, starb. Sie krallte sich in den wärmenden Stoff, weil sie damit rechnete, dass der Fremde ihn ihr gleich wieder vom Körper riss, so wie der vorherige Kerl es vermutlich getan hätte.
Genauso rechnete sie damit, erneut angebrüllt zu werden; ohne die Möglichkeit zur Flucht. Ihre Beine waren steif vor Kälte und plötzlich war Sara sich nicht mehr sicher, ob sie überhaupt noch aufstehen konnte.
»Du bist nicht von hier?«
Saras Tränen verschwanden genauso schnell, wie sie gekommen waren, und für eine Sekunde schien es, als würde ihr Körper innehalten. Ihr Herz stockte, ebenso ihr Atem und ihre düsteren Gedanken.
Deutsch.
Der Mann sprach Deutsch.
Offenbar nicht als Muttersprache, denn sein Akzent war nicht zu überhören, aber welche Rolle spielte das?
Sie schaute auf. »Du … sprichst Deutsch?«, wiederholte sie ihre Gedanken.
»Ein wenig«, erwiderte der Mann.
»Oh, Gott sei Dank!«
Wieder entfuhr Sara ein Schluchzen, dieses Mal vor Erleichterung. Die alleinige Anwesenheit des Fremden reichte aus, um ihr einen riesigen Felsen vom Herzen zu nehmen.
»Ich brauche Hilfe.«
»Das sehe ich.« Der Fremde lächelte, doch in seinen Augen lag Sorge. »Komm. Ich bringe dich ins Warme.«
Behutsam legte er seine Hand auf Saras Oberarm, um ihr aufzuhelfen. Ihre Knie protestierten, aber sie biss die Zähne zusammen und zwang ihren Körper zur Mitarbeit. Unter keinen Umständen würde sie sich jetzt von ein paar tiefgefrorenen Gelenken und Knochen davon abhalten lassen, diese Eiseskälte und hoffentlich auch diese Welt zu verlassen.
Genauso wie der Fremde ihr beim Aufstehen half, half er ihr auch, seine Jacke anzuziehen. Sie war etwas zu klein, weshalb Sara sie offenließ, dennoch schützte sie schon nach kurzer Zeit vor dem winterlichen Wetter und nahm ihr mit jedem Meter die Reste ihrer Verzweiflung.
»Tut mir leid«, brachte sie deshalb hervor, nachdem sie einige Minuten schweigend durch die engen Gassen spaziert waren, in denen der Fremde sich bestens auszukennen schien. »Dass ich dich aufhalte, meine ich.«
»Keine Sorge. Ich hatte eh nichts Wichtiges vor.«
»Es schien so …«
»Mein Haustier ist abgehauen.« Er hielt eine Leine hoch, die er die ganze Zeit über zusammengerollt in der Hand gehalten hatte. »Aber schon okay. Sie kennt den Weg zurück.«
»Was für ein Haustier hast du?« Sara nahm die Hände aus den Jackentaschen schlang die Arme um sich. Noch hatte sie nicht ganz herausgefunden, auf welche Weise sie ihre Körperwärme am ehesten bei sich behielt.
»Ein Drache.« Ein stolzer Ausdruck erschien auf dem Gesicht des Mannes.
Sie waren ungefähr gleich groß und alt, und auch wenn es bescheuert war, sich nur auf diese Eigenschaften zu verlassen, ging Sara allein deswegen nicht davon aus, dass der Fremde ein Serienmörder war. Dennoch fiel es ihr schwer, ihm seine Antwort abzunehmen.
»Ein Drache?«, wiederholte sie.
»Es mag für euch Menschen schwer vorstellbar sein, aber hier sind Drachen gewöhnliche Haustiere.«
Ganz langsam nickte Sara, während sich in ihrem Kopf eine ganze Diashow an Bildern von feuerspeienden Riesenechsen abspielte. Im Anbetracht der Häuser zweifelte sie stark daran, dass Drachen darin einen geeigneten Schlafplatz finden konnten, und Gärten hatte sie noch keine gesehen. Trotzdem entschied sie sich, zu schweigen. Sollte dieser Mann die Wahrheit sagen, würde sie sich noch früh genug von seinen Worten überzeugen können. Andernfalls konnte sie froh sein, wenn er nur ein notorischer Lügner war und nichts Schlimmeres.
Kapitel 2
»Da sind wir«, verkündete der Fremde, nachdem sie eine Weile schweigend durch die Gassen geschlendert waren, wobei er unentwegt den Himmel abgesucht hatte. Nun hingegen klebte sein Blick an dem pelzigen Wesen, das sich auf der Fußmatte vor einer der Haustüren zusammengerollt hatte. »Und das ist Nacho.«
Bei der Nennung seines Namens hob das Wesen den Kopf. Spitze Ohren und schwarze Knopfaugen richteten sich auf sie.
»Das ist ein Drache?« Ungläubig starrte Sara auf das Tier, das größentechnisch höchstens mit einer gewöhnlichen Hauskatze mithalten konnte.
»Jep.« Der Fremde streckte die Hand nach der Klinke aus und öffnete die Tür.
Sofort sprang das Wesen auf und stürmte ins Innere des Hauses, wodurch Sara einen besseren Blick auf den kleinen Körper erhaschte. Sah man von den spitzen Ohren und den Flügeln ab, könnte es glatt als Frettchen durchgehen.
Sie entschied, das Tierchen nicht als Drachen zu bezeichnen. Trotzdem würde sie es nur zu gerne streicheln, denn niedlich war es allemal.
Eine andere Meinung akzeptierte sie nicht.
Mit diesen Gedanken trat sie über die Türschwelle ins Wohnzimmer. Der Fremde leitete sie von dort geradewegs hindurch in die Küche, die auf der gegenüberliegenden Seite lag. Mehr Räume gab es nicht, allerdings führte eine Wendeltreppe nach oben und ließ Sara vermuten, dass sich dort weitere Zimmer befanden.
»Bitte, setz dich.« Der Mann zog einen Stuhl von dem rechteckigen Holztisch und bedeutete Sara, Platz zu nehmen, ehe er die gläserne Tür eines Ofens öffnete. Ohne Umschweife legte er die bloße Hand auf die Holzscheite und binnen Sekunden stiegen erste Flammen zwischen seinen Fingern empor.
Mit offenem Mund starrte Sara auf das Feuer, aus dem der Mann eilig seine Hand zurückzog.
»Du … bist ein Magier«, brachte sie hervor.
Sie hätte sich denken können, dass der Mann kein gewöhnlicher Mensch war. Dennoch überkam die Furcht sie erst jetzt und wurde glücklicherweise umgehend von Erleichterung abgelöst. Ein Magier war definitiv besser als die blutsaugende Alternative, aber wohler fühlte sie sich damit nicht.
»Ja.« Der Magier platzierte seine Hände auf ihren Schultern und drückte vorsichtig auf den Stuhl, auf den sie sich noch immer nicht gesetzt hatte. Dabei lächelte er. »Aber keine Sorge, wir sind freundlich … meistens zumindest. Ich heiße Tobi und du?«
»Sara.«
Sie ließ ihre Kameratasche von der Schulter rutschen und stellte sie zu ihren Füßen ab. Ihr Wissen über Magier war begrenzt. Erzählungen dienten ihr als Quelle und diese waren nicht immer verlässlich. Somit wusste sie nur, dass Magier sich lieber um den Kram in ihrer Welt kümmerten und die Geschehnisse der menschlichen Gegenwart gekonnt ignorierten.
»Freut mich, dich kennenzulernen, Sara.« Mit einem Augenzwinkern wandte er sich der Arbeitsfläche zu und griff nach einem kleinen Gerät, das einem Handy ähnelte. Was wahrscheinlich daran lag, dass es eines war.
»Bin gleich wieder bei dir. Die Gesetze besagen, dass ich dich melden muss.«
»Melden?« Sara sprang auf, wurde aber sogleich von ihren müden Gliedern zurück auf den Stuhl gezwungen. Bisher war die Wärme angenehm gewesen, aber allmählich fühlte ihre Haut sich an, als würde sie brennen, und dem Rest ihres Körpers ging es nicht besser. »Bitte, ich möchte keinen Ärger. Nur nach Hause!«
»Hmm …« Tobi musterte sie mit zusammengekniffenen Lidern. »Hast du absichtlich ein Portal erschaffen und bist hergekommen, um den Frieden unserer Welt zu stören?«
»Was? Nein! Natürlich nicht!«
»Dann brauchst du dir keine Gedanken machen.« Ein belustigtes Funkeln spiegelte sich in Tobis Augen. »Du bist ein Mensch. Du solltest nicht hier sein. Deswegen bin ich verpflichtet, deine Anwesenheit den Großmagiern zu melden. Aber dir wird nichts passieren, das verspreche ich.«
Voller Unglauben starrte Sara den Magier an. Dass er sie melden musste, war eine Tatsache, mit der sie sich abfinden konnte. Aber an einen Großmagier?
Von Großmagiern hatte Sara noch weniger Ahnung als von gewöhnlichen Magiern, aber selbst sie war sich im Klaren darüber, dass diese von allen menschenähnlichen Wesen die mächtigsten waren. Dazu skrupellos, wenn man den Beschreibungen ihrer Geschichtslehrer glauben konnte.
»Muss das sein?«, hakte Sara vorsichtig nach. Der stillen Hoffnung erlegen, Tobi würde einen anderen Weg finden.
»Ja. Und wie der Zufall es will, kenne ich einen.«
»Du kennst einen Großmagier?« Saras Hoffnung fiel ins Bodenlose.
Tobi lachte. Offensichtlich amüsierte ihn ihre Unwissenheit sehr. »Klar. Ein Großmagier zu werden, ist eine Ehre und der ultimative Beweis der Loyalität zu unserer Welt. Viele Magier entscheiden sich für diesen Weg.«
Wenig beruhigt von dieser Information, ließ Sara sich gegen die Lehne ihres Stuhls sinken. Sie ahnte, weshalb es ein beliebtes Ziel war, zum Großmagier aufzusteigen.
»Dann … willst du auch einer werden?«
»Ich? Nein. Jetzt entschuldige mich, wir sollten nicht länger warten. Nimm dir gerne ein paar Kekse, du musst hungrig sein.« Er deutete auf einen Teller mit selbstgebackenen Plätzchen, der mittig auf dem Küchentisch stand, und ging dann ins angrenzende Wohnzimmer.
Sara sah ihm nach. Durch eine Durchreiche konnte sie mühelos beobachten, wie Tobi auf dem Handy herumscrollte und es sich schließlich ans Ohr hielt.
Ein Anblick, der sie tatsächlich ein wenig enttäuschte. Sie hatte sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie Magier über Distanzen miteinander kommunizierten; hätte man sie allerdings gefragt, wäre sie vielleicht von Kristallkugeln ausgegangen. Oder von Spiegeln. Halt von irgendetwas, das die Magie aufrechterhielt. So hingegen erstarb die magische Stimmung, bis Tobi das Gespräch aufnahm. Es reichte ein einziges Wort, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken und ihr die Erkenntnis wie Schuppen von den Augen fallen zu lassen: »Salve, Luc …«
Latein.
Der Kerl sprach Latein.
Echtes, altes Latein.
Nicht nur er, überall war Latein. Auf allen Schildern, die sie auf dem Weg hierher gesehen und in jeder Unterhaltung, die sie aufgeschnappt hatte. Sie war sogar auf Latein angebrüllt worden. Die ganze Stadt, wenn nicht sogar die ganze Welt, kommunizierte in einer Sprache, von der sie geglaubt hatte, dass sie längst ausgestorben war.
Sie schüttelte den Kopf. Wenn sie das ihrer besten Freundin erzählte …
Das Telefonat war kurz und Tobi guter Laune, als er zurück in die Küche kam.
»Lucien kommt gleich«, sagte er, während er einen Edelstahlnapf vom Boden nahm, ihn auf die Arbeitsfläche stellte und anschließend das Eisfach öffnete, das sich gleich unter dem Kühlschrank befand.
Wie zu Hause.
Es beruhigte Sara, dass nicht alles in dieser Welt anders zu sein schien. Was sie hingegen beunruhigte, war, dass sich Tobis Miene mit einem kurzen Blick in besagtes Eisfach verdunkelte.
»Alles gut?«, traute sie sich auf ein paar gemurmelte Worte seinerseits hin zu fragen.
»Ich habe kein Fleisch mehr.« Sichtlich unzufrieden warf Tobi die Tür zu. »Kann ich dich für einen Moment alleine lassen? Nacho braucht Futter und die Läden machen gleich zu.«
»Klar.« Sara hatte absolut nicht vor, sich auch nur einen Meter vor die Tür zu bewegen, jetzt, da ihr Körper langsam auftaute. Immerhin gab es bedeutend Schlimmeres, als ein paar Minuten alleine in einem fremden Haus zu verbringen – obgleich sie sich die Räumlichkeiten mit einem geflügelten Frettchen teilen musste.
»Danke. Es dauert auch nicht lange.«
Noch während Tobi sprach, schnappte er sich seine Jacke, die Sara in der Zwischenzeit über einen der Stühle gehängt hatte, und eilte zur Tür. »Öffne bitte die Tür, wenn es klingelt! Das wird Lucien sein!«, rief er ihr noch zu, dann war er verschwunden.
Sara sah ihm nach, bis die hölzerne Haustür zu fiel. Da war er also, der Haken, der ihr Herz schneller schlagen ließ. Sie schaute zu dem Frettchen, das auf der Arbeitsplatte saß und ungeduldig mit dem Schwanz schlug.
»Ist dieser Lucien nett?«, fragte sie an das Tierchen gewandt. Wie erwartet, erhielt sie keine Antwort. Nur einen Blick aus neugierigen Knopfaugen, von denen sie nicht sagen konnte, wie viele Gehirnzellen sich dahinter verbargen.
Waren Drachen intelligent?
Laut Filmen ja, aber denen traute sie mit jeder vergehenden Minute weniger.
Seufzend ließ sie ihren Blick durch die Küche wandern. Vielleicht wäre es das Beste, wenn sie nicht zur Tür ging, bis Tobi zurückkam. Allerdings würde das wohl ein schlechtes Licht auf sie werfen und sie wollte nicht verdächtigt werden, aus bösen Absichten heraus in diese Welt geraten zu sein. Und genau das würde vermutlich geschehen, wenn sie sich vor dem Treffen mit diesem Lucien drückte.
Entsprechend blieb ihr keine Wahl.
Ihre einzige Hoffnung bestand darin, dass Tobi zurückkam, bevor der Großmagier hier eintraf. Sie wollte nicht mit ihm allein sein.
Großmagier. Das Wort reichte aus, um Unbehagen in ihr zu wecken.
Für die Loyalität dieser Welt – was auch immer das bedeuten mochte.
Sie kannte weder die Gesellschaft noch ihre Gesetze. Wer versicherte ihr also, dass ihr tatsächlich nichts geschah? Wer versprach ihr, dass Tobi die Wahrheit sagte und niemand ihr etwas zuleide tat?
Um sich von ihren Gedanken abzulenken, stand Sara auf und ging ins Wohnzimmer. Genau wie außen waren auch die Wände im Inneren gemauert. Unweigerlich fragte sie sich, wie gut dieses Haus isoliert sein mochte, bis sie sich daran erinnerte, dass es in dieser Welt wohl weitaus mehr Möglichkeiten für derlei Dinge gab, als sie es gewohnt war.
Ob die kahlen Wände der Grund waren, warum Tobi jeden Zentimeter von ihnen vollgestellt hatte? Überall waren Regale angebracht, bestückt mit Pflanzen, Büchern und Unmengen an Kleinkram. Im Vorbeigehen betrachtete Sara ein kleines Arsenal an Taschenmessern, zwei Modellflugzeuge – von denen ein weiteres unter der hohen Decke baumelte – und Figuren, deren Gesichter ihr nicht bekannt vorkamen.
Am meisten beeindruckte sie jedoch die gigantische Sammlung von Flaschenschiffen. Eine ganze Wandbreite lang, vom Boden bis zur Decke, sammelten sich Modelle unterschiedlichster Formen und Größen. Unterbrochen wurden sie lediglich von einem einladenden Kamin, auf dessen Sims noch mehr Exemplare standen. Von Kriegsschiffen über Segelboote bis hin zu modernen Kreuzern war alles dabei. Tobis Sammlung schien keinem Muster zu folgen und wirkte gleichzeitig wunderbar ausgewählt.
Voller Neugier nahm Sara eines der Schiffe aus dem Regal. Attilio Regolo stand auf dem vergoldeten Schild des hölzernen Sockels, doch das war es nicht, was sie interessierte. Vielmehr beachtete sie die winzigen Seile, die sich vom Mast über den halben Schiffskörper spannten – die Türme, die Beiboote, die Reling, …
Jeder Millimeter des Schiffes war bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, was Sara vermuten ließ, von welch enormen Wert dieses fingerlange Modell sein musste. Darum war sie gerade im Begriff, eszurück an seinen Platz zu stellen, als das schrille Läuten einer Klingel durch das Wohnzimmer drang.
Erschrocken fuhr Sara zusammen.
Die Flasche rutschte ihr aus den Fingern und zerbrach auf dem Steinboden.
»Nein«, keuchte sie, ließ sich auf die Knie sinken und begutachtete den Schaden. Es gab nichts mehr zu retten. Das Schiff war halbiert, der Mast geknickt und zwei der Türme abgebrochen.
Ein zweites Mal klingelte es. Diesmal erschien es ihr, als wäre der Ton ungeduldiger geworden.
Eilig stand sie auf.
»Einen Moment!«, rief sie in Richtung der Tür, ehe sie in die Küche hastete, wo ihr Blick an Nacho hängen blieb.
»Bleib bloß da sitzen!«
Sie riss den Schrank unter der Spüle auf. Ein Kehrblech. Irgendwo musste es doch ein Kehrblech geben. Sie würde ihr Missgeschick sowieso beichten müssen, aber Lucien brauchte sie ihre Schusseligkeit nicht unter die Nase zu reiben. Außerdem konnte sie nicht riskieren, dass das Frettchen sich an den Scherben verletzte.
Verzweifelt raufte sie sich die Haare. Zwei Schränke und keiner beherbergte irgendetwas zum Auffegen.
Besaßen Magier etwa keine Handfeger?
Ihr Blick huschte durch den Raum und blieb an der Wand neben dem Ofen hängen. Aus der Nische dazwischen lugte hervor, wonach sie suchte. Hastig riss sie die Utensilien vom Haken, stürmte zurück ins Wohnzimmer – und erstarrte, als sie den Mann entdeckte, der vor dem Kamin stand.
In der Hand hielt er die Attilio Regolo.
Sie war heile. Und in ihrer Flasche.
»Tu cautiosior debes cum rebus alienis esse«, sagte der Fremde und Sara verstand kein Wort. Steif wie eine Statue stand sie im Bogen zwischen Küche und Wohnzimmer und schielte zur Tür, die nach wie vor geschlossen war.
Hatte Lucien einen Schlüssel?
Nein. Undenkbar.
Wieso sollte er?
Dann musste er sich mit Hilfe seiner Magie Zutritt verschafft und die Flasche repariert haben.
Natürlich. Sie hätte sich gar keine Gedanken machen müssen, immerhin wäre Tobi ebenfalls in der Lage dazu gewesen.
Lucien stellte das Schiff zurück ins Regal. Er sah anders aus, als Sara es von einem Großmagier erwartet hätte. Gekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover und einer schlichte graue Jogginghose sah er aus, als hätte Tobi ihn vom Sofa geklingelt. Piercings zierten seine Ohren. Zwei rechts, drei links, wie Sara feststellte, als er sich zu ihr umdrehte.
»Mihi nomen Lucien est. Quod tibi?«
Er sprach Latein.
Natürlich sprach er Latein.
Spätestens als sie ihn anstarrte wie ein Auto, hätte ihm klar sein müssen, dass sie kein Wort verstand. Aber sein Name war gefallen, also hatte er sich ihr vermutlich vorgestellt.
»Sara«, beeilte sie sich zu sagen.
»Gaudeo, Sara. Tobi linguam nostram tibi docuit?«
Sara neigte den Kopf zur Seite, in der Hoffnung, er würde dadurch verstehen, dass sie keine Ahnung hatte, was er sagte.
Was wollte er?
Was erwartete er?
Durch seine Betonung ahnte sie, dass er eine Frage gestellt hatte, aber damit hörte ihr Wissen auch wieder auf.
Zu ihrer Erleichterung legte sich ein warmes Lächeln auf seine Lippen. »Id tamquam non aestimo«, sagte er, während er auf sie zuging.
Sara wollte gerade einen Schritt zur Seite treten, um ihn in die Küche zu lassen, als er die Hand hob und auf ihre Stirn legte. Irritiert wich sie zurück, doch Lucien folgte ihrer Bewegung. Mit der anderen Hand stützte er ihren Rücken und im nächsten Augenblick durchzog ein stechender Schmerz ihren Schädel.
Sie keuchte.
Versuchte, weiter zurückzuweichen, aber Lucien hielt sie davon ab. Sanftheit und Bestimmtheit lagen gleichermaßen in seinem Griff, und so blieb ihr nichts anderes übrig, als die Schmerzen so lange auszuhalten, bis ihr schwindelig wurde. Handfeger und Kehrblech rutschten ihr aus den Fingern und fielen scheppernd zu Boden. Schwarze Punkte tanzten durch ihr Sichtfeld und gerade als sie drohte, das Bewusstsein zu verlieren, ließ Lucien von ihr ab.
»Das war es schon.« Eilig griff er nach ihrem Arm, als er merkte, dass sie das Gleichgewicht verlor. »Tut mir leid, anders ging es nicht. Bitte, setz dich.«
Er sprach Latein, das wusste Sara trotz ihres benebelten Gehirns, dennoch verstand sie jedes Wort. Sie ließ zu, dass Lucien sie zum Tisch führte und auf einen der Stühle platzierte, doch in ihren Gedanken kreiste nur ein einziger Satz: Ich verstehe Latein.
Von einer Sekunde auf die andere hatte Lucien ihr die ganze Sprache eingepflanzt, was die höllischen Kopfschmerzen und die Übelkeit definitiv erklärten.
Benommen schaute sie dabei zu, wie er eine Tasse aus einem der Schränke nahm. Er stellte sie auf die Arbeitsfläche und im nächsten Moment erschien wie aus dem Nichts eine Tafel Schokolade in seiner Hand.
Mehr bekam sie nicht mit. Ihr Kopf sank auf die Tischplatte und sie schloss ihre schwer gewordenen Lider.
Ihr Körper verlangte nach Ruhe. Ruhe, um die Sprache zu verarbeiten, die ihren Kopf explodieren ließ.
»Huch.« Luciens Stimme klang meilenweit entfernt, so verloren war sie zwischen dem Gedankenbrei aus Deutsch und Latein, der in ihrem Schädel lag.
Nur am Rande bekam sie mit, wie sich etwas Warmes um ihre Hände legte. Es war angenehm, besonders jetzt gerade, während ihre Haut die vielen Stunden in der Kälte auf schmerzhafte Weise verarbeitete.
---ENDE DER LESEPROBE---