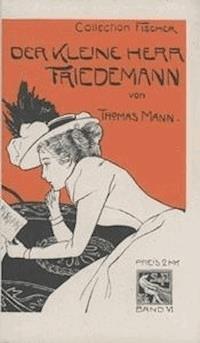0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Ähnliche
Heinrich MannZwischen den RassenRoman
Albert LangenVerlag für Litteratur und KunstMünchen 1907
Erster Teil
I
Die Schwarzen, die das Pferd am Zaum geführt hatten, mußten ihre Herrin auffangen: ihr ward schwach; — und dann lag sie in Farren versteckt; ein Palmenblatt ward bewegt über ihrem dunkeln Scheitel; der große, hellhaarige Mann beugte sich zu seiner bleichen Gefährtin; und das Kind kam zur Welt. Die Bäume des Urwaldes standen starr und übermächtig daneben. Dorther, wo er sich lichtete, kam das Schlagen des Ozeans, und von drüben, aus der Finsternis, das wilde Geschrei der Papageien und der Brüllaffen.
Das Kind lernte sprechen von seiner schwarzen Amme und laufen auf dem Sand zwischen Wald und Meer. Vom Rande des Meeres holte es Muscheln, die es von großen Steinen löste; und am Waldsaum erntete es abgefallene Kokosnüsse: daraus zogen ihm die Diener mit glühenden Spießen die süße Milch. Große, zuckerige Früchte hingen überall bei seinen Händchen; im Garten ertrank es in Blumen; und als goldene Funken schossen Kolibris um seinen Kopf.
Dann ward Brüderchen Nene groß genug, daß sich mit ihm spielen ließ. Man suchte zwischen Mauerritzen nach den winzigen runden Eidechseneiern und den Natterneiern, rund und weich. Vom Schwanz des Gürteltieres brachten einem die Neger die kleinsten Ringe: damit schmückte Nene der Schwester und sich selbst alle Finger; und dann fuhr man in einem Zuber den Bach hinab, und die schwarzen Kurubus auf ihren Büschen sahen einem, über ihre feuerroten Krummschnäbel hinweg, hoheitsvoll nach.
Und man erlebte in der Hauptstadt den Tropenregen: in den Straßen fuhren Kanoes, und unablässig mußten die Schwarzen mit Schaufeln das Wasser aus den Zimmern stoßen; — und den Karneval! An der Jalousietür saß man auf einem Stühlchen, über dem Gewimmel der Masken, und die schöne Mama warf Wachsbälle hinab: die platzten und tränkten die bunten Trachten mit flüssigem Duft. Aber aus einer Muschel, die ein ganz roter Mann an den Mund setzte, fuhr ein so schrecklicher Ton, daß man ihn nicht ertragen konnte, sondern sich mit seinem Stuhl zurückwarf und auch Nene mit umriß.
Und auf der Großen Insel — das Haus der Großeltern schwamm im Duft der Orangenblüten — sog man inmitten eines Heeres erntender Neger an einem Stückchen Zuckerrohr. Und zitternden, schreienden Laufes kam man von einer Begegnung mit der Boa heim! Und schaute, mit allen schwarzen, gelben und weißen Kindern der Pflanzung, erregten Auges und jubelnd zu, wie der Großvater viele Papierröllchen anzündete und sie in weiten, leuchtenden und zischenden Bögen über das Meer schoß. Das Meer schob einem lange, laue Schlangen über die bloßen Füßchen; im Hemdchen, das ein Gürtel enger schloß, fing sich ein Stoß warmen Nachtwindes; und hob man den Blick, schwindelte es einem, so voll war er auf einmal von Sternen!
Es war herrlich: man war wie alle andern Kinder — und doch nicht ganz so. Vornehmer war man. Man hatte blondes Haar; nicht einmal Nene hatte es; und die schwarze Anna war sehr stolz darauf und konnte nicht genug Locken daraus wickeln. Man hatte auch einen blonden Papa: wer hatte den noch? Und kam er zu Besuch auf die Insel der Großeltern, und ging man an seiner Hand umher: viel größer war er als alle Menschen und immer ernst, — und sah man alle ihn bewundern, dann durchrann einen selbst ein Schauer von stolzer und ehrfürchtiger Liebe.
Da aber — was bedeutete dies? — saß eines nachmittags im Saal, wo Großmutter klöppelte, Mama, die schöne Mama und weinte: ja, weinte laut. Kaum aber hatte sie ihr kleines Mädchen erblickt, stürzte sie darauf los, riß es an sich, fiel vor ihm auf die Knie, rief und rang das Schluchzen nieder:
„Lola! Meine Lola! Sag: bist du nicht mein?“
Mit einem Finger vor den Lippen, erschrocken fragend sah das Kind nach der Großmutter: die saß da, grade und streng wie immer, und klöppelte.
„Bist du nicht mein?“ flehte die Mutter.
„Ja, Mai.“
„Man will dich mir wegnehmen. Sag’, daß du nicht willst! Hörst du? Du willst doch nicht fort von mir, von uns Allen?“
„Nein, Mai. O Gott! Wohin soll ich? Ich will dableiben: bei Pai, bei dir, bei Anna! Die Luiziana hat mir ein kleines Kanoe versprochen; morgen bringt sie es!“
Aber schon am Abend wartete auf die kleine Lola ein großes Kanoe. Die schöne Mai lag in einer Ohnmacht; Nene hing schreiend an Lolas Kleid; — aber ein Schwarzer machte sie los, trug sie, und die Ärmchen der Geängsteten würgten ihn, ans Wasser, setzte vorsichtig seinen nackten Fuß von einem der großen überfluteten Steine auf den nächsten . . . Das Meer brandete wütend; zerrissene Finsternis flatterte umher; und manchmal warf ein Stern ein böses Auge herein. Nun ward das Kind ins Boot gelegt; es hatte nicht geschrieen, es weinte unhörbar im Finstern; die Schwarzen ruderten schweigend; und das Kielwasser leuchtete fahl, als sei es die Spur eines Verbrechens.
II
An Bord des großen Dampfschiffes, auf das Lola gebracht ward, standen Pai und die schwarze Anna. Welch Wiedersehen! Dann:
„Pai, ist es wahr, daß wir ganz wegfahren? Und Mai? Und Nene? Und wohin fahren wir denn?“
Herr Gustav Gabriel fuhr mit seiner kleinen Tochter nach Hause, weil sie eine Deutsche werden sollte.
Mit neunzehn Jahren war er herübergekommen und hatte sich begeistert eingelebt. Bis zu seinem dreißigsten Jahre berührte ihn niemals Sehnsucht nach seinem Vaterland. Er dachte seiner wie an etwas Kleinliches und Bedrücktes; machte ihm auf einer Europareise einen spöttischen Besuch; fühlte sich mit Stolz als Brasilianer . . . Eines Tages bekam er zu spüren, daß er’s nicht sei. Er hatte geschäftliche Einbußen erlitten: was zu Demütigungen führte von seiten seiner Freunde und der Familie seiner Frau. Er sah sich plötzlich allein und ihm gegenüber eine ganze Rasse, deren für immer unzugängliche Fremdheit er auf einmal begriff. Nun fing er an, auf das Land seiner Herkunft als auf eine Macht zu pochen, sich selbst als Erzeugnis einer Kultur zu fühlen, von deren Höhe seine Umgebung nichts ahnte. Bei der Umschau nach Bundesgenossen begegnete er den Blicken seiner Kinder. Auch diese sollten in Sitten und Sprache eines niedrigeren Volkes erwachsen? Seine Feinde werden? Die Laute, die ihm in herzlichen Stunden kamen, die er von seiner Mutter erlernt hatte, sie sollten sie nie verstehen? Er hatte sie, wenn er ihnen deutsche Kosenamen gab, sich anblicken und lächeln gesehen . . . Das sollte anders werden! Ihr Vaterland war nicht dieses, und er wollte sie ihm zurückgeben! Mit dem Jungen würde es vielleicht schwer gehen: die Nachfolge im hiesigen Geschäft ward ihm bereitet; — aber seine Tochter! Er erblickte sich schon mit ihr in dem Garten, worin sein Elternhaus stand. Dort wollte er einst enden. Er sah sich den Weg zum Tor des Städtchens gehen, und an seiner Seite ein blondes junges Mädchen: seine Tochter. Sie war blond; sie war sein Kind und eine Deutsche. Er nahm sie für sich allein; mochte seine Frau — wie fremd sie ihm eigentlich geblieben war! — sich an dem Jungen schadlos halten: seine Tochter sollte ihn verstehen lernen, sollte in solcher Reinheit und Gediegenheit leben, wie man nur zu Hause lebte. Sie sollte nach Haus.
Nie war Pai so zärtlich gewesen mit Lola! Übrigens sollte sie bald zurück; und Mai und Nene würden sie besuchen, dort, wohin sie fuhren. Solche Fahrt war lustig: sie sollte sehen.
Vorläufig ward ihr sehr übel; es dauerte drei Tage; aber Pai selbst pflegte sie; er selbst tat alles, was Anna hätte tun müssen. Zwischen ihren Krisen lag Lola in aller Erschöpfung ganz glücklich da; und wenn sie ihre Hand in Pais schob, war ihr’s, als sei sie selbst ganz in Pais Hand geschlüpft.
Dann konnte sie aufstehen und zusehen, wie die Matrosen Fische heraufzogen: einen Fisch sogar mit einem langen Säbel an der Nase!
Da aber nahte jemand mit einem Wasserschlauch und bespritzte alle Kinder. Man mochte sich hinter den Schornstein verstecken oder in einer Taurolle: überall trieb der Strahl einen wieder hervor: es war ein angstvolles Vergnügen. Die durchnäßten kleinen Mädchen kreischten, und die Damen und Herren freuten sich laut, daß sie trocken waren. Überhaupt war es zum Erstaunen, wie lustig alle waren, wie freundlich miteinander und mit Lola. Es schien, sie hatten nichts anderes zu denken, als wen sie jetzt erfreuen wollten. Nie hatte Lola so viele liebe Menschen gesehen. Einer war da, der allen Kindern Schokolade schenkte und ordentlich flehte, bis man sie nahm. Selbst Pai war selten mehr ernst. Und Meer und Himmel strahlten unauslöschlich.
Dennoch geriet man nochmals in graues Wasser mit Wolken darüber und ward arg geschaukelt. Doch Lola focht das nicht mehr an; und Pais Mantel, unter dem sie auf Deck lag, war, wenn sie mit ihren Knieen ein Dach machte, so gut wie ein eigenes Haus: die Sturzwellen mochten darüber hingehen. Auch ward bald ausgestiegen; alle waren viel ernster geworden; — und Lola fand sich mit Pai und Anna in einer großen, nicht schönen Stadt, in deren Straßen man sich müde lief. Immerhin gab es Spielsachen, wie sie daheim nie welche gesehen hatte, und Pai kaufte ihr so viele, daß sie sich wunderte. Eines Morgens dann eine Fahrt mit der Bahn: und da waren sie in einem seltsamen Städtchen mit höckrigen Häusern und mit Gassen, die über Berge kletterten und rutschten, — und gelangten in einem riesigen, schaukelnden Wagen vors Tor und an ein Haus, daraus sprang hurtig eine kleine alte Frau hervor, lief auf Pai zu und hüpfte ihm an den Hals. Lola war erschrocken: denn Pai weinte. Wie war das möglich? Da griff aber die alte Frau ihr selbst unters Kinn und zog Lolas Gesicht ganz dicht zu ihrem, bis in das Wimpernfächeln ihrer Augen, — die sehr gütig blickten. Aber was wollte sie? Sie redete so viel Unverständliches. Lola sah fragend auf Pai; und indes sie ins Haus gingen, erklärte Pai ihr, dies sei seine Mama, und heute feiere sie ihren Geburtstag, und er bringe ihr Lola zum Geschenk.
Im Hause roch es nach Kuchen und Blumen; Pais Brüder waren da und umarmten ihn. Sie gaben Lola die Hand; einer ließ sich von Pai etwas ins Ohr sagen, und dann wünschte er Lola in ihrer Sprache Willkommen. Sie lachte über ihn; alles wäre gut gewesen: da aber kam die neue Großmama, aus lauter Herzlichkeit, auf den Gedanken, die Arme um Lolas Hüften zu legen und vor ihr auf die Kniee zu fallen. Lola hatte plötzlich ein zum Weinen verzerrtes Gesicht. Alle stießen Fragen aus, und Pai übersetzte:
„Was ist dir?“
„Nichts, Pai.“
Lächelnd und stammelnd:
„Ich dachte an etwas.“
Grade so hatte, am letzten Tage, die schöne Mai vor Lola gelegen: aber in Tränen und Jammer. Lola dachte: „Ist es wahr, daß ich bald zu ihr zurück darf?“
Einer der Onkel heiterte sie auf: er klatschte in die Hände, und sie mußte vor ihm davon laufen. Sie tat es aus Gefälligkeit, und lächelte höflich, wie er sie fing. Nun spielten alle mit und wollten sich verstecken, und der lustige Onkel sollte sie suchen. Man zeigte Lola einen sehr guten Versteck: hinter einem kleinen Gartenhause und unter einem dunkeln Baum. Da stand sie lange, und niemand fand sie. Kein Geräusch im Garten. „Sollten sie mich vergessen haben?“ Eine hastige Angst überfiel sie: „Pai ist fort, Anna ist fort: sie haben mich allein gelassen!“ Sie senkte, betäubt, den Kopf und legte die Hände vors Gesicht. Ganz allein! Da kamen Schritte herbei; Lola nahm sich zusammen und gab einen kleinen hellen Vogellaut von sich. Es dauerte etwas; sie lauschte atemlos, zwitscherte nochmals, und dann fand man sie.
„Damit du mich nicht zu lange suchen solltest,“ erklärte sie, obwohl der Onkel doch nichts verstand.
Beim Abendessen ward sie lebhaft und sang sogar ein Lied, näselnd wie die Schwarzen, von denen sie es gelernt hatte. Mitten in aller Vergnügen aber, und wie auch Pai gerade lachte, nahm sie seine Hand und flüsterte ihm, als überrumpelte sie ihn, eilig zu:
„Nicht wahr, Pai, wir reisen bald nach Haus?“
Pai nickte; aber er war nun wieder ernst, und Lola hatte gesehen, daß er beinahe ärgerlich geworden wäre. Verstört schwieg sie: war’s möglich, daß man sich auf Pai nicht mehr verlassen konnte?
„Weißt du nicht, wann wir nach Haus reisen?“ fragte sie nachher im Schlafzimmer die schwarze Anna.
Nein, Anna wußte es nicht, und ihr glaubte Lola. Anna sah sich, mit kleinem tierischen Kopfrücken, im Zimmer um, wie in einem Käfig; Lolas Augen folgten ihr; — und dann betrachteten die beiden einander ratlos.
Aber die neue Großmutter war so heiter! Man konnte nicht an ihrer Hand durchs Haus laufen: in den Saal, wo die Äpfel lagen, auf den Boden, woher sie bunte Kleider und alte, seltsame Puppen holte, — ohne daß irgend etwas Lustiges vorfiel. Der zweite Onkel brachte seinerseits viel Leben mit; — und dann war es ziemlich spaßhaft, mit Anna auszugehen, unter die hiesigen Kinder, die scheinbar noch nie eine Schwarze erblickt hatten. Da ward man angesehen! Manchmal zwar liefen einem zu viele nach und machten sich lästig: da half nur, daß man ihnen Bonbons hinwarf, um zu entkommen, während sie sich rauften . . . Ferner war unter den freundlichen Menschen, die Lola kennen lernte, ein schwarzgekleideter Herr mit weißem Bart, der eines Tages in Großmamas Zimmer saß und Lola etwas fragte. Pai bedeutete ihr, es handle sich darum, ob sie zum protestantischen Glauben übertreten wolle; er rate ihr dazu. Sie sagte ja, bekam von dem alten Herrn einige glatte bunte Bildchen und ward am Abend in den Zirkus geführt . . . So viel hatte man erlebt, daß gewiß schon ein Jahr herum war.
„Nicht wahr, ein Jahr sind wir bald hier?“ fragte sie eines Abends. Pai erwiderte:
„Was denkst du. Sechs Wochen erst.“
„Erst? Aber es ist doch schon wieder Winter?“
„Nein, Kind, so ist hier der Sommer.“
Sie hätte sich gern einmal wieder nach der Heimreise erkundigt; aber Pai schien nicht aufgelegt; er hatte die schon lange nicht mehr gesehene Falte zwischen den Augen. Auch die Andern sprachen heute viel weniger. Sogar Großmama lächelte nur halb. Lola ging bedrückt zu Bett.
In der Nacht träumte ihr etwas Trauriges: sie sah einen Neger — welchen, wußte sie nicht, aber es war einer, den sie gern hatte — von einem Aufseher grausam prügeln, hörte sein Winseln, brach selbst in Weinen aus und lief, es dem Großvater zu klagen: weinte und lief. Da erwachte sie, noch immer schluchzend, — und auch das andere Schluchzen ging weiter. Die schwarze Anna kauerte, über das Bett gebeugt, und jammerte erstickt:
„Kleine Herrin, ich muß fort. Schon morgen reisen der Herr und Anna mit dem Dampfschiff fort, zurück in unser Land; die kleine Herrin aber bleibt hier.“
Und da Lola, auffahrend, in Geschrei ausbrach:
„Ganz leise! Anna darf nichts sagen: der Herr hat es verboten. Anna sollte ohne Abschied weggehen: sie kann doch nicht!“
„Du sollst nicht weggehen! Hörst du, du tust es nicht! Ich befehle es dir!“
Des Kindes Stimme brach sich vor Zorn.
„Pai läßt mich nicht hier zurück; das sind alles Lügen.“
Die Amme wiederholte nur, eintönig klagend:
„Ganz leise! Anna muß fort.“
Und in ihrem Gemurmel ging der Zorn der Kleinen allmählich unter. Sie ließ sich auf Annas Schulter fallen, gebrochen, mit Schluchzen und Bitten.
„Geh nicht fort!“
„Anna muß gehen.“
„Wenn du fortgehst, dann —“
Der Schmerz schüttelte das Kind. Es preßte sein Gesicht auf die nackte schwarze Schulter; — und mit dem öligen Geruch dieser Haut, an der es einst die ersten Atemzüge getan hatte, erhob sich die dunkle Flut seiner frühesten Erinnerungen und überschwemmte es. Lola sah, in einem aufgeregten Gedränge von Bildern, zuerst einen Palmenwald, dann viele grimassierende Negergestalten, die ihr namenlos schön erschienen, um Fleischtöpfe hocken, in die sie oft ihre Händchen getaucht hatte; sah ein Stück schäumenden, heftig blauen Meeres und die buschigen Wedel des Zuckerrohrs davor; sah Nene, den Bach und die Kurubus . . .
„Wenn du fortgehst,“ wimmerte sie, „dann —“
Es entstand ein Wogen großer Blumen hinter ihren an Annas Schulter gedrückten Lidern; und tief in den Blumen hing die Hängematte mit der schönen Mai, die ihr zunickte und langsam und wie von einer nicht mehr Anwesenden das Gesicht wegwandte.
„Wenn du fortgehst, dann ist . . . alles aus!“
Am Morgen trat Pai ins Zimmer und sagte:
„Meine kleine Lola, Pai muß nun auf kurze Zeit zurückreisen, und bis er wiederkommt, läßt er dich hier.“
Da das Kind nur den Kopf senkte:
„Es wäre für dich nicht gut, schon wieder so weit zu reisen.“
Lola schlug die Augen auf und sagte hell, wie eine verzweifelte Schelmerei:
„Pai, nimm mich mit?“
„Meine kleine Tochter ist vernünftig, nicht wahr,“ erwiderte Pai, ohne Frage im Ton; und Lolas kleines gespieltes Lächeln brach ab. Pai nahm sie bei der Hand und führte sie zur Stadt, über einen Marktplatz und in ein altes Haus, an dessen gläserner Flurtür die Glocke lange klapperte.
„Hier wohnt,“ sagte Pai, „eine gute Dame, die sich meiner Lola annehmen will, solange Pai nicht da ist.“
Der Flur war weit; auf seinen Steinfliesen gingen Arm in Arm, zu zweien oder in langen Reihen, viele Mädchen umher. Andere hüpften zwischen den Flügeln einer Tür, in der buntes Glas war, in den Garten hinab. Es waren große und kleine; aber die kleinste, sah Lola gleich, war sie selbst. Sie sah es aus dem Zimmer, worin Pai mit ihr wartete. Es hatte weiße Tapeten mit goldenen Blumen darauf, eine goldene Stutzuhr, sehr hohe Fenster mit den Bäumen des Gartens dahinter; und Lola wandte sich, beklommen seufzend, von einem Gegenstand zum andern. Gleich war’s nun so weit: Pai war fort. Noch hielt er sie doch an der Hand: und war schon fast fort! O, o, was für eine drängende Menge von Dingen hätte sie ihm zu sagen gehabt; er mußte doch einsehen. Mit zuckender Lippe brachte sie hervor:
„Pai, sieh, was für ein komischer Mann ist auf der Uhr.“
Und fieberhaft dachte sie: „Das war’s doch nicht, was ich wollte.“
Hatte Pai wirklich gar kein Erbarmen? Sie lugte zu ihm auf, mit unverstelltem Jammer. Pai sah gradaus; er hatte den Mund fest geschlossen, die Falte zwischen den Augen; — und zum ersten Male fühlte Lola, daß er ein strenges Gesicht mache, weil er traurig sei; daß er sich streng stelle, weil er sie lieb habe. Es ward ihr ganz warm und glücklich; sie drückte Pais Hand; Pai sah hinab, ihr in die Augen: da aber ward es draußen bei den Mädchen viel stiller, und eine kleine Dame im schwarzen Kleid lief eilig an dem gelben Treppengeländer entlang. Schon war sie unten, und nun kam sie auf das offene Zimmer zu. Gab es denn keine Rettung? Pai tat nichts? Die kleine Dame trug die eine ihrer schmalen Schultern höher als die andere, sie hielt die Arme gekrümmt zu den Seiten ihres zerknitterten Trauerkleides, und ihr blasses, langes Gesicht bekam vom Lächeln eine krause Nase: Lola sah das alles mit schreckensvoller Genauigkeit. Ihr war wie in einem Traum, worin man davonlaufen möchte und kann sich nicht regen. Da fühlte sie schon die dünnen langen Finger der Dame kühl um ihre Hand. Was sagte nun die Dame? Ratlos wandte Lola sich nach Pai um.
„Fräulein Erneste begrüßt dich,“ erklärte Pai, „und verspricht dir, sie wolle dich lieb haben und dich alles Gute lehren. Du mußt ihr danken.“
„Danke,“ sagte Lola, mit Anstrengung.
Darauf begann das Fräulein unter Lauten freudiger Erregung überall in Lolas Gesicht Küsse zu werfen, die hart waren und schmerzten. Lola begriff nicht; sie erschrak; und inzwischen hatte das Fräulein schon wieder eine Menge geredet, und alles klang fragend. Allmählich hörte Lola, daß sie immer dasselbe sagte, und immer langsamer und deutlicher sprach sie es aus. Wieder suchte Lola Hilfe bei Pai, aber Pai hatte sich in einen Stuhl gesetzt und bekümmerte sich nicht um sie. Und das Fräulein drang immer strenger auf sie ein, mit steil aufgerichtetem Zeigefinger. Lola hielt sich nicht länger; sie brach, und sah dem Fräulein dabei immer starr in die Augen, in entsetztes Schluchzen aus. Da geschah etwas sehr Seltsames. Die eifrige, Gehorsam heischende Miene des Fräuleins fiel jäh in sich zusammen und ward ganz unsicher und hilflos. Das Fräulein war auch anfangs nicht groß gewesen: jetzt aber war es nicht mehr viel höher als Lola, und es tastete schüchtern, während es den Kopf zum Bitten schief legte, nach Lolas Hand. Darüber erschrak Lola nochmals: aber nicht für sich selbst. Was hatte das Fräulein? Ein verlegnes Mitleid berührte ihr Herz, und sie lächelte zart. Ein wenig höher noch hob sie des Fräuleins Hand, die um ihre lag: zögernd, — und plötzlich legte sie die Lippen darauf. Sogleich aber trennten sie sich, und Lola lief auf Pai zu, fiel ihm um den Hals und rief, um Pai von dem Fräulein und seiner Verwirrung abzulenken: was für ein herrlicher Apfelbaum da zum Fenster hereingreife. Pai hob, da das Fräulein ihm etwas zurief, Lola hoch empor, und sie konnte eine Frucht brechen.
Alle drei gingen nun in den Garten; Lola fühlte sich irgendwie beglückt; und ehe jemand es sich versah, saß sie droben im Apfelbaum. Pai schalt, aber sie hörte, daß es Spaß sei; das Fräulein lachte von Herzen, und aus allen Ecken des Gartens liefen Mädchen herbei, sich die kleine Wilde anzusehen. Sie tanzten um den Baum, schrieen und streckten die Hände aus. Pai sagte hinauf, das Fräulein erlaube, daß Lola zur Feier ihrer Ankunft den Mädchen Äpfel pflücke. Lola warf sie ihnen zu; sie kletterte von Ast zu Ast, suchte sich mit ernster Miene eine aus und warf ihr die Frucht in die Schürze. Als sie herunterstieg, umringten die Größeren sie und liebkosten sie. Aber eine Glocke läutete, und alle eilten ins Haus. Pai und Lola folgten dem Fräulein zu einer Laube, wo ein Frühstück bereitstand.
Lola bekam zum Essen ein halbes Gläschen Wein; dann nahm Pai sie auf sein Knie, küßte sie und sagte: „Nun lauf umher.“
Trotzdem behielt er sie im Arm und sah sie an. Sie entschlüpfte.
„Einen Kuß noch, kleine Tochter,“ rief Pai ihr nach.
„Gleich!“
Und sie sprang hinter einem Schmetterling her. Ihr war lustig zu Sinn, sie dachte: „Solche großen Klatschrosen! . . . Ich muß sehen, was dort in der Mauer für ein dunkles, dunkles Loch ist . . . Pai ist gut, auch das Fräulein ist gut . . . Eine Eidechse, husch . . . Ob die Mädchen nicht wiederkommen? . . . Der schöne Tag!“
„Pai!“ jauchzte sie.
„Er kann mich nicht hören, so groß ist der Garten. Wo ist denn die Laube geblieben? Ah, um diese Hecken muß ich herum . . . Nun aber: Pai!“ Und sie lief.
Plötzlich hielt sie an: vor der Laube stand das Fräulein allein.
„Pai?“
Lola kam langsam näher. Ihre Augen durchforschten die Laube, überflogen den Garten und hafteten, verzagend, am Blick des Fräuleins. Was sagte er? Doch nicht das? Er konnte nicht! Lola nahm sich zusammen und fragte:
„Wo ist Pai, Fräulein?“
Das Fräulein sagte etwas, wieder mehrmals dasselbe, aber garnicht langsam und deutlich wie vorhin: und doch verstand Lola. Sie warf, haltlos jammernd, die Arme in die Höhe.
„Er wollte noch einen Kuß von mir! Wie kann er fort sein, wenn ich ihm doch noch den Kuß geben soll!“
Sie taumelte einmal um sich selbst und schlug, unsicheren Laufs, den Weg zum Hause ein. Mitten darauf blieb sie stehen, ließ die Arme fallen, senkte den Kopf; und die rinnenden Tränen wuschen ihr von den Lippen den Kuß, den sie nicht hatte geben dürfen.
III
Lola war allein.
Sie weinte auf einer Bank, zusammengekrümmt, lange und wild. Das Fräulein stand anfangs dabei und flüsterte hier und da ein Trostwort, das fragend klang, als wisse sie es selbst nicht genau. Dann machte sie einige Schritte, sah sich wartend um, verschwand im Hause. Bald kam sie wieder und rief sehr munter, ob Lola diesen schönen Pfirsich möge. Als aber das Kind zornig den Kopf schüttelte und wilder schluchzte, zog das Fräulein sich so rasch zurück, als flöhe sie.
Die Glocke läutete wieder, und Lola ließ sich fortführen, weil das Fräulein ihr sagte, nun würden die Mädchen kommen und sie weinen sehen. Das Fräulein öffnete die Tür zu ihrem eigenen Zimmer: da sprang kläffend ein kleiner weißer Spitz auf Lola zu, und Lola, die daheim vor Großpais riesigen Hunden keine Furcht gehabt hatte, wich mit einem Aufschrei zurück.
„Ami!“ rief das Fräulein und redete, zu ihm niedergebeugt, ernsthaft auf den Spitz ein. Es half nicht; das Kind und das Tier hatten sich gegenseitig erschreckt; und der Hund mußte hinaus, — wo er winselte.
Nun kramte das Fräulein in einem Schrank, zog ein großes buntes Buch hervor und hielt es Lola entgegen. Sie wollte Lola auf einen Schemel setzen; Lola glitt damit aus, griff um sich und warf ein Glas Wasser über die Handarbeit, neben der es gestanden hatte. Das Fräulein strich ihr die Wange und lächelte. Dann schlug sie das bunte Buch bei der ersten Seite auf; es war ein Affe darauf, ein Ast und noch mehrere Dinge; und wiederholte, auf den Affen zeigend, ein Wort: immer nur das eine. Zuerst beachtete Lola es nicht; dann merkte sie wohl, daß sie es nachsprechen solle: aber sie schwieg; und diese Rache für alles, was mit ihr geschah, tat ihr wohl. Trotzdem richtete das Fräulein seinen Finger jetzt auf den Ast und sagte dazu ein anderes Wort, viele Male. Sie führte Lola auch zu einem weißen Turm, der in einer Ecke des Zimmers ragte, und zu dem Schirm, der davorstand: darauf waren aus bunten Perlen eine Dame und ein Kind, und zu beider Füßen ein Tier, das Lola nicht kannte. Es schien ihr sanft, zärtlich, zum Zerbrechen sein; und seine großen Augen glitzerten, als seien sie voll Tränen. Mitleid durchschauerte Lola, mit dem Tier, mit sich selbst, — und da stammelte sie das Wort nach, das das Fräulein ihr schon längst vorsagte: „Reh“, und weinte, leise und ohne Trotz.
Wie die Tränen gestillt waren, nahm das Fräulein sie mit zum Essen, an eine lange Tafel, wo viele Mädchen schwatzten und klapperten. Lola aß nichts, aus Traurigkeit; sie saß betäubt da, erschrak, wenn ihr Name genannt ward, und dachte, weh und wund: „Was wollt ihr alle? Was tue ich hier? Warum hat Pai mich nicht mitgenommen?“ Nach Tisch ward sie in den Garten gebracht, aber sie schüttelte den Kopf und ging dem Fräulein nach, bis sie wieder im Zimmer und bei dem Reh war: denn das war hier ihr einziger Freund. „Reh, Reh,“ flüsterte sie ihm zu. Das Fräulein küßte sie leise auf die Locken und ließ sie mit ihrem Kameraden allein. Als Lola später zu Bett gelegt werden sollte, hatte sie sich schon in Schlaf geweint.
Beim Erwachen in heller Sonne fiel ihr als erstes das Reh ein; dann der Spitz Ami. Sie bedachte vieles Erlebte und auch, ob sie dies Zimmer schon kenne. Neugierig sah sie sich darin um. Noch ein anderes Bett stand da, aber es war schon verlassen. Sie ließ sich aus dem ihren gleiten und trippelte umher: da trat das Fräulein herein, hob Lola auf ihren Arm, zeigte sich auf die Brust und sagte mehrmals:
„Erneste“.
Lola hatte in ihrem rotgeschlafenen Gesichtchen große, aufmerksame braune Augen, die, auf den Mund des Fräuleins gerichtet, ganz leise seitwärts hin und her rückten; ihre blonden Locken hingen wirr geringelt, die leichten Linien ihrer Lippen fügten sich fein ineinander; und am Saume ihres Hemdchens streichelten sich ihre rosigen kleinen Füße. Sie äußerte nichts; aber als sie fand, das Fräulein habe genug „Erneste“ gesagt, nickte sie bedächtig, zum Zeichen, daß sie verstanden habe.
Sie bekam ihren Kakao, grub im Garten, ward, wie die Glocke geläutet hatte, von den Mädchen in einem Ringelreihen geschwenkt und dann wieder von Fräulein Erneste in das Zimmer des Rehes geholt. Der Spitz Ami knurrte nur, und er wedelte dabei. Lola sollte auch heute „Affe“ und „Ast“ nachsprechen. Sie tat es zerstreut, sah dabei immer das Reh an: sie hatte keinen Sinn für die Dinge, auf die Erneste sie jetzt noch hinzulenken wünschte; und nur zufällig bemerkte sie, daß es sich um die zweite Seite des bunten Buches handelte, und daß dort jedes Bild mit einer Marzipanscheibe bedeckt war. Nahm man sie weg, kamen darunter zum Vorschein: ein Baum, ein Bäcker, ein Bottich. Sie erlernte diese Worte in großer Eile, um zu erfahren, was auf der dritten Seite wäre.
Von diesen Erlebnissen, die sie interessiert hatten, wollte sie bei Tisch — war nicht heute alles lustiger bei Tisch? — ihrer Nachbarin erzählen, einem Mädchen, daß nur wenige Jahre älter sein konnte. Sie erzählte ausführlich, die andere aber lachte nur und stieß eine dritte an. Lola, in Eifer, kam von dem Reh auf die Tiere daheim; sprach von daheim und von Nene und Mai. Plötzlich ward sie inne, daß alle still waren, zu beiden Seiten des Tisches, und sie ansahen: die meisten mit Neugier, einige spöttisch; — und keine, erinnerte sie sich nun, keine einzige hatte sie verstanden! Errötet, ratlos beschämt, sah sie die Reihen entlang, konnte, zitternden Gesichtes, die Tränen noch gerade hinunterschlucken und beugte sich mit einem kleinen einsamen Lächeln über ihren Teller.
Nun kam eine Stunde, in der alles durchs Haus sprang und sang. Auch Lola sollte singen, sie tat nur so, als begriffe sie nicht. Da faßte aber Erneste ihre beiden Arme, und die Nase kraus vor Freundlichkeit und während alle umherstanden, sagte sie ihr mehrere Worte, deren jedes ungefähr klang wie „singen“: nur nicht ganz. Schließlich aber fand sie’s wirklich: singen; und da sang Lola. Sie sang näselnd: „Ihr Negerknaben meines Vaters . . .“, schloß dabei halb die Lider und sah nun alles, was sie sang, sah die Heimat . . . Noch wie sie schwieg, war sie aus dem Schwarm der auf sie Einredenden weit fort.
Eine Weile darauf fiel ihr ein, daß sie dieses Lied einmal bei der deutschen Großmama gesungen hatte. Seltsam: an den Aufenthalt bei der Großmama hatte sie noch gar nicht wieder gedacht; ihr war, als sei sie von der großen Insel gradeswegs hierher verschlagen, und alles dazwischen war verworren wie ein Schiffbruch. Nun kam ihr eine Fratze in den Sinn, die der lustige Onkel einmal geschnitten hatte: und von da aus fand sie sich in allem wieder zurecht. Ach! Das war doch Lolas Großmama, denn Pai war ihr Sohn, und sie hatte ihn lieb. Eine aufzuckende Hoffnung: Ob Pai nicht bei ihr war? Daß Lola daran nicht früher gedacht hatte! Pai war nicht abgereist, er war bei seiner Mama! Lola ging zu Fräulein Erneste und sagte „Großmama“: nur das eine, bittende Wort; und Erneste verstand es, sie ließ Lola hinführen.
Die Großmama breitete die Arme aus, Lola aber lief, ohne ihrer zu achten, um sie herum: „Pai! Pai!“ — in sein Zimmer, in das Wohngemach, in den Garten: „Pai! Pai!“ Sie kehrte von ihrer vergeblichen Runde wieder.
„Wo ist Pai?“
Die Großmama bedeutete ihr etwas, Lola wußte wohl, was, aber sie glaubte ihr nicht. Einer der Onkel kam, die Magd ward gerufen, und alle wiederholten dasselbe. Lola schüttelte nicht mehr den Kopf, aber ihre Meinung stand fest. Zuletzt erschien der lustige Onkel und wünschte ihr Guten Tag in ihrer Sprache. Immer die zwei Worte, die er sich einst von Pai hatte ins Ohr sagen lassen. „Dummer Papagei,“ dachte sie, und sie verlangte fort.
Sie spähte in jedes Haustor, zerrte ihre Begleiterin in die Läden, die sie mit Pai besucht hatte, und auf einem leeren Platz, wo es wehte, blieb sie stehen und rief flehentlich „Pai!“ Keins der trägen Fenster öffnete sich; es fror Lola bitterlich; und die Magd zog sie fort.
Aber für das bunte Buch war sie nicht mehr zu haben, nicht mehr für den Garten und kaum noch für das Reh. Sie sah jeden mit Mißtrauen an, der ein Wort zu ihr sprach: eins dieser unverständlichen Worte, deren Geräusch um sie her war. Zu Fräulein Erneste sagte sie: „das ist nicht wahr,“ obwohl sie gar nicht wußte, was das Fräulein gemeint hatte; bei Berührungen brach sie in Geschrei aus; und ihr Drang war immer: auf die Straße, durch die Stadt, und in die Häuser spähen. Sie schrie, bis das Fräulein ängstlich ward und sie hinausließ. Das dauerte mehrere Tage.
Dann wich Lolas Glaube. Sie hatte gewiß in jedem Winkel nachgesehen und überall ihr „Pai!“ gerufen. So wollte Pai sie wohl nicht hören, oder er war wirklich fort. Ja, er war fort: die Leute hatten recht. Aber dann hatte Pai selbst sie verraten und unter diesen Fremden zurückgelassen. Wem also war noch zu trauen? Scheu sah das Kind sich um. In diesen Tagen brach ein Gewitter aus; und Lola — wie hatte sie daheim zu urweltlichen Unwettern gejauchzt! — ward von jedem dieser Blitze in eine andere Zimmerecke gescheucht: bleich und mit geschlossenen Lippen; denn niemandes Hilfe wußte sie anzurufen.
Ward Lola jetzt um ihr Lied gebeten, schüttelte sie, mürrisch und verlegen, die Schultern. Auch sprach sie nicht mehr; und sie dachte ganz Ungewöhnliches. „Ich werde vielleicht sehr krank werden und kann dann niemandem sagen, wo es weh tut, und muß immer so schreien, wie damals der Neger schrie, der ein Loch im Magen hatte.“ Wenn sie allein im Zimmer war und mit sich selbst und ihren Puppen plauderte, mußte sie manchmal lauschen: so seltsam klein und allein klang ihr die eigene Stimme; — und sie fühlte es plötzlich, tief in ihrem erschauernden Herzen, es gäbe im Hause und in der ganzen Stadt und auf allen Straßen die hinausführten, keinen Menschen, der, wie die daheim, zu ihr sagen könne: „Meine kleine Lola, meine liebe kleine Lola.“ Sie flüsterte die ersehnten Worte vor sich hin und sah dabei ihre Puppen an. Da bemerkte sie, daß auch die Puppen sie ihr nie sagen und, was sie ihnen vorplauderte, nie verstehen würden: waren doch auch sie aus diesem fremden Lande. Sie schob sie weg. Und selbst das Reh! Daheim gab es kein solches Tier, und es wußte nichts von Lola. „Hörst du denn nicht?“ bat sie, mit Tränen. „Reh! Reh!“ Aber das Reh sah sie fremd an.
Lola war allein.
Am Sonntag ward sie wieder zur Großmama gebracht. Sie benahm sich scheu und verdrossen; man verlor endlich die Geduld und überließ sie nach dem Essen sich selbst. Unzufrieden, weil niemand mehr sich um sie bekümmerte, drückte sie sich im Garten umher. Wie es kalt war in diesem Lande! Ängstlich und feindselig sah sie zu den grauen Wolken hinauf, die herabdrohten. Der Pavillon, der sie am ersten Tage versteckt hatte, damals, als sie schon vorausgeahnt hatte, Pai werde sie allein lassen: heute stand er offen, und Lola betrat ihn. Es waren wunderliche alte Möbel darin; sie bemühte sich, einen Wandschrank zu öffnen: — da geschah ein Poltern unter ihr. Sie fuhr zusammen. Es polterte stärker, es schlug sogar gegen den Boden, auf dem sie stand. Erstarrt, horchte sie. Ein furchtbarer Krach: nun drang es gleich zu ihr ein; und Lola schrie los, mit allen Kräften höchster Not:
„Der Teufel! Der Teufel!“
Sofort hörte das Poltern auf, und im nächsten Augenblick stand in der Tür der lustige Onkel, ganz bleich, und blickte Lola zornig an. Sie schrie, zu ihrer Rechtfertigung und aus Eigensinn, noch einmal: „Der Teufel!“ Da stürzte aber der Onkel auf sie zu und legte sie über sein Knie . . . Und nachdem Lola dies durchgemacht hatte, war es ihr viel leichter und sanfter. Der Onkel nahm sie bei der Hand und führte sie in das Kellergewölbe, unter dem Gartenhaus. Er zeigte ihr, wie er Holz gehackt habe, und wie die geschwungene Axt manchmal gegen die niedrige Decke gestoßen sei. Was er dazu redete, hatte einen guten, tröstlichen Ton; — und Lola ward betroffen und sehr nachdenklich. Denn es war klar, daß dies gegen alle ihre bisherigen Erfahrungen ging. Wenn daheim aus dem Urwald heraus irgend eine ungewohnte Stimme erscholl, lief es bei den Schwarzen von Mund zu Mund: „Der Teufel“; und blinzelte irgendwo ein Licht, das niemand kannte, ward geraunt: „Der Teufel“. Als der Onkel Holz hackte, hätte die schwarze Anna nur bei Lola sein sollen: ganz sicher würde sie gewimmert haben: „Der Teufel“. Er war es also nicht? Wenigstens nicht immer? Das war tröstlich, und der Onkel war gut, daß er Lola dies gelehrt hatte. Sie lächelte ihm zu. Sie hatte auf einmal alle Menschen lieber, ging ins Zimmer, umarmte die Großmama und klatschte in die Hände bei dem Gedanken, daß sie auch dem Fräulein Erneste etwas recht Liebes antun wolle. Eifrig verglich sie im Innern die schwarze Anna mit Fräulein Erneste und wunderte sich, wie viel näher ihr Erneste sei. Die schwarze Anna war dumm, mit ihrem Teufel; Lola schämte sich ihrer ein wenig. Wie sie nach Haus kam, stellte sie sich vor Erneste hin, sammelte sich und sagte zutraulich:
„Ast, Boot, Reh, Erneste.“
Dabei lächelte sie entschuldigend, denn für ein achtjähriges Mädchen war dies natürlich kindisch; aber was sollte sie sagen? Erneste verstand Lola; vor Rührung bekam sie ein bekümmertes Gesicht und Tränen in die Augen.
Einige Wochen später schlug sie Lola vor, einen Brief an Pai zu schreiben.
„Schreibe in deiner Sprache.“
Lola tat es; aber sie fügte mit Genugtuung eine Anzahl ihrer deutschen Wörter hinein: alle waren in einem Brief schon nicht mehr unterzubringen. Die Antwort kam. Auch Herr Gabriel hatte auf portugiesisch geschrieben; nur am Schluß stand der Satz: „Ich habe dich lieb“; und diese Worte, die er noch nie in seiner eigenen Sprache hatte äußern dürfen, waren von ihm mit einer Süßigkeit erfüllt worden, die Lolas schwache Hände noch nicht herauspressen konnten. Erneste sah diese Zeilen lange an und sagte dann:
„Bewahre den Brief gut auf, Kind.“
Den nächsten schrieb Lola — sie war vier Monate bei Erneste — ganz deutsch, und ihr Vater antwortete ebenso. Inzwischen aber war ein Brief angekommen; Lola wußte nicht gleich, wer ihn abgeschickt habe. Sie war sehr gespannt.
„Ah!“
„Nun?“ fragte Erneste.
„Von Mai!“ — und sie betrachtete ihn angestrengt.
„Was schreibt dir deine Mama?“
„Ja, ja“, machte Lola, und: „Gleich komme ich wieder.“
Sie lief ins Schlafzimmer und buchstabierte. Mais Schrift sah Lola zum erstenmal; die schöne Mai lag immer nur in der Hängematte. Wie mußte sie Lola lieb haben, daß sie ihr schrieb! Lola küßte den Brief. Dann versuchte sie es nochmals: nein; wirklich, sie verstand nichts, oder nur hier und da ein paar Worte. „Mai, Mai“, stammelte sie, und plötzlich weinte sie. Kleinlaut berichtete sie später Erneste:
„Jetzt ist es sehr heiß in Rio, schreibt Mai, und hier ist es so kalt.“
Tags darauf wußte sie:
„Nene war krank und ist nun wieder gesund.“
Sie las immer in dem Brief; er hatte schon Risse, Fettflecke und Tränenspuren. Eines Morgens beim Erwachen fand Lola ihr Händchen hoch in der Luft. Im Traum hatte sie’s nach einer Frucht ausgestreckt, die Mai ihr hinhielt, — und zog es nun leer zurück. Noch sah sie Mais Gesicht: und da verstand sie plötzlich einige von Mais Worten in ihrem Brief. Schon war Lolas erste Sprache, Wort für Wort, zurückgedrängt von ihrer zweiten; neue Gesichter schoben sich ihr vor die alten; und eine neue Luft malte alle Dinge anders. Draußen schneite es; das erste Mal hatte Lola den Schnee für Zucker gehalten; und Mai kannte ihn noch immer nicht. Mai lag in großer Wärme in ihrer Hängematte und kannte, obwohl sie Mai war, nichts von allem, was Lola sah. Wie rätselhaft das war! Lola dachte sich darin fest; sie saß am Boden, den Blick nach innen, die Lippen leise gelöst, und hielt mit allen Kräften den Geschmack solches Gedankens fest. Manchmal war es nur ein Wort, ein Name, den sie in solcher Weise ganz auszukosten suchte: Erneste, wie konnte jemand so heißen; Er—ne—ste, wie jede der Silben plötzlich verwunderlich und komisch war. Jeden Augenblick wurden sie fremder! Im Frühling, auf einem Ausflug, ward Lola vermißt und allein zwischen Waldhügeln bei einer Quelle gefunden. Das nasse Laub hing um sie her, es roch herb nach Kräutern, die Quelle rann, Lola saß ohne Regung. Worüber sie nachgedacht habe. „Über die Quelle.“ Im Sommer lag sie oft am Rande eines Heliotropbeetes auf dem Bauch, schob den Kopf zwischen die Blumen und lauschte in die große Tiefe dieses Duftes.
Ein Gesicht, das sie lange schon kannte, ward ihr auf einmal wie durchleuchtet: nun fühlte sie’s. Einmal, im Schulzimmer, sah sie, anstatt nachzuschreiben, unverwandt auf ihre Lieblingslehrerin, auf die raschen kleinen Mienen und die flinken, pickenden Bewegungen des Fräuleins.
„Lola, warum siehst du mich immerfort an?“ fragte Fräulein Mina. Lola erklärte:
„Du aussiehst wie ein klein Vogel.“
Die französische Lehrerin ward gehaßt von Lola: besonders seit sie Lola gedroht hatte, wenn sie noch länger die Kirschkerne verschlucke, werde ihr ein Kirschbaum aus dem Halse wachsen. Lola wühlte sich mit dem Blick in dieses fette, graue, schnüffelnasige Geschöpf hinein, bis sie in dem Fräulein deutlich eine große, dicke Ratte sah und bei einer zufälligen Berührung besinnungslos aufschrie!
In eine Vorstellung, eine Begierde konnte sie sich rettungslos festrennen, bis zu kleinen Verbrechen. Einmal log sie, in dem unvermittelten Drange, eine Sache ganz für sich zu haben. Nun hatte sie’s: ein Geheimnis; und kostete tagelang aus, daß niemand wisse, was sie wußte. Das war ein neues Leben, eine eigene Welt! Etwas später stiftete sie, um des Abenteuers willen, eine große Verschwörung an, verbunden mit Diebstahl. Zwar handelte es sich um die „Ratte“, die ohnehin jeden Streich verdiente. Mittlerweile nannten alle sie so; Lola hatte den Namen durchgesetzt und in Vielen Widerwillen erregt gegen die Lehrerin. Es war nicht schwer, die Mädchen zu überzeugen, daß sie der Ratte eine große, scheußliche Puppe ins Bett legen müßten. Man brauchte eine Maske, eine Haube, eine Jacke, eine Brille. Das Geld? Man wußte doch, wo die Ratte ihres aufbewahrte. Es war nur gerecht, daß sie selbst sich die Puppe kaufte. So geschah es. Die Ratte fiel zuerst in Ohnmacht, und wie der Verlust des Geldes herauskam, erlitt sie einen Weinkrampf. Lola sah ihn mit an: sie sah den Schmerz des häßlichen und geizigen Geschöpfes, ward hineingezogen und lebte ihn mit, außer sich vor Reue. Sie sah eine dicke Ratte sich ängstigen, die sie vergiftet hatte, und hätte gern, wenn es noch möglich gewesen wäre, das Gift selbst gegessen. Sie bat um Verzeihung, nahm sogar, mit leidenschaftlicher Selbstüberwindung, die Hand der Ratte. Denselben Ekel empfand sie auch jetzt noch; aber sie sah dieses Wesen leiden; sah unendlich mehr davon, als die andern sahen; und begriff nicht mehr, wie sie solch Leiden hatte zufügen mögen! Viel lieber statt anderer leiden! In mancher Nacht kam ihr die Frage: „Wenn ich mich lebendig begraben lassen sollte, oder Erneste sollte sterben, oder Mai: was würde ich wählen?“ Sie warf sich seufzend und heiß umher: nun hieß es sich entscheiden, das Furchtbarste auf sich nehmen. Und plötzlich war sie hindurch, sah Licht, war sanft und süß durchronnen und hatte sich dargebracht: „O, lieber, viel lieber will ich lebendig begraben werden!“
Sie war erschüttert; ein Drang nach Güte, eine schmerzliche Wallung von Liebenwollen hob ihr Herz auf; — und da kam rechtzeitig der neue Geschichtslehrer, Herr Dietrich. Er war schüchtern und ironisch, und er sprach immer wie zu erwachsenen Damen. Alle interessierten sich für ihn, einige erkundeten seine Lebensumstände. Er wohnte mit seiner Mutter und seinen jungen Geschwistern zusammen und unterhielt sie. Wie Lola von seinem Leben träumte! Liebreich mußte es dahinfließen, voll sanfter, gütiger, edler Gedanken. Mit zwei andern, die für ihn schwärmten, wagte sie es unter einem Vorwand, ihn aufzusuchen. Kein Teppich lag auf den weißen Dielen seines Zimmers. Herr Dietrich stand von seinem Schreibtisch auf, der dabei ins Wanken kam, und deckte verlegen ein Kissen auf einen Riß im Ledersofa. Das ganze Haus roch nach saurer Milch. Tagelang erbitterte Lola sich gegen Erneste, die ihn nicht besser bezahlte. Alle hätten hingehen sollen und es ihr vorhalten. Lola sonderte sich ab, so oft sie konnte, lernte den Leitfaden der Geschichte auswendig, und wenn sie ihn sich wiederholte, war es ihr, als sagte sie ihm etwas Liebes. Als sie an einem Märztag, es lag noch Schnee, allein im Garten gewesen war, kam sie erregt zu Erneste gelaufen.
„Erneste, ich weiß jetzt, wie der Frühling aussieht!“
„Wieso?“
„Wie Herr Dietrich sieht er aus!“
Lola leuchtete. Die Offenbarung, die sie soeben empfangen hatte, war einfach und tiefwahr.
Erneste dachte: „Mit zwölf Jahren schon? . . .“ Sie faßte sich und äußerte:
„Aber Kind, für ein Mädchen, das bald dreizehn wird, ist das doch zu kindisch. Herr Dietrich ist natürlich ein Mensch wie wir alle.“
Lola stutzte; war er das? Warum mußte sie dann soviel an ihn denken? Immer hatte sie jenen leichten Geruch von saurer Milch in der Nase: soviel dachte sie an Herrn Dietrich. „Ich will ihn mir ganz genau ansehen.“ Gerade heute war Herrn Dietrich sein gelber Strumpf über seinen schwarzen Schuh gerutscht. Lola starrte finster und nachdenklich darauf hin. Ähnliches konnte man auch bei andern Lehrern sehen: aber Herr Dietrich, der so edel war! an den Lola so viel denken mußte! Nun bemerkte sie auch, wie Herr Dietrich sich mit Jenny abgab; wie die dicke, freche Jenny, das Kinn auf der geziert ausgespreizten Hand, ihn anschmachtete; wie er errötend wegsah und, nachdem er ein wenig an seinem Kneifer gerückt hatte, ihr zulächelte. Da ward es Lola kalt und zornig zu Sinn; es trieb sie, Herrn Dietrich zu zeigen, daß er für sie durchaus kein Ideal sei. Er stand grade vor ihr; seine rötliche, knochige Hand lag auf ihrem Tisch; und in seiner Manschette konnte sie Haare sehen. Vorsichtig führte sie zwei Finger hinein, erfaßte ein Haar, machte „Kieks!“ — und da hatte sie’s. Herr Dietrich zuckte zusammen; dann rief er mit roter, entrüsteter Miene:
„So etwas tut man nicht!“
Lola, ziemlich erschrocken über ihre Tat, aber trotzig, betrachtete das Haar.
„Gib’s her!“ — und Herr Dietrich nahm es ihr weg.
Als er sie später etwas fragte, antwortete sie nicht, obwohl sie’s wußte. Sie beschloß ihm brieflich ihre Verachtung auszusprechen; den ganzen Nachmittag arbeitete sie daran. „Wenn ich einen Menschen gern habe, verlange ich mehr von ihm als von andern, Sie haben mich sehr enttäuscht,“ wollte sie ihm sagen, und: „Ich bin viel zu stolz, um jemand noch gern zu haben, der eine andere liebt.“ Indes fiel ihr ein, daß Herr Dietrich von ihrer Neigung nichts gewußt habe, und daß ihn darum auch ihre Enttäuschung nichts angehe. Wahrscheinlich würde er ihr mit seiner entrüsteten Miene den Brief zurückgeben und dazu schreien: „So etwas tut man nicht!“
Sie hielt sich nun für fertig mit der Liebe Dennoch verlor sie den Winter darauf ihr Herz an einen italienischen Leierkastenmann. Sie lag im Fenster und lebte in seinen Augen. Bleich und traurig schmachtete er herauf. Lola sagte:
„Wie ist er schön! Ich habe noch nie einen schönen Mann gesehen.“
Die dicke Jenny störte sie diesmal nicht: im Gegenteil, sie fragte, ob Lola seine Bekanntschaft machen wolle, sie begleite sie gern. Lola schrak zurück, sie wußte noch nicht, wovor. Aber am Sonntag wartete sie mit ihrem ganzen Wochengeld. Der Italiener kam, nur war er betrunken und kotbespritzt, fing Streit an und ward verhaftet. Lola warf aufs Geratewohl ihre zehn Mark hinunter und rettete sich.
Die Trennung von dieser Liebe war hart. Wochenlang zuckte Lola schmerzlich zusammen, pfiff jemand auf der Straße eine von des Italieners Arien. Bei der Ankündigung der Oper, aus der sie stammten, geriet Lola in Erregung und verlangte hin. Sogar die Begleitung der Ratte nahm sie mit in den Kauf. Auf ihrem Balkonplatz bekam sie Herzklopfen; aber wie sie sich den Leierkastenmann vor Augen rufen wollte, bemerkte sie, daß sein Bild unauffindbar war, und daß nur die Klänge und Gebärden von dort drüben sie erfüllten und bewegten. Ihr schien es der erste Theaterbesuch; und alles mutete sie wie eigene tiefe Erinnerungen an. Woran sie jemals ahnungsvoll gerührt hatte, das war hier aufgeschlossen und entzaubert. Der letzte Duft schöner Blumen, Namen, Gesichter schien hier herausgepreßt. Die Worte klangen alle voller und sinnreicher, die Dinge hatten höhere Farben, die Mienen erglänzten inniger. Hier wiederholte sich, hätte man meinen sollen, das Leben Lolas in stärkerem Licht: als habe sie dort auf der Bühne ihr eigenes Herz, höher schlagend, vor Augen. Alles, wofür man sonst keine Verwendung wußte, konnte hier spielen. Man konnte sich ganz geben, wie man war; denn die Menschen hielten endlich das, was man sich von ihnen versprach. Der Held dieser Oper war so edel, wie Herr Dietrich hätte bleiben sollen, und so schön wie der Italiener, ohne sich dabei zu betrinken.
Bei der Heimkehr war es Lola, als habe sie nun ein Zauberwort erfahren: Schauspielerin, und sei dadurch erlöst und mit sich selbst bekannt gemacht.
„Wie sonderbar!“ dachte sie im Bett und starrte zur dunklen Decke hinauf; „das also bin ich!“ Erneste rührte sich, und Lola hätte sie fast, in rascher Regung, aufgeweckt und ihr Schicksal Erneste offenbart. Noch hielt sie zurück; sie hatte sich erst selbst an seine Erkenntnis zu gewöhnen. Beim Aufwachen aber erschütterte sie sogleich ein großer Jubel; sie machte sich schnell fertig und lief zu Erneste, gerade so herzhaft und ohne Arg, wie damals, als sie mit der Nachricht kam, der Frühling sehe aus wie Herr Dietrich.
„Erneste!“ rief Lola, „weißt du, was ich werden will? Schauspielerin!“
„Auch gut,“ erwiderte Erneste und befestigte gelassen den Papierdeckel auf einem Glas mit Eingemachtem. Lola erklärte freudig:
„Gestern im Theater habe ich es gemerkt, und jetzt weiß ich es ganz genau.“
„Dummes Kind; trinke lieber deinen Kakao.“
„Warum, dumm? Ich glaube, daß ich Talent habe.“
„Das glaube ich auch: du rezitierst sehr niedlich; deswegen verfällt aber doch kein verständiges Mädchen auf solches dumme Zeug. Möchtest du wohl einen Löffel Gichtbeerenkompott?“
Verwirrt ließ Lola sich den Löffel in den Mund schieben.
„Nun geh, Kind,“ sagte Erneste, und Lola ging, den Kopf gesenkt. Vor der Tür zum Frühstückszimmer richtete sie sich auf und kehrte nach der Speisekammer zurück.
„Erneste!“
Lola war blaß, ihre Stimme hatte gezittert; Erneste sah sie sprachlos an.
„Erneste, du hast so getan, als ob es Scherz wäre. Es ist mir aber ganz ernst.“
„Um so schlimmer,“ sagte Erneste, polternd vor Schrecken. „Geh ins Klassenzimmer und erwarte, welche Strafarbeit ich dir aufgeben werde!“
„Ich will alle Strafarbeiten machen, die du mir aufgibst, Erneste. Aber ich bin fest entschlossen, Schauspielerin zu werden.“
Lola redete das wie ein Diktat; irgend eine Macht weihte sie zum Sprechen.
„Es ist das erste Mal, daß ich so zu dir spreche, Erneste: daraus kannst du ersehen, wie wichtig dies ist,“ sagte sie sanft, mit feuchten Augen; denn Erneste tat ihr leid. Erneste war auf einen Holzschemel gefallen; ihre von Fruchtsaft blauen Finger lagen wie tote kleine Soldaten durcheinander im Schoß; ihr Gesicht war ganz lang und über alle Maßen verstört.
„Was kannst du denn auch dagegen haben,“ meinte Lola, „wenn ich es nun einmal als meinen Beruf erkannt habe.“
Da aber kam alles wieder zu Leben an Erneste; sie sprang auf.
„Dein Beruf? Eine unanständige Person zu werden, das soll dein Beruf sein? Dazu habe ich dich durch sieben Jahre auf Gottes Wegen erhalten? Du weißt nicht, was du redest: das ist das einzige, was mir noch Hoffnung läßt. Jenny, mein Kind, sie weiß nicht, was sie redet; schweige um Gotteswillen über das was du gehört hast!“
Lola wandte sich um: in der Tür stand die dicke Jenny und sah sie mit heuchlerischem Entsetzen an.
„Du begreifst, Jenny, wenn sie dabei bliebe, das wäre noch schlimmer als das mit Susanne, und davon habe ich doch schon graue Haare. Versprich mir, mein Kind, daß niemand etwas erfahren soll!“
Jenny versprach es artig. Dann entließ Erneste sie; und da sie unbeachtet stand, ging auch Lola. Ernestes Aufregung begriff sie nicht. Lola wollte zur Bühne und möglichenfalls dieselben Stücke spielen, die in der Klasse gelesen wurden. Was hatte das mit Susanne zu tun, die weggeschickt war, weil sie irgend etwas, nicht recht verständliches, mit dem Gärtner zu tun gehabt haben sollte? Lola saß in Rätseln; aber schon nach der ersten Unterrichtsstunde fing sie neugierige Blicke auf, die sogleich, mit künstlicher Fremdheit, weggelenkt wurden; und auch die Lehrerin, die jetzt darankam, starrte erst einmal Lola recht unverschämt forschend ins Gesicht, und dann richtete sie plötzlich das Wort an eine andere. In der Pause bemerkte Lola, daß manche ihr auswichen, und daß einem harmlosen Mädchen, mit dem sie sprach, von Jenny und mehreren andern so lange bedeutsam gewinkt ward, bis es sich verlegen von Lola losmachte. Lola ging gradeswegs auf Jenny zu: was das eigentlich heiße. Jenny wendete sich gepeinigt hin und her, murmelte, als sei sie um Lolas willen in Sorge, daß nur keine es höre: das wisse Lola wohl selbst am besten; und rasch tauchte sie in einen Kreis Schwatzender.
Ernestes Benehmen war noch viel auffallender. Lola erinnerte sich nicht, daß Erneste jemals länger als eine Nacht mit ihr böse gewesen war. Am Morgen hatte sie sich immer anmerken lassen, daß sie gern versöhnt werden wolle. Dabei ging sie beinahe bittend zu Werke; infolge jeder von Lolas Ungezogenheiten war Erneste es, die gewissermaßen Vergebung suchte, und deren Miene um ein gutes Wort warb. Lola bat schwer um Verzeihung. Wenn sie sich dazu entschloß, tat sie’s aus Mitleid mit Erneste. Das junge Mädchen dachte dann an des Kindes erste Begegnung mit Erneste: als Erneste zuerst streng auf sie eingedrungen und plötzlich, wie sie Lolas Tränen sah, ganz aus der Fassung geraten war. So ging es immer. Erneste schien sich manchmal viel zu dünken, und plötzlich fiel sie in Schüchternheit. Nachdem sie anfangs ihre gnädige Gesinnung als Belohnung hingestellt hatte, bemühte sie sich schließlich um Lolas Zuneigung. Was sie bekam, war eine etwas geringschätzige Freundlichkeit.
Jetzt aber gebärdete sich Erneste, Tag um Tag, traurig und behutsam gegen Lola: wie wenn Lola schwer krank sei und man könne mit ihr nur noch wenig und leise reden. Lola sah: auch die wohlwollenden Mitschülerinnen bekamen davon die Empfindung, Lola sei aufgegeben; — und sie selbst geriet über sich ins Unklare. Hätte Erneste ihr Szenen gemacht! Lola würde sich versteift, sich behauptet haben. So erschien, was sie gewagt hatte, allmählich ihr selbst als etwas Ungeheuerliches. Keine andere also war dessen fähig! Lola fühlte sich abgesondert, ihre Schritte unheimlich gedämpft, ihr ganzes Dasein fragwürdig. „Bin ich denn anders als alle?“
Da erinnerte sie sich gewisser Träume, gewisser ahnender, grübelnder Gefühle, für die sie, kam sie damit heraus, nirgends Verständnis gefunden hatte. Befremdet und etwas peinlich berührt, hatte man sie stehen gelassen. Die besten hatten gutmütig gelacht. Auch das mit Herrn Dietrich und dem Frühling fiel Lola wieder ein: und nun bedeckte sie, im verschlossenen Schlafzimmer, die Augen mit den Händen, glühend rot durch diese vor Jahren gesprochenen Worte. Plötzlich richtete sie sich auf.
„Und ich bin doch so!“ sagte sie laut vor sich hin, und:
„Auch ich habe mein Recht!“
Sie überlegte:
„Sollte alles daher kommen, daß ich aus einem andern Lande bin? Wenn im Sommer alle stöhnen, dann wird mir erst wohl. Natürlich: ich gehöre gar nicht hierher! O, zu Hause, wie viel schöner war es zu Hause!“
Irgend ein glänzendes Bild aus Kindertagen war ihr unvermutet durch den Sinn geschossen; sie hielt den Atem an: es war fort. Durch Nachdenken wollte sie ihre Gefühle von einst zurückbannen: es kam nichts; und als sie endlich eins zu halten meinte, war es nur die Erinnerung an eine Ansicht aus den Tropen, die sie kürzlich in einer Zeitschrift gesehen hatte. Klagend trat sie ans Fenster, die Schultern hochgezogen, als träfe sie der kalte Regen, der gegen die Scheibe schlug.
„Hier bin ich nicht heimisch geworden; und das, was meine Heimat war, habe ich vergessen. Wohin gehöre ich denn?“
„Drüben hatte ich meine Familie und meine Freunde. Drüben verstanden alle mich. Drüben war ich glücklich.“
Und bittere Gedanken richteten sich gegen den Vater, der sie losgerissen und verbannt hatte.
„Warum grade mich? Nene hat dort bleiben dürfen. Pai kann mich niemals lieb gehabt haben!“
Lola überdachte seine Briefe und fand sie kalt. Gleichwohl schrieb Herr Gabriel ihr jeden zweiten Monat; und nur sein besonnener kaufmännischer Stil war schuld, daß seine Sätze kühl klangen. Lola war nicht gestimmt, die Liebe zu fühlen, die hinter den Worten bebte.
„Niemals hat er mich besucht, in all den Jahren!“
„Und wie grausam ist er gegen Mai gewesen! Mai, die weinte und mich festhalten wollte, als der große Schwarze mich forttrug!“
Das ganze phantastische Grausen jener Sturmnacht entstand noch einmal in Lola; und mit der Kinderangst von einst wallte Sehnsucht auf:
„Mai!“
Die Arme ausgestreckt:
„Mai! Mai!“
Ein weißer, glänzender Nebel erschien vor Lolas Augen und, weich darum gelegt, ein Rahmen aus dunklem Haar. Lola wollte Züge hervorlocken: der Nebel blieb leer; er drohte wegzufließen. Sie flüsterte bange Koseworte, hielt in ekstatischer Beschwörung dem Phantom ihrer Mutter die Lippen hin: umsonst. Lolas Kraft war aus und das Bild zerronnen.
Sie ergab sich nicht; sie suchte, mit einem Blick der Not, nach Hilfe umher, nach einem Anhalt — und traf auf eine alte Schreibmappe. „Mais Brief!“ Sie wühlte ihn heraus, legte aufschluchzend ihre Wange in das alte Papier. „Das kommt von Mai!“ Jeder dieser kleinen flüchtigen Buchstaben war ein Geschenk von Mai an Lola. Sie las darüber hin, lange Zeit. Dann enträtselte sie, mit Hilfe des Französischen, einige Worte. Dann sprach sie sie laut, fügte andere hinzu und horchte jedem nach, mit offenem Mund und seitwärts gewendeten Augen. Dazwischen erregtes Lachen: ja, so klang es. Ein Jubelruf: das war Mais Stimme! So sagte Mai dies! O, und dies war die schwarze Anna; und dies —. Die Namen ehemaliger Freundinnen klangen mit; ein Gesicht sprang aus einer Silbe, eine Begebenheit. Lola wußte nicht mehr, wohin sie lauschen sollte. Ihr Geist stürzte hinter alledem her, nach allen Seiten, wie ein Kind hinter Schmetterlingen. Minutenlang war sie glücklich. Schließlich zerflatterte alles; — aber Lola war nun gewiß: „Ich muß hinüber! O, gleich, gleich an Pai schreiben!“ Sie setzte sich daran, wollte schmeicheln, Pai günstig stimmen und fand vor fieberhaftem Drängen keine Worte. „Kann ich nicht telegraphieren? Kann ich nicht fliehen? Sofort? Sofort?“ Sie irrte, hochatmend, durchs Zimmer. Notdürftig gesammelt, schrieb sie:
„Lieber Pai, darf ich jetzt nicht bald zu Euch zurück? Du wolltest wohl, daß ich hier etwas lernen sollte. Ich kann Dir versichern, ich habe schon viel gelernt.“
Was sagte dies! Gegenüber erblickte sie ihr Spiegelbild in einem fremden Raum: in dem Raum, der sie seit sieben Jahren umfing und nun aussah wie ein Zufallsquartier zum Übernachten. Sie dachte ihr Gesicht neben denen draußen, ringsumher: lauter Gesichter mit anderen Wesenszügen, geformt von einem fremden Blut. Im Geist hörte sie die Stimmen: anders fallende Stimmen, Künderinnen fremder innerer Gewohnheiten. Sie schrieb:
„Ich hätte Dir noch viel zu sagen; aber ich kann mich nicht recht ausdrücken, da ich ja keine Sprache ganz beherrsche. Bitte, erlaube mir, daß ich kommen darf. Ich grüße Nene und Mai. Wäre es nicht möglich, daß ich ein Bild von Mai bekäme?“
Im Gefühl, sich gerächt zu haben, ging Lola zu den andern. Sie benahm sich so entschieden und selbstbewußt, daß Jenny mit ihr reden mußte und Erneste sie nicht länger durch leises Sprechen für krank ausgeben konnte. Am Abend fing sie sogar mit einer Streit an und, entgegen ihrer Alltagsnatur, bereute sie nichts von dem, was sie im Zorn gesagt hatte.
Sie blieb hochgemut: wie konnte Pai ihre Bitte abschlagen! — und inzwischen sammelte sie Anhängerinnen, denen sie den Ton angab, denen sie half, am Sonntag, bei den lebenden Bildern, in Kostümen und Kunst der Stellung die andern zu besiegen. Die Pension spaltete sich; die eine der Parteien scharte sich um Jenny, die andere um Lola, und jede warb mit Leidenschaft um die draußen wohnenden Schülerinnen. Erbitterte und wortlose. Kämpfe wurden bestanden. Einmal ward das Ziel des Ehrgeizes darin entdeckt, als erste beim Frühstück zu sein; aber mochten Jennys Freundinnen bei kaum grauendem Tag hinabschleichen: Lola mit den Ihren saß doch schon am Tisch. Am Abend hatte sie von sich zu den andern, unter den Stubentüren hindurch, einen Bindfaden geleitet. Jede war mit der Nächsten verbunden; regte sich eine, erwachten alle; und geschlafen hatte keine. Dafür genoß man nun Triumphgefühle, die einen sprengten.
Zu Lolas Hochgefühl wirkte Verachtung mit. Sie übte ihre Macht als Parteiführerin und dachte dabei: „Was ihr alle mich angeht! Wie lange dauert dies überhaupt noch! In vierzehn Tagen ist Pais Brief da!“ Manchmal sah sie Erneste an, die nichts ahnte, und konnte ihr Frohlocken kaum niederringen. Einmal verriet sie sich. Am Sonntag nachmittag hatte Jenny gesungen: etwas peinlich Sentimentales, wobei sie himmelte und die Fingerspitzen auf die Brust setzte. Lola rief aus tiefster Seele:
„Das ist aber über alle Maßen geschmacklos!“
Jennys Anhängerinnen gaben dies nicht zu; nicht einmal unter ihren eigenen waren viele der Meinung Lolas. Die Tochter eines Reichstagsabgeordneten sagte:
„Es war so deutsch.“





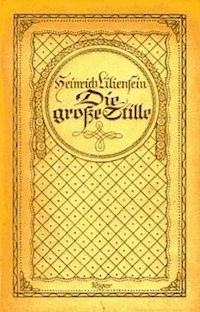






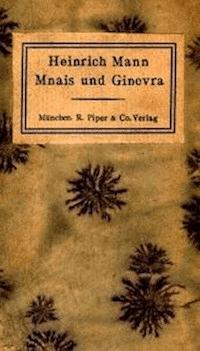


![Tonio Kröger [Erstausgabe; Illustrationen von Erich M. Simon] - Mann, Thomas - kostenlos E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3a478194097d1eb0cb64b212ce4fdaa/w200_u90.jpg)