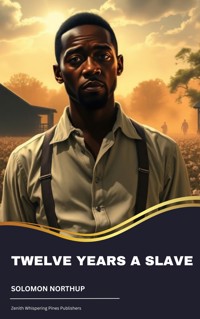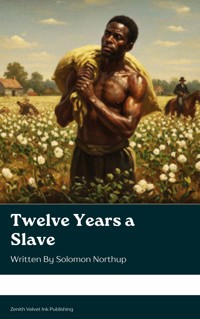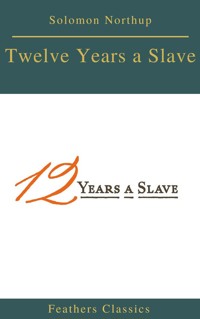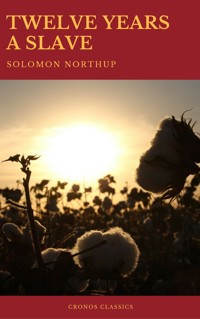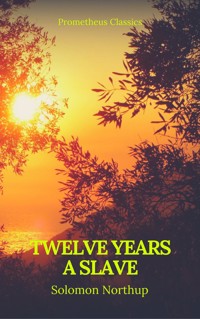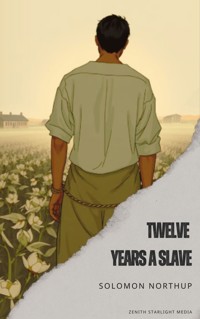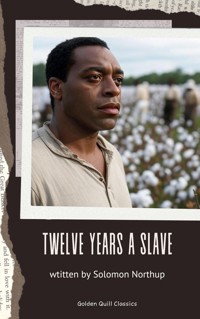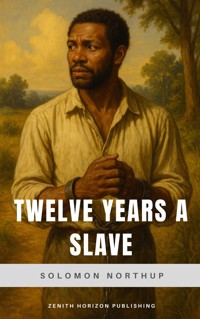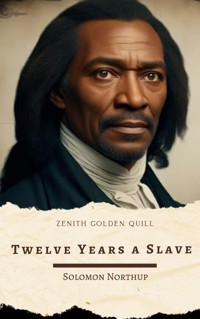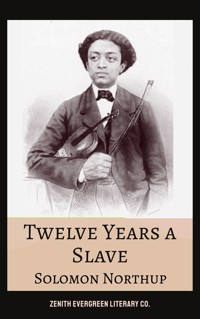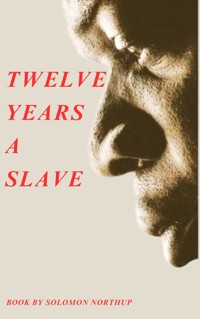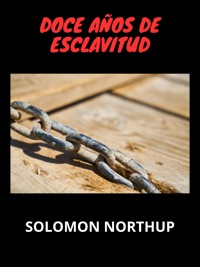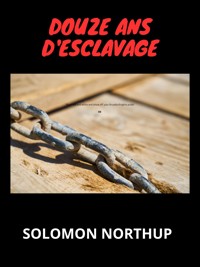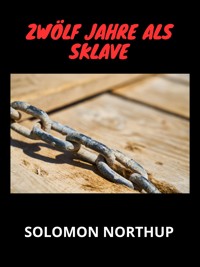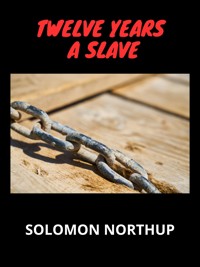Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dies ist die detailgetreue Übersetzung und Gesamtausgabe des Bestsellers "12 Years A Slave", verfilmt 2013, bereits heute ausgezeichnet mit dem Golden Globe als Bester Film und einer der ersten Anwärter auf den Oscar. "Zwölf Jahre Ein Sklave" ist die Geschichte des Solomon Northup, der - obwohl als freier Mann geboren - zwölf lange Jahre versklavt wurde. Northups Geschichte war nicht nur eine der ersten ihrer Art, sondern auch eine der prägnantesten, informativsten und unverfälschtesten. Versklavt für Jahre und mehrfach weiterverkauft musste er die Peitsche, Hunger und Beleidigungen ertragen. Umso beeindruckender ist sein Bericht. Northup war ein freier Bürger des Bundesstaats New York, als man ihn kidnappte und am Red River in Louisiana in die Sklaverei verkaufte. Dort wurde er zwölf Jahre getrieben, ausgepeitscht und von brutalen Plantagenbesitzern herumgestoßen bis ihn ein Freund aus dem Norden rettete und mit seiner Familie zusammenführte. Trotz seiner schrecklichen Leidensgeschichte ist es ihm gelungen, sein Unglück so gerecht wie möglich zu beschreiben - eine nicht unbedeutende Leistung, zu der nur wenige in seiner Situation fähig gewesen wären. Die feinsinnigen Beobachtungen und bedächtigen Abschätzungen des hochintelligenten Northup machen "Zwölf Jahre Ein Sklave" zu einem überragenden Zeitzeugnis der Sklaverei. Als historisches Dokument schlägt es die bezaubernd einfache Geschichte des Vaters Henson um Längen. Geduldig, verlässlich und ohne Bosheit erzählt ist es wertvoller als die Geschichte von Beecher-Stowes Märtyrer "Onkel Tom" und ein stärkeres Argument gegen die Sklaverei als es die Berge von argumentativen Schriften und ethischen Diskursen jemals sein können
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwölf Jahre Ein Sklave
Die Geschichte des Solomon Northup,
Bürger des Staates New York,
Gefangen genommen in Washington 1841,
Inhalt:
Einführung
Die Geschichte des Solomon Northup
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Zwölf Jahre Ein Sklave, Solomon Northup
© 2013, Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849643003
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Einführung
Dies ist die originalgetreue, deutsche Übersetzung des Buches von Solomon Northup, jüngst verfilmt, mit dem Golden Globe und dem Oscar 2014 als bester Film ausgezeichnet. Vieles, was auf den nächsten Seiten erzählt und gesagt wird, ist hinreichend belegt – vieles basiert aber auch einzig auf Solomons Gedächtnisprotokollen. Der Herausgeber der englischen Originalausgabe, der die Gelegenheit hatte, Widersprüche und Unstimmigkeiten mit den Original-Manuskripten abzugleichen, hat sich strikt an die aufgeschriebene Geschichte gehalten ohne auch nur im kleinsten Detail davon abzuweichen.
Es war Solomons „Glück“, dass er während seiner Gefangenschaft mehrere Besitzer hatte. Die Behandlung auf „Pine Woods“ zeigt deutlich, dass es auch unter den Sklavenhaltern sowohl humane, als auch grausame Männer gab. Von einigen spricht er mit dankbaren Gefühlen – von anderen mit bitteren Worten. Wir dürfen annehmen, dass speziell die Ereignisse, die am Bayou Boeuf passiert sind, alle Facetten der Sklaverei, sowohl Licht als auch Schatten, widergeben. Unvoreingenommen und ohne jedes Vorurteil hat der Herausgeber die Geschichte aufgeschrieben, so wie sie von den Lippen Solomon Northups erzählt wurde – eine wirklichkeitsgetreue Geschichte seines Lebens.
Die Geschichte des Solomon Northup
Kapitel 1
Ich wurde als freier Mann geboren und genoss die Vorzüge der Freiheit in einem freien Land mehr als dreißig Jahre lang. Dann wurde ich gefangen genommen und als Sklave verkauft, was ich bis zu meiner Rettung im Januar 1853 zwölf lange Jahre geblieben bin. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass ein Bericht über mein Leben und meine Erlebnisse für die Öffentlichkeit von Interesse sein würde.
Seit meiner Rückkehr in die Freiheit ist es mir nicht entgangen, dass sich die nördlichen Bundesstaaten mehr und mehr für das Thema Sklaverei interessierten. Prosaliteratur, die mehr darauf ausgerichtet war, die positiven als die abscheulichen Aspekte zu schildern, ist in vorher nie gekanntem Ausmaß erschienen und bot einen fruchtbaren Nährboden für Kommentare und Diskussionen.
Ich kann über Sklaverei nur soweit Auskunft geben, wie ich sie selbst erlebt habe, wie ich sie selbst beobachten konnte. Mein Ziel ist es, eine offene und ehrliche Abhandlung von Fakten zu schreiben: die Geschichte meines Lebens zu wiederholen, ohne zu übertreiben. Dabei möchte ich es dem Leser überlassen, selbst zu beurteilen, ob die angesprochene Prosa eher über- oder untertreibt.
So weit zurück, wie ich es sicher weiß, waren meine Vorfahren väterlicherseits Sklaven in Rhode Island. Sie waren im Besitz einer Familie namens Northup, von denen sich einer in Hoosic, im Rensselaer County des Staates New York, niederließ. Er nahm meinen Vater Mintus Northup mit. Nach dem Tod dieses Gentlemans, ungefähr vor fünfzig Jahren, war mein Vater ein freier Mann, was durch das Testament seines Herrn verfügt war.
Henry B. Northup, Landjunker von Sandy Hill und renommierter Rechtsanwalt, ist der Mann, dem ich meine Freiheit und die Rückkehr zu meiner Familie und meinen Kindern verdanke und ein Verwandter der Familie, in der meine Vorfahren ihren Dienst verrichteten. Von ihm, der auch ein intensives Interesse an mir und meiner Geschichte zeigte, stammt auch der Name, den ich trage.
Irgendwann nach der Freisetzung meines Vaters zog dieser nach Minerva, Essex County, New York, wo ich im Juli 1808 geboren wurde. Ich kann nicht sicher sagen, wie lange er dort wohnen blieb. Von dort zog es ihn nach Granville, Washington County, wo er in der Nähe von Slyborough einige Jahre auf der Farm von Clark Northup, einem Verwandten seines alten Herren, arbeitete; von dort ging er zur Alden Farm, etwas nördlich des Dorfes Sandy Hill gelegen; und von dort zur Farm, die jetzt im Besitz von Russel Pratt ist und an der Straße von Fort Edward nach Argyle liegt. Dort blieb er bis zu seinem Tode am 22. November 1829. Er hinterließ eine Witwe und zwei Kinder; mich, und Joseph, meinen älteren Bruder. Letzterer lebt immer noch im County von Oswego, nahe der gleichnamigen Stadt. Meine Mutter starb während meiner Gefangenschaft.
Obwohl er als Sklave geboren wurde und unter den Nachteilen der unglücklichen Rasse, der er angehörte, zu leiden hatte, war mein Vater wegen seines Fleißes und seiner Integrität ein respektierter Mann - wie viele, die noch leben, bestätigen werden. Er widmete sein Leben dem friedlichen Geschäft der Landwirtschaft und suchte immer die Anstellung in den niederen Tätigkeiten, die scheinbar speziell den Kindern Afrikas vorbehalten waren. Neben der Tatsache, dass er uns Kindern eine Bildung angedeihen ließ, die jenseits dessen war, was Kinder unserer Abstammung normalerweise erhalten, hatten ihm sein Fleiß und seine Sparsamkeit ausreichend Besitz verschafft, um das Wahlrecht zu erhalten. Er hatte es zur Gewohnheit gemacht, uns von seinem früheren Leben zu erzählen; und obwohl er immer in den höchsten Tönen, ja sogar Hingebung, von der Familie, in der er angestellt war erzählte, begriff er doch, was Sklaverei hieß und war in tiefer Sorge ob der Erniedrigung seiner Rasse. Er war stets darauf bedacht, uns moralische Grundsätze beizubringen und uns das Vertrauen in Ihn, der die niedrigsten wie auch die höchsten Kreaturen gleich behandelt, zu lehren. Wie oft habe ich über seine väterlichen Ratschläge nachgedacht, während ich in einer Sklavenhütte im entfernten Louisiana lag, unter den unverdienten Wunden leidend, die mir ein unmenschlicher Herr beigebracht hatte; mich nur nach dem Grab sehnend, in dem mein Vater lag, und das mich doch auch nicht vor der Peitsche des Schinders bewahren hätte können. Im Kirchenfriedhof von Sandy Hill weist nur ein kleiner, bescheidener Stein die Stelle, wo er ruht. Stets hatte er seine Pflichten in denen ihm von Gott zugedachten niederen Gesellschaftskreisen aufs Beste erfüllt.
Bis zu dieser Zeit war ich hauptsächlich und zusammen mit meinem Vater mit der Arbeit auf unserer Farm beschäftigt gewesen. Die wenigen Stunden Freizeit, die mir blieben, verbrachte ich meistens über meinen Büchern oder mit dem Spiel auf der Geige - eine leidenschaftliche Beschäftigung in meiner Jugendzeit. Die Musik war auch eine Quelle des Trostes und der Freude für die einfachen Menschen, die mein Los teilten, und führte meine eigenen Gedanken für viele Stunden weg von meinem schrecklichen Schicksal.
An Weihnachten 1829 heiratete ich Anne Hampton, ein farbiges Mädchen, das zu diesem Zeitpunkt in der Nähe unseres Anwesens lebte. Die Zeremonie wurde in Fort Edward von Landjunker Timothy Eddy abgehalten, einem Stadtrat und auch heute noch prominenten Bürger dieses Ortes. Anne hatte längere Zeit in Sandy Hill bei Mr. Baird, dem Inhaber der Eagle Tavern, und in der Familie von Reverend Alexander Proudfit aus Salem gelebt. Dieser Gentleman war viele Jahre Vorsitzender der dortigen Presbyterianischen Gesellschaft. Anne erinnert sich heute noch voller Dankbarkeit an die überaus große Güte und hervorragenden Ratschläge dieses guten Mannes. Sie selbst kann nichts Genaues über ihre Abstammung sagen, aber das Blut dreier Rassen hat sich in ihren Venen vermischt. Es ist schwer zu sagen, ob das rote, weiße oder schwarze dominiert. Aber diese Mischung hat ihr eine einzigartige und anziehende Ausdruckskraft gegeben, wie man sie selten findet. Obwohl sie einer Mischlingsfrau sehr ähnlich sah, war sie doch keine. Und ich konnte das beurteilen, war doch meine Mutter eine solche Mischlingsfrau.
Ich hatte gerade meine Minderjährigkeit beendet und war im vergangenen Juli 21 Jahre alt geworden. Des Rates und der Hilfe meines Vaters beraubt und mit einer Frau, die von meiner Unterstützung abhängig war, begann ich ein Leben des Fleißes zu führen. Trotz meiner hinderlichen Hautfarbe und dem Bewusstsein meiner niederen Abstammung schwelgte ich in Träumen von einer guten Zeit, in der mich mein bescheidener Wohnsitz und die wenigen ihn umgebenden Felder mit Freude und Annehmlichkeiten belohnen würden.
Vom Zeitpunkt meiner Heirat bis heute war die Liebe, die ich für meine Frau empfand, immer aufrichtig und ohne Makel; und nur diejenigen, die selbst die überwältigenden und zärtlichen Gefühle eines Vaters für seinen Nachwuchs erlebt haben, werden meine Hingabe für die geliebten Kinder, die uns geboren wurden, verstehen können. Ich halte es für angemessen, ja sogar notwendig, dies zu betonen. Nur so werden die Leser dieser Seiten die Intensität der Schmerzen, die ich zu tragen hatte, verstehen.
Unmittelbar nach unserer Hochzeit zogen wir in ein altes, gelbes Gebäude, das zu diesem Zeitpunkt am südlichen Rand von Fort Edward stand. Es wurde später in eine moderne Villa umgewandelt und in letzter Zeit von Captain Lathrop bewohnt. Es ist bekannt als das Fort House. Es diente als Gerichtsgebäude und wurde im Jahr 1777 wegen seiner Lage in der Nähe des alten Forts am linken Ufer des Hudsons von Burgoyne in Besitz genommen.
Während des Winters war ich mit anderen damit beschäftigt, den Champlain Kanal zu reparieren. Ich arbeitete in dem Abschnitt, den William Van Nortwick beaufsichtigte. David McEachron hatte die direkte Befehlsgewalt über die Männer, die mit mir zusammen arbeiteten. Als der Kanal im Frühjahr eröffnete, erlaubten mir meine Ersparnisse ein paar Pferde und einige andere Dinge, die man für die Schifffahrt brauchte, zu kaufen.
Nachdem ich mehrere tüchtige Hände eingestellt hatte, schloss ich Verträge für den Transport großer Bauholzflöße vom Lake Champlain hinunter nach Troy. Dyer Beckwith und ein Mister Bartemy aus Whitehall begleiteten mich auf einigen Reisen. Während der Saison perfektionierte ich die Kunst und die Geheimnisse des Flößens - ein Wissen, das mich später befähigte, einem ehrenwerten Herren gewinnbringende Geschäfte anbieten zu können und das die einfachen Holzfäller an den Ufern des Bayou Boeuf immer wieder in Erstaunen versetzte.
Während einer meiner Reisen den Lake Champlain hinunter wurde ich eingeladen, einen Abstecher nach Kanada zu machen. In Montreal besichtigte ich die Kathedrale und andere interessante Plätze dieser Stadt. Ich setzte meine Rundreise nach Kingston und anderen Städten fort und eignete mir ein Wissen über diese Örtlichkeiten an, das mir später ebenfalls sehr nützlich wurde. Darüber werden wir am Ende dieses Berichtes mehr erfahren.
Nachdem ich meine Verträge am Kanal zu meiner eigenen und zur Zufriedenheit meines Arbeitgebers erfüllt hatte und nicht untätig bleiben wollte zu einem Zeitpunkt, als die Schifffahrt auf dem Kanal eingestellt worden war, schloss ich einen weiteren Vertrag mit Medad Gunn. Ich sollte für ihn eine größere Menge Holz schlagen und war damit während des Winters 1831-32 beschäftigt.
Als der Frühling kam, fassten Anne und ich den Kauf einer Farm in der Nachbarschaft ins Auge. Schon von frühester Jugend an war ich an landwirtschaftliche Arbeit gewöhnt und der Beruf kam meinen Vorstellungen vom Leben geradezu entgegen. Also schloss ich einen Pachtvertrag für einen Teil der alten Alden Farm, auf der mein Vater einst gewohnt hatte. Mit einer Kuh, einem Schwein und zwei Ochsen, die ich kurz vorher von Lewis Brown in Hartford erworben hatte, sowie weiteren persönlichen Besitztümern, zogen wir in unser neues Heim nach Kingsbury. In diesem Jahr pflanzte ich 25 Morgen Mais, bestellte riesige Felder mit Hafer und hatte die Landwirtschaft so groß aufgezogen, wie es mir meine Mittel maximal erlaubten. Anne kümmerte sich um die Hausarbeit, während ich emsig in den Feldern zugange war.
Hier wohnten wir bis 1834. Während der Winter hatte ich viele Auftritte mit meiner Geige. Wo auch immer die jungen Leute sich zum Tanz versammelten, war auch ich. Überall in den umliegenden Dörfern war meine Geige berühmt. Anne war aufgrund ihres langen Aufenthalts in der Eagle Tavern als Köchin bekannt geworden. Während der Wochen, in denen Gericht gehalten wurde, und an öffentlichen Veranstaltungen durfte sie unter guter Bezahlung in der Küche von Sherrills Coffee House arbeiten.
Immer kamen wir von der Ausübung unserer Dienste mit Geld in den Taschen nachhause; bald hatten wir, dank Geigenspiel, Kochen und Landwirtschaft, ein stattliches Vermögen und lebten ein glückliches und wohlhabendes Leben. Nun, wäre es nach uns gegangen, wären wir auf der Farm bei Kingsbury geblieben; aber die Zeit war gekommen, um den nächsten Schritt in Richtung des grausamen Schicksals, das mich erwartete, zu tun.
Im März 1834 zogen wir nach Saratoga Springs in ein Haus, das Daniel O'Brien gehörte und am nördlichen Ende der Washington Street lag. Zu dieser Zeit betrieb Isaac Taylor eine große Pension am nördlichen Ende des Broadways, bekannt als Washington Hall. Er stellte mich als Taxifahrer ein. In dieser Position arbeitete ich zwei Jahre für ihn. Nach dieser Zeit arbeitete ich immer während der Sommersaison; auch Anne war angestellt und arbeitete im United States Hotel oder in anderen Gaststätten der Stadt. Während des Winters verließ ich mich auf meine Geige, auf der ich während des Baus der Troy und Saratoga Eisenbahn so manchen harten Arbeitstag wegspielte.
In Saratoga war es Brauch, dass man die Artikel, die man zum Leben benötigte, in den Läden von Mr. Cephas Parker und Mr. William Perry kaufte - beides ehrenwerte Männer, für die ich, ob ihrer vielen netten Gesten, starke Gefühle der Hochachtung hatte. Dies war auch der Grund, warum ich zwölf Jahre später den Brief, der am Ende des Buches eingefügt ist und der den Weg zu meiner glücklichen Befreiung geebnet hat, genau ihnen geschickt habe.
Während wir im United States Hotel lebten, traf ich oft auf Sklaven, die ihre Herren aus dem Süden begleiteten. Sie waren immer gut gekleidet und versorgt und führten offenbar ein lockeres Leben, das nur durch wenige Alltagssorgen gestört wurde. Oft unterhielten sie sich mit mir über das Thema der Sklaverei. Allen gemeinsam war der heimliche Wunsch nach Freiheit. Einige äußerten sogar den leidenschaftlichen Wunsch, zu fliehen und fragten mich nach der besten Methode, wie dies gelingen könnte. Allerdings reichte in allen Fällen die Angst vor der Bestrafung, die ganz sicher nach ihrer Ergreifung und Rückkehr über sie hereinbrechen würde, sie von diesem Versuch abzubringen. Ich selbst hatte mein ganzes Leben die freie Luft des Nordens geatmet und war mir sicher, dass in mir die gleichen Emotionen und Leidenschaften herrschten, die auch die Brust eines weißen Mannes füllten; sicher auch, dass ich eine Intelligenz besaß, die einem Mann mit hellerer Hautfarbe gerecht werden würde. Ich war zu ignorant, vielleicht zu unabhängig, um zu verstehen, wie hier jemand in dem absurden Abhängigkeitsverhältnis eines Sklaven leben konnte. Ich konnte die Gerechtigkeit eines Gesetzes, oder einer Religion, die die Prinzipien der Sklaverei aufrechterhält, nicht nachvollziehen; und nicht ein einziges Mal, das sage ich mit Stolz, habe ich nicht darauf hingewiesen, dass jeder seinen Kampf für die Freiheit selbst führen muss.
Ich lebte in Saratoga bis ins Frühjahr 1841. Die Verlockungen, denen wir vor sieben Jahren in unserer ruhigen Farm am Ufer des Hudsons erlegen waren, hatten sich nicht erfüllt. Obwohl wir immer bequem gelebt hatten, waren wir nicht zu Wohlstand gelangt. Die Gesellschaft und die Vereine in dem weltbekannten Kurort waren nicht in Übereinklang zu bringen mit den Idealen von Fleiß und Sparsamkeit, die ich gelernt hatte; ganz im Gegenteil herrschte hier Unbeholfenheit und Extravaganz.
Zu dieser Zeit waren wir Eltern dreier Kinder - Elizabeth, Margaret, und Alonzo. Elizabeth, die Älteste, war zehn; Margaret war zwei Jahre jünger und Alonzo war gerade erst fünf geworden. Sie erfüllten unser Haus mit Freude und ihre jungen Stimmen waren Musik in unseren Ohren. Ich und ihre Mutter haben manches Luftschloss für sie gebaut. Wenn ich nicht gearbeitet habe, bin ich immer mit ihnen durch die Straßen und Haine von Saratoga gegangen. Ihre Gegenwart war eine Lust für mich; und ich drückte sie an meine Brust mit so warmer und zärtlicher Liebe, als ob ihre dunkle Haut so weiß wie Schnee gewesen wäre.
Kapitel 2
Eines Morgens, gegen Ende des Monats März im Jahr 1841, hatte ich keine Arbeit, der ich mich zuwenden hätte können. So ging ich durch die Straßen von Saratoga Springs und dachte darüber nach, wo ich schnell eine Beschäftigung bekommen könnte, um die Zeit bis zur Saison zu überbrücken. Anne hatte wie gewöhnlich die 20 Meilen hinüber nach Sandy Hill hinter sich gebracht, um die Leitung der Küche in Sherrills Coffee House während der Gerichtswochen zu übernehmen. Elizabeth, glaube ich, hatte sie begleitet. Margaret und Alonzo waren bei ihrer Tante in Saratoga.
An der Ecke Congress Street und Broadway, nahe der Gaststätte, die damals und – soweit mir bekannt – auch später noch im Besitz von Mr. Moon war, traf ich auf zwei Gentlemen von bemerkenswerter Erscheinung. Keinen von ihnen hatte ich jemals vorher gesehen. Ich hatte den Eindruck, dass sie durch einen meiner Bekannten erfahren hatten, dass ich ein ausgezeichneter Geigenspieler war. Leider kann ich mich bis heute nicht erinnern, wer dieser Bekannte war.
Auf jeden Fall begannen sie sofort eine Unterhaltung über dieses Thema und stellten einige Fragen, um den Stand meines Könnens auszuloten. Nachdem meine Antworten augenscheinlich zufriedenstellend waren, boten sie an, meine Dienste für eine kurze Zeit in Anspruch zu nehmen - immer betonend, dass ich genau die Person war, die sie suchten. Ihre Namen, die sie mir später nannten, waren Merrill Brown und Abram Hamilton - wobei ich starke Zweifel habe, dass dies ihre wirklichen Namen waren. Ersterer war ungefähr 40 Jahre alt, etwas kleiner und untersetzt und seine Haltung verriet Verschlagenheit und Intelligenz. Er trug einen schwarzen Gehrock und einen Hut gleicher Farbe und sagte, dass er in Rochester oder Syracuse beheimatet war. Der zweite war ein junger Mann von normaler Gestalt und mit leuchtenden Augen; ich würde sagen, dass er nicht älter als 25 war. Er war groß und schlank und mit einem mehrfarbigen Mantel, einem glänzenden Hut und einer Weste mit elegantem Muster bekleidet. Seine ganze Kleidung war sehr modisch. Sein Gehabe war irgendwie weibisch, nichtsdestotrotz besitzergreifend und ihn umhüllte eine Aura, die verriet, dass er die Welt gesehen hatte. Sie gehörten, so sagten sie mir, zu einem Zirkus, der gerade in Washington war; dass sie auf dem Weg dorthin zurück wären, einen Ausflug Richtung Norden unternommen hätten, um das Land zu sehen, und ihre Ausgaben durch gelegentliche Vorstellungen deckten. Sie bemerkten ebenso, dass es schwierig war, Musiker für ihre Vorstellungen zu finden und dass sie mir, wenn ich sie bis New York begleiten würde, einen Dollar pro Tag meiner Dienste und zusätzlich drei Dollar pro Vorstellung bezahlen würden. Ebenso würden sie die Kosten für meine Rückfahrt von New York nach Saratoga übernehmen.
Ich nahm dieses verlockende Angebot sofort an, einerseits wegen des versprochenen Geldes, andererseits wegen des Verlangens, die Großstadt zu besuchen. Sie waren darauf bedacht, sofort aufzubrechen. In der Annahme, dass meine Abwesenheit nur von kurzer Dauer wäre, hielt ich es nicht für notwendig, Anne zu schreiben, wohin ich gegangen war; ich nahm an, dass sich meine Rückkehr ungefähr mit ihrer decken würde. Nachdem ich Bettwäsche zum Wechseln und meine Violine eingepackt hatte, war ich fertig zur Abreise. Die Kutsche fuhr vor - ein geschlossenes, von zwei edlen Braunen gezogenes Gefährt. Alles machte einen sehr eleganten Eindruck. Ihr Gepäck, aus drei großen Koffern bestehend, wurde auf dem Dach befestigt und während sie ihre Plätze hinten einnahmen, kletterte ich mit auf den Kutschersitz. Ich verließ Saratoga auf der Straße in Richtung Albany, beschwingt von meiner neuen Anstellung, so glücklich, wie ich noch nie in meinem Leben gewesen war.
Wir fuhren durch Ballston, trafen auf die Ridge Road - wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, wurde sie so genannt - und folgten dieser bis nach Albany. Wir erreichten die Stadt noch vor Dunkelheit und hielten bei einem Hotel etwas südlich vom Museum. Diese Nacht hatte ich die Gelegenheit, Zeuge einer ihrer Vorführungen zu werden - es blieb die einzige während der ganzen Zeit, die ich bei Ihnen war. Hamilton stand an der Tür; ich war das Orchester, während Brown für die Unterhaltung zuständig war. Diese bestand aus dem Werfen von Bällen, Seiltanz, dem Braten von Pfannkuchen in einem Hut, dem Quieken unsichtbarer Schweine, Bauchreden und Taschenspielereien. Publikum war nur sehr spärlich vertreten und nicht von der erlesensten Sorte. Obendrein stand in Hamiltons Bericht über die Einnahmen nicht mehr als das, was ein Bettler am Ende eines Tages in seinem Hut wiederfindet.
Früh am nächsten Morgen brachen wir wieder auf. Ihre Unterhaltung war nun eingefärbt von der Sorge, den Zirkus ohne jede weitere Verzögerung zu erreichen. Ohne noch einmal anzuhalten für eine weitere Vorstellung, preschten sie voran und nach einiger Zeit hatten wir New York erreicht. Dort bezogen wir eine Unterkunft im Westen der Stadt in einer Straße, die vom Broadway zum Fluss führte. Ich dachte, meine Reise sei zu Ende und erwartete, dass ich in ein oder zwei Tagen wieder zu meinen Freunden und meiner Familie nach Saratoga zurückkehren könne. Brown und Hamilton begannen aber mich zu bedrängen, mit ihnen nach Washington zu reisen. Sie behaupteten, dass der Zirkus, nun da die Sommersaison begonnen habe, sich sofort nach unserer Ankunft in Richtung Norden begeben würde. Sie versprachen mir eine Anstellung und einen hohen Lohn, wenn ich sie begleiten würde. Ausführlich beschrieben sie mir die Vorteile und schmeichelten mir derart, dass ich schließlich beschloss, ihr Angebot anzunehmen.
Am nächsten Morgen schlugen sie vor, nachdem wir kurz davor waren, in einen Bundesstaat einzureisen, in dem Sklaverei erlaubt war, die nötigen Dokumente für mich aufzutreiben, bevor wir New York verlassen. Diese Idee erschien mir sehr umsichtig, obwohl ich glaube, dass mir das vermutlich nicht eingefallen wäre, wenn sie es nicht vorgeschlagen hätten. Wir steuerten sofort das Zollhaus an – zumindest glaube ich, dass es eins war. Sie versicherten dort eidesstattlich, dass ich ein freier Mann war. Ein Papier wurde ausgestellt und uns übergeben mit dem Hinweis, es zum Büro des Buchhalters zu bringen. Das taten wir und nachdem der Buchhalter dem Dokument etwas hinzugefügt hatte, für das er sechs Schilling bekam, kehrten wir zum Zollhaus zurück. Dort gab es noch einige andere Formalitäten zu erledigen. Nachdem wir dem Beamten zwei Dollar bezahlt hatten, konnte ich die Papiere endlich in Empfang nehmen und mit meinen beiden Freunden in unser Hotel zurückgehen. Ich muss gestehen, dass ich zu dieser Zeit dachte, dass diese Papiere wohl kaum die Kosten ihrer Ausstellung wert waren; aber ich dachte auch nicht im entferntesten daran, dass es irgendwo eine Gefahr für meine persönliche Sicherheit geben könnte. Ich erinnere mich, dass der Buchhalter, zu dem wir geschickt wurden, eine Notiz in einem großen Buch machte, welches vermutlich noch immer in seinem Büro liegt. Sollte jemand Zweifel haben an den hier gemachten Angaben haben, wird ein Blick auf diese Eintragungen, die aus dem März oder April 1841 stammen, genügen, um die Echtheit zu bestätigen, wenigstens für diesen Teil der Erzählung.
Mit dem Beweis der Freiheit in meinem Besitz nahmen wir am Tag nach unserer Ankunft in New York die Fähre nach Jersey City und anschließend die Straße nach Philadelphia. Dort blieben wir eine Nacht und setzten die Reise früh am nächsten Morgen in Richtung Baltimore fort. Schließlich erreichten wir letztgenannte Stadt und stiegen in einem Hotel in der Nähe des Eisenbahndepots ab. Es war das Rathbone House, das vielleicht so hieß, weil sein Besitzer ein Mr. Rathbone war. Während der gesamten Fahrt war die Sorge meiner Begleiter, den Zirkus noch rechtzeitig zu erreichen, ständig größer geworden. Wir ließen das Fuhrwerk in Baltimore und stiegen in den Zug nach Washington, wo wir kurz vor Dunkelheit ankamen. Es war der Vorabend von General Harrisons Begräbnis und wir stiegen im Gadsbys Hotel an der Pennsylvania Avenue ab.
Nach dem Abendessen riefen sie mich in ihr Apartment und zahlten mir 43 Dollar – eine Summe, die um einiges größer war als mein verdienter Lohn. Sie begründeten diese Großzügigkeit damit, dass sie während unserer Reise von Saratoga hierher nicht so viele Vorstellungen gegeben hatten, wie sie es mir versprochen hatten. Darüber hinaus informierten sie mich, dass es die Absicht des Zirkus gewesen sei, Washington am nächsten Morgen zu verlassen und dass man beschlossen hatte, dies wegen des bevorstehenden Begräbnisses um einen Tag zu verschieben. Sie waren, wie die ganze Zeit seit unserem ersten Treffen, sehr zuvorkommend und nett. Sie ließen keine Gelegenheit aus, um mir schön zu reden; andererseits war ich auch sehr voreingenommen und zu ihren Gunsten gestimmt. Ich ließ sie mein vorbehaltloses Vertrauen spüren und hätte ihnen zu diesem Zeitpunkt alles abgekauft. Ihre Konversation mit mir und ihr ganzes Verhalten mir gegenüber, ihre Voraussicht bezüglich der Dokumente und viele andere Kleinigkeiten, die hier nicht erwähnt werden müssen – alles ließ mich glauben, dass sie echte Freunde waren, nur auf mein Wohlergehen bedacht. Ich weiß immer noch nicht, ob sie unbeteiligt waren an der ganzen Bosheit, derer ich sie heute beschuldige. Ob sie nur Helfershelfer meines Unglücks waren, raffinierte und unmenschliche Monster in Menschengestalt, einzig und allein darauf aus, mich um des Geldes willen von Heim, Familie und Freiheit wegzulocken – derjenige, der diese Zeilen liest, möge dies selbst entscheiden, er hat nun die gleichen Kenntnisse wie ich. Wenn sie unschuldig waren, war mein plötzliches Verschwinden schlicht unerklärlich; zieht man aber alle Begleitumstände in Betracht, ist es mir unmöglich, mich ihnen gegenüber nachsichtig zu zeigen und Milde walten zu lassen.
Nachdem ich das Geld, von dem sie anscheinend mehr als genug hatten, von ihnen erhalten hatte, wiesen sie mich an, in dieser Nacht das Hotel nicht zu verlassen, umso mehr, als ich mit den Regeln in dieser Stadt nicht vertraut war. Ich versprach ihnen, diesen Ratschlag zu beherzigen und wurde kurz danach von einem farbigen Diener zu einem Schlafraum im hinteren Teil des Erdgeschoßes des Hotels gebracht. Ich legte mich zur Ruhe und dachte an meine Heimat, meine Frau und meine Kinder und die große Entfernung zwischen uns. Schließlich schlief ich ein. Aber kein Engel des Mitleids erschien an meinem Bett und hieß mich zu fliehen – keine Stimme der Gnade warnte mich in meinem Traum vor den Prüfungen, die kurz bevor standen.
Am nächsten Tag gab es einen großen Umzug in Washington. Das Donnern von Kanonen und Glockengeläut erfüllte die Luft und viele Häuser waren mit Trauerflor verschleiert und die Straßen schwarz vor Menschen. Nach einiger Zeit kam die Prozession langsam die Straße herunter, Kutsche an Kutsche, in endloser Reihenfolge und mit Tausenden Fußgängern im Schlepptau, die sich alle zum Klang melancholischer Musik bewegten. Sie trugen den toten Körper Harrisons zu Grabe.
Vom frühen Morgen an war ich ständig in Begleitung von Hamilton und Brown. Sie waren die einzigen Menschen in Washington, die ich kannte. Wir standen zusammen, als die Beerdigungsprozession an uns vorbei zog. Ich entsinne mich noch, wie einmal das Fensterglas brach und zu Boden fiel, als man auf dem Friedhof die Kanone zum Salut abgefeuert hatte. Wir schlenderten zum Capitol und gingen dort eine ganze Weile in den Anlagen spazieren. Am Nachmittag schlenderten die Herren in Richtung des Weißen Hauses (damals noch President's House, Anmerkung des Übersetzers) und zeigten mir, der ich immer in ihrer unmittelbaren Nähe war, weitere Sehenswürdigkeiten. Bis jetzt hatte ich noch nichts von dem Zirkus erspäht. Um ehrlich zu sein, habe ich aber auch wenig, falls überhaupt, an ihn gedacht. Dafür war der Tag viel zu aufregend.
Meine Freunde gingen während des Nachmittags mehrmals in Kneipen und bestellten alkoholische Getränke. So weit ich das beurteilen kann, waren sie aber weit davon entfernt, zu viel davon zu trinken. Bei diesen Gelegenheiten reichten sie, nachdem sie sich selbst eingeschenkt hatten, auch mir ein Glas. Auch wenn man nun aufgrund der folgenden Ereignisse meinen könnte, ich sei betrunken gewesen – dem war mitnichten so. Gegen Abend und kurz nachdem ich eines dieser Getränke zu mir genommen hatte, begann ich mich schlecht fühlen. Sogar sehr krank. Mein Kopf begann zu schmerzen – ein dumpfer, schwerer Schmerz, der fast nicht auszuhalten war. Beim Abendessen fühlte ich keinerlei Appetit; beim Anblick und Geruch des Essens wurde mir schlecht. Als es dunkel wurde, führte mich derselbe Diener zu dem Zimmer, das ich auch in der vergangenen Nacht bewohnt hatte. Brown und Hamilton rieten mir, mich zur Ruhe zu begeben und bedauerten meine Lage. Sie gaben mir Anlass zur Hoffnung, dass es mir morgens besser gehen würde. Ich entledigte mich bloß meines Mantels und meiner Stiefel und legte mich aufs Bett. Es war unmöglich zu schlafen. Der Schmerz in meinem Kopf wurde immer stärker, fast unerträglich. Nach kurzer Zeit wurde ich sehr durstig. Meine Lippen waren wie ausgedörrt. Ich konnte nur noch an Wasser denken – an Seen und Flüsse, an Bäche, über die ich mich zum Trinken gebeugt hatte und an den tropfenden Eimer, der voll des kühlen Nektars vom Boden des Brunnens heraufgezogen wurde. Gegen Mitternacht, das vermutete ich jedenfalls, stand ich auf. Ich war nicht länger in der Lage, diesen unglaublichen Durst auszuhalten. Ich war fremd in dem Haus und wusste nichts über seine Zimmer. Alle schliefen, soweit ich das beurteilen konnte. Blind herumtastend, keine Ahnung wo, fand ich irgendwie den Weg in eine Küche im Untergeschoß. Zwei oder drei farbige Diener liefen darin herum und eine Frau gab mir zwei Gläser Wasser. Das brachte mir eine kurzfristige Linderung, die aber nur solange anhielt, bis ich mein Zimmer wieder erreicht hatte. Dann begann das Ganze von vorne; der gleiche peinigende Durst, das unbändige Verlangen zu trinken, war wieder da. Es war sogar noch schlimmer als zuvor, ebenso der abscheuliche Schmerz in meinem Kopf – falls dies überhaupt möglich war. Ich war in einer schlimmen Lage und litt grausamste Höllenqualen! Mir schien, ich stünde am Rande des Wahnsinns! Die Erinnerung an diese Nacht voller schrecklicher Leiden wird mich bis ins Grab verfolgen.
Innerhalb einer Stunde nach meiner Rückkehr aus der Küche bemerkte ich, wie jemand den Raum betrat. Es schienen mehrere zu sein, ein Gemisch verschiedenster Stimmen; aber wie viele und wer sie waren, kann ich nicht sagen. Ob Brown und Hamilton unter ihnen waren oder auch nicht wäre pure Vermutung. Ich erinnere mich nur mit einiger Deutlichkeit, dass man mir sagte, ich müsse zu einem Arzt gehen und mir dort Medikamente besorgen. Ich zog meine Stiefel an und folgte ihnen, ohne Mantel oder Hut, durch einen langen Durchgang oder eine Gasse raus auf die Straße. Diese bog rechtwinklig von der Pennsylvania Avenue ab. Auf der anderen Seite sah ich ein Licht in einem Fenster. Mein Eindruck war, dass da drei Personen bei mir waren; aber das ist so verschwommen und vage wie die Erinnerung an einen bösen Traum. Die letzte aufflackernde Erinnerung, die ich heute noch habe, ist, dass wir auf das Licht zugingen, von dem ich glaubte, dass es aus der Praxis eines Arztes schien und das immer mehr zurückwich, je mehr ich mich ihm näherte. Von diesem Moment an war ich bewusstlos. Wie lange ich das war, weiß ich nicht, vielleicht nur eine Nacht, oder auch viele Tage und Nächte; aber als mein Bewusstsein zurückgekehrt war, fand ich mich allein, in völliger Dunkelheit und in Ketten vor.
Der Schmerz in meinem Kopf war beträchtlich zurückgegangen, aber ich fühlte mich immer noch benommen und schwach. Ich saß auf einer niedrigen Bank, die aus rauen Bohlen gefertigt worden war, und hatte weder Mantel noch Hut. Man hatte mir Handschellen angelegt. Um meine Fußknöchel lagen schwere Fesseln. Ein Ende der Kette war an einem großen Ring im Fußboden befestigt, das andere an einer der Fesseln. Ich versuchte vergebens aufzustehen. Erst nach geraumer Zeit konnte ich mich einigermaßen sammeln, die Bewusstlosigkeit musste doch einige Zeit angedauert haben. Wo war ich? Was bedeuteten diese Fesseln? Wo waren Brown und Hamilton? Was hatte ich getan, dass ich es verdient hatte, in so einem Verlies gefangen zu sein? Ich verstand überhaupt nichts. Es gab eine Lücke unbekannten Ausmaßes in meinem Gedächtnis. Was vor meinem Erwachen hier passiert war, konnte selbst die größte Anstrengung nicht rekonstruieren. Ich lauschte intensiv nach einem Lebenszeichen, aber nichts durchbrach die bedrückende Stille - außer dem Klirren der Kette, wenn ich mich bewegte. Ich sprach mit lauter Stimme, aber der Klang meiner Stimme erschreckte mich. Soweit die Fesseln es erlaubten, fühlte ich nach meinen Taschen – weit genug um festzustellen, dass man mich nicht nur der Freiheit, sondern auch meines Geldes und meiner Dokumente beraubt hatte! Dann dämmerte mir der Gedanke, zuerst leise und verworren, dass man mich entführt hatte. Aber das wäre ja unglaublich gewesen.
Es muss wohl einen Irrtum gegeben haben, irgendeinen unglücklichen Zufall. Es durfte nicht sein, dass ein freier Bürger des Staats New York, der niemandem etwas zuleide getan, geschweige denn ein Verbrechen begangen hatte, so unmenschlich behandelt wurde. Je mehr ich über meine Lage nachdachte, desto sicherer erschien mir mein Verdacht. Es war ein trostloser Gedanke. Ich fühlte, dass kaltherzige Menschen weder Vertrauen verdienten, noch Gnade erwarten ließen. Ich empfahl mein Schicksal dem Gott der Unterdrückten, beugte mein Gesicht auf meine gefesselten Hände und begann bitterlich zu weinen.
Kapitel 3
Ungefähr drei Stunden vergingen, in denen ich auf der niedrigen Bank sitzen blieb und in schmerzliches Nachdenken vertieft war. Dann hörte ich in der Ferne das Krähen eines Hahns und kurz darauf ein polterndes Geräusch, als ob Kutschen durch die Straßen getrieben wurden. Ich wusste, dass es Tag war. Kein Lichtstrahl durchbrach mein Gefängnis. Schließlich hörte ich Schritte direkt über mir, als ob jemand hin- und hergehen würde. Es kam mir in den Sinn, dass ich wohl in einem unterirdischen Raum war und der modrige, feuchte Geruch, der mich umgab, bestätigte diese Vermutung. Die Geräusche über mir dauerten ungefähr eine Stunde lang; dann hörte ich Schritte, die sich von außen näherten. Ein Schlüssel kratzte im Schloss und eine schwere Tür schwang auf. Licht überflutete den Raum und ich sah zwei Männer hereinkommen und sich vor mir aufbauen. Einer war groß und kräftig, vielleicht 40 Jahre alt, mit dunklem, haselnussfarbenem Haar, das leicht mit Grau durchsetzt war. Er hatte ein rundliches Gesicht und war von aufgeschwemmter Statur; alles an ihm war derb und ekelhaft und bezeugte nichts als Grausamkeit und Durchtriebenheit. Er war etwa 1.80 Meter groß und ohne Vorverurteilung darf ich sagen, dass ich noch niemanden getroffen hatte, der so widerlich und finster war. Sein Name war, wie ich später herausfinden sollte, James H. Burch – ein stadtbekannter Sklavenhändler aus Washington; und zu diesem Zeitpunkt Geschäftspartner von Theophilus Freeman aus New Orleans. Der andere war ein einfacher Lakai mit Namen Ebenezer Radburn, der als Gefängniswärter fungierte. Beide Männer lebten zur Zeit meiner Rückkehr aus der Gefangenschaft, was letzten Januar war, immer noch in Washington.
Das Licht, das durch die offene Tür fiel, erlaubte mir den Raum, in dem ich gefangen war, näher zu betrachten. Er war rund 4 Quadratmeter groß und von solidem Mauerwerk umgeben. Der Boden war aus schweren Dielen gemacht. Es gab ein kleines Fenster, das mit großen Eisenstangen vergittert und von außen mit Fensterläden fest verschlossen war.
Eine mit Eisen beschlagene Tür führte in eine benachbarte Zelle - oder besser Verlies; es gab dort nicht das kleinste Fenster oder irgendetwas anderes, durch das Licht hereinfallen hätte können. Das Mobiliar des Raums, in dem ich mich befand, bestand aus der Holzbank, auf der ich saß, und einem altmodischen Ofen; das war alles. In keiner der beiden Zellen gab es so etwas wie ein Bett oder eine Decke oder überhaupt irgendetwas sonst. Die Tür, durch die Burch und Radburn den Raum betreten hatten, führte in einen Durchgang mit einem Treppenhaus, das wiederum in einen Hof führte, welcher von einer über drei Meter hohen Ziegelmauer umgeben war. Der Hinterhof gehörte offenbar zu einem Haus von ungefähr der gleichen Größe. In einer Wand war eine starke, ebenfalls mit Eisen beschlagene Tür eingelassen, die in einen engen, überdachten Durchgang führte. Dieser Gang verlief entlang der äußeren Mauer bis vor zur Straße. Das Schicksal des farbigen Mannes, hinter dem sich diese Tür einmal geschlossen hatte, war besiegelt. Die Mauer stützte einen Teil des Daches, das nach innen anstieg und so eine Art offenen Schuppen bildete. Unter dem Dach war etwas montiert, das wie eine Art Käfig oder Taubenschlag aussah. Hier konnten Sklaven die Nacht verbringen oder bei schlechtem Wetter Schutz vor einem Sturm suchen. Fast könnte man meinen, es sei die Scheune eines Bauern - wenn sie nicht so gebaut worden wäre, dass die Welt von draußen niemals einen Blick auf das darin eingepferchte menschliche Vieh werfen konnte.
Das Gebäude, zu dem der Hof gehörte, hatte zwei Stockwerke und mündete vorne auf eine der öffentlichen Straßen Washingtons. Von außen erweckte es den Eindruck eines ruhigen, privaten Wohnsitzes. Ein Fremder, der es erblickte, wäre niemals auf den abscheulichen Zweck gekommen, den es wirklich erfüllte. Paradoxerweise lag das Capitol in Sichtweite des Hauses und schaute von seinem Hügel auf es herunter. Fast hörte man, wie sich die Stimmen der von Freiheit und Gleichheit redenden patriotischen Abgeordneten mit dem Klirren der Sklavenketten vermischten. Ein Sklavenstall im Schatten des Capitols!
Dies ist die Beschreibung von Williams' Sklavenstall, wie man ihn 1841 in Washington vorgefunden hätte. Zumindest so, wie ich ihn aus dem Keller heraus, in dem ich mich unerklärlicherweise befand, sehen konnte.
„Na, mein Junge, wie geht's dir jetzt?“, fragte Burch, als er durch die Tür trat. Ich antwortete, dass mir übel war und fragte nach dem Grund meiner Einkerkerung. Er antwortete, dass ich ein Sklave sei – dass er mich gekauft hatte und mich nach New Orleans schicken würde. Ich versicherte, laut und schroff, dass ich ein freier Mann sei, ein Bürger von Saratoga, wo ich eine ebenso freie Frau und Kinder hatte und dass mein Name Northup war. Ich beschwerte mich bitterlich über die Behandlung, die mir widerfahren war und drohte ihm, nach meiner sofortigen Freilassung, Genugtuung für das Unrecht an. Er bestritt, dass ich frei sei und erkläre unter einigen heftigen Flüchen, dass ich aus Georgia käme. Wieder und wieder versicherte ich, dass ich niemandes Sklave sei und bestand darauf, meine Ketten sofort abgenommen zu bekommen. Er bemühte sich, mich zum Schweigen zu bringen, als ob er Angst hatte, dass man meine Stimme hören könnte. Aber ich war alles andere als still und bezeichnete die Verantwortlichen meiner Gefangenschaft, wer immer diese auch waren, als Erzgauner. Da er sah, dass er mich nicht in den Griff bekam, fing er an unbändig zu wüten. Unter gotteslästerlichen Flüchen nannte er mich einen schwarzen Lügner, einen Flüchtling aus Georgia, und gab mir jede andere profane und vulgäre Bezeichnung, die er sich in seinem kranken Hirn ausdenken konnte.
Während dieser Zeit stand Radburn einfach nur ruhig daneben. Seine Aufgabe war es, diesen menschlichen, oder unmenschlichen Stall für zwei Schilling pro Kopf und Tag zu beaufsichtigen, Sklaven in Empfang zu nehmen, zu füttern und auszupeitschen. Burch wandte sich ihm zu und befahl, den Bleuel und die neunschwänzige Katze zu bringen. Radburn verschwand und war im Nu mit diesen Folterinstrumenten zurück. Der Bleuel, wie er im Sklavenjargon genannt wird, oder zumindest in dem, das ich kennenlernen durfte, war ein Stück eines harten Holzbohlens, etwa einen halben Meter lang, und geformt wie ein altmodischer Kochlöffel oder ein Ruder. Der flache Teil hatte einen Umfang von knapp zwei geöffneten Händen und war an einigen Stellen mit kleinen Bohrern besetzt. Die Katze war eine große Peitsche mit vielen Strängen, die sich nach dem Griff trennten und an jedem Ende einen Knoten hatten.
Sobald diese Foltergerten da waren ergriffen mich die beiden und zogen mich, ohne Rücksicht zu nehmen, aus. Wie schon gesagt, waren meine Füße am Boden festgemacht. Radburn legte mich, das Gesicht nach unten, über die Bank und stellte seinen schweren Fuß auf die Kette zwischen meinen Handgelenken, so dass diese schmerzhaft nach unten gedrückt wurden. Burch begann, mich mit dem Bleuel zu schlagen. Schlag auf Schlag prasselte auf meinen nackten Körper herunter. Als sein unnachgiebiger Arm müde wurde, hörte er auf und fragte mich, ob ich immer noch darauf bestehe, ein freier Mann zu sein. Ich bestand in der Tat darauf und die Schläge wurden fortgesetzt, härter und energischer als zuvor – falls dies überhaupt noch möglich war. Als er erneut müde war, wiederholte er seine Frage und, nachdem die Antwort dieselbe blieb, setzte die Tortur fort. Die ganze Zeit über stieß dieser fleischgewordene Teufel dabei die unsäglichsten Flüche aus. Nach einiger Zeit brach der Bleuel entzwei und Burch hatte nur noch den nutzlosen Griff in der Hand. Aber ich gab immer noch nicht nach. All seine brutalen Schläge konnten meine Lippen nicht dazu bewegen, die Lüge zu äußern, dass ich ein Sklave sei. Nachdem er den Griff des gebrochenen Bleuels in Rage auf den Boden geworfen hatte, nahm er die Peitsche. Die verursachte viel größere Schmerzen als das andere Werkzeug. Ich betete um Gnade, aber mein Gebet wurde nur mit Verwünschungen und Striemen erhört. Ich glaubte, ich müsse sterben unter den Schlägen dieses brutalen Rohlings. Auch heute noch lässt die Erinnerung an diese Szene mir das Blut in den Adern gefrieren. Es brannte wie Feuer. Der einzige Vergleich, der mir für diese Qualen einfällt, ist das Höllenfeuer!
Irgendwann konnte ich seine wiederholten Fragen nicht mehr beantworten. Es war mir fast unmöglich, zu sprechen. Immer noch prügelte er mit der Peitsche auf meinen geschundenen Körper ein, bis es mir schien, als ob jeder Schlag mein aufgerissenes Fleisch von den Knochen schälen würde. Ein Mensch, mit auch nur einem Funken von Erbarmen in seiner Seele, hätte nicht einmal einen Hund so grausam geschlagen. Nach einiger Zeit meinte Radburn, dass es nutzlos sei, mich weiter auszupeitschen und dass ich bereits wund genug sei. Daraufhin hörte Burch auf und sagte, indem er seine Faust warnend vor meinem Gesicht schüttelte und durch seine fest geschlossenen Zähne zischte, dass die Bestrafung, die ich gerade erhalten hatte, nichts im Vergleich zu dem sei, was darauf folgen würde, sollte ich jemals wieder behaupten, ich sei ein freier Mann, oder gefangen genommen worden, oder irgendetwas in dieser Richtung.
Er schwor mir, dass er mich entweder brechen oder töten würde. Mit diesen tröstenden Worten nahm man mir die Handschellen und ihre Kette ab, während die Füße am Ring befestigt blieben; der Fensterladen des kleinen, verrammelten Fensters, das zwischenzeitlich geöffnet gewesen war, wurde wieder zugezogen. Als die Männer den Raum verließen, verschlossen sie die große Tür hinter sich und ich war erneut in der Dunkelheit gefangen.