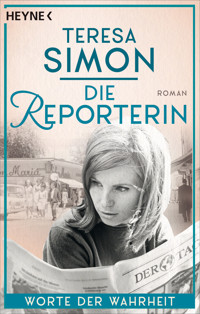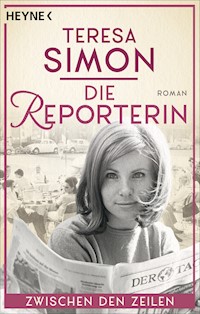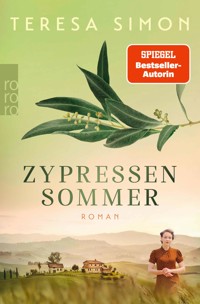
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Olivenbauernfamilie, eine Frau zwischen zwei Brüdern und der Kampf um Freiheit: die große deutsch-italienische Familiengeschichte von Bestsellerautorin Teresa Simon. Die Hamburger Goldschmiedin Julia Matthiesen reist zum ersten Mal in das malerische Dorf Lucignano in der Toskana und ist auf Anhieb überwältigt vom Zauber der Landschaft. Ihr kürzlich verstorbener Nonno stammt von hier, seine Familie hat seit jeher Oliven angebaut, doch über seine Vergangenheit hat Gianni immer geschwiegen. Julia begibt sich auf die Spuren ihres Großvaters, unterstützt von dem attraktiven Italiener Matteo. Ihre gemeinsame Suche führt in die 1940er-Jahre, in die Zeit der «Resistenza», als italienische Partisanen sich in den Bergen versteckten und gegen die Faschisten kämpften; sie führt zu zwei Brüdern, den Olivenbauern Vito und Gianni, und zu einer tragischen Liebesgeschichte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Teresa Simon
Zypressensommer
Roman
Über dieses Buch
Der Geschmack von hundert Sommern
Die Hamburger Goldschmiedin Julia Matthiesen reist zum ersten Mal in das malerische Dorf Lucignano in der Toskana und ist auf Anhieb überwältigt vom Zauber der Landschaft. Ihr kürzlich verstorbener Nonno stammt von hier, seine Familie hat seit jeher Oliven angebaut, doch über seine Vergangenheit hat Gianni immer geschwiegen. Julia begibt sich auf die Spuren ihres Großvaters, unterstützt von dem attraktiven Italiener Matteo. Ihre gemeinsame Suche führt in die 1940er-Jahre, in die Zeit der «Resistenza», als italienische Partisanen sich in den Bergen versteckten und gegen die Faschisten kämpften; sie führt zu zwei Brüdern, den Olivenbauern Vito und Gianni, und zu einer tragischen Liebesgeschichte …
Vita
Teresa Simon ist das Pseudonym der promovierten Historikerin und Autorin Brigitte Riebe. Sie ist neugierig auf ungewöhnliche Schicksale und lässt sich immer wieder von historischen Ereignissen und stimmungsvollen Schauplätzen inspirieren. Die Spiegel-Bestsellerautorin ist bekannt für ihre intensiv recherchierten und spannenden Romane, die tiefe Emotionen wecken. Ihre Romane Die Frauen der Rosenvilla, Die Holunderschwestern, Die Oleanderfrauen und Glückskinder wurden zu Bestsellern. Zuletzt erschien ihre Dilogie Die Reporterin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Katja Bendels
Liedtext auf S. 141: Adriano Celentano, Una festa sui prati.
Text: Luciano Beretta/Mogol/Michele Del Prete
Liedtext auf S. 141: Gianna Nannini, Latin Lover. Text: Gianna Nannini
Liedtext auf S. 216: Gianna Nannini, Profumo. Text: Gianna Nannini
Liedtext auf S. 389: Lucio Battisti, E penso a te. Text: Mogol
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Evelina Kremsdorf, Joanna Czogala, Rekha Garton/Arcangel Images; Shutterstock
ISBN 978-3-644-02016-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Babsi
O partigiano, portami via,
O bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
Ché mi sento di morir.
O Partisan, bring mich weg,
O Schöne, ciao! Schöne, ciao! Schöne, ciao, ciao, ciao!
O Partisan, bring mich weg,
weil ich das Gefühl habe, dass ich sterbe.
Italienisches Volkslied
Prolog
Unterwegs nach Norden, September 1943
Das Brechen der Kruste, wenn die Mutter mittags das frische Brot aufschneidet.
Das grüne Gold des Olivenöls, fruchtig, scharf und leicht bitter auf der Zunge und im Gaumen, ein Geschmack von hundert Sommern.
Wind, der durch die alten Bäume streicht.
Warme Sonne auf der Haut.
Vitos ansteckendes Lachen.
Die kleine Schwester Anna, die versonnen im Garten schaukelt.
Und Giulia. Samtbraune Augen hinter runden Gläsern, geliebtes Eulchen, so mutig und klug.
Sehnsucht, die sich tief in mich hineinfrisst …
Mit einem Ruck kam der Zug zum Stehen. Giannis Traum zerstob, und er wurde unbarmherzig ins Hier und Jetzt zurückgeworfen. Sechzig Männer auf engstem Raum, verzweifelt und ausgehungert, angeekelt vom Gestank der überquellenden Latrineneimer, die seit drei Tagen nicht mehr geleert worden waren.
Soldaten waren sie bis vor Kurzem gewesen. Jetzt waren sie nur noch Verräter.
Die Deutschen spuckten ihnen dieses Wort in ihrer harten Sprache entgegen, angewidert, verachtungsvoll. Dabei waren sie es, die ihr Versprechen gebrochen hatten, denn diese Viehwaggons, gefüllt mit Hoffnungslosen, brachten die einstige Italienische Armee nicht zurück nach Hause, sondern geradewegs ins Deutsche Reich.
Neben ihm stöhnte der schmächtige Cosimo aus Napoli, der seine Waffe nicht ohne Gegenwehr hatte abgeben wollen und dafür Schläge mit dem Gewehrkolben ins Gesicht kassiert hatte. Seine Wunden hätten gereinigt und anschließend genäht gehört, doch darum hatte sich niemand gekümmert. Jetzt eiterten sie und sahen verheerend aus. Wenn er Pech hatte, würde womöglich noch sein linkes Auge dabei draufgehen.
Beinahe hätte Gianni bitter aufgelacht. Pech – was für ein lächerliches Wort für das, was sie gerade erlebten!
Als der Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten verkündet worden war, hatten sie alle für ein paar Stunden aufgeatmet und sich jubelnd umarmt in dem Glauben, der Krieg sei endlich vorbei und sie könnten nach Hause zurückkehren. Doch kurz darauf diese böse Überraschung, als Soldaten der Wehrmacht in ihre Kaserne gestürmt kamen, sie überwältigten und entwaffneten. Der erst vor wenigen Wochen von der neuen italienischen Regierung festgesetzte Duce war befreit worden und konnte in Salò am Gardasee seine Schattenrepublik von Hitlers Gnaden errichten.
Jetzt waren sie keine Soldaten mehr, aber auch keine Kriegsgefangenen.
Was waren sie dann?
Italienische Militärinternierte – Niemande!
Konnte es noch schlimmer kommen?
Gianni hatte das Soldatenleben von Anfang an gehasst – das Exerzieren, die kratzige Uniform ebenso wie das endlose Marschieren und das Gebell der Ranghöheren, vor allem aber das Töten. Seine kräftigen, geschickten Hände waren die eines Olivenbauern, der die Erde liebte und jeden einzelnen seiner Bäume hegte, so wie der Nonno und sein Babbo es ihm von klein auf beigebracht hatten. Auf andere zu schießen, nur weil sie angeblich Feinde des Vaterlands waren, hatte ihm nie eingeleuchtet.
Wozu brauchte er Ruhm und Ehre, wozu Kolonien im weit entfernten Afrika, von denen die faschistischen Schwarzhemden euphorisch gefaselt hatten? Er wollte keine anderen Völker unterjochen, um sich mächtig und groß zu fühlen. Mussolini, diesem arroganten Glatzkopf mit der heiseren Stimme und den imposanten Gesten, hatte er stets misstraut.
Seit drei Generationen bestellten die Contis ihren Bauernhof unweit der mächtigen mittelalterlichen Mauern von Lucignano, wo sie an Markttagen ihre Produkte verkauften: Olivenöl, Wein, Honig, Pecorinokäse und Zia Rosalias berühmte Torta della Nonna, nach der das halbe Städtchen verrückt war. Was hätte Gianni jetzt nur für einen Krümel dieser Köstlichkeit gegeben! Hunger rumorte in seinen Gedärmen wie ein wildes Tier, doch noch schlimmer war die Angst.
Was stand ihnen bevor?
Eines jener schrecklichen Lager, von denen alle nur im Flüsterton sprachen?
Weitertransport an die Ostfront?
Oder direkt der Tod durch Erschießen?
Verräter verdienen keine Gnade …
Die Tür wurde aufgerissen.
«Raus mit euch!», brüllten die bewaffneten Deutschen. «Geschissen wird jetzt draußen, ihr dreckigen Badoglio-Schweine!»
Sie rappelten sich auf, taumelten ins Freie. Nirgendwo etwas, wo man ungestört seine Notdurft hätte verrichten können, weit und breit nur freies Feld. Die Abendluft war frisch und kühl, das fiel ihm auf.
Sie mussten bereits in den Alpen angelangt sein.
Die Männer erleichterten sich, ohne nach rechts oder links zu schauen. Jede Scham war verschwunden, sie wollten nur noch überleben. Zwei bekamen die Exkrementeneimer aus dem Zug in die Hand gedrückt, um sie zu leeren. Gianni und ein weiterer Mann erhielten jeweils eine Schaufel mit der barschen Aufforderung, das verdreckte Stroh aus dem Waggon zu räumen.
Viel zu knapp wurde anschließend neu eingestreut.
Danach bekam jeder eine dünne Decke zugeworfen.
«Rein mit euch, und keine falsche Bewegung!», krächzte einer der Bewaffneten in schauderhaftem Italienisch.
Sie folgten dem Befehl. Bevor die Türen wieder verschlossen wurden, hievte man noch drei Eimer mit lauwarmer Suppe und mehrere Laibe Brot in den Waggon, um die die Männer sich sofort ausgehungert rangelten.
Irgendwann fuhr der Zug wieder los.
«Wohin, Kamerad?», flüsterte Cosimo neben ihm, seine Stimme so dünn wie die eines furchtsamen Kindes. «Direkt in die Hölle?»
Natürlich, hätte Gianni ihm am liebsten geantwortet. Was glaubst du denn?
Aber war er nicht schon sein ganzes Leben ein großer Bruder gewesen, stets verantwortlich für das Wohl der jüngeren Geschwister? Auf Vito, seinen kleinen Bruder mit den schnellen Beinen und dem frechen Mundwerk, hatte er aufgepasst, seit dieser laufen konnte, ebenso wie auf die Schwester Anna, ihre sensible, verträumte Nachzüglerin mit den goldenen Augen, die viel zu naiv und gutgläubig war. Cosimo und Gianni waren nicht verwandt, aber teilten sie nicht gerade das gleiche ungewisse Schicksal?
Einer musste stark sein. Wenigstens einer.
«Keine Ahnung, fratellino», erwiderte Gianni deshalb, und seine Stimme klang um einiges zuversichtlicher, als ihm tatsächlich zumute war. «Aber was immer es auch sein mag – ich schwöre dir, wir werden es überleben!»
Eins
Lucignano, Juni 1998
Julia
Aufgrund heftiger Gewitter hatte die Nachmittagsmaschine aus Hamburg via Zürich stundenlange Verspätung, und so dämmerte es bereits, als sie endlich auf dem Flughafen Amerigo Vespucci landeten. Julias Beine waren eingeschlafen vom endlosen Sitzen, sie fühlte sich erschöpft, und der korpulente Schweizer am Fensterplatz neben ihr müffelte so penetrant nach Schweiß, dass sie schon seit einer Weile nur noch flach atmete. Ihren Flug nach Florenz hatte sie sich wahrlich anders vorgestellt, und dass alle Passagiere nun wie verrückt aus der Maschine drängelten, anstatt abzuwarten, bis sie an der Reihe waren, machte es nicht besser. Doch all der aufgestaute Ärger legte sich augenblicklich, als draußen auf der Gangway warme Luft Julias Gesicht streichelte.
So roch der Süden.
Sie war in Italien angekommen.
Schon wieder halbwegs entspannt, ließ sie sich vom Bus die kurze Strecke bis zum Flughafengebäude bringen und wartete geduldig, bis schließlich ihr blauer Trolley auf dem Laufband erschien. Nun musste es nur noch mit dem vorbestellten Mietwagen klappen, kein ganz unwichtiges Detail, denn von ihrem Zielort trennten sie noch knappe hundert Kilometer. Die Toskana-Karte in ihrer Umhängetasche sah inzwischen fast aus wie Malen nach Zahlen, so vielfarbig hatte sie sich darauf ausgetobt. Eigentlich alles kein Problem, denn die Autostrada Richtung Rom führte fast geradewegs an Lucignano vorbei, aber Julia hatte es in der Vergangenheit schon fertiggebracht, sich auch auf den einfachsten Strecken zu verfahren. Daher hatte sie dieses Mal vorgesorgt, alles bunt markiert und sich die Route genau eingeprägt.
Doch was hatte diese endlose Schlange vor dem Leihwagen-Schalter zu bedeuten?
Plötzlich verstand sie. Deshalb hatten es viele der anderen Passagiere zuvor so eilig gehabt! Lauter potenzielle Kunden. Bis die alle mit fahrbaren Untersätzen versorgt waren, würde es Stunden dauern.
Ihre gute Laune sank erneut.
Sie hatte in Lucignano ein Zimmer in einer kleinen Pension gebucht. Kam sie dort erst gegen Mitternacht oder noch später an, stünde sie womöglich vor verschlossenen Türen.
Was sollte sie tun?
Vorsichtshalber dort anrufen? Seit Neuestem hatte sie ein Handy, es war griffbereit, doch leider war die Telefonnummer in den Tiefen ihres Koffers vergraben …
«Chi ha prenotato?», rief die Dame hinter dem Schalter in die wartende Menge.
Seit Julias Kindheitstagen war ihr Italienisch immer dürftiger geworden, aber hierfür reichte es gerade noch aus.
«Io», rief sie und berührte das kleine Schmetterlingsamulett mit den vier roten Turmalinen, das sie um den Hals trug, als Talisman speziell für diese Reise auf ihrer Werkbank angefertigt. Es war nicht nur schön, sondern würde ihr Glück bringen, davon war sie überzeugt. «Ich habe vorbestellt. Julia Matthiesen aus Hamburg.»
«Signora Matthiesen, venga avanti per favore!»
Auch das verstand sie. Sie sollte nach vorne kommen, und so zog Julia mit ihrem Koffer an den bedröppelten Gesichtern der übrigen Wartenden vorbei.
Der Rest ging erfreulich schnell. Führerschein, Personalausweis, Kreditkarte, ein paar Unterschriften, und schon bekam sie die nötigen Papiere und den Autoschlüssel ausgehändigt.
«La cinquecento rossa.» Die junge Frau hinter dem Schalter riskierte ein winziges Lächeln. «Last row at the back.»
Ein kleiner Fiat also – dazu in ihrer Lieblingsfarbe.
Julia beschloss, dies als gutes Omen zu werten. Und das konnte sie gut gebrauchen, denn sie war reichlich überstürzt zu dieser Reise ins Ungewisse aufgebrochen. Wie hätte sie vor seinem Tod ahnen können, dass das Vermächtnis ihres Großvaters aus einem dünnen Blatt Papier bestehen würde, auf dem er nur ein paar unfertige Sätze notiert hatte?
Lucignano stand ganz oben, dick unterstrichen. Und darunter:
Famiglia Barbero – Verrat?
Die schwarze Eule, wichtig!
Grabstein Anna?
Vergebung Vito! Unschuldig?
Primo Lezzone: Was hat der Kerl gewusst?
Notaio Angelo De Luca – Nachfolger?
Geh deinen Weg, cuore mio, geh ihn mutig bis zum Ende.
Über diesen Satz hatte sie schon viele Stunden gegrübelt.
Was meinte der Nonno damit?
Waren diese letzten Worte womöglich gar nicht an seine Enkelin gerichtet, sondern eine allgemeine Lebensweisheit?
Nein, dann hätten sie nicht auf diesem abgegriffenen Blatt gestanden, das ihr die Krankenschwester nach seinem letzten Atemzug überreicht hatte.
Der Nonno hatte immer nur andeutungsweise über seine Jugend in Italien gesprochen. Manchmal war es Julia sogar vorgekommen, als handle es sich dabei um eine Art geheimes Abkommen zwischen ihm und ihrer Großmutter, die nur allzu gern das Thema wechselte, sobald das Gespräch darauf kam. Die hellblonde Hamburgerin und der schwarzhaarige Italiener waren immer ein auffallend attraktives Paar gewesen, auch noch in späten Jahren, als sie bereits das Rheuma plagte, er Probleme mit dem Herzen bekam und seine Mähne immer silbriger wurde. Trotzdem waren die beiden bis zu Omas Tod vor acht Jahren montags bis samstags eisern hinter der Theke ihres kleinen, liebevoll sortierten Feinkostgeschäfts in Hamburg-Eimsbüttel gestanden, das sie Anfang der Fünfzigerjahre eröffnet hatten. Nicht ohne Anstrengung, wie Julia aus Erzählungen wusste. Anfangs mussten sie jeden Pfennig umdrehen, weil noch vieles abzubezahlen war, und auch die kritische Kundschaft brauchte eine ganze Weile, bis sie mit dem Italiener wirklich warm wurde. Irgendwann jedoch lief das Geschäft sehr gut. Niemand hatte die beiden dazu bewegen können, beizeiten in Rente zu gehen, auch Julias Mutter nicht, die bis zu ihrer Heirat mit dem smarten Kinderarzt Jan Matthiesen ebenfalls im Laden mitgeholfen hatte.
Wann genau es den Nonno nach Hamburg verschlagen hatte, wusste Julia nicht. Entscheidend war, dass er viele Jahre dort gelebt und ein Stück Italien mit in den regnerischen Norden gebracht hatte. Und das hatte er in der Tat: die besten Panini des Viertels – wer konnte Gianni Contis Kompositionen aus Pecorino oder Parmaschinken, getrockneten Tomaten, Rucola und dieser sagenhaften Kaperncreme nach geheimer Rezeptur schon widerstehen?
Allein beim Gedanken daran wurde Julia noch hungriger, als sie es ohnehin war, denn seit den wenigen hastigen Bissen heute Morgen waren Stunden verstrichen. Sie nahm ein paar Schlucke Wasser aus der Plastikflasche, die sie neben sich auf den Beifahrersitz gelegt hatte, und schüttelte sich, so lau und abgestanden schmeckte es inzwischen.
Egal, sie musste jetzt dringend los, um nicht noch mehr wertvolle Zeit zu verlieren. Raus aus dem Flughafengelände fand sie noch ganz gut. Doch kurz darauf tauchte vor ihr ein Schilderwald auf, der sie verwirrte.
Grosseto? Arezzo?
Richtung Roma musste sie doch, Roma!
Julias Augen brannten vor Anstrengung, so stark konzentrierte sie sich – und trotzdem verpasste sie im letzten Augenblick die richtige Ausfahrt.
So ein Mist, das wäre die Autobahn gewesen. Und was nun?
Wenden und es ein zweites Mal versuchen – aber wo um Himmels willen konnte sie das?
Aus purer Verzweiflung fuhr sie einfach weiter geradeaus, bis plötzlich wieder ein Schild vor ihr auftauchte: Siena, achtzig Kilometer.
Das musste die kleine Behelfsautobahn sein, die sie ebenfalls auf der Landkarte markiert hatte. Und tatsächlich landete sie bald auf einer zweispurigen Straße, auf der man immerhin hundertzehn fahren durfte, wobei sie dabei in ihrem einfachen Auto die altgedienten Betonplatten, aus denen der Untergrund bestand, deutlich zu spüren bekam.
Sie ließ das Fenster herunter, und die frische Abendluft tat ihr gut.
Trotzdem wollte sie jetzt nur noch eins: endlich ankommen.
Poggibonsi, Val d’Elsa, Monteriggioni, die Ortsschilder mit den malerischen Namen flogen an ihr vorbei, alles garantiert sehenswerte Ausflugsziele, für die sie wahrscheinlich gar keine Zeit haben würde. Zehn Tage Toskana auf Gianni Contis Spuren. Samira würde sie währenddessen im Laden vertreten. Zusammen mit der jungen Ägypterin betrieb Julia im Hamburger Stadtteil Ottensen den kleinen Laden namens «Fundstücke», in dem sie selbst ihren Schmuck verkaufte, und die Freundin ihre originellen Eigenkreationen an Hüten, Kappen und Mützen anbot.
Dann endlich Siena.
Die Landstraße, auf der sie anschließend weiterfuhr, wurde gerade ausgebaut, das verrieten die zahlreichen Baufahrzeuge auf der Gegenspur, doch noch dominierte eine mehrfach geflickte Fahrbahn. Julia hielt noch einmal in einer kleinen Parkbucht, schaltete das Licht im Auto an und studierte abermals die Karte. Rapolano Terme, so hieß der nächstgrößere Ort mit seinen berühmten Schwefelquellen, den sie links liegen lassen musste, um nach Lucignano zu gelangen.
Also auf zur letzten Etappe.
Jetzt überholte sie nur noch gelegentlich ein Auto, kein Wunder, ging es inzwischen doch schon stramm auf Mitternacht zu.
Als Julia schließlich im Mondlicht ihr Ziel stolz auf einem Hügel thronen sah, hätte sie vor Erleichterung fast geweint. Oben angekommen stellte sie den Wagen auf dem Parkplatz vor der mächtigen Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert ab, holte den Trolley aus dem Kofferraum und ging los.
Morgen würde sie den angeblich sehr hübschen Ort mit den steinernen Türmen und roten Ziegeldächern genauer erkunden, über dessen wechselvolle Historie zwischen den beiden konkurrierenden Städten Siena und Arezzo sie während der langen Flugstunden bereits einiges gelesen hatte, jetzt jedoch wollte sie nur noch schlafen. Sie entdeckte die Pension Martelli schon nach wenigen Schritten auf der rechten Straßenseite und drückte leicht beklommen wegen der späten Stunde auf den bronzenen Klingelknopf.
Nichts geschah.
Julia wartete ein Weilchen, dann versuchte sie es ein zweites Mal.
Jetzt öffneten sich die dunkelgrünen Fensterläden im ersten Stock, und ein grauer Lockenkopf erschien.
«Cosa vuole?» Ihre Pensionswirtin klang alles andere als erfreut.
«Tut mir leid, aber das Flugzeug aus Hamburg hatte so viel Verspätung …»
Damit würde sie hier nicht weit kommen.
Julia kratzte ihr ganzes Italienisch zusammen. «Mi dispiace, l’aereo ha avuto un gran ritardo…»
«Lei è la signora di Amburgo?»
Die Dame aus Hamburg? Natürlich, das war sie!
«Si, sono Julia …»
Zum zweiten Mal wurde sie jäh unterbrochen.
«Un momento! Vengo subito.»
Sie wollte also herunterkommen, das war schon mal gut. Trotzdem dauerte es, bis die Tür endlich aufgeschlossen wurde, dann stand Julia einer zierlichen älteren Dame gegenüber, die ihren bunt geblümten Morgenmantel über der Brust zusammenraffte und sie missbilligend musterte. Aus der Nähe ähnelte der eisengraue Lockenkopf eher einem explodierten Wischmopp, was dessen Trägerin jedoch nicht zu stören schien.
«Normalmente chiudiamo alle dieci», sagte sie streng.
Julia, die dieses Mal kein Wort verstanden hatte, zuckte hilflos die Schultern.
«Non ho capito», erwiderte sie leise.
«Lei non parla italiano?» Die Stimme wurde noch frostiger.
«Solamente un po›», erwiderte Julia wahrheitsgemäß und schämte sich, dass es so weit gekommen war.
Nur ein bisschen Italienisch verstand sie – und das bei einem Großvater, der ursprünglich aus der Toskana stammte! Dass ihre Mutter schuld daran sein sollte, die nach den ersten Kinderjahren kaum noch Italienisch mit ihr gesprochen hatte, erschien Julia als Entschuldigung so mau, dass sie diesen Gedanken schnell wieder wegschob. Schließlich wäre es an ihr selbst gewesen, sich darum zu kümmern, als sie älter war, doch dazu war sie leider zu bequem gewesen. Von Hamburg aus war ihr das Land Italien unendlich weit weg erschienen, zumal ihre Eltern Familienurlaube in nördlichen Regionen wie Dänemark, Schweden oder Norwegen bevorzugt hatten.
Zumindest schien ihre Zerknirschung aufrichtig zu wirken, denn Signora Martelli schaute nicht mehr gar so griesgrämig drein.
«Va bene», sagte sie gnädig. «Venga!»
Sie trat einen Schritt zurück und ließ Julia herein. Die hievte ihren Koffer zwei enge, steile Treppen nach oben, bis sie in einem schmalen Flur angekommen waren, von dem aus mehrere Türen abgingen.
«Ecco qui!»
Signora Martelli hatte eine davon aufgesperrt und den Lichtschalter betätigt. Ein Doppelbettungetüm, Schrank, Kommode, ein kleiner Tisch, zwei Stühle und an den Wänden viele bunte Heiligenbilder, golden gerahmt. Die Decke war erstaunlich hoch, und der ehemalige Stuck, der sie zierte, an manchen Stellen ziemlich abgeschlagen. Außerdem roch es irgendwie ältlich, nach den Mottenkugeln, die sie auch aus der Wohnung ihrer Großeltern kannte. Immerhin verfügte das Zimmer über das versprochene angrenzende Bad, wenngleich die frei stehende Wanne mit den Löwenfüßen wie ein Relikt aus dem vorletzten Jahrhundert wirkte.
«Va bene?» Es klang so, als sei von jeder Missbilligung dringend abzuraten. Wie eine strenge Gouvernante in einem verstaubten englischen Internat kam die Wirtin Julia vor.
«Sì, molto bene», erwiderte sie beflissen, weil sie endlich allein sein wollte.
Julia bekam den Schlüssel in die Hand gedrückt, dann drehte die alte Dame sich um und ging zur Tür. Fast schon draußen, wandte sie sich jedoch noch einmal zu ihrem späten Gast um.
«Documento tomorrow», sagte sie, erneut in sehr strengem Ton. «Here no breakfast. Coffee and snacks at the bar. Buona notte!»
Julia öffnete als Erstes das Fenster und atmete tief aus.
«Salve, Lucignano», sagte sie leise. «Jetzt bin ich endlich da. Mal sehen, ob wir uns mögen werden!»
Ein Sonnenstrahl kitzelte Julia aus dem Schlaf. Sie rekelte sich genüsslich. Erstaunlicherweise hatte sie in dem Bettungetüm tief und fest geschlafen, und sie hatte vom Nonno geträumt. Jung war er in ihrem Traum gewesen. Er hatte ein rotes Käppi auf den dunklen Locken getragen und ein seltsames Vehikel kutschiert, eine Mischung aus Fahrrad und Auto, beladen mit Gemüsekisten. Trotzdem war seine Geschwindigkeit enorm gewesen, so fix, dass sie ihm zu Fuß nicht lange folgen konnte und schließlich zurückbleiben musste, während er hinter der nächsten Ecke verschwunden war.
Addio, nonno, addio …
Julias Herz wurde wieder schwer. Wie sehr sie ihn vermisste!
Sein Lachen hatte jeden Raum sonniger gemacht, seine Gegenwart sie beschützt und gewärmt, seit sie denken konnte. Sie hatten sich verstanden, auch ohne viele Worte.
Jetzt blieb ihr nur noch die Erinnerung an ihn – und sein Vermächtnis, das es zu erfüllen galt.
Sie schlug die dünne Decke zurück, die sie im Lauf der Nacht wild zusammengestrampelt hatte, stand auf und spürte, wie durstig und hungrig sie war. Ihr abgestandenes Wasser von gestern war restlos ausgetrunken, und dem Rinnsal, das aus dem antiken Hahn im Badezimmer träufelte, traute sie nicht. Also fiel die Dusche schnell und die Morgentoilette eher sparsam aus, dann war sie bereits ausgehbereit in Jeansrock, Shirt und Sneakern. Bloß nicht die Sonnenbrille vergessen – im letzten Moment dachte sie noch daran.
Im Treppenhaus passte Signora Martelli sie ab, heute mit frisch onduliertem Haar, weißer Spitzenbluse und dunkelblauem Rock noch gouvernantenhafter. Gebieterisch verlangte sie nach Julias Ausweis und schien erst ein wenig zufriedener, nachdem sie alles umständlich in ein Formular eingetragen hatte.
«La questura», stöhnte die Signora dabei. «They treat us like criminals. But we are here in Lucignano, not in Palermo.»
Jetzt bekam Julia auch den geheiligten Haustürschlüssel ausgehändigt, damit sie ihre Wirtin nicht mehr aus dem Schlaf reißen musste, wenn sie spätabends nach Hause kam.
Schließlich ließ die Signora sich sogar zum Anflug eines Lächelns hinreißen, das Julia erwiderte. Dennoch war sie erleichtert, als sich die Tür der Pension hinter ihr geschlossen hatte.
Trotz der frühen Stunde war die schmale Straße erstaunlich belebt, und als ihr ein paar motorisierte Dreiräder mit Gurken-, Aprikosen- und Tomatenkisten entgegenkamen, wusste sie auch, weshalb. Plötzlich fiel ihr der Name dieser putzigen Gefährte wieder ein, von denen sich eines in ihren Traum gestohlen hatte: Ape, so hießen sie.
Und heute war Markttag.
Über den Markt würde sie später in aller Ruhe schlendern, doch jetzt erst einmal Frühstück!
Köstlicher Kaffeeduft führte sie rasch zum Ziel. Unmittelbar vor der mächtigen Stadtmauer befanden sich zwei Cafés. Das rechte war heute geschlossen, das linke zum Glück geöffnet.
«Man geht immer an den Tresen und bestellt dort», hatte sie plötzlich die raue Stimme des Nonno im Ohr. «Nur Idioten setzen sich in Italien sofort an den Tisch und bezahlen dort das Doppelte.»
Als Fünfjährige hatte sie ihn einmal gefragt, warum seine Stimme stets so heiser klang.
«Sai, farfallina rossa», hatte seine Antwort gelautet, und sein Gesicht hatte sich jäh verschlossen. «Als junger Mann hatte ich einen prächtigen Bariton, den keiner während der heiligen Messe überhören konnte. Doch dann kam eine schreckliche Nacht, in der ich vergebens gegen das Schicksal angebrüllt habe. Seitdem höre ich mich an wie eine rostige Pumpe.»
Farfallina rossa – kleiner roter Schmetterling, das war sein ganz spezieller Kosename für sie gewesen, und Julia hatte ihn geliebt. Niemand aus der Familie außer ihm hatte ihn verwendet. Aus dem Mund ihres Großvaters würde sie ihn nie mehr zu hören bekommen, aber dafür gab es jetzt den kleinen Schmetterling um ihren Hals, der sie immer daran erinnerte.
Julia bestellte Cappuccino, ein Cornetto und dazu einen Schinken-Käse-Toast, was sie alles zusammen ausgehungert im Stehen verschlang. Als ihr knurrender Magen halbwegs besänftigt war, setzte sie sich mit einem zweiten caffè nach draußen und begann in ihrem Taschenkalender den Tag zu planen. Allerdings musste sie zwischendrin immer wieder aufschauen, so leuchtend blau war der Himmel über ihr, so angenehm warm die Luft. Während die Menschen zu Hause im Hamburger Juni sich gerade erst vorsichtig aus ihren Steppjacken geschält hatten, gingen hier alle kurzärmelig, und sie war froh, sich nicht mit einem Cardigan belastet zu haben, den sie doch nur hätte rumschleppen müssen.
Geld wechseln hatte noch zu Hause ganz oben auf ihrer Agenda gestanden. Aber das hatte sie zum Glück bereits in Hamburg erledigt.
Notar suchen.
Ob der junge Barista mit der kühnen Gelfrisur ihr dabei behilflich sein konnte?
Doch der war schon seit Minuten in ein offensichtlich mehr als anregendes Gespräch mit einer vollbusigen Schönheit vertieft, die ständig an ihrem Reißverschluss herumzuppelte, wohl um den ohnehin schon bemerkenswerten Ausschnitt noch besser in Szene zu setzen, also beschloss Julia, die beiden besser nicht zu stören. In der Regel besaßen Anwälte und Notare Schilder, die außen an der Hauswand angebracht waren und auf ihre Tätigkeit hinwiesen. Der Ort war übersichtlich klein, vielleicht stieß sie ja beim Schlendern von ganz allein auf das, was sie suchte.
Doch den Friedhof würde sie womöglich nicht ohne fremde Hilfe finden.
Verflixt, wie hieß gleich noch einmal Friedhof auf Italienisch?
Julia grübelte, dann fiel ihr das Wort wieder ein, und sie stand auf.
Dov’è il cimitero?, wollte sie gerade fragen, als eine Ape so dicht an ihr vorbeidüste, dass sie erschrocken zur Seite springen musste.
Was für ein Idiot! Um ein Haar hätte er sie umgefahren.
Ihr wütendes «Haben Sie denn keine Augen …» blieb Julia im Hals stecken, als der junge Mann, der das voll beladene Gefährt lenkte, sie unwiderstehlich angrinste.
Schmales Gesicht mit Dreitagebart, braune Locken, markante Nase, dazu verstörend blaue Augen, die sein türkises Shirt noch unterstrich.
«Scusi!», rief er ihr im Vorbeifahren zu. «Mi dispiace, signorina, ma ho fretta!»
«Il solito Matteo», kommentierte der Barista vom Tresen aus lakonisch. «Sempre di fretta come il diavolo!»
Julia verstand nur diavolo, das hieß Teufel.
War der attraktive junge Mann, der sie fast über den Haufen gefahren hätte, hier in Lucignano etwa als Teufel verschrien?
Und wenn ja, weshalb?
Aber das ging sie im Grunde nichts an. Beschäftigen tat es sie trotzdem.
In Julias Hirn purzelte gerade einiges durcheinander.
Sie beschloss, ein paar Schritte zu gehen, um sich wieder zu beruhigen, vielleicht Richtung Markt, was garantiert keine schlechte Idee war.
Die schmale, gepflasterte Straße war beiderseits von kleinen Läden gesäumt, die sich wie in einer Perlenkette aneinanderreihten: Bäckerei, Metzgerei, Haushaltswaren, eine Eisdiele, die Julia sich vormerkte, denn sie liebte gelato, Schuhgeschäfte, Papier- und Andenkenladen, Töpfereiprodukte, davon gleich mehrere, Brillen, Modeboutique – bis sie schließlich am Fuß der Stadtkirche ankam, wo die Stände des Wochenmarktes aufgebaut waren.
Was für eine Geruchsexplosion!
Säuerliches vermischte sich mit Süßem und Bitterem, alles jedoch übertüncht vom durchdringenden Thymianaroma eines knusprigen Spanferkels, das sich am Spieß drehte. Obwohl sie gerade erst gefrühstückt hatte und sich normalerweise nicht viel aus Schweinefleisch machte, lief ihr das Wasser im Mund zusammen.
«Signorina?» Die rundliche, stark blondierte Frau am Wurststand lächelte ihr aufmunternd zu. «Vuole assaggiare? La nostra porchetta è buonissima!»
Bevor Julia etwas erwidern konnte, bekam sie schon ein Stück braunes Backpapier in die Hand gedrückt, bestückt mit einem ordentlichen Fleischfetzen.
Es war heiß, es war fettig, und ja, es schmeckte himmlisch.
Sie nickte begeistert.
«Ne vuole ancora?»
Noch mehr? Bloß nicht!
«No, no, grazie», sagte Julia schnell und machte, dass sie weiterkam.
Signorina – so nannten sie spontan alle hier, und plötzlich fühlte sie sich ganz frei und jung. Neunundzwanzig Jahre alt und zum ersten Mal allein in Italien unterwegs, war das nicht ein Grund, um glücklich zu sein?
Aber es war kein Erholungsurlaub, der sie in den Süden geführt hatte, fiel Julia im nächsten Moment wieder ein. Sie wandelte auf den Spuren ihres Nonno und hatte die Liste auf seinem Zettel abzuarbeiten. Anna, ihre Mutter, hatte nicht mitreisen wollen, obwohl Julia sie mehrfach dazu aufgefordert hatte.
«Ich möchte meinen Vater so in Erinnerung behalten, wie er war», hatte sie gesagt. «Geh du nur allein auf deine Erkundigungsfahrt.»
Julias Interesse an den Ständen mit den bunten Klamotten und den günstigen Lederhandtaschen erlosch. Sie wollte zum Friedhof, und irgendjemand auf diesem Markt konnte ihr dabei doch sicherlich weiterhelfen.
Sie peilte einen älteren Mann an, der an seinem Stand Zitronen, Erdbeeren und Zucchini feilbot.
«Ich suche den Friedhof», sagte sie, um sich sofort zu korrigieren: «Mi scusi, dov’è il cimitero?»
«Il cimitero?», wiederholte der Händler ungläubig und sah sie an, als sei sie nicht ganz bei Trost. «È chiuso.»
Geschlossen? Sie musste ihn falsch verstanden haben.
Doch die Frau mit den Cannoli, knusprigen Röllchen gefüllt mit Ricottacreme und kandierten Früchten, die Julia als Nächstes fragte, erwiderte das Gleiche.
Dritter Versuch am Töpferstand, wo sie auf ihre Frage hin lediglich ein Achselzucken erhielt, bevor ein anderer Kunde bedient wurde.
Stimmte etwas nicht mit ihr – oder warum verhielten sich alle so abweisend?
Vielleicht hatte sie in der anderen Richtung mehr Glück. Nach ein paar Schritten merkte Julia, wie durstig das salzige Spanferkel sie gemacht hatte. Sie brauchte etwas zu trinken.
Ihr Blick fiel auf ein Ladenschild, das sie innehalten ließ:
Conti – Prodotti toscani
Conti – der Name des Nonno und der Mädchenname ihrer Mutter!
Also ein Verwandter?
Oder reiner Zufall, weil viele hier im Örtchen Conti hießen?
Leicht beklommen betrat sie den Laden. Die Wände waren naturbelassen aus rötlichem Stein, der Boden einen Ton heller gefliest. Links und rechts zogen sich bis an die niedrige Decke Regale voller Weinflaschen, zu deren Füßen kleine Kanister und Flaschen mit Olivenöl standen. Weiter hinten stand ein Holztresen, hinter dem ein brauner Lockenkopf auftauchte. Ausgerechnet der dreiste Typ von vorhin mit seiner Ape, der ihr jetzt lächelnd entgegenstarrte.
«Benvenuta, signorina», sagte er freundlich, und alle italienischen Worte stoben in Julias Kopf auf wie ein Haufen nervöser Spatzen.
«Ich möchte», begann sie zu stottern. «Ich bräuchte …»
Sie gab auf.
«Vielleicht einen guten Wein? Oder etwas von unseren wunderbaren Oliven? Ich kann auch noch Pecorino oder Honig aus eigener Produktion anbieten.»
Sein Deutsch war kehlig, aber tadellos. So redete niemand, der nur einen schnellen Sprachkurs besucht hatte.
«Sie sprechen Deutsch?», fragte Julia verblüfft.
Sein Lächeln vertiefte sich. «Sì», erwiderte er. «Nach vier Semestern Mathematik in München und zwei Jahren Sklavenarbeit in Malcesine, wo es ja ausschließlich deutsche Touristen gibt, habe ich endgültig erkannt, dass die Wissenschaft und ich wohl doch keine Freunde werden. Das Deutsch aber ist mir geblieben. Was kann ich für Sie tun?»
«Haben Sie Wasser?», stieß Julia hervor, noch immer damit beschäftigt, sich innerlich zu sammeln. «Ich bin am Verdursten.»
«Selbstverständlich. Fredda – ich meine, kalt?»
«Egal, Hauptsache, nass.»
Dankbar nahm Julia die leicht beschlagene Flasche, die er ihr bereits geöffnet reichte, in Empfang und trank.
«Besser?» Er hatte sie keinen Moment aus den Augen gelassen.
«Viel besser.»
«Tut mir leid, dass ich Sie heute Morgen so er…»
Ihre ungeduldige Geste brachte ihn zum Verstummen.
«Conti – sind Sie das?», fragte Julia. «Ist das Ihr Name?»
Er nickte. «Matteo Conti. Wieso fragen Sie?»
«Weil mein Großvater auch Conti hieß. Gianni Conti. Vor zwei Monaten ist er in Hamburg gestorben.»
Sein Gesicht war ernst geworden. «Das tut mir leid. Und deshalb sind Sie hier?», fragte er nach einer kleinen Pause.
«Um sein Vermächtnis zu erfüllen, ja. Haben Sie ihn vielleicht gekannt?»
«Leider nein.»
«Oder jemals von ihm gehört?», bohrte Julia weiter.
Abermals schüttelte er den Kopf – aber war da gerade nicht ein winziges Zögern gewesen?
Sie konnte sich ebenso gut getäuscht haben.
«Schade», sagte sie. «Hätte ja sein können.»
«Mein Vater hieß Leandro», sagte er. «Und mein Großvater Vito. Beide leben leider nicht mehr.»
Ein Vito stand auf der Liste des Nonno.
Zufall? Oder hatte er damit den Großvater des jungen Mannes gemeint? Aber dann müssten sie bei dem gleichen Nachnamen ja höchstwahrscheinlich verwandt gewesen sein …
«Gibt es denn viele Contis in Lucignano?», fragte Julia.
«In der Region ist Conti ein häufiger Name. Hier im Ort sind mein Bruder Bruno und ich heute die einzigen Männer, die so heißen.» Er schmunzelte. «Aber er will bald heiraten, und wie ich Bruno und seine Verlobte kenne, gibt es sicher schon bald viele neue kleine Contis …»
Julia schüttelte den Kopf, als sei seine Antwort ganz und gar unbefriedigend.
«Ich kann Ihnen gern zeigen, wo Sie unsere Vorfahren finden», fuhr Matteo Conti fort. «Dazu müssen Sie mich allerdings auf unseren Friedhof begleiten.»
«Genau den suche ich», erwiderte Julia. «Aber meine Fragen liefen bisher ins Leere. Chiuso, chiuso, das ist alles, was ich dazu gehört habe. Wie kann ein Friedhof denn geschlossen sein?»
Da war es wieder, sein spitzbübisches Lächeln, das ihre Knie weich werden ließ.
«Weil heute Donnerstag ist», erwiderte er sanft. «Und donnerstags ist unser Friedhof geschlossen.»
«Weil auch die Toten einen Ruhetag brauchen?», rutschte es ihr heraus.
«Weil der Gärtner ungestört arbeiten möchte», antwortete er ungerührt.
«Und wo finde ich diesen sagenhaften Friedhof mit seinen strengen Besuchszeiten?», wollte Julia wissen.
Matteo Conti ließ eine unbestimmte Geste folgen.
«Ein ganzes Stück draußen», sagte er. «Ich kann Sie hinbringen, wenn Sie möchten. Vielleicht morgen Vormittag? Da ist mein Laden nämlich geschlossen. Einverstanden?»
Sollte sie ablehnen, um nicht aufdringlich zu wirken?
Irgendwie gefiel ihr der Vorschlag. Und mehr als das.
Der ganze Mann gefiel ihr, so sehr, dass sie plötzlich ganz verlegen wurde. Sie entschloss sich, diese Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen.
«Va bene», sagte Julia.
«Verraten Sie mir noch Ihren Namen?», erkundigte er sich liebenswürdig. «Damit auch ich weiß, mit wem ich unterwegs bin.»
«Natürlich. Ich bin Julia Matthiesen.» Sie atmete tief aus. «Vielleicht nach dem Frühstück? Ich wohne in der Pension Martelli.»
Als Reaktion darauf zog er die Nase kraus.
«Keine gute Wahl?», erkundigte sich Julia.
«Emilia ist in Ordnung», antwortete er. «Sie ist Witwe und braucht das Geld. Aber ihre Pension ist ein wenig» – er räusperte sich – «altmodisch. Finden Sie nicht?»
Julia dachte an die Heiligenbildchen, den strengen Geruch nach Mottenkugeln und den mehr als sparsamen Wasserhahn.
«Ein wenig», räumte sie ein. «Gäbe es denn etwas Besseres hier? Ich musste von Hamburg aus buchen. Und ein Vermögen nur fürs Übernachten wollte ich auch nicht ausgeben.»
«Sehr vernünftig. Ja, ich denke, da finden wir etwas. Lassen Sie sich überraschen. Dann a domani, alle dieci?»
«Sì», erwiderte Julia. «A domani!»
Ein englisches Paar mit zwei lauten rothaarigen Kindern betrat den Laden, und Julia ging hinaus – nicht ganz aus freien Stücken allerdings, denn eigentlich wäre sie gern noch länger geblieben. Dieser Matteo Conti strahlte etwas aus, das sie gern in seiner Nähe sein ließ, obwohl sie ihn doch gar nicht kannte. Es lag eine ganze Weile zurück, dass sie sich mit jemandem spontan so wohlgefühlt hatte. Mit Alex, ihrem Ex, von dem sie sich vor über einem Jahr getrennt hatte, war sie ein unterschwelliges Gefühl der Anspannung nie ganz losgeworden, einen ständigen Druck, es ihm recht machen zu müssen, damit er bloß keine schlechte Laune bekam. Alex schien das anders zu sehen und versuchte noch immer, sie zu einem Revival der Beziehung zu überreden, doch Julia hatte innerlich längst damit abgeschlossen.
Trotzdem fühlte sich das Alleinsein manchmal bedrückend an, zumal ihre Freundin Samira seit ein paar Monaten schwer verliebt war. Hinzu kamen die gelegentlichen Bemerkungen von Mama, die wehtaten, auch wenn sie es sicherlich nur gut mit Julia meinte.
«Wer zu anspruchsvoll ist, findet vielleicht niemals den richtigen Partner. Man muss kompromissbereit sein, sonst wird es nichts mit dem Leben zu zweit, und wie das bei aller Unterschiedlichkeit funktionieren kann, siehst du ja an deinem Vater und mir …»
Als ob sie das nicht selbst wüsste!
Aber in Dingen, die ihr wichtig waren, klein beizugeben, nur um sich nicht einsam zu fühlen, war für Julia eben auch keine Alternative. Außerdem: Sie war noch nicht einmal dreißig und hatte doch alle Zeit der Welt …
Hatte sie die wirklich?
Im Freundeskreis häuften sich in letzter Zeit die Hochzeiten und Geburten, das war unübersehbar. Julia ging jedes Mal hin, gratulierte und feierte fröhlich mit, hübsche Geschenke selbstredend eingeschlossen. Doch leider kehrte sie nach manch einer dieser Festivitäten nicht in der allerbesten Stimmung in ihre stille kleine Wohnung über dem Laden zurück.
Etwas musste anders werden mit ihrem brach liegenden Liebesleben, das spürte sie schon seit geraumer Zeit. Unglücklicherweise jedoch war ihr die gute Fee bislang noch nicht begegnet, die mit ihrem Zauberstab flugs für den richtigen Partner gesorgt hätte …
Inzwischen war Julia tief in Gedanken ein paar Gassen weitergelaufen. Hier standen die Steinhäuser noch enger zusammen, manche so dicht, dass in den oberen Stockwerken kleine Balkone von einer Straßenseite zur anderen liefen. Eine Art Labyrinth, das Geborgenheit und Schatten spendete. Überall gab es reichlich Blumenschmuck – Hortensien, Geranien, Rittersporn, bunt gemischt und in voller Farbenpracht. Schon jetzt konnte Julia sich ausmalen, wie im milden Nachmittagslicht die Bewohner ihre Stühle neben die Hauseingänge stellen würden, um sich über den neuesten Klatsch auszutauschen – undenkbar für eine Stadt wie Hamburg! Auf einer Steinbank rekelte sich eine gefleckte Katze so genüsslich, dass sie sich am liebsten danebengelegt hätte.
Die anstrengende Reise steckte ihr noch in den Knochen, und so beschloss Julia, weitere Besichtigungen zu verschieben und heute einen geruhsamen Tag einzulegen. Den Friedhof würde sie morgen mit Matteo Conti besuchen. Als Einheimischer konnte er ihr sicherlich auch mit dem gesuchten Notar weiterhelfen.
Die neuen Sneaker begannen zu drücken, so heiß hatte sie sich die Füße inzwischen gelaufen. Höchste Zeit, sie gegen etwas Luftigeres zu tauschen. Langsam kehrte sie zur Pension zurück, stieg die steilen Treppen hinauf und stellte in ihrem Zimmer angekommen fest, dass das Bett inzwischen wieder in seine anfänglich betonartige Ordnung gebracht und das Badezimmer penibel gereinigt worden war. Die strenge Signora hatte ihr nicht nur eine gefüllte Wasserkaraffe und eine kleine Flasche Rotwein auf den Nachttisch gestellt, sondern auch eine blaue Hortensie in einer schmalen weißgoldenen Vase.
Der Beginn einer zarten Freundschaft?
Zum Glück hatte sie ja nicht hören können, wie Julia mit Matteo Conti über das Zimmer gelästert hatte.
Grinsend holte Julia Bikini und Handtuch aus dem Schrank und packte beides zusammen mit ihrer aktuellen Lektüre in eine Basttasche. Dann befreite sie sich von den Sneakern, verließ in Sandalen die Pension und ging zum Parkplatz. Dort stieg sie in ihren Wagen und fuhr los in Richtung Rapolano Terme.
Am Fuß des Hügels waren viele Getreidefelder bereits abgeerntet, und dicke Heuballen warteten auf den Transport in die Scheunen. Sie fuhr an einigen Olivenhainen vorbei, wo die knorrigen Bäume in Zweier-, Dreier- und Vierergruppen zusammenstanden. Dichte, silbergraue Blätterdächer, die sich wie sanfte Wogen im Wind bewegten. Manche der Bäume sahen sehr alt aus; die Stämme waren voller Runzeln, Knoten und Risse.
«Wer sie pflanzt, denkt in Generationen», hatte der Nonno ihr erzählt. «Denn es dauert lange, bis sie den vollen Ertrag bringen. Doch dann können sie hundert Jahre und älter werden.»
Es war still auf der schmalen, teils sogar ungepflasterten Straße; außer dem Gesang der Zikaden war ab und zu nur ein Vogelruf zu hören, und Julia genoss die kurze Fahrt. Immer wieder ragten am Straßenrand Zypressen wie schlanke dunkelgrüne Pfeile majestätisch in den Himmel, und es tat ihr fast leid, als sie am Ortsschild von Rapolano Terme angelangt war. Andererseits lockte die Verheißung der berühmten Schwefelquellen, in denen schon die Römer gern gebadet hatten. Heute galten sie als Heilmittel bei rheumatischen Erkrankungen sowie bei Gelenk- und Wirbelsäulenleiden. Vom langen Sitzen an der Werkbank, an der ihre ausgefallenen Schmuckstücke entstanden, hatte Julia in letzter Zeit immer mal wieder unter Rückenschmerzen gelitten, also konnte ein Bad im warmen Wasser gewiss nicht schaden.
Der Parkplatz vor der Badeanstalt war gut besetzt; Julia stellte das Auto ab und betrat das weiße Gebäude. Bereits am Ticketschalter schlug ihr ein Geruch entgegen, der sie an faule Eier erinnerte und leicht die Nase rümpfen ließ.
Aber was tat man nicht alles für die Gesundheit …
Nach wenigen Schritten hatte sie die großzügig angelegte Badelandschaft erreicht; zwei geräumige Becken, umrahmt von Liegewiesen, umstanden von weiteren Zypressen und schattenspendenden Pinien. Julia suchte sich ein ruhiges Plätzchen, dann ging sie noch einmal hinein, zog sich in einer der Kabinen um und kehrte im Bikini wieder zurück. Die Liege war im Eintrittspreis inbegriffen; der O-beinige Bademeister stellte sie feixend auf, offensichtlich äußerst angetan, dass Julia den Altersdurchschnitt der übrigen anwesenden Damen erheblich senkte.
Sie las ein paar Zeilen, dann ging sie unter die Dusche und ließ sich anschließend ins warme Wasser gleiten. Das Schwimmen im Schwefelwasser entpuppte sich als erstaunlich anstrengend, aber man konnte sich auf den Rücken legen und tragen lassen. Mit halb geschlossenen Augen ließ Julia sich treiben, bis ein unverwechselbarer Klingelton sie aufschreckte.
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins … So klang nur ihr Handy!
Sie spurtete aus dem Becken und nahm den Anruf an.
«Julekind», hörte sie ihre Mutter sagen. «Wo steckst du denn? Nicht einen Pieps hört man von dir. Papa und ich hatten schon Angst, die Cosa Nostra hätte dich verschleppt!»
«Ich bin in der Toskana, Mama, nicht auf Sizilien! Ich hätte euch ohnehin gleich angerufen, aber jetzt war ich erst einmal baden.»
«Im Lago Trasimeno? Wolltest du dich nicht in Lucignano umsehen?»
«Das tue ich auch. Nein, kein See weit und breit, aber warme Schwefelquellen ganz in der Nähe, und die hab ich gerade ausprobiert.»
«Und sonst? Alles in Ordnung? Geht es dir gut?»
Hast du denn schon etwas rausgefunden?, hörte Julia zwischen den Zeilen, aber da ihre Mutter es nicht aussprach, antwortete sie auch nicht darauf.
Sieh an, jetzt wurde sie also doch neugierig!
Aber da sie zuvor abgelehnt hatte mitzufahren, war diese Reise in die Vergangenheit ihres Nonno Julias Angelegenheit, und so wollte sie es zumindest bis auf Weiteres auch beibehalten.
«Alles bestens. Schönstes Wetter, die Leute hier sind freundlich, und morgen gehe ich auf den Friedhof.»
«Wieso das denn?» Die Stimme ihrer Mutter klang auf einmal spitz.
«Weil der unter anderem auf der Liste steht, die Nonno mir vermacht hat. Und irgendwo muss ich ja schließlich anfangen.»
«Dann sei bloß vorsichtig. Da unten kann man nämlich nicht jedem trauen …»
«Sagt ausgerechnet die Tochter eines waschechten toscano», erwiderte Julia lachend. «Brava!»
«Gerade die. Mein Papa, dein heiß geliebter Großvater, war wunderbar, aber er hatte auch diverse Tapetentüren, hinter denen er blitzschnell verschwinden konnte. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.»
Was Julia gerne vertiefen würde, aber nicht jetzt am Telefon.
«Ich glaube, ein Gewitter ist im Anzug», entschuldigte sie sich nicht ganz wahrheitsgemäß. «Ich packe lieber zusammen und laufe zum Auto.»
«Unbedingt! Du weißt ja, wie gefährlich Blitze sein können …»
Julia musste grinsen, als sie wieder unter ihrer Pinie lag.
Wie ängstlich ihre Mutter war!
Ob Anna das auch schon gewesen war, als sie noch Conti geheißen hatte? Oder war sie es erst während ihrer Ehe mit dem charmanten Jan Matthiesen geworden, der eindeutig mit dem Beschützersyndrom ausgestattet war? Für seine kleinen Patienten, um die er sich liebevoll kümmerte, sicherlich eine gute Sache, für die eigene Tochter jedoch bisweilen eher lästig. Julia liebte ihren Vater, gerade weil er so hoffnungslos deutsch war, wobei ihr unbeschwerteres italienisches Erbe sie ebenfalls anzog.
Höchste Zeit, dass sie endlich nach Italien gekommen war!
Sie würde den Tag später mit einer Pizza und einem guten Glas Wein ausklingen lassen, um sich morgen mit Matteo Conti in neue Abenteuer zu stürzen.
Die Osteria le Botti lag fast gegenüber der Pension Martelli, und Julia bereute ihre Wahl nicht, als ihr dort nach einem erfrischenden Insalata Caprese eine krosse Pizza, reichlich belegt mit Tomaten, Mozzarella, Kapern und Sardellen, serviert wurde. Ein heftiges Gewitter mit Platzregen, das überraschend schnell aufgezogen war, hatte verhindert, dass sie im Freien speisen konnte, doch auch der urige Innenraum mit seinen alten Steinwänden und den geschrubbten Holztischen gefiel ihr. Sie hatte sich einen Platz ziemlich weit hinten ausgesucht, von dem aus sie das gesamte Lokal überblicken konnte.
Frisch geschminkt und in ihrer türkisblauen Carmenbluse, die sie zu den Röhrenjeans trug, fand sie sich ganz passabel. Noch ein paar Sonnenstrahlen mehr, und ihre schulterlangen Haare würden wieder jenen leuchtenden Rotton annehmen, den der Nonno so geliebt hatte. «Una bella rossa», hatte sein anerkennender Kommentar immer gelautet.
Sollte sie sich noch ein zweites Glas Chianti gönnen?
Sie wollte dem Kellner gerade ein Zeichen geben, als die Tür aufging und Matteo Conti hereinkam, begleitet von zwei auffallend hübschen Frauen, die eine blond, die andere schwarzhaarig. Die beiden hatten ihn in ihre Mitte genommen und redeten lachend auf ihn ein. Das muntere Trio wählte einen Tisch nahe des Eingangs, und leider setzte Matteo sich mit dem Rücken zu Julia, die er in ihrer Ecke gar nicht bemerkt hatte.
Trotz der Entfernung flogen ein paar Bruchstücke ihrer Unterhaltung bis zu ihr herüber. Offenbar war er mit zwei Französinnen unterwegs.
Kundinnen?
Oder gehörte Conti zu jenen Papagalli, die sich auf den Kontakt mit reizvollen Touristinnen spezialisiert hatten?
Julias gerade noch so würzige Pizza schmeckte auf einmal fad, und die Lust auf mehr Wein war ihr vergangen. Sie legte das Besteck beiseite und spitzte die Ohren, doch leider war ihr Schulfranzösisch zu mager und die Entfernung zu groß, um verstehen zu können, worüber die drei sich unterhielten. Dafür bekam sie mit, wie ausgelassen sie lachten und herumalberten. Besonders die Blonde hatte ständig etwas an Conti herumzufummeln, was ihn keineswegs zu stören schien, wenn Julia seine Körpersprache richtig deutete.
Waren die beiden ein Paar und die Schwarzhaarige die Begleitperson?
Julia musste ihren Eindruck revidieren, als jene aufstand und sich auf den Weg zur Toilette machte, nicht ohne Conti zuvor inniglich zu umarmen.
Er war ein Papagallo!
Ihre Laune sank weiter, und plötzlich hatte die Aussicht auf den morgigen Ausflug viel von ihrem Glanz verloren. Am liebsten wäre sie aufgestanden und gegangen, doch wie sollte sie das anstellen, ohne am vorderen Tisch vorbeizukommen?
Die Schwarzhaarige war wieder zurück auf ihrem Stuhl, und das Plappern und Schäkern ging weiter. Julia winkte den Kellner heran und bezahlte. Auf den angebotenen limoncello della casa verzichtete sie; viel lieber hätte sie in diesem Moment eine Tarnkappe bestellt, um unbehelligt an dem Trio vorbeizukommen.
Schließlich stand sie auf und ging ein wenig steifbeinig in Richtung Tür – und natürlich bemerkte Conti sie.
«Signorina Julia», sagte er überrascht auf Deutsch. «Sie haben auch hier gegessen? Hat es Ihnen geschmeckt?»
Sie nickte knapp.
«Sie wollen schon gehen? Setzen Sie sich doch zu uns!»
Das hätte ihr gerade noch gefehlt! Waren ihm zwei Frauen noch nicht genug?
Julia spürte, wie die beiden Französinnen sie neugierig musterten.
«Danke», sagte sie rasch. «Sehr freundlich. Aber ich habe noch jede Menge Telefonate zu erledigen … also dann, buona serata.»
«A domani!», rief er ihr fröhlich hinterher, während sie aus dem Lokal stiefelte. «Buona notte!»
Wie gut, dass die Pension so nah lag.
Fast fluchtartig überquerte Julia die schmale Straße und war heilfroh, als sie die Tür zugezogen hatte und sich die alten Mauern schützend um sie herumschlossen.
Sollte sie ihre Verabredung morgen absagen?
Auf dem Weg ins Bad entschied Julia sich dagegen.
Was dieser Conti in seiner Freizeit trieb, konnte ihr doch wirklich egal sein. Sie wollte zum Friedhof – und genau dorthin sollte er sie bringen.
Außerdem hatte sie ja nicht einmal seine Telefonnummer.
Zwei
Hamburg, Oktober 1943
Gianni
Das Straflager Sandbostel mitten im Teufelsmoor, in das man sie nach der Ankunft in Norddeutschland zunächst gebracht hatte, war ihm wie die Hölle erschienen – schmutzig, überfüllt, menschenverachtend –, doch das heruntergekommene Hamburger Schulgebäude, in das man Gianni anschließend zusammen mit schätzungsweise vierhundert anderen Kameraden verfrachtet hatte, stellte auch keine große Verbesserung dar. Unzureichende Sanitäranlagen, wegen Überfüllung alsbald in jämmerlichem Zustand, Stockbetten in den ehemaligen Klassenräumen, so dicht gestellt, dass man unweigerlich alles von allen mitbekam, dazu eine Verpflegung, die den Namen nicht einmal ansatzweise verdiente. Inzwischen war es deutlich kühler geworden, aber bis auf ihre Uniformen, von denen die Rangzeichen abgerissen worden waren, hatte jeder nur zwei fadenscheinige Decken zur Verfügung gestellt bekommen, um der bevorstehenden kalten Jahreszeit zu trotzen. Anstatt ihrer Lederstiefel, die die Wachposten konfisziert hatten, mussten sie nun Holzpantinen tragen, in denen sie alle Arbeiten zu erledigen hatten.
Wenigstens hatten sie Cosimo zusammen mit ihm verlegt. Gianni passte noch immer auf ihn auf, weil dieser nach den erlittenen Misshandlungen auf dem linken Auge so gut wie nichts mehr sehen konnte. Mio, wie er seinen kleinen Schützling inzwischen nannte, folgte ihm ergeben wie ein Hündchen, erleichtert, unter Giannis Schutz zu stehen.
Doch was war dieser schon wert?
Ganz unten waren sie gelandet, das hatten sie schon in Sandbostel zu spüren bekommen, angesiedelt weit unter den englischen und französischen Gefangenen, noch unter den Holländern und Belgiern, sogar unter den Rumänen, auf einer Stufe mit den Ukrainern, was wahrlich nichts Gutes bedeutete.
«Das gesamte deutsche Volk hasst euch!», hatte ihnen ein SS-Offizier beim Empfang in Hamburg auf Deutsch entgegengebrüllt, übersetzt von ihrem Landsmann Enrico, den alle möglichst mieden, weil er bereitwillig mit den Nazis kooperierte. «Und es verachtet euch zutiefst, denn jeder wahrhaft Deutsche verachtet Verräter! Nichts anderes seid ihr: ein Haufen feiger Schweine, die die Seite gewechselt haben, anstatt zu ihren Verbündeten zu stehen! Ihr werdet ihn zu spüren bekommen, diesen Abscheu eines ganzen Volkes, Tag für Tag, Monat für Monat, so lange, bis unser geliebter Führer den Krieg an allen Fronten glorreich gewonnen hat! Bis dahin werdet ihr arbeiten im Schweiß eures Angesichts, und wer sich davor drücken will, den erwarten drakonische Maßnahmen, vom Konzentrationslager bis hin zur Todesstrafe!»
Erste Kommandos, zu denen auch Gianni gehörte, hatten bereits zum Schutträumen ausrücken müssen, denn vor wenigen Tagen waren Teile Hamburgs von einem weiteren britischen Bombenangriff zerstört worden. Die Spuren des gigantischen Feuersturms von Juli und August, der, wie man munkelte, 30000 oder sogar noch mehr Menschen das Leben gekostet hatte, waren unübersehbar.
Gianni fand sich in einer bizarren Ruinenlandschaft wieder, aus der jedes Leben getilgt zu sein schien: zerstörte Straßenzüge, verrußte, halb eingefallene Häuserreste, Trümmer, wohin das Auge schaute, darunter seltsam wirkende Relikte aus glücklichen Tagen wie Kinderwagen, zerfetzte Sofagarnituren, auseinandergerissene Möbel. Dazwischen herumirrende Menschen, die ihre Unterkunft verloren hatten oder verzweifelt nach Vermissten suchten. Trotzdem fanden sie noch Gelegenheit, die ausgemergelten Fremden finster anzustarren oder sogar vor ihnen auszuspucken. Denn Gianni und seine Begleiter waren gezeichnet, genau wie die anderen Ausgegrenzten des Naziregimes: Auf den Rücken ihrer Jacken stand weithin sichtbar die Bezeichnung Ital oder IMI.
Mit bloßen Händen oder kaum tauglichen Schaufeln mussten sie den zum Teil noch schwelenden Schutt zur Seite schaffen. Die Arbeit war so hart und kräftezehrend, dass ihre Mägen brüllten, doch die dünne Gemüsesuppe, in der bestenfalls ein paar Kartoffeln dümpelten, oder der Brei aus Rübenschalen, dazu zwei Scheiben Brot und ein Löffel Margarine reichten nicht aus, um auch nur annähernd satt zu werden. Das Wasser schmeckte brackig, und was sich «Kaffee» schimpfte, war in Wahrheit eine undefinierbare bräunliche Brühe. Manche sammelten aus Verzweiflung Regenwasser und rissen auf dem Marsch zurück ins Lager heimlich die letzten Brennnesseln aus, um sich Tee zu kochen, denn mit dem Hunger ließ sich nicht verhandeln.
Die Gier nach etwas Essbarem beherrschte sie alle.
Im Wachzustand verbot Gianni sich, an die einfachen Köstlichkeiten seiner Heimat zu denken: den saftigen Brotsalat, die duftende Minestrone, Mamas sommerliche Pasta mit Olivenöl, Knoblauch und Pfeffer, gebratene Leber mit Zwiebeln, vor allem die köstliche Torta della Nonna … In seinen Träumen jedoch überfielen ihn die Erinnerungen daran, und er wachte noch hungriger auf.
Schon nach wenigen Tagen fühlte er sich total geschwächt. Noch ärger traf es den klapperdürren Mio, der kaum noch alleine stehen konnte.
«Du musst durchhalten, fratellino», beschwor ihn Gianni. «Sonst stecken sie dich noch in die Krankenstation. Und wer da landet, für den ist das Ende nicht mehr weit.»
Aus Mitleid gab er ihm oft die Hälfte seiner kärglichen Brotration ab, doch das Wenige konnte kaum etwas ausrichten. Zumal sich im Lager herumsprach, dass sie alle bald in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden würden. Zwölf Stunden im Schichtdienst Handgranaten oder anderes Kriegsmaterial zusammenschrauben – das bedeutete sogar für gesunde, gut ernährte Arbeiter Schwerstarbeit.
«Sie wollen, dass wir alle krepieren, und das möglichst schnell.» Francesco, der aus Arezzo stammte, war der Pessimistischste unter ihnen, ein großer, hagerer Mann mit Stirnglatze, der schon jetzt mit Mitte zwanzig so gebückt ging, als laste die Schwere eines langen Lebens auf seinem Rücken. «Das spart ihnen das Geld für unseren Unterhalt.»
«Unsinn!», widersprach Paolo aus Bologna, der Kommunist und schon dreimal geflohen war, bevor sie ihn wieder eingefangen und schließlich doch zum Kampf für den Duce gezwungen hatten. «Arbeiten sollen wir, denn den Nazis gehen die Männer aus, deshalb sind wir hier. Einen Großteil ihrer Leute haben sie sinnlos in Russland verheizt, jetzt fehlen ihnen die Arbeitskräfte für ihre Fabriken. Und wie sie zuvor halb Europa überfallen und reihenweise Schätze geplündert haben, so rauben sie jetzt die Menschen. Sie brauchen uns, dringend sogar, sonst haben sie bald kein Material mehr, mit dem sie Krieg führen können.»
«Aber wie sollen wir denn arbeiten – mit nichts als lauter Löchern im Bauch?», jammerte Francesco.
«Du sollst arbeiten, bis du umfällst. Dann tritt der nächste an deine Stelle und macht genau da weiter, wo du aufgehört hast», erwiderte Paolo ungerührt. «Es sei denn, wir streiken. Und zeigen ihnen, dass wir Makkaronifresser, wie sie uns beschimpfen, alles andere als machtlos sind.»
Gianni gefiel diese Idee, doch er blieb der Einzige. Die anderen duckten sich und gehorchten weiterhin den Befehlen der Wachleute, deren Wirksamkeit diese durch gezielte Prügeleinsätze zu verstärken wussten.
«Ihr seid Abschaum!», brüllten sie die italienischen Militärinternierten an, wie sie nun offiziell hießen. «Kein Wunder, dass Italien bei den Alliierten um Gnade winseln musste! Den Lohn dafür bekommt ihr jetzt!»
Nach einigen Tagen landete Mio dann doch auf der gefürchteten Krankenstation, weil er morgens zu schwach zum Aufstehen gewesen war. Er fieberte stark und hustete bellend. Gianni brachte ihm die Hälfte seiner Suppe und flößte sie ihm löffelweise ein.
«Gib nicht auf, fratellino», forderte er ihn auf und dachte dabei an seinen eigenen Bruder, von dem er so lange nichts gehört hatte.
Dass Vito den Bauernhof verlassen hatte, bevor die Wehrmacht ihn hatte einfangen können, war das Letzte, das Gianni von ihm mitbekommen hatte. Rebellisch von Kindheit an und nur allzu gern über seine Kräfte agierend, hatte sein jüngerer Bruder sich offenbar den örtlichen Partisanen angeschlossen, um Sabotageakte gegen die deutsche Besatzung zu unternehmen. Gianni war stets der Besonnenere von beiden gewesen. Wenn er zu Hause gewesen wäre, hätte er seinen Bruder natürlich vor dieser Aktion gewarnt, denn damit setzte Vito unweigerlich sein Leben aufs Spiel. Gianni bekam schließlich täglich am eigenen Leib zu spüren, wozu diese ehemaligen Verbündeten fähig waren. Aber hätte der Bruder auf ihn gehört?
Niemals!
Vito machte, was er wollte, ohne Kompromisse, so war es schon von jeher gewesen.
Wo er wohl gerade steckte?
Hoffentlich war er bei ihren Verwandten in Civitella gelandet, jenem kleinen steinernen Nest, das so abgelegen in den Bergen lag, dass sich wohl kaum je ein Nazi dorthin verirren würde. Doch wie hatte Vito, Widerstand hin oder her, die Familie schutzlos zurücklassen können? Was sollte nun aus den Frauen werden, aus Mamma, Zia Rosalia und Anna, wenn außer dem kranken Babbo, vor dem sich nicht einmal mehr der räudigste Köter fürchtete, kein Mann mehr da war, um sie zu beschützen?
Und wer würde die Olivenernte einbringen, die schon bald anstand?
Die harten Kriegsjahre und eine galoppierende Inflation hatten die Ersparnisse der Contis so drastisch zusammenschmelzen lassen, dass nicht mehr genug vorhanden war, um fremde Arbeitskräfte zu beschäftigen. Früher hatten in Notfällen die Nachbarn mitgeholfen, doch auch bei denen waren alle wehrfähigen Männer eingezogen worden oder geflohen, sodass diese Möglichkeit nicht mehr bestand.
Kein Olivenöl zu pressen hieß auch, kein Geld zur Verfügung zu haben, um zu heizen und damit den Winter zu überstehen – ein Gedanke, der Gianni ganz krank machte, denn in den Monaten November bis März konnten die Temperaturen auch bei ihnen in der Region empfindlich fallen. Als ältestem Sohn oblag es ihm, dafür zu sorgen, dass es in dieser Zeit allen gut ging. Wie aber sollte er seiner Familie von hier aus unter die Arme greifen – gefangen und herabgestuft auf den Status eines Schädlings, verdreckt und ausgehungert mitten im Feindesland?
Die seelischen Qualen, die er beim Gedanken an zu Hause empfand, überstiegen die körperlichen noch bei Weitem. Er war es gewohnt, gebraucht zu werden, tüchtig anzupacken, Dinge zu regeln und zu entscheiden – und nun war er hier bei den Deutschen dazu verdammt, sich ohnmächtig wegzuducken. Außerdem fehlten ihm seine Bäume, das Licht der Heimat, das Summen der Bienen, sogar das Meckern der Ziegen, wenn er sie morgens aus dem Stall holte, sowie das Gackern der Hühner, die zu füttern stets Annas Aufgabe gewesen war.
Seine kleine Schwester, so zart, so verträumt, so unschuldig – wie würde sie wohl diese schlimme Zeit ohne brüderlichen Schutz überstehen?
Dazu kam die Sehnsucht nach einem anderen Lächeln, das ihm bislang nur einige Male geschenkt worden war und deshalb umso kostbarer erschien. Er wusste, dass seine Angebetete mit ihren knapp siebzehn Jahren noch zu jung war, als dass er offiziell um sie freien könnte, doch in seinen Träumen hatte er es dennoch schon unzählige Male getan. Während der Messe in der Chiesa di San Francesco hatte er immer wieder verstohlen zu ihr hinübergeblickt und sehr wohl bemerkt, dass auch sie nicht abgeneigt schien. Wenn sie zu ihm rübergelugt hatte, war ihm heiß und kalt zugleich geworden, und er bekam vor lauter Aufregung am ganzen Körper Gänsehaut. Es störte ihn kein bisschen, dass sie eine Brille tragen musste, was ihr im Ort viel Spott eingebracht hatte. Als gufo – Eule – hatten die Kinder in der Schule sie gehänselt, das wusste Gianni von seiner Schwester, die mit ihr in der einklassigen Schule gewesen war.
Wie dumm und blind die Leute sein konnten!
Die Kurzsichtigkeit trübte ihre Schönheit doch kein bisschen. Gianni fand im Gegenteil, dass die runden Gläser ihre klugen braunen Augen nur noch mehr unterstrichen.
Gufetta, kleine Eule, so nannte er sie zärtlich, wenn er an sie dachte, und er hätte ihr so gern noch tausend andere Kosenamen ins Ohr geflüstert. Doch der bullige Metzger Ludovico Barbero bewachte seine jüngste Tochter wie seinen Augapfel und war bereit, jeden Mann zu verprügeln, der sich ihr zu nähern versuchte. Allerdings war das junge Mädchen vor ein paar Monaten zu ihrer Zia Regina ans andere Ende des Städtchens gezogen, das stand in Annas letztem Brief, der ihn noch erreicht hatte. Regina Barbero, deren Hüfte ihr in letzter Zeit offenbar solche Probleme bereitet hatte, dass sie auf die Unterstützung ihrer Nichte angewiesen war, rauchte öffentlich, galt als ausgesprochen trinkfest und sah das Leben bei Weitem nicht so eng wie ihr sittenstrenger Schwager. Der Ehemann war ihr irgendwann abhandengekommen, angeblich nach Kanada ausgewandert, so wurde im Ort gemunkelt, doch so genau wusste das keiner. Geblieben war ihr kleiner Sohn Tommaso, den sie nun ohne männliche Unterstützung großziehen musste.
Wenn er jetzt nur zu Hause sein könnte, nah bei seiner Gufetta, wäre vielleicht so einiges möglich …
Kam ihm das alles in den Sinn, war an Schlaf erst recht nicht mehr zu denken, und so verbrachte Gianni den Großteil seiner Nächte mit verzweifeltem Grübeln, begleitet vom Schnarchen, Stöhnen und Ächzen der anderen Männer um ihn herum. Zwischendrin waren ab und an auch ein paar verstohlene Schluchzer zu hören, doch natürlich wollte das am Morgen keiner gewesen sein. Dabei gab es für jeden hier viele Gründe zum Weinen.
Eines Abends kam Bewegung in die einstige Schule, als sich jener aufgeblasene SS-Offizier erneut zwischen den elenden Stockbetten aufbaute und die Männer zu überreden versuchte, sich für den Dienst in der deutschen Wehrmacht zu verpflichten – natürlich abermals begleitet von seinem Adlatus, der alles übersetzen musste.
«Die allerletzte Gelegenheit zur Umkehr, die der Führer euch gewährt!», dröhnte er, in seiner makellosen schwarzen Uniform und den blank gewichsten Stiefeln ein krasser Gegensatz zu den gerupften Elendsgestalten vor ihm. «So könnt ihr durch persönlichen Einsatz ein Stück wiedergutmachen, was euer schäbiges Land an ihm und an uns Deutschen verbrochen hat! Als deutsche Soldaten bekommt ihr eine ordentliche Uniform, Schusswaffen, Munition und natürlich anständig zu essen! Einige eurer Offiziere waren bereits so klug, dieses einmalige Angebot anzunehmen. Schließt euch ihnen an. Ihr werdet es nicht bereuen!»
Breitbeinig stolzierte er wieder hinaus.