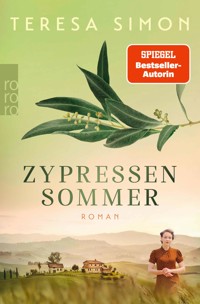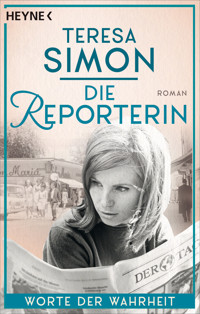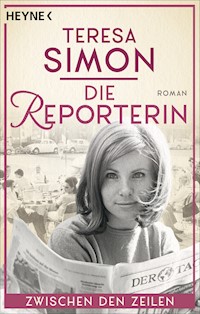9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Köln in den Vierzigerjahren. Die junge Nellie Voss hat gerade eine Stelle bei 4711 angetreten. Schnell wird ihr klar, dass sie ein untrügliches Gespür für Düfte hat. Ab und zu vergisst sie darüber sogar, dass ein schrecklicher Krieg tobt. Doch noch mehr beschäftigt sie ihre aussichtslose Liebe zu einem Mann, den sie nicht haben darf ...
Köln in der Gegenwart: Nach ihrer schmerzhaften Trennung eröffnet Liv einen kleinen Laden für Seifen und Düfte im Stadtviertel Ehrenfeld. Eines Tages begegnet sie auf der Straße zufällig einer geheimnisvollen weißhaarigen Dame, die bei ihrem Anblick regelrecht erschüttert ist und sie beschimpft. Wer ist sie, und was verbindet sie mit Liv?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Köln in den Vierzigerjahren. Die junge Nellie Voss hat gerade eine Stelle bei 4711 angetreten. Schnell wird ihr klar, dass sie ein untrügliches Gespür für Düfte hat. Ab und zu vergisst sie darüber sogar, dass ihr Land sich im Krieg befindet. Doch noch mehr beschäftigt sie ihre aussichtslose Liebe zu einem Mann, den sie nicht haben darf …
Köln in der Gegenwart: Nach ihrer schmerzhaften Trennung eröffnet Nina einen kleinen Laden für Seifen und Düfte im Stadtviertel Ehrenfeld. Eines Tages begegnet sie auf der Straße zufällig einer geheimnisvollen weißhaarigen Dame, die bei ihrem Anblick regelrecht erschüttert ist und sie beschimpft. Wer ist sie, und was verbindet sie mit Nina?
Die Autorin
Teresa Simon ist das Pseudonym einer bekannten deutschen Autorin. Sie reist gerne (auch in die Vergangenheit), ist neugierig auf ungewöhnliche Schicksale, hat ein Faible für Katzen, bewundert alles, was grünt und blüht, und lässt sich immer wieder von stimmungsvollen historischen Schauplätzen inspirieren.
Lieferbare Titel
Die Frauen der Rosenvilla Die Holunderschwestern Die Oleanderfrauen Die Fliedertochter
T E R E S A S I M O N
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 06/2020 Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Katja Bendels Covergestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Arcangel Images (Lee Avison) und Shutterstock (kosam, Subbotina Anna, Sergio33, Tom Gowanlock, Le Do, yegorovnick)
Für Babsi
Mein Duft ist wie ein italienischer Frühlingsmorgen nach dem Regen, Orangen, Pampelmusen, Citronen, Bergamotte, Cedrat, Limone und die Blüten und Kräuter meiner Heimat. Er erfrischt mich, stärkt meine Sinne und Phantasie.
Giovanni Maria Farina, Köln, um 1714
Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand.
Arno Pötzsch, 1900–1956
Prolog
Diese Zeilen sind für dich, geliebtes Herz, und ich habe sie in mein Tagebuch gelegt, damit du später einmal erfährst, warum alles so geschehen musste. Bitte sei nicht schockiert, wenn du das liest. Und lass dir vor allem keine Schuld einreden.
Du bist ein Geschenk Gottes – mein Geschenk.
Dabei dürfte es dich eigentlich gar nicht geben, hätten wir auf jene zornigen alten Männer gehört, die das Verbot schon vor langer Zeit festgelegt haben.
Ein Verbot gegen die Liebe.
Ein Verbot gegen die menschliche Natur.
Ein Verbot, das wir gebrochen haben, weil wir es brechen mussten.
Eine andere Zeit, eine andere Epoche wird uns vielleicht einmal verstehen …
Ich bringe dich weg von hier, damit du sicher aufwachsen kannst, bei einem Menschen, der mein Lehrer war, in so vielen Dingen. Er hat Erfahrung damit, ein Vater zu sein, und liebt dich von Herzen wie sein eigenes Kind. Und er ist so nobel, uns beiden seinen Namen zu schenken.
Kann die Zeit Wunden wirklich heilen?
Der Volksmund behauptet es, doch ich spüre, eine tiefe Wunde wird für immer in mir zurückbleiben. Deinen wahren Vater werde ich bis zum Ende meiner Tage im Herzen tragen. Zu stark war das Band zwischen uns, zu groß die Gefahr, die wir gemeinsam meistern mussten, zu bitter der Schmerz, als ich ihn für immer verloren habe. Dieser Verlust hat sich für mich angefühlt, als würde ich sterben, und hätte ich dich nicht schon als zartes Flattern in mir gespürt, wäre ich daran wohl zugrunde gegangen.
So aber musste ich weiterleben, um dir das Leben zu schenken, und jedes Mal, wenn ich dich ansehe oder berühre, weiß ich, dass es keine andere Entscheidung geben konnte. Ganz einfach ist es dennoch nicht, denn du bist so sehr sein Ebenbild, dass es mich manchmal wie ein Schlag trifft. Dann kehrt alles wieder zurück, mein Sehnen, mein Bangen, und ich durchlebe erneut jene aufreibenden letzten Monate zwischen Hoffen und Verzweiflung.
Ich bete, dass du niemals erleben musst, was uns beinahe zerbrochen hätte – deinen Onkel, deine Großmutter, meine beste Freundin, die niemals deine Patin werden konnte, und auch mich, deine Mutter. Deinen Vater hat der Krieg dir genommen, just in jenem Moment, in dem er bereit gewesen wäre, sich zu uns zu bekennen, und dafür hasse ich das sinnlose Töten umso mehr, das so viele Leben gekostet hat.
Aber nun ist das Schlimmste überstanden. Wir haben Frieden, und ich hoffe auf einen Neuanfang jenseits der Grenze. Mögest du glücklich aufwachsen in diesem Land; unser neuer Name soll dir dabei helfen. Meine Aufzeichnungen werden dir eines Tages beweisen, dass es im Land deiner Mutter nicht nur Fanatiker und Mitläufer gab, sondern auch Menschen, die tapferen Widerstand gegen ein unmenschliches Regime geleistet haben.
Dieses Erbe schlummert in dir, und das zu wissen macht mich froh. Wenn du alt genug bist, um es zu verstehen, sollst du alles erfahren. Einstweilen verbleibt das Tagebuch in sicherer Obhut.
Gott sei mit dir.
Kinder wie du stehen unter seinem ganz besonderen Schutz, das weiß ich, auch wenn die Kirche anderes behauptet. Möge er dich führen und behüten. Möge er dich glücklich machen und zu einem so tapferen Menschen heranwachsen lassen wie deine beiden Väter es waren.
Köln, im Frühling 1945
1
Köln, Mai 2019
Gleich mussten sie kommen.
Livs Herz schlug bis zum Hals, und ihre Hände waren trotz des sonnigen Spätfrühlingstags eiskalt, so aufgeregt war sie. War es wirklich eine gute Idee gewesen, ausgerechnet damit zu starten, noch vor der offiziellen Eröffnung?
Doch jetzt gab es ohnehin kein Zurück mehr.
Alle Karten waren verkauft; die Kundinnen wollten etwas erleben für ihre vierzig Euro, die sie im Voraus für das Duftseminar bezahlt hatten. Kein geringer Betrag für Ehrenfeld, das Kölner Stadtviertel, in dem ihr neuer Laden lag. Die nächste Idiotie, die sie begangen hatte, würde manch einer vielleicht sagen. Wer brauchte an der verkehrsreichen und alles andere als noblen Venloer Straße schon ein Geschäft, das sich Göttliches Düftchen nannte?
Und doch hatte sie gerade das an diesem Veedel, wie die Kölner ihre Stadtviertel nannten, gereizt: das Miteinander der Kulturen, eine friedliche Koexistenz von hip und schäbig, von gestern und übermorgen, von gut betucht und eher ärmlich. Es war laut, es war bunt, es war dreckig – und ungemein lebendig. Im Vergleich dazu wirkte ihre alte Wohngegend in der Maastrichter Innenstadt geradezu museal, und obwohl sie ihre niederländische Heimat manchmal vermisste, hatte Liv ihren kühnen Entschluss, nicht nur einen Neuanfang in Köln zu wagen, sondern auch noch ihr Hobby zum Beruf zu machen, bislang noch nicht bereut.
Genau genommen, hatte sie gar keine andere Wahl gehabt.
In ihrem Testament hatte Tante Wimmi Livs Umzug nach Köln, genauer gesagt nach Köln-Ehrenfeld, als Bedingung genannt, um das Erbe anzutreten. Ohne diese Verfügung, die Liv zwar band, ihr gleichzeitig aber auch einen unerwarteten finanziellen Spielraum eröffnete, hätte der Abschied von Maastricht wohl ein Traum bleiben müssen. So aber konnte sie sich von all jenem trennen, das sie nur noch belastet hatte: die gemeinsame Wohnung mit Hendrik, die nach dessen überstürztem Auszug zu groß und vor allem zu teuer für sie und Thijs geworden war. Die Stammkneipen, in denen sie oft Freunde getroffen hatten, bevor der Kleine sich angemeldet hatte. Ihren Job als Biologin in einem mittelständischen Pharmaunternehmen, der in seiner Eintönigkeit für sie nach der Zeit des Mutterschutzes jegliche Attraktivität verloren hatte. Vor allem aber der Anblick des Standesamts, in dem bereits das Aufgebot gehangen hatte, bevor der untreue Verlobte im letzten Augenblick die Flucht ergriff …
Wie wohl ihr kleiner Sohn das alles verarbeitete?
Manchmal wünschte sie sich, Thijs könne es ihr erzählen, doch dazu reichte sein Wortschatz noch nicht aus. So blieb ihr nur, ihn liebevoll zu beobachten und darauf zu hoffen, dass er mit der neuen Situation zurechtkam. Einiges sprach dafür. Mit seinen zweieinhalb Jahren war Thijs nach wie vor ein fröhliches Kind, das wenig Scheu vor Fremden zeigte und begeistert auf alles zurannte, das vier Beine, einen Schwanz und eine Schnauze hatte. Nicht einmal beim Essen war er heikel wie viele andere seines Alters, abgesehen von Brokkoli, von ihm als Kokko bezeichnet, den er zutiefst verabscheute. Beim Schlafengehen machte er in der Regel kein Tamtam, sondern schlummerte meist schon, bevor Liv das erste Schlaflied zu Ende gesungen hatte.
Doch es gab auch andere Zeichen.
So legte er jetzt manchmal das Köpfchen schief, wenn er müde wurde, und fragte »Pa?«, und zwar in einem so anrührenden Tonfall, dass Liv sich jedes Mal zusammenreißen musste, um nicht auf der Stelle in Tränen auszubrechen. Thijs vermisste also seinen Vater und verstand nicht, warum der auf einmal aus dem gemeinsamen Leben verschwunden war.
Genau besehen, verstand sie selbst es bis heute nicht …
Liv zwang sich in die Gegenwart zurück.
Zu viel Grübeln würde sie doch nur wieder traurig machen, und genau das konnte sie jetzt nicht gebrauchen. Lieber ging sie noch einmal durch den angrenzenden Ladenraum, wo der große Tisch und die Klappstühle aufgebaut waren, und kontrollierte, ob dort auch alles an seinem Platz war: die einundzwanzig Duft-Facticen, wie man in der Parfümeursprache die braunen Glasgefäße mit natürlichen Ingredienzien nannte. Die ausgedruckten Blätter mit den Stichwort-Erklärungen. Die kleinen Sprühflakons, in denen die Kundinnen ihr eigenes Parfüm kreieren durften, das sie dann mit nach Hause nahmen. Die schmalen weißen Papierstreifen, dazu gedacht, in die Facticen getaucht zu werden, nachdem Liv ihre, wie sie nur hoffen konnte, kurzweilige Einführung gegeben hatte. Und Namensschilder, die waren besonders wichtig! Sobald alle sich beim Vornamen nannten, kam jedes Mal Schwung in die Runde.
Hoffentlich lief alles glatt …
Man konnte im Vorfeld nie wissen, wie ein Seminar ausgehen würde, denn Düfte führten ihre eigene Regie. Von hässlichen Migräneattacken über halbe Veitstänze bis hin zu bestürzenden Lebensbeichten war ihr schon alles begegnet. Besonders gefährlich waren Erinnerungen, die durch einen Duft ausgelöst werden konnten. Aus gutem Grund standen daher auch zwei Glasgefäße mit frisch gerösteten Kaffeebohnen auf dem Tisch, auf die die Teilnehmer beißen sollten, falls unerwünschte Gefühle und Empfindungen sie zu überwältigen drohten.
Manchmal waren die begeisterten Teilnehmer in der Mehrzahl und übertrugen ihren Enthusiasmus rasch auf die anderen. Dann wieder überwogen Skeptiker oder sogar Nörgler, und Liv ahnte bereits nach wenigen Minuten, wenn ihr ein schwieriger Nachmittag bevorstand. Meistens jedoch gelang es ihr, die Stimmung mit Scherzen, historischen Anekdoten oder Tipps zur Verfeinerung der Mischungen herumzureißen. Es hatte aber auch schon Veranstaltungen gegeben, bei denen das leider nicht so gut geglückt war. Am unerträglichsten fand sie jedes Mal die Unentschlossenen, die so lange herummixten, bis schließlich alles verdorben war, weil sie bis dahin längst wieder vergessen hatten, was Liv ihnen anfangs eingeschärft hatte. Trotzdem durfte sie niemals schimpfen, so genervt sie innerlich auch sein mochte, sondern musste stets locker und positiv bleiben, um die Kunden nicht zu vergrätzen.
Und das alles jetzt auch noch auf Deutsch!
Ihr Vater war zwar der Ansicht, sie sei absolut zweisprachig, doch Liv hatte seine Muttersprache in den letzten Jahren leider ein wenig vernachlässigt. Niederländisch ging ihr leichter über die Lippen; auf Niederländisch träumte, rechnete und fluchte sie, und sie musste sich zusammennehmen, um nicht auch in Köln unwillkürlich in dieser Sprache zu antworten, wenn jemand sie anredete.
Sie sah auf die Armbanduhr.
Nur noch wenige Minuten, bis sie den Laden aufschließen musste. Gute zwei Stunden würden sie dann hier zusammen mischen.
Ob Thijs so lange bei Frau Esser im zweiten Stock durchhalten würde?
Liv war der alten Dame sehr dankbar, dass sie auf den Kleinen aufpasste. Ab Montag hatte er dann einen Platz in der St.-Joseph-Kita und war dort hoffentlich bestens versorgt. Ein bisschen störte sich Liv daran, dass es ein katholischer Kindergarten war, eine Einrichtung, mit der sie unwillkürlich Strenge, Ordnung und Gebetspflicht verband. Dafür lag er nur zwei Ecken weiter, war kindgerecht ausgestattet und nicht allzu teuer. Und Hanne Niedeck, die freundliche junge Erzieherin, die Thijs’ Gruppe leiten würde, hatte Mutter und Söhnchen auf Anhieb gefallen.
Ungeduldiges Klopfen an der Schaufensterscheibe riss sie endgültig aus ihren Grübeleien. Sie eilte nach vorne und öffnete die Tür. Die Teilnehmerinnen, die nun hereinströmten, waren alle zwischen dreißig und sechzig, wie sie auf den ersten Blick schätzte, also die übliche Altersgruppe. Zu Livs Überraschung befand sich darunter auch ein jüngerer Mann mit dunklen, schulterlangen Haaren und Stirnband, der sie angrinste, nachdem er sich prüfend umgesehen hatte.
»Cooler Laden«, sagte er anerkennend. »Passt in unsere Gegend.«
Livs Blick flog über Theke und Regale, streifte die indirekte Beleuchtung, die so schlicht wirkte und doch so teuer gewesen war, weil sie das Wesentliche raffiniert in Szene setzte, um schließlich auf dem dunklen Holzboden zu landen, der einen ruhigen Gegenpol zum Glas und den bunten Ingredienzien bildete. Cool war wahrlich nicht das Adjektiv, das ihr dabei in den Sinn gekommen wäre, doch wenn es bedeutete, dass ihm Einrichtung und Warenpräsentation zusagten, sollte es ihr recht sein.
Oder hatte er sich gerade über sie lustig gemacht?
Für einen Moment wurde sie unsicher, aber sein Lachen wirkte offen und freundlich.
»Ganz im Ernst«, bekräftigte er. »Keine anonyme Markenkette, nichts zu übertrieben Alternatives mit Schlamm und Heublütenaroma – wobei ich nichts gegen Heublüten an sich habe. Aber Sie wissen schon, was ich meine.«
Liv nickte und platzierte ihn vorsichtshalber am anderen Ende des Tisches, damit er ihr bei ihrem Vortrag nicht dauernd reinreden konnte. So hielt sie es immer, wenn jemand ihr gleich anfangs besonders redselig vorkam, und meistens funktionierte diese Methode.
Heute jedoch leider nicht.
Sie hatte noch nicht einmal richtig mit ihrer Einführung begonnen, als schon seine erste Frage kam.
»Gibt es eigentlich auch Parfümöle nur für Männer?«
Die Frauen grinsten.
»Zu jedem Duft gehen wir eine sehr persönliche Beziehung ein«, erwiderte Liv diplomatisch. »Der eine liebt ihn, der andere findet das gleiche Aroma fürchterlich, weil er damit vielleicht etwas Unangenehmes verbindet. Rein biologisch betrachtet, ist der Riechkolben der Männer eine Spur schwerer als der der Frauen, aber das heißt nicht, dass sie besser riechen könnten. Denn die weibliche Variante besitzt 16,2 Millionen Zellen pro Riechkolben, und zwar von Geburt an, wogegen Männern im Schnitt nur 9,2 Millionen Zellen zur Verfügung stehen.« Sie lächelte. »Männer und Frauen sollen ja in so einigen Dingen grundverschieden sein, wie man hört.«
Jetzt lachte die gesamte Runde.
»Das war keine Antwort auf meine Frage.« Der Mann runzelte die Stirn. Mit seinem Stirnband passte er wirklich so ganz und gar nicht zu den eher bieder wirkenden Frauen der Runde. Wenigstens trug er keinen dieser lächerlichen Samuraiknoten, mit denen jetzt so viele junge Männer herumliefen, die wohl nicht ahnten, wie sehr sie sich damit entstellten.
»Gut erkannt. Weil es nämlich keine allgemeine Antwort auf diese Frage gibt. Lassen Sie sich von den Düften finden, vielleicht erhalten Sie dann Ihre ganz persönliche Antwort. Und jetzt ein Vorschlag, damit es einfacher für uns alle wird.« Sie deutete auf das Namensschild, das sie sich ans Shirt geklebt hatte. »Ich bin Liv, komme aus Maastricht, lebe jetzt hier in Ehrenfeld und habe, wie man so schön sagt, eine sehr feine Nase. Ich darf euch heute in die Welt der Düfte entführen und schlage vor, dass wir uns duzen, das macht es gleich mal lockerer.«
Alle waren einverstanden, beschrifteten ihre Schilder und klebten sie sich an die Kleidung. Man konnte förmlich spüren, wie erste Entspannung eintrat.
»Ich könnte euch jetzt stundenlang etwas über das Riechen erzählen«, sagte Liv, »eines meiner Lieblingsthemen seit vielen Jahren. Aber ich will versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken, denn ihr seid ja schließlich nicht zu einem wissenschaftlichen Vortrag hier, sondern um euren eigenen Duft zu kreieren.«
Allgemeines Nicken.
»Und dennoch kann es ganz interessant sein, vorab ein wenig an Theorie zu erfahren: Bei jedem Atemzug erreicht eine Fülle von Informationen das Limbische System in unserem Gehirn. Der Nase kommt dabei nur eine Teilfunktion zu. Zunächst erfolgt die Geruchswahrnehmung über die Flimmerhärchen, die in gebündelter Form zu jeweils sechs oder acht Härchen auf einer Zelle der Riechschleimhaut sitzen. Diese wiederum befindet sich rechts und links in der Kuppel der Nasenhöhle etwa auf Augenhöhe; sie ist die einzige Stelle des Organismus, an der das Zentralnervensystem mit der Außenwelt in Kontakt tritt. Treffen nun Duftmoleküle auf die an den Flimmerhärchen sitzenden Eiweißrezeptoren, erfolgt eine Kopplung, und ein elektrischer Impuls wird an das Gehirn gesendet.«
Sie schaute in die Runde. »Seid ihr alle noch bei mir?«
Die Teilnehmerinnen nickten wieder. Der Mann mit dem Stirnband ebenso.
»Gut. Dann weiter: Im Gehirn werden diese Informationen zu einem Geruchsbild verarbeitet. Je nach Training und Sensibilität kann der Mensch zwischen viertausend und zehntausend Gerüche unterscheiden. Da die neuronale Vernetzung zum Erinnerungszentrum ausgeprägter ist als zum Sprachzentrum, sind Gerüche oft schwer zu beschreiben, lösen aber sofort Erinnerungen positiver oder negativer Art aus …«
»Das stimmt!«, kam der Zwischenruf einer Dame namens Helga. »Bei mir ist das Kamillentee. Musste ich als Kind immer trinken, wenn ich krank war. Heute brauche ich ihn nur von fern zu riechen, und schon …«
Ihre Geste war eindeutig.
»Kamillenblüten haben wir heute garantiert nicht dabei«, versprach Liv. »Aber dein Beispiel demonstriert anschaulich, was ich gemeint habe. Die subjektive Geruchsempfindung ist also, wie wir gerade gehört haben, bei jedem von uns von Erfahrungswerten bestimmt und daher individuell verschieden. Das werdet ihr gleich merken, wenn es ans Mischen geht.«
Die leicht entrückten Mienen der Teilnehmerinnen verrieten ihr, dass sie den theoretischen Teil zügig abschließen sollte.
»Nur noch eins«, fügte sie lächelnd hinzu. »Das Riechen ist entwicklungsgeschichtlich betrachtet erheblich älter als das Hören oder Sehen, was an seiner engen Anbindung an das Limbische System im Stammhirn liegt. Deshalb wirkt es auch direkter als die anderen Sinnesreize auf das Unterbewusstsein und lässt sich sehr viel weniger steuern oder kontrollieren. Gerüche treffen uns, ohne dass wir uns dagegen wehren können …«
»Ich kann dich nicht riechen.« Das kam von Dorle mit der herausgewachsenen Dauerwelle. »Sagt man doch so.«
»Richtig«, bestätigte Liv. »Und diese olfaktorische Wahrnehmung, um es einmal so richtig schön wissenschaftlich auszudrücken, vollzieht sich im Bruchteil von Sekunden. Übrigens nicht ganz unwesentlich für die Fortpflanzung. Ungeeignete Partner werden sozusagen schon im Vorfeld aussortiert.«
»Klappt aber leider nicht immer«, kommentierte Carmen seufzend. »Sonst hätte ich doch meinen Hajo und seine Schweißfüße niemals geheiratet!«
Abermals Gelächter. Jede der anwesenden Frauen hatte eine Anekdote dazu beizutragen, nur Jan, der Mann mit dem Stirnband, blieb stumm.
Liv kam nun zu den Inhalten der braunen Glasflaschen, erläuterte Bergamotte, Zitrone, Orange, Grapefruit, Vanille, Grünen Tee, Holz und Blumen, also all das, was die Basis eines Dufts darstellen konnte. Anschließend waren die sogenannten »Störer« an der Reihe, Essenzen wie Petitgrain, Lavendel, Rosmarin, Rosa Pfeffer, Basilikum, Ingwer, Früchte und Gewürze.
»Jetzt wird es spannend«, versprach sie. »Ihr ›baut‹ sozusagen zunächst die Basis eures neuen Dufts. Mittels der Pipette könnt ihr euer Glasfläschchen bis zu zwei Dritteln füllen, ich empfehle allerdings nicht mehr als maximal vier verschiedene Ingredienzien. Taucht zuerst die schmalen Streifen ein, und riecht dann daran, bevor ihr euch entscheidet. Sobald ihr fertig seid, könnt ihr mich nach Wunsch zurate ziehen, ob der neue Duft bis hierher auch funktioniert. Und falls die Düfte euch zu überwältigen drohen: einfach zwei Kaffeebohnen in den Mund stecken und draufbeißen, dann wird alles wieder neutral.«
Emsiges Werkeln am Tisch.
Einige sprachen sich eng mit der Nachbarin ab, andere waren vollkommen ins eigene Werk versunken. Nach und nach wurde Liv zu allen gerufen, gab ihren Kommentar ab und machte Verbesserungsvorschläge. Nur Jan hatte sich noch nicht gerührt.
»Du kommst zurecht?«, fragte sie ihn im Vorbeigehen.
Er zuckte die Achseln.
»Eigentlich ganz okay. Aber irgendwas fehlt.« Er hielt ihr seinen kleinen Flakon unter die Nase. »Keine Ahnung, was. Eventuell etwas …«
»Holz!« Liv und er hatten es im gleichen Augenblick gesagt.
»Funktioniert ja großartig«, sagte sie lächelnd und nutzte die Gelegenheit, um noch einmal auf die »Störer« einzugehen.
»Hier nur tropfenweise arbeiten. Weniger ist mehr, bitte vergesst das nicht! Maximal drei Störer, oft sind zwei verschiedene schon genug. Denn ist ein Duft erst einmal gekippt, kann ihn nichts mehr retten.«
»Was macht man dann?«, fragte Thea mit der randlosen Brille.
»Wegschütten.«
Wieder hatten Liv und Jan wie aus einem Mund geantwortet.
Unwillkürlich sah sie ihn genauer an.
Braune Augen, dunkle Haare von der Farbe nasser Erde, die schon lange keinen Schnitt mehr gesehen hatten, die Nase gerade, fast aristokratisch, ein markantes Kinn, das Entschlossenheit verhieß, und als Gegensatz dazu freche, sinnliche Lippen. Sie schätzte ihn auf Anfang dreißig, was bedeuten würde, dass er ein wenig jünger war als sie.
Womit dieser Jan wohl sein Geld verdiente?
Immerhin hatte er Zeit für einen Kurs am Freitagnachmittag unter lauter Hausfrauen und Rentnerinnen. Oder er nahm sie sich.
Gefühl besaß er auch. Als er ihr etwas später seine fertige Duftkreation zum Proberiechen reichte, war Liv beeindruckt.
»Frisch, mit feiner Holznote, Spuren von Grünem Tee und genau dem richtigen Hauch Petitgrain plus Rosa Pfeffer – an deiner Stelle würde ich es genau so belassen.«
»Meinst du?« Seine Nase kräuselte sich leicht. »Eigentlich bin ich ja nie ganz zufrieden …«
»Damit kannst du es sein. Wirklich gut gelungen als erster Wurf«, sagte sie.
Nicht alle Parfüms in der Runde waren so geglückt.
Manche Kompositionen waren für Livs Geschmack viel zu blumig ausgefallen, andere wiederum hatten eine zu bittere Note, und sie gab sich Mühe, durch den jeweils richtigen Tipp ihre Teilnehmerinnen im Nachklang doch noch zufriedenzustellen. Bei Dorle allerdings ging leider gar nichts mehr: zwei Tropfen Lavendelöl zu viel hatten ihr Gemisch in etwas verwandelt, das wie die übelste Möbelpolitur stank. Weil sie gar so betrübt war, schenkte Liv ihr zum Abschied einen Gutschein für den nächsten Kurs, damit sie ihr Glück noch einmal versuchen konnte.
Als schließlich alle gegangen waren und sie sich ans Aufräumen machte, zog sie ihr Resümee dieses Nachmittags. Gefallen hatte es allen, das war zu spüren gewesen, und sie würden garantiert in Nachbarschaft und Freundeskreis für sie werben. Zwei Drittel der Frauen hatten sogar verkündet, schon bald wiederzukommen, zum Teil in Begleitung von Töchtern, Müttern oder Freundinnen.
Es würde funktionieren.
Es musste aber auch funktionieren, denn Livs finanzielle Reserven waren trotz des Erbes inzwischen empfindlich zusammengeschmolzen. Zum Glück war die Miete für die Erdgeschosswohnung unweit des Ladens in der ruhigeren Körnerstraße überschaubar, und Liv hatte sogar im etwas größeren Nachbarhaus einen Tiefgaragenplatz für ihren alten Kombi ergattern können. Allerdings hätte sie sich für Thijs eine Gegend mit deutlich mehr Grün gewünscht, aber es gab ja immerhin die kleine Terrasse, die nach hinten hinausging. Mit ein paar Pflanzentöpfen, Liegestuhl und einem Mini-Planschbecken, das sie irgendwo noch auftreiben musste, ließ es sich dort im Sommer bestimmt gut aushalten …
Plötzlich wollte sie nur noch raus – und Thijs abholen, der sie bestimmt schon sehnsüchtig erwartete. Ein letzter Kontrollblick, ob im Laden auch alles in Ordnung war, dann schloss Liv ab und ging hinaus.
Draußen war es fast sommerlich warm. Die Venloer Straße empfing sie mit Lärm und einem bunten Cocktail an Gerüchen. Vom Kebabspieß bis zum orientalischen Zimtaroma strömte alles als wilde Mischung auf sie ein, und plötzlich spürte sie, wie hungrig sie war. Auf Kochen hatte sie keine Lust. Sie würde sich ihren Kleinen schnappen und mit ihm in diesen aufregenden neuen Kosmos eintauchen, in dem sie beide jetzt zu Hause waren.
»So brav war er.« Frau Essers eisengraue Löckchen wippten beim Reden im Takt, als sie ihr Thijs übergab. »Hat lange geschlafen, Apfelsaft getrunken und schön mit seinem Schweinchen gespielt.«
»Pinki!« Thijs drückte das schon ziemlich abgeliebte rosa Stofftier fest an sich.
»Pinki muss immer mit«, erklärte Liv. »Ins Bett, in die Badewanne, beim Verreisen, einfach überallhin. Wenn Pinki mal fehlt, ist die Welt nicht mehr in Ordnung.«
»Merk ich mir.« Frau Esser lächelte. »Und ich nehme Ihnen Thijs gern wieder ab. Kommen Sie einfach auf mich zu, wenn Sie mich brauchen. Mit so einem Kleinen fühlt man sich gleich wieder jung. Das mag ich.«
»Tausend Dank.« Liv streckte ihr den Flakon entgegen, den sie mittags noch schnell für die Nachbarin abgefüllt hatte. »Müsste Ihnen eigentlich gut stehen, aber wenn Sie es nicht mögen – einfach Bescheid sagen.«
Frau Esser betupfte ihr Handgelenk und beschnupperte sich anschließend mit verzückter Miene.
»Wunderbar! Ich liebe Parfüm. Außerdem bin ich ab jetzt die Betty, das macht alles leichter.«
»Und ich die Liv – freue mich sehr, liebe Betty! Und jetzt komm her, du kleiner Racker. Wir drehen noch eine Runde.«
Sie packte Thijs und Pinki in den blauen Buggy und zog los. An Speiseangeboten herrschte hier wahrlich kein Mangel. Café reihte sich an Restaurant – mexikanisch, italienisch, indisch, türkisch, vegan, alle auf den ersten Blick verlockend, sodass die Entscheidung schwerfiel. Schließlich landeten sie im Madame Tartine, einem kleinen Café mit französischen Spezialitäten, in dem Liv selbstgemachte Limonade, für Thijs Käsekuchen mit Himbeerspiegel und für sich ein mit Ziegenkäse überbackenes Walnussbrot bestellte, das köstlich schmeckte.
Plötzlich spürte sie, dass jemand sie ansah.
»Gute Wahl«, sagte Jan, der im hinteren Teil des lang gestreckten Raums allein an einem Tisch saß. Seine Haare hatte er inzwischen mit einem Band nach hinten genommen, was ihn älter und seriöser wirken ließ. »Wenn ich frei habe, bin ich gerne hier.« Sein Blick wanderte zu Thijs. »Dein Kleiner?«
Liv nickte. »Einunddreißigeinhalb Monate alt, der Sonnenschein meines Lebens, außer wenn er bockig wird. Dann kann es auch schon mal passieren, dass ich nur noch Regen sehe.«
Thijs war aufgestanden und zu Jan gelaufen. »Thijs«, erklärte er und deutete mit dem Zeigefinger erst auf sich und dann auf sein Schweinchen: »Pinki.« Sein Blick wurde fragend. »Und du?«
»Ich bin der Jan. Freut mich sehr, euch beide kennenzulernen. Deine Mama durfte ich heute schon beim Duft-Seminar erleben. Hat mir sehr gefallen.« Er lächelte. »Leider muss ich jetzt zur Arbeit, aber wir drei, ich meine natürlich wir vier, sehen uns bestimmt wieder.«
Liv gefiel, dass er freundlich mit Thijs redete, ihn aber nicht berührte. Sie mochte Leute nicht, die kleine Kinder einfach anfassten, als besäßen sie ein Recht dazu.
Im Vorbeigehen legte Jan eine Visitenkarte neben Livs Teller.
DELIRIUM, las sie. Anders speisen.
»Falls du mal Lust auf was Neues hast«, sagte er. »Aber unbedingt vorher anrufen. Kann ziemlich voll werden.« Er beugte sich zu Thijs, der ihm nachgelaufen war und an seinem Hosenbein zerrte. »Dann für heute tschö, kleiner Mann!«
»Tschö«, echote Thijs und setzte für alle Fälle noch ein »Vaarwel« hinzu.
»Ein echter Niederländer eben«, erläuterte Liv. »Zum echten Kölner muss er erst noch werden.«
Auf dem Rückweg kamen sie an der Kirche St. Joseph vorbei. Offenbar war gerade eine Messe zu Ende, denn eine ganze Gruppe vorwiegend älterer Frauen strömte aus dem Portal. Eine davon, groß, dünn und mit schlohweißer Mähne, blieb wie angewurzelt stehen, als sie Liv erblickte.
»Nellie?«, sagte sie mit brüchiger Stimme, starrte sie an und umklammerte dabei den Arm der rundlichen Frau neben ihr, als habe sie Angst zu stürzen.
»Ich bin nicht Nellie«, erwiderte Liv freundlich. »Sie müssen sich irren.«
»Aber du siehst genauso aus wie sie – die rotblonden Haare, die Augen, die Nase, der Mund, sogar die Sommersprossen …«, stammelte die Frau.
»Tut mir leid«, sagte Liv. »Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen.«
»Beruhige dich, Lilo«, bat ihre Begleiterin, die zu einem breiten Haarreif in Orange und Pink eine türkisfarbene Bluse und orangefarbene Plastikohrhänger kombiniert hatte, was in der Kombination ein wenig an die Bühnenoutfits in Mamma Mia! erinnerte. »Denk an dein Herz! Du hast doch gehört, was die junge Frau gesagt hat. Offenbar hast du sie mit jemandem verwechselt. Kann schon mal passieren, wenn man nicht mehr fünfundzwanzig ist. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Dort koche ich dir einen schönen Tee …«
Behutsam führte sie ihre Freundin weiter.
Liv machte sich mit dem Buggy in die entgegengesetzte Richtung auf den Weg. Nach ein paar Schritten blieb sie jedoch noch einmal stehen und sah sich um. Die weißhaarige Dame und ihre farbenfrohe Begleiterin waren verschwunden, vermutlich in einer der kleinen Nebenstraßen.
Doch der Gedanke an das, was sie gesagt hatte, ließ Liv den ganzen Tag nicht mehr los, auch nicht, während sie Thijs badete, ihm in den Schlafanzug half und ihn schließlich ins Bett brachte. Heute wollte er zum Einschlafen unbedingt eine Geschichte hören, also las sie ihm aus dem Regenbogenfisch vor, den er schon so gut kannte, dass er mitbrabbeln konnte.
Nach wenigen Sätzen fielen ihm allerdings die Augen zu; Thijs war eingeschlafen.
Liv setzte sich mit einem Glas Wein auf die Terrasse. Irgendwo in der Nähe hörte sie lautes Fauchen, wahrscheinlich ein Revierkampf zweier Katzen.
Aber du siehst genauso aus wie sie –die rotblonden Haare, die Augen, die Nase, der Mund, sogar die Sommersprossen …
Unwillkürlich berührte sie ihre Nase.
Die alte Frau hatte so überzeugt geklungen. Und ziemlich erschrocken noch dazu. Als hätte sie einen Geist gesehen.
Unsinn, sagte Liv sich schließlich. Es gibt keine Geister. Und ich bin erst recht keiner.
Ein Plopp ließ sie zum Smartphone greifen.
Gut in Hanoi gelandet, lautete die WhatsApp ihres Vaters. Mein Abenteuer kann beginnen! Gruß und Kuss für dich & Thijs. Papa.
Sie musste schmunzeln.
Ein Leben lang war er stets vorsichtig gewesen: im Berufsleben, im Umgang mit Geld, bei seinen Wünschen und Ansprüchen. Und jetzt, mit vierundsiebzig, brach er auf einmal zu einer ausgedehnten Südostasientour auf! Liv gönnte ihm diese aufregende Erfahrung von ganzem Herzen, keine Frage.
Aber wenn sie ehrlich war, vermisste sie ihn bereits jetzt.
Und es hätte ihr Sicherheit gegeben, ihn bei ihrem Neustart nur anderthalb Stunden entfernt in Maastricht zu wissen, statt Abertausende Kilometer entfernt in Asien.
Sie stand auf, trug ihr Glas in die Küche, schloss die Terrassentür und machte sich anschließend im Bad für die Nacht fertig.
Doch sie konnte lange nicht einschlafen. Als die Müdigkeit sie schließlich doch übermannte, träumte sie von duftenden weißen Blüten, die auf sie herabrieselten und sie nach und nach zudeckten.
2
Köln, Mai 1940
Wann hat eigentlich alles angefangen?
Bereits im Februar, als die Kinder der Pfarrei St. Joseph so traurig waren, weil der Karnevalsumzug verboten worden war und der neue Kaplan heimlich für sie eine kleine kostümierte Feier im Pfarrsaal veranstaltet hat? Damals habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, und gefallen hat er mir auf Anhieb: groß, athletisch, von der Figur her eher einem Sportler als einem Geistlichen ähnelnd, mit dunkelgrünen Augen und braunen Haaren, die lockig wären, würde er sie nur eine Spur länger tragen.
Oder war es, als wir mit unseren Körben die Ostermesse besucht haben, um traditionsgemäß Brot, Eier und Schinken weihen zu lassen?
Beim Hinausgehen hat er an der Kirchentür jedem die Hand geschüttelt und frohe Ostern gewünscht. Plötzlich hat mein ganzer Körper gekribbelt, und als er mich dann auch noch so verschmitzt mit seinen Grübchen angelächelt hat, war ich verloren.
Greta schien es ähnlich zu ergehen.
»Was für ein Mann!«, hat sie gestöhnt, kaum dass St. Joseph hinter uns lag. »Und welch abgrundtiefe Verschwendung …«
Muss ich betonen, dass Greta und ich seitdem keine Sonntagsmesse mehr versäumen? Wir, die bislang nicht gerade die regelmäßigsten Kirchgängerinnen waren?
Zum Glück sind es von unserer Wohnung in der Körnerstraße bis zur Kirche in der Venloer Straße nur wenige Schritte. Greta aber, eine begeisterte Langschläferin, nimmt dafür sogar die Anreise aus Lindenthal in Kauf. Dabei ist sie so gut wie verlobt. Aber das scheint sie manchmal zu vergessen. Vor allem, wenn sie Kaplan Benedikt Maria Weiss zu Gesicht bekommt.
Ich lasse ihr ihre Schwärmereien. Greta hat viel Temperament, das muss an dem italienischen Blut in ihren Adern liegen. Bei ihr fällt alles immer eine Nummer größer aus: Freude, Enttäuschung, Begeisterung, Trauer. Allerdings kann sie sich das auch leisten, denn sie stammt aus einer der angesehensten Familien der Stadt. Hätten wir beide nicht im gleichen Jahrgang die weiterführende Schulbank gedrückt, wären wir uns sicherlich niemals begegnet. So aber hat die Handelsschule für Frauen uns zu besten Freundinnen gemacht: Greta Farina, deren berühmte Vorfahren jene Parfümmarke ins Leben gerufen haben, die an allen europäischen Höfen Triumphe feiern konnte, und ich, die Halbwaise Nellie Voss, deren Mamm Ilka jeden Tag in der kleinen Eckkneipe Halflang Kölsch ausschenkt.
Normalerweise erzählen wir uns alles, wie beste Freundinnen es eben tun. Aber wie hätte ich ihr nur gestehen sollen, dass ich nicht mehr schlafe und kaum noch etwas herunterbringe, weil ich Tag und Nacht an ihn denken muss, obwohl ich doch genau weiß, dass es vollkommen aussichtslos ist, weil er sein Leben für immer Gott geweiht hat?
Welche Sünde begehe ich damit!
Nein, Abertausend Sünden sind es, denn ich bin von Woche zu Woche mehr in ihn verliebt.
Es zu beichten wage ich nicht.
Und wem auch?
Im Beichtstuhl von Pfarrer Greven würde ich kein Wort herausbringen, und selbst in einer anderen Kirche wäre es mir zu gefährlich. So bleibt mir nur dieses Tagebuch, um meine Gedanken zu sammeln und all das niederzuschreiben, was mich bewegt und bedrückt.
Bin ich oberflächlich oder sogar leichtsinnig?
Aus gleichaltrigen Jungs hab ich mir nie viel gemacht, sie erscheinen mir immer so naiv und unreif; vor erwachsenen Männern jedoch habe ich mich bislang gehütet.
»Sieh dich vor, Nellie«, so Mamms warnende Worte. »Wenn du schwanger wirst, dann musst du auch heiraten. Selbst, wenn es der falsche Mann fürs Leben ist …«
Einen falschen Mann fürs Leben habe ich niemals gewollt. Vielleicht denken manche in Ehrenfeld deshalb auch, ich sei arrogant, aber das bin ich nicht. Bloß kritisch und wählerisch, das ja. Vielleicht habe ich die ganze Zeit ja einfach nur auf den Richtigen gewartet.
Wie aber hätte ich in meinen kühnsten Träumen ahnen sollen, dass das ausgerechnet ein Mann Gottes sein würde?
Es ist ja nicht allein sein Aussehen, das mich unwiderstehlich anzieht, nein, auch seine Freundlichkeit, sein Humor, die Klugheit im Reden und im Handeln. Vor allem aber gefällt mir seine Fürsorglichkeit gegenüber den Kindern und Jugendlichen aus der Pfarrei, die gerade jetzt so dringend männlichen Beistand brauchen. Beim Jungvolk werden sie nur noch gedrillt, vorbei mit lustigen Lagerfeuern und Zeltfreizeiten. Am liebsten würde mein Bruder Martin gar nicht mehr hingehen, doch das traut er sich nicht. Wenn er schon bald zur Hitlerjugend muss, wird es sicherlich noch schlimmer.
Männer werden hier mehr und mehr zur Mangelware. Viele aus Köln-Ehrenfeld sind inzwischen Soldaten, ganze Jahrgänge sind schon eingezogen worden. Söhne, Brüder, junge Ehemänner fehlen plötzlich an allen Ecken und Enden, das macht den Familien hier schwer zu schaffen. Unseren Bap können sie zum Glück nicht mehr holen, der liegt schon seit sechs Jahren auf dem Melaten-Friedhof.
Und was bin ich froh, dass Martin erst dreizehn wird und damit noch viel zu jung für die Wehrmacht ist!
Dabei ist unser Küken im letzten Jahr gewaltig in die Höhe geschossen. Er sieht jetzt schmal und staksig aus wie ein Fohlen und ist ständig hungrig, weil unsere Mamm ihn mit den paar Lebensmittelmarken niemals richtig satt bekommt. Und das trotz ihrer kleinen Extrageschäfte, auf die ihr allerdings keiner kommen darf.
Nächste Woche wird Martin gefirmt.
Spätestens dann werde ich Benedikt wiedersehen, der die Firmlinge aus Ehrenfeld an diesem Tag in den Dom begleitet …
Was für ein Tag!
Mamm hat mich in aller Herrgottsfrüh mit dem Fahrrad nach Bickendorf zu Bäcker Lemmle geschickt, dem Einzigen, der gegen heimliche Bierlieferungen Roggenbrötchen rausgibt, die die Arbeiter nach Feierabend in unserer Kneipe, dem Halflang, so gern als Halve Hahn zum Kölsch verzehren. Ich muss warten, bis er den Korb für mich gefüllt hat, da sehe ich sie: das fahrende Volk, das seit drei Jahren in Wohnwagen und Baracken auf dem Schwarz-Weiß-Platz hinter Stacheldraht vegetiert. Hin und wieder haben sie sich zu uns ins Halflang geschlichen, mager und zerlumpt, aber immer freundlich, haben für ein paar Groschen Messer geschärft oder unsere Töpfe geflickt, und Mamm hat sie niemals ohne ein Glas Bier und eine zusätzliche Wegzehrung wieder gehen lassen. Mit dem kleinen Adriano, der anfangs immer mitkam, hat Martin sich sogar ein wenig angefreundet. Die Jungs haben zusammen geschussert, wobei Adriano meistens gewonnen hat, weil er mit den Murmeln einfach geschickter ist.
Jetzt treiben SA-Leute sie wie Vieh zusammen und verfrachten Greise, Männer, Frauen und sogar die Kinder auf Lastwagen. Mit Schlagstöcken, Fußtritten und Gewehrkolben zwingen sie sie aufzusteigen. Viele schreien, bluten und weinen, darunter auch Adriano, der eine Platzwunde an der Stirn hat und so elend aussieht, so voller Angst, dass mir selbst ganz eng ums Herz wird.
»Zeit, dass wir diese Zigeuner endlich loswerden.«
Hat Bäcker Lemmle das gerade wirklich gesagt?
»Was haben sie dir denn getan?«, frage ich zurück.
»Das weiß man nie. Besser, du zählst alles nach, wenn einer von denen im Laden war. Schon ihre kleinsten Bastarde haben das Klauen im Blut, und verschlagen sind sie doch alle miteinander! Die müssen jetzt endlich das Arbeiten lernen. Der Führer räumt gründlich auf, und ich bin heilfroh, dass dieses Pack endlich kriegt, was es verdient!« Seine Augen sind ganz schmal geworden; im Mundwinkel hängt ihm ein Speichelfaden.
Hass macht hässlich, muss ich denken und mag den Bäckermeister mit dem zurückweichenden Haaransatz noch weniger als sonst.
Ich schlage die Rosinenschnecke aus, die er mir unbedingt aufdrängen will. Mit einem süßen Stückchen kann er mich jetzt nicht fangen. Noch beim Zurückfahren ist mir speiübel, und nicht einmal der Duft der frischen Brötchen, den ich sonst immer begierig einatme, kommt dagegen an.
Jetzt gleich nach Hause?
Unmöglich!
Obwohl ich mich für die Arbeit noch umziehen muss. Fräulein Weber, Bürovorsteherin bei 4711, duldet Nachlässigkeit in puncto Kleidung ebenso wenig wie beim Schriftverkehr. Weil ich so gut in Steno bin, habe ich bei ihr einen Stein im Brett, was sich allerdings schnell ändern kann, denn sie ist extrem launisch. Doch der Gedanke, mich sofort in den dunkelblauen Rock und die frisch gebügelte weiße Bluse zu zwängen, ist unerträglich. So halte ich vor St. Joseph an, nehme meinen Korb vom Lenker, damit ihn niemand klauen kann, und gehe für einen Moment hinein.
Im Gotteshaus hängt noch ein Rest Weihrauch von der gestrigen Maiandacht. Ich liebe es, wenn der Rosenkranz gemeinsam gebetet wird und wir die schönen Marienlieder singen, die ich alle auswendig weiß. Doch meistens braucht Mamm mich abends am Tresen, und so muss ich leider oft darauf verzichten.
Langsam gehe ich weiter.
Erst jetzt fällt mir die kniende Gestalt vor dem kleinen Marienaltar auf, der mit einem üppigen Strauß roter Pfingstrosen geschmückt ist. Dass es nur Benedikt sein kann, weiß ich, noch bevor er sich umdreht, obwohl er nicht seinen üblichen schwarzen Anzug mit Collarhemd trägt, sondern eine blaue Hose und ein helles Hemd.
Langsam erhebt er sich.
»Die SA holt sie alle ab.« Die Worte strömen einfach so aus mir heraus. »In Bickendorf. Die ganzen Menschen aus den Wohnwagen und Baracken …«
»Ich weiß«, erwidert er dumpf. »Das mit der Räumung ist schon gestern durchgesickert. Kollege Sion von der Rochuspfarrei hat Kardinal Schulte informiert und ihn um Beistand für diese bedauernswerten Menschen angefleht.«
»Und?«
»Durch das Konkordat seien ihm die Hände gebunden. So lautete die Antwort.« Der Kaplan klingt aufgebracht. »Ich kenne den Kardinal als Dozenten aus dem Priesterseminar und weiß, wie vorsichtig er ist. Zwar hat er gegen die Schließung der Bekenntnisschulen Veto eingelegt, doch in der Regel sinniert seine Eminenz lieber über Katechismuswahrheiten, als sich mit realem menschlichem Leid zu beschäftigen.«
Erste Sonnenstrahlen bringen die blauen Glasfenster in der Apsis zum Leuchten. Plötzlich wirkt sein Kopf wie in Licht gehüllt. Wie ein zorniger himmlischer Bote steht er vor mir, und mein Herz fliegt ihm zu.
»Aber sie sind doch alle katholisch! Das hat Adrianos Vater uns erzählt. Und sie verehren die Gottesmutter Maria«, sage ich leise. »Viele tragen ihren Namen. Nicht nur die Frauen.«
»Ja, das tun sie. Unter ihnen gibt es viele Fromme, aber das wird ihnen leider wenig nützen. Für die Nationalsozialisten sind sie Abschaum, den es zu isolieren gilt.«
Es klingt so schrecklich für mich, dass ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte.
»Was werden sie mit ihnen machen?« Mein Blick hängt an seinen Lippen.
»Es heißt, sie würden desinfiziert und dann vom Bahnhof Deutz aus nach Osten gebracht, wohin genau, konnte mir bisher niemand sagen.«
»Und die Gottesmutter …« Beinahe flehentlich schaue ich zur Marienstatue.
»Sie meinen, warum sie so etwas zulässt?«, erwidert er sanft. »Was glauben Sie, wie oft ich mich das in den letzten Jahren schon gefragt habe! Und dennoch bleibt Maria unsere große Fürsprecherin und Unterstützerin, das dürfen wir auch in den dunkelsten Stunden nicht vergessen. Wollen wir gemeinsam einen Rosenkranz beten?«
Ja!, schreit mein sehnsüchtiges Herz, und ich will schon nicken, doch dann besinne ich mich gerade noch rechtzeitig. Neben ihm auf der schmalen Bank zu knien, seine Wärme zu spüren, ihn zu riechen und dabei zu wissen, dass er mir niemals gehören wird – das wäre mehr, als ich in diesem Moment ertragen könnte.
»Ein anderes Mal vielleicht«, sage ich. »Meine Mamm wartet auf die Brötchen. Außerdem ruft die Arbeit.«
»Mütter soll man niemals warten lassen.« Ein winziges Lächeln umspielt seine Lippen. »Und die Arbeit natürlich ebenso wenig. Sagen Sie bitte Martin, dass ich gern für ihn als Firmpate einspringe, nachdem Frau Hauer so überraschend ins Krankenhaus musste. Ich bin ohnehin bei der feierlichen Zeremonie im Dom dabei – und jetzt auch noch mit meinem eigenen Firmling. Wie schön!«
»Davon hat mein Bruder gar nichts erzählt«, stottere ich.
»Wissen wir ja auch erst seit gestern. Ihre Mutter habe ich sofort informiert, die war auch gleich einverstanden. ›Aber ja kein Geschenk, Hochwürden‹, hat sie mich beschworen. ›Dass Sie dem Jungen als Firmpate aushelfen, ist schon Geschenk genug.‹«
Jetzt sieht er mich so eindringlich an, dass ich kaum noch atmen kann. Ich benehme mich wie ein Backfisch, dabei bin ich doch bereits dreiundzwanzig!
»Aber Hand aufs Herz, Nellie. Ich darf Sie doch Nellie nennen?«
Ich nicke atemlos.
»Eine Firmung so ganz ohne Geschenk, das geht doch nicht. Hätten Sie nicht einen Tipp für mich, worüber Martin sich freuen würde?«
»Über einen Lederfußball«, sagte ich, ohne lange nachdenken zu müssen. »Bei seinem alten ist die Luft nämlich schon raus, so zerfetzt ist der. Und er kickt mit den anderen Jungs für sein Leben gern. Aber natürlich nur, wenn das nicht zu teuer ist.«
»Ein Fußball.« Jetzt grinst er und sieht dabei selbst wieder wie ein Junge aus. »Gute Idee! Ich denke, das müsste auch bei einem armen Kaplan gerade noch drin sein …«
Er lächelt, als ich ihn erschrocken ansehe.
»Kleiner Scherz! Natürlich soll der Junge seinen Ball bekommen. Wir treffen uns dann direkt zur heiligen Messe am Dom.« Er beugt sich zu mir herunter. »Und sorgen Sie bitte dafür, dass seine Fingernägel sauber sind! Das vergisst er nämlich manchmal vor lauter Eile, und unser geschätzter Herr Kardinal kann ein echter Pedant sein.«
Dann ist der Tag der Firmung da, und ich kann kaum glauben, dass mein sehnsüchtiges Warten endlich vorbei ist. Mamm hat vergessen, den Ofen im Badezimmer einzuheizen, so müssen wir uns alle mit kaltem Wasser waschen. Ich will heute besser denn je riechen und helfe nach mit ein paar Spritzern aus meinem 4711-Fläschchen; bei Martin kann ich nur hoffen, dass er sich wenigstens halbwegs gründlich gewaschen hat.
Mamm trägt ihr gutes dunkelblaues Kostüm mit der Spitzenbluse, ich ein hellblaues Kleid mit einem passenden Wolljäckchen und weiße Schuhe. Zum Glück ist es so warm, dass ich auf Strümpfe verzichten kann, denn ich besitze nur noch ein einziges Paar ohne Laufmaschen. Seitdem Krieg herrscht, sind alle Anziehsachen Kostbarkeiten geworden. Was man auf Kleidermarken an Zuteilung erhält, ist der reinste Witz; wer nicht nähen, stopfen und stricken kann, ist aufgeschmissen. Anfangs hatten wir ja gehofft, der ganze Spuk sei bald vorbei und wir bekämen unser normales Leben wieder zurück, doch inzwischen sieht es so aus, als sei noch lange kein Ende in Sicht. Die deutschen Soldaten marschieren, ein Sieg folgt auf den nächsten. Vor ein paar Tagen wurde die Gesamtkapitulation der niederländischen Streitkräfte verkündet. Van Geeren, unseren Chefparfümeur bei 4711, hat das stark getroffen, obwohl er nun schon so viele Jahre in Köln lebt und mit einer Deutschen verheiratet war. Aus dem Volksempfänger dröhnt es, wir sollen froh und dankbar sein, an solch grandiosen Zeiten teilhaben zu können, doch wenn ich mich bei uns in Ehrenfeld so umschaue, sehe ich in den Gesichtern der Frauen vor allem Angst.
Auch unsere Mamm wird immer verzagter. Eine Kölschkneipe mit Lebensmittelmarken zu führen ist ein Wahnsinn. Ich sehe sie oft grübeln und rechnen, rechnen und grübeln. Hätten wir nicht mein bescheidenes Gehalt, das ich bei 4711 bekomme, sähe es noch übler aus. Aber auch so müssen wir auf jeden Pfennig achten; größere Anschaffungen sind kaum noch drin. Martin schießt immer mehr in die Höhe; seine Anzugshosen, die wir erst vor Ostern gekauft haben, enden schon wieder oberhalb der Knöchel.
»Isst du heimlich Hefe, Jung?«, fragt Mamm und zupft dabei an seinen Hosenbeinen, als ob sie damit länger werden könnten. »Wenn das so weitergeht, stößt du noch mit dem Kopp an die Decke!«
Dabei soll er heute doch tipptopp aussehen, wo Benedikt auch noch sein Firmpate ist!
So früh wir auch aus den Federn geschlüpft sind, zum Schluss müssen wir doch rennen, obwohl die Straßenbahn von Ehrenfeld bis zum Bahnhof nur neun Minuten braucht. Trotzdem sind wir beinahe die Letzten, und es ist mir unendlich peinlich, den Kaplan so lange warten zu lassen.
Er schüttelt meiner Mutter die Hand, dann mir; Martin erhält einen kleinen Stups auf die Nase.
»Alles im Lot, Firmling?«, fragt er mit gespielter Strenge, und Martin lächelt ihn verzückt an. Kaplan Weiss ist sein Idol, das ist deutlich zu sehen. Was würde mein kleiner Bruder wohl sagen, wenn er wüsste, dass es mir ebenso geht?
An die Messe selbst kann ich mich seltsamerweise kaum noch erinnern. Viel Orgelspiel, Schwaden von Weihrauch, dass mir fast schwindelig wird, schließlich der Moment, als die Firmlinge an der Seite ihrer Paten zum Altar treten, wo der Kardinal sie schon erwartet und mit ausgebreiteten Armen den Heiligen Geist auf sie herabruft. So schmal und schutzbedürftig sieht Martin neben dem breitschultrigen Kaplan aus, dass ich unwillkürlich daran denken muss, wie mein Bruder zur Welt gekommen ist: zwei ganze Monate zu früh, derart winzig und verschrumpelt, dass er in einen alten Schuhkarton gepasst hat. Damals war ich schon zehn und habe mich ein wenig wie seine zweite Mamm gefühlt. Zumal wohl kaum einer in Ehrenfeld eine Wette darauf abgeschlossen hätte, dass unser Nachzügler sein erstes Lebensjahr erreicht.
Doch unser Frühchen hat es allen gezeigt. Und manchmal haut er jetzt Antworten raus wie ein Großer. Frühreif, sagen die einen, aber das trifft es nicht ganz, denn es hat eher mit seinem Herzen zu tun, und nicht mit dem Körper. Oma Hildegard sagt immer, Martin höre das Gras wachsen, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, was sie damit meint. Aber schlau ist er, das steht fest.
Vielleicht sogar schlauer als wir alle.
Wäre unser Bap nicht an seiner Raucherei gestorben, als der Kleine gerade eingeschult wurde, würde Martin heute vielleicht sogar das Schillergymnasium in Ehrenfeld besuchen, denn er lernt schnell und leicht. So aber ist bei uns das Geld leider immer knapp, und er geht stattdessen nach wie vor in die Volksschule an der Platenstraße. Martin langweilt sich oft im Unterricht, weil er schneller ist als die anderen, das hat er mir anvertraut. Deshalb treibt er sich auch öfters mit älteren Jungs herum, die schon in der Lehre sind oder in einer der umliegenden Fabriken arbeiten, was unsere Mutter gar nicht gern sieht …
Jetzt läuten die Messdiener, und ich bin wieder zurück im Dom. Handauflegung, Salbung, Besiegelung.
Das alles durfte auch ich vor Jahren erleben, heute aber habe ich nur Augen für Benedikt, der als Pate neben meinem Bruder kniet, während der die Firmung empfängt.
Mit leuchtenden Augen kehrt Martin an seiner Seite schließlich zu uns in die Kirchenbank zurück.
»Jetzt bist du erwachsen«, sagt Benedikt bei der Heimfahrt in der Straßenbahn zu ihm. »Als Christ und als Mensch. Also benimm dich auch so, Martin.«
Als er danach mich ansieht, muss ich den Blick sofort senken. Wahrscheinlich bin ich blutrot angelaufen – aber seine Augen sind auch zu schön!
Frau Walter, die Pfarrer Greven und Kaplan Weiss bekocht, serviert uns allen im Pfarrhaus rheinischen Sauerbraten mit Klößen, über die Martin herfällt, als sei er kurz vor dem Verhungern.
»Schling doch nicht gar so, Jung«, sagt Mamm verlegen, während ich das Essen auf meinem Teller hin und her schiebe, denn mein bisschen Hunger ist in Benedikts Nähe erst recht verflogen. »Und Ellenbogen runter vom Tisch, wie oft soll ich dir das noch sagen? Hochwürden muss ja denken, wir aus ’m Biertopp hätten keine Manieren!«
»Schmeckt aber so gut …«, murmelt Martin mit vollem Mund.
»Lassen Sie ihm doch die Freude, Frau Voss«, sagt Benedikt nachsichtig. »Gutes Essen ist jetzt so knapp, und Jungs bleiben eben Jungs – außerdem ist heute sein großer Tag. Lust auf Fußball, Martin? Dann nichts wie ab hinters Haus!«
Der neue Ball ist die Krönung des Tages, viel interessanter als Baps alte Armbanduhr, die Mamm ihm geschenkt hat. Benedikt hat sein Jackett ausgezogen, und auch Martin hat nur noch Unterhemd und Turnhose an. Anzug und Hemd liegen fein säuberlich zusammengefaltet auf der Treppe. Die beiden rennen und schießen und dribbeln, dass es eine wahre Freude ist, ihnen zuzusehen, schwitzen dabei, fallen hin, lachen, stehen wieder auf, und ich ertappe mich bei dem Gedanken, wie Benedikt wohl aussehen mag, wenn er ganz ohne Kleidung unter der Dusche steht …
Sünde. Sünde! Sünde!!!
Ich müsste sie beichten, aber ich weiß ja nicht, wem …
Irgendwann waren sie müde geworden, ruhten sich aus und stillten den Durst mit Frau Walters selbstgemachter Limonade. Nellie hätte ihren Gastgeber zu gern gefragt, wie es mit dem fahrenden Volk weitergegangen war, aber die Antwort darauf konnte ja eigentlich nur schlecht ausfallen, und so ließ sie es für heute bleiben, obwohl sie sich feige dabei vorkam. Ohnehin hätte sie längst zu Hause sein sollen. Ihre Mutter hatte sich vor einer Stunde verabschiedet und bediente im Halflang bereits die ersten Gäste, doch Nellie zögerte den Abschied hinaus.
Und als Benedikt schließlich zur Gitarre griff und das Lied Kein schönerLand in dieser Zeit anstimmte, in das Martin leicht kieksend einfiel, war es vollständig um sie geschehen. Seine Stimme war weich und voll, ein wohlklingender Bariton. Glücklich, dass sie ein paar Jahre im Kirchenchor gesungen hatte, bevor er aufgelöst worden war, wagte sie die zweite Stimme – und sieh an! Es klang richtig gut.
»Sie singen sehr schön, Nellie«, sagte er, und wieder wusste sie vor Verlegenheit kaum noch ein und aus.
»Ich bin leider ziemlich aus der Übung«, erwiderte sie errötend. »Als mein Vater noch lebte, haben wir oft zusammen musiziert. Er konnte Akkordeon, Flöte, ein wenig Geige und eben auch Gitarre spielen. Manchmal glaube ich, er wäre viel lieber Musiker geworden, anstatt in einer Brauerei zu schuften.«
»Ich übe jetzt manchmal auf seiner Klampfe«, sagte Martin. »Die alten Fahrtenlieder mag ich am liebsten. Die klingen so stark und frei. Als ob es keine Grenzen gäbe. Die anderen Jungs …« Er brach ab, als hätte er sich verplappert.
Benedikt betrachtete ihn aufmerksam.
»Man muss heutzutage nicht nur sehr vorsichtig mit dem sein, was man sagt, sondern auch mit dem, was man singt. Erst recht in der Öffentlichkeit. Das predige ich immer meiner kleinen Schwester. Und du weißt das doch hoffentlich auch, Martin?«
Der Junge nickte, wirkte aber alles andere als überzeugt.
»Manches Liedgut ist offiziell sogar verboten, und wer sich nicht daran hält, kann großen Ärger bekommen«, setzte er hinzu, auf einmal wieder ganz Kirchenmann.
»Das wissen die Ehrenfelder Navajos auch. Aber sie scheren sich nicht darum und singen diese Lieder trotzdem!«, stieß Martin hervor.
»Was hast du denn mit den Navajos zu schaffen?« Mit einem Mal klang Benedikt richtig streng.
»Nichts«, erwiderte Martin. »Gar nichts! Ich hab ihnen nur mal aus Versehen zugehört.«
Nellie sagte dieser Name nichts. »Sind das Indianer?«, riet sie auf gut Glück, denn natürlich hatte auch sie einige Karl-May-Bände verschlungen, als sie klein war.
»Sie wollen welche sein«, antwortete Benedikt. »Dabei handelt es sich eher um einen Haufen unreifer Kerle, die sich mit ihren wilden Aktionen in große Schwierigkeiten bringen, und ihre Familien mit dazu. Ich habe sie gewarnt, mehr als einmal, aber sie wollen ja partout nicht hören. Bei der großen Osteraktion des HJ-Streifendienstes hat es einige von ihnen böse erwischt. Und wo sitzen sie jetzt? In der Arbeitsanstalt Brauweiler. Dort zu sein ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Halt dich von ihnen fern, Martin! Dafür bist du noch viel zu jung.«
Benedikt stand abrupt auf, und es war, als hätte sich mit einem Mal ein Schatten über diesen sonnigen Spätnachmittag gelegt.
»Die Pflicht ruft«, erklärte er. »Kommt gut nach Hause, ihr beiden.«
Ein freundlicher Rauswurf, aber definitiv ein Rauswurf, da machte Nellie sich nichts vor. Sie erhob sich ebenfalls. Wann würde sie wohl wieder Gelegenheit haben, Benedikt ungezwungen so nah sein zu können?
Wahrscheinlich nie mehr.
Plötzlich wurde sie wütend auf ihren Bruder. Mit seinem dummen Gerede hatte er alles verdorben.
»Jetzt mach schon!«, fuhr sie ihn an, als er mit dem Anziehen so gar nicht vorankommen wollte. »Mamm wartet bestimmt schon auf uns.«
Seite an Seite gingen sie die Venloer Straße entlang. Martin hatte seinen neuen Ball wie eine Trophäe unter den Arm geklemmt. Vorsichtig linste er zu seiner Schwester hoch. Wenn er sie von schräg unten ansah, so wie jetzt, fiel es Nellie schwer, ihm weiterhin böse zu sein, das wusste er.
»Du magst ihn«, konstatierte er, als sie das Halflang beinahe erreicht hatten. »Deshalb bist du jetzt auch so sauer.«
»Und du redest lauter Blödsinn!«, fuhr Nellie ihn an. »Erst das mit diesen Indianern, und nun auch noch solch dämliche Unterstellungen, über die ich ja nur …«
»Bist du verliebt in Kaplan Weiss?«, unterbrach er sie. »Du bist so anders, wenn er in der Nähe ist.«
Ihr wurde heiß. Konnte sie ihre Gefühle jetzt nicht einmal mehr vor einem Halbwüchsigen verbergen?
»Dazu müsste ich ja ganz schön bescheuert sein, oder?«, gab Nellie zurück.
Martin zog die Schultern hoch. Seine hellbraunen Augen, die sie schon immer an Bernstein erinnert hatten, wurden noch größer.
»Hat man denn eine Wahl?«, fragte er leise. »Ich glaube ja, die Liebe macht einfach, was sie will.«
Woher er das nun schon wieder hatte!
»Hör auf, große Töne zu spucken«, fuhr sie ihn unwirsch an. »Schreib dir lieber hinter die Löffel, was der Kaplan gesagt hat, und halte dich von diesen Navajos fern. Unsere Mamm hat schon genug Sorgen!«
»Du kennst sie ja gar nicht«, sagte Martin leise. »Du hast sie niemals singen gehört. Sonst …«
»Sonst?«, wiederholte Nellie. »Was sonst?«
»Nichts«, murmelte er.
Später, als sie in eines der alten Sommerfähnchen schlüpfte, die man schnell rauswaschen konnte, wenn sie beim Servieren schmutzig wurden, musste sie wieder an Martins Worte denken. Natürlich konnte sie als Frau niemals ein echter Köbes werden, da half auch die alte blaue Strickjacke ihres Vaters mit den schwarzen Knöpfen und die lederne Geldtasche vor dem Bauch nichts, die sie manchmal anlegte. Aber sie war mit dem Kranz, dem typischen Tablett am Stiel, das die Gäste mit Stangen frisch gezapften Kölschs versorgte, mindestens so schnell wie jeder Kerl. Inzwischen tat es ihr leid, dass sie ihren kleinen Bruder angefahren hatte, nur weil sie sich ertappt gefühlt hatte, und Nellie beschloss, es bei nächster Gelegenheit wiedergutzumachen.
»Ei, die schöne Nellie!«, ertönte es, als sie flink durch die kleine Gaststätte wieselte, um die durstigen Kehlen zu befriedigen. »Welch Glanz in dieser Hütte!«
»Geb dir gleich Glanz«, konterte sie und versetzte der Schirmmütze des lautesten Schreiers einen kleinen Stoß. »Wenns’t d’r Schnabel ze fän aufreißt, Tünnes, könnt’s enne dren öntlich nass wes!«, sagte sie.
Die anderen Männer am Stehtisch lachten.
Abgesehen von einigen Rentnern, waren die meisten Gäste Handwerker und Metallarbeiter in mittleren Jahren aus den Werken Pellenz, Vulkan oder der Fahrradfabrik Goldberg, die sich hier zu einem Feierabendkölsch trafen, während ihre jüngeren Brüder, ihre Söhne und Enkel gegen die Polen, die Niederländer, und wie es aussah, nun auch bald gegen die Franzosen kämpfen mussten. Polen zumindest lag von Köln weit entfernt. Bis auf die Familien, die von dort stammten und bereits Ende des letzten Jahrhunderts nach Westen gekommen waren, sodass man sie inzwischen nur noch an ihren Nachnamen als einstmals »fremd« identifizieren konnte, kannte eigentlich niemand jemanden dort. Ganz anders aber verhielt es sich mit den Holländern, Belgiern und Franzosen, von denen sie nur der Rhein trennte. Diese Grenze war immer »weich« gewesen; der Handel mit den Nachbarländern bestand seit Menschengedenken und hatte stets zum beiderseitigen Vorteil floriert. Viele hatten nach drüben, andere wieder herüber geheiratet.
Das sollten nun auf einmal Feinde sein?
Den meisten hier fiel es schwer, sich das vorzustellen. Schon im Großen Krieg, der mit unzähligen Toten auf beiden Seiten und unsagbarem Leid in vielen Familien geendet hatte, hatten sie ihre Probleme damit gehabt.
»Vielleicht geht es ja dieses Mal ganz schnell«, meinte der alte Laurin, der seit der Schlacht bei Verdun das linke Bein nachzog und Nellie immer besonders wohlwollend hinterhersah. Sie wusste, dass sie ihn an seine verstorbene Emma erinnerte, die nun schon seit Jahren auf dem Melaten-Friedhof lag. »Und unsere Jungs sind wieder daheim, wenn die Blätter fallen.«
»Dat glaubste wal selvs net!« Tünnes wiegte nachdenklich den grauen Kopf. »Der hüre eesch op, wann se all erobert han!«
»Wollt ihr wohl den Schnabel halten, ihr alten Saufköpfe!« Zornblitzend stand Nellies Mutter vor ihren Gästen. »In meinem Lokal wird nicht politisiert. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Noch ein Wort, und ihr fliegt alle zusammen hochkant raus! Habt ihr das jetzt endlich kapiert?«
»War ja nicht so gemeint, Ilka«, murmelte Laurin. »Man wird ja wohl noch denken dürfen. Das kannst du uns nicht verbieten!«
»Denk, wo du willst, aber nicht im Halflang, und schon gar nicht laut«, sagte sie, bevor sie sich wieder hinter den Tresen verzog. »Und du kommst gleich mit, Mädchen. Gläser spülen!«
»Sie haben einfach keinen Respekt vor einer Frau«, sagte sie seufzend zu ihrer Tochter, nachdem sie zugesperrt hatten und nun gemeinsam mit aufgekrempelten Ärmeln die Holztische schrubbten. Sauberkeit war das oberste Gebot der umsichtigen Gastwirtin, da verstand Mamm keinen Spaß, und nichts anderes hatte sie auch ihren Kindern eingetrichtert. »Als euer Vater noch am Leben war, hätte keiner gewagt, mir so zu kommen.«
»Laurin ist noch der Harmloseste«, sagte Nellie. »Und außerdem nimmt ihn ohnehin niemand ernst.«
»Aber dich anglotzen, als wärst du splitternackt, das kann er sehr gut«, erwiderte ihre Mutter heftig. »Manchmal kommst du mir vor wie eine duftende Blumenwiese, die alles Männliche unwiderstehlich anzieht – und beileibe nicht nur die besten Exemplare! Ich würde mich sicherer fühlen, dich endlich in festen Händen zu wissen. Unser Martin, der schwerer zu hüten ist als ein Sack Flöhe, reicht mir schon zum Aufpassen!«
»Die Auswahl ist zurzeit nicht gerade berauschend, das musst du zugeben.« Jetzt kam es auf jedes Wort an, das wusste Nellie. Ihre Mutter besaß ein untrügliches Gespür für Ausreden und Lügen. Mühsam verbannte sie jeglichen Gedanken an Benedikt aus ihrem Kopf, und zu ihrem eigenen Erstaunen funktionierte es sogar. »Die meisten jungen Männer sind bei der Wehrmacht, und auf einen, der vom Alter her fast mein Vater sein könnte, kann ich wirklich verzichten.«
»Weil keiner es dir recht machen kann. So war es doch auch schon vor dem Krieg! Worauf wartest du eigentlich? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung, der auf seinem stolzen Ross durch die Körnerstraße galoppiert kommt? Da war deine Freundin Greta schon schlauer. Die hat sich mit ihrem Viktor Lohse einen angesehenen Hotelier an Land gezogen. Einen Mann, der gute zehn Jahre älter ist und seiner Frau etwas zu bieten hat. Dabei ist sie nicht einmal halb so hübsch wie du.«
»Greta ist aber auch eine Farina«, entgegnete Nellie und ließ die Bürste sinken. »Und welcher Kölner möchte nicht in diese angesehene Familie einheiraten? Auch wenn der Krieg die Geschäfte gerade stark behindert, irgendwann wird ja wieder Frieden sein – und dann sehnen sich die Leute wieder nach guten Düften.«
»Ohne Parfüm kann man leben. Was die Leute aber immer brauchen, ist Brot.« Ilka vermied es, ihre Tochter anzusehen. »Und zwar alle Leute. So ein Bäcker hat es da gut. Sitzt sozusagen an der Quelle und kann jederzeit …«
»Mamm!«, fiel Nellie ihr ins Wort. »Du versuchst nicht gerade, mir diesen widerlichen Lemmle schönzureden, oder?«
»Ich weiß beim besten Willen nicht, was an Willy Lemmle widerlich sein sollte! Ein ehrbarer Witwer mit zwei Kindern, die klein genug sind, um sich an eine neue Mutter zu gewöhnen. Außerdem hat er …«