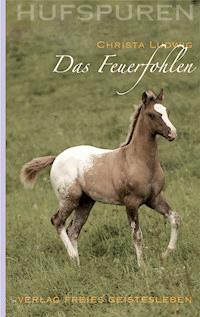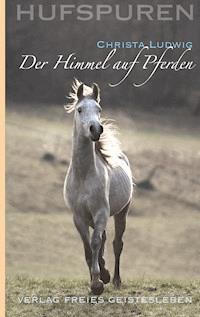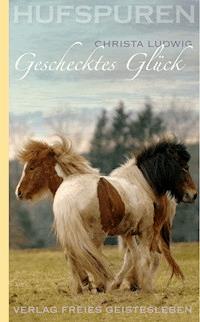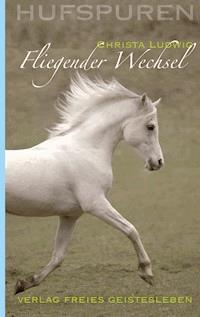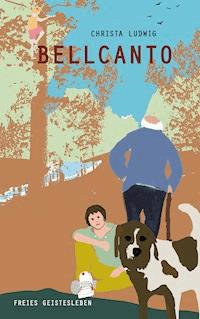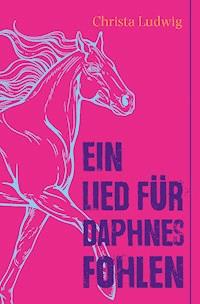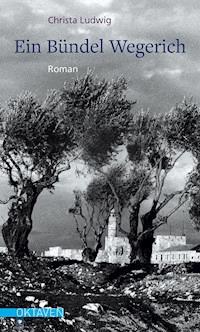Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Johannes spricht etwas fremdartig und rau, wie jemand der erkältet ist. Ohne deutliches Gespür für hoch und tief, laut und leise, Frage oder Antwort. Mit Händen reden kann er viel besser. Und wen er sprechen sieht, den versteht er auch. In der lautlosen Welt kennt er sich aus. Und dann kommt dieser Sommer. Im Nachbarhaus zieht Maria ein. Maria, die Töne liebt. Die ihm ihre Musik zeigen, die mit ihm tanzen will …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christa Ludwig
Blitz ohne Donner
Inhalt
Viereinhalb Wochen vor den Sommerferien
Blattlauszeiten
Sonntag
Singen
Tanzen und Springen
Die Lösung
Schallwellen
Kleine Nägel
Schlangenbeschwörer
Muttersprache
Geschrei
Tanja
Irrtum
Johann Christian
Was ist denn eine Telefonzelle?–Nachwort zur Neuausgabe
Viereinhalb Wochen vor den Sommerferien
Johannes war ein Sonntagskind. Er wurde an einem Sonntag geboren, an einem Morgen im September, und er lebte ein herrliches Sonntagskindleben, fast fünfzehn Jahre lang, bis zu jenem Nachmittag im Juli, als die Sonne in das Südfenster seines Zimmers schien und mit den Spiegeln an allen Wänden spielte. Nur, Johannes war nicht in seinem Zimmer, er stand im Nachbarhaus neben der Terrassentür, schaute nahezu geblendet in das Licht derselben Sonne, unter der er so lange glücklich gewesen war und die nun auf den geschwungenen Bogen einer Harfe schien. Die Saiten boten dem Licht kein Hindernis, auf den Teppich fiel kaum ein Schatten, aber Johannes starrte durch die zarten Drähte wie durch die Gitterstäbe eines Gefängnisfensters. Er war hier eingesperrt, hier war seine Grenze, an dieser Stelle war sein Sonntagskindleben zu Ende.
Dass er überhaupt so lange hatte glücklich sein können, verdankte er seinen – nahezu – tadellosen Eltern. Sophia und Stefan waren nett, immer da, wenn man sie brauchte, einsichtig, großzügig und reich. Nichts war an ihnen auszusetzen außer der Tatsache, dass sie ihn Johannes genannt hatten.
Jedes Mal, wenn er sich vorstellte –
«Wie heißt du?»
«Johannes.»
«Und weiter?»
«Beer.»
– war er versucht, zu buchstabieren B-ä-r. Aber so hieß er nicht. Er hieß Beer. B-e-e-r. Johannes Beer.
Nach einer kurzen Pause kam Gelächter. Er sah Spott in den Augen, gebleckte Zähne im Ring der Lippen, sinnlos geöffnete Münder, die keine Worte formten: Gelächter.
Früher war er dabei wohl auch rot geworden, johannisbeer-rot, jetzt passierte ihm das nicht mehr. Man gewöhnt sich an alles oder kann zumindest so tun, als hätte man sich daran gewöhnt. Und je näher die Sommerferien kamen, desto leichter wurde es. Noch viereinhalb Wochen und dann ab nach Spanien, wo niemand, wenn er seinen Namen nannte, an Marmelade dachte.
Es war am frühen Nachmittag in der Physikstunde. Er dachte an Spanien und an Mercedes.
Man lacht nicht über Leute mit komischen Namen! Das war für Johannes ein Gesetz, und als Mercedes ihm vor vier Jahren vorgestellt wurde, hatte er sich das Grinsen verbissen. Dann lernte er, das ‹c› in jenem Mercedes zu zischen wie ein gelispeltes ‹s›. Aber erst viel später wurde Mercedes ein Zauberwort. Seit mehr als einem Jahr hatte er dabei nicht mehr an Autos gedacht.
Auf seinem Tisch lag noch sein Biologieheft von der letzten Schulstunde. Darin sagte der Längsschnitt eines menschlichen Kopfes: aaaaaaaaaaaaaa. In den bei der ‹a›-Stellung breiten Raum zwischen Zunge und Gaumensegel malte Johannes Mercedessterne, wobei er nicht an Autos dachte.
Mercedes war die Tochter der Familie, die das Haus der Beers an der Costa del Sol betreute und, wenn nicht gerade Ferien waren, auch ganz bewohnte. Wenn die Beers anreisten, zogen sich die Spanier in einen kleinen Teil des Hauses zurück und betraten die anderen Räume nur noch, um dort zu kochen, zu räumen, zu putzen. Aber wie sie das taten! Gracias! – war das Wort, an dem Johannes das spanische Lispeln lernte, weil er das Gefühl hatte, sich ständig bedanken zu müssen, nicht nur dafür, dass Mercedes’ Mutter kochte und seinen Dreck wegräumte, vor allem dafür, dass er überhaupt in diesem Haus wohnen durfte. Es gehörte nämlich offensichtlich den Spaniern. Niemals in seinem Leben sah Johannes eine dermaßen herablassende Geste wie jene, mit der Mercedes eine Türklinke herunterdrückte in ihrem Haus, gelassen durch die Tür ging und ihm mit gnädigem Kopfnicken bedeutete, er dürfe folgen.
Mercedes in Málaga hatte eine seltsame Eigenschaft: Sie wurde mit jedem Sommer schöner. Es hatte ganz harmlos angefangen. Als er elf war und sie fünfzehn, musste sie schon ziemlich hübsch gewesen sein, er erinnerte sich nicht daran. Im folgenden Jahr fiel ihm auf, was für ungeheuerliche Haare sie hatte – und Augen! –, und dann, als er fast vierzehn war und sie siebzehn, hatte er einen geradezu explosionsartigen Anstieg ihrer Schönheit festgestellt. Wenn das so weiterging mit ihr, mussten da unten in Spanien unaufhörlich Funken sprühen. Sicher war es so. Johannes hatte immer das Gefühl, dass Funken sprühten, wenn er nur an Mercedes dachte, und er dachte kaum noch an etwas anderes.
Fast hatte er Angst, ihr im Sommer wieder zu begegnen. Andererseits war es unerträglich, noch viereinhalb Wochen warten zu müssen.
Darum malte er Mercedessterne in alle seine Schulhefte und übte, klar und deutlich zu sprechen: «Merßedes, Merßedes, Merßedes …», während der Physiklehrer ihnen den Rücken zuwandte, Hebelwirkungen an die Tafel zeichnete und nichts merkte. Aber Christian, der zwei Plätze weiter rechts saß, entdeckte mit seinen Adleraugen die Mercedessterne. Ausgerechnet Christian. Der war das kleine, lästige Ärgernis in seiner Klasse. Dauernd quirlte er um Johannes herum und zog ihn wegen seines Namens auf. Die anderen hatten das längst aufgegeben. Natürlich hatte Christian keine Ahnung, was die Mercedessterne in den Heften bedeuteten. Er warf einen roten Filzstift hinüber auf Johannes’ Tisch, strich damit zwei Sterne durch, und peinlicherweise sagte Johannes: «Bleib weg von Merßedes», sagte es spanisch, und Christian entdeckte die Zunge an den Zähnen.
«Eine lißßßßpelnde Johannisbeere!» Er warf die Arme in die Luft, dass alle hinschauten. «Der kann immer noch kein ‹s›. Der ist unreif. Darum wird er auch nie rot, wenn man ihn ärgert. Johannisbeeren werden rot, wenn sie reif sind.»
Seit Jahren wartete Christian darauf, dass Johannes einmal rot wurde, rot wie eine reife Johannisbeere, aber der tat ihm den Gefallen nicht.
Da drehte sich der Physiklehrer um, sah die Unruhe, zwang mit einer Handbewegung Christians Blick wieder zur Tafel, und Johannes ließ das Biologieheft unter der Bank verschwinden.
Er näherte sich dem Physikunterricht, indem er versuchte, eine Kurve zu berechnen und zu zeichnen. Er wollte die explosive Entwicklung von Mercedes’ Schönheit durch eine trigonometrische Funktion darstellen. So etwas hatte sein Vater ihm beigebracht – die trigonometrischen Funktionen natürlich, nicht eine mathematische Darstellung von Mercedes. Johannes aber hatte nicht viel davon kapiert, der Versuch misslang, in seiner Gleichung sprühten keine Funken. Sie war also falsch.
Er versuchte es mit einer einfachen Gleichung. Dabei jedoch kam nichts als eine Gerade heraus, das ging noch weniger, denn um Mercedes abzubilden waren unbedingt Kurven nötig.
Johannes strich die Kurve, in der keine Funken sprühten, durch und überlegte, ob er seinen Bruder fragen sollte. Thomas war zwar fast zwei Jahre jünger als er, aber ein Mathematikgenie wie der Vater. Der war Professor für Mathematik, und so etwas würde Thomas wahrscheinlich auch werden. Stefan und Thomas konnten einfach alles berechnen. Doch es hatte keinen Sinn, Thomas zu fragen. Der hatte zwar von den trigonometrischen Funktionen alles kapiert, von Mercedes dagegen nichts.
Neben dem Lehrerpult blinkte die Lampe, und damit war wieder ein Schultag zu Ende – ein Tag weniger bis zu den Sommerferien.
Auf dem Heimweg überlegte Johannes, warum Thomas von Mercedes’ Veränderung nichts sah. Das musste an seiner Kurzsichtigkeit liegen. Wahrscheinlich konnten Brillen doch nicht die vollständige Sehkraft ersetzen.
Johannes’ Sehkraft war allerdings an diesem Nachmittag auch getrübt, obwohl er wirklich Augen hatte wie ein Indianerhäuptling. Unkraut sollte er jäten in den Blumenrabatten hinter dem Haus, und schon als er die Steintreppe zum Garten hinunterging, wäre er beinahe gefallen. Er sah eine Stufe zu wenig, machte einen Schritt geradeaus und trat ins Leere. Dann stolperte er über die Steine, mit denen die Blumenbeete eingefasst waren, fing sich wieder und begann mit seinem Arbeitsauftrag. Als er aber nach ein paar Minuten anschaute, was er geschafft hatte, da hatte er genauso viel Kapuzinerkresse ausgerupft wie Löwenzahn und Ackersenf.
So ging das nicht. Er setzte sich auf einen Stein – viereinhalb Wochen bis zu den Sommerferien, dachte er –, malte einen Mercedesstern auf den Sandweg, wollte ihn wieder auslöschen, aber das erledigte der Hund für ihn, der plötzlich – ein schwarz-weiß gezackter Blitz – über Rasen und Sandweg ins Blumenbeet sauste. Damit war dieser Teil der Rabatte hinreichend vorbereitet für eine Neubepflanzung.
Noch viereinhalb Wochen warten und dann drei Wochen Spanien, nur drei Wochen, weil in diesem Jahr niemand außer Johannes länger bleiben wollte oder konnte. Sein älterer Bruder Andreas kam gar nicht mit, Stefan musste zu einem Kongress nach Berlin, Thomas wollte zum Trainingslager seines Ruderclubs. Also musste Sophia ihn zurückbringen, und Johannes konnte schließlich nicht allein in Spanien bleiben. Spanisch sprach er noch weniger als Deutsch.
Er beschloss, das Gärtnern zunächst aufzugeben – mit Hilfe des Hundes waren ohnehin nur Rodungsarbeiten möglich – und Stöckchen zu werfen, damit wenigstens Bailando diesen milden Frühsommertag genießen konnte.
Bailando war ein Springerspaniel, und er machte dem Namen dieser Rasse Ehre, denn am liebsten sprang er – schwarz-weiß gefleckt und mit wehenden Schlappohren – den Katzen, den Raben, den Rehen nach, und wenn nichts anderes da war, auch einem Stock.
Johannes brauchte also einen Stock.
Er fand ein akzeptables Stück Holz im Gemüsebeet, den Zettel daran – ROSENKOHL – riss er ab. Er wog das Holz in der Hand und orientierte sich, wo er war. Vor zwei Wochen nämlich hatte er bei diesem Spiel eine der Bleiglasscheiben eingeworfen. Die waren zwar klein, aber teuer. Die Beers bewohnten ein altes Haus, eines von denen, die schöner werden, wenn sie altern. Es hatte viele Erker mit spitzen Hauben, kleinen Türmchen mit glasierten Ziegeln, geschnitzte Holzverkleidungen an den Balkonen, eine steinerne Freitreppe und eben diese mit Blei eingefassten Fensterscheiben, von denen Johannes nicht noch mehr einwerfen durfte. Es war das zweitschönste Haus in der Straße, nur das Nachbarhaus gefiel ihm noch besser, denn es stand seit einem halben Jahr leer, und das Einzige, was diese Häuser und Gärten noch anziehender machte als das langsame Altern, war ein bisschen Verwilderung. Aus Nachbars Rasen war eine Sommerwiese geworden, Moose und Flechten zierten das alte Mauerwerk.
Das würde nun wieder anders werden. Auf der Straße stand ein Möbelwagen. Neue Leute zogen ein. Hoffentlich waren die den Verlust der Sommerwiese wert.
Johannes schaute hinüber zum Nachbarhaus, sah nur das Obergeschoss, so hoch war die Lebensbaumhecke zwischen den beiden Grundstücken, und er warf das Holz. Zu weit. Immerhin nicht in Richtung Bleiglasscheibe. Es flog über die Hecke, Bailando sauste hinterher, schlüpfte durch das Gebüsch und war weg.
Johannes wartete –
Johannes rief –
Johannes wartete –
Er war sicher, dass er den Hund gerufen hatte. Er rief noch einmal und beobachtete genau die Muskeln um seinen Brustkorb. So wie er die zusammenpresste, musste er laut geschrien haben.
Er wartete.
Das war ungewöhnlich. Bailando apportierte zuverlässig. Es sei denn, er hatte einen Menschen getroffen. Er schloss begeistert neue Bekanntschaften. Johannes seufzte. Langsam ging er auf die Thujahecke zu und bog vorsichtig die Zweige auseinander. Erst mal gucken, auf welche Weise er nun die Nachbarn kennenlernen würde. Nicht alle neuen Bekanntschaften teilten Bailandos Leidenschaft für stürmische Begrüßung.
Und wirklich – es war gut, dass er sich zunächst im Hintergrund hielt. Was er sah, brachte ihn völlig aus der Fassung.
Da war ein Mädchen. Sie hatte offenbar keine Angst vor Hunden, denn sie hielt das Stück Holz, und Bailando sprang an ihr hoch. Was aber Johannes verblüffte, erschreckte, begeisterte, entsetzte, war – da stand mitten auf dem Nachbargrundstück in einer Sommerwiese zwischen Margeriten, Löwenzahn und Hornklee, umtobt von seinem Hund, an einem Frühsommertag viereinhalb Wochen vor den Sommerferien ein Mädchen und sah aus wie Mercedes.
Johannes duckte sich entgeistert im Lebensbaum und starrte auf seine neue Nachbarin. Nein, ganz so schön wie Mercedes war sie nicht. Sie war vielleicht vierzehn, und vor vier Jahren war Mercedes auch noch nicht so schön gewesen.
Sollte die da jetzt einziehen und mit einer langsam einsetzenden, sich allmählich steigernden, dann sprunghaft emporschnellenden Vermehrung ihrer Schönheit beginnen, dass es Tag und Nacht sprühte und funkte?
Das würde er nicht aushalten.
Das Mädchen fühlte sich beobachtet, blickte auf, schaute ihn an. Auch Bailando entdeckte ihn, raste auf ihn zu und wieder zu ihr zurück. Johannes konnte nicht mehr ausweichen. Er quetschte sich durch die Hecke.
«Hallo», sagte sie.
Er nickte.
«Dein Hund?», fragte sie.
Er nickte.
«Toller Hund.»
Er nickte.
Warum redet die so wenig, dachte er. Nur halbe Sätze ohne ‹s›-Laute. So krieg ich nicht raus, ob sie nun aus Spanien kommt. An dem ‹s› merkt man das meist. Das werden die Spanier nicht los, auch wenn sie deutsch sprechen.
Da bückte sie sich auch noch und streichelte den Hund.
Es war seltsam, auf diese dichten schwarzen Haare hinabzuschauen. Zu Mercedes musste er immer aufblicken, obwohl er seit Ostern größer war als sie.
«Ziehst du hier ein?», fragte er.
Das winzige Nicken ihres Kopfes musste wohl ‹ja› bedeuten.
Sie streichelte noch immer den Hund, schaute dann auf, eine Frage im Blick, eine wartende Ungeduld.
«Ich wohn da drüben», sagte er.
«Auch gut. Dein Hund gefällt mir. Wirklich, toller Hund.»
Das sagte sie nun schon zum zweiten Mal. Außerdem wusste Johannes das selber. Sehr informativ war dieses Gespräch bisher nicht und leider immer noch s-frei.
Sie hat viel kürzere Haare als Mercedes, stellte er fest, aber es ist die gleiche Sorte schwarze Haare. So etwas gibt es hier nicht. Ob sie auch solche Augen hat?
Er bückte sich und streichelte den Hund nun auch. Mit einem heftigen Ruck warf sie den Kopf hoch – ja, sie hatte auch solche Augen – und blickte zum Haus. Wahrscheinlich hatte jemand nach ihr gerufen. Schade, jetzt würde sie weggehen. Aber sie blieb und kraulte den Hund an der Kehle.
Ein Spaniel ist ein mittelgroßer Hund. Er ist gerade groß genug, dass zwei Menschen mit insgesamt vier Händen ihn gleichzeitig streicheln können, ohne einander zu berühren. Aber man musste schon aufpassen. Wenn Johannes sich vor zwei Jahren für die Deutsche Dogge entschieden hätte, die Thomas so gern wollte, hätte er es jetzt leichter gehabt.
Das Mädchen sagte: «Ich will auch einen Hund.»
«Deu … Deutsche Dogge ist gut», stotterte er und dachte: Blödsinn, Doggen sind bescheuert.
«Nein», sagte sie, «Doggen finde ich doof.»
Es blieb eine Unterhaltung ohne ‹s›, aber Johannes witterte seine Chance.
«Setter», schlug er vor, «Setter?»
Gespannt schaute er auf ihren Mund. Jetzt, jetzt musste er kommen, der leichte Schlag der Zunge auf die Zähne.
«Nein, ich will einen Pudel oder einen Collie oder einen Dalmatiner. Aber ich kriege keinen Hund. Nie!»
Dass es so viele Hunde gibt ohne eine Spur von ‹s›. So kam er nicht weiter. Er musste fragen, ganz plump, ganz direkt.
«Kommst du aus Spanien?»
«Nein. Wieso?»
«Du siehst so aus.»
«Meine Mutter ist Italienerin. Und du?»
«Ich, was?»
«Wo kommst du her?»
Er kannte diese Frage. Deutsch war für ihn eine Fremdsprache, und natürlich wunderte sie sich über seine Aussprache. Vielleicht sollte er leiser sprechen. Wenn er aufgeregt war, wurde er immer zu laut.
«Von da», sagte er und zeigte hinüber zu seinem Haus.
Warum scheute er sich, ihr die Wahrheit zu sagen? Das war ihm noch nie passiert.
«Bist du erkältet?», fragte sie.
Gut – das war auch eine Möglichkeit, das fragten Fremde ihn oft. Er sprach immer so, als sei er schwer erkältet. Er hätte jetzt sagen müssen: Nein, ich …, aber er nickte.
«Und wie heißt du?», fragte sie.
Natürlich! Das war die andere lästige Frage, die unerbittlich wie ein Naturgesetz jedes Kennenlernen zu einem Sketch machte. Diesmal konnte er nicht ausweichen.
«Johannes.»
Kaum gab er sich Mühe, deutlich zu sprechen, aber sie hatte ihn verstanden, und nach der üblichen kurzen Pause lachte sie. Genau wie alle anderen. Sie hatte also ihr Namensschild gesehen. Es hing klein, aber gut sichtbar neben dem Briefkasten am Gartentor. Nur Mercedes hatte nicht über seinen Namen gelacht. Sie konnte kein Wort Deutsch.
Das Mädchen lachte immer noch. Wieder wandte sie mit plötzlichem Ruck den Kopf zum Haus, hörte aber nicht auf zu lachen.
«Das ist nicht komisch!», sagte er.
«Doch!»
Sie strahlte ihn an, grinste und kicherte.
«Du hast nichts kapiert. Gar nichts. Kannst du auch nicht, du weißt ja noch nicht, wie wir …»
So hatten die anderen nicht gelacht, so nicht. Die freute sich. Ja, es war ganz klar, die freute sich.
«Wir heißen Käfer!»
Er zuckte die Achseln.
«Kapierst du das nicht? Jetzt musst du doch kapieren!»
Sie grinste ihn an, schaute ihm gerade ins Gesicht, dann zuckten ihre Lippen, das Grinsen wurde breiter, kaum merklich drehte sie den Kopf, nur die Augen wandten sich deutlich dem Haus zu, fordernd, auffordernd, er sollte endlich verstehen, begreifen. Aber Johannes starrte auf ihren Mund.
«Mein Vater ruft mich», sagte sie.
Er nickte.
«Mich ruft er. Mich!»
Er nickte.
«Er hat meinen Namen gerufen! Hörst du?»
Beinah hätte er wieder genickt. Das wäre nun wirklich eine glatte Lüge gewesen.
«Warum kapierst du das nicht?», fragte sie. «Kannst du nicht zwei und zwei zusammenzählen?»
Doch das konnte er, wenn er auch wenig von der mathematischen Begabung seines Vaters geerbt hatte. Nur, die Aufgabe, die sie ihm da stellte, war für ihn eine Gleichung mit mehr als einer Unbekannten.
Und dann geschah zum ersten Mal, was von da an für ihn zu einer heimlichen, von niemandem bemerkten Quelle eines wundervollen Wissens werden sollte: lautlos, absichtslos und unbewusst formten ihre Lippen ein Wort:
– Maria –
Johannes hatte seine Unbekannte und konnte die Gleichung lösen.
Da hockten sie im hohen Gras, streichelten den Hund und grinsten sich an:
Johannes Beer und Maria Käfer.
«Mögen …», sagte er, und er fühlte, dass seine Stimme noch seltsamer klang als sonst, «mögen Marienkäfer Johannisbeeren?»
«Wenn sie Läuse haben, ja. Marienkäfer leben von Blattläusen.»
Sie sprang auf und lief ins Haus.
«Ich bin verlaust!», schrie Johannes, so laut er konnte. «Total verlaust!»
Wie gut, dass Christian nicht da war, denn er merkte, dass er rot wurde, so richtig knallig rot wie reife Johannisbeeren. So werden sie meist erst im Juli, nicht viereinhalb Wochen vor den Sommerferien. Inmitten einer Frühsommerwiese stand er und fühlte sich wie Anfang August. Er spürte schon alles Gute des hohen Sommers in sich: die Sonnenwärme, die Beerenreife, die Blattläuse.
Blattlauszeiten
Blattlauszeiten?»
Johannes hatte beschlossen, dass nun «Blattlauszeiten» für Johannisbeeren zu beginnen hatten, die er nicht mit Gift und Chemie bekämpfen würde, sondern auf natürliche Weise durch massiven Einsatz von Marienkäfern. Und er wollte Maria fragen, ob sie damit einverstanden war. Sehr vorsichtig und gar nicht aufdringlich wollte er sie fragen: «Blattlauszeiten?»
Aber Johannes war taub. Nicht schwerhörig. Taub. Bis jetzt hatte er für seine Bedürfnisse gut genug sprechen können. Sehr plötzlich, von einem Tag auf den anderen, brauchte er nun Feinheiten des Sprechens, die er bislang nie vermisst hatte.
Er ging auf eine Schule für Schwerhörige und Gehörlose, und er fragte, ob er in der Mittagspause eine Einzelstunde haben könne. Fragen wolle er üben.
So saß er mit dem Lehrer vor dem Visible Speech Trainer. Auf einem Bildschirm konnte er sehen, was er gesagt hatte.
«Blattlauszeiten?», und er schaute auf die zittrige Kurve, die seine Stimme auf den Monitor warf.
Wenn die Kurve nach oben ging, schwebend hochgeworfen endete, dann war ihm die Frage gelungen.
«Warum willst du sagen: Blattlauszeiten?», fragte der Lehrer.
Johannes zuckte die Achseln.
Der Lehrer fragte nicht weiter. Er half ihm. Sie übten, bis die zittrige Kurve Johannes bewies: Er hatte eine Frage gestellt. Er hatte es geschafft, die Stimme so zu heben, dass er eine Frage stellte. Ohne ein Fragewort.
«Sehr gut, Johannes! Sehr sehr gut!»
Das musste er sich nun irgendwie merken.
«Blattlauszeiten?»
Er behielt die Linie vor Augen, lief rasch nach Hause, verschlang ungewohnt hastig ein Stück Kuchen, pfiff den Hund herbei, und zusammen rannten sie in den Garten.
Johannes warf wieder Stöckchen für den Hund. RADIESCHEN stand diesmal auf dem Zettel, der flatternd im Gemüsebeet zurückblieb, und Johannes warf überhaupt nicht in die Bleiglasscheiben, sondern über den Lebensbaum ins Nachbargrundstück. Und jedes Mal schrie er laut: «Bailando, bring!»
Dreimal brachte Bailando das Stöckchen, dann kam er nicht zurück.
Drüben stand Maria. Sie war schon dem ersten Ruf: «Bailando, bring!» gefolgt und aus dem Haus gegangen, die Treppe hinunter, aber langsam, lauschend. Es war etwas seltsam an dieser Stimme, schwerer erkältet als alle Erkälteten, die sie jemals gehört hatte, fremder als alle Fremdsprachigen, die sie bisher hatte deutsch reden hören, und das waren viele. Sie zögerte. Dann entdeckte sie der Hund und brachte das Stöckchen zu ihr. Sie warf es Richtung Lebensbaumhecke, aber sie konnte nicht so weit werfen, und es flog nicht hinüber.
Sie rief: «Bailando, bring!»
Und schrie: «Bailando, bring!»
Aber nichts geschah, nur der Hund stand mitten in den Thujabüschen und wusste nicht wohin. Schließlich ging sie zu ihm, hob das Stück Holz auf, bog die Büsche auseinander, Johannes erschrak und flüsterte rasch: «Blattlauszeiten? Blattlauszeiten?», denn endlich apportierte Bailando, wozu er in Wahrheit ausgeschickt war.
Johannes, als Maria endlich vor ihm stand, machte eine zunächst ganz selbstverständliche, weil keineswegs neue Feststellung: Es fiel ihm auf, wie sehr eine gewisse Mercedes, die er aus Südspanien kannte, Maria ähnlich sah. Ja, früher, als er noch die Tage bis zu den Sommerferien zählte, da kannte er so eine eingebildete Spanierin, und die sah so ähnlich aus wie Maria.
Er sagte zunächst einmal «Hallo», und sie sagte auch «Hallo», aber dann kam er gleich zur Sache.
«Blattlauszeiten?», fragte er und dachte angestrengt an die nach oben schwingende Kurve auf dem Monitor.
Leider merkte er bei ihrer Antwort nicht, ob ihm die Frage gelungen war, ob sie ihn verstanden hatte, ja nicht einmal, was sie sagte. Denn sie wiederholte seine Worte:
«Blattlauszeiten.»
Und Johannes musste raten. Hatte sie nun bestätigt:
«Blattlauszeiten.»
oder hatte sie gar jubelnd gerufen:
«Blattlauszeiten!!!»
oder hatte sie zögernd seine Frage aufgenommen:
«Blattlauszeiten?»,
oder hatte sie ihn überhaupt nicht verstanden und gefragt:
«???Blattlauszeiten???»
Er schaute angestrengt in ihre Augen. Augen waren für ihn Satzzeichen: Fragezeichen, Punkte, Ausrufungszeichen.
Marias Augen waren tief dunkelbraun, das Braun war sehr warm, fast schwarz, es machte Sommerferien entbehrlich, fast überflüssig, sie anschauen und an Satzzeichen denken war schwer, fast unmöglich.
So durfte das nicht weitergehen.
«Ich bin taub», sagte er, «deshalb klingt das so komisch, wenn ich rede. Du musst mich immer anschauen, wenn du mit mir sprichst. Ich kann sehr gut Lippen lesen. Das ist alles …»
Das Entsetzen in ihren Augen – damit hatte er nicht gerechnet, ein Entsetzen ohne irgendwelche Satzzeichen, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Anführungsstriche, jenseits aller Ausrufungszeichen –
«… das ist alles nicht weiter …»
– helles Entsetzen in dunkelsten Augen –
«… nicht weiter schlimm …»
Eine solche Reaktion kannte er nicht. Alle, denen er sagte, dass er nichts hörte, waren zuerst erschrocken, dann kriegten sie meist so einen mitleidvollen Blick, dass er lachen musste, vor allem, wenn sie mit übertrieben großen Bewegungen mit Lippen und Armen herumfuchtelten.
«Nicht so laut», sagte er dann, «ich bin doch nicht blind.»
Maria versuchte so etwas nicht. Ihr Mund blieb offen stehen, mitten zwischen ‹a› und ‹o›.
Ich werde mich, dachte Johannes, wohl daran gewöhnen müssen, dass dieses Mädchen immer etwas übertrieben reagiert. Ihr Vater ist ein ganz normaler Deutscher, nur ihre Mutter ist Italienerin, und sie sieht übertrieben spanisch aus. Sie mag übertrieben viele Hunderassen ohne ‹s›, sie hat übertrieben gelacht, als sie meinen Namen erfuhr – nun, da hatte sie auch einen Grund –, jetzt reagiert sie wieder übertrieben, vielleicht hat sie jetzt auch einen Grund? Vielleicht freut sie sich seit gestern darauf, mit mir in eine Disco zu gehen?
Er schnippte ein paar Blattläuse von Johannisbeerblättern, es war kein Zufall, dass er dicht bei den Sträuchern stand.
«Ich war mal in einer Disco», sagte er, «fand es ganz toll da drin, die Lichter und alles, ein paar Freunde von meiner Schule fanden es auch so gut, die sind schwerhörig, fast so taub wie ich, wir konnten uns da unterhalten, und meine Eltern haben noch nie gesagt, ich soll da nicht hin, weil das meinen Ohren schadet. Nie.»
Doch er erreichte keine Veränderung. Marias Lippen blieben erstarrt zwischen ‹a› und ‹o›. Und nun schloss sie auch noch die Augen, verdeckte ihm die Satzzeichen und wandte den Kopf ab, machte damit die Stille seiner Welt zu einer Rede ohne Antwort.