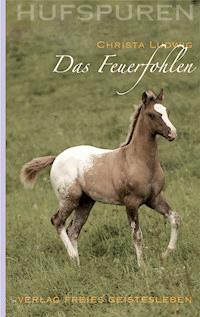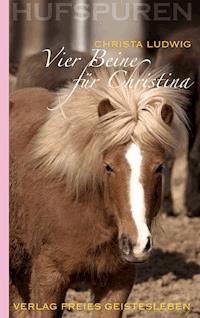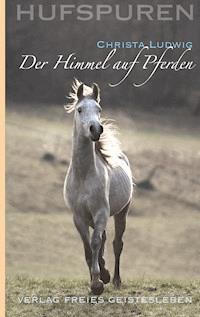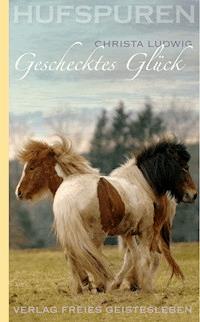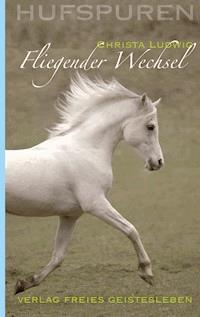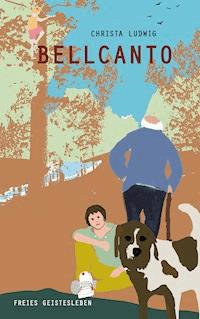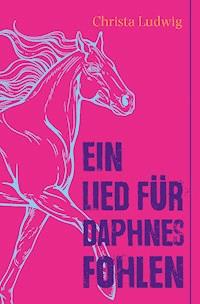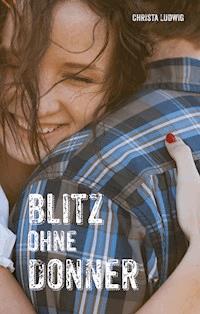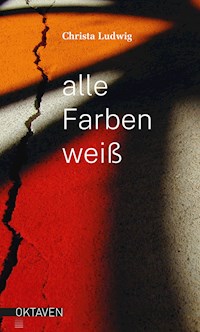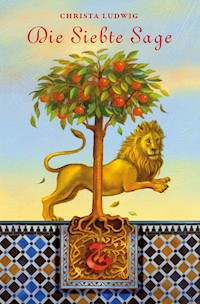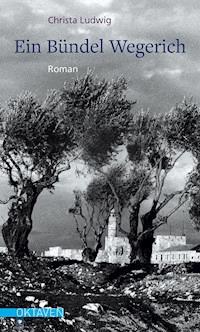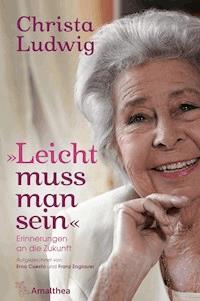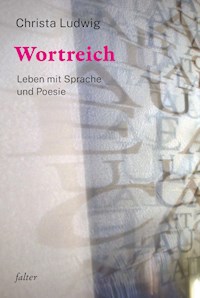
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: falter
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Vom Klang der Sprache und den Farben der Poesie Christa Ludwig wandert in ihren spielerisch leicht erzählten Texten durch das Reich der Worte. Sprache ist ihr Lebenselixier. Sie sammelt Lieblingswörter, wirft Fragen auf wie »War das Wort zuerst Gesang?« und »Ist der Mensch zum Sehen geboren - oder eher zum Hören, weil man Sprache hören muss?« Sie erzählt, wie Gedichte Alltagsprobleme lösen können, und findet die Poesie im Alltag und den Alltag in der Poesie. In diesen kurzen, eingängigen Betrachtungen erschließt Christa Ludwig erstaunliche Phänomene der Sprache, die das Leben oft in einem ungewohnten Licht erscheinen lassen. Mit ihren Anregungen können wir auch in unserem Alltag einen überraschend neuen Blick auf die Dinge gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
falter 54
Wege der Seele – Bilder des Lebens
Christa Ludwig
Wortreich
Leben mit Sprache und Poesie
Verlag Freies Geistesleben
1. Auflage 2022
Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
www.geistesleben.com
eISBN 9783772546549
© 2022 Verlag Freies Geistesleben
& Urachhaus GmbH, Stuttgart
Der Abdruck der Gedichte erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Verlage bzw. der Rechteinhaber.
Umschlaggestaltung & Satz: Thomas Neuerer
Umschlagfoto: Photocase Addicts
Inhalt
Vordemwort
Teil 1
Redseelig
Vom Klang der Kellertür
War das Wort zuerst Gesang?
Ziegen oder Schafe? / Schmerz oder Angst? / Abbild oder Symbol? / Geist oder Körper? / Gott oder die Natur?
Unser Voldemort
Das Zauberwort
Zum Hören geboren
Die Sprache, die niemand spricht
Der Fall Adessiv
So what!
Das Flüstern und der Glücksmotor
Verbrennungen äußersten Grades
Was macht das Gedicht zum Gedicht?
Teil 2
Lyrische Lösungen
Süße Beeren im Schnee
Die Ente und die Nachtigall
Die Ofenkachel und das Sieb
Schiller für Wodka – Rilke für Slibowitz
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Der entsetzliche Hai, des Meeres Hyäne
Tadel-los
Reisen
Sonne sagen, Sonne sein
Nützliche Lektüre
Du musst dein Leben ändern
Vom Sagen und Meinen
Das Messer und das zweischneidige Schwert
Eichenbuchstaben im Rosensteinpark
Text und Textil
Nachdemwort
Anmerkungen
Vordemwort
Was war vor dem Wort?
Niemand weiß es. Tiere verständigen sich durch Körpersprache, durch die Haltung des Kopfes, des Halses, Hunde reden mit dem Schwanz, Pferde mit den Ohren, Rinder mit den Hörnern. Auch der Mensch hat seine Körpersprache. Auch Tiere sprechen mit Lauten. Wie aber wurden für den Menschen die Laute zu Wörtern? Wie hat er es gebaut, das Wortreich? Und wie erlangten die Worte ihre eigene Ästhetik? Wie wurde aus dem Bezeichnen und Bedeuten Poesie? Oder war die von Anfang an da? Immer? Und überall? Und wie durchdringt und gestaltet all dies unseren Alltag?
Durch dieses Wortreich lasse ich hier meine Gedanken strömen, mäandern – da ist schon so eins, ein Lieblingswort: mäandern …
Ich glaube, mich an den Augenblick zu erinnern, in dem mir zum ersten Mal bewusst wurde, wie Wörter durch mein Leben fließen.
Es war in einer Schulstunde, 7. Klasse, Mathematik, Geometrie. Ich sah, wie Babs neben mir das rechtwinklige Dreieck mit einem Lineal zeichnete, das anders war als alle anderen. So behandelte sie es auch. Bevor sie es aufs Papier legte, hielt sie es vor ihr Gesicht, atmete es ein, streichelte es, und erst dann übergab sie es der banalen Funktion, die Basislinie zu ziehen. Ich fand das angemessen, denn das war nicht irgendein Stück Holz wie meines, es war zusammengesetzt aus neun, zehn oder mehr Edelholzfarben.
«Zeig mal», flüsterte ich.
Der Blick, mit dem sie aufschaute, war weder rechtwinklig noch dreieckig, eher schwimmend in Wellen und Kreisen, und so ähnlich sah auch die kaum geometrische Form in ihrem Matheheft aus. Sie reichte mir das Lineal.
«Hat mein Freund mir geschenkt», hauchte sie.
Ich staunte. Die Sensation war nicht, dass Babs mit knapp dreizehn Jahren einen «festen Freund» hatte, das hatte ich gewusst, sie sprach ja von nichts anderem, die Überraschung war das Lineal.
«Gerds Vater handelt mit südlichen Hölzern», flüsterte Babs.
Der kostbare Gegenstand war ein Werbegeschenk, zusammengesetzt aus Edelhölzern, in rötlichen, bräunlichen Farbtönen schimmernd, poliert, aber nicht ganz eben geschliffen, die Fingerkuppen ahnten eine fein ziselierte Maserung, und die Nase nahm einen zarten Duft wahr, exotisch und geheimnisvoll. Ein Zauberstab, der leicht in der Hand lag, zum Sehen, Fühlen, Riechen …
Aber die Augen können mehr als Farben sehen. Sie können lesen, und wenn sie lesen, sehen sie mehr als bei jedem anderen Anblick. Eingraviert waren die Namen der Hölzer: Maobi, Macaranduba, Cumarú, Bongossi, Merbau, Wengé, Bankirai, Kasai, Bintangor – die Wörter überboten die Farben, das Fühlen, den Duft. Ich schrieb sie sofort auf das nächste erreichbare Blatt, es lag ja vor mir. Mit einem rechtwinkligen Dreieck hatte meine Arbeit in dieser Mathestunde keinerlei Ähnlichkeit mehr, aber im Heft von Babs sah es auch nicht geometrischer aus, freilich in Folge einer ganz anderen Verwirrung der Sinne.
Ich war schon davor von Worten fasziniert gewesen, aber niemals zuvor hatte ich ihre Kraft so klar bewusst gespürt. Wie ich in den folgenden Jahrzehnten durch das Wortreich gewandert-mäandert bin, habe ich in diesem Buch zusammengetragen.*
* Die Texte dieses Buches sind größtenteils bereits als einzelne Kolumnen in den Jahren 2018 und 2021 im Lebensmagazin a tempo (www.a-tempo.de) erschienen.
Teil 1
redseelig
Vom Klang der Kellertür
Sprachen halten Ordnung. Sie haben Regeln, und es wird darauf geachtet, dass diese eingehalten werden. Allerdings – ich gebe zu – Zahlen sind ordentlicher. Es braucht keine «Gesellschaft für Zahlen», um zu gewährleisten, dass ihre Regeln nicht verändert werden. Jahrtausende haben die Gesetze der Zahlen nicht gebrochen und werden es nicht tun. Auf die Sprache dagegen muss man aufpassen. Sie neigt zum Aufstand gegen ihre Regeln. Man ruft sie zur Ordnung! Man lässt den Widerstand zu. Und begrüßt ihn.
Liebe ich darum Worte mehr als Zahlen? Ich bewundere die Standhaftigkeit der Zahlen! Und ich liebe den Aufstand der Worte! Und ebenso den Rahmen ihrer Ordnung. Darum will ich hier ordentlich sein und das Sprachgebäude dieser Essays mit dem Fundament beginnen. Und da dieses Gebäude solide unterkellert ist, betrete ich das Wortreich durch die Kellertür.
Und stolpere über die Schwelle:
Bei einer Lesung in einer internationalen Schule stellte mir ein Junge eine ungewöhnliche Frage: «Schreiben Sie nur deutsch oder auch in anderen Sprachen?»
Während meines Studiums schrieb ich tatsächlich nicht deutsch, sondern englisch. Ich hatte Verwandte in England, war häufig dort und mit der Sprache vertraut. Und ich graulte mich vor der deutschen Sprache. Ich fand sie klumpig, spröde, schwer in einen Rhythmus zu bringen und für Lyrik geradezu unbrauchbar. Wenn etwas Neues erfunden und ein Wort gebraucht wird, das keinen Urahn im klangvolleren Althochdeutschen hat, dann benennen die Deutschen es mit einem unmelodischen Wortbrocken: Reißverschluss – die Engländer sagen zip. Sollte es in England so etwas geben wie einen Eikappensollbruchstellenverursacher, dann nennt man diesen überflüssigen Gegenstand dort vielleicht egg grab oder so ähnlich.
Und die Namen! Hätte ein Josef Grün die Chance gehabt, von Belcanto-Tenören so geliebt zu werden wie ein Giuseppe Verdi? Verbal sehe ich keinen Reiz darin, im Harz auf den Brocken zu klettern. Da ist es entschieden eindrucksvoller, auf den Rocciamelone zu steigen (eine gewisse Sportlichkeit muss bei dem Dreieinhalbtausender vorausgesetzt werden).
J. R. R. Tolkien (Der Herr der Ringe) hat einmal gesagt, es gebe Wörter, die einfach schön seien. Er nannte als Beispiel cellar door.1 Und ich ärgerte mich, dass ich deutschsprachig aufwachsen musste, und beneidete glühend alle Engländer, die einen Klang wie cellar door verschwenden konnten an so etwas Banales wie Kellertür. Ich machte mich auf die Suche nach ähnlich Klangvollem im Haus: Ich lehnte mich an die Fensterbank (oh, window sill), schlurfte über den Fußboden (ach, floor), stolperte die Treppenstufen hinunter (hach, steps), draußen spielten ein paar Kinder Tischtennis, und sprächen sie englisch, dann hätten sie ping-pong gespielt – wie viel lustiger wären die Bälle geflogen im Klick-Klack-Takt. Mein Erzfeind der deutschen Sprache war die Wendung etwas auswendig lernen. Was für ein Unsinn! Wenn es wenigstens inwendig lernen hieße! Aber auch das wäre keine Konkurrenz zu learn by heart.
Die deutschsprachigen Dichter, dachte ich, gehen mit Handicap in das Rennen um den Lorbeerkranz. Sie haben keine Chance. Warum nur gab ich mich stunden-tagelang mit diesen Losern ab? Warum saß ich bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit auf Stühlen, Bänken, Wiesen, in Bussen und in Straßenbahnen mit Sammlungen deutscher Gedichte und verpasste es, ein- oder auszusteigen? Weil man Glückseligkeit kaum mitreißender beschreiben kann als mit: Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte (Eichendorff),2 Liebe – in diesem Fall zur Mutter – nicht inniger ausdrücken kann als so: Wäre mein Lächeln nicht versunken im Antlitz, Ich würde es über ihr Grab hängen (Lasker-Schüler).3 Und kann man Sehnsucht eindringlicher schildern als mit Folg ich der Vögel wundervollen Flügen (Georg Trakl4)? Womit bewiesen ist, dass dieselbe Sprache, die ein Wort wie Eikappensollbruchstellenverursacher zu verantworten hat, durchaus lyrikrelevant ist.
Von da an schrieb ich deutsch, und aus allen Ecken, Fugen und Ritzen stürmten Wörter herbei, die den Vergleich mit cellar door nicht scheuen mussten: Firlefanz, Kokolores, Fisimatenten, Schlafittchen, Plempel, Schnickschnack, Kinkerlitzchen, Huckepack, Hallodri, Schabernack, Mumpitz, Klabautermann … Aber Halt! Das sind wenig ernsthafte Wörter! Und häufig, wenn ich sie anpreise, höre ich nicht nur Zweifel wegen ihrer unordentlichen Bedeutung, sondern auch den Einwand, das seien keine deutschen Wörter, das seien Immigranten, und zwar liederliche! Da sage ich zunächst: Danke für das Wort! Das ist auch so eines: liederlich! Es klingt nach Lied. Aber damit ist es nicht verwandt. Man sagte früher lüderlich. Das klingt nach Luder. Aber in diese Verwandtschaft gehört es auch nicht. lieder bedeutete im Mittelhochdeutschen ‹leicht› bis ‹leichtfertig›. Was für ein leichter, liedhafter Tanz um einen zweifelhaften Inhalt! Und tatsächlich stammen nahezu alle meiner liederlichen Lieblingswörter aus alten Formen der deutschen Sprache. Als die noch jung war, klang sie volltöniger, jünger. Im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende wurden Klang und auch Grammatik abgeschliffen. Solch einen Prozess durchliefen alle Sprachen – bis auf eine! Ich habe im Studium ein wenig Altnordisch gelernt, und mein Dozent sagte damals, er fahre einmal im Jahr nach Island, um die Sprache, die er unterrichte, sprechen zu können. Durch die Insellage hat sich das Altisländische so gut wie nicht verändert. Die Isländer sprechen wie ihre Vorfahren vor mehr als tausend Jahren. Beneidenswert! Während uns die frühen Werke unserer Kultur – Parzival, Tristan – ohne Übersetzung nahezu unverständlich sind, können die Isländer ihre Edda und ihre Sagas problemlos lesen.
Aber zurück zu meinen liederlichen Freunden, dem Firlefanz (firlifanz war ein mittelalterlicher Tanz), dem Kokolores (vielleicht von gokeler, Gaukler) und zu der Frage: Gibt es denn nichts in der deutschen Sprache, das seriös und attraktiv ist? Doch!
Das Wort er-innern versöhnte mich mit auswendig lernen. Die Weisheit der Ent-täuschung erhellte mir die damit beschriebene Lebenserfahrung, verwandelte sie diese doch in die positive Erkenntnis, dass eine Täuschung aufgehoben wurde. Kann man den Umzug mittelloser Studenten reizvoller beschreiben also mit: Die Habenichtse sammeln ihre Habseligkeiten?
Mein Lieblingswort der deutschen Sprache aber wurde saumselig, ein Klang und ein Zustand von purem Genuss.
Und nun habe ich ein neues Lieblingswort: redseelig …
War das Wort zuerst Gesang?
Waren es Ziegen oder Schafe? War es Schmerz oder Angst? War es der Geist oder der Körper? Abbild oder Symbol? War es Gott oder die Natur? Waren es Frauen oder Männer?
Wenn man die Frage stellt, aus welcher Quelle die Sprache erschaffen wurde, dann gibt es fast so viele Antworten und Spekulationen wie Sprachen auf dieser Erde. Es ist darum unsinnig, hier eine Antwort finden zu wollen, aber es ist faszinierend, die Spekulationen zu betrachten. Ich weiß, ich begebe mich auf Glatteis.
Ziegen oder Schafe?
Im 7. Jahrhundert v. Chr. wollte Pharao Psammetich es genau wissen: Welches ist die Ursprache? Die Mutter aller Muttersprachen? Einem Ziegenhirten wurden zwei Säuglinge übergeben, die er zusammen mit seinen Ziegen versorgte, in deren Gegenwart er aber nicht sprechen durfte. Nach zwei Jahren begrüßten die Kinder den Hirten mit dem Wort bekos, dem phrygischen Wort für Brot. Verwundert nahm der Pharao zur Kenntnis, dass Phrygisch die Ursprache sei, was für ihn wohl ein Schock war, denn so musste er annehmen, dass die Phryger die sprachschöpfende Kultur waren und nicht die Ägypter.
Nun, es waren wohl eher die Ziegen, die hier phrygisch sprachen, und die Kinder ahmten deren Meckern nach. Wenn irgendetwas über den Spracherwerb nicht spekulativ, sondern gesichert ist, dann ist das der Faktor Nachahmung. Dass man aber in der Nachahmung von Tierlauten den Ursprung der Sprache findet, wie die Vertreter der Wau-Wau-Theorie vermuten, leuchtet mir nicht ein. Es muss unterschieden werden zwischen der Frage nach der Ursprache und der Frage nach dem Ursprung der Sprache. Das Nachahmen von Tierlauten kann man noch nicht als Sprechen bezeichnen, wenn auch das Ziegenmeckern der Kinder nach einem Wort klang. Sprache und Sprechen wird das erst, wenn dem Laut eine Bedeutung zugeteilt wird. Herder antwortet auf die Frage, ob dem Menschen per se Sprache eigen sei,5 dass Menschen zuerst das Blöken eines Schafes nachahmten – das war ein Laut, nicht mehr –, aber sobald der Mensch diesem Laut die Bedeutung Schaf zuwies, wurde daraus ein Wort.
Schmerz oder Angst?
Die Ursprache habe sich aus Urlauten entwickelt, so nimmt die Aua-Theorie an. Wenig überzeugend. Vom Laut zur Sprache ist der Weg komplexer. Wenn eine Katze sich den Schwanz einklemmt, schreit sie seit zigtausend Jahren Mi-aua; eine dem menschlichen Sprechen vergleichbare Kommunikation zu entwickeln, haben diese klugen Tiere aber bislang nicht für nötig befunden.
Abbild oder Symbol?
Die Linguistin Wendy Sandler erforscht die Gebärdensprache,6 die im Lauf der letzten hundert Jahre in einem Dorf in der Negev Wüste entstand. Hier geht es nicht um die hochdifferenzierte Gebärdensprache der Gehörlosen, sondern um eine isolierte Zeichensprache, die parallel zur Lautsprache eingesetzt wird. Mit allen drei Generationen, die sich mit diesen Zeichen verständigen, konnte Sandler reden. Und sie entdeckte: In der ersten Generation bildet das Zeichen seinen Gegenstand ab: Ein klopfender Zeigefinger stellt ein pickendes Huhn dar, die Hand formt das Nest: das heißt Ei. In der dritten Generation ist der Gegenstand in der Geste nicht mehr erkennbar: eine nach oben offene Hand bedeutet Ei. Diese Erkenntnis überzeugt: Sprache wird ebenso den Weg vom lautmalenden Abbild zum abstrakten Symbol gegangen sein.
Geist oder Körper?
Ich verweise noch einmal auf Herder. In seiner Sprachphilosophie geht er davon aus, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen sei und darum die Sprache erfinden musste.