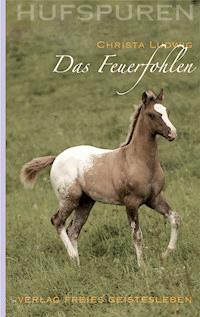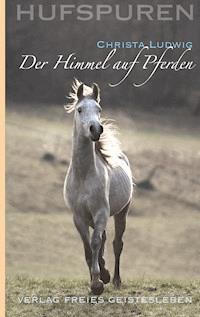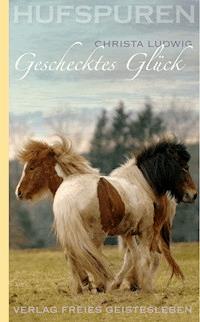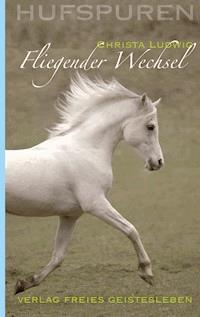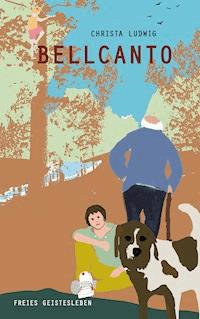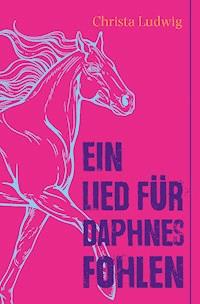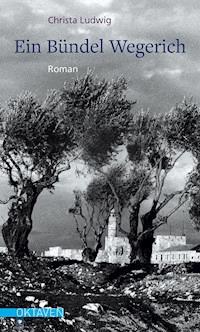Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sie heißt Dshirah und ist ein Hirtenmädchen in einem wunderschönen südlichen Land. Doch sie kann nicht leben wie andere. Sie darf keine Freundin haben. Muss sich verbergen, fliehen. Denn wenn erkannt wird, was sie von anderen unterscheidet, droht ihr der Tod im Löwenrachen. Für Dshirah beginnt eine dramatische Flucht und verzweifelte Suche nach der verlorenen, vergessenen Siebten Sage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTA LUDWIG
Die Siebte Sage
Inhalt
Flucht mit einem Schuh
Freundschaft
Flucht ins Gefängnis
Hinter der Blumenmauer
Ein Aramine mit Herz zerbeißt seine Zunge
Geheimnisse
Glückstag
Die geprügelte Sonne
Der weiße Lakai
Das Gesetz
Januãos letzte Augenblicke
Träume
Das Hdorigo-Rot
Blindenschule
Ein Wieder-Sehen
Das Zeichen von Leben oder Tod
Wasser
Abwasser
Der Tod ist da, wo du daheim bist
Im Saal der weichen Stimmen
Katzenorgel
Das Gastmahl unter der Erde
Lesen ist lebenswert
Auf der Suche nach dem verborgenen Schmutz
Das dreimal gewendete Blatt
Ein paar Wörter, die du vielleicht nicht kennst?
Meinen jungen Lektorinnen und Lektoren
Alles erfunden?
Flucht mit einem Schuh
Wasser!
Dshirah liebte Wasser. Daheim in der weiten Ebene am Fluss, wo man immer rechtzeitig sah, ob sich jemand näherte, durfte sie die Schuhe ausziehen und im Wasser planschen. Sie konnte sogar ein wenig schwimmen. Die fünf Jungen, die vor ihr in dem schmalen künstlichen Bach mitten in der Stadt herumsprangen, konnten das bestimmt nicht.
«Dshirah!», schrie Silbão und spritzte ihr Wasser ins Gesicht. Er war ein Freund ihres Bruders und sie mochte ihn. Doch sie wandte sich ab.
Ich hätte nicht mit den Jungen gehen sollen, dachte sie. Aber in einer Stadt wie Al-Cúrbona ist es nicht leicht, allein nach Hause zu gehen, wenn die Schule zu Ende ist. Jenseits des kleinen Platzes sah sie die Mädchen aus ihrer Klasse gerade in einer Straße verschwinden. Eine drehte sich um und winkte ihr zu. Beinahe hätte Dshirah zurückgewinkt, es zuckte in ihrer Hand, aber sie presste noch rechtzeitig den Arm an den Körper. Drei Tage hintereinander war sie mit diesem Mädchen bis zur Plaza de las Poemas gegangen, drei Tage, das war fast der Beginn einer Freundschaft. Und Dshirah hatte den Eltern doch fest versprochen, dass sie nie nie nie eine Freundin haben würde, sonst hätte sie nicht zur Schule gehen dürfen.
Ein nasser Ball traf sie im Rücken. Silbão lachte. Das Wasser reichte ihm bis zum Knie. Es floss hier mit nur leichter Strömung am Rand der sacht abfallenden Straße in einem kunstvollen Bachbett aus bunten Fliesen mit Schnörkeln und Ornamenten. Silbão bückte sich, patschte auf das Wasser, dass es spritzte und sprühte. Im Regen der Tropfen sah er noch schöner aus, allerdings nicht klüger. Er war ein Aramine mit schwarzem, gewelltem Haar und dunklen Augen.
«Dshirah, Dshirah wasserscheu …», rief er, «wasserscheu, wasserscheu, wasser-, wasser-, scheu, neu, freu?»
Er kam nicht weiter. Im Verse-Machen war Silbão ein völliger Versager. Er schaute hilflos auf den kleinen Kirr, der auf den Randfliesen saß. Kirr hatte helle Haare, er war ein Barde wie Dshirah. Er hob den Kopf und sagte: «Dshirah, Dshirah wasserscheu, fasst keinen Tropfen Wasser an, es sei denn, dass man’s trinken kann.»
«Fasst keinen Tropfen Wasser an …», schrie Silbão.
«Ich bin nicht wasserscheu», unterbrach Dshirah und trat näher an den Bach.
Ich muss gehen, dachte sie, weg! Weg!
Aber sie war elf Jahre alt und wollte mit anderen Kindern spielen, nicht immer nur daheim mit ihrem Bruder und mit – oh, sie hatte eine Freundin! Doch das durfte niemand wissen.
Silbão sprang an einer bunten Schlange aus mehreren Fliesen entlang, die sich am Boden des Bachbettes ringelte. Er lachte.
Ich muss gehen, dachte Dshirah und sagte: «Ich kann nur nicht ins Wasser, weil meine Schuhe dann so rutschig werden.»
«Zieh sie aus!»
Die Sandalen der Jungen lagen alle auf der Straße.
«Das geht nicht. Meine Mutter bindet sie immer so fest. Ich krieg sie nicht auf.»
Niemand kriegt sie auf, dachte sie, die auch nicht.
Denn Dshirah trug keine Sandalen, sondern weiche Lederschuhe. Bänder waren über Kreuz ihre Unterschenkel hinauf gewickelt und unter ihrem Knie mit einem Knoten zusammengehalten, den niemand öffnen konnte, nicht einmal ihre Mutter. Die schnitt ihn jeden Abend auf und zog neue Bänder ein.
Silbão hörte auf zu planschen.
«Warum hast du nur diese Schuhe an?», fragte er.
Er kam häufig Dshirahs Bruder besuchen und wusste, dass sie diese Schuhe immer trug.
«Hast du keine Sandalen?»
«Das geht dich nichts an», sagte Dshirah. «Und überhaupt – du hast mir gar nichts zu sagen.»
Das stimmte. Zwar war Silbão ein Aramine und gehörte damit zu jenem Volk, das vor über vierhundert Jahren die Südbarden überfallen und das Land erobert hatte, aber das war inzwischen kaum noch wichtig. Viel bedeutsamer war, dass Silbãos Hemd auf der rechten Schulter einen Ziegenkopf trug, während auf Dshirahs linke Schulter ein Pferdekopf gestickt war. Hirtenkinder waren sie alle in der Hirtenschule, aber sie waren damit nicht alle von gleichem Rang. Die Ziegenhirten waren die niedrigsten. Unter ihnen standen nur noch die geächteten Metzger, aber deren Kinder gingen in eine andere Schule. Dshirahs Familie hütete die Halbblutfohlen des Kalifen, und nur der kleine Kirr mit dem Pferdekopf auf der rechten Schulter war höher gestellt als sie, denn sein Vater betreute die Vollblutfohlen.
Silbão war ein friedlicher Junge. Er lachte noch immer und rief: «Dshirah, Dshirah wasserscheu …»
«Ich kann schwimmen!», schrie Dshirah.
Da lachten sie alle.
Weg, dachte sie, weggehen.
Aber sie sprang ins Wasser, hüpfte über die roten und goldenen Fliesenfische, spritzte Silbão Wasser ins Gesicht, lachte und spritzte, lachte und spritzte, rannte den Bach hinunter, die Jungen folgten und lachten, sie hüpfte, rutschte und fiel.
«Glaubt ihr es jetzt?», fragte sie.
Silbão nickte. «Ich komme heute zu euch und du zeigst mir, wie du schwimmst.»
Sie hätte es nicht sagen dürfen.
Weg, dachte sie, weg.
Sie sprang aus dem Bachbett und merkte nicht, dass sich am Rand eine Fliese gelöst hatte. Das Band ihres rechten Schuhs blieb daran hängen, und sie hatte das Bein so heftig aus dem Wasser geschwungen, dass es riss.
«He», sagte Silbão, «jetzt kannst du den Schuh ausziehen.»
Und Kirr grinste: «Und auf einem Bein hüpfen, ohne zu rutschen.»
Dshirah hielt die losen Enden zusammen, humpelte ein Stück, sagte: «Ich muss heim.»
Aber die Jungen folgten ihr. Da rannte sie. Sie gewann einen kleinen Vorsprung, weil die Jungen verblüfft stehen blieben. Als sie sich aber umdrehte, sah sie, dass sie ihr nachliefen. Sie bog in eine Seitenstraße. Sollte sie versuchen, das Schuhband wieder zu verknoten? Silbãos Kopf erschien am Ende der Straße, da jagte sie in wilder Angst davon. Sie fühlte, wie das Band sich ihren Schenkel hinunterringelte, sie versuchte die Schuhsohle mit den Zehen zu halten, doch dadurch wurde sie langsam, und die Jungen holten auf. Sie sprang über die mit glatten Steinen gepflasterten Straßen. Es war am frühen Nachmittag. Die Menschen kamen gerade erst wieder aus ihren Häusern gekrochen, noch war es heiß. Nicht heiß genug, um ihre Schuhe schnell zu trocknen. Sie glitt aus, fiel einem fremden Mann in den Weg und fühlte an ihrem rechten Fuß keinen Schuh. Er war weg. Sie zog das rechte Bein an, setzte sich auf den Fuß, der Mann reichte ihr eine Hand, um ihr aufzuhelfen, sie nahm sie nicht. Dicht hinter dem Fremden sah sie ihren Schuh liegen. Da stießen die Jungen gegen den Mann. Der schimpfte, drehte sich um. Dshirah sah, wie Silbão nach ihrem Schuh griff. Sie sprang auf und rannte, schneller jetzt, noch schneller.
Al-Cúrbona war eine schöne Stadt. Sie lag am Hang über dem Fluss. Hoch über allen Häusern schwebte die Palaststadt des Kalifen. Neben den größeren Straßen flossen auf einer oder auf beiden Seiten die kleinen Bäche in ihren bunten, kunstvollen Betten. Ihr Wasser sammelte sich in Brunnen, schoss in Kaskaden und kleinen Wasserfällen über die Hänge und sprühte Fontänen an Straßenecken. Obwohl die Häuser sich nach außen schlicht gaben und fast allen ihren Schmuck in den Innenhöfen zeigten, hatten auch die Fassaden ihren eigenen Stil. In vielen Farben gewebt waren die Vorhänge vor den Türen, um den Türrahmen war eine Leiste mit bunten Ornamenten in den weißen Putz gemalt, und vor den wenigen Fenstern hingen Blumen.
Dshirah blieb stehen.
Die schmale Gasse, in die sie sich geflüchtet hatte, war menschenleer. Sie keuchte. Ein heftiger Schmerz stieß in ihre linke Seite. Aber die Jungen schienen ihr nicht mehr zu folgen.
Sie haben nichts gemerkt, dachte sie, nur, wie komme ich jetzt nach Hause?
Sie versuchte herauszufinden, wo sie war. Neben den Türen hingen Schilder: Schneider, Weber, Schuster – sie überlegte, ob sie in eines der Schusterhäuser schleichen und ein paar Schuhe stehlen sollte, doch das schien ihr noch gefährlicher, als mit einem Schuh weiterzugehen. Sie kannte diese Gasse nicht, aber solange sie abwärts- und der Sonne entgegenlief, war sie auf dem Heimweg. Sie bemühte sich, weiterhin durch unbelebte Gassen zu gehen, doch immer mehr Vorhänge wurden beiseite geschoben. Um diese Zeit drängten die Menschen hinaus. Es war also besser, wieder zu rennen.
«Da! Da ist sie!»
Silbão und die anderen Jungen! Sie lief genau auf sie zu. Dshirah drehte sich um und stürmte planlos durch die Gassen und Straßen. Schon füllten die sich mit Leuten, schon musste sie sich im Zick-Zack um fremde Körper schlängeln. War das ein Vorteil? Konnte sie so den Jungen leichter entkommen? Aber jedes Paar Augen war genauso gefährlich wie Silbãos schwarze Pupillen. Und da hörte sie ihn wieder. Erschrocken sprang Dshirah geradeaus, dahin, wo Platz war, wo niemand ging –
«He, du!», schimpfte eine Männerstimme – und Dshirah merkte nicht, dass sie den schlimmsten aller Fehler gemacht hatte. Sie war über eine Baustelle gelaufen, ein kleines Geviert, das auf einer Kreuzung für ein neues Muster von Fliesen vorbereitet wurde. Man hatte den Boden mit frischem Sand bestreut. Den hatte man nass gemacht, geebnet. Als Dshirahs rechter Fuß darauf trat, fühlte sie kurz die feuchte Kühle einer glatten Fläche, fest, aber nicht hart.
Wieder rennend, schaute sie zurück, sah die Jungen aus der Menge kommen, sah – nur im fernsten Winkel ihres Blicks –, wie die Arbeiter sich über den Sandboden beugten, wie Kirr stehen blieb. Sie hörte, dass er etwas rief, verstand es aber nicht. Da tat sie, womit die Jungen nicht rechnen konnten: sie verschwand hinter dem Vorhang des nächsten Hauses, sie fühlte schon am Stoff, dass es ein Adelshaus war.
Ein Hirtenkind in einem Adelshaus, ohne Auftrag, etwas zu holen oder abzugeben – natürlich wusste sie, wie streng das verboten war. Trotzdem atmete sie auf. Hierhin würden ihr die Jungen auf keinen Fall folgen. Sie würde durch das Haus und den Patio schleichen und das Gebäude auf der anderen Seite wieder verlassen – denn Dshirah wusste genau, wie ein Adelshaus von innen aussah, und sie wusste ziemlich genau, wer sich um diese Tageszeit wo aufhielt.
Wenn jemand kommt, sage ich, ich soll die Geburt eines Fohlens melden, dachte sie. Dann bin ich eben im falschen Haus, ich habe mich verlaufen.
Ein paar Frauen kamen ihr entgegen, die beachteten sie nicht, also war sie im Gesindetrakt und damit immerhin auf der richtigen Seite. Aber dann kam ein Mann vorbei und trat ihr in den Weg. Und leider gab es hier Fenster. Wer den ganzen Tag arbeiten muss, braucht Licht. Sie schob den bloßen Fuß hinter die Ferse des Schuhs.
«Was machst du hier?», fragte der Mann.
Sie zeigte auf ihre linke Schulter.
«Ich bin Dshirah, die Tochter von Tazihlo, dem Hüter der Halbblutfohlen. Ich soll die Geburt des Fohlens melden.»
Der Mann nickte.
«Geh durch den Patio. Die Verwalter sitzen am Teich der Goldfische. Einer wird dich zum Herrn führen.»
Glück gehabt! Jetzt wusste sie genau, wohin sie nicht gehen würde.
Sie lief der Nase nach, fort von dem Geruch nach gebratenem Fleisch und auf den Duft von Blumen zu. So erreichte sie den Patio. Er war sehr groß. Wer hier wohl wohnte? Die Bäume und Hecken schützten sie, eine gelbe Katze putzte sich im Schatten, mitten im Garten rauschte der Springbrunnen, sonst war es still. Sie mied den Teich und kam zum Hauptgebäude. Hier war es dämmrig, man hielt die Sonne und die Hitze fern. Aber nun durfte ihr niemand mehr begegnen. Der Herr war also wahrscheinlich im Haus. Hoffentlich in seinen Arbeitsräumen. Die mussten rechts sein. Links ging es zur Halle und von da auf die Straße. Wenn jetzt nicht von oben eine der Frauen herunterkam …
Dshirah schlüpfte an den Wänden entlang, lautlos über dicke Teppiche, durch den Flur, durch den Vorhang – sie stand auf der Straße und – vor der Plaza de las Poemas. Im ersten Augenblick wusste sie nicht, was größer war, ihr Schrecken oder ihre Erleichterung. Sie musste durch das Haus eines Ministers gegangen sein, aber den Jungen war sie entwischt. Auf keinen Fall würde auch nur einer ihr auf diesem Weg folgen. Nur – sie war noch lange nicht zu Hause. Sie stellte sich dicht an die weiße Hauswand und trat mit dem Schuh über den bloßen Fuß. Wie sollte sie weitergehen? Hier rannte niemand, weder auf dem endlosen Platz noch auf den Wegen um ihn herum. Und – oh! – sie hatte jetzt nicht mehr die Jungen hinter sich, keinen Grund zu rennen, keine Möglichkeit vorzutäuschen, dies sei ein Spiel.
Die Plaza de las Poemas war kein Ort der Hast, sondern eine Stätte des geruhsamen Schreitens. Nur den kleinen Kindern, die in den Bächen planschten, war das Laufen gestattet. Die Männer saßen auf den Steinbänken. Die meisten trugen das araminische Tuch um den Kopf gebunden, doch es waren auch bardische Gesichter darunter. Sie redeten, besprachen philosophische, mathematische und rechtliche Fragen, zwei spielten Schach mit lebendigen Figuren, der eine mit Dunkelleuten aus Afrika, der andere mit hellen Figuren aus dem Norden, die Dshirahs Volk ähnlich sahen. Auch die wenigen Frauen, die sich verhüllt und tief verschleiert am Rande bei den Kindern aufhielten, bewegten sich langsam und gemächlich. Dshirah schaute, ob sie eine Strecke fand, auf der niemand ging, eine Schlangenlinie quer über den Platz, immer weit genug entfernt von Augen, die ihr auf den nackten Fuß schauen konnten. Sollte sie sich in die Nähe der Philosophen begeben, die vielleicht darüber nachdachten, ob der Himmel oder ob das Wasser blau sei? Oder lieber an den Rechtsgelehrten vorbeigehen, die sich mit Sicherheit – wie immer – darüber stritten, ob man zum Tode Verurteilte köpfen sollte, wie es bei den Araminen üblich war, oder erhängen, wie die Barden verlangten?
Sie schaute nach links.
Da war die Fassade eines alten araminischen Gotteshauses, das gut gepflegt, aber seit der Zeit von Armei dan Hasud leer war. Sie schaute nach rechts. Da war das größte der prachtvollen Bäder dieser Stadt, in der es fast 800 öffentliche Bäder gab, und nicht eines hatte Dshirah jemals von innen gesehen. Nirgendwo ein Weg, frei von Menschen und deren Blicken. Und dann erkannte sie rechts neben sich auch noch das vergoldete mannshohe Gitter im Maul eines Mosaiklöwen. Hier endete der Löwengang, der bis zu dem Käfig mit den beiden Löwen oben im Palast von Kalif Hisham III. führte. Wenn sie nicht bald einen Fluchtweg fand, brauchten die Rechtsgelehrten nicht mehr über Schwert und Strick zu verhandeln. Wenn man sie so, wie sie hier stand, erwischte, würde man ihre Familie weder köpfen noch hängen, dann würden die Löwen endlich einmal wieder etwas zu jagen haben, bevor sie es fraßen.
Von links kam Lärm, Unruhe, Bewegung. Rettung? Eine Gruppe kleiner Kinder, Dshirah sah das Zeichen der Bäcker und Köche auf ihren Hemden. Sie wurden vielleicht zum ersten Mal auf die Plaza geführt, der Lehrer gab ihnen ein Zeichen und sie stürmten los. Sie sollten hier lesen lernen. Denn der Platz war mit Buchstaben, Silben, Worten gepflastert. Die Dichter kamen hierher und erfanden im gemächlichen Schreiten hin und her, kreuz und quer über den Platz endlose Gedichte, die entstanden und vergingen und die außer der Sonne niemand las. Aber man glaubte in Al-Cúrbona, dass die kurzlebigen Gedichte die Luft durchtränkten, das Atmen würzten, die Lungen reinigten.
«Ich helfe euch!», rief Dshirah und warf einen fragenden Blick auf den Lehrer. Der schaute auf ihre Schulter, sah den Pferdekopf, ja, sie war vom selben Rang wie die Kinder der Bäcker und Köche, und er nickte.
So sprang Dshirah mit den Kindern über den Platz, von Buchstabe zu Buchstabe, sagte: «Gota, alef, fora …», die Kinder sprachen ihr nach und hüpften. Sie hatte keine Angst, dass die Kleinen ihr Geheimnis entdeckten, denn in Al-Cúrbona lernten alle immer zuerst lesen und dann zählen. So sprangen sie an dem Brunnen vorbei und um die große marmorne Statue von Armei dan Hasud herum. Der Gelehrte saß nachdenkend, den Kopf auf die rechte Hand gestützt, ein stilles, freundliches Lächeln lag auf seinem Gesicht. Dshirah blieb stehen und grüßte ihn mit einem leichten Neigen des Kopfes, und das taten auch die kleinen Kinder. Armei dan Hasud zu achten, lernte man in Al-Cúrbona so früh, wie den Kalifen zu ehren.
Dshirah erreichte das südwestliche Ende des Platzes. Durch die anschließenden Straßen würde sie wieder rennen dürfen.
«Geht denselben Weg zurück», sagte sie, winkte dem Lehrer auf der anderen Seite noch einmal zu, wollte in den Gassen verschwinden, hörte einen Schrei: «Dshirah!!!» Silbãos Stimme. «Warte! Warte doch! Dshirah!!!» Und sie rannte.
Er wird mich einholen, dachte sie, er ist schneller als ich, er weiß ja, in welche Richtung ich laufe, ich muss nach Haus, wo soll ich sonst hin?
Es war jetzt nicht mehr so voll in den Gassen. Die meisten, die nicht mehr arbeiten mussten, hatten sich schon mit ihren Freunden auf der Plaza oder auf den anderen Plätzen bei den Springbrunnen getroffen. Dshirah kam gut voran. Aber was nützte ihr das? Sie konnte versuchen, Silbão zu täuschen, und in die kleinen quer liegenden Gassen verschwinden, doch das würde ihr nicht helfen. Auch Silbão war klug genug, um zu wissen, dass er sie auf der weiten Ebene zu ihrem Elternhaus sehen und einholen konnte. Er musste sie nur überholen und dann am Stadtrand warten.
Zaiira, dachte Dshirah, es tut mir leid, ich will dir das nicht antun, aber nur du kannst mich retten.
Zaiira war ihre heimliche Freundin. Ihr Vater war ein adliger Aramine und der oberste Verwalter der Gestüte des Kalifen. Er hatte viel mit Dshirahs Vater zu besprechen, Zaiira begleitete ihn oft und Dshirahs Familie hatte nicht bemerkt, dass sich die beiden Mädchen mehr als nur vom Ansehen kannten. Zaiiras Haus war das letzte am Stadtrand vor den weiten Ebenen, in denen die halbwilden Sorraia-Pferde lebten.
Dshirah lief in eine schmale Seitengasse, dort wohnten Sattler. Vor den Häusern lagen Berge von gegerbtem Leder. Sie verkroch sich darin, sie war zu erschöpft und musste verschnaufen. So wartete sie, bis sie Silbão vorbeilaufen sah. Jetzt erst merkte sie, wie sehr ihr der rechte Fuß wehtat. Sie ging ja niemals barfuß wie die anderen Kinder, nie. Auf dem glatten Pflaster in der Stadt würde sie schon noch laufen können, aber nicht über das Feld in der Ebene. Sie ging langsamer weiter, die Gassen waren leer und sie kannte jetzt ihren Weg.
So erreichte sie Zaiiras Haus. Hier war sie ein gern gesehener Gast. Sie musste sich nur vor den Dienern verbergen, bis Zaiira ihr ein Hemd mit einem Schwert auf der Schulter brachte. Sobald sie das trug, war sie in diesem Haus die Tochter eines Offiziers. Zaiiras Eltern grinsten über den kleinen Betrug. Sie kümmerten sich wenig um die Rangordnung, sondern freuten sich mit ihrer einzigen Tochter an dieser Freundschaft. Zaiira war zwölf und das einzige Kind des Fürstenhauses Al-Antvari. Sidi Antvari hatte keinen Sohn. Seine Frau hatte nach Zaiira kein gesundes Kind mehr geboren. Ein Junge hatte drei Tage gelebt und war dann gestorben. Natürlich hätte Antvari sich eine zweite Frau nehmen können, eine dritte, eine vierte, aber er hatte sich entschieden, mit dieser und keiner anderen Frau zu leben. So war es Sitte gewesen im Volk der Barden, die meisten bardischen Familien hielten sich noch heute daran, und einige Araminen hatten sich ihnen angeschlossen.
Dshirah trat durch den Haupteingang ein, ging die Stufen hinauf zu den Frauengemächern. Auf der Treppe war es dunkel. Sie stolperte über etwas Weiches, hörte ein Fauchen und sah Zaiiras Falbkatze die Stufen hinunterlaufen, ein heller Streifen, fahlgelb wie die halbwilden Sorraia-Pferde. Dshirah trat in Zaiiras Zimmer. Aber ihre Freundin war nicht dort. Sie hörte Stimmen auf der Treppe. Zwei Dienerinnen stritten. Das würden sie nicht wagen, wenn die Herrschaft im Haus wäre. War Zaiira mit ausgegangen? Oder war sie hinten bei den Stallungen? Oder unten im Patio? Dshirah schaute aus dem Fenster hinunter in den Innenhof. Sie sah niemanden. Wenn sie aus dem Fenster kletterte, am Weinlaub hinunter bis in den Patio, sich dann weiter schlich bis zu den Stallungen … Oder sollte sie hier warten? Aber es war sehr leicht möglich, dass eine Dienerin kam, um zu putzen. Sie blickte noch einmal über den Patio. War wirklich niemand da? Nein. Sie schwang sich aus dem Fenster, ließ sich an den Ranken hinunter und das letzte Stück fallen. Sie fiel Zaiira vor die Füße, die mit einem Buch auf einer Bank an der Hauswand saß und ihr nicht ins Gesicht schaute. Zaiira war so blass, wie ihr dunkles araminisches Gesicht überhaupt blass sein konnte. Sie starrte auf Dshirahs bloßen Fuß, dann hob sie den Kopf und sagte: «Du?»
Dshirah verbarg den Fuß nicht mehr, sah der Freundin in die Augen und sagte: «Ja. Ich.»
Freundschaft
Ein paar Herzschläge lang saßen die beiden Mädchen schweigend nebeneinander. Dshirah kuschelte sich in das schützende Weinlaub und zog Blätter über das Zeichen des Hirten kindes auf ihrer Schulter. Sie war in Sicherheit und war froh, so froh …
Dann sprang Zaiira auf.
«Ich hole dir dein Hemd», flüsterte sie, «und – und – Schuhe …»
Sie lief ein paar Schritte über den knisternden Kiesweg, blieb stehen, kam zurück, wollte ihre Sandalen ausziehen.
«Besser als nichts», hauchte sie.
Ihr Gesicht hatte noch immer die erschrockene Blässe unter der araminisch dunklen Haut.
«Lass nur», sagte Dshirah, die Füße unter der Bank verborgen, «hier vertreibt mich doch niemand. Ich lese.»
Sie griff nach Zaiiras Buch, ließ ihre Augen über die Seiten gleiten. Lesen konnte sie die araminische Schrift kaum. Sie war bis jetzt nur zehn Tage zur Schule gegangen. Zaiira lächelte, legte eine Hand an Dshirahs linke Schläfe, ein kleines, leichtes Streicheln, dann ein deutlicher Schubs.
«Danke», lachte Dshirah, «ich passe auf.»
Oh ja, sie musste achtgeben. Wenn sie auch das Buch nicht las, so musste sie doch die Augen von rechts nach links über die Seiten führen. So schrieben die Araminen. Die Barden hatten eine andere Sprache, die inzwischen fast vergessen war. Sie hatten auch eine andere Schrift und sie schrieben von links nach rechts. Das aber hatten die herrschenden Araminen in diesem Land seit mehr als vierhundert Jahren verboten. Nur heimlich unterrichteten die Barden ihre Kinder in ihrer eigenen Schrift. So hatte Dshirah zuerst von links nach rechts lesen gelernt, bevor sie vor zehn Tagen in die Hirtenschule kam.
Zaiira war schnell zurück. Sie brachte das Hemd, das Dshirah in eine Generalstochter verwandelte, und ein paar Reitstiefel aus weichem gelbem Leder.
«Andere feste Schuhe habe ich nicht gefunden», sagte sie. «Damit kannst du nicht nach Hause gehen. Unser Zeichen ist in den Absatz gebrannt.»
Nein, Dshirah konnte auf dem Heimweg nicht zugleich ein Hirtenhemd tragen und auf allen feuchten, lehmigen Stellen am Fluss Spuren des Hauses Al-Antvari hinterlassen.
«Hier bei euch geht es», sagte Dshirah. «Silbão ist hinter mir her. Wenn er weg ist, kann ich barfuß nach Hause laufen.»
Sie wollte nach dem rechten Stiefel greifen, aber Zaiira zog ihn zurück.
«Warte», flüsterte sie.
Dann kniete sie vor Dshirah und nahm den rechten bloßen Fuß der Freundin in beide Hände. Ihre Finger glitten über die Zehen, zögernd, von einem zum anderen, als wollte sie es nicht glauben: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs – und zurück: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
«Bitte», sagte sie, «Dshirah, lass mich drei Sonnenblicke lang genießen, dass meine Freundin das lang ersehnte Kind mit den sechs Zehen ist. Drei Sonnenblicke lang genießen. Bis das Unglück über dich hereinbricht.»
«Wirst du», Dshirah zitterte, «mich verraten?»
«Nie!», Zaiira schüttelte heftig den Kopf. Sie streifte den gelben Stiefel über Dshirahs Fuß.
«Dann wird es kein Unglück geben», sagte Dshirah. «Nur meine Eltern und mein Bruder wissen es. Silbão und die anderen Jungen haben nichts gemerkt, als ich den Schuh verlor. Hast du ein Messer? Ich muss das Band vom linken Schuh aufschneiden.» Zaiira lief über den Kiesweg bis zum Rosentor. Da sollte ein neues Mosaik gelegt werden, es mussten dort bunte Steine mit scharfen Kanten sein, und sie brachte eine leuchtend rote Scherbe.
«Deine Eltern sind nicht hier?», fragte Dshirah. «Und kommen auch nicht so bald?»
Zaiira schüttelte den Kopf: «Mein Vater ist beim Kalifen, und meine Mutter ist im Krankenhaus und besucht mal wieder bardische Kinder.»
Dann warf sie den Kopf zurück, schaute Dshirah an und stieß heraus: «Warum haben deine Eltern das getan? Warum halten sie dich verborgen? Dshirah, ich muss immer mit den Kindern des Kalifen spielen. Sie haben mir die goldene Wiege gezeigt, in der du hättest liegen sollen.»
«Wo ist die?», fragte Dshirah und hielt ihr den linken Fuß hin. «Wie sieht sie aus?»
«Sie steht mitten im Frauenpalast und – oh – sie ist ganz aus Gold mit einem Himmel aus goldener Seide. Sie steht auf Kufen, die enden in kleinen Schnecken, so …» Ihre Finger malten kleine Schnecken in die Luft. «… und wenn sie weit genug schwingt, so hin und her, schlagen die Schnecken an goldene Glöckchen, die machen Töne wie – wie – lachende Sonnenstrahlen, die über die Dächer von Palästen stolpern.»
Dshirah lehnte den Kopf an die Wand und murmelte: «Lachende Sonnenstrahlen, die über die Dächer von Palästen stolpern … Manchmal denke ich, es wäre schön gewesen.»
Zaiira säbelte mit der roten Scherbe an Dshirahs Schuhband.
«Warum haben deine Eltern das gemacht?», presste sie durch die Zähne. «Jetzt ist alles verloren. Oder …», sie schaute auf, «… kennst du vielleicht die Siebte Sage?»
Dshirah schüttelte den Kopf, und Zaiira säbelte weiter.
«Siehst du», murmelte sie, «siehst du. Jetzt ist alles verloren. Und wenn der Kalif jemals herausbekommt, dass das Kind mit sechs Zehen längst geboren ist, und es wurde ihm nicht gebracht – Dshirah, er muss euch töten, alle miteinander.»
«Ich weiß», flüsterte Dshirah. «Verrätst du mich?»
«Niemals! Ich bin deine Freundin. Aber du musst mir sagen, warum deine Eltern das gemacht haben.»
Sie zerriss das Band, zog Dshirah den linken Schuh aus, zuckte zusammen. Hatte sie gehofft, dass die Freundin an diesem Fuß nur fünf Zehen hätte? Es waren sechs. Sie blickte auf.
«Sag es mir!», verlangte sie. «Warum?»
«Weil wir Barden sind», erklärte Dshirah. «Wir glauben eben nicht, dass irgendein Kind mit sechs Zehen das Dshinnu aus den Sieben Sagen ist. Nur weil es auch sechs Zehen hat. Also haben meine Eltern auch nicht geglaubt, dass ich die verlorene Siebte Sage erzählen kann. Auch nicht, wenn ich in der goldenen Wiege schlafe. Und – was wäre dann gewesen? Der Kalif hätte mich doch getötet.»
«Ich weiß nicht», sagte Zaiira. «Kalif Hisham tötet gar nicht so gern.»
Doch Dshirah schüttelte den Kopf.
«Er hätte es getan! Wenn seine Richter und Gelehrten das Urteil fällen: das ist nicht die Siebte Sage, dann wird das Kind mit den sechs Zehen getötet. Und seine Familie dazu. Damit wieder ein Kind mit sechs Zehen geboren werden kann. Meine Eltern haben mir das alles erzählt.»
«Ja», meinte Zaiira, «aber vielleicht hättest du ja doch … Und Armei dan Hasud hat gesagt …»
«Nein!», Dshirah schüttelte heftig den Kopf. «Ich bin nicht das Dshinnu aus den sechs Geschichten. Ich habe sechs Zehen, na und? Wir Barden glauben das alles nicht.»
«Und was glaubt ihr?»
«Das wirst du doch wissen.»
«Nein! Dshirah, ich gehe auf eine araminische Fürstenschule. Von den Barden erzählen sie uns nichts.»
«Ah», sagte Dshirah, «so.»
Und dann sprudelte es aus ihr heraus.
«Die Sieben Sagen sind unsere Geschichten! Nicht eure! Ihr habt sie uns gestohlen wie unser Land. Ihr habt alle unsere Bücher zerstört. Dabei ist die Siebte Sage verschwunden. Und viele Jahre konnten wir nichts von unseren Geschichten erzählen, bis alles vergessen war. Dann endlich haben die Araminen gemerkt, dass Barden auch Menschen sind. Kalif Obajan war ein gerechter Herrscher. Und seitdem geht es uns hier gut, und sechs Geschichten von den sieben hat man gefunden. Aber die siebte Geschichte ist weg. Und dass ein Kind mit sechs Zehen kommt und nur weil es in einer goldenen Wiege beim Kalifen aufwächst, dann mit sieben Jahren diese Sage erzählen kann, das ist Unsinn, Zaiira, Unsinn!»
«Leise. Bitte», sagte Zaiira, «nicht so laut.»
«Mein Vater», murmelte Dshirah, «mein Vater meint, das ist nur, weil die Richter nicht wissen, wie sie ein – was für ein Todesurteil sie sprechen müssen. Es gibt da kein Gesetz. Darum soll das Dshinnu das machen. Die Siebte Sage erzählen, und dann haben sie ihr Gesetz. Das kann ich nicht. Das will ich nicht!»
Zaiira setzte sich neben Dshirah auf die Bank. Beide schauten in den Patio, aber Dshirah sah nichts, nicht das Rosentor, nicht die Pomeranzenbäume, auch nicht zwischen den Lorbeerbäumen die Fontänen des Brunnens, bunt gefärbt von Blumen und Fliesen.
«Aber Geschichten vergisst man doch nicht», sagte Zaiira. «Man erzählt sie weiter und immer weiter, auch wenn keine Bücher da sind. Das ist doch bei uns genauso.»
«Ja …», Dshirah zögerte, «ja … du weißt nicht viel von euch, Zaiira, sie erzählen euch in eurer Schule nichts von uns und nicht viel von euch. Aber wir reden ja auch nicht gern davon.»
«Wovon? Komm! Sag es mir!»
Aber Dshirah schüttelte den Kopf: «Meine Mutter sagt immer, ich soll das keinem araminischen Kind erzählen. Wir leben gut jetzt hier mit euch. Meine Mutter meint, das müssten die Araminen ihren Kindern selber sagen.»
Zaiira drängte nicht mehr.
«Mein Vater wird es tun, wenn es richtig ist», flüsterte sie. «Er hat mir beigebracht – du, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis –, er hat mir gesagt, ich soll immer, wenn ich einen Barden begrüße, mit dazu denken: ‹Und ich bitte dich, verzeih mir.› Aber er hat mir nicht gesagt, warum.»
Die beiden Mädchen schauten sich an. In Zaiiras Blick lag eine Bitte. Dshirah nickte und hielt der Freundin die offene Hand hin. Zaiira legte einen Zeigefinger auf Dshirahs Handgelenk und suchte, bis sie den Puls fühlte. Da schloss sie die Augen. Sie saßen reglos, bis sie beide spürten, dass ihre Herzen im gleichen Takt und Rhythmus schlugen. Das war ein alter bardischer Brauch für Herzensfreunde. Niemand wusste, ob er aus uralten Zeiten stammte und im Gegensatz zu den Büchern nicht hatte zerstört werden können, oder ob er entstanden war, als die Araminen die Barden so schlimm unterdrückten.
Die beiden Mädchen nahmen ihre Hände wieder zu sich, und die schreckliche graue Blässe unter Zaiiras dunkler Haut war verschwunden.
«Du musst nach Hause», sagte sie. «Komm!»
Gemeinsam sprangen sie durch den Patio über knisternden Kies, über farbige Mosaike. Sie liefen durch den hinteren Teil des Hauses, wo die Verwalter und Diener wohnten, und wieder hinaus, nun auf sandigen Wegen, in die Dshirahs Absätze das Zeichen des Hauses Al-Antvari drückten. So hüpften sie am Reitplatz vorbei, wo ein paar Jungen mit den dreijährigen Fohlen übten, ruhig auf einem Fleck zu stehen. Als die Mädchen vorbeirannten, sprangen fünf junge Pferde zugleich in die Luft, schnaubten, prusteten, quietschten, buckelten, stiegen.
Zaiira legte einen Arm um Dshirahs Schulter.
«Wahrscheinlich hast du recht», zischte sie der Freundin ins Ohr. «Wenn Kalif Hisham wüsste, dass du sechs Zehen hast – er ahnt es nicht! Liebe Sonne, Dshirah, er ahnt es nicht, und ich weiß es! Ich glaube, er würde dich sofort den Rechtsgelehrten geben, damit sie aus dir herausquetschen, ob man die zum Tode Verurteilten nun hängen oder köpfen soll.»
«Das könnte ich ihnen sogar erzählen», sagte Dshirah. «Dazu brauche ich die Siebte Sage nicht. Ich weiß ja, dass sie aus unserem Volk kommt. Wenn wir die Siebte Sage fänden, würde die grässliche Köpferei endlich aufhören.»
«Ich glaube nicht, dass die Gehängten schöner sind», sagte Zaiira.
«Immerhin sind die Köpfe noch dran», meinte Dshirah.
Zaiira blieb stehen.
«Hast du mal einen gesehen?», fragte sie atemlos.
«Liebe Sonne nein!!!» Dshirah schüttelte sich. «Einen Toten! Nie!»
Sie liefen weiter und erreichten die Stallungen. Von hier konnte Dshirah über die Ebene laufen, ohne von der Stadt aus gesehen zu werden.
«Kann ich deine Sandalen haben?», fragte sie. «Es ist doch besser als nichts, und mein rechter Fuß tut mir weh. Kein Kind in Al-Cúrbona ist das Barfußlaufen so wenig gewöhnt wie ich.»
«Natürlich kriegst du die Sandalen. Aber nicht zum Laufen. Ich gebe dir Dshalla.»
Dshirah blieb stehen.
«Das kannst du nicht wagen. Ich kann sie heute nicht mehr zurückbringen.»
«Du lässt sie einfach bei der Herde. Sie fällt zwischen den wilden Stuten nicht auf. Und morgen bringst du sie zurück.»
Zaiiras eigene Stute Dshallalalama hatte die gleiche helle Falbfarbe wie die halbwilden Sorraia-Pferde, nur nicht die dunklen Querstreifen an den Beinen.
«Das geht», überlegte Dshirah, «Januão zählt die Herde immer schon auf dem Heimweg. Wenn da hinterher eines mehr ist, merkt das keiner. Und sie ist tragend, ja? Du bist sicher? Wir haben den Hengst.»
«Umso besser. Wenn sie noch nicht tragend ist, wird er sie decken. Er ist doch ein Vollblut.»
«Danke», sagte Dshirah. «Dann komme ich auch nicht gar so spät heim. Meine Eltern haben es nicht gern, wenn ich in der Stadt bin. Du weißt jetzt, warum.»
Dshallalalama war zusammen mit den anderen Stuten der Al-Antvaris im Sandauslauf. Sie langweilte sich und kam sofort, als sie die Mädchen sah. Zaiira legte ihr ein leichtes Schnurhalfter an. Das genügte Dshirah zum Reiten. Dann tauschten sie die Schuhe. Noch einmal hielt Zaiira einen von Dshirahs Füßen zwischen den Händen, die genauso heftig zitterten wie Dshirahs Fuß und Stimme, als sie wieder und immer wieder sagte: «Es ist nichts Besonderes. Es ist gar nichts Besonderes. Ich bin deine ganz gewöhnliche Freundin. Das einzige Besondere ist, dass ich ein Hirtenkind bin, und du bist eine Fürstentochter.»
Dann schloss sie die Schnalle der Sandalen. Die gelben Stiefel lagen noch am Boden, Zaiira hatte keinen Grund, ihre Füße zu verbergen. Dshirah schlüpfte aus dem Generalshemd. Sie führten die Stute zu dem Stein, den man zum Aufsteigen benutzte, und Dshirah sprang auf Dshallalalamas Rücken.
«Es stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe», flüsterte sie. Dabei legte sie den Kopf an Dshallas Hals, so tief, dass sie fast Zaiiras Stirn berührte. «Das wirklich Besondere an unserer Freundschaft ist – ist –, dass du mir hilfst, auch wenn es für dich gefährlich ist. Zaiira, wenn irgendjemand erfährt, dass du es weißt …»
Zaiira nickte. Ihr dunkles Haar streifte Dshirahs Stirn. Sie führte die Stute durch den Torbogen hinaus ins freie Feld. Beide Mädchen blickten über das Gelände.
«Silbão ist längst nach Hause gegangen», sagte Dshirah.
«Jetzt reite!» Zaiira ließ ihr Pferd los. Dshirah zögerte.
«Zaiira», sagte sie, «jedes Mal, wenn ich dich grüße, werde ich jetzt denken: Ich danke dir, meine Freundin, ich danke dir.»
Und sie drückte der Stute die Schenkel in die Seite. Sie drehte sich nicht mehr um. Es war kein schwerer Abschied von der Freundin. Sie glaubte ja, dass sie sich bald wiedersähen.
Obwohl sie einen Umweg reiten musste, würde sie viel schneller sein als zu Fuß. Auf geradem Weg zu ihrem Elternhaus führte nur ein schmaler Steg über den Fluss. Da kam man mit einem Pferd nicht hinüber. Sie musste den Fluss überqueren, wo das Wasser niedrig war. Also lenkte sie die Stute nach Nordwesten. Nur einmal schaute sie nach rechts, sah in der Ferne an dem Steg einen Reiter stehen, wunderte sich kurz: Was wollte der Mann da mit einem Pferd? Aber dann sprang Dshalla die Böschung hinunter und sie konnte den fremden Reiter nicht mehr sehen.
Sie genoss den Ritt über die weite Ebene wie niemals zuvor. Sie saß auf einem Vollblutpferd, einem echten Vollblutpferd, und es war nicht irgendeines, es war Zaiiras. Sie hielt die dünnen Lederzügel mit der Rechten, das Handgelenk der Linken aber legte sie an ihre Schläfe, dahin, wo die Haut am dünnsten war. An dem Handgelenk hatten Zaiiras Finger den Puls gefühlt, bis ihre Herzen wie ein einziges doppeltes schlugen. Und sie ritt Zaiiras Pferd. Sie war so glücklich, dass sie nicht aufhören konnte, glücklich zu sein, als sie vor dem kleinen weißen Haus ihrer Eltern elf fremde Pferde sah. Die standen dort mit hängenden Zügeln und dem Zeichen der Polizei auf der Satteldecke. Sie waren nicht angebunden, sie standen und rührten sich nicht, als Dshirah an ihnen vorbeiritt. Das waren vorzüglich erzogene Pferde hoher Polizeioffiziere. Und Dshirah war so glücklich, dass sie immer noch keine Angst hatte.
Aber sie ritt um das Haus herum und mied den Eingang.
Elf. Elf Polizeioffiziere im Haus ihrer Eltern? Manchmal kam einer, um die Fohlen des letzten Jahres zu prüfen, denn die Polizei ritt immer Halbblüter, deren Mütter halbwilde Sorraia-Stuten waren und der Vater ein Vollbluthengst aus dem Stall des Kalifen. Aber elf ! Was konnte so wichtig sein, dass die auf einmal zu einem Pferdehirten kamen? Und elf war eine Zahl, die im ganzen Land gemieden wurde. Die Lieblingszahl des Kalifen war zwölf. Am Steg, dachte sie, der zwölfte Reiter steht am Steg.
Sie sprang vom Pferd. Run, Lont und Moia kamen ihr entgegen, die drei Hirtenhunde ihrer Familie, groß, gelb, mit langem, feinem Haar und mit einer schwarzen Maske im Gesicht, auch Beine und Schwanzspitze waren schwarz. Nur die Pferdehirten hatten solche Hunde, die eigentlich Windhunde waren aus dem Zwinger des Kalifen für die Jagd. Alle drei kamen lautlos, still – kein Bellen, kein Fiepen, kein wildes Begrüßen wie sonst, wenn sie Dshirah sahen. Run, die Jüngste, wedelte heftig mit dem Schwanz und hechelte, die anderen taten nicht einmal das. Also hatten ihr Bruder oder ihre Mutter oder ihr Vater den Befehl: «Still allem!!!», gesprochen. Die Hunde waren so gut erzogen wie die Pferde der Polizeioffiziere. Run leckte Dshirahs Hand und konnte gar nicht damit aufhören. Dshirah streichelte sie und band Dshallalalama an der Rückseite des Hauses an. Sie stieg durchs Fenster in das Zimmer, das sie sich mit ihrem Bruder teilte – und schaute in Silbãos dunkle, vor Schreck und Angst so weit aufgerissene Augen, dass sogar dieses Gesicht nur noch verzerrt und gar nicht mehr schön war.
Flucht ins Gefängnis
Silbão legte eine Hand auf seinen halb offenen Mund und stellte sich vor die Tür, die zum Patio führte. Er schaute auf Dshirahs Füße. Die Sandalen verdeckten die äußeren Zehen, ließen die mittleren frei, und nur wer genau hinsah, konnte erkennen, dass es hier nicht drei, sondern vier mittlere gab. Silbãos Hand fiel herunter.
«Es ist wahr», hauchte er.
Dshirah schluckte.
«Wie – wie hast du es gemerkt?»
«Du musst fliehen», sagte er. «Sofort! Sie sind schon da. Sie dürfen es nicht sehen. Nie! Dann haben sie keinen Beweis.»
Dshirahs Herz überschlug sich. Es verlor den Takt, der in Zaiiras Hand gepocht hatte. Wer hatte sie verraten? Wer? Die Jungen! Es mussten die Jungen gewesen sein. Sie hatten es also doch gesehen. Bevor sie die Gefahr spürte, die jetzt ihrem Leben drohte, hatte sie Angst, ihr Glück zu verlieren, das Glück, das Zaiira hieß.
Nein!, dachte sie. Zaiira war es nicht. Die Zeit war ja auch viel zu kurz. Nein!
Der Gedanke beruhigte sie und sie konnte fragen: «Was ist geschehen?»
«Du bist über die Baustelle gelaufen. Du bist auf den Sand getreten. Mit dem – dem Fuß da. Die Arbeiter haben geschimpft. Und als sie deinen Fußabdruck wegharken wollten, haben sie es gesehen. Kirr hat verraten, wer du bist.»
Kirr! Ein Barde wie sie!
«Ich bin dir weiter nachgelaufen», fuhr Silbão fort. «Ich wollte dich warnen. Ich glaube nicht, dass so eine Spur im Sand ein Beweis ist. Du musst weg. Wenn sie dich nie sehen … aber ich weiß nicht, wohin? Weißt du wohin?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Der Kalif wird dich suchen lassen. Überall. Es gibt keinen Ort, wo er nicht suchen wird, wir müssen Januão fragen. Der ist klug. Ich bin nicht so klug.»
«Wo ist er?»
«Was? Was sagst du?»
Silbão konnte sie nicht mehr verstehen. Die Angst hatte angefangen, ihre Stimme zu zernagen. Sie schluckte.
«Wo ist er?»
«Im Patio. Ich glaube, ich kann ihn holen.»
Er öffnete die Tür einen Spalt. Geschützt vom Dunkel des Raumes blickte sie in den Hof und sah ihre Eltern an dem kleinen Brunnen sitzen. Das Gesicht der Mutter war so weiß wie der gekalkte Brunnenrand. Der Vater wandte ihr den Rücken zu. In dem kleinen Patio saßen die Polizeioffiziere, sie rauchten oder aßen Trauben, sie tranken Tee, sonst taten sie nichts. Sie warteten. Januão sah Dshirah nicht. Aber Silbão schien zu wissen, wo er war. Er schlüpfte durch den Türspalt und kam gleich darauf mit dem Freund zurück.
Die Geschwister schauten sich an.
Wie die sich anschauen konnten, die zwei! Es gab vielleicht im gesamten araminischen Reich keinen anderen Menschen, dem Dshirah oder Januão so gerade, so geradewegs in die Augen schauen konnten. Ihre Blicke passten zusammen. Sie hatten beide die gleichen weit auseinanderstehenden Augen. Es war, als seien ihre Augen nach außen gerutscht, an den Rand des breiten Gesichts, an die äußerste Grenze des menschlichen raubtierähnlichen Blicks. Ein wenig mehr noch und die Augen wären an der Seite gelandet, wie bei Pferden und Rindern und Hirschen, wie bei allen Tieren, die nicht jagen, sondern gejagt werden. Und zwischen den Augen war reichlich Platz für das strähnige helle farblose Haar, das ihnen von der Stirn fiel.
Manchmal aber brach Januão aus dem Geschwisterblick. Wenn er lautlos, tief im Innern, ein neues Lied sang, das er für sich und die Pferde spielen würde, dann verloren seine Augen jeden Blick. Er lief dann gegen den Tisch oder die Truhe oder die Tür, und seine Mutter Chomina musste ihm immer wieder sagen: «Vergiss das Schauen nicht. Verlern es nicht. Sonst wirst du noch blind.»
Januão war ein Jahr älter als seine Schwester, aber nicht größer, weil er so sehr kurze Beine hatte.
«Dir ist etwas eingefallen?», fragte Silbão. «Du weißt, wo wir sie hinbringen können?»
Januão nickte.
«En-Wlowa», sagte er, und Silbão wurde blass.
«Da geht niemand freiwillig hin.»
Januão zuckte die Achseln.
«Ich weiß kein anderes Versteck.»
«A-a-aber», wenn Silbão aufgeregt war, fing er immer an zu stottern, «aber ist es nicht besser, sie geht zu dem Kalifen? Du kannst so gute Geschichten erzählen. Warum erfindest du nicht die Siebte Sage?»
«Das haben schon viele versucht, aber noch nie haben die Richter und die Gelehrten so eine Geschichte als Siebte Sage anerkannt. Alle warten auf etwas – keine Ahnung auf was, ja, sie warten auf etwas, das sie nicht erwartet haben.»
Der Gedanke an En-Wlowa hatte Dshirah nur wenig erschreckt.
«Muss ich da lange bleiben?», fragte sie. «Ich kenne da niemanden.»
«Du musst bleiben, bis sie dich hier nicht mehr überall suchen. Dann hole ich dich und bringe dich übers Meer. Die Eltern kommen nach. Wir gehen alle nach Afrika. Die Mutter hat immer gewusst, dass dies eines Tages geschieht.»
Da erst erschrak auch Dshirah. Sehr!
«En-Wlowa», murmelte Silbão. «Oh, es ist schlimm. Wir kriegen sie rein, aber nie wieder raus.»
«Wir kriegen sie genauso raus, wie wir es immer mit dir gemacht haben», sagte Januão.
Silbão schüttelte heftig den schönen, störrischen Kopf.
«Ich habe immer gewusst, dass du am nächsten Tag um dieselbe Zeit die Pferde vorbeirufst. Wie soll sie das wissen, wenn sie Wochen da drin ist?»
«Indem du hineingehst, Silbão, und es ihr sagst. Wir brauchen dich.»
Dshirah erholte sich nicht von ihrem Schreck. Es war jedoch nicht En-Wlowa, was sie entsetzte. Sie kannte von dem Gefängnis des Landes nur die Blumenmauer. Es war der Gedanke an Afrika, der ihr alle Freude nahm.
«Wir gehen fort?», flüsterte sie.
Und sie dachte an Zaiira. Januão nickte.
«In der Wüste wissen sie nichts von den sieben Geschichten. Wir hätten längst gehen sollen. Mutter sagt, vor zwanzig Jahren ist ein bardisches Kind mit sechs Zehen da untergetaucht, ein Junge. Der Kalif hat es nie erfahren.»
«Es hat schon mal ein Kind mit sechs Zehen gegeben?» Dshirah wunderte sich. Ihr Bruder nickte: «Das ist gar nicht so selten in unserem Volk. Komm!»
Zum ersten Mal, seit das Unglück begonnen hatte, musste Dshirah weinen. Januão legte ihr die Hände auf die Schultern. Auch in ihre weinenden Augen passte Blick in Blick, denn auch in seinen standen Tränen.
«Wir werden dort keine Not leiden», versuchte er zu trösten. «Es gibt da wundervolle kleine Pferde. Ganz sicher folgen die mir so gut wie unsere hier. Und ganz gewiss brauchen sie dort einen Pferdepfeifer.»
Aber Dshirah schüttelte den Kopf.
«Du darfst dort barfuß gehen», versprach Januão, «und die Hunde können wir mitnehmen, und, Dshirah, du darfst dort eine Freundin haben, hörst du! Eine Freundin! Das war doch immer dein größter Wunsch.»
Er schloss die Augen, als er das sagte, und von Silbão hörten sie einen leisen Schluchzer.
«Ja», hauchte Dshirah, «ja.»
Januão ließ sie los.
«Wir gehen jetzt», sagte er.
Er holte aus der Kleiderkiste ein paar weiche geschlossene Lederschuhe, sie zog die Sandalen aus. Januão erstarrte.
«Wo hast du die her?», fragte er.
«Gestohlen», behauptete sie, «in der Schustergasse.»
«Gib her!»
Er drehte die Sandalen in seinen breiten, klotzigen Händen, von denen kein Fremder erwartet hätte, dass er damit Flöte spielte.
«Das ist gut», murmelte er. «Das ist gut.»
Er blickte auf, schaute seine Schwester an.
«Geh in dein Versteck!», befahl er.
«Mein Versteck!», rief Dshirah leise. «Ich kann doch einfach in meinem Versteck bleiben!»
Aber Januão schüttelte den Kopf.
«Nein! Da bist du nur sicher, solange dich Polizisten suchen. Polizisten sind dumm. Sie haben nichts zu tun. Die können nichts mehr, als ihre Pferde ausbilden. Morgen werden sie Soldaten schicken. Die finden dich dort. Geh.»
Sie stiegen beide auf die Truhe und schoben ein Brett in der Decke beiseite. Dann half er ihr in den doppelten Boden zwischen Decke und Dach. Da konnte sie nur liegen und warten, nichts sehen, aber hören. Doch es blieb still. Wie lange? Sie hatte hier manchmal liegen müssen. Zum Üben für den Notfall. Und jedes Mal war ihr die Zeit entsetzlich lang geworden.
«Im Notfall», hatte ihr Vater immer gesagt, «wirst du froh sein über jeden Herzschlag, den du da in Sicherheit bist.»
Sie war aber nicht froh. Es war eng und fast dunkel, nur durch die Ritzen der Bretter kam ein wenig Licht.
Ja, dachte sie, morgen kommen Soldaten, und die sind nicht dumm.
Polizisten galten als dumm in Al-Cúrbona. Es gab keine Mörder und keine Diebe im Land, fast nicht. Das lange Nichts-Tun hatte die Polizisten dumm gemacht.
Und dann hörte sie einen Schrei, einen Freudenschrei.
«Ich hab sie! Ich hab sie gefunden!»
Januãos Stimme.
«Was hast du gefunden?»
Das musste einer der Polizisten sein.
«Dshirahs Sandalen! Sie lagen beim Misthaufen. Dshirah lässt eben immer alles herumliegen.»
Es war eine Weile still. Dann hörte Dshirah den Polizisten.
«Und warum zieht sie in der Stadt keine Sandalen an? Der kleine bardische Junge hat gesagt, sie trägt nie Sandalen.»
«Sie geht doch erst seit zehn Tagen in die Schule.» Das war die Stimme ihres Vaters. «Sie wird schon noch mit Sandalen kommen.»
«Wir warten», bestimmte der Polizist. «Wir bleiben auf alle Fälle, bis sie nach Hause kommt.»
«Darf ich jetzt die Pferde reinholen?», fragte Januão.
Eine Antwort hörte Dshirah nicht, aber wenig später das leise Klopfen an dem losen Brett, das verabredete Zeichen. Sie schob das Brett beiseite.
«Diese Sandalen können uns retten», flüsterte Januão. «Jetzt schnell!»
Er drückte ihr die Lederschuhe in die Hand. Sie schlüpfte hinein, er verknotete die Bänder so fest wie die Mutter. Sie schaute zur Tür mit bittendem Blick.
«Nein!», er schüttelte den Kopf. «Du kannst dich nicht verabschieden. Du siehst sie erst in Afrika wieder.»
Sie kletterten aus dem Fenster. Silbão folgte, ohne zu fragen. Run stand sofort wieder neben Dshirah und leckte ihre Hand.
«Wo kommt das Pferd her?», fragte Januão.
«Ich habe es eingefangen», log Dshirah.
«Das ist ein Vollblut.»
«Ich weiß. Wahrscheinlich gehört es zum Haus Al-Antvari. Ich denke, der Reiter ist runtergefallen. Bring du es morgen zurück.» Januão nickte.
«Das hat dich gerettet», sagte er. «Am Steg über den Fluss steht ein Reiter und wartet auf dich.»
Er band die Stute los.
«Wir lassen sie bei unseren.»
Dshirah nahm ihm die Zügel aus der Hand. Sie legte Dshalla die Arme um den Hals, drückte ihr Gesicht in die dunkle Mähne, wühlte Stirn und Nase durch bis zu dem glatten gelben Fell, trocknete dabei ihre Tränen im feinen Mähnenhaar. Dabei legte sie der Stute eine Hand auf den Rücken. Morgen würde Zaiira wieder dort sitzen. Drei Herzschläge lang fühlte sie sich noch einmal, ein letztes Mal, der Freundin nah, so nah. Und Run stand hinter ihr und leckte ihre Kniekehlen, die ganze Zeit.
«Komm jetzt», flüsterte Januão und tippte leicht auf ihre Schulter.
«Ich muss ihr danken», sagte Dshirah. «Sie hat mich doch gerettet.»
Und sie ließ Januão nicht merken, dass sie nicht die Stute, sondern Zaiira meinte. Ihre Hände flatterten über Dshallas Brust und Hals, über Ohren, Stirn, Nüstern, sie konnte nicht aufhören zu streicheln, zu klopfen, überall da, wo Zaiiras Hände dieses Fell berührt hatten und wieder berühren würden. Und dann hätte sie eigentlich das Gesicht wieder in die Mähne drücken müssen, denn sie hatte sonst nichts, um die Tränen zu trocknen, aber Januão zog sie weiter. Er holte seine Flöte aus dem Schuppen, hängte sie sich um den Hals. Dshirah sah, dass er weinte. Er wählte drei Pferde und vier Halfter aus, gab Dshirah das vierte Halfter, er berührte dabei ihre Hand und hielt sie fest, das wäre nicht nötig gewesen. Dshirah verstand, dass dies ein Abschied war.
Run war ihnen nachgelaufen und wich nicht von Dshirahs Seite.
«Nieder!», befahl Januão leise, aber scharf, und er hob den Arm, als schwinge er eine Peitsche. «Nieder! Hart Leder sonst droht!»
Die Hündin zuckte zusammen und kauerte winselnd am Boden. Sie hatte diese schlimme Drohung aus Januãos Mund noch nie gehört. Dshirah wollte sich zu ihr setzen und sie trösten, aber sie hatte verstanden, was sie zu tun hatte.
Silbão saß als Erster auf dem Pferd. Er konnte am besten aufspringen, und das war gut so, denn er fiel am häufigsten hinunter. Dshirah und Januão führten ihre Pferde zu einem Stein und kletterten hinauf.
«Du erklärst ihr alles», sagte Januão zu seinem Freund, wendete sein Pferd nach Nordwesten und trabte davon, ohne Dshirah noch einmal anzusehen. Die wusste sofort, sie würde ihn so bald nicht wiedersehen. Nur hören. Sie schaute noch einmal auf ihr Haus, auf die Stallungen. Dann presste sie die Augen fest zu. Das Letzte, was sie von ihrem Zuhause wahrnahm, war Run, ein schwarz-gelber zitternder Fleck vor dem Stall.
Sie ritt mit Silbão nach Südwesten. Als sie sich ein einziges Mal umdrehte, war ihr Bruder nur noch ein kleiner Punkt in der Ferne. Silbão hielt sich mit einer Hand in der Mähne fest, führen musste Dshirah.
«Wir suchen die Herde?», rief sie ihm zu.
Er nickte.
Sie fand die Zuchtstuten schnell. Es ging auf den Abend zu, und die Herde war schon auf dem Heimweg. Es waren 24 Sorraia-Stuten, alles Falben. Sechs hatten schon ihre Fohlen geboren, dunklere, wollige Körperchen sprangen auf endlos langen Beinen um sie herum. Es führte sie Je-ledla, die alte Leitstute, es trieb sie von hinten ein weißer Vollbluthengst aus dem Stall des Kalifen. Dshirah ritt auf ihre alte Freundin Je-ledla zu. Auf ihr hatte sie reiten gelernt. Um den Hengst kümmerte sie sich nicht. Er würde folgen. Sie legte Je-ledla das Halfter an.
«Wohin?», fragte sie.
«Ich mache bestimmt alles falsch», sagte Silbão.
«En-Wlowa liegt ungefähr da», Dshirah zeigte nach Norden.
Silbão nickte: «Ja, aber wir müssen nach Westen.»
Dshirah ritt mit Je-ledla voraus. Die Herde folgte. Schon stand die Sonne am westlichen Himmel, aber noch hoch, sie zeigte keine rötliche Färbung. Es ging leicht abwärts, der Weg wurde steiniger, nah im Norden sahen sie den flachen Hügelzug, hinter dem En-Wlowa liegen musste. Plötzlich fiel Dshirah mit einem jähen Schrecken ein, dass sie sich freuen musste. Sie hatten bestimmt schon mehr als die Hälfte des Weges hinter sich, und sie hatte sich noch nicht ein kleines bisschen daran gefreut. Es war so wichtig, dass sie sich freute. Denn dies war ihr letzter Ritt auf einem Sorraia-Pferd.
In Afrika gibt es Pferde, hatte Januão gesagt.
Kleine, hatte Januão gesagt.
Sorraias gab es da offenbar nicht.
Ich muss mich freuen, dachte Dshirah, jetzt, schnell!
«Oh, wir müssen traben!», rief Silbão. «Wir müssen schneller sein als sonst. Ich muss dir ja noch alles erklären. Los!»
Er stieß seinem Pferd die Hacken in die Seite. Das machte einen Satz und hätte er nicht die Hand in der Mähne gehabt, wäre er hinuntergefallen.
Dshirah trabte an. Je-ledla lief ruhig neben ihr.
«Schneller!», rief Silbão. «Sonst fängt Januão an zu pfeifen und du weißt nicht wohin!»
Sie ritten der Sonne entgegen.
Freuen!, dachte Dshirah, ich muss mich freuen.
Sie schaute zurück. Hinter ihr wogten die Rücken der hellen Pferde wie ein gelber Fluss. Sie trabten, nur der Hengst – eine weiße Schaumkrone am Schluss – galoppierte. Er war ein ausgebildetes Reitpferd und beherrschte den langsamen Galopp. Dshirah beugte sich nach rechts und legte Je-ledla eine Hand auf die dunkle Mähne hinter den Ohren. Nie wieder würde sie dieses Pferd berühren. Nie wieder eines, das so ähnlich aussah.
«Da!», rief Silbão. «In die Senke.»
Jetzt verstand Dshirah, warum ihnen die Pferde so willig gefolgt waren. Die Senke war voller Silbergras. So nannten sie die langen, dünnen Halme, weil sie von einer Seite silbrig schimmerten. Alle Pferde liebten Silbergras. Da würden sie bleiben, bis Januão sie rief, obwohl daheim am Stall ihre salzigen Lecksteine auf sie warteten. Dshirah zog Je-ledla das Halfter über die Ohren. Nun musste sie auch die Stute gehen lassen. Sofort hatten alle Pferde ihre Nasen im Gras, nur die Fohlen ließen sich von den dünnen Halmen die Nüstern kitzeln. Dshirah und Silbão aber ritten davon, jetzt auf die Hügelkette zu. Sie folgten einem kleinen Bach, der von den Bergen kam und der am Fuß des Hügels in einer Höhle verschwand. Dort nahm Dshirah Je-ledlas Halfter auseinander und fesselte damit ihren beiden Pferden die Vorderbeine. Sobald die Januãos Pfeife hörten, würden sie versuchen, dem Ton zu folgen. Silbão kletterte schon den Hügel hinauf. Dshirah folgte.
«Wart mal», rief sie ihm leise nach. «Du musst nachher mit den Pferden zu Januão. Kriegst du sie über den Bach?»
Silbão nickte: «Mach ich immer!»
Verborgen hinter Felsen und Sträuchern schauten sie hinüber auf die Blumenmauer von En-Wlowa, mitten darin drei Blumentore, darunter je zwei Wächter in roter Uniform, bewaffnet mit Speer und Pfeil und Bogen, stehend neben ihren gesattelten Pferden.
Silbãos Unterlippe zitterte.
«Nicht stottern jetzt», sagte Dshirah und griff nach seiner Hand. «Du musst mir nun erklären, was ich tun soll.»
Er nickte, presste die Lippen zusammen, aber als er sie wieder öffnete, zitterten beide, und alles, was er schließlich herausbrachte, war: «I-i-i-ich mache alles falsch.»
Dshirah versuchte zu fragen.
«Januão wird gleich die Pferde rufen?»
Er nickte.
«Die Wächter werden ihre Pferde halten müssen. Oder die werden ihnen durchgehen. Und dann soll ich da irgendwie rein?»
Er nickte.
«Man kann durch die Mauer?»
Er nickte.
«Wo?»
Er zeigte nach Westen.
«Also», flüsterte Dshirah, «also laufe ich los, wenn die Herde dort vorbei ist?»
«Ja.»
Dshirah hielt den Atem an, immerhin, ein Wort hatte er wieder herausgebracht. Sie wartete, dass er weitersprach.
«Du musst nur hinter die Blumen. Da. Die hängen da runter. Dann sehen sie dich nicht mehr. Dann musst du gucken und das Loch finden. Aber schnell! Sonst bringen sie dich um.»
«Warum rennen die da drin dann nicht alle weg?»
«Sie rennen. Aber sie kommen nicht weit. Wenn die wegrennen, dürfen die Wächter sie erschießen. Januão sagt, das soll so sein. Wenn sie nicht immer mal welche erschießen, wird es da drin zu voll. Ist schon voll.»
«Was soll ich machen da drin?»
Silbão zuckte die Achseln.
«Warten. Bis wir dich rausholen. Sie kriegen zu essen.»
Er kroch auf dem Boden herum, hielt sich verdeckt von dem niedrigen Strauch, er hob kleine Steine auf, ließ sie fallen, behielt einen spitzen mit scharfer Kante.
«Komm!»
Er zog sie zu sich heran, säbelte mit dem Stein an dem Hirtenzeichen auf ihrer Schulter herum, bis er eine Ecke gelöst hatte, da riss er es ab.
«Jetzt siehst du aus wie die anderen. Nur dicker.»
«Ich habe Angst.»
Er nickte.
«Du gehst zum letzten Haus nach Nordosten, da fi-fi-fi-»
«Silbão!»
Sie schrie zu laut, sie wusste es. Sie packte seine Schultern und schüttelte ihn. Manchmal, wenn die Worte in ihm stecken blieben, konnte man sie herausschütteln.
«Ma-ma-ma-ma-meine Schwester. Du erkennst sie, man erkennt sie immer noch.»
Jetzt zitterte Dshirahs Unterlippe. Silbãos Schwester war seit fast zwei Jahren verschwunden.
«Deine Schwester?», fragte sie. «Ist die da? Da ist sie?»
Aber Silbão konnte nicht mehr reden. Er öffnete den Mund. Sie sah, wie seine Zunge darum kämpfte, Laute zu formen, er fasste sich an den Hals, aber er stieß nur tonlose Luft heraus, würgend, als hätte er eine Fischgräte in der Kehle.
Da hörten sie aus der Ferne einen langen, leisen, klagenden Ton. Sie wandten die Gesichter nach Osten. Dshirah schloss die Augen. Alles, was ihr Bruder spielte, erkannte sie am ersten Ton. Dies war sein traurigstes Lied. Wie hätte es auch anders sein können. Januão spielte Flöte, seit er das Instrument halten konnte, aber er hatte bis jetzt nicht gelernt zu spielen, was andere von ihm forderten. In seine Flöte floss immer, was er im selben Atemzug spürte. Dieses Lied hatte Dshirah zum letzten Mal gehört, als ihr winziges Schwesterchen vor zwei Jahren starb. Silbão stieß sie an und drehte ihren Kopf zur Blumenmauer. Auch die Wächter schauten nach Osten, alle. Ihre Pferde fingen an zu tänzeln. Und nun hörten sie von der anderen Seite das Wiehern des Hengstes. Es klang nicht schrill wie sonst, wenn er seine Stuten trieb, es klang dunkel wie die Töne aus den langen Holzröhren, die in manchen Patios hingen. Noch niemals hatte Dshirah ein solches Wiehern gehört. Auch die Wächter wandten den Kopf. Nun blickten sie gerade in die untergehende Sonne. Dshirah erkannte den Plan ihres Bruders: Die Wächter hatten nicht nur mit ihren unruhigen Pferden zu kämpfen, sie schauten auch der Herde entgegen und würden von der Sonne geblendet sein.
Silbão hatte den Kopf auf die Knie gelegt und die Hände über die Ohren gepresst. Dshirah starrte entsetzt auf die schwarzen Locken, die durch seine Finger quollen. Er musste ihr noch so viel erklären, und er brachte kein Wort mehr heraus. Da schlug die Angst wie schwere Pauken in ihrem Kopf und übertönte die Flöte.
«Silbão!» Sie packte und schüttelte ihn. «Was soll ich tun da drin? Und wie, wie komme ich wieder raus?»
Er blickte auf. Sein Gesicht schien zerstört, schief hing sein Mund und die Augen wirkten blöde. Sie schüttelte ihn. Aber es hatte keinen Sinn. Es sah aus, als ob dieser Junge noch niemals hätte sprechen können.
«Wo finde ich deine Schwester?»
Er zeigte nach Nordosten. Auch sein Arm zitterte. Da kamen die Pferde.
Man hörte sie kaum. Der Boden war sandig. Ihre unbeschlagenen Hufe machten fast kein Geräusch. Und immer wenn Januão spielte, wurden ihre Körper leicht wie Federbälle. Nur zögernd lösten sich die gelben Leiber der Stuten wie große goldene Tropfen aus der Sonne und flossen weiter über die Ebene. Dshirah konnte Je-ledla nicht mehr erkennen, denn es gab keine einzelnen Pferde mehr. Sie waren eine schwebende Schar von Wesen, die vielleicht von einem anderen Stern auf die Erde gefallen waren. Eine alte Geschichte erzählte, so seien Pferde entstanden.
Die Paukenschläge! Die trommelnde Angst! Das Einzige, was Dshirah retten konnte, war die laut lärmende Panik in ihrem Kopf. Wenn sie hier weiter lauschte und schaute, kam sie niemals nach En-Wlowa. Aber die Pauke war nur noch ein sanftes, tiefes Beben im Bauch, über dem hoch in der Luft Januãos Flöte schwebte. Auch Silbão neben ihr hatte wieder sein schönes Gesicht, nicht jedoch seine Sprache gefunden. Vier der Wächter hielten ihre tobenden Pferde am Zügel. Zwei waren aufgesessen, hatten aber die Speere verloren, ihre Pferde mischten sich unter die Sorraia-Stuten, weiße Flecken im gelben Fluss und darüber das Rot der Uniform. Von der anderen Seite des Hügels schrien die beiden gefesselten Reitpferde, im Osten ein einzelner Reiter. Die Musik wurde lauter.
Da sagte, klar und deutlich, Silbão ein einziges Wort: «Jetzt!»
Das war ein Befehl.