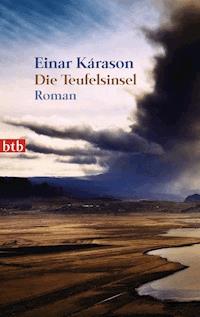7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Baracken-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Die Familiesaga aus dem Wilden Norden geht weiter: Inzwischen schreiben wir die siebziger Jahre, und wieder begegnen wir unseren Freunden von Camp Thule, dem Baracken- und Glasscherbenviertel in Islands Hauptstadt Reykjavík, allen voran Lina, der Wahrsagerin, und Tommi, dem Krämer. Ihr altes Haus wurde platt gewalzt, doch mit der halsstarrigen Lebensfreude seiner Bewohner wird kein Bulddozer fertig. Es sind Menschen, die mehr von Marlon Brando als von der Edda halten, schonungslos modern, unerhört findig und nie um eine Antwort verlegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel »Fyrirheitna landið« im Verlag Mál og menning, Reykjavík.
Wiederveröffentlichung Juli 2011, btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 1989 by Einar Kárason
Published by agreement with Forlagið, www.forlagid.isCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: semper smile, MünchenUmschlagmotiv: © Julian Calverley / CorbisSatz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, BerlinRK · Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-06782-3V002
www.btb-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Die Familiensaga aus dem Wilden Norden geht weiter: Inzwischen schreiben wir die siebziger Jahre, und wieder begegnen wir unseren Freunden von Camp Thule, dem Baracken- und Glasscherbenviertel in Islands Hauptstadt Reykjavík, allen voran Lina, der Wahrsagerin, und Tommi, dem Krämer. Ihr altes Haus wurde plattgewalzt, doch mit der halsstarrigen Lebensfreude seiner Bewohner wird kein Bulldozer fertig. Es sind Menschen, die mehr von Marlon Brando als von der Edda halten, schonungslos modern, unerhört findig und nie um eine Antwort verlegen.
EINAR KÁRASON, geboren 1955, ist einer der wichtigsten skandinavischen Autoren der Gegenwart. Berühmt wurde er durch seine Trilogie »Die Teufelsinsel«, »Die Goldinsel« sowie »Das Gelobte Land«. Sein Roman »Sturmerprobt« stand auf der Shortlist des Nordischen sowie des Isländischen Literaturpreises. Für »Versöhnung und Groll« erhielt er den Isländischen Literaturpreis. Kárason lebt in Reykjavík.
EINAR KÁRASON BEI BTB: Versöhnung und Groll. Roman Sturmerprobt. Roman Feindesland. Roman
TRILOGIE AUS DEM WILDEN NORDEN: Die Teufelsinsel. Roman Die Goldinsel. Roman Das Gelobte Land. Roman
GEWIDMET MEINEM FREUND KVASI
17. Mai 1984
31. Juni 1989
Amerikanische Nacht
Wir waren im Gelobten Land gelandet, und ich blickte mich neugierig und mit großen Augen um, doch ich sah vor allem Wände. Überall hingen Schilder mit verschiedenen Vorschriften, und eines von ihnen verbot das Spucken. No spitting.
Ich gelangte unbehelligt durch die Passkontrolle am Kennedy-Flughafen, aber Manni, mein Reisegefährte, geriet in Schwierigkeiten. Man hatte uns in der Botschaft zu Hause Anträge ausfüllen lassen, in denen wir angeben mussten, ob wir unter Geschlechtskrankheiten litten, drogenabhängig waren, an den Judenverfolgungen teilgenommen hatten oder Mitglieder einer kommunistischen Vereinigung waren. Manni bejahte diese letzte Frage; er war irgendwann in seinen Jugendjahren ein paar Mal zu Versammlungen der Maoisten gegangen. Damals hatte er gerade aufgehört, die Bahai-Gemeinde zu besuchen, und angefangen, mit der Philosophischen Gesellschaft zu liebäugeln. Er bekam nur irgendeinen vorläufigen Stempel in seinen Pass wegen dieser Sache mit den Maoisten und musste sich auf dem Weg durch das Goldene Tor in die Vereinigten Staaten dafür rechtfertigen. Versuchte dabei, einen Gesichtsausdruck zu zeigen, als sei er persönlicher Verfolgung ausgesetzt, sehr stolz auf seine Wichtigkeit. Männern des Geistes wird überall mit Misstrauen begegnet. Wir anderen sind allen egal.
Wir fuhren mit der Subway hinein nach Manhattan und waren zufrieden mit uns selbst, weil wir unterwegs weder verprügelt noch ausgeraubt worden waren. Nervös hielten wir uns an den Griffschlaufen fest und sahen uns dauernd mit ängstlichen Blicken um. Äußerst glücklich, unseren Bestimmungsort erreicht zu haben, checkten wir uns im Hotel ein. Ich sprang unter die Dusche, während Manni anfing, herumzusuchen und überall zu kramen, wo doch nichts Besonderes zu finden war.
Wir hatten uns fest vorgenommen, meine Oma hier in Amerika zu besuchen. Die Oma Gógó. Eine Frau, die ich vielleicht nie gekannt hatte. Sie wohnte weit landeinwärts, ein- oder zweitausend Kilometer weit weg, in der Nähe des Großen Stromes. Ich hatte den Namen eines Dorfes oder Bezirks aus einem Brief bei mir, den sie Uroma vor mehr als einem Jahr geschickt hatte; das war nun nicht sehr genau und die Alte immer auf Achse. Aber Bóbó, mein Halbbruder, war auch hier, und der würde uns vielleicht helfen; ich hatte seine Telefonnummer und irgendeine Adresse in New York. Ich rief gleich an, als ich aus dem Bad kam, mit einem Handtuchturban auf dem Kopf. Aber keiner ging bei ihm ans Telefon.
– Das fängt ja nicht sehr vielversprechend an, sagte Manni, und begann, vor sich hinzuseufzen und zu stöhnen. Er hatte seine Schatzbriefe verkauft und größtenteils die Tickets für uns beide bezahlt. Manni hatte große Zweifel, ob dieses Geld gut angelegt war. Aber es gab keinen Grund, sofort alle Hoffnung aufzugeben, also breiteten wir einen Plan des Stadtzentrums auf dem Fußboden aus. – Hier sind wir, Kreuzchen. Direkt neben dem Pan Am-Gebäude. Die Straßen sind alle nummeriert wie die Gräberreihen auf einem Friedhof. Wir beschlossen, zum Broadway hinunterzugehen.
Der Geruch von Leuten lag in der Luft; ein Geruch von Leben, vermischt mit Autoabgasen und dem Duft von heißem Frittierfett. Die Häuser waren so groß, dass wir sie gar nicht wahrnahmen. Auf allen Seiten waren nur Wände, und darüber der Himmel. Die Straße regennass, und Autos hupten durchdringend.
Wir sahen uns einige Schaufenster an, und Manni regte sich darüber auf, dass die Sachen hier überhaupt nicht billiger waren als zu Hause. Er hatte vorgehabt, ein winziges Tonbandgerät zu kaufen, Spionagewerkzeug zu Forschungszwecken. Schließlich fing er ein großes Geschrei vor den Ladenfenstern an und schüttelte immer und immer wieder den Kopf, als wir endlich weitergingen. Also kauften wir uns nur Schreibblöcke mit Spiralbindung und einfache Kugelschreiber, an einem kleinen Zeitungskiosk am Straßenrand; ich liebäugelte nämlich mit der Idee, mir zu bemerkenswerten Erlebnissen vielleicht ein paar stichpunktartige Notizen zu machen und dann einen Reisebericht für eine Zeitschrift oder eine Wochenendbeilage zu schreiben. Ich sah mich um und versuchte, mich zu orientieren und einen Überblick zu bekommen, aber alles war nur ein großes Durcheinander.
Dort war der Posttempel. Ionische Säulen oder dorische, an einem Prachtbau aus der Blütezeit des antiken Athen, und auf dem Giebel in riesigen Buchstaben U.S. Mail. Wir gingen die Marmortreppen zum Tempeleingang hinauf, setzten uns auf einen Sockel und sahen uns um. Auf der Straße unter uns hatte es einen Unfall zwischen zwei Taxis gegeben, und Schreien und Rufen drang von unten herauf. In dem Moment wurde mir mit der Spitze eines Schlagstocks auf die Schulter getippt, und ein Mann in Uniform stand dort. Auf den Treppen sitzen ist verboten. Wir standen auf und versuchten, Einwände vorzubringen, aber der Mann hörte uns gar nicht zu. Wartete einfach, bis wir unten auf dem Bürgersteig angekommen waren, dann verschwand er wieder im Tempel.
Ein schwarzer Typ mit Brille sah uns zweideutig und spöttisch grinsend an. Fragte, ob wir von der Treppe vertrieben worden seien. – Ja, sagte ich, so steht es um die Menschenrechte heute.
– It’s no human rights man, it’s human fuck ups, antwortete er. Streckte uns dann die Zunge raus und verschwand in der Menge.
Der Hunger meldete sich, und wir gingen in einen Hühnchengrill dort mitten in Manhattan. Alles aus Plastik, weiß und gelb; die Stühle, die Tische, die Wände, alles von einer Fettschicht überzogen. Auf beiden Seiten der Verkaufstheke standen mehrere Leute, doch der Verkauf lief stockend. Manni setzte sich an einen Tisch, und ich wollte etwas holen gehen, aber die Leute an der Kasse waren beschäftigt. Dann kam Manni, stellte sich neben mich und sagte, er habe Angst vor einem Typen, der zwischen den Tischen herumlief und bettelte. Der schien um die dreißig zu sein, groß und glatzköpfig, mit einem Verband um den Kopf. Mit langen Schritten ging er auf und ab, in ausgetretenen Lederstiefeln und einer löchrigen Felljacke und rempelte die Leute an. Geld wollte er. Wir wären hinausgeflüchtet, wenn sich nicht in diesem Augenblick eine schlecht gelaunte Verkäuferin zu uns umgedreht und uns gefragt hätte, was wir wollten. Zögerlich brachte ich es vor, aber da hörte sie gerade nicht hin, sondern war mit einem der anderen Angestellten in Streit geraten. Daher mussten wir warten, und schließlich wandte sie sich wieder uns zu und wiederholte ihre Frage, als ob sie nicht bereit sei, diese Sache noch lange mitzumachen.
Als wir uns mit unseren Leckereien endlich an einem der fettüberzogenen Tische niederlassen konnten, hatte der große Bettler angefangen, in dem Restaurant aufzuräumen, Papierteller und Servietten zusammenzufegen und in einen Müllsack zu schütten; dabei griff er auch Mannis und meinen Teller mit den noch unberührten Grillhühnchenteilen und warf sie einfach in den Müll. Er tat es trotz Mannis Protest. So dass wir uns verzogen, genauso hungrig wie zuvor, bitter und beleidigt.
Bóbós Adresse lag in Manhattan. Manni und ich fanden uns mittlerweile in diesem einfachen Straßengittersystem der Stadt zurecht und sahen, dass es gar nicht so weit war, dorthin zu laufen. Außerdem war es sehr belebend, wieder an die frische Luft zu kommen, und wir zogen los.
– Ob das nicht teuer ist, in Manhattan zu wohnen?, fragte Manni. – Bóbó muss wohl irgendwelche Einnahmen haben?
Ich war mir nicht sicher. Hatte zuletzt von ihm gehört, als er vor zwei Monaten in Island anrief und mich bat, ihm das Geld zu schicken, das er als Behindertenrente bekam, weil eines seiner Beine von Geburt an kürzer war als das andere. Er schien irgendwie davon zu leben, dass er Billard spielte, aber was bedeutete das?
Der kurze Weg war länger, als wir gedacht hatten, und der Weltstadtglanz verblasste langsam, je länger wir gingen. Die Häuser wurden baufällig, und an einer Stelle stieg schwarzer Rauch aus einer lichterloh brennenden Mülltonne in einem Durchgang zwischen den Häusern auf. Als ob nichts natürlicher wäre. Langsam überkamen uns Zweifel, ob es richtig wäre, sich noch weiter in dieses Gebiet hineinzuwagen, aber da waren wir schon beinahe bei seinem Haus angekommen. Und hier stand es also, ein schäbiges, zweistöckiges Backsteinhaus, irgendwann zu Urzeiten das letzte Mal verputzt.
Wir wollten die Treppen hoch und anklopfen oder klingeln, aber ein Kerl mittleren Alters saß in einem schmutzigen Unterhemd auf einem Küchenstuhl vor dem Haus und trank Bier. Hässlich, unfrisiert und bösartig. Scharf und heiser fragte er, wohin verdammt noch mal wir wollten.
Wir versuchten zu erklären, wo wir hinwollten, klar und höflich, aber für ihn war es ausgeschlossen, dass wir uns dort irgendwo auf den Treppen herumtrieben. – Kommt nicht in Frage! Nein, dort wohnt kein Bóbó. Noch viel weniger ein Halldór Halldórsson. Und wir waren erstaunt und verwirrt, begannen, von einem Bein auf das andere zu treten und hätten uns sicher davongemacht und wären wieder gegangen, wenn wir die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Doch dann wurde der Kerl freundlicher, sagte, dass allerdings ein Bursche aus Island dort wohne, ein Mr. Jónsson, Student. Und manchmal sei ein Gast bei ihm; wahrscheinlich der, nach dem wir suchten. Einer, der hinkt.
– Nein, die sind im Moment nicht da. Und ich weiß auch nichts über sie! Dann stand der Kerl auf und sagte, dass es Mr. Jónsson verboten sei, Gäste zu empfangen.
– Wieso, war denn Bóbó nicht zu Gast bei ihm?, fragte ich, aber der Kerl antwortete nicht. Er war auf dem Weg die Treppe hinauf, selbst mit einem steifen Fuß.
Ich erreichte Bóbó am Abend telefonisch. Er war kurzangebunden und ein wenig mürrisch, aber das ist er immer am Telefon. Als ob er genug hätte von diesem Geschwätz. Trotzdem fand er freundliche Worte und lobte uns für unsere Energie und unseren Unternehmensgeist, uns einfach aufzumachen und über den großen Teich zu kommen. – Ihr seid mir die Richtigen. Und Manni auch? Der hat wohl eine Freikarte bekommen?! Nein?
Er sprach, als ob wir kleine Kinder wären, das fiel mir erst auf, nachdem ich schon aufgelegt hatte. Man hätte ihn vielleicht darauf hinweisen sollen, dass wir drei Jahre älter waren als er. Aber er war hier zu Hause, und er wollte uns auf alle Fälle treffen; unsere Verabredung war ziemlich umständlich. Um zwei Uhr nachmittags auf einer Bank im Central Park; eine bestimmte Bank, die wir nach einem komplizierten System zu finden hatten. Ich schrieb mir die Anweisungen stichpunktartig in meinen neuen Schreibblock, leicht fahrig, und Bóbó fragte:
– Hast du das alles mitgekriegt, Kleiner, oder spreche ich zu schnell?
Am nächsten Morgen erwachten Manni und ich ausgeschlafen um halb sechs. Da war für uns einfach der neue Tag gekommen; wir hatten uns noch nicht an den Zeitunterschied gewöhnt. Gegen sechs machten wir einen Spaziergang durch die morgenbetauten Straßen, und Manni sagte, wir seien so früh auf den Beinen, dass sicher alle glaubten, wir seien Bäcker.
Trotzdem waren wir zu spät dran, als wir aufbrachen, um Bóbó im Park zu treffen, und wollten Zeit sparen, indem wir ein Taxi nahmen für diesen viertelstündigen Fußweg von unserem Hotel zum Central Park. Aber das Auto, gelb und verbeult, war eine Dreiviertelstunde unterwegs. Steckte andauernd im Stau und fuhr dann wieder einige Meter am Stück, während der Fahrer Selbstgespräche darüber führte, wie blöd doch die anderen Autofahrer waren. Es war schon nach halb drei, als wir endlich den Park erreichten und begannen, uns nach den Anweisungen, die wir bekommen hatten, durchzuschlagen.
Und dort saß mein Bruder Bóbó. So richtig nett und schön zurechtgemacht, in einem Anzug mit Weste. Ich bekam das Gefühl, dass er uns schon aus weiter Ferne gesehen hatte, aber versuchte, sich nichts anmerken zu lassen; so tat, als ob er völlig versunken sei in seine große Zeitung, mit zum Pfeifen gespitztem Mund. Wie zufällig sah er auf, als wir schon vor ihm standen, hob die Augenbrauen und sagte:
– Grüß dich, Kleiner!
Ich reichte ihm die Hand und sagte: – Ásmundur Grettisson, Bäcker.
Manni stellte sich vor als Hermann Þórgnýsson, Bäckermeister. Er musste immer noch eins draufsetzen.
Wir beschlossen, in eine Kneipe zu gehen, und fanden ein kleines italienisches Restaurant, eine Pizzeria mit fünf Tischen, die alle leer waren. Wir bestellten drei Budweiser, die Manni sofort auf Budenweiser umtaufte. Er war äußerst zufrieden mit diesem Namen und dem Leben allgemein; kam langsam in Stimmung und schlug Bóbó auf die Schulter und sagte, es wäre großartig von ihm, sich mit uns zu treffen, und ob es ihm gutginge? Aber Bóbó verzog nur etwas den Mund und wischte die Stelle an seiner Jacke ab, an der Manni seine Pfoten gehabt hatte, und sagte, er lese immer noch ohne Brille, falls es das sei, was er meine. Er war ungeheuer selbstsicher. Verdammt, bist du toll zurechtgemacht und eklig, sagte ich, und er antwortete lässig: – Das gehört zum Fach.
Er hatte zugenommen und begann an den Schläfen bereits zu ergrauen, nur sechsundzwanzig Jahre alt. Hatte silberne Strähnen im dunklen, zurückgekämmten Haar. An einem Finger trug er einen Ring, und er hatte die Unart, damit dauernd an das Glas auf dem Tisch zu klopfen; ließ den Ring andauernd klinkern, das schien der einzige Überrest dieses empfindlichen und nervösen Charakters zu sein, als den ich ihn mein ganzes Leben gekannt hatte.
Doch Manni war in äußerst aufgeräumter Stimmung, lachte zu allem, was Bóbó sagte, sah ihn mit tränennassen Augen an undsagte ständig: – Das ist einfachgenial! Dasist einfach genial! Und Bóbó kam ebenfalls in Fahrt, bestellte mehr Bier und hörte auf, mit dem Ring an sein Glas zu schlagen, und als er hörte, dass wir Oma und Onkel Baddi zu Forschungszwecken besuchen wollten, fing er an, uns Familiengeschichten zu erzählen.
Vieles kannte ich natürlich schon oder hatte es selbst miterlebt, aber Bóbó gewann den meisten Geschichten neue Aspekte ab. Manches hatte ich auch noch nie gehört, wie zum Beispiel die Geschichte, wie er irgendwann vor drei Jahren einmal mit dem Flugzeug von Nordisland in Reykjavík ankam:
– Grettir, mein Stiiiefvater (Bóbó spricht immer nur in höhnischem Ton von Papa), holte mich vom Flughafen ab. Er stand einfach da, der arme Alte; ich fand das zwar nett, dass er mir so nachrannte, aber fand ihn auch gleich wieder so hängeschultrig und gebeugt und deprimiert. Mehr als sonst. Dachte mir gleich, dass seine Alte, also dass die Mama ihm mal wieder irgendwie das Leben schwermachte. Also frag ich ihn, als wir so nach Hause fahren, ob alles in Ordnung ist, und ich merke an allem, dass irgendwas nicht stimmt. Na ja, und am Ende kommts raus. – Ach, im Moment geht alles drunter und drüber!, sagt der Alte. – Drunnnter und drüüüber!, wie er sagt. Atmet schwer aus und stöhnt. – Vor ein paar Tagen, da war die Schwiegermama hier, die Gógó, deine Oma. Und die ist einfach eine verdammte Schlampe, die Alte! Hör mal, kannst du dir das vorstellen, behauptet die alte Fotze doch tatsächlich, ich hätte versucht, sie zu ficken!
– Was sagst du da?!
– Jaaa! Pass auf, das war der sechzigste Geburtstag von der Schwarzen Lilli, der sollte im Süden, im Fluuughafenrestaurant von Keflavík gefeiert werden, und die beiden wollen dahin, deine Mama und die Gógó, deine Oma. Jaaaja! Ich biete noch an, sie dahinzufahren. Machs auch noch. Scheiß Regen und Kälte, ist schließlich auch schon November. Guuut! Ich komm nach Hause und leg die Füße hoch, seh ’n bisschen fern und will eben ins Bett gehn, kurz vor eins, warte nur noch auf die Wettervorhersage im Radio, da klopfts! Pass auf! Da steht die Gógó, deine Oma, vor der Tür, stockbesoffen, die alte Sau. Klatschnass draußen im Regen. Keine Ahnung, wie sie in dem Zustand zurück in die Stadt gekommen ist! Deine Mutter nirrrgendwooo zu sehn! Na, ich lass sie natürlich rein, versuch ihr Kaffee zu geben und sooo, anstatt sie draußen in der Kälte umkommen zu lassen. Und der Dannnk dafür: Sie erzählt deiner Mama, als die gegen Morgen nach Hause kommt, dass ich versucht hätte, sie zu ficken!
– O Scheiße, Mann! Und wie hat Mama drauf reagiert?
– Die?! Die hat ein halbes Glas Tryptysol geschluckt. Das haben sie ihr aus dem Magen gepumpt, im Stadtkrankenhaus, und da musste sie dann noch eine Woche bleiben! In der Psychiatriiie!
– Das war doch sicher nicht gut für sie?
– Ja, ich weiß nicht. Sie redet jetzt davon, als ob sie auf irgendeinem … einem … ääh, Seminaaar gewesen wäre! Jedenfalls weiß sie jetzt alles über Nervenheilkunde!
An dieser Stelle fiel Manni vom Stuhl, so sehr lachte er. Weinte vor Lachen, feuerrot im Gesicht. Er hatte einen totalen Lachkrampf. Ich fand das alles gar nicht so witzig. Hatte eher das Gefühl, dass Bóbó mich eigentlich schlechtmachte damit, dass er solche Idiotengeschichten von Papa erzählte. War halbwegs beleidigt. Aber Manni und Bóbó waren so gut drauf; Bóbó selbstverständlich zufrieden damit, dass seine Geschichten solchen Erfolg hatten, und Manni musste dann natürlich auch was erzählen. Er erzählte deshalb eine Geschichte, die ich schon tausendmal gehört hatte, wie er im letzten Jahr zu einer Feier im Hotel Borg wollte, kurz bevor Onkel Baddi hierher nach Amerika fuhr; er stand an in der Schlange am Eingang und sieht auf einmal den Baddi, der da irgendwo hockt wie ein runtergekommener Obdachloser. Offensichtlich ohne Aussicht, mit normalen, zivilisierten Bürgern an einer Feier teilzunehmen. Das hat mich getroffen, sagt Manni, diesen tollen Typen da so ausgestoßen in irgendwelchen Fetzen rumhängen zu sehen, also sag ich zu ihm: –Baddi! Der härteste Kerl Islands! Komm, ich lad dich zu der Party ins Hotel ein. Und da sagt Baddi: – Das ist schon alles in Ordnung, Manni. Vergiss es einfach. Let the good times roll!
Let the good times roll!
Sie wollten nicht darüber wegkommen, wie komisch das war. Wiederholten es in jedem zweiten Satz, ob sie Bier bei der Bedienung bestellten, aufs Klo mussten, um Feuer für die Zigarette baten. Let the good times roll! Ich hatte langsam genug davon und versuchte, zu gähnen und auf die Uhr zu sehen. Aber die beiden waren rot im Gesicht vor Ausgelassenheit. Schließlich zog ich Omas Brief hervor und fragte Bóbó, ob er wüsste, wie wir sie mit diesem Absender auf dem Umschlag finden könnten.
An Karolína Klængsdóttir
Liebe Mama, ein par Zeilen um dich von uns höhren zu lassen unz gehts gut nur Baddi leidet an Sensucht er sent sich nach seinen kindern und Sirry das ist normal. das war nicht schön zu höhren das alle die Pollizei auf ihn hetsten als er auf der strasse war. Dafür wirt Gott sie strafen. er läst sich grad die letsten Zehne rausmachen und kriegt neue Zehne in 2 Monaten, er hats so schwer mit der Sensucht ich hoffe das wirt nochmal mit Sirry und ihm er ist so treu und emfintlich. Jaja sonz gehts unz gut wir sind in die Statd gezogen weil das kürtzer ist für mich und klara in die arbeid. hoffe das alles in Ortnung ist zu hause deine Tochter Gógó Baddi Klara und Bella.
Bóbó lachte zwei-, dreimal laut auf, während er den Brief las, aber dann wurde er ernst und etwas bitter im Gesicht, schüttelte den Kopf und sagte:
– Und mit so was ist man nun verwandt.
– Der Mutter Mutter lehrte mich, beim Untergang der Sonne, sagte ich, aber Bóbó antwortete nur:
– Du mit deinem Volkskundetick.
Manni saß da und sah uns beide abwechselnd an, und dann bekam er diese erleuchtete Idee. Dass Bóbó einfach mit uns mitfahren sollte, mit dem Bus nach Westen zu den großen Strömen, um Oma und Baddi aufzustöbern. Verdammt wär das toll, Mann!
Ich fand die Idee nicht besonders. Das würde alles nur komplizierter machen. Ging daher freudig darauf ein, als Bóbó zu erzählen begann, dass er eigentlich genug hätte von diesem Pack, seiner Familie.
– Aber das ist Forschung, Mann!, sagte Manni. – Das ist eine kulturanthropologische Untersuchung!
– Eine kulturanthropologische Untersuchung?, fragte Bóbó und sah Manni an; Hohn blitzte in seinen Augen. Aber dann überlegte er es sich und sagte, dass es natürlich ein Spaß gewesen wäre, einfach mitzufahren, aber dass er im Moment nicht so flüssig sei; die augenblicklich verfügbaren Beträge seien nicht so hoch.
Aber Mannis Augen glühten, er wollte keine Einwände hören, und in seiner Großzügigkeit bot er an, noch mehr Geld auszulegen, als er ohnehin bereits getan hatte: – Ich werd dir das Geld für den Bus leihen, Bóbó. Ich kauf dir so eine Halbmonatskarte, wie Mundi und ich eine haben. Mit der kann man endlos reisen, und wohin man will. Genau wie mit Interrail!
Am nächsten Abend saßen wir drei mit achtzehn Bier in der hintersten Bankreihe des Greyhoundbusses und hatten zwanzig Stunden Fahrt vor uns. Sangen wie die Pfadfinder:
– New Jersey turnpike, in the wee wee hours …
Draußen lag die ungeheure amerikanische Nacht.
Autolichter schossen vorbei. Und erleuchtete Fabrikanlagen unter dicken Rauchwolken und dann flaches Land, eine sich weit erstreckende Ebene und ab und zu, weit verstreut, einzelne Häuser, Strommasten, und dann vor uns Lichtschein am Himmel, und eine andere Stadt übernahm die Erde; mehr Autos und Leute und Häuser und das Geräusch des Motors, ein klebriges Summen, wenn die Reifen wieder über Asphalt fahren, und irgendwo weiter vorn im Bus schnurrt so ein Amisender; manchmal kommen Leute rein, verschlafene Leute und hellwache, Männer mit ihren guten Anzügen auf einem Bügel und Plastiküberzug darüber, arme Schlucker mit großen Beuteln, Jugendliche mit Sporttaschen; manche kommen zu uns in die hinteren Sitzreihen, wo das Rauchen erlaubt ist; dort hängt auch der Geruch von Desinfektionsmittel, aus der Toilette ganz hinten im Bus mit dem blauen Strom aus dem Spülkasten; dann kommt ein Zwischenraum und dann in den Reihen davor die, die schlafen und die, die Kreuzworträtsel lösen, und manchmal liest der Fahrer die nächsten Haltestellen vor, und man versteht nichts außer dem letzten Namen und dem ersten und dazwischen nur eine ähnlich klingende Reihe von Vokalen, wie Mönchsgesang. Und wir drei ganz hinten, aufgedreht und rot, dabei ein bisschen ängstlich und auf dem Weg in eine andere Welt.
Ich war zum Statisten geworden, nachdem Bóbó sich uns angeschlossen hatte. Er sprach und erzählte, fiel uns rücksichtslos ins Wort, war witzig und wortgewandt, und Manni lachte; trotzdem war mir nicht wohl dabei, Bóbó so zu hören, so fröhlich war er nie, auch jetzt nicht; irgendein anderer Ton schwang darunter mit. Manchmal lachte ich und sah ihm in die Augen, und dann fühlte ich ihr Stechen; besonders gelang es ihm, sich über Manni lustig zu machen, schnell und nur in Andeutungen Dinge zu sagen, die ihn in seinem Innersten trafen, aber Manni überhörte sie absichtlich, lachte nur mit rotem Gesicht und schüttelte den Kopf.
Bóbó sprach für uns, wo wir hinkamen, der größte und bestangezogene von uns und derjenige, der die Sprache beherrschte wie ein eingeborener Ami. Und es waren seine Geschichten, die alles beherrschten. Er saß zwischen uns in der hintersten Reihe im Bus, machte sich breit und erzählte Geschichten von der Familie, diesem Pack, von dem er die Nase gestrichen voll hätte. – Oma Gógó, das ist vielleicht eine komische Alte, Mann. Weißt du noch, Mundi, wie komisch das war, eine Oma im Ausland zu haben? Oder:
– Früher galt es mal als schrecklich fein, eine Oma im Ausland zu haben, im Himmelreich dort im Westen, wo die Kartons mit Kaugummi herkamen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit fünfzehn oder so mit der Snookermannschaft nach Dänemark fahren durfte, das war mehr oder weniger die Jugendnationalmannschaft …
– Ich kann mich daran erinnern, warf ich ein, – Mama ließ mich auf dem Wechsel für die Fahrkarte unterschreiben, der dann später platzte …
– Jaja, sagte Bóbó ungeduldig, scheißegal! Damals wohnte Oma in Kopenhagen, und das traf sich ganz toll, fand jeder, denn da konnte man sich Unterkunft und Verpflegung für mich sparen, indem man mich bei Oma unterbrachte. Mama rief an, und Oma meinte, das sei doch nun ganz selbstverständlich. Der Bóbó! Der kann hier bei mir bleiben, solange er will; aber ja doch, meine Liebe! Trotzdem konnte sie mich nicht vom Flughafen abholen, sie müsse in die Arbeit; aber ich lass einfach offen, und dann kann der Junge einfach reinkommen und sich ganz wie zu Hause fühlen!
Ich erinnere mich, dass es furchtbar sonnig und heiß war in Kastrup, aber windig. Das erste Mal im Ausland. – Du hast vielleicht ein Glück, hier eine Oma zu haben, sagten die Leute; die meisten anderen Jungen mussten bei Fremden im Haus übernachten, wo sie gegen einen Unkostenbeitrag wohnen durften, die Gruppenleiter waren in einem Hotel untergebracht. Vom Flughafen aus wurden wir mit Taxis über die Stadt verteilt. Ich war der erste aus meinem Auto, Oma wohnte draußen in Amager. Und da war auch die richtige Straße, die Holmbladsgade, verwahrlost und heruntergekommen: Kneipen überall und besoffene Männer auf der Straße, ein paar Kolonialwarenhändler der alten Schule, mit Konservendosen auf dem Regal hinter dem Tresen und vergammeltem Obst in Pappkartons auf dem Bürgersteig. – Mein lieber Bóbó, sagten die Betreuer, – bist du sicher, dass du allein zurechtkommst? – Das ist das Haus, sagte ich und zeigte unsicher auf einen großen, braunen Backsteinblock, und dann war das Auto verschwunden.
Was für ein Treppenaufgang! Ich war in großem Zweifel, ob es nicht zu gefährlich wäre, diese alten, verrotteten Stufen hinaufzugehen. Die Wände tropfnass vor Feuchtigkeit.
Dritter Stock, war mir gesagt worden. Schilder auf beiden Türen, aber nicht mit Omas Namen. Ich klopfe trotzdem an der einen, aber höre nichts außer Hundegebell. Versuche zu öffnen, und der Hund dreht fast durch. Abgeschlossen.
Eine ängstliche alte Frau erscheint in der anderen Tür. Ich versuche zu fragen, in gebrochenem Dänisch, aber die Alte schüttelt nur den Kopf und antwortet irgendwas, das ich nicht verstehe. Am Ende zeigt sie nach oben. Die Treppe hinauf. Er dette ikke tredje højde? – Ist das nicht der dritte Stock?, presse ich heraus. Und wieder schüttelt die Alte den Kopf, zeigt weiter nach oben. Ich steige mit meiner Reisetasche in den vierten Stock.
Dort wohnte Oma. Herbor Gógó og Rasmus. Ich hatte keine Ahnung, was für Leute das waren, Herbor und Rasmus, aber selten habe ich mich mehr gefreut, den Namen meiner Oma zu lesen. Klopfe an und drücke die quietschende Tür auf und befinde mich in einem Vorraum mit drei Türen. Der Herr segne dieses Heim, mit der Giebelfront eines isländischen Bauernhauses auf der Wand mir gegenüber. Dem konnte ich nur zustimmen.
Ein Mann von unbestimmbarem Alter schnarchte auf einem altmodischen Sofa im Wohnzimmer. Als er mich bemerkte, setzte er sich auf und schmatzte eine Weile vor sich hin, rieb sich die Augen und knöpfte sein Flanellhemd zu. Es war dunkel da drinnen; nur ein Bruchteil der Sonnenstrahlen schaffte es durch die schlammbraunen Stores. Ich versuchte, fröhlich und natürlich zu wirken und dem Mann zu erklären, wer ich war, aber er schien kein Interesse daran zu haben, irgendet-was zu erfahren.
An den Wänden war nichts außer einem Bild vom Geysir im Haukadalur, in einem Trauerrahmen.
Schimmelgeruch in der Küche. Der Mann holte sich eine Bierflasche aus einem kleinen, wackligen Kühlschrank und öffnete sie sehr fachmännisch an der Tischkante. Das erfüllte mich mit einiger Achtung für ihn. Dann trippelte er ins Wohnzimmer, zog die Vorhänge zurück und setzte sich. Er trank das Bier und schien wieder ganz zu sich zu kommen. Fragte mich irgendwas, nicht unfreundlich. Er schien so zwischen vierzig und fünfzig zu sein, hager und mit schütterem Haar. – Mormor, verstand ich, – din mormor er på arbejde, deine Oma ist auf der Arbeit. – Ja? – Ja. Dann schwiegen wir, er begann, sich seine Schuhe anzuziehen, und fragte irgendwas dabei, ich stimmte zu, ja ja, aber er fragte weiter, bis ich die Wörter komme med aus seiner Rede heraushörte. – Ich? – Ja, kom med.
Wir waren nicht gerade wie Vater und Sohn. Er lief mit langen Schritten den Bürgersteig entlang, und ich an seiner Seite. Ich rannte beinahe vor lauter Nervosität. – Bist du Rasmus, schaffte ich zu fragen. – Ja, sagte er.
Er fragte mich nicht nach meinem Namen.
Eine schwere, knarrende Tür öffnete sich langsam in ihrer in den Boden eingeschliffenen Spur, und wir standen in einer dunklen Gaststätte. Ein Tresen und eine Million Flaschen. Der Geruch wie in einem Bierfass. Ich war noch nie an einem so sündenbesudelten Ort gewesen und bekam es langsam mit der Angst zu tun. Aber dann hörte ich zu meiner Erleichterung das fröhliche, schrille Lachen meiner Oma.
Dann erhellte sich der Anblick. Meine Oma kam heraus, leise irgendwelche Schlager vor sich hinsingend, die damals in der Luft lagen; erschien mit lautem Rascheln und küsste meinen Begleiter auf den Kopf. – Rasmus min skat! Sie trug eine geblümte Bluse und einen Strohrock. Dann sah sie mich, umarmte mich, dass es mir den Atem vor Parfümgestank verschlug und sagte: – Willkommen in der Hawaii-Bar!
Dort war sie Serviererin, meine eigene Oma. Im Strohrock. In einer der billigsten Kneipen der Stadt. Zwei solche einhändigen Banditen, Spielautomaten mit Hebel und sich drehenden Scheiben, waren dort an der einen Wand, und immer die gleichen alten Weiber in ihren Mänteln spielten daran, spielten von morgens bis abends schweigend an diesen idiotischen Automaten. Dann waren noch die Penner und die Witwer aus dem Viertel da, tranken Hofbräu am Tresen, und Oma flirtete mit ihnen. Natürlich eine hervorragende Arbeitskraft! Dieser Rasmus, eine hirngeschädigte Jammergestalt, saß den ganzen Tag an einem Tisch, legte Karten und besoff sich mit ihrem Geld. Stell dir vor. Bei diesem Pack war ich zehn Tage. Aß in der Bar, irgendwelches gottverdammte dänische Smørrebrø. Und dann das ewige Versteckspiel, um zu verhindern, dass einer aus der Mannschaft zu Oma zu Besuch käme. Man war ja damals noch nicht so selbstsicher; das hätte einen schwer getroffen, wenn jemand aus der Mannschaft gesehen hätte, was für ein Pack das war, bei dem man sich da aufhielt. Bei einer Oma im Strohrock.
So ungefähr waren die Geschichten, die Bóbó erzählte, während der Bus mit schwerem Brummen seinen Weg durch die Nacht nahm. Die meisten Fahrgäste schliefen, und es war nichts zu hören außer der Stimme meines Halbbruders, angeberisch und selbstzufrieden, und Mannis Zwitschern, der immer nur die gleichen Phrasen wiederholen konnte: – Das ist genial. Das ist ein Masterpiece. Oh oh! Bis Bóbó aufhörte zu reden und einschlief, und da hatten Manni und ich auch kein Gesprächsthema mehr und schliefen ebenfalls ein.
Gegen Mittag hielten wir in einer gemütlichen kleinen Stadt. Das Wetter war gut, und wir beschlossen, den Bus fahren zu lassen und dort einen Teil des Tages zu verbringen. Wanderten eine Weile in der Nähe der Bushaltestelle herum, während Bóbó sich umsah; er entdeckte eine Bar, die Billard und Kartenspiel anbot, und wir ließen uns darin nieder. Manni war immer noch glänzender Laune, jedes zweite Wort, das er sagte, war auf amerikanisch, und er ging an die Bar, um einzukaufen. Budenweiser auf der ganzen Linie, oder? Zog seine Hosen hoch, die die Neigung hatten, bis zur Hälfte hinunterzurutschen, so dass der obere Teil des nackten Hintern zwischen Jacke und Hosenbund zu sehen war. Bóbó betrachtete ihn mit einem Lächeln, und als Manni gegangen war und sich am Bartresen angestellt hatte, begann Bóbó, sich über ihn lustig zu machen.
– Wann hat sich Manni denn diese tolle, grüne Lederjacke zugelegt?, fragte Bóbó mit unterdrücktem Lachen.
Ich trug selbst eine Lederjacke, wenn auch eine braune, und wurde bei dieser Frage misstrauisch.
– Wieso? Was ist so toll daran?
– Ich meine, sie hat nicht gerade den richtigen Schnitt für diesen kegelförmigen Zeitgenossen. An den Schultern viel zu weit, reicht aber offenbar nicht über den Bauch.
– Ah ja.
– Der gute, isländische Álafosspullover hat ihm besser gestanden. Der sackartige. Oder? Passte auch sonst mehr zu seinem Charakter. Andererseits ist es wirklich süß, diese Gewohnheit, nie die untersten Knöpfe am Hemd zu schließen. Immer schaut die haarige Wampe raus.
Bóbó selbst hatte sein Jackett ausgezogen und saß mir in Hemd und Anzugweste gegenüber am Tisch. – Es können nicht alle so schick sein wie du, sagte ich, aber er antwortete nichts darauf, zumal Manni jetzt mit den Dosen von der Bar zurückkam.
Bóbó sah ihn an und sagte in höhnischem Ton: – Verdammt, bist du fett geworden! Dann kniff er Manni in den Bauch. Und wusste zweifellos, dass es nur eine Sache gab, die Manni noch weniger leiden konnte, als wenn man Witze über sein Aussehen machte, und das war, wenn man ihn anfasste. Manni sackte zusammen und wurde rot. Doch Bóbó setzte noch eins drauf, fragte, ob seine Mama so großzügig wäre mit Puddingresten und Pferdefleisch, aber weil das von Bóbó kam, den Manni so sehr verehrte, begann er eigentlich, um Gnade zu bitten; sah mich hilfesuchend an und sagte:
– Hier, Jungs, wir wollen doch nicht in so ’ne Stimmung verfallen.
Und Bóbó schonte ihn, hörte auf, darüber zu reden, und sagte zu Manni: – Kannst du mir nicht zwanzig Dollar leihen, mein Kleiner, ich will diese Waschlappen da drüben beim Pokern besiegen. Zeigte hinüber auf den nächsten Tisch, an dem drei Männer saßen und spielten.
Natürlich nutzte Manni schnell diese Gelegenheit, sich Frieden zu kaufen, und reichte Bóbó den Schein. Der stand auf, kämmte sich mit einem Kamm aus seiner Hosentasche, ging hinüber zu den Männern und sagte: – How about dealing me in? Wedelte mit dem Geldschein.
Manni und ich waren im Vergleich dazu die totalen Bauern und Lumpenvagabunden. Bóbó zündete sich eine Zigarette an und hielt sie zwischen den Lippen im Mundwinkel, während er spielte wie ein echter Profi; warf die Karten lässig auf den Tisch, verzog nie eine Miene. Wir saßen schweigend und beobachteten dieses kunstvolle Spiel und versuchten, uns so wenig beeindruckt wie möglich zu zeigen. Aber dann wurde es langweilig, es geschah nicht viel in diesem Pokerspiel, und wir begannen, uns über irgendwelche Belanglosigkeiten zu unterhalten, bis sich Bóbó plötzlich wieder zu uns setzte und fragte, ob kein Bier mehr da sei.
Manni sah ihn fragend an:
– Wo ist das Geld, das ich dir gegeben hab?
– Ich habs verloren.
Mannis rotes Gesicht wurde blass. Er war wütend. – Du hast das Geld verloren? Hey, glaubst du, ich habs so dicke, dass ich das Geld einfach zum Fenster rausschmeißen …
– Du hast das Geld verloren?! Bóbó ahmte Manni nach und machte eine Grimasse dazu. – Unser bettelarmer, kleiner Bubi! Du wirst noch ganz wie deine Mama, so eine verdammte, widerliche Art ist das! Trägst wahrscheinlich auch schon das Korsett von deiner Alten, was?
– Das ist wohl überflüssig, so unfreundlich zu werden, sagte ich, da ich sah, wie sehr Manni verletzt war. Aber Bóbó zitterte vor Zorn, und plötzlich kniff er Manni fest in beide Wangen und schlug ihm mit voller Wucht den Schädel vor die Stirn. Stand dann schnell auf, dass der Stuhl hinter ihm umkippte. Setzte sich auf einen Hocker an der Bar.
Manni war ganz benommen. Das war so ein unerwarteter und heftiger Wutanfall. Manni sah mich ganz blass an, murmelte dann mit einem winzigen Zittern um die Mundwinkel: – Was hat der Mann?
Schließlich stand ich auf, nachdem Manni und ich eine halbe Stunde schweigend am Tisch gesessen hatten, ging zur Bar und sagte Bóbó, dass wir daran dachten weiterzufahren. Er nickte mit dem Kopf, rief dann nach mir, als ich mich schon wieder umgedreht hatte.
– Leih mir etwas Geld.
Ich zog ein paar Scheine aus der Tasche, zwanzig, dreißig Dollar, und wollte sie gerade zählen, aber er riss mir das Geld aus der Hand. Ging dann hinüber zu den Männern, die ihn im Poker besiegt hatten, und forderte sie zu einem Billardspiel heraus. Sagte zu mir, ich solle einen Augenblick warten.
Sie spielten zwei Spiele. Das erste gewann Bóbó ganz knapp, so dass beim zweiten um größere Einsätze gespielt wurde. Da räumte er den Tisch mit einer Mustervorstellung ab. Und die Männer standen mit offenen Mündern und waren verblüfft, aber auch ein bisschen hingerissen, nannten Bóbó The Champ, und er gab eine Runde für die ganze Bar aus. Bóbó stand eine Weile zwischen all den Männern, die sich um ihn drängten, und erzählte ein wenig von sich, während Manni und ich zusammengesunken über unseren Bierdosen in einer Ecke warteten. Dann kam Bóbó, lächelnd und glänzend gelaunt, warf Manni und mir etwas Geld hin und fragte: – Was schulde ich euch? Wollten wir uns nicht vom Acker machen?
Ich hatte halbwegs erwartet, dass Bóbó sich bei Manni entschuldigen würde, ich fand, er schuldete ihm das, doch nichts dergleichen tat sich. Aber er war in guter Stimmung, pfiff und war laut, und als wir uns an der Bushaltestelle Fahrkarten besorgten, kniff er Manni in den Hintern. – Lassdas!, sagte Manni, und Bóbó lachte und ahmte ihn nach: – Lasssdasss!
Manni bereute es mittlerweile, Bóbó mitgenommen zu haben. Das vertraute er mir an, während wir auf den Bus warteten und Bóbó für einen Moment weggegangen war.
– Du wolltest doch unbedingt, dass er mitkäme, sagte ich.
– Ja, man hat eben nicht gleich begriffen, was für ein Irrer er ist, sagte Manni bitter und sah sich schnell um, als ob er fürchtete, dass jemand ihn belauschte. – Vielleicht ist diese Fahrt eine einzige, verdammte Dummheit!
– Wir werden nicht umkehren deshalb, sagte ich.
– Ja, warum nicht?, sagte Manni. – Wir haben einen Geisteskranken bei uns, an den wir denken müssen. Dann verstummte er und biss sich auf die Unterlippe und begann, den Boden durch seine dicke Brille zu studieren, da Bóbó in diesem Augenblick zurückkam.
– Gott, wie traurig ihr da zusammen rumhängt, sagte er.
– Ist irgendwas? Zog dann eine Zeitung hervor und begann zu lesen, leise vor sich hinsummend.
Dann fuhr der Bus ab. Wir setzten uns in die hinterste Sitz-reihe, und Bóbó breitete sich zwischen uns aus und erzählte weiter Geschichten. Sprach pausenlos. Klapperte mit seinem Ring an der leeren Bierdose. Nun erzählte er Geschichten vom Billard. Manni hatte aufgehört zu zwitschern und zu rufen, wie toll das alles wäre, und versuchte, nicht zu lachen, doch ohne Erfolg. Bóbó begann, ihm eine Geschichte von einem Familienvater zu erzählen, der ein leidenschaftlicher Billard-spieler war und regelmäßig seinen Monatslohn verspielte, bis Frau und Kinder es nicht mehr ertragen konnten und ihn verließen. Als der Mann auf diese Weise alles durch seine Spielsucht verloren hatte, beschloss er, niemals wieder einen Billardstock anzurühren.
– Hochheiliges Ehrenwort. Wurde gläubig. Traf seine beiden Kinder jeden zweiten Sonntag. Spendierte ihnen Eis und Würstchen und Kinokarten. Aber eines Sonntags besitzt er keine einzige Krone mehr. So steht es einfach um den armen Kerl. Er will natürlich nicht, dass die Kinder begreifen, wie elend sein Zustand ist, fängt an herumzutelefonieren, und versucht, irgendwo Geld für Kinokarten herzukriegen, aber nichts geht. Am Ende ist er so mit den Kindern auf den Fersen unten im Stadtzentrum angekommen und fängt an, um die Billardsalons herumzuschleichen. Sagt ihnen schließlich, sie sollen einen Moment warten, und geht auf eine Partie Kugelschach hinein. Und kommt eine halbe Stunde später mit einem dicken Packen Geldscheine wieder heraus und lädt sie alle ins Kino ein.
– Da war nun sein Enthaltsamkeitsgelübde dahin, sagte Bóbó und drehte sich zu Manni. – Findest du das nicht bemerkenswert? Mein Kleiner?
– Doch, sagte Manni.
– Entschuldige, wenn ich mich danebenbenommen habe, ich bin einfach so gestresst von dem Gedanken, dieses Pack wiederzutreffen.
Manni verzieh und lachte wieder. Und ich fragte Bóbó doch nicht, warum er immer mein Kleiner sagte, als ob er mit Windelkindern spräche.
Spät abends kamen wir zu dem Ort, in dem Omas Brief abgestempelt war. Nahmen ein Taxi und fragten nach einer billigen Übernachtungsmöglichkeit, und das Auto fuhr mit uns direkt zum YMCA, dem Christlichen Verein junger Männer.
– Wir wirken wohl sehr gottesfürchtig, sagte Bóbó, der immer noch ganz aufgekratzt war. Er wünschte den Männern in der Lobby Gottes Segen, und als wir hoch in den Gang kamen, in dem unser Zimmer lag, trafen wir auf eine Gruppe schwarzer Teenager, die nach dem Takt der Discomusik aus einem riesigen, tragbaren Kassettenspieler ihre Turnübungen machten. Und Bóbó bat sie um Ruhe, sagte ihnen, er sei ein Missionar aus Skandinavien, und brachte die Jungen dazu, March On Christian Soldiers mit ihm zu singen – Vorwärts, christliche Soldaten. Und Manni und ich hielten uns die Bäuche und wurden beinahe blau vor unterdrücktem Lachen, versuchten aber, ebenfalls mitzuspielen, und verabschiedeten uns mit Pfadfindergruß von den Jungen, als wir gingen, um uns auf die knarrenden Soldatenpritschen in unserem Zimmer zu werfen, das einer Gefängniszelle glich.
Der Schweinehirt
– Oma?!