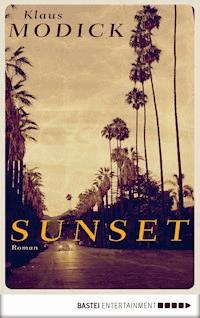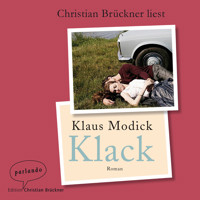9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Klaus Modicks früher Roman über Geschichte und Macht eines Gemäldes Der Hamburger Werbegrafiker Michael Jessen ist Junggeselle, Sportwagenfahrer und aufgehender Star der Branche. Gerade entwickelt er eine neue Kampagne, da wirft ein Bild aus einem Trödelladen ihn völlig aus der Bahn: Zwei rote Doppeldeckerflugzeuge auf grauem Grund veranlassen ihn zu einem Spontankauf und rauben ihm fortan den Schlaf. Was hat es mit dem rätselhaften Hintergrund auf sich, und wer ist der unbekannte Künstler? Zusammen mit der Kunsthistorikerin Edith begibt sich Michael Jessen auf eine Odyssee des Sehens, die sie zunächst von einem oldenburgischen Bauernhof bis nach Bayern und dann in die Ferne führt. Der Fluchtpunkt der Reise ist das Karolinen-Atoll in der Südsee.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Ähnliche
Klaus Modick
Das Grau der Karolinen
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Klaus Modick
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Schönheit, die dauert, ist
ein Gegenstand des Wissens.
Und ist es fraglich, ob die
Schönheit, welche dauert,
so noch heißen dürfe –
fest steht, dass ohne
Wissenswürdiges im Inneren
es kein Schönes gibt.
Walter Benjamin
I
Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?
Goethe
Eine blasenförmige Zelle, losgelöst vom notorischen Azorenhoch, war vor vierzehn Tagen über die Biskaya und Frankreich hinweggezogen, hatte bei dieser Wanderbewegung Pilzgestalt angenommen, sich schließlich über dem Frankfurter Raum festgesetzt und dort mit dem Festlandsmaximum über Polen und Westrussland Verbindung aufgenommen. Seit einer Woche gab dies dem bloßen Auge unsichtbare Wettergebilde nun auch noch alle verfügbaren Räume für Zuströme subtropischer Luftmassen aus dem Mittelmeergebiet frei. Die sonst als Wetterscheide relativ zuverlässig funktionierenden Alpen versagten unter solchen, für mitteleuropäische Verhältnisse ungewöhnlichen Umständen ihren regulierenden Dienst. Dennoch taten Isobaren wie Isothermen nichts weiter als ihre ordnungsgemäße Schuldigkeit – ein unscheinbarer Sachverhalt, der bereits anderweitig genutzt wurde, um den Blick aufs Besondere einer zu erzählenden Begebenheit gleichsam aus dem Allgemeinen der Witterung auftauchen zu lassen.
Meteorologen versicherten, die Hitzewelle sei, wiewohl ungewöhnlich, durchaus noch im Bereich der hierzulande seit mehr als einhundert Jahren ermittelten Extreme und Durchschnittswerte einzuordnen. Während der ersten Tage hatte die Mehrzahl der schwitzenden Bevölkerung die Phänomene mit Floskeln wie ›endlich Sommer‹ oder ›Bella Germania‹ begrüßt, schnell jedoch begonnen, in Begriffen wie ›Affenhitze‹ oder ›Hundstage‹ über die Witterungslage Klage zu führen, um sich endlich, die hohen Dauertemperaturen gingen in die zweite Woche, ermattet mit der erstarrten Schönheit aus Azur über ihren Köpfen abzufinden. Nichts bewegte sich, oder, genauer gesagt, nichts schien sich zu bewegen, oder, um völlig korrekt zu reden, was sich bewegte, bewegte sich nur unendlich langsam, auf eine kaum wahrnehmbare, zeitlupische Weise.
Von oben, aus mehr als einhundertachtzigtausend Metern Höhe, in der ein europäischer Wettersatellit die ganze Angelegenheit gleichgültig durch seine Objektive aufnahm, die empfangenen Eindrücke in Funksignale umwandelte, um diese dann gedankenschnell zu Bodenstationen zu senden, wo sie wiederum von sinnreichen Geräten dechiffriert und in fotografische Bilder verwandelt wurden, von oben also sah alles durchaus langweilig aus: Dem Weitblick des Satelliten stand kein Wölkchen im Wege. Länder, Meere, Küsten, Gebirge, Flüsse, Bäche, Wälder und Waldbrände, größere Städte, kleinere Städte, Dörfer, einzelne Häuser, selbst Gegenstände in der Größenordnung eines Automobils oder eines Menschen, der allein über ein Feld ging, waren dem technischen Auge kenntlich und in dessen fotografischer Übersetzung entsprechend dem menschlichen – und zwar ohne dass die sonst üblichen Hilfsmarkierungen auf den Fotos darauf hinzuweisen gehabt hätten, wo beispielsweise das Grau der Ostsee zu suchen war.
An einem der Abende dieses später sogenannten Jahrhundertsommers fand ein Diplom-Meteorologe, der sich mit einigen Kollegen auf dem Fernsehschirm darin abwechselte, den Zuschauern Aufschluss über die Wege und Abwege der Witterungsverhältnisse zu geben, nachdem er sich entschuldigt hatte, dass das heutige Satellitenfoto aufgrund eines technischen Problems nicht wie gewohnt in Farbe, sondern lediglich in Schwarz-Weiß gezeigt werden könne, zum Stand der Dinge folgenden trostreichen Vergleich: Läge Deutschland nicht dort, wo es liegt, im Zentrum Europas, sondern auf der anderen Seite des Globus, dazu noch etwas weiter südlich, dann – ja, dann wären diese ungebrochen anhaltenden Extremwerte der Quecksilbersäule das Allernormalste von der Welt. So aber – er deutete auf eine Schautafel, deren Grün er mit eingängigen Zeichen bekreidet hatte: Sonne von Maas bis Memel – so aber bliebe die ersehnte und für die Landwirtschaft dringend notwendige Abkühlung wegen der stabilen Inversionslage vorerst bloßer Wunsch. Wesentliche Änderung könne nämlich auch er bis auf Weiteres nicht verheißen, von lokalen Hitzegewittern einmal abgesehen. Doch bevor der Meteorologe sich mit dem Zuruf »Genießen Sie also den Sommer!«, von seinen Millionen Zuschauern verabschiedete, gab er noch einige weiterführende Erklärungen, die jene ungewöhnliche hochsommerliche Hitzestabilität plausibel machten, Erklärungen, die man während dieser Tage in jeder Zeitung lesen konnte, tabellarisch aufgewertet nach der trockenen Art der Wetterkundler, oder aber mit Abbildungen plastisch gemacht, die vorzugsweise junge Mädchen und Frauen, nackt, halb nackt oder doch zumindest mit wasserdurchweichten, hautanschmiegenden Blusen zeigten, wie sie in der Sonne lagen beziehungsweise aus der Sonne flohen unter Markisen, in schattige Cafés, oder wie sie badeten in Pools, Teichen, Bächen, Flüssen, Seen und Meeren, obwohl all diese Gewässer, die Pools eingeschlossen, wegen ihrer hohen Schad- und Giftstoffbelastungen für die Gesundheit nicht eben zuträglich waren. Kurz: Deutschland samt angrenzenden Gebieten war eine hüllenlose Hitzeblase.
Trotz aller Storys zum Thema, die sich Journalisten aus den feucht geschwitzten Fingern sogen, wurde nirgendwo einem jener Hauptpunkte, der im hier weiterhin Berichteten zu beachten sein wird, die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt: dass nämlich alles, was ist oder erscheint, dauert oder vorübergeht, nicht isoliert, nicht nackt gedacht und gezeigt werden darf. Selbst in einer Alltäglichkeit wie derjenigen des Wetters wird ja eins immer noch vom anderen durchdrungen, begleitet, umkleidet, umhüllt; es verursacht und erleidet Einwirkungen und bringt selbst Wirkungen hervor, die, wie im Falle solcher Hitze, vom Verdorren vieler Vegetationsformen bis, um ein beliebiges Beispiel zu geben, zu psychischen Störungen bei an sich wenig labilen Menschen reichen können.
Und wenn so viele Phänomene sich durchdringen, ist es am Ende schwierig zu beurteilen, was vorangeht und was folgt, was produziert und was aufnimmt, was Wirkung auslöst und was Wirkung spürt. Als noch komplizierter erweist sich jedoch der Versuch, das vielschichtige Spiel von Wirkung und Gegenwirkung, erst recht das von Wirkung und Ursache, begreifbar oder anschaulich zu machen. Denn, um mit einer althergebrachten Einsicht zu formulieren, eigentlich unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfasste wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges.
Die stahlblaue Transparenz des Himmels über der Hafenstadt Hamburg täuschte das Auge darüber hinweg, dass die Luft, träge, unbewegt, bleiern über der Stadt lagernd, dem freischaffenden Gebrauchsgrafiker Michael Jessen eher als ein graues Einerlei erschien. Fiebrigkeit, überzogen von einer Art gedehntem, beständigem Gähnen, wiegte die Tage in halbschlafartigen Zuständen, wurde während der Nächte abgelöst von stoßweisen Phasen des Erwachens, die aber kaum Kühlung brachten, sondern nur die Farbe der Hitze in ein neongesprenkeltes Blauschwarz laufen ließen. Dennoch gab es dann, meist gegen Morgen, der Feuchtigkeit versprach, ohne dies Versprechen einzulösen, Momente, in denen sich plötzlich und ungerufen die Konzentration einstellte, der er tagsüber vergeblich nachschlich.
So kam Jessen nur schleppend mit seinem Auftrag voran, und obwohl der Abgabetermin zuverlässig näher rückte, war an kontinuierliche Arbeit nicht zu denken. Die übers Papier fahrende Hand verklebte mit den Bögen, die Zeichenstifte rutschten zwischen den Fingern beim leisesten Druck, Schweißspuren der Handkante weichten und wellten die Blätter auf, deren kühles Weiß an solchen Stellen aufgeraute gräuliche Spuren zeigte.
Die Ostseestrände waren hoffnungslos überlaufen, aber wer einen Kilometer hinausschwamm, war allein und hörte nichts mehr. Toter Mann, meinte Jessen, sei bei dieser Hitze die erträglichste Daseinsform. Fast bewegungslos lag er, den Kopf im Nacken, rücklings im Meer, sodass kleine Wellen zögernd über seine Stirn laufen konnten und in seinen Ohren ein eintöniges Schwappen hervorriefen. Wenn man diese Sprache verstünde, dachte er und ließ das Wasser durch seinen Kopf strömen, durch seinen Körper, fühlte seine Extremitäten wabern wie Tang in der Dünung, dehnte sich oder wurde gedehnt, wand sich durch Meerengen, Sunde, an Inseln vorbei, fand sich auf hoher See, in Ozeanen, weite, stille Wasser, ließ die Augen geschlossen, damit die exotischen Inselwelten seiner Träume, die Unberührtheit ferner Strände, deren Palmenrauschen er hörte, möglichst fern blieben vom Strand.
Hinter geschlossenen Lidern war alles möglich, greifbar, nah. Erst die Bilder machten die Dinge zu dem, was sie waren, oder zu sein vorgaben, und so zögerte er den Augenblick hinaus, da seine Augen die Strahlen empfangen würden, die von der Sonne ausgingen oder von den Menschen und Gegenständen am Strand reflektiert wurden, die Pupillen passieren würden, die Linsen durchdringen, die sich entsprechend der Helligkeit und Entfernung der wahrzunehmenden Objekte verändern, durch den Glaskörper fallen würden und schließlich auf die Netzhäute träfen, wo ein umgekehrtes Bild aller Gegenstände entstünde. Das Bild würde in seinem Gehirn wieder gedreht werden, und dies kluge Gehirn würde sogar die Eindrücke der Umwelt, des Außen, verdeutlichen, verschärfen, damit sich Michael Jessen besser darin zurechtfinden und dies Außen abbilden oder umbilden konnte, wie es ihm oder seinen Auftraggebern gelegen war. Vor allem würde das Gehirn die Gegensätze von Hell und Dunkel verstärken, die Unterschiede der Farben, und so schlug er nur widerwillig die Augen auf, weil er sich wohlfühlte im Meer, in dem ihm für kurze Zeit Gegensätze und Unterschiede zerflossen waren, sah über sich die fast mediterrane Bläue des Himmels, die zu einem durchsichtigen Schleier verschwamm, wenn das Wasser ihm übers Gesicht lief. Von kurzen Böen, die sofort kraftlos verfielen, wurden hin und wieder weiße Kronen auf die Fläche gesetzt, und Spritzer legten sich dann über sein Gesichtsfeld. Weil die Sonne im Zenit stand, kam ihr Licht dem reinen Weiß am nächsten. Zwischen allen Farben herrschten die stärksten Kontraste. Die Schatten waren schwarz.
Das Licht, das aus dem wolkenlosen Blau fiel, schien Jessen leer, als ob es alle Farbe in sich hinaufsaugen wolle. Die seit Tagen unveränderte Transparenz hatte alle Heiterkeit verschluckt. Jessen war dankbar für jede Bewegung dort oben, begrüßte, ungläubig lächelnd, ein versprengtes Wölkchen, das der müde Wind von irgendwoher über See gebracht hatte, sah ihm nach, bis es über die Wasserlinie hinweg war und hinter den Dünen über den flimmernden Flächen schnell zu nichts zerflatterte.
Er drehte sich auf den Bauch und begann, in kräftigen Zügen zu schwimmen, die Augen geschlossen. Auf der Nacht der Netzhaut erschien die Sonne als blutiger Ball, pulsierend im Rhythmus seiner plötzlichen Körperbewegungen. Das grelle Gebilde zog sich zur Größe einer im Dunkeln glühenden Zigarette zusammen, wenn Jessen einatmend mit Armen und Beinen ausholte; schloss er sie wieder ausatmend, um vom Schwung getrieben eine Strecke zu gleiten, blähte sich das Lichtecho sogleich gegen unendlich, quoll über die Begrenzungen seines Kopfes hinaus, sodass er das Gefühl hatte, in dieses Nachleuchten hineinzuschwimmen. Langsam verebbte die Erscheinung, bis sie zu einem stecknadelkopfkleinen Punkt geschrumpft war.
Klick, dachte Jessen, drehte sich wieder auf den Rücken und schlug die Augen auf. Er blickte nun nach Norden, wo weit hinter dem dichter werdenden Dunst Skandinavien lag. Hoch im Himmel, genau im Zentrum seines Blickfeldes, standen silbrig-weiß zwei winzige Punkte. Während er sich darüber amüsierte, dass es ihm gelungen war, die Sonne von Süden nach Norden geholt, verdoppelt und umgefärbt zu haben, merkte er, dass die beiden Punkte sich bewegten. Er versuchte, diese Bewegung durch rasches Öffnen und Schließen der Augen still zu stellen. Es misslang. Er blinzelte. Flieger, schoss es ihm endlich durch den Kopf. Flieger sind das. Sie wuchsen auf ihn zu oder auf den Strand hinter ihm oder auf das Land hinter dem Strand, oder auf die Städte im Land, oder auf die Menschen in den Städten, aber dann vollführten sie doch eine lang gezogene Schleife nach Osten, wobei sie zugleich höher stiegen. Und plötzlich zeichneten sie ihre parallele Bahn in den Himmel, Kondensstreifen, die fadengleich den schimmernden, rasenden Punkten entflossen. Die beiden Linien schienen regungslos in der Luft zu stehen, quollen an den Enden schaumig auseinander, verflossen zu einem künstlichen Wolkenschleier, der zögernd durchsichtiger wurde und schließlich zu Dunst zerfiel.
Die Exaktheit, mit der die Maschinen wie an einem unsichtbaren Reißbrett ferngelenkt ihre Bahn zogen, erinnerte Jessen an den Auftrag, der unerledigt auf seinem Zeichentisch in Hamburg lag.
Malt mir mal ’ne Idee da oben, dachte er ins Blaue hinauf, aber die Flieger verschwanden, als ob sie sich beobachtet fühlten, zielstrebig aus seinem Blickfeld, bis nur noch ein vereinzelter weißer Strich im Himmel stand, der gemächlich in ein mattes Grau changierte. Dann verschluckte das Blau das Grau. Alles war wieder hoch und öde. Der Tag prahlte mit seiner vollkommenen Leere.
Jessen überlief ein Schauer. Er fröstelte, überlegte, wie lange er schon im Wasser war, eine Stunde vielleicht, und schwamm schnell dem Strand entgegen. Dort verflimmerte alles blau, grün und rot auf der gleißend gelben Fläche. Die Farben fielen so klassisch klar in seine Augen, dass sie ihm falsch schienen, eine übermütige Hochstapelei der Lichtstrahlen. Er fröstelte wieder, wollte aufs Trockene, aber irgendetwas stieß ihn ab vom Lärm des Strands, von der grellen Farbigkeit des Landes, der Sonnenschirme und Strandkörbe, der bunten Bälle, Badehosen und Bikinis.
Die Brise, die bislang träge, kaum wahrnehmbar übers Wasser gekrochen kam, frischte plötzlich auf, fiel nicht wie sonst in diesen Tagen sofort wieder schlaff in sich zusammen, und die blendende Aufdringlichkeit des Farbgetümmels am Strand schien schlagartig eine Nuance gedämpfter.
Als Jessen schließlich tief atmend auf seinem gelb-grün gestreiften Handtuch lag, dessen gelbe Linien übergangslos in den Sand strömten, sah er die im Südwesten einzeln aufziehenden Wolken. Sonne drang noch streifig durch die faserigen Schleier, schien wie durch Mattglas. Von Regen hatte keine Wettervorhersage gewusst, aber Jessen erinnerte sich, dass einzelne Hitzegewitter nicht ausgeschlossen waren. Die Luft beunruhigte sich, die Bewegungen der Menschen am Strand wurden fahriger, nervöser. Ein Transistorradio beendete seinen Werbeblock und plärrte die Fünfzehn-Uhr-Nachrichten, in denen von umfangreichen Truppenmanövern der Roten Armee, in der Luft und zu Wasser, im gesamten Ostseebereich die Rede war. Die Kondensstreifen hatten die Meldung schon vorweggenommen, sie sinnlich gemacht, ihre Wahrheit mit gigantischer Hand längst an den Himmel geschrieben. Jetzt wurde das Bild zum Wort.
Jessen fühlte sich unbehaglich. Die Witterung schlug ihm auf den Kreislauf, die Arbeit hockte ihm unerledigt im Nacken. Er blieb noch eine halbe Stunde dösend im Sand liegen, tauchte dann kurz ins Wasser, dessen unbewegte Starre in ein hektisches Gekabbel übergegangen war, wusch den Schweiß ab, packte seine Sachen zusammen und ging durch die Dünen zum Parkplatz, wo er sein Auto abgestellt hatte. Er strich, während er die Tür öffnete, mit der Hand liebevoll über das glühende Blech des Daches, stieg in die Brutofenhitze des Wagens, in dem die Ledersitze zu schmelzen schienen, ließ die Fenster herunter und den Motor an, ein Vorgang, der ihn immer noch in einen milden Machtrausch versetzte. Die Maschine heulte in eleganter Kraft auf. Wohlgefällig vermerkte Jessen, dass einige Leute auf dem Parkplatz ihm nachsahen, als der Wagen, aus dem sein linker Arm heraushing, schwungvoll auf die Straße bog und in einer Staubwolke Richtung Autobahn verschwand.
Dafür, dachte er vergnügt und legte den vierten Gang ein, lohnt sich der Job. Und entspannt schoss er dahin.
Im Süden, über der Stadt, zogen sich Wolken zusammen. Lockere Schichten und Bänke aus flachen Schollen und Ballen wuchsen zu dicken Massen, deren obere Teile wie Kuppeln ausgebildet und mit rundlichen Auswüchsen besetzt waren, warzig, blasig, gigantischen Blumenkohlköpfen ähnlich, deren Unterseiten horizontal abgeschnitten waren. Das Weiß in ihnen wurde zusehends schmutziger, der Wind nahm beständig zu. Regen, hoffte Jessen. Durchs abdunkelnde Grün der schleswig-holsteinischen Ebenen stach das graue Betonband der Autobahn, das wiederum aufgerissen wurde vom vermischenden Gelb des Wagens, der mit voll aufgeblendeten Scheinwerfern ins perlmuttfarbige Licht über Hamburg raste. Jessen versuchte, sich über dem Auto schweben zu sehen. Er liebte Bilder aus der Vogelperspektive, in denen die Wirklichkeit der dreidimensionalen Dingwelt in flache, grafische Flächen verwandelt wurde, stellte sich vor, wie ein Flieger ihn jetzt sähe, sah die Mittelstreifen zu einer Linie verlaufen, weiß flackernd, zu einem Strich zusammenschieben, zischend, zu Kondensstreifen, die sein Wagen ausstieß und auf denen er zugleich ritt. Ihn überkam ein Schwindel, wie ihn vorhin im Wasser ein Frösteln überlaufen hatte. Er fuhr langsamer, wollte die vertrauten Unterbrechungen wieder wahrnehmen zwischen dem Weiß der Balken und dem nachtschwarzen frischen Asphalt, in den das Betongrau der Autobahn inzwischen gemündet war. Doch der Mittelstreifen quoll auf wie Schleier vor der Sonne, warf Blasen.
Jessen stoppte am nächsten Parkplatz, schüttelte sich wie ein Hund, fuhr sich mit einem mit Eau de Cologne getränkten Erfrischungstuch durchs Gesicht. Er sah wieder klar. Die Elektrizität der Luft hatte ihm Streiche gespielt. Oder seine Fantasie, die er sonst zu zügeln, produktiv zu kanalisieren wusste, war mit ihm durchgegangen, wie es früher manchmal passiert war, als er noch Malerei studierte, Kunst.
»Kunst«, lachte er halblaut in sich hinein. Die konnte er sich heute nicht mehr erlauben: Dafür war sein Leben zu aufwendig, zu teuer. Er zwang sich, an die Arbeit zu denken, die auf ihn wartete: das Layout für die Blitz-Weiß-Doppelseiten-Kampagne, ein Riesenauftrag, von dem er mehrere Monate lässig würde leben können. Zu Hause, beschloss er im Weiterfahren, würde er sich an den Zeichentisch setzen und die Sache in einem Rutsch aus dem Ärmel schütteln, selbst wenn es ihn mit Kaffee und Captagon die ganze Nacht kosten sollte.
Der Wind blies ihm in den Rücken. Die Sonne war jetzt hinter einer vollständig geschlossenen Wolkendecke verschwunden. Staub, Papiere, leere Dosen trieben durch die Straßen Hamburgs. Das Gewitter war nah.
Als Jessen seine Wohnungstür öffnete, fuhr ihm ein kräftiger Luftzug entgegen. Glas klirrte. Er hatte ein Fenster offen gelassen. Die Papiere, Bögen, Schnipsel waren vom Arbeitstisch geweht und weit im Raum verstreut.
Er schloss das Fenster, ließ das Zeug liegen, holte ein Bier aus dem Kühlschrank, legte sich aufs Bett, starrte gegen die Decke, trank, fühlte sich müde, zerschlagen, trank, die Augen fielen ihm zu. Er döste, dachte an das Layout. Blitz-Weiß als Schriftzug vor dramatischem Gewitterhimmel. Vielleicht. Er trank. Der Wind trieb Staub gegen Fenster. Ein feines Ticken. Er nickte ein.
Als es klingelte, schlug er nach dem Wecker, der stumm neben dem Bett stand. Das Telefon ging.
Halb schlafend griff er zum Hörer.
»Hier Kathie«, flötete eine weibliche Stimme fröhlich.
»Wer?«, murmelte er benommen, fuhr sich mit der Hand über Stirn und Augen.
»Ka-tha-ri-na«, betonte die Stimme jede Silbe ihres Namens. »Katharina Bechler. Du wirst mich doch wohl noch kennen!«
»Kathie, natürlich. Entschuldige«, beeilte er sich. »Ich habe gerade geschlafen.«
»Wir sind verabredet«, sagte sie. »In einer Stunde. Ich hab einen Tisch im Tre Fontane bestellt.«
»Geht in Ordnung. Bis gleich also.«
Kathie, dachte er unter der Dusche, hätte ich beinah vergessen. Wär schade drum. Herrlich unkompliziert, besonders wenn sie lacht. Und sie lacht oft. Er sah ihr lachendes Gesicht, den weit geöffneten Mund, die weit auseinanderstehenden Augen, deren Grün apart zu ihrer blonden Mähne kontrastierte, in die sie seit einiger Zeit dunkle Strähnen gefärbt hatte. Jessen war sich sicher, dass Kathie ein bisschen verliebt in ihn war. Und er? Verliebt war wohl kaum das richtige Wort, doch er mochte sie, und ein- oder zweimal, als er sie in einem Flur der Werbeagentur McLinn vor sich hatte gehen gesehen, waren in ihm erotische Fantasien aufgestiegen, hatte er sich ausgemalt, wie das sein würde mit Kathie, in deren Art, auf hochhackigen Schuhen zu laufen, etwas verspielt Sinnliches lag. Angenehm, dachte er, dass sie so offen auf mich zukommt. Angenehm. Und nützlich: Als Copy-Team-Chief der Agentur war sie wichtig für Jessen. Es konnte kein Zufall sein, dass Kathie die größten und besten Aufträge, die die McLinn an freie Mitarbeiter außer Haus gab, seit einiger Zeit Jessen zuschob; genauer gesagt seit dem Tag, als er in einer Präsentation Partei für einen von Kathie formulierten Werbespruch ergriffen hatte, den alle anderen Anwesenden kritisierten. Vielleicht hatte Jessen nur Spaß daran gehabt, gegen die Meinung der Mehrheit zu stehen; vielleicht aber war er auch Kathie zur Seite gesprungen, weil er plötzlich wieder daran denken musste, wie sich ihre langen Beine unter dem engen Lederrock abgezeichnet hatten.
Jessen betrachtete sich im Spiegel, während er sich rasierte, sah mit Zufriedenheit, dass die Bräune seiner Haut sich weiter verdunkelt hatte nach diesem Tag an der Ostsee. Am Glas des Spiegels lief das Kondenswasser in fetten Tropfen abwärts. Jessen wollte mit der Handfläche darüberwischen, stutzte jedoch einen Moment, als er in einem der Tropfen seine eigenen Augen gespiegelt zu sehen glaubte, wischte dann aber die Fläche entschlossen frei, nickte sich zu, lächelte.
Das Tre Fontane lag an einer Einbahnstraße in Barmbek, einem Stadtteil, in dem Jessen sich schlecht auskannte. Er verpasste die richtige Zufahrt und parkte schließlich in einer Parallelstraße, fünf Minuten von dem Restaurant entfernt.
Der Himmel hatte sich verdunkelt, der Wind war fast stürmisch geworden. Alle Farben schienen seltsam verfremdet. Licht reflektierte grünliche Schatten in die Schaufenster der kleinen Geschäfte, an denen er vorbeiging. Die Bewegung am Himmel setzte Akzente in die Scheiben, kräftige Blautöne. Der erste Blitz zerriss die drückend düstere Atmosphäre mit einer Gewalt, dass Jessen erschrocken stehen blieb in der plötzlichen Weißglut, die für den Bruchteil einer Sekunde über alles Sichtbare fiel und noch nicht erloschen war, als schon der Donnerschlag detonierte. Scheiben klirrten, der Boden schien zu wanken und Regen stürzte, ohne jedes zaghaft beginnende Tröpfeln, als ob die Ostsee zum Himmel erhoben und einfach ausgekippt worden wäre. Jessen sprang in den Eingang eines Geschäftes, dessen Tür etwa zwei Meter ins Innere des Hauses, an dem er gerade vorbeiging, versetzt war.
Sein Blick fiel auf ein weißes Emailleschild, dessen schwarze Schrift einen Inhaber: K.P. Wuttke verriet, und von dort wanderte er auf die Auslagen in den kleinen, vitrinenartigen Schaufenstern des Eingangsflures, die vollgestopft waren mit Gläsern, Dosen, Bilderrahmen, alten Fotografien, Ansichtskarten, einem Feuerwehrhelm, Säbeln, einem hölzernen Schaukelpferd. Es war einer dieser zahlreichen Trödelläden, in denen man, meist zu völlig überhöhten Preisen, Kitsch von gestern für die Gemütlichkeit von heute kaufen konnte, Objekte, dachte er, die offenbar genügend Leute für eine Unentbehrlichkeit moderner Wohnkultur hielten, sodass diese Läden florierten. Auch Kathie Bechler, die jetzt vielleicht ebenso wie er in einen Hauseingang gedrückt wartete, bis das Schlimmste vorüber war, hatte ihre Wohnung mit allerlei Plüsch und Plunder ausstaffiert, was ihn gestört hatte, als er dort einmal ein Storyboard abgegeben hatte. Vielleicht kompensierte sie so die Stromlinienförmigkeit der Dinge, Worte und Gedanken, mit denen sie täglich in der Agentur umging. Diese stilistische Gelecktheit war freilich auch sein Job: Er stellte sie her und liebte sie so, wie man Geld liebt.
Ein zweiter, deutlich schwächerer Blitz, dessen Gelb durch die Streifen des Regens fiel wie das Licht einer Glühbirne durch einen windbewegten Vorhang, zuckte auf, und der nachfolgende Donner rollte aus großer Distanz, versöhnlich. Die Güsse begannen zu zögern, wurden feiner, verloren sich zu einem dünnen Schleier, der schließlich ganz verschwand. Als Jessen die Hand ins Freie streckte, kam nichts mehr.
Das Wasser gurgelte über Gehweg und Fahrbahn den Gullys entgegen. Er überquerte den schimmernden Asphalt und warf von der anderen Straßenseite einen Blick auf die Schaufensterfläche des Ladens, in der sich das abziehende Gewitter spiegelte. Als Gebirge und Türme stiegen mächtige Wolkenmassen vertikal nach oben, wo sie sich in Form eines Ambosses ausbreiteten. Unten, fast auf den Hausdächern, standen noch gleichmäßig tief Regenwolken, die sich aber schon langsam hoben. Jessen sah zum Himmel, dann wieder auf dessen Spiegelbild im Fenster, wo es sich mit den Gegenständen der Auslage vermischte, Silberbestecke umwogte, steife Uniformen in Bewegung setzte, ein Cello umspielte, durch einen Petticoat fuhr, blasse Fotografien halb enthüllte, halb verdeckte. Vor diesem rasch wechselnden, ineinander bewegten, lebendigen Bild sah sich Michael Jessen nun als ein drittes Bild den Bildern im Rahmen des Schaufensters entgegengehen. Plötzlich tauchten zwei kleine Flugzeuge vor dem Grau des Wolkenturms auf, leuchtend rot und seltsamerweise Doppeldeckermaschinen, wie sie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts aufgekommen waren.
Ein Schauflug?, dachte er. Bei diesem Wetter?, drehte seine Augen wieder zum Himmel zurück, aber dort wirbelten nur die Wolken, und von irgendwoher fielen Strahlen der Abendsonne über die Dächer, wie manchmal Licht durch den Bühnenvorhang in den abgedunkelten Zuschauerraum dringt.
Jetzt stand er unmittelbar am Fenster, legte das Gesicht ans Glas, über das ablaufende Regentropfen Muster malten, und schirmte sein Gesichtsfeld mit beiden Händen ab. Nichts spiegelte mehr. Direkt vor ihm stand, auf einem Gründerzeitbuffet, ein Ölgemälde in einem ausladenden Goldrahmen. Es zeigte zwei rote Flugzeuge, jene Doppeldecker, die er wegen des Ineinanders von Bild und Spiegelbild eben am Himmel gesehen zu haben glaubte. Die Flugzeuge standen auf einem nahezu farblosen, gleichwohl unruhig wirkenden Hintergrund. Eine der Maschinen schien zu stürzen, war in der Bewegung auf den linken, unteren Bildrand festgehalten und zog einen weißen Schleier hinter sich her. Aufmerksamkeitswert eins a, dachte Jessen. Aus dem Motor schlugen Flammen, der Schleier war Rauch, und Jessen war er im ersten Moment vorgekommen wie die Kondensstreifen, die er heute Nachmittag beobachtet hatte. Kriegskitsch, dachte er. Vierzehn–Achtzehn, stieß sich von der Scheibe ab und ging kopfschüttelnd weiter. Kurze Hose, Holzgewehr. Wer so was wohl kauft, möcht ich wissen.
Kerzenlicht flackerte unruhig über die weiß getünchten, rustikal verputzten Wände des Restaurants, das etwa zur Hälfte besetzt war. Aus versteckten Lautsprechern rieselten italienische Schlager, gläsern spiegelte das Buffet mit den Vorspeisen. Kathie war nicht zu sehen. Ein Kellner kam auf den umherblickenden Jessen zu und führte ihn auf seine Frage nach dem reservierten Tisch in eine ruhige Nische.
»Signorina«, lächelte der Kellner etwas zu beflissen, »wartet schon.«
Auf dem für zwei Personen gedeckten Tisch stand ein Glas Aperitif, und Jessen bestellte sich ebenfalls einen Martini. Dann sah er Kathie aus dem dämmrigen Hintergrund des Lokals auf sich zukommen. Sie trug den schwarzen Lederrock, in dem sie ihm zum ersten Mal aufgefallen war, darüber ein tief ausgeschnittenes, spitzenbesetztes Unterhemd, das, da seit seiner Fabrikation fünfzig Jahre vergangen sein mochten, inzwischen als Oberbekleidung in Mode war. Ihre gebräunte Haut stach dunkel von den dünnen Trägern ab, ihre Zähne blitzten weiß, als sie Jessen lächelnd begrüßte und erklärte, sie habe sich nach dem Schauer nur schnell ein wenig frisch machen müssen.
Er musterte unverhohlen ihr makellos geschminktes Gesicht. Sie hielt dem Blick gelassen lächelnd stand, hob ihr Glas. Sie stießen an. Sie sagte etwas, doch Jessen lauschte auf das Klirren der Gläser, denn für einen kurzen Moment hatte er den Eindruck, als zöge dieses Geräusch eine farbige Linie durch die Luft.
Sie tauschten allerlei Belanglosigkeiten, streiften das Wetter, landeten jedoch schnell bei Jessens Arbeit an dem Blitz-Weiß-Layout. Kathie erinnerte ihn daran, dass bis zum Abgabetermin, bis zur, wie sie sagte, ›deadline‹, nur noch wenige Tage Zeit wären.
»Kein Problem«, nickte er. »Ich hab da ’ne gute Idee. Wolken am Himmel …«
»Wolken sind gut«, unterbrach ihn Kathie. »Weiß, weich. Wolken, ja …«, sagte sie fast träumerisch.
»Oder Kondensstreifen von Fliegern«, hörte er sich sagen und wusste zugleich, dass der Vorschlag unsinnig war.
»Kondensstreifen?«, lachte sie dann auch. »Mach keine Witze. Das ist doch keine Kampagne für die Bundeswehr.« Sie bestellten das Essen, bestellten Wein. Aßen. Tranken. Sprachen von neuen Filmen, neuer Musik. Jessen fiel das Bild ein, das er vorhin im Schaufenster gesehen hatte; er öffnete schon den Mund, um ihr davon zu erzählen, aber dann wusste er nicht, warum er darüber sprechen sollte, wusste auch nicht, was dazu zu sagen sei.
Seltsam, dachte er, während Kathie von einem Popkonzert erzählte, das sie gestern besucht hatte, dieser Tropfen hier am Rotweinglas läuft genauso herunter wie der an meinem Spiegel, genauso wie der an der Schaufensterscheibe, hinter der dies Bild steht. Er hielt das Glas dicht vor sein Gesicht, sah Kathies Gesicht durch das Glas gebrochen, rot gefärbt vom Wein. Spiegelungen, dachte er, Spiegelungen eines Auges in einem einzigen Tropfen, tausendfältig vervielfacht, tausend- und abertausendmal. Augen, dachte er, als er das Glas wieder absetzte und in Kathies grüne Augen blickte, die Augen widerspiegeln. Kathie sprach nun von einem Film, und Jessen hörte durchaus, was sie sagte, aber parallel zu der Aufmerksamkeit, die er ihr entgegenzubringen versuchte, liefen wieder Assoziationen in ihm ab, gegen die er sich nicht wehren konnte. Spiegelungen, durchkreuzt von Spiegelungen. Gesichter, die aus dem geisterhaften Licht des Filmprojektors hervorschwimmen oder im unbewegten Wasser der Ostsee Gestalt annehmen. Aber gibt es überhaupt vereinzelte Gewässer? Gibt es überhaupt vereinzelte, feste Formen? Schichten sind da, Schichten über Schichten, Strömungen, durchwoben von Gegenströmungen, viele Wasser, sehr viele Tropfen, schwer zu unterscheiden.
Wegen der Witterung wirkte der leichte Wein schnell und schwer. Zwei Augenpaare drangen ineinander, verschleierten sich flüchtig, als erblickten sie die Ziellosigkeit ihrer Annäherung. Jessen sah sein Gesicht in ihren Augen, sah seine grauen Augen, die schwarzen, kurz geschnittenen Locken, die etwas zu breite Nase, sah seine unregelmäßigen Zähne blitzen, wenn er sich sprechen sah, fragte sich, ob sie ihn so sähe, wie er sich in ihren Augen zu sehen glaubte.
»Ich bin etwas beschwipst«, sagte er und fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. »Etwas überarbeitet wohl auch.«
Sie tranken Espresso, dessen Schwarz im weißen Rund der Tasse Jessen für einen Moment an etwas erinnerte. Er musste über sich selbst lächeln, freute sich, dass Kathie dies Lächeln erwiderte. Sie zahlten.
»Getrennt?«, fragte der Kellner.
»Zusammen«, bestimmte Kathie, und als Jessen abwehren wollte: »Geht auf Spesen. Arbeitsessen. Erst die Arbeit …«
Er legte einen Arm auf ihre Schulter. Sie schlang einen Arm um seine Hüfte. Als sie an dem Laden vorbeikamen, in dessen Eingang er Schutz gesucht hatte, sah er ein Schild im Fenster hängen, das er vorhin übersehen hatte.
FUNDGRUBE GESTERN UND HEUTE
Inhaber: Karl P. Wuttke – Vormals
Dies wehmütige, nur auf Firmentafeln gebräuchliche ›vormals‹ – und dann folgte irgendein Name, ausgeblichen.
»Hier war das«, sagte er und blieb vor dem Bild stehen, das in der Dunkelheit kleiner wirkte und tiefer und ferner ins Schaufenster hineingerückt schien.
»War was?«, fragte Kathie.
»Eine seltsame Spiegelung. Ein Bild im Bild«, murmelte er mehr zu sich selbst als erklärend.
»Ja, Wuttkes Laden«, wusste Kathie. »Da kann man gute Schnäppchen machen. Neulich habe ich hier erst ’ne Tiffanylampe gekauft. Fast echt.« Sie lachte. »Der alte Charly ist ein netter Typ. Lässt mit sich handeln. Haut einen aber auch gern übers Ohr, wenn er merkt, dass man keine Ahnung von Antiquitäten, aber Geld hat. Ich kenn den Charly schon lange. Neuerdings ist er aber ziemlich unfreundlich und …«
Kathies Art zu reden hatte etwas Leichtfüßiges, etwas, das Jessen sonst unweigerlich anzog, aber heute Nacht, während sie in seinem Wagen zu ihrer Wohnung fuhren, ging ihm diese Art auf die Nerven; manche ihrer Worte, keine bestimmten, vielleicht nur der leichte Klang, in dem sie aus ihrem Mund kamen, taten ihm fast körperlich weh. Ihm wurde immer unbehaglicher. Er spürte, dass ihm die Sache, auf die sie zusteuerten und die er sich gewünscht hatte, keinen Spaß machen würde. Seine Gedanken kreisten fremd über ihm selbst. Er starrte auf Wassertropfen an seiner Windschutzscheibe, war fasziniert vom Aufglühen der Ampeln im glitzernden Blauschwarz der langsam trocknenden Nacht.
Ich glaub, ich bin krank, wollte er sagen, aber da waren sie schon vor ihrer Wohnung.
»Champagner ist kalt gestellt«, sagte sie lächelnd, als sie die Haustür aufschloss.
Er blickte sie von der Seite an. Ja, sie sah gut aus. Sehr gut sogar. Er starrte auf die Spitzen ihrer Brüste, die sich unter dem Hemd abzeichneten. Aber er fürchtete sich vor der Berührung, suchte nach Gründen für diese Furcht, fand ihr gepflegtes Make-up. Ich hasse solches Make-up. Dies Gepuder, dachte er, doch im kalten Licht des Fahrstuhls bemerkte er plötzlich den weißen Schimmer, einen niedrig über der Haut schwebenden Schleier von etwas getrübter Milchfarbe, und dann einen warmen Schatten im Rot ihres geöffneten, sprechenden, lachenden Mundes, und dieser Schleier und dieser Schatten stimmten ihn versöhnlich. Für einen Moment spürte er die Zärtlichkeit, auf die er gewartet hatte, sodass nicht sie ihn küsste, sondern zwei Lippenpaare sich trafen in diesem nach oben gleitenden Aufzugskuss.
Das Bett stand vor der geöffneten Balkontür, durch die Licht von Bogenlampen hereinfiel, Fetzen des abflauenden Windes. Aus großer Entfernung konnte man noch das Gewitter hören oder doch ahnen.
Sie verschwand im Bad, ließ die Tür offen stehen und rief durch das Rauschen der Dusche, der Champagner stünde im Eisschrank und die Gläser auf dem Tisch, und er solle doch schon mal anfangen. Gierig, ohne durstig zu sein, stürzte er ein Glas in einem Zug hinunter. Was tat er hier? Gier ohne Durst. Affären ohne Liebe. Lebte er so dahin? Jedenfalls arbeitete er auch so – indem er Bilder schuf, die mit ihm nichts zu tun hatten.
Sie kam aus der Badezimmertür, schaltete das Licht aus. Er sah ihren Körper auf sich zukommen. Weiße Streifen, vielleicht Licht von der Jalousie, vielleicht Bikinispuren, um Hüften und Brüste. Der Körper, nach dem er sich undeutlich gesehnt hatte, bot sich ihm an, aber er war unfähig zuzugreifen. Sie legte sich mit dem Bauch aufs Bett. In der Rille ihres Rückgrats sammelten sich Wassertropfen, ein schwaches Rinnsal, das im undeutlichen Licht kupplerisch reflektierte. Etwas erregte ihn, doch als er sich neben sie legte und die Tropfen aus dem Blick verlor, ließ die Erregung sofort wieder nach, sodass er sich erleichtert fühlte, als sie Spaß daran fand, ihn auszuziehen.
Nichts tun, sich treiben lassen. Was geschieht, geschieht. Alles kommt auf mich zu. Weglaufen aus diesem Leben, eine kleine Hütte an einem fernen, exotischen Strand. Ins Licht sehen und malen, was das Licht einem zuträgt.
»Mein müder Held«, flüsterte sie einmal, und damit kam in ihm automatisch das Leistungsbewusstsein hoch, das ihn so erfolgreich durch Beruf und Privatleben führte. Er fühlte sich verpflichtet, das zu geben, was von ihm erwünscht, erwartet wurde. Auch dies war ein Tausch, der ihm nun zu gefallen begann, und sie schien hochzufrieden mit seinem entschlossenen Sinneswandel, und er dachte, dass sie auch allen Grund haben müsse, mit ihm zufrieden zu sein, denn er strengte sich wirklich an, verausgabte sich, dachte an nichts als diese Leistung oder doch wenigstens fast nur daran, wobei sein Kopf leichter wurde und es ihn nicht einmal mehr störte, dass sie »gut« sagte oder auch »Ja so« und am Ende gar »ach du«, und ihm den Schweiß vom Gesicht wischte.
Er sah sie gern liegen auf der Kühle der Laken, von denen der Körper sich kontrastreich abhob, ruhiger wurde in den verebbenden Atemzügen. Als Maler, dachte er, als Künstler, hätte man hier ein Motiv. Aber durch diesen Gedanken fuhr der Blitz-Weiß-Schriftzug wie ein erhobener Zeigefinger.
Schließlich, sie schlief schon tief, fühlte sich auch Jessen ins Schwarze gezogen, als das Geräusch eines vorbeifahrenden Wagens ihn wieder hochschrecken ließ. Nun war er wacher als zuvor. Scheinwerferglanz an der Zimmerdecke strich weißlich, schleierhaft, mechanisch stockend über Wände, brach in den Kanten. Von den Bogenlampen auf der Straße fiel Licht in den Raum, aber dies Licht und die dazugehörenden Schatten waren ungeordnet, verdorben, überdeckten einander und waren als Farben kaum zu identifizieren. Jessen begann darüber nachzugrübeln, warum man längere Zeit braucht, um eine Farbe überhaupt zu erkennen, dann jedoch, hat das Verständnis seine entscheidende Richtung genommen, immer rascher von der Farbe sich überzeugen lässt. Wie aber, dachte er und fragte sich zugleich, warum er das dachte, bei Schwarz, Weiß oder Grau, diesen Unfarben, diesen Schatten, diesen Helligkeitswerten, Dunkelheitswerten, diesen – was wusste er denn, und was ging es ihn eigentlich an?
Vielleicht war es auch eine ganze Reihe von Fahrzeugen gewesen. Der Glanz wurde in einer weit geschwungenen Linie vom Kopfende des Bettes begrenzt, drückte dabei das Bett tiefer zu Boden, verbreiterte es, als ob nicht nur Michael Jessen und Katharina Bechler darin Platz finden mussten, sondern die ganze Reihe von Figuren und Gestalten, die er über Bett- und Zimmerdecke wandern sah, über die Wände, Figuren, die aus Kondensstreifen fielen, Menschen, die er nicht kannte, nie gesehen hatte, oder vielleicht doch schon einmal, gekleidet in vergangene Moden, gewesene Gesichter, Gestalten, die sich an den Händen gefasst hielten und schleppenden Schritts wie in einer Prozession durch die Kette der Generationen gingen. Der Glanz hob die Zimmerdecke über dem Bett, die Decke wurde durchsichtig wie die Schaufensterscheibe des Trödelladens in jener Parallelstraße, viele, zu viele Reflexionen und Irritationen des Lichts, und diese Gestalten huschten durch das Glas in die Auslagen hinein und verschwanden eine nach der anderen in dem Bild, als ob sie darin zu Hause wären. Endlich versank ihm alles zu einer grauen Gleichgültigkeit, und er schlief traumlos in den Morgen, fühlte die kurze Abkühlung, sah weiße Schlieren in eine blaue Masse rinnen.
Als er erwachte, war es warm im Raum. Um seine geschlossenen Augen schwamm ein Schimmer, rötlich, ausgelaugt, energiearm, der sich jedoch schnell mit einem Ausdruck von angenehm luftigem Schweben mischte und zu einem rosa Duft verwandelt schien, etwas zu süßlich. Die Augen aufschlagend, die Sonne stand schon im Zimmer, sah er den Duft. Er entströmte dem blassrosa Kärtchen, das neben ihm im Bett lag. Kathies Handschrift war kindlich, unzusammenhängend, fiel an den Zeilenenden ab:
Guten Morgen! Es war schön mit Dir. Musste früh raus wegen des Herrenmode-Briefings. Ihr Freien habt’s gut. Bitte, denk an das Layout. Und ruf mich an. Ich mag Dich.
Kuss, Kathie
Jessen duschte, verließ die Wohnung, um in einem Café an der Alster zu frühstücken. Das Gewitter hatte kaum Spuren hinterlassen. Vielleicht, dass die Stadt, die um den See in ihrem Zentrum schon glänzend genug war, an diesem Tag noch eine Nuance blanker schien. Staub und Dunst der letzten Wochen waren abgeregnet worden, und es würde eine ganze Zeit dauern, bis der alte, stickige Zustand wiederhergestellt sein würde. Segelboote zogen weißleinene Dreiecke gezirkelt auf das Blau des Wassers, das von so unbewegter Glätte war, dass seine Säume sich an den Pfählen des Landungsstegs, auf dem das Café stand, kaum kräuselten. Hoch flogen Schwalben. Er blickte ihnen nach, entschlossen, endlich den Auftrag zu erledigen. Wieder waren Flugzeuge am Himmel, Flieger über der Stadt. Und wieder Kondensstreifen. Plötzlich kam alles zurück, was am Tag zuvor und während dieser Nacht durch seine Augen gegangen war, in seinem Gedächtnis festsaß.
Verärgert über dies unproduktive Nachhängen, das manchmal kam, ohne dass er es verhindern konnte, das er aber nicht liebte, wenn er unter Termindruck stand, schlug er dem Frühstücksei den Kopf ab. Das Dotter troff auf das weiße Blech der Tischplatte, zerlief in Kratzern des Metalls. Was war mit ihm los? Was tat ihm das Wetter? Was war da gewesen, gestern im Gewitter, im Eingang dieses Trödelladens? Was war das für ein Bild? Es war etwas mit dem Bild. Oder an dem Bild. Oder in dem Bild. Oder zwischen ihm und dem Bild. Oder war er nur überarbeitet? Unausgeschlafen? Oder wollte er sich ablenken lassen von dem Job, der auf ihn wartete? Oder von der Frau, der er diesen Job verdankte und die auf seinen Anruf wartete? Hatte er sich nicht schon hinreichend bedankt heute Nacht?
»Bitte«, krächzte eine stimmbrüchige Stimme, und ein Junge, der ein Star-Wars-T-Shirt trug, legte Jessen ein Flugblatt in die Eigelblache. Grellrot, schwarze Lettern im Billigsatz:
Große Motor-Kunstflug-Show.
Kommen! Sehen! Staunen!
Er drehte das Blatt hastig um, rief nach dem Ober, bestellte ein Glas Sekt, um sich in Form zu bringen.
»Und räumen Sie bitte schon ab. Ich fühle mich belästigt.«
Er machte eine Handbewegung über die gesamte Alster hin, bezog die Türme der Stadt, die Hochhäuser mit ein, den ganzen Himmel. Der Ober zog die Brauen hoch, wischte die Tischplatte sauber, brachte den Sekt. Jessen zahlte, trank, holte seinen Wagen vor Kathies Wohnung ab und fuhr nach Hause.
In seiner Post lag die Einladung zu einer Ausstellungseröffnung am gleichen Abend. Benjamin Waldhoff, Jessens Freund und Studienkollege von der Kunsthochschule, stellte aus. Kunst, Jessen schüttelte den Kopf. Waldhoff, der Spinner. Na ja, man wird sehen.
Er begann zu arbeiten, nachdem er die Rollos heruntergelassen hatte und der Raum in ein gleichmäßig gedämpftes Licht gefallen war. Zügig grundierte er die Fläche mit seinen Magic-Marker-Filzern dunkelblau, ein strahlender Himmel wie der über Hamburg, die Stifte quietschten leise, wenn sie sich am Papier rieben und weiße Schäfchenwolken in diesen ewig blauen Himmel schrieben. Er verschob den Blindschriftzug der Headline von hier nach dort, sah mit schräg gelegtem Kopf, einige Schritte vom Tisch zurücktretend, darauf, hantierte mit dem Firmenlogo, riss mit gelben Filzern blitzartige Strukturen hinein.
Eigentlich, dachte er, ist es ja ein Waschmittel. Und keine Kampagne für die Elektrizitätswerke. Er lachte in sich hinein. Ginge aber doch. Dynamisch irgendwie. Man müsste nur den Slogan ändern. Ein Weiß, das Sie durchzucken wird. Zum Beispiel. Ha. Er schmunzelte. Bin ich der Texter? Textarbeit zahlt mir keiner. Oder wie, wenn ich ein Flugzeug hereinbrächte? Ein Flugzeug, das den Schriftzug strahlend weiß an den Himmel zeichnet? Kondensstreifen. Dramatisch würden die stehen auf diesem satten Navy-blue.
Er skribbelte flüchtig an Flugzeugumrissen, es gelang nicht mit Blau. Er griff zum roten Filzer – und plötzlich lag ein Doppeldecker vor ihm.
»Scheiße«, fluchte er leise. Dann schoss ihm das Bild durch den Kopf. »Verdammte Scheiße«, sagte er laut.
Seine Hand zitterte. Wütend warf er den Stift in eine Zimmerecke, zerknüllte die Papiere, stützte den Kopf in die Hände, starrte gegen das Zwielicht, das durch die Rollos brach.
Da war etwas. Es hatte sich in ihm eingenistet. Bohrte. Rumorte.
»Möchte doch wissen«, murmelte er vor sich hin. »Möchte doch wirklich wissen.«
Was er wissen wollte, wusste er aber nicht.
Er fuhr hin, fand einen Parkplatz direkt vor dem Laden. Als er ausstieg und die Wagentür zuschlug, sah er eine junge Frau in den kurzen Eingangsflur gehen, an den Türknopf fassen, ziehen, mit den Schultern zucken. Sie drehte sich ihm zu.
»Geschlossen?«, fragte er.
Sie lächelte ihn an, großäugig, strahlend blau, einige feine Falten belauerten schon die Lider, die sie wegen der Sonne leicht zusammenkniff. In den fast schwarzen Locken blitzte es hier und da grau.
»Ja«, sagte sie. »Mittagspause«, lächelte ihm nochmals zu und verschwand die Straße hinunter in der Hitze.
Überflüssigerweise, als glaubte er ihrer Erfahrung nicht, zog er ebenfalls am Türknopf, fluchte.
Das Bild stand immer noch auf dem Buffet, wirkte aber jetzt in der Helligkeit größer als gestern Abend. Mit verschränkten Armen stand Jessen steif vor der Scheibe. Gestern hatte er das Bild nur zur Kenntnis genommen, flüchtig gesehen. Jetzt sah er es an. Ganz unbeholfen waren die Flugzeuge gemalt, deren Piloten nicht erkennbar waren. Es hatte Ähnlichkeit mit naiver Malerei, doch war der Strich anders, verkrampft, aggressiv, manisch. Jessen fand keine Begriffe dafür. Ein verzweifelter Versuch, in einer eher unrealistischen Atmosphäre realistisch zu sein oder zu bleiben, hielt die Umrisse der Doppeldecker zusammen. Aber sie wirkten nicht geschlossen, schienen auseinanderfallen zu wollen. Zweifellos war es die Arbeit eines Dilettanten, eines Amateurs, möglicherweise unter dem Einfluss des magischen Realismus der Zwanzigerjahre. Sehr viel feiner schien dagegen der Hintergrund ausgeführt zu sein, ein eigentümlich farbloser, fast monochromer Himmel, der nicht genau zu erkennen war, dessen Struktur aus der Entfernung aber wie eine Landschaft wirkte oder wie ein heftig bewegtes Seestück.
Blickte er länger darauf, traten die Flugzeuge in den Hintergrund, ihre Farbe schien abgesaugt zu werden von dem leblosen Kolorit, auf dem sie standen. Die Lebendigkeit des Bildes nährte sich aus seinen wenigen, starken Farbeffekten, aus der unbeholfenen Besonderheit, ja Absonderlichkeit, mit der der unbekannte Maler die Bewegung der Flugzeuge darzustellen und in der Bewegung zugleich stillzustellen versucht hatte. Doch diese Lebendigkeit verströmte etwas Abgelebtes, zog vom Betrachter fort in Richtung des Weißen und Schwarzen, aus dem der Fond gemischt und komponiert war, verlor sich dort in unbestimmter Allgemeinheit, als söge das Grau alle Farbigkeit in Bedeutungslosigkeit hinein. Die undurchsichtige Geschlossenheit der aggressiven Rotflächen wurde nahezu transparent, fixierte Jessen den Hintergrund. Allerdings ließ sich dieser Hintergrund nicht fixieren, wie man sonst einen Gegenstand, eine Person, einen Punkt oder eine Farbe fixiert: Vielmehr wirkte er wie ein Magnet, demgegenüber Jessens Augen Eisenspäne waren, die sich seiner Kraft zuordnen mussten.
In der gedankenlosen Betrachtung der ersten Sekunden hatte Jessen diesen Sog nicht bemerkt. Nun, als er ihn wahrnahm, weil er zu denken begann (oder begann er zu denken, indem er ihn wahrnahm?), als er blinzelte und sich die Augen rieb, war er wieder Herr seiner Sinne – aber er merkte nicht (wie er es eigentlich nie in der letzten Zeit merkte), dass diese Beherrschung der Sinne im Denken zu seiner schleichenden Entsinnlichung beitrug.
Vielleicht, dachte Jessen, muss die Lebendigkeit eines Kriegsbilds so gebrochen sein, selbst wenn es wie dies hier ganz offensichtlich den Krieg verherrlicht. Vielleicht muss diese zweifelhafte Verherrlichung so widersprüchlich ausfallen, so in ihr Gegenteil umkippen, ins Sterbende, Tote, wie ja auch das brennende Flugzeug aus dem Bild herauszufallen scheint ins Leere, ins Ungerahmte, ins Bilderlose.
In Jessens bildervernarrtem Kopf regte sich Furcht vor solcher Bilderlosigkeit. Denn wirklich war ihm nur, was als Bild erschien. Und begreifbar, beeinflussbar, veränderbar war ihm nur, was er selbst zum Bild machen konnte. Das Unbehagliche, die Irritation dieses Bilds im Schaufenster, das er nicht einmal in seiner ganzen Tiefe erkennen konnte, bestand eben darin, dass die bilderlose Leere nicht außerhalb des Rahmens war, sondern hinter dem Dargestellten zu warten schien.
Er spürte ein Ziehen im Nacken, wandte sich gewaltsam ab, blickte die Straße hinunter, die flimmernd vor sich hin döste. Kein Mensch. Kein Verkehr. Nicht einmal ein Hund im Schatten. Von weit her tönte die Hauptstraße, ein gleichmäßiges Rauschen.
Es war nichts. Er straffte sich. Und weil es nichts war, ging es ihn nichts an. Es war nicht einmal gut gemacht. Optische Täuschungen bestimmten Jessens Wahrnehmung. Das verdammte Wetter. Optische Zufälle. Und er fiel darauf herein. Er konnte es sich nicht leisten. Werbung war Kalkül, war das genaue Gegenteil von Zufällen. Er hatte optische Täuschungen herzustellen, auf die dann die Verbraucher hereinfielen, doch um diese Täuschungen produzieren zu können, durfte er sich ihnen nicht selbst unterwerfen. Er musste klar blicken. Der Zufall war nicht sein Geschäft. Der Zufall war sogar geschäftsschädigend. Der Glaube an den Zufall war die Flucht vor Arbeit, das Ausweichen in Träume von plötzlicher Intuition und nächtlichen Musenküssen. Geschenkt, der Zufall. Er schenkte ihn den Künstlern. Waldhoff hatte damals diese Träume geträumt, Benjamin Waldhoff, ein exzellenter Zeichner und, zumindest früher, während des Studiums, ein noch besserer Zecher. An ihm war ein Art-Director verloren gegangen. Die McLinn hätte ihn genommen mit Kusshand. Natürlich hätte er sich den Künstler abschminken müssen.
»Der Zufall«, erinnerte sich Jessen plötzlich, als er zurückfuhr, »der Zufall«, hatte er einmal zu vorgerückter Stunde am Tresen ihrer Stammkneipe Waldhoff zugelallt, »der Zufall, Mensch, das ist doch bloß die Blauäugigkeit in Person.«
»Unsinn«, hatte Waldhoff hilflos geantwortet, lange ins Glas geschaut, das vor ihm stand, dann jedoch nach mehreren Minuten des Schweigens, mit überraschend klarer Stimme den unklaren Satz gesagt: »Aber der Zufall hat blaue Augen.«
Benjamin Waldhoff
BLAUE AUGEN
Aquarelle
stand vorn auf dem Faltblatt, das innen die Preise auflistete, die für die Aquarelle verlangt wurden. Jessen lächelte nachsichtig.
Die kleine Galerie, kurz hinter den Landungsbrücken, am Fischmarkt vorbei, direkt am Hafen, man blickte auf Masten, Schornsteine, Kräne, Speicher, war brechend voll. Außen roch es nach Elbe, innen nach schwarzem Tabak und Rotwein. Jessen kannte viele der Besucher. Was hier rauchend, redend, rotweintrinkend herumstand, durchweg einheitlich schwarz gekleidet, war jener Teil seiner Vergangenheit, für den er sich zwar nicht gerade schämte, der ihm aber peinlich war: seinen heutigen Kollegen und Auftraggebern gegenüber, weil freie Kunst in deren Augen nicht bloß brotlose, wenn auch schöne Spielerei war, sondern für einen erfolgshungrigen, durchsetzungsfähigen Werbegrafiker, der es vielleicht sogar einmal zum Art-Director bringen wollte, erfahrungsgemäß eher abträglich. Die Ästheten, die die Hochschule für Bildende Künste entließ, bekamen in den Agenturen nicht selten Probleme, da sie sich nicht damit abfinden konnten, nun nicht mehr ihre eigenen Ideen darzustellen, sondern die dem Markt nützlichen, die zündenden Verkaufsideen, weil sie nicht mehr ihre Träume und Fantasien zu zeichnen, sondern mit geschmeidiger, möglichst kritikloser Anpassungsfähigkeit die Traum-, Glanz- und Wunschwelten zu erfinden hatten, die Normalverbraucher hegen sollten. Und dann saßen sie häufig da und arbeiteten nicht mehr mit heißem, sondern höchstens noch mit halbem Herzen und träumten doch allesamt heimlich immer noch den Traum des freien Künstlertums.
Jessen war früh genug ausgestiegen aus diesem Studium, und doch kam es ihm manchmal so vor, als hafteten die acht Semester Malerei wie hartnäckige Farbflecken an seinen Fingern. Er übertünchte diese Flecken mit sauberer, schneller Arbeit.
»Spitzenmann«, hatte ihn einmal Peter Scharfenthal, Creative Director der McLinn, genannt. »Spitzenmann, trotz Akademie …«
Jessen hatte in sein Lachen eingestimmt, erleichtert, zugleich unfroh, gequält.
Den vielen Künstler-Darstellern und den wenigen wirklichen Künstlern gegenüber war ihm seine, mit ihnen gemeinsame Vergangenheit deshalb unangenehm, weil er sich wie ein Verräter vorkam: jemand, der sich hatte kaufen lassen von den Interessenverwaltern, die mit selbstbestimmter Gestaltung nichts gemein hatten, ihr sogar den Hals zudrückten, indem sie den Geschmack bestimmten und damit die Absatzchancen für nicht dekorative, neue, ungewöhnliche Kunst schrumpfen ließen.
Obwohl er von allen Seiten freundlich gegrüßt wurde, zurückgrüßte, Hände schüttelte, Schultern klopfte, Küsschen bekam und austeilte, fühlte er sich fremd, deplatziert, einsam. Die Bilder, die er sehen, vielleicht sogar kaufen wollte, hingen dicht, schlecht ausgeleuchtet und waren überdies schon deshalb kaum zu betrachten, weil die drei engen Räume der Galerie vollgestopft waren wie ein U-Bahn-Waggon am Morgen.
Manchmal sah Jessen Waldhoffs Halbglatze zwischen Köpfen, sah seine randlose Brille aufblitzen, sah seinen mageren Hals mit dem riesigen Adamsapfel stengelhaft aus dem dunkelblauen Arbeitsoverall ragen, den er trug, seitdem Jessen ihn kannte. Er war sicher, dass auch Waldhoff ihn bemerkt hatte.
Mechanisch, abwesend, aber höflich, beteiligte sich Jessen am schwirrenden Small Talk, der sich um alles außer die ausgestellten Bilder drehte, wurde mehrmals um Zigaretten angeschnorrt, trank hastig einige Gläser des Weins, dessen übertriebene Tockenheit ihm sauer aufstieß, dachte einmal daran, dass Kathie wahrscheinlich versuchen würde, ihn anzurufen, war deshalb für einen Moment froh, hier und unerreichbar zu sein, dachte flüchtig an sein unerledigtes Layout, sagte zerstreut »tschüß«, und »hallo«, und »du auch hier?«, und »lange nicht gesehen«.
Plötzlich trompetete die Sirene eines von der Elbe in den Hafen eingeschleppten Tankers so gewaltig durch die Galerie, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Die Gewalt dieses dumpfen Tons riss für Sekunden alle Aufmerksamkeit an sich. So muss das gewesen sein bei Fliegeralarm, dachte Jessen, dies Erstarren, und als er sich, der Ton war schon verklungen, fragte, warum er auf solche abwegigen Assoziationen verfiel, stand das Bild in Wuttkes Schaufenster vor seinen Augen. Er zuckte zusammen bei dem Gedanken und beschloss, nach Hause zu fahren, um seine überreizte Erinnerung in Arbeit zu disziplinieren, um die Erinnerung, die ihn von der Arbeit abhalten wollte, mit ebendieser Arbeit zu besiegen.
Die Galerie hatte sich inzwischen fast geleert. Ein paar Unentwegte hockten oder standen noch plaudernd herum. Waldhoff selbst war nicht mehr zu sehen, und Jessen schlüpfte unbemerkt ins Freie, ging die Treppe zum Parkplatz hinunter. Auf dem Kühler seines Wagens saß, mit gekreuzten Beinen, Benjamin Waldhoff und grinste Jessen breit entgegen.
»Schön, dass du gekommen bist«, sagte er herzlich. »Eigentlich hab ich mit dir gar nicht gerechnet.«
»Klar doch«, murmelte Jessen. »War doch selbstverständlich.«
»Und?«, fragte Waldhoff unvermittelt, direkt. »Wie gefallen dir meine Arbeiten?«
»Gut, sehr gut.«
»Du hast sie dir ja gar nicht angesehen.«
»Hab ich doch. War nur etwas voll dadrinnen. Und dann das Licht, katastrophal.«
»Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Willst du die Bilder jetzt noch mal sehen?«
»Sicher.«
»Also gut«, sagte Waldhoff. »Hast du mal ’ne Zigarette? Danke.«
Jessen fingerte sich selbst eine aus der Packung. Der Schein des Feuerzeugs schmolz ihre beiden Gesichter für einen Augenblick zusammen. Sie rauchten. Schwiegen. Die letzten Besucher stolperten die Treppe hinunter, wankten lachend an ihnen vorbei.
»Klasse Ben«, lallte jemand im Vorübergehen. »Das ist der Durchbruch. Blaue Augen! Allein schon der Titel! Irre, Mensch, klasse, echt …«
Sie schwiegen.
»Zufall?« Jessen hob plötzlich die Stimme in die Stille.
»Du kannst dich erinnern?«
Jessen nickte. Waldhoff glitt vom Wagen herunter.
»Schönes Gerät. Nicht übel.« Er klopfte auf das Blech, wie man einem Pferd gegen den Hals klopft.
»Lass das jetzt«, sagte Jessen und trat ärgerlich seine Zigarette aus.
»O.k., o.k.!« Waldhoffs Stimme klang beschwichtigend. »Du willst die Bilder also wirklich sehen? Ansehen, mein ich, betrachten? Dann zeig ich sie dir jetzt.«
»Jetzt? So spät? Und das Licht?«
»Keine Ausreden. Da oben gibt’s auch Deckenlicht.«
Jessen fühlte sich gestellt, verhaftet und abgeführt, als sie die Stufen wieder hinaufstiegen und die Galerie betraten, in der einzelne Punktstrahler Licht an die Wände warfen, von wo es reflektierte und diffus die Räume ausleuchtete. Waldhoff schaltete die Deckenbeleuchtung ein. Neon flutete über das Chaos aus überquellenden Aschenbechern, leeren und halb vollen Weinflaschen und Gläsern. Jessen kniff geblendet die Augen zusammen, fand sich zwinkernd zurecht.
»So«, sagte Waldhoff und stieß ihm den Finger wie eine Pistole in den Rücken. »Jetzt hast du deine Chance, Mann.«
Er sagte das, als ob sie beide die Hauptrollen in einem Film der Schwarzen Serie spielten. Jessen lachte.
Waldhoff sagte: »Jetzt kannst du sehen.«
Ja, jetzt konnte er sehen. Im Getümmel der Eröffnung hatte er geglaubt, trotz der schlechten Sicht schon alles gesehen zu haben: Aquarelle, ausschließlich aus den unterschiedlichsten Blautönen komponiert, in verschiedenen Formaten, das kleinste wie ein Briefumschlag, das größte an die einmal ein Meter. Hügelige Landschaften, Strand- und Seestücke, Wolken, Wälder, Ebenen, hin und wieder hell dazwischen Häuser, alles aber menschenleer, lichtdurchflutet. Jessen war enttäuscht. Sicher, das alles war handwerklich sauber, aber langweilig, epigonal, ohne jede Überraschung, ohne Irritation. Was war aus Waldhoffs exaktem, oft provokantem Strich geworden? Passte er sich schon dem Publikumsgeschmack an? Im Übrigen war er ein Zeichner, kein Maler und schon gar kein Aquarellist.
»Italien?«, fragte Jessen schließlich, um überhaupt etwas zu sagen.
»Ligurien, ja. Ich hab da ein Zimmer gemietet, bei Sebastian. Müsstest du noch kennen von früher.« Jessen nickte. »Schön, doch doch. Durchaus, aber es reißt mich nicht vom Hocker.«
»Du stehst zu dicht davor«, unterbrach ihn Waldhoff und zog ihn etwa zwei Meter von der Landschaft zurück, vor der sie standen.
»Bisschen weit für das Format, was?«, sagte Jessen und legte den Kopf schief.
Dann sah er es plötzlich. Wie in einem Vexierbild lag über der gesamten Fläche des Bildes, nur aus diesem Abstand erkennbar, rein aus Farbabstufungen konturiert, in den Konturen jedoch verlaufend, ein menschliches Auge, in dessen Pupille alle Schattierungen des Blaus zusammenflossen. Stand man direkt vor dem Aquarell, erschien die Stelle als die Krone eines Baums, der den Mittelpunkt der Landschaft bildete.
»Ich sehe«, sagte Jessen verblüfft, machte die Runde durch alle Räume noch einmal, murmelte ab und zu »Ja, ich sehe«, stellte fest, dass sämtlichen Aquarellen Augen eingezeichnet waren, große einzelne über die volle Bildfläche, kleine Paare, die zwischen Bäumen hervorsahen als Felsen oder aus Wolken wuchsen, manchmal nur Pupillen, die als Sonne über den Dingen hingen. Aber immer flossen die Farben diesen Augen zu, oder sie flossen aus ihnen heraus, verdichteten sich in ihnen, strahlten aus ihnen zurück.
»Großartig«, entfuhr es Jessen, als er wieder vor Waldhoff stand. »Ben, das ist ja …«
»Lass mal, lass mal«, winkte Waldhoff ab. »Das sind Kindereien. Spielereien mit Farbe und Konturen. Vor allem mit Farbe. Mit Blau. Das sind unterhaltsame Bilder mit einer Idee in der zweiten Schicht. Ich nehm das nicht sehr ernst. Das ist für mich eine Phase zwischen wichtigeren Sachen, so«, er lachte, »einfach ins Blaue. Du weißt ja, ich hatte immer Probleme mit der Farbe, interessierte mich mehr für Konturen, für Formen. Zeichnete eben. Aber wenn ich als Künstler erwachsen werden will, muss ich durch die Kindlichkeiten der Farbe hindurchgehen. Was hier hängt, das könnten Illustrationen sein für Kinderbücher.«
Jessen wollte ihn unterbrechen, aber Waldhoff hatte seinen Faden gefunden. Er sprach nicht gern über seine Arbeit. Wenn er aber darüber ins Sprechen kam, stellten sich Gedanken ein, die ihm vorher unbekannt waren. Er verfertigte seine Ideen, indem er sie aussprach, fand Formulierungen für Zusammenhänge, die er sonst für unformulierbar erklärte.
»Diese Bilder«, sagte er hastig, als müsse er diesen Formulierungen nachlaufen, »sind Ergebnisse der Fantasie, nicht, noch nicht der Gestaltungskraft, auf die ich zuarbeite. Wenn man Farben sieht, erkennt man ziemlich genau den Unterschied zwischen Fantasieanschauung und wirklich schöpferischer Einbildung. Alle Formen nämlich, alle Umrisse, die ich wahrnehme, entsprechen mir selbst, indem ich sie hervorbringen kann. Wenn ich tanze, bildet mein Körper Formen nach. Wenn ich zeichne, bildet meine Hand Umrisse nach und eignet sie sich zugleich an. Dies Nachahmungsvermögen hat aber an der Welt der Farbe seine Grenze. Unsere Körper können die Farben nicht erzeugen. Unsere Körper entsprechen den Farben nicht schöpferisch, nicht gestaltend, sondern aufnehmend, empfangend. Und wo? Wo ist diese Empfangsstation?«
Er machte eine Pause und sah Jessen an. Der zuckte mit den Schultern. Was redete Waldhoff daher?
»Ich weiß nicht, Ben.«
»Im farbig schimmernden Auge, mein Lieber. Im Auge. Und das Sehen ist gewissermaßen die, wie soll ich sagen?, die Wasserscheide der Sinne, weil es Form und Farbe zugleich auffasst. Deshalb gehören dem Sehen nicht nur die aktiven Fähigkeiten an, Formensehen und Bewegung, Gehör und Stimme, sondern auch die passiven wie eben das Farbensehen, was eine Sinneswahrnehmung ist wie das Riechen und Schmecken. Kurz und gut: Reine Farbe ist ein Medium der Fantasie, die Wolkenheimat verspielter Kinder, nicht das strenge Medium eines bewusst arbeitenden Künstlers. Der hat beide Medien zusammenzubringen. Aber um das zu tun, muss er sich natürlich erst mal in der Farbe ausgetobt haben, muss sie kennen, um ihre Wirkungen kalkulieren zu können. Man muss wissen, um gestalten zu können. Und umgekehrt muss man, um die Wirkung des Gestalteten zu verstehen, ebenfalls wissen. Wenn ich hier aquarelliert habe, dann deshalb, weil ich mir die Farbe aneignen wollte, und zwar die durchsichtige, die …«
Er brach ab, ging zu einem Tisch und kramte dort in Papieren.
»Warte, Momentchen. Ich hab’s mir aufgeschrieben. Hier.« Jetzt las er tatsächlich vom Blatt ab.
»Die durchsichtigen Farben sind in ihrer Erleuchtung wie in ihrer Dunkelheit grenzenlos, wie Feuer und Wasser als ihre Höhe und ihre Tiefe angesehen werden können. Das Verhältnis des Lichts zur durchsichtigen Farbe ist, wenn man sich darein vertieft, unendlich reizend, und das Entzünden der Farben und das Verschwimmen ineinander und Wiederentstehen und Verschwinden ist wie das Odemholen in großen Pausen von Ewigkeit zu Ewigkeit, vom höchsten Licht bis in die einsame und ewige Stille in den allertiefsten Tönen. Die undurchsichtigen Farben stehen wie Blumen dagegen, die es nicht wagen, sich mit dem Himmel zu messen und doch mit der Schwachheit von der einen Seite, dem Weißen, und dem Bösen, dem Schwarzen, von der anderen zu tun zu haben.«
Waldhoff sah von seinem Zettel auf. Jessen blickte ihn kopfschüttelnd an.
»Was war denn das für ein Sermon?«, fragte er. »Die Theorie hast du doch gar nicht nötig.«
»Goethe«, sagte Waldhoff. »Ein schlauer Fuchs. Willst du noch mehr hören?«
»Nein, nein«, wehrte Jessen ab. »Das reicht.«
»Ist auch nicht so wichtig«, sagte Waldhoff und legte den Zettel beiseite. »Es hat mir nur gefallen, wie der Mann über etwas sprechen kann, was eigentlich nicht der Sprache angehört.«
Sie schwiegen eine Weile.
»Schmecken, sagtest du, ist eine passive Sinneswahrnehmung?«, fragte Jessen schließlich und zeigte auf eine fast volle Weinflasche. »Lass uns mal die Probe aufs Exempel machen.«
Sie setzten sich Schulter an Schulter auf den Fußboden, lehnten die Rücken an die Wand, streckten die Füße aus, reichten sich abwechselnd die Flasche zu, tranken, rauchten.
»Blau«, murmelte Jessen. »Warum ausgerechnet blau?«
»Die Stille ist der der Schönheit eigentümliche Zustand, wie die Ruhe dem ungestörten Meere«, sagte Waldhoff.
»Noch mal Goethe?«
»Nein, Schelling.«
»Kannst du das vielleicht auch etwas zeitgenössischer ausdrücken?«
»Klar. Welche Farbe kommt auf jeder Zuckerpackung vor?«
Jessen überlegte. »Blau, glaub ich.«
»Gut. Und warum?«
»Keine Ahnung.«
»Das solltest du als Werbeheini aber wissen. Weil die blaue Geschmacksempfindung Süße ist.«
»Hm«, machte Jessen. »Blau kommt aber auch auf Salzpackungen vor. Und Rot müsste demnach sauer sein. Könnte stimmen, wenn man diesen Wein auf der Zunge hat.«
Er reichte die Flasche an Waldhoff.
»Blau«, sagte der, trank einen Schluck und gab die Flasche zurück, »blau ist die Voraussetzung für jede Einfühlung, für jedes ästhetische Erleben, sogar für jedes Nachdenken. Dunkelblau ist, physiologisch gesprochen, die Farbe erregungsfreier Ruhe. Psychologisch die der Befriedigung, der Zufriedenheit, des Friedens. Die sinnliche Empfindung des Blaus ist Zärtlichkeit. Ihr Organ ist die Haut. Wir Deutsche als alte und notorische Romantiker haben für die Grundstimmung des Blaus ein Wort, das kaum übersetzbar ist: Gemüt. Blau ist die Erfüllung des Ideals der Einheit. Es ist die Zeitlosigkeit und damit übrigens auch die Tradition. Wo das Blau fehlt, wirkt alles bedrohlich. Die Ökologisten sagen mit Recht, dass das Grün aus unserer Umwelt verschwindet. Und damit das Leben. Man sollte aber auch auf das Verschwinden des Blaus achten, auf den Himmel sehen, auf die Meere, in die Ferne, in die Geschichte.«
»Und warum hat der Zufall blaue Augen?«
»Weil in der Kunst alles darauf ankommt, dasjenige festzuhalten, was dem Auge zufällt. Was das Licht dem Auge zufallen lässt. Nur darf das dann auf den Betrachter nicht zufällig wirken. Der Zufall muss verstanden worden sein, verarbeitet. Er muss gestaltet werden. Der Zufall ist das einzige Gesetz. Der Zufall ist die eigentliche Notwendigkeit. In der Malerei sowieso. In der Literatur – na, da kenn ich mich nicht so aus. Aber in der Geschichte wohl auch. Gestalten heißt: das Zufallende festhalten. Nicht vergewaltigen, sondern bannen. Aber flüssig lassen.«
»Flüssig lassen ist immer gut«, sagte Jessen und gab Waldhoff die Flasche. »Ist ja fast wie früher, Ben.«
Sie lachten. Jessen fühlte sich wohl, geborgen, auch wenn er Waldhoffs gedanklichen Höhenflügen nicht recht folgen mochte. Die Verspannungen der letzten Tage lösten sich zwischen dem kühlen Blau der Aquarelle.
»Wie früher, ja«, sagte Waldhoff leise. »Oder wie immer. Oder auch wie später.«