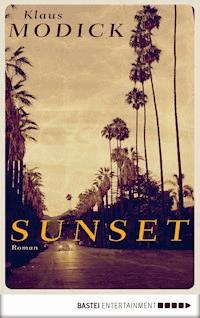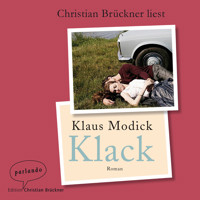9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Auf den Spuren eines Taugenichts. In seinem neuen Roman erzählt Klaus Modick von einer Zeit der Umbrüche, von einem jungen Mann, der sich weigert, nützlich zu sein, und seinem abenteuerlichen Roadtrip ins Offene und Ungewisse. Die Bundesrepublik in den turbulenten Siebzigern. Während an den Universitäten die Revolution geprobt und bundesweit nach den Mitgliedern der RAF gefahndet wird, sitzt ein junger Mann vor dem muffig-engen Elternhaus und trifft eine Entscheidung. Er packt ein paar Sachen, greift seine Gitarre und geht. Wenig später steht er an der Straße und reckt den Daumen in den Wind. Ohne Geld und Plan schlägt sich der selbsternannte Nichtsnutz über Wien und die Toskana nach Süden durch, trifft auf schräge Vögel, hoffnungslose Romantiker, zwielichtige Rocker, Hippies und die große Liebe, spielt als Troubadour im Batikshirt groß auf, entdeckt die magische Welt der Pilze, das unvergleichliche Licht Italiens und die unermessliche Freiheit der Straße. Unfreiwillig wird er dabei zum Protagonisten eines raffiniert eingefädelten Verwirrspiels, das die Grenze zwischen Tag und Traum auf märchenhafte Weise verschwimmen lässt ... »Fahrtwind« ist ein schillernder Roman über das Loslassen und Ausreißen, über unstillbare Sehnsucht, die Wirren der Liebe, den Rausch und die Kraft der Musik. Kunstvoll und einfühlsam porträtiert Klaus Modick einen modernen Taugenichts, der sich mit Witz, Ironie und Fantasie den gesellschaftlichen Konventionen und Zwängen seiner Zeit widersetzt. Und Eichendorff winkt aus der Ferne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Ähnliche
Klaus Modick
Fahrtwind
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Klaus Modick
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Motto
Einleitung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Copyright-Verzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Es war Illusion, liebe Freundin, alles Illusion, außer dass ich vorhin am Fenster stand und nichts tat, und dass ich jetzt hier sitze und etwas tue, was auch nur wenig mehr oder wohl gar noch etwas weniger als nichts tun ist.
Friedrich Schlegel Lucinde
Inhaltsverzeichnis
Gegenwärtig wäre nicht das zeitlose Jetzt sondern eines, das gesättigt ist mit der Kraft des Gestern.[1]
Theodor W. AdornoZum Gedächtnis Eichendorffs
Die Geschichte – genauer gesagt: die Idee zu der Geschichte –, die jetzt endlich erzählt werden soll, ist fast ein halbes Jahrhundert alt. Sie stammt aus einer Zeit, die in den Dateien meiner Erinnerung als märchenhaft oder jedenfalls romantisch gespeichert ist. Lebendig geworden ist sie, plötzlich und unerwartet, als ich wieder einmal Ordnung in meiner Bibliothek schaffen wollte. Zwar waren auch frühere Versuche gescheitert, das Chaos in den Regalen einzudämmen, aber immerhin hatte sich dabei eine gewisse Struktur herauskristallisiert.
Es gibt nämlich, erstens, jene Bücher, bei deren Lektüre mir das Herz aufging, die mich bewegten, mir galten und immer gelten werden, egal, ob ich sie noch einmal lese oder nur im Regal stehen lasse, wo sie eine freundliche Aura verströmen. Sie bilden den unveräußerlichen Bestand, das Herzstück meiner Bibliothek. Zweitens gibt es die Bücher, die ich mit Interesse, mit Vergnügen, manchmal auch nur mit Respekt gelesen habe, die ich aber nie wieder lesen werde. Ihr Verlust würde mir auffallen, aber nicht schmerzen. Dann sind da natürlich auch noch all die ungelesenen Bücher, versehen mit dem unsichtbaren Untertitel »Hoffentlich bald«, und jene hoffnungslosen Fälle, von denen ich weiß, dass sie stets ungelesen bleiben. Sie stehen im Regal wie aufgebahrt, trostlos und ungeliebt.
Und schließlich gibt es die verstellten, verschollenen, verrutschten Exemplare, die im Zwielicht zweiter Reihen davon träumen, wiederentdeckt zu werden. Zwischen fetten Staubmäusen stieß ich hinter der Hamburger Goethe-Ausgabe auf Joseph von Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts – ein zerfleddertes Reclam-Bändchen, aus dem ein paar vergilbte Zigarettenblättchen ragten, die wohl als Lesezeichen gedient hatten. Der Text war übersät mit Anstreichungen, und an den Rändern wimmelte es von gekritzelten Stichworten und kaum lesbaren Bemerkungen. Beim Blättern rieselten Tabakkrümel und Grasfitzelchen heraus, und die angebräunten Seiten verströmten einen leicht stockigen Muff, der in mir etwas längst Vergessenes weckte.
Denn plötzlich ich mich in einem von Zigarettenrauch durchwaberten Seminarraum wieder – Universität Hamburg, Philosophenturm, 4. Stock. Der Raum ist mit etwa fünfzig Studenten hoffnungslos überfüllt. Die weißen Resopaltische und die Stapelstühle aus Stahl und Hartplastik reichen für dreißig Personen. Wer keinen Platz erwischt hat, hockt auf Fensterbänken, Heizkörpern oder dem PVC-Fußboden. Angesichts des brav klingenden Themas »Liebe und Ehe in Romanen der Romantik« könnte der Andrang überraschen, aber der noch recht jugendlich wirkende Professor ist beliebt, weil er sich darauf versteht, im scheinbar Harmlosen das Rebellische und die Abgründe in spießbürgerlicher Behaglichkeit aufzuspüren.
Draußen vor den Fenstern hängt nasskalt und grau die Nebelsuppe eines norddeutschen Winters, während in die funktionale Hässlichkeit des Philosophenturms Eichendorffs Taugenichts Einzug hält, um mit der Geige im Arm als Troubadour zu einer Tournee ins Blaue und Helle aufzubrechen. Ich bin begeistert von dem namenlosen, abenteuerlustigen, schlagfertigen Bruder Leichtfuß, der gegen stumpfsinnige Arbeit und Nützlichkeitsethos opponiert, sich selbst nicht allzu wichtig nimmt und respektlos-ironische Blicke auf das Leben, die Leute und die Liebe wirft. Das kommt daher wie ein von Musik durchzogener Traum, ein sanfter Trip, ziel- und zügellos, voller Fernweh und sinnlicher Sehnsucht, durch nächtliche, wie halluziniert wirkende Parks, durch Landschaften, wie von einem bekifften Caspar David Friedrich gemalt, dass einem, wie Thomas Mann so schön sagte, »die Ohren klingen und der Kopf summt vor poetischer Verzauberung und Verwirrung«.
Doch so leicht und hell und zauberhaft der Text auch sein mag, so bleibt er immer nur ein Text, schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Und so anregend das Seminar auch sein mag, es ist und bleibt ein Seminar. Viel lieber würde ich aus dem überheizten, verqualmten und überfüllten Übungsraum fliehen und auf den Spuren des Taugenichts nach Süden ziehen. Mitnehmen würde ich nur meine Gitarre, und unterwegs würde ich Gedichte und Songs schreiben für die Studentin, die mir schräg gegenübersitzt und mindestens so hübsch ist, wie ich mir »die schöne Frau« des Taugenichts vorstelle. Leider himmelt sie, wie fast alle Studentinnen, den Professor an, der, zugegeben, clever und ironisch ist.
Wegen solcher Eigenschaften gilt der Mann bei den diversen Parteien, Gruppen, Grüppchen und Zellen, die im Dienst der Weltrevolution durch die Universität geistern, als scheißliberal, wenn nicht gar konterrevolutionär. Einmal, als vermummte Reiter den Taugenichts gerade zwingen, sich ihnen anzuschließen, platzt eine Handvoll revolutionär Gesinnter in den Raum und erklärt das Seminar für »gesprengt«. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Partei, Gruppe oder Fraktion sie gehörten und ob sie den Lehren Lenins oder Trotzkis, Maos, Hodschas oder Kim Il-sungs anhingen, aber ich weiß noch genau, wie es mir damals gelang, der schönen Frau ein Lächeln zu entlocken, ein Lächeln, das mir gilt. Statt sich über romantische Realitätsflucht und Adelsverherrlichung im Frühkapitalismus zu echauffieren, verlangen diese Seminarsprengmeister eine Diskussion über Stamokap und Stamosoz. Außerdem lassen sie ein Flugblatt herumgehen, das Solidarität mit den Roten Brigaden Italiens fordert und gefälligst von allen Anwesenden zu unterschreiben sei. Es will aber niemand dergleichen diskutieren, geschweige denn unterschreiben, doch die Revolutionäre weichen nicht.
Und da melde ich mich schließlich zu Wort und sage, das Seminar befinde sich in einer intensiven Debatte über poetischen Anarchismus am Beispiel eines antikapitalistischen Arbeits- und Prosperitätsverweigerers im vorindustriellen Italien, von wegen Rote Brigaden, Arte Povera und Bella Ciao, und diese notwendige Diskussion erfordere den Respekt und die Solidarität aller revolutionären Kräfte und müsse nun endlich ungestört fortgesetzt werden.
Zur allgemeinen Verblüffung nimmt der Wortführer der Revolte diesen Blödsinn mit nachdenklichem Kopfnicken zur Kenntnis und räumt samt seiner Putztruppe das Feld. Und in genau diesem Augenblick trifft mich von schräg gegenüber jenes Lächeln, das man zu Eichendorffs Zeiten vermutlich hold, wenn nicht gar bezaubernd genannt hätte.
Aber was bin ich denn schon gegen den in seinem Charisma badenden Professor? Und während dieser Charmebolzen seine Geistesblitze durch den stickigen Raum schleudert und die Augen der schönen Frau zum Glänzen bringt, frage ich mich, wie sich die alte Geschichte erzählen ließe, würde man sie jetzt noch einmal schreiben. Was für ein Ton wäre anzuschlagen? Wie würde das klingen? Würde es der schönen Frau gefallen? Und also kritzele ich unzusammenhängendes Zeug auf die Seitenränder, auf das Vorsatzpapier, zwischen die Zeilen des südwärts ziehenden Taugenichts.
Damals, in dem überheizten und verräucherten Seminarraum, glaubte ich zu wissen, was ich sagen wollte. Aber mir fehlten die treffenden Worte oder, wie es bei Eichendorff heißt: »Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste.«
Vielleicht finde ich ihn heute?
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
I’m goin’ to some place I’ve never been before I’m goin’ where the water tastes like wine
Alan Wilson (Canned Heat)Going Up The Country
Ich hatte herrlich lange geschlafen und ausgiebig gefrühstückt und setzte mich dann mit der Gitarre auf die Treppe, die vom Wintergarten in den Garten führte. Entspannt drehte ich mir eine Morgenzigarette, mischte zwecks Horizonterweiterung ein paar Krümel Gras dazu, sah den Rauchwölkchen nach, die im Blau verschwebten, genoss die Frühlingssonne und freute mich über das Vogelgezwitscher und das quirlige Eichhörnchenpaar, das sich im Walnussbaum tummelte. Ich klimperte auf der Gitarre und suchte für den Text, der mir seit einigen Tagen im Kopf herumging, nach einer flockigen Melodie.
Ich sitz in der Sonne,
summe mir ein kleines Lied,
blinzle zu der Wolke,
die da weiß ins Blaue zieht.
Gestört wurde meine Inspiration durch Motorgeräusch und Dieseldunst, als mein Vater mit dem Wagen in die Einfahrt einbog. Ich sah auf die Uhr. Pünktlich wie immer. Von Montag bis Freitag kam der Alte um 12:00 Uhr aus dem Büro, aß um 12:30 Uhr zu Mittag, legte sich um 13:00 Uhr eine halbe Stunde auf die Couch und fuhr dann um 13:30 Uhr zurück in die Firma. Heizungsbau, Installationen und Sanitärgroßhandel Johann Müller GmbH & Co. KG. Nach dem Krieg hatte mein Vater als kleiner Klempnergeselle die Ärmel hochgekrempelt und in die Hände gespuckt, um im Wirtschaftswunderland mit Fleiß und Schweiß auf dem sprichwörtlich goldenen Boden des Handwerks sein Glück zu machen. Die Firma war ständig gewachsen und wuchs immer noch, und alles hätte wie geschmiert ewig so weitergehen können und sollen, wenn --- ja, wenn ich mich zu einer Ausbildung aufraffen würde, mit der ich in die Firma eintreten und Johann Müller GmbH & Co. KG zu Johann Müller & Sohn GmbH & Co. KG veredeln würde. Von der Klempnerlehre bis zum Volkswirtschaftsstudium hätten meine Eltern alles Einschlägige begeistert oder jedenfalls erleichtert akzeptiert und großzügig finanziert. Als »& Sohn« wollte ich allerdings ums Verrecken nicht enden und verspürte auch nicht die geringste Neigung, Flachflansche auf Rohre zu schrauben oder die Gewinnmargen von Toilettenschüsseln zu optimieren. Nach einem mit Ach, Krach und blauem Auge bestandenen Abitur hatte ich lieber zwei, drei Semester locker vor mich hin studiert, ein Schlückchen Philosophie, eine Prise Kunstgeschichte, ein Quäntchen Literaturwissenschaft, aber heimisch wurde ich nirgends im akademischen Elfenbeinturm, der auch gar nicht aus Elfenbein, sondern aus Waschbeton war.
Meine Eltern nahmen diese Neigungen zur Brotlosigkeit mit Befremden, wenn nicht gar mit Verbitterung zur Kenntnis. Undankbar sei ich und wisse nicht, wie gut ich es habe, und solange ich meine Füße unter ihren Tisch und so weiter und so fort und überhaupt, was bloß aus mir werden solle?
Das wusste ich nicht so genau, wollte es damals auch noch gar nicht wissen, fand jedoch, im Sonnenschein auf der Schwelle zu sitzen, Gitarre zu spielen und ein Liedchen zu summen, wäre kein schlechter Anfang.
Mein Vater sah das natürlich entschieden anders. »Was gammelst du hier so nichtsnutzig rum?«, fragte er recht rhetorisch, als er die Treppe hochschnaufte. »Wie lange sollen wir dich eigentlich noch durchfüttern? Wenn du schon nichts mit der Firma zu tun haben willst, dann sieh wenigstens zu, dass du mir nicht mehr auf der Tasche liegst. Und geh mal wieder zum Friseur. Mit diesem Wischmopp auf dem Kopf findest du nie einen Job.«
Das wollte ich ja auch gar nicht – es sei denn, als Gitarrist. Aber für immer klimpernd auf der Treppe zu sitzen, war vermutlich auch keine Lösung. Und dass ich nach dem Abi zu Hause hocken geblieben war, statt schleunigst in eine andere Stadt zu ziehen, war durchaus ein Fehler gewesen. Da hatte mein Alter ausnahmsweise nicht ganz unrecht, auch wenn er es gar nicht so meinte. Geblieben war ich einzig wegen Doris, aber weil sie neulich zugunsten eines schnöseligen Zahnmedizinstudenten mit mir Schluss gemacht hatte, hielt mich nichts mehr hier.
Ich ging also auf mein Zimmer, packte meinen Rucksack und verstaute die Gitarre in ihrem Koffer. Dann schlurfte ich ins Esszimmer, wo meine Eltern bei Schweinekotelett mit Blumenkohl in Mehlschwitze saßen und mich verblüfft anglotzten.
»Wo willst du denn hin?«, fragte mein Vater.
»Weg«, sagte ich.
»Was soll das heißen --- weg?«
»Weg von hier.«
Meine Mutter guckte ganz entgeistert. »Aber willst du denn vorher nicht noch etwas essen?«
»Nein, danke«, sagte ich. »Und Blumenkohl mochte ich noch nie.«
Als ich dann an der Straße stand und den Daumen in den Wind reckte, war mir etwas unbehaglich bei dem Gedanken, dass ich mich nicht von meinen Freunden verabschiedet hatte. Aber so sang- und klanglos war es allemal abenteuerlicher, romantischer irgendwie. Sang und Klang würde ich schon selbst produzieren. Und was Doris betraf, hatte sich eine beziehungstechnische Abschiedsszene sowieso erübrigt.
Der Erste, der mich mitnahm, war ein Handelsvertreter für Herrenkosmetik. Im Heck seines sänftenartigen Opel Commodore stapelten sich Kartons, und der ganze Kombi müffelte nach etwas zu lieblichem Rasierwasser. Nachdem der Mann mehrfach mein linkes Knie mit dem Schaltknüppel verwechselt hatte, erzählte ich ihm, dass ich auf dem Weg zu meiner Verlobten sei.
»Ach, wie schade«, seufzte er entsagungsvoll, »so ein süßer Bengel ---«, hielt an der nächsten Tankstelle an, ließ mich aussteigen und wünschte gute Reise.
Als Nächstes nahm sich ein netter norwegischer Lkw-Fahrer meiner an. Er war in etwa in meinem Alter, hatte meine Gitarre gesehen und mochte die gleiche Musik wie ich. So sangen wir zusammen all die Songs, die wir beide kannten, und weil es inzwischen zu regnen begonnen hatte, schlugen die Scheibenwischer den Takt dazu. Gegen Abend erreichten wir H., wo der Norweger übernachten und am nächsten Morgen Fracht aufnehmen musste. Ich nahm mit der Kargheit einer Jugendherberge vorlieb.
Am nächsten Morgen postierte ich mich an einer Autobahnraststätte, klappte den Gitarrenkoffer auf, warf als Köder ein paar Münzen hinein und kritzelte auf ein Stück Pappkarton das Sehnsuchtswort: SÜDWÄRTS. Dann gab ich ein paar Songs zum Besten und versuchsweise auch schon mal einen, an dem ich abends noch in der Jugendherberge gebastelt hatte.
Jetzt pack ich meine sieben Sachen
Jetzt lass ich’s endlich richtig krachen
Pack den Rucksack und düse los
Ohne dich und ohne Moos
Ohne dich wird’s wunderschön
In Rio, Kairo und Athen
Ohne dich wird’s wunderbar
In Timbuktu und Sansibar
Jetzt hau ich einfach ab
Dabbadi dabbadu dabb dabb
Ich tauge nicht zur Nützlichkeit
Scheiß auf die Strebertüchtigkeit
Schluss mit grauem Alltagsstuss
Ich will Strand und Kokosnuss
Wecker schmeiß ich gleich ins Klo
Schlips und Kragen ebenso
Ich will keinen Blumenkohl
Ich will Sex und Rock’n’Roll
Jetzt hau ich einfach ab
Dabbadi dabbadu dabb dabb
Zugegeben, keine Sternstunde lyrischen Schaffens, aber auf den Reim von Blumenkohl auf Rock’n’Roll wäre wohl nicht jeder gekommen. Und bedenkt man, dass sich das Werk noch in progress befand, und weiterhin, welch peinlicher Balla-Balla-Bullshit manchmal zum Hit wurde, war der Text nichts, wofür ich mich hätte schämen müssen. Damals jedenfalls nicht. Und mein Gereime und Geschrammel zeigten ja auch erfreuliche Wirkung. Zwar nahmen mich die meisten Leute, die vom Parkplatz zur Raststätte oder von dort zu ihren Autos hasteten, kaum zur Kenntnis, warfen bestenfalls im Vorübergehen ein bisschen Kleingeld in den Gitarrenkoffer, als wäre ihre Hektik gebührenpflichtig. Je falscher die Richtung, desto sinnloser das Tempo, dachte ich, und dass das ja womöglich eine gute Songzeile sein könnte. Ein paar Kunstsinnige aber blieben immerhin eine Weile stehen und hörten zu.
Nachdem ich So Long, Marianne von Leonard Cohen gesungen hatte, gab es sogar zaghaften Applaus, und zwei Frauen warfen mir Blicke zu, die ich nicht so recht einordnen konnte. Kritisch? Wohlwollend? Neugierig? Begeistert gar? Die eine war etwa in meinem Alter und sah umwerfend gut aus. Die andere hätte ihre Mutter sein können, war im Gesicht noch einigermaßen knitterfrei oder jedenfalls knitterfrei geschminkt, in den Hüften allerdings stark aus dem Leim gegangen. Sie tuschelten miteinander. Die Junge kicherte und nickte.
»Sie haben ja Talent, junger Mann«, redete die Ältere der beiden mich an.
»Ich weiß«, sagte ich. »Es kommt aber erst richtig zur Geltung, wenn so schöne Frauen zuhören.«
»Ach, wie charmant.« Sie schien unter ihrem Sonnenbankteint sogar ein bisschen zu erröten und deutete auf das Pappschild. »Was meinen Sie denn eigentlich mit südwärts?«
Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Das Wort gefiel mir irgendwie. Es war, als triebe mich eine alte Erinnerung an irgendetwas längst Vergessenes nach Süden. Aber das sagte ich natürlich nicht, weil es genauso altklug und pathetisch geklungen hätte, wie es hier jetzt zu lesen steht. Weil mir auf die Schnelle nichts Besseres einfiel, sagte ich einfach, dass ich nach Wien unterwegs sei.
Nun fing die kosmetisch Konservierte wieder an, mit der Naturschönheit zu tuscheln. Die schüttelte zwar einige Male kokett den Kopf, schielte dabei aber zu mir hin. Ihre Mutter oder Tante, oder was auch immer sie sein mochte, keckerte albern. »Wir nehmen Sie gern mit«, sagte sie schließlich zu mir. »Da fahren wir nämlich auch hin.«
Ich kratzte die kümmerliche Gage aus dem Gitarrenkoffer, raffte meinen restlichen Kram zusammen und folgte den zwei ungleichen Grazien zum Parkplatz. Unterwegs waren sie mit einem weißen Mercedes Roadster 107, Zweisitzer, dahinter zwei Notsitze, rotes Leder. Für manche Leute, den neuen Freund von Doris zum Beispiel, wäre so ein Snobschlitten der Wirklichkeit gewordene geile Traum aus Chrom, Lack und Leder gewesen. Mein Stil war das nicht. Ich stand damals eher auf Kastenente mit Rolldach und Revolverschaltung. Der Roadster war nun allerdings der sprichwörtliche geschenkte Gaul in Form eines edlen Rennpferds, und die Schöne überstrahlte sowieso alles. Also zwängte ich mich quer auf die beiden Notsitze und stopfte irgendwie auch noch Rucksack und Gitarre dazu.
Die beiden Frauen banden sich Kopftücher um. Die Breite quetschte sich hinters Steuer, die schöne Schlanke räkelte sich auf dem Beifahrersitz, und schon fädelten wir auf die Autobahn ein. Vor uns lag ein breites Tal, durch das die Fahrbahn wie ein silbergraues, glänzendes Band schnitt. Die Sonne stand strahlend und hoch im Himmelsblau, in dem weiße Schäfchenwolken trieben, die Kopftücher flatterten wie Fahnen im Wind. Vor Glück laut zu schreien, schämte ich mich, tanzte und jubelte aber innerlich umso hemmungsloser. Die reine Lust der Straße! Unter uns rollten die Mittelstreifen ab und umarmten den linken Vorderreifen, als würden Asphalt und Gummi sich lieben. Die Frauen wechselten manchmal ein paar Worte untereinander, und die Schöne drehte sich auch einmal zu mir um und fragte, ob bei mir alles okay sei. Doch ansonsten gab es nichts zu sagen oder zu verstehen, weil die Wörter vom Motorengeräusch und dem Rauschen der Reifen verschluckt und von Musik aus dem Radio übertönt wurden. Was da aus dem Lautsprecher strömte, wusste ich nicht, weil ich von klassischer Musik kaum eine Ahnung hatte. Erst dachte ich noch, dass zu so einem Trip Songs der Doors oder Stones oder Traffic besser gepasst hätten, aber nach einer Weile gefiel mir immer besser, was mir da fetzenweise um die Ohren rauschte, bevor es im Wind verwehte.
Bald türmten sich am Horizont die Alpen auf, über deren Gipfeln schwere dunkelgraue Gewitterwolken hingen. Selbst der Fahrtwind wurde von einer fast klebrigen Schwüle durchwabert, die mich schläfrig werden ließ und für ein paar Momente so melancholisch stimmte, als müsste ich wieder umkehren. Was tat ich hier eigentlich? Ich legte meinen Kopf auf den Rucksack, sah über mir einen Vogelschwarm dahinziehen und darüber einen silbern glitzernden Jet, der einen Kondensstreifen ins Blaue schrieb. Und weil ich in der vorigen Nacht im unbequemen Jugendherbergsbett kaum ein Auge zugemacht hatte, schloss ich nun beide und schlief ein.
Als ich erwachte, stand der Wagen still im Halbschatten einer Lindenallee, die Sitze vor mir leer, die Frauen verschwunden. Am Ende der Allee führte eine breite Freitreppe in ein Schloss. Leicht benommen fragte ich mich, in was für einen Kiffertraum ich mich wohl verirrt haben mochte, aber über dem Schlossportal prangten die Worte SCHLOSSHOTEL LINDENHOF, und das klang immerhin recht real. Das polierte Messingschild mit der Inschrift glänzte wie pures Gold in der fetten Sonne des Spätnachmittags. Seitwärts durch die Bäume schimmerte die Skyline einer Stadt, drei, vier Hochhäuser, Kirchtürme und ein schwebender Halbkreis – das obere Drittel eines Riesenrads.
Ich musste also tatsächlich in oder jedenfalls in der Nähe von Wien angekommen sein und wunderte mich, dass ich es offenbar ohne Passkontrolle über die Grenze nach Österreich geschafft hatte. Üblicherweise wurden langhaarige Typen wie ich auf der Suche nach bewusstseinserweiternden Substanzen, die das Gesetz ahnungslos als Betäubungsmittel bezeichnete, penibel gefilzt und von Spürhunden beschnüffelt, und im Gitarrenkoffer vermutete damals jeder wackere Zöllner ein Maschinengewehr der RAF. Womöglich verfügten österreichische Grenzpolizisten jedoch über so viel angeborenen Charme, dass sie die zwei Hübschen im feschen Cabrio lässig durchgewinkt, mich jedoch für ein Gepäckstück gehalten hatten.
Ich stieg aus, schulterte den Rucksack, griff zum Gitarrenkoffer und stieg die Treppe hinauf. Vor der von Säulen gerahmten Drehtür stand ein Page in einer albernen Fantasieuniform stramm, der etwa in meinem Alter war. Seine blasierte Visage formte wortlos die Frage »Was willst du denn hier?«, und ich grinste ihm ebenso wortlos die Antwort ins Gesicht: »Nichts tun.« Passieren lassen musste er mich natürlich trotzdem. Aus einem geöffneten Fenster irgendwo oberhalb des Portals drang gedämpftes Lachen. Es klang erfreulich weiblich.
Drinnen spiegelte sich die üppige Stuckverzierung der Decke im glänzenden Marmor des Fußbodens. Eine Säulenreihe teilte den Raum in einen Empfangsbereich, in dem hinter einem Tresen ein Empfangschef thronte, der ebenfalls eine Uniform trug, die aussah, als wäre sie für einen Hollywoodfilm über ein fiktives Duodezfürstentum entworfen worden. Jenseits der Arkade befanden sich eine Bar und die Lobby. Auf tiefen Sesseln und Canapés verlor sich dort etwa ein Dutzend Gäste. Zwei Kellner, gleichfalls absurd betresst und bandeliert, wieselten mit beladenen Silbertabletts zwischen den Tischen und der Bar hin und her. Im Hintergrund klimperte ein Pianist im schwarzen Jackett auf einem weißen Flügel müde vor sich hin. Man soll ja die Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, you can’t judge a book by the cover, auf die inneren Werte kommt es an und sprichwörtlich immer so weiter und so fort, aber erste flüchtige Blicke auf korrekte Scheitel und hochtoupierte Kreationen, Cocktailkleider, Bügelfalten und glitzernde Klunker vor faltigen Dekolletés ließen erahnen, dass die Hotelgäste der Generation meiner Eltern, wenn nicht gar meiner Großeltern angehörten, und zwar dem besser bis bestens verdienendem Teil dieser Generation. Mir war, als wäre ich in eine Seniorenresidenz für Millionäre geraten.
Über eine Halbbrille, die auf einer langen, irgendwie fürstlich wirkenden Nase klemmte, blickte mir der Chefrezeptionist staunend, ja geradezu fassungslos entgegen.
»Därä«, nuschelte er mürrisch vor sich hin, was, wie ich später erfuhr, als mir sein skurriles Idiom etwas vertrauter geworden war, »habe die Ehre« bedeuten sollte. Dann machte er eine Pause, als müsse er nach Luft schnappen oder als fehlten ihm angesichts meiner Erscheinung die Worte, bis er schließlich etwas Dreisilbiges ausstieß, das bei mir als »Sie wünschen?« ankam.
Wäre all das zu Zeiten passiert, in denen das Wünschen noch geholfen hatte, hätte ich vielleicht gesagt, dass ich die umwerfend schöne Frau, die mich mit ihrer Traumkutsche in dies Märchenschloss entführt hatte, zu sehen wünschte, zu sprechen, zu umarmen, zu küssen und noch viel mehr, und zwar augenblicklich und ohne jede weitere Erklärung. Leider waren diese Zeiten aber längst vorbei.