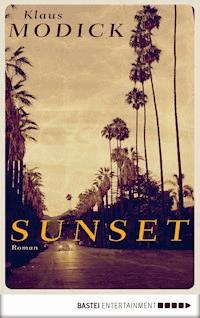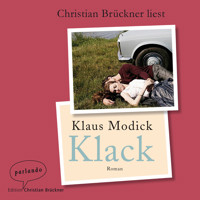9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
»Ein Meisterwerk« Denis Scheck Klaus Modick erzählt die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Worpsweder Gemäldes, von einer schwierigen Künstlerfreundschaft – und von der Liebe. Im Jahr 1905 ist Heinrich Vogeler auf der Höhe seines Erfolgs und wird für sein Meisterwerk »Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff« öffentlich gefeiert. Für Vogeler ist es das Resultat eines dreifachen Scheiterns: In seiner Ehe kriselt es, sein künstlerisches Selbstbewusstsein wankt, und seine fragile Freundschaft zu Rainer Maria Rilke, dem literarischen Stern am Himmel der Worpsweder Künstlerkolonie, zerbricht – und das Bild bringt das zum Ausdruck: Rilkes Platz zwischen den Frauen, die er liebt, bleibt demonstrativ leer. Was die beiden zueinander führte und später trennte, welchen Anteil die Frauen daran hatten, die Kunst, das Geld und die Politik, davon erzählt Klaus Modick auf kunstvolle Weise. Ein großartiger Künstlerroman, einfühlsam, kenntnisreich, atmosphärisch und klug.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Ähnliche
Klaus Modick
Konzert ohne Dichter
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Klaus Modick
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Das Konzert
Dank
Motto
I Worpswede
II Von Bremen nach Oldenburg
III Oldenburg
Note des Autors
Inhaltsverzeichnis
Das Konzert
Inhaltsverzeichnis
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds e.V. für ein Stipendium, mit dem die Entstehung dieses Buchs gefördert wurde.
Inhaltsverzeichnis
»Es ist so vieles nicht gemalt worden, vielleicht alles.«
– Rainer Maria Rilke, Worpswede –
Inhaltsverzeichnis
IWorpswede
7. Juni 1905
etuschel. Traumreste. Klatschende Flügelschläge. Wer spricht? Graue Zugvögel kreisen um einen dunklen Turm, kreischen heisere Lockrufe, Lieder in unverständlichen Sprachen. Über Moor und Heide und den Spiegeln von Fluss und Kanälen zeichnen die Flugbahnen unregelmäßige, organische Muster. Oder sickert das Geflüster aus der unaufhaltsamen Flut der Morgendämmerung, die zweifelnd, ob ihre Zeit schon gekommen ist, ins Zimmer kriecht?
Er steht auf, zieht den nachtblauen Morgenrock an, halb japanischer Kimono, halb mittelalterliches Adelsgewand. Die Stickerei, ein im Dornendickicht schnäbelndes Nachtigallenpaar, hat er selbst entworfen, wie er alles, was ihn hier umgibt, selbst entworfen hat, vom großen Bett aus poliertem Birkenholz über die Lampen, Kerzenleuchter und Tapeten bis zur mattweiß gestrichenen Kommode. Im ganzen Haus gibt es vom Dachfirst bis zum Weinkeller keinen Raum und kaum einen Gegenstand, den er nicht bearbeitet oder geformt hätte, und die Dinge, die er nicht selbst gestaltet hat, sind so platziert und arrangiert, dass sie sich seinen Vorstellungen und Ideen, Fantasien und Wünschen fügen.
Er öffnet die Flügeltür zum Balkon und blickt über den noch dunklen Boden des Blumengartens zum Birkenhain, dem das Haus seinen Namen verdankt – Barkenhoff. Auch die Bäume hat er vor Jahren selbst gesetzt, Stämmchen für Stämmchen, damit man das Haus von der Landstraße aus durchs Raster einer feinen Schraffur sieht, als zeichne die Natur sich ihr eigenes Bild. Aber im Zwielicht ist das frische Grün der Blätter noch vom grauen Mehltau der Nacht überzogen, und die hellen Stämme treten zu schwarzem Gitterwerk zusammen. Sperrt es die Welt aus? Oder sperrt es ihn ein in sein eigenes Werk, in Haus und Hof mit Frau und Kindern und Pferden und Hund und den vielen Gästen, die kommen und gehen?
Im Garten und auf den Feldern des Hofs ist er jedem Baum und jedem Busch nah, sucht sie täglich auf, hilft ihrem Wachstum, düngt sie, verleiht ihnen Halt, beschneidet sie und gibt ihnen die Richtung, die dem Organismus angemessen scheint. Alles sieht so reich aus, so glücklich geordnet, und die Früchte reifen, samen sich aus, und die Bäume werden groß und zeigen ihren Eigenwillen, dem man nicht mehr helfen kann. So ist sein Garten ein in die Wirklichkeit gewachsenes, ein lebendig gewordenes Kunstwerk. Doch irgendwann erwacht man aus einem jahrelangen Traum, einem freiwilligen Dornröschenschlaf, und beginnt zu begreifen, dass man keine Insel der Harmonie und Schönheit geschaffen hat, sondern ein von Hecken und Zäunen, Mauern und Birkengittern umschlossenes Gefängnis.
Wieder hört er das Flüstern. Wie tuschelnde Frauen. Doch jetzt weiß er, dass es Lerchen sind, deren Stimmen aus den Birken wie aufgelöst durch die tauende Luft schwimmen. Was sagen diese Stimmen? Dass noch nicht Tag ist, aber auch nicht mehr Nacht? Dichter wissen so etwas vielleicht und finden dann Worte dafür. Zeichnen lassen sich Stimmen aber so wenig wie der Nachtwind, der sacht durch den Garten streicht und wie auf Zehenspitzen ums Haus geht, so wenig auch, wie Musik sich zeichnen lässt.
Das ist einer der Gründe, warum das große Bild, mit dem er sich jahrelang abgequält hat, so gründlich missglückt ist. Es zeigt Musizierende, aber es klingt nicht. Bleibt stumm. Und die Lauschenden hören nichts. Sind taub. Deshalb ist Konzert auch kein guter Titel. In der Festschrift zur Kunstausstellung, die morgen eröffnet wird, feiert ein sogenannter Fachmann das Bild – ein rauschender Hymnus auf den Abendfrieden sei es, höchst realistisch und ungekünstelt und voller Musik, voll zarter lyrischer Klänge, eine Feierstunde, in sich gekehrte, keusche Lebensfreude, welt- und zeitenfernes, naives Genießen. Dieser Experte sagt nicht, was er sieht, sondern was er sehen will; und wie er es sagt, so pathetisch hochgestimmt und lyrisch überdreht, klingt es wie eine schlechte Parodie auf den Dichter, der auf dem Bild fehlt. Er hätte zwischen Paula und Clara sitzen sollen, so wie er zwischen ihnen gesessen hat, als er damals auf dem Barkenhoff erschien, ein rätselhaftes, frühreifes Genie, unter dessen Worten und Blicken die Frauen schmolzen. Aber da, wo er hätte sitzen sollen, ist der Platz leer, und so wäre vielleicht Konzert ohne Dichter ein besserer Titel.
Paula hat das Bild immer nur Die Familie genannt, aber diese Familie zerfällt, ist schon zerfallen. Süße Dichterworte halten sie längst nicht mehr zusammen, klingen nur noch wie hohle Ideologien, Predigten eines Scharlatans. Die zerrüttete Familie wäre allerdings kein guter Titel. Die Sterne beginnen zu bleichen, und ins fliehende Blau der Nacht schiebt sich von Osten ein grünlicher Schimmer des Sommermorgens. Wäre Sommerabend ein besserer Titel?
Als ob es auf Titel ankäme! Er zuckt mit den Schultern, gähnt, verzieht den Mund zu einem matten Lächeln, tritt ins Zimmer zurück. Mit dem Fingernagel streicht er über die Saiten der an der Wand hängenden Gitarre. Sie klingt verstimmt. Seit wann hat er nicht mehr auf ihr gespielt? Verstimmt wie so vieles in diesem Haus, verstimmt wie sein Leben.
Schlafen kann er jetzt nicht mehr. Er wird einen Spaziergang machen, hinunter zum Fluss, hinein in den Morgen, der mit rosigem Schimmer leise das Haus betritt und sich bald, fast lärmend, über volles Rot zu einer alles erfassenden Farbensymphonie steigern wird. Er streift sich ein blau-weiß gestreiftes, grobes Leinenhemd und eine blaue Kattunhose über, derbes Arbeitszeug, in dem er sich wohlfühlt.
Den Aufzug als biedermeierlicher Bohemien, in dem er sich der Welt präsentiert, mit Stehkragen und Halstuch, Weste und Schoßrock, kniehohen Gamaschen, Zylinder und Gehstock, ist ihm fremd geworden, lächerlich und peinlich, aber weil ihn die Welt so sehen will, wird er der Welt die Rolle ab morgen auch wieder vorspielen. Das Märchen Worpswede und sein Märchenprinz. Er verkauft sich so, wie ein Märchenprinz sich verkaufen muss, der sein Heim mitten im Moor mit Rosen und Birken umhegt und neben die schweren, düsteren Fachwerkhöfe ein Haus baut mit weißen Wänden und hellen Fenstern. Er hat ein Gesamtkunstwerk eigenen Stils geschaffen und seine eigene Erscheinung in dessen Zentrum gestellt. Und er hat bislang immer geliefert, was man von ihm verlangte, zuverlässig und pünktlich, geschmackvoll und erlesen, und als Kunstfigur hat er sich gleich mit in den Kauf gegeben. Heute wird er nach Bremen fahren und morgen weiter zur Nordwestdeutschen Kunstausstellung. Er wird sich dafür in seine Verkleidung, sein Künstlerkostüm, werfen, und die Großherzogin oder der Großherzog, dessen Galauniform auch nur eine Verkleidung ist, wird ihm die Große Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft überreichen. Für den Sommerabend, das Konzert ohne Dichter, für die zerrüttete Familie.
Barfuß tritt er in den Flur, öffnet lautlos die Tür zum blauen Zimmer, wirft einen Blick in den Raum, in dem seine Töchter schlafen. Fast an jedem Abend, wenn sie im Bett liegen, liest er ihnen vor. Unter der Dachschräge, getaucht ins beruhigende Blau der Wände, wirkt das Kinderzimmer wie ein Beduinenzelt, in dem die Tage mit einer Geschichte enden, die Nächte mit einer Geschichte beginnen, lustige und traurige Geschichten, kurze und lange. In diesen Stunden zwischen Tag und Traum herrscht ein heller Zauber, mit dem die Buchstaben zu gesprochenen Worten werden und sich zwischen erzählendem Mund und lauschenden Ohren eine unsichtbare Brücke bildet, während der Kater, der eingerollt einem der Mädchen zu Füßen liegt, seinen einverständigen Kommentar schnurrt. Manchmal, wenn die Mädchen eingeschlafen sind, liest er noch ein wenig weiter – vielleicht, um ihren Träumen ein paar Worte einzugeben, vielleicht aber auch, weil er vom Vorlesen nicht lassen will, wenn daraus etwas aufsteigt, was stumme, erwachsene Leseroutine nicht mehr kennt: Klang. Das hat er von Rilke gelernt, der seine Gedichte auch so vorträgt, dass sie wie Zaubersprüche klingen oder wie Gebete. Nur dass Rilke von Kindern nichts versteht und nichts wissen will – nicht einmal von seiner eigenen Tochter.
Vogeler geht weiter zum Schlafzimmer seiner Frau. Die Vorhänge sind zugezogen. Im Dunkeln hört er ihr gleichmäßiges Atmen. Er reißt ein Streichholz an. Im schwachen Schein überzieht der grünliche Ton der Seidenvorhänge des Himmelbetts ihr Gesicht und lässt sie krank aussehen. Das ist nicht mehr das Mädchen, in das er sich auf den ersten Blick verliebte, nicht mehr die zarte, märchenleise Frau, die er wieder und wieder gemalt hat und die als Königin im Staat des Schönen herrschen und zugleich der edelste Schmuck sein sollte. So hat er sie formen, zu seinem Geschöpf machen wollen. So hat er sie auch ins Bild gesetzt, als ätherische, träumerisch in unbestimmte Fernen blickende Herrin des Barkenhoffs. Das Bild lügt. Es ist eine monumentale Lebenslüge, ein Meter fünfundsiebzig hoch und drei Meter zehn breit. Die Wahrheit liegt vor ihm im Flackern des Streichholzes. Mit beiden Geburten ist Martha stärker geworden und bauernbreiter, und jetzt drückt sie die dritte Schwangerschaft als schwerer, grünlich kranker Schatten nieder. Bald wird sie ihrer Mutter ähnlich sein, die in dumpfen Stuben Kind um Kind geboren hat.
Er zuckt zusammen, als ihm das erlöschende Streichholz Daumen und Zeigefinger versengt. Die Launenhaftigkeit, die unerklärliche Willkür des Lebens. Es wird ihm täglich unbegreiflicher, warum er gerade jetzt lebt, nicht früher und nicht später. Warum er überhaupt auf die Welt gekommen ist. Er hat ein Leben bekommen, um das er nicht gebeten hat, und es wird ihm auch wieder genommen, ohne dass er gefragt wird. Ist seine Sehnsucht nach dem Leben nicht dann immer besonders groß, wenn er wie jetzt glaubt, die Richtung zu verlieren? Will er überhaupt noch etwas? Hat er nicht alles im Überfluss? Er lauscht dem schneller werdenden Rhythmus seines Herzschlags. Das Leben ist stärker als jede Kunst, der Alltag überwuchert alles Gestaltete. Jetzt, da es fast fertig ist, füllt sich sein Haus mit Sattheit und Konvention, mit Trägheit und Routine. Jetzt, auf der Höhe seines frühen, allzu frühen Erfolgs, erscheint ihm seine Kunst flach und schal, und in seinem schönen, allzu schönen Leben brechen Risse auf wie Krakelüren auf einem Ölgemälde.
Unten in der Diele schlüpft er in Holzpantinen. Neben der großen Anrichte, auf der Zinnkrüge und silberne Kandelaber stehen, daneben blaues und gelb geblümtes Steingut, hängt an der ockergelben Wand ein Stillleben. Von Paula. Weiße, silbergraue Töne eines Tischtuchs, eines Wasserglases und einer Flasche. Das tiefe Schwarz einer Bratpfanne mit Spiegeleiern. Das warme Gelb dieser Eier. Darunter das kalte Gelb einer halbierten Zitrone. Schlicht. Ehrlich. Klar. Man glaubt, den Duft der Spiegeleier riechen, die Frische der Zitrone schmecken zu können. Paula kann Gerüche malen. Vielleicht könnte sie sogar Musik malen, ein Konzert, das man nicht nur sieht, sondern zu hören glaubt. Ein Bild gewinnt seine Kraft nicht aus dem, was man malt, sondern aus dem, was die Pinselstriche und die Formen umgibt, was sie einspinnt wie ein unsichtbares Netz, etwas, das abwesend und ebendeshalb besonders präsent ist – wie der abwesende Dichter. Ja, Paula macht das Kühnste und Beste, was hier in Worpswede je gemalt worden ist. Und ausgerechnet von Paula hängt in der Ausstellung kein Bild – – –
Über die Gartentreppe mit ihren nach außen schwingenden Wangen, hindurch zwischen den Urnen auf den Balustraden, schlendert er dem Fluss entgegen, wirft einen Blick zurück auf die durchkomponierte Symmetrie des Hauses. Die Urnen auf beiden Seiten des Giebels korrespondieren mit den Empire-Urnen der Treppe, heben sich leichenbleich aus dem Morgengrau heraus, und überm Dach zieht die vergehende Nacht einen letzten Stern abwärts. Die Fenster starren als düstere Augenhöhlen, und im noch nicht erwachten Garten steht das Haus so kalt, als sei seine schwungvolle Harmonie erfroren oder abgestorben. Die Treppenstufen, die sonst immer etwas Einladendes und Erwartungsvolles verströmen oder jedenfalls verströmen sollen, ragen abweisend auf. Worauf sollen sie auch warten? Auf ein Wunder?
Fröstelnd zieht er die Schultern hoch. Wie ein Wurm in einem Apfel der Bäume, die er hegt und pflegt, haben Zweifel in ihm zu nagen begonnen. Er ahnt die Unzulänglichkeit seiner Mühen, vor den Kulissen des Barkenhoffs eine heile Welt zu inszenieren und Harmonie zu simulieren. Der Riss geht mitten durch die von ihm gestaltete Welt. Er hat sich ein Haus gebaut, dessen dem Garten zugewandte Seite mit der herrschaftlichen Freitreppe Fassade ist und etwas Hochstaplerisches ausstrahlt. Aber im alten Teil des Hauses, in der Bauerndiele, lebt noch seine Liebe zu den einfachen Dingen, zu handwerklicher Redlichkeit und zu jener Klarheit und Ehrlichkeit, die auch Paulas Bilder prägen.
Über Moorwiesen, an von Birken, Eichen und Ginster gesäumten Gräben und Dämmen entlang, erreicht er den Steg, an dem sein Boot vertäut liegt. Er setzt sich auf die Ruderbank, die Ellbogen auf die Knie und den Kopf in die Hände gestützt. Der dunkle Moorfluss drängt sacht glucksend gegen den Bug. In Ried und Schilf rascheln Wasservögel. Ins Horizontgrün der Dämmerung mischt sich goldener Schimmer und fächert sich überm Land auf. Die Wiesen erwachen. Kiebitze, schwarz-weiß, streichen mit schwerfällig klatschendem Flügelschlag ab, aber in ihrem Element schießen sie dann befreit und schwerelos durch den Himmel. Irgendwo wird eine Sense gedengelt.
Er packt die Riemen, lenkt das Boot zwischen hohem Wasserliesch und Seerosen, Röhricht und Schilf hindurch, rudert eine Weile ziellos, absichtslos bis zur halb verfallenen Hütte mit dem von Moos überwucherten, schadhaften Strohdach. Die Dichter und Maler sind immer gern hierhergekommen, die Maler mit ihren Modellen besonders gern. Sie lagerten am grasigen Ufer, zogen Leinen zwischen den Birkenstämmen und hingen bunte Papierlaternen auf, und aus den blauen Nächten schimmerten dann die hellen Kleider und manchmal das Weiß der Nacktheit.
Das Reet steht hier so hoch, dass der im Boot Sitzende vom Ufer aus nicht zu sehen ist, und vom Boot aus lässt sich nur das löchrige Dach der Hütte erkennen. Er zieht die Pfeife aus der Tasche, stopft sie behutsam und etwas umständlich, und als er ein Zündholz anstreichen und den Tabak anstecken will, hört er plötzlich eine Stimme. Halblautes, unverständliches Gemurmel. Singsang. Rhapsodisches Gestammel. Eine Stimme, die nach Weihrauch klingt, die Stimme eines Betenden – – –
»– – – he bedet all wedder.«
Lina, die steinalte Haushälterin, empfand wohl eine an Entsetzen grenzende Scheu vor dem eigentümlichen Gast, der, von einer Russlandreise kommend, gegen Ende jenes verzauberten Sommers auf dem Barkenhoff erschien. Er wohnte im Giebelzimmer, das auf den Arbeitshof hinauswies. Wenn er in der umgürteten grünen Rubaschka und den bunt applizierten, roten tatarischen Lederstiefeln an den Füßen durch den Garten ging, ein Notizbuch so in der Hand, wie der Pastor sein Gebetbuch zu halten pflegte, und in an- und abschwellender Lautstärke vor sich hin murmelte, manchmal stehen blieb und mit einem Stift etwas in sein Buch kritzelte, dann wurde die abergläubische Lina von Angst befallen, das Gemurmel könnten womöglich keine Gebete, sondern Spökenkiekereien sein, Zaubersprüche, Bannworte oder Verwünschungen.
Vielleicht fürchtete sie auch nur, dieser seltsame Heilige könnte in seiner exotischen Kostümierung ins Dorf gehen und mit seiner unheimlichen Erscheinung den ganzen Barkenhoff in Klatsch, Verruf und Misskredit bringen. Seitdem die Künstler Worpswede für sich entdeckt und sich angesiedelt hatten und ihre aus großen Städten und fernen Ländern anreisenden Freunde zu Besuch kamen, hatte man in Worpswede zwar schon allerlei karnevaleske Kostümierungen und pittoreske Aufzüge zu sehen bekommen, aber Rilke schoss den Vogel ab.
Lina war jedenfalls empört. »De Keerl lett jo dat Hemd över sin Büx hangen.«
Und wenn er dann, das Hemd über der Hose hängend, oben in seinem Zimmer auf und ab ging, die roten Russenstiefel einen trägen, unregelmäßigen Rhythmus auf die Bodendielen schlugen und seine Stimme manchmal so laut wurde, dass sie durchs Gebälk bis nach unten drang, dann stand Lina in der Diele, horchte verstört auf und zeigte mit ihrer zerarbeiteten, faltigen Hand zur Decke.
»He deit ton leev Heiland proten«, flüsterte sie. »He bedet alltied.«
Vogeler lächelte, tätschelte ihr beruhigend die Schulter. »Er betet nicht, Lina. Er dichtet. Der Herr Rilke dichtet doch nur.«
Damals, vor fünf Jahren, als Rilke »die Familie« des Barkenhoffs komplett machte, ahnte Vogeler noch nicht, dass dieser Dichter nicht einfach nur dichtet. Inzwischen weiß er, dass Rilke seinem Talent, seiner Gabe mit einem derart erbarmungslosen Ernst dient, dass seine Arbeit einem Verhängnis, einer Selbstversklavung gleichkommt. Als allein glücklich, selig und heilig machende Gnade empfindet und verkündet er sein Schaffen, sein Werk, und unproduktive Phasen gelten ihm nicht als Erholung oder Entspannung der ständig etwas zu hoch gestimmten Saiten. Dass es manchmal leere Momente geben muss als Antrieb zum Schaffen, dass sogar Langeweile notwendig ist, damit der Geist sich wieder sammelt und produktiv wird, ist Rilke völlig fremd. Dass Kunst auch aus Spiel und beiläufiger Improvisation entsteht, dem lebendigen Augenblick hingegeben oder abgelauscht, davon weiß dieser Dichter nichts oder will nichts davon wissen.
Er verachtet den Müßiggänger. Und er fürchtet den Müßiggang, weil er im Grunde selbst ein Müßiggänger ist, der noch im Nichtstun zwanghaft so tut, als sei er in ernster Arbeit versunken. Rilkes Kostümierung als Dichter geht viel tiefer als sein Russenkittel, den er aber inzwischen abgelegt hat, viel tiefer als Vogelers Biedermeiermaskeraden. Rilke gibt selbst dann noch den Poeten, wenn ihm jede Inspiration abgeht, spielt der Welt eine Rolle vor, die sich untrennbar in seine Person verstrickt hat.
Mit seinem zynischen, nach zu viel Alkohol auch zotigen Humor hat Fritz Mackensen einmal gesagt, dass Rilke wohl selbst noch auf dem Donnerbalken Reime von sich gebe und das dort liegende Papier beschreibe. Ob das, was er jetzt hier am hellen Morgen vor sich hin spricht, ein Pfeifen im dunklen Wald ist, Inspiration erzwingen will oder Arbeit simuliert, Geplapper, mit dem er seine panische Angst vor der Leere vertreibt, oder ob ihm in diesem Moment eins seiner schmelzend-schönen, zwischen Kitsch und Tiefsinn schwankenden Gedichte aus dem Mund tropft – wie soll Vogeler das wissen? Die Laute, die Rilke beim Dichten ausstößt, sind eine Sprache, die niemand versteht. Versteht Rilke sie?
Einmal standen sie im Museum gemeinsam vor einem Bild Arnold Böcklins. Ein Faun liegt mit übereinandergeschlagenen Beinen und ausgebreiteten Armen im Gras und pfeift mit gespitzten Lippen einer Amsel zu, die auf einem schwankenden Zweig über seinem Kopf sitzt. Die Flöte aber und das Notenpapier, es könnten auch Manuskriptblätter und ein Füllfederhalter sein, liegen neben dem Faun im Gras.
»Köstliches Bild«, sagte Vogeler bewundernd, auch ein wenig neidisch auf die Motividee und auf Böcklins technische Meisterschaft und malerische Kraft.
Rilke strich sich über den Schnauzbart, runzelte die Stirn und kniff die Augen zusammen, fast wie angewidert. »Es ist gut gemacht, gewiss doch«, sagte er schließlich streng, »aber es ist falsch.«
Vogeler wunderte sich, war Rilke doch ein erklärter, rückhaltloser Bewunderer Böcklins. »Wie meinen Sie das, mein Lieber? Falsch?«
»Der Faun hat vielleicht Sinn für Kunst, aber er ist kein Künstler. Er ist ein Faulpelz. Er arbeitet nicht.« Und indem er das sagte, zog Rilke das Notizbuch aus der Tasche seines Jacketts und schrieb mit lautlos Worte formenden Lippen etwas hinein.
Vogeler hatte das Gefühl, dass Rilke ihm eine Lektion erteilen, ihm etwas unter die Nase reiben wollte, und hätte gern widersprochen, aber eine Antwort fiel ihm nicht ein. Als sie aus dem Museum wieder in den sonnendurchfluteten Park hinaustraten, wusste er plötzlich die Antwort. Er spitzte die Lippen und pfiff eine kleine Melodie. »Wenn ich ein Vöglein wär – – –«
Rilke lächelte nicht, sondern warf ihm einen seiner traurig-strengen, vorwurfsvollen Blicke zu. Wie lange war es her, dass Rilke gelächelt hatte? Hatte er je gelacht? Oder zumindest gepfiffen?
Wenn Rilke ihn jetzt so auf der Ruderbank sitzen sieht, statt eines Skizzenblocks die gestopfte Tabakspfeife in der Hand, träge und entspannt der Morgenstimmung am Fluss hingegeben, dem sanften Strömen und Fließen, ohne diese Stimmung festhalten und formen zu wollen, wird Rilke ihn wohl noch tiefer verachten, als er es bereits tut. Natürlich sagt er es ihm nicht ins Gesicht, doch hinter seinem Rücken blühen von Mund zu Mund und von Brief zu Brief Klatsch und Tratsch, wie das in Familien so üblich ist – und in einer zerstrittenen und zerfallenden Familie erst recht.
Vogelers Kunst, habe Rilke zu seiner Frau gesagt, die es an Paula weitergab, und Paula flüsterte es Martha zu, die es fast vorwurfsvoll wiederum ihrem Mann anvertraute, Vogelers Kunst also sei nur noch dekorativer Tand, reine Oberfläche, werde immer unsicherer, verliere ständig an Anschauung, sei ganz auf den Zufall spielerischer Erfindungen gestellt, die sich von den Dingen entfernten, und den tiefen Ernst, auf den alles ankomme, habe er noch nie gehabt.
Ein Fünkchen Wahrheit, das räumt Vogeler ein, mag daran sein. Er ist eitel, und er weiß um seine Eitelkeit. In der wachsenden Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit kennt er auch Selbstzweifel zur Genüge. Aber dass Rilke sein Gift in den Brunnen der »Familie« schüttet, deprimiert Vogeler. Bedenkt er, was er im Lauf der Jahre alles für Rilke und Clara getan hat – – –
Als könne er Vogelers Gedanken lesen, verstummt in diesem Augenblick Rilkes rhapsodisches Selbstgespräch. Vogeler steht vorsichtig, um die Balance nicht zu verlieren, vom Rudersitz auf. Sein Kopf ragt nun über Schilf, Röhricht und Kolbengras hinaus, und er lässt den Blick über die Hütte mit den staubblinden Fensterscheiben und den verwilderten, von hohen Gräsern überwucherten Platz gleiten. Rilke kehrt ihm den Rücken zu und steht mit leicht gespreizten Beinen am Stamm einer Birke. Vogeler begreift, dass der Dichter sein Wasser abschlägt, erschrickt über seine ungewollte Indiskretion, duckt sich hinter den Schilfvorhang, wartet eine Weile, ob das poetische Stammeln wieder einsetzt.
Die Stille wird vom wummernden Flügelschlag eines Kiebitzes unterbrochen, der mit schrill klagenden Kschäää-Kschäää-Rufen über dem Fluss abstreicht. Von Rilke ist jetzt nichts mehr zu hören; er wird wohl weitergegangen sein. Aber als Vogeler sich wieder aufrichtet, steht Rilke immer noch auf dem Platz und schaut zum Fluss, als habe er Vogeler längst erwartet. Als sich ihre Blicke treffen, scheint Rilke sich nicht einmal darüber zu wundern, von ihm nur Brust und Kopf zu erblicken, die wie aus dem Wasser gewachsen das Schilf überragen.
»Was für ein herrlicher Morgen. Seien Sie gegrüßt, Herr Rilke.« Die unfreiwillige Komik ihrer Begegnung lässt Vogeler schmunzeln.
»Ach, mein lieber Vogeler«, sagt jedoch Rilke mit feierlichem Ernst. »Wie lange schon haben wir uns nicht gesehen?« Dabei greift er hastig in seine Jackentasche und zieht das Notizbuch heraus, ohne das Vogeler womöglich auf die abwegige Idee verfallen könnte, Rilke sei untätig.
Mit seinen leicht hervortretenden, blassgrünen Augen, dem vollen, dunkelblonden Haar über der hohen Stirn, den melancholisch über die Mundwinkel hängenden Schnurrbartspitzen und dem von russischer Mode inspirierten Kinnbart ist Rilke durchaus nicht das, was man einen schönen Mann nennen würde. Aber er strahlt diese merkwürdige Mischung aus zarter Herrenhaftigkeit und Schutzbedürftigkeit, arrogantem Selbstbewusstsein und jungenhafter Schüchternheit aus, eine Strenge und einen undefinierbaren Charme, der die Frauen schmelzen lässt und hinreißt. Er trägt einen hellen, zerknitterten Leinenanzug und ein weißes, kragenloses Hemd. Die Hosenbeine sind bis zum Knie aufgekrempelt, und er hat keine Schuhe an. Barfußlaufen ist eine seiner sonderbaren Obsessionen – jedem seine Macken, hat Mackensen einmal gewitzelt.
»Ich kann nicht an Land kommen«, sagt Vogeler wie entschuldigend. »Es gibt hier keinen Anleger, und das Reet steht zu dicht.«
Rilke hebt den Kopf, als lausche er Vogelers Worten nach, murmelt halblaut »nirgends ein Steg und das Reet beugt sich bang«, kritzelt die Worte in sein Notizbuch. Dann tritt er dicht ans Ufer heran, sodass die beiden Männer nur noch einige Schritte voneinander entfernt sind. Ein von Rilke aufgescheuchter Frosch hüpft aus dem Gras ins Wasser. Es spritzt.
Im Boot stehend, ringt Vogeler schwankend um sein Gleichgewicht. »Ich wähnte Sie noch in Berlin«, sagt er. »Wollten Sie nicht – – –«
»Berlin?« Es klingt wie eine Frage, und Rilke macht eine wegwerfende Handbewegung. »Solche Städte, müssen Sie wissen, sind schwer, weil es ihnen an Tiefe mangelt. Große Städte lügen. Ich meine, ich fühlte mich der Stadt Berlin noch nicht wieder gewachsen nach der anstrengenden Kurarbeit in Dresden. Ach, lieber Vogeler, Sie ahnen ja gar nicht, was solche Kuren kosten, und zwar nicht nur materiell. Ich meine eher, wie sehr solche Kuren auf der Seele lasten können.«
Vogeler nickt nur ganz vorsichtig, um nicht die Balance zu verlieren. Anstrengende Kurarbeit? Seit wann fällt Rilke die Erholung zur Last? Zwar stimmt er gern ganze Leidenslitaneien an, klagt über Erschöpfungszustände, Vertrocknetsein, Zahnschmerzen, Gliederreißen, Augenweh, Rachenkatarrh mit Fiebergefühl und überhaupt schmerzhafte Zustände, wogegen er nicht nur Barfußlaufen ins Feld führt, sondern auch Bircher-Benner-Kuren, Fichtennadel-Luftbäder, Wassertreten oder zwecks Nervenstärkung Phytinum liquidum und andere Medikamente, deren exotische Namen Vogeler noch nie gehört hat. Vielleicht sind es gar keine Medikamente, sondern Zaubersprüche? Doch Gliederreißen hin und Nervenschwäche her – in Gesellschaft eleganter Unpässlichkeitsflaneure und anämischer, poetisch anfälliger Hypochondrierinnen blüht Rilke zuverlässig auf. Kurarbeit also? Nun ja, ihm ist nichts wert und heilig, was er nicht als »Arbeit« bezeichnen kann. Und Berlin sei er nicht gewachsen? Lou nicht gewachsen, meint er wohl. Wahrscheinlich durfte er dieser Frau mal wieder nicht so nahetreten, wie er es sich gewünscht hätte.
»Erzählen Sie lieber von sich«, sagt Rilke. »Wie ich höre, waren Sie in Paris.«
»Wir haben Paula besucht«, sagt Vogeler. »Sie wird immer besser, Paris tut ihr gut. Und ich habe auch großartige Bilder von Gauguin gesehen, von Seurat, van Gogh, Matisse. Und ich frage mich, ob ich in meiner eigenen Arbeit nicht ganz anders – – –«
»Und Rodin?«, unterbricht Rilke ihn dringlich. »Haben Sie Rodin aufgesucht? Haben Sie Rodin gesehen?«
Rodin, Rodin, Rodin. Vogeler mag den Namen nicht mehr hören. Er ist der Refrain, mit dem Rilke seit Jahren allen und jedem in den Ohren liegt. Rodin ist Rilkes Gott, den anzubeten und dem zu opfern er von allen verlangt und neben dem er keine fremden Götzen duldet, keinen Gauguin, keinen van Gogh, von Paula Modersohn-Becker ganz zu schweigen, von einem flachen Dekorateur wie Vogeler ohnehin.
»Nein«, sagt er, »Rodin haben wir nicht aufgesucht. Unsere Zeit war leider zu knapp bemessen.«
»Zu knapp bemessen, um zu Rodin zu gehen?« Rilke schüttelt fassungslos und vorwurfsvoll den Kopf.
»Wenn Sie dort gewesen wären oder Clara, hätten wir Ihnen gewiss unsere Aufwartung gemacht«, sagt Vogeler versöhnlich. »Aber nun sind Sie beide ja auch wieder hier. Wie ist denn das werte Befinden?«
»Ach Gott, Vogeler.« Rilke seufzt schwer. »Was fragen Sie da? Sie wissen doch, was das mit uns geworden ist. Sie sehen, wie alles, was wir versucht haben, misslungen ist. Sie haben es nahe an uns, fast mit uns erlebt, und so muss ich Ihnen gar nichts sagen, lieber Freund. Sie wissen ja alles. Clara und ich sind Ihnen natürlich sehr dankbar, dass Sie uns einstweilen das kleine Atelier zur Verfügung stellen. Auch wenn es ja nur vorübergehend ist, hätten wir sonst gar nicht gewusst, wohin wir uns wenden sollen. An mir kann sich doch niemand halten. Mein Kind, die kleine Ruth, muss bei fremden Leuten sein – – –«
Fremde Leute?, denkt Vogeler. Es sind immerhin Ruths Großeltern.
»– – – und meine Frau, deren Arbeit auch nichts einbringt, hängt von anderen ab – – –«
Von anderen? Es sind Claras Eltern!
»– – – und ich selbst bin nirgends nützlich und weiß auch nicht, wie ich nützlich sein könnte, um etwas zu erwerben. Und wenn mir auch die Nahen keinen Vorwurf machen – – –«
Die Nahen? So spricht er von Frau und Kind?
»– – – so ist der Vorwurf doch da, und das Haus, in dem ich jetzt sein muss und das mir ein selbstloser Gönner zur Verfügung – – –?, ich meine, das Sie, lieber Vogeler, mir so großzügig zur Verfügung stellen, dies Haus ist bereits ganz voll mit diesem Vorwurf. Und mit mir selbst habe ich so viel Arbeit Tag und Nacht, dass ich oft fast feindselig bin gegen die Nahen, die mich stören, wenn es mich überkommt und aus mir herausströmt, und die Nahen haben doch auch ein Recht auf mich.«
So, denkt Vogeler, strömt es also schon wieder aus Rilke heraus. Es ist eine endlose Elegie, und es fehlt nur noch, dass er dabei ins Reimen gerät. Oder von Russland schwärmt. Oder beides.
»Sie fragen so freundlich nach meinem Befinden, lieber Vogeler«, sagt Rilke nämlich, räuspert sich und fällt in ein leicht deklamatorisches Tremolo, als schlüpfe er in ein Kostüm oder in eine Rolle. »Mir ist wie dem russischen Volk zumute, von dem Unkundige fordern, es müsse endlich erwachsen werden und die Wirklichkeit ins Auge fassen, um es zu etwas zu bringen. Und zu etwas käme man dann ja auch vielleicht, wie die westlichen Menschen zu etwas gekommen sind, zu Häusern und Sicherheit, Bildung und Eleganz, zu dem und jenem, von einem zum anderen. Ob man so aber zu dem einen käme, wonach allein, über alles fort, unsere Seele verlangt? Verstehen Sie das?«
Vogeler nickt zögernd, bedächtig. »Ich denke, Ihnen fehlt vielleicht – – –«
»Ganz recht«, unterbricht Rilke, der sich von Vogeler schon längst nicht mehr verstanden weiß, »mir fehlt etwas, das in meiner haltlosen Heimatlosigkeit eine feste Stelle bildet, ein Dauerndes, Wirkliches. Ich plane aber nicht eigentlich, etwas für das Entstehen dieser Wirklichkeit zu tun. Allein schon die Vorstellung, dass es zwischen meinem Werk und den Anforderungen des täglichen Lebens eine Verbindung geben könnte, bewirkt, dass mir die Arbeit stockt. Wie alles Wunderbare müsste sich dies dauerhaft Wirkliche von selbst ergeben, mir als Geschenk oder Gabe zufallen oder aus Notwendigkeit und Reinheit meiner Verbindung mit Clara – – –«
»Moin, moin, Hinnerk!« Die kräftige Stimme eines Bauern, der in seinem schwarz geteerten Torfkahn gelassen und sicher vorbeistakt, unterbricht Rilkes rhetorischen Rausch.
»Moin ok, Jan.« Vogeler winkt dem Mann leutselig zu.
»Wo geiht di dat?«
»Gaut.«
»’n beeten an’t Klönen?«
»Möt woll«, sagt Vogeler.
»Jau, denn man tau.«
Rilke starrt dem Mann im Kahn unter dem schlaff am Mast hängenden Segel hinterher, als sei er eine Erscheinung aus einer anderen Welt oder eine Figur aus einem Gemälde Böcklins. Dann wendet er sich wieder an Vogeler. »Was hat er gesagt? Ich meine, was haben Sie miteinander gesprochen?«
Ach, Rilke. Der höfliche Vogeler schüttelt den Kopf, aber nur innerlich und sehr dezent. In seinem Buch über die Worpsweder Maler hat Rilke von der Sprache dieses Landstrichs geschwärmt, vom Platt mit seinen kurzen, straffen, farbigen Worten, die wie mit verkümmerten Flügeln und Watbeinen gleich Sumpfvögeln schwerfällig einhergehen. Aber außer »moin, moin« versteht Rilke von dieser Sprache kein Wort. Er versteht auch die Menschen nicht, die hier leben. Und ob er versteht, was die Maler umtreibt, ist wohl auch mehr als zweifelhaft.
Als das Worpswede-Buch vor zwei Jahren erschien, kamen Rilke und Clara aus Paris zurück, wollten weiter nach Rom, verbrachten aber den Sommer in Worpswede. Ihr eigenes Haus in Westerwede hatten sie bereits verkaufen müssen, und so wohnten sie, Vogelers erneuter Einladung folgend, mietfrei auf dem Barkenhoff. Als jedoch im August Vogelers zweite Tochter Bettina zur Welt kam, wurde es dem Dichter auf dem Barkenhoff zu eng und zu unruhig. Babygeschrei störte Rilkes Kampf mit der Inspiration, übertönte sein stammelndes Wortesuchen und -finden, und so wichen die Rilkes zu Claras Eltern nach Oberneuland aus. Immerhin lebte ja auch ihre eigene Tochter dort.