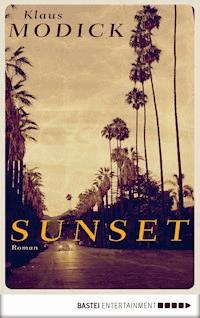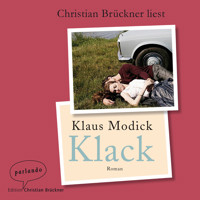9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Ein Buch, so rätselhaft wie ein Adventskalender« Der Spiegel. Im Haus des Erzählers geht es in der Vorweihnachtszeit turbulent zu. Seine beiden Töchter kommen langsam in das Alter, in dem Weihnachtswünsche teuer werden und Familienrituale an Kraft verlieren. Doch der Adventskalender, den die Mutter von einem alten Mann geschenkt bekommt, fesselt die Aufmerksamkeit der ganzen Familie. Er erzählt auf vierundzwanzig Bildern eine faszinierende Geschichte aus der Nachkriegszeit: Drei Männer stehlen ein Worpsweder Gemälde, um damit den Kauf von Heizmaterial und Lebensmitteln zu finanzieren. Ein Schneesturm zwingt sie zur Einkehr in einem einsamen Gehöft, wo eine junge Frau in den Wehen liegt. Meisterlich kontrastiert Klaus Modick die satte Welt der Gegenwart mit einer ebenso behutsam wie anrührend erzählten Weihnachtsgeschichte, in der es um Liebe, Hoffnung und ein Verbrechen geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Ähnliche
Klaus Modick
Vierundzwanzig Türen
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Klaus Modick
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Dezember
Die erste Tür
2. Dezember
Die zweite Tür
3. Dezember
Die dritte Tür
4. Dezember
Die vierte Tür
5. Dezember
Die fünfte Tür
6. Dezember
Die sechste Tür
7. Dezember
Die siebte Tür
8. Dezember
Die achte Tür
9. Dezember
Die neunte Tür
10. Dezember
Die zehnte Tür
11. Dezember
Die elfte Tür
12. Dezember
Die zwölfte Tür
13. Dezember
Die dreizehnte Tür
14. Dezember
Die vierzehnte Tür
15. Dezember
Die fünfzehnte Tür
16. Dezember
Die sechzehnte Tür
17. Dezember
Die siebzehnte Tür
18. Dezember
Die achtzehnte Tür
19. Dezember
Die neunzehnte Tür
20. Dezember
Die zwanzigste Tür
21. Dezember
Die einundzwanzigste Tür
22. Dezember
Die zweiundzwanzigste Tür
23. Dezember
Die dreiundzwanzigste Tür
24. Dezember
Die vierundzwanzigste Tür
Hinweise
Inhaltsverzeichnis
Nehmt eure Stühle und eure Teegläser
mit hier hinter an den Ofen
und vergeßt den Rum nicht.
Es ist gut, es warm zu haben,
wenn man von der Kälte erzählt.
Bertolt Brecht
Inhaltsverzeichnis
1. Dezember
Adventskalender sind ja so was von mega-out, befand Miriam, verzog dabei das Gesicht zu einer Grimasse aus Abscheu und Verachtung und stülpte sich wieder den Kopfhörer ihres Walkman über die Ohren. Geräuschbrei flirrte durch den Raum, Beatles-Recycling der Gruppe Oasis – der dritte Aufguß. Uncool sind die!
Schrei nicht so, sagte ich. Wir sind doch nicht schwerhörig.
Was hast du gesagt? Sie lüftete überm linken Ohr den Kopfhörer.
Daß du nicht so brüllen sollst.
Muß ich doch. Sie ließ den Kopfhörer wieder ans Ohr flappen. Sonst versteh ich nicht, was ich sage.
Auch gut, sagte Stacy, dann gibt’s dies Jahr wenigstens keinen Streit, wer die Türchen aufmachen darf. Sie nickte Laura aufmunternd zu. Du kannst jetzt Nummer eins aufklappen.
Doch Laura zog die Nase kraus, dachte also intensiv nach, und ließ wie abwägend noch etwas von dem an der Kerze heruntergelaufenen und erstarrten Wachsstrang in die Flamme tropfen. Dann schaute sie zweifelnd zu ihrer großen Schwester hinüber, legte sogar die glatte Stirn in grüblerische Falten und sagte schließlich entschlossen: Nö.
Was heißt denn hier nö? Sollen Mama und ich etwa die Türchen aufmachen?
Von mir aus, sagte Laura, mehr melancholisch als patzig, und hielt ein Zweigende des Adventskranzes in die Kerzenflamme. Es prasselte und zischte und roch nach meiner eigenen Kindheit. Möglich, daß mich mit knapp fünfzehn, in Miriams Alter also, Adventskalender auch nicht mehr so recht vom Hocker gerissen hatten. Aber mit dreizehn? Mit den zarten dreizehn meiner kleinen Laura?
Als ich in eurem Alter war, sagte ich, also jedenfalls in deinem, da war ein Adventskalender was ganz Besonderes, etwas wie … Oasis-Fetzen fiepten durch Rauchschwaden. Paß doch mit dem Zweig auf! Du zündest uns noch das ganze Haus an!
Ist ja schon gut, Papa, sagte Laura, wenn ich dir damit eine Freude machen kann … Sie ließ den verkohlten Zweigrest auf die Tischdecke fallen, schob im Sitzen den Stuhl zurück, daß er über die Fliesen schepperte, stand auf und schlurfte zum Kaminsims.
Mir eine Freude machen? Für wen veranstalten wir eigentlich den ganzen Advents- und Weihnachtszauber? Weihnachtsgeschenke wollt ihr dann ja vermutlich auch keine mehr haben. Soll mir recht sein, murmelte ich, griff nach dem Teller mit Nüssen und Spekulatius und knackte laut und demonstrativ eine Haselnuß.
Ich wünsch mir auf jeden Fall die neue CD von Alanis Morissette! brüllte Miriam, die meine rhetorischen Fragen offenbar kraft familiärer Telepathie empfangen hatte.
An den weißgekalkten Ziegeln der Schornsteinmauer lehnte wie jedes Jahr, pünktlich zum ersten Dezember, ein Adventskalender. Alle Jahre wieder hatte sich Stacy der Qual ausgesetzt, eine Wahl zu treffen zwischen katholisch-frömmelndem Christkindskitsch und putziger Weihnachtsmannbiederkeit, drolligen Genreszenen aus der verschneiten Welt Walt Disneys und mund- und fußgemaltem Behindertenkunstgewerbe, anthroposophisch angehauchten Astralfiguren und pädagogisch korrekter SOS-Kinderdorfkunst, skandinavischer Trollknolligkeit und deutscher Rauschgoldseligkeit, naiver Malerei aus Entwicklungsländern und knalliger Comicstrip-Ästhetik. Und rätselhafterweise war es ihr auch immer gelungen, einen Kalender aufzutreiben, der den Mädchen gefiel und uns selbst nicht in Peinlichkeiten stürzte, wenn Nachbarn oder Freunde sich im Haus umsahen und aus der Qualität der Weihnachtsdekoration unsere Zurechnungsfähigkeit in Geschmacksfragen hochrechneten.
Der sieht ja fast aus wie ’ne Diskokugel, staunte Laura und starrte den Kalender an, den Stacy gestern aus der Stadt mitgebracht und vorhin aufgestellt hatte. Sind das Spiegel da drauf? Oder was? Sie nahm den zeitungsseitengroßen, daumendicken Gegenstand vom Sims und legte ihn auf den Tisch. Ist ja voll geil …
Diese Information durchdrang sogar die akustischen Scheuklappen von Miriams Kopfhörer, aus dem jetzt die Gruppe Nirvana lärmte. Spiegel? echote sie wie erwachend, zog den Kopfhörer von den Ohren und griff nach dem Kalender. Zeig mal her das Teil.
In einer Mischung aus selbstverachtender Pickelsuche und erwachender Selbstverliebtheit war Miriam nämlich seit einiger Zeit einem Spiegelfetischismus verfallen; wenn sie nach stundenlanger Identitätssuche das Badezimmer freigab, hätte es mich gelegentlich nicht einmal mehr gewundert, wenn mich statt meines ihr Bild aus dem Spiegel angesehen hätte.
Laß mich doch mal sehen, eyh!
Nö, mauerte Laura, das hab ich jetzt. Das siehste doch. Du findest Adventskalender ja auch was für Babys.
Quatsch, sagte Miriam, zeig doch mal, und rückte neben ihre Schwester; beide hielten schweigend und grimassierend ihre Gesichter über die glänzende Fläche: ein selten gewordenes Bild schwesterlicher Eintracht. Zum Fotografieren schön. Aber bevor man eine Kamera geholt hätte, lägen die beiden sich längst wieder in den Haaren. Außerdem hatte mein Fotoapparat vor einigen Monaten den Geist aufgegeben – ein uraltes Gerät aus den fünfziger Jahren, das mir mein Patenonkel einmal zu Weihnachten geschenkt hatte, nachdem es ihm selbst nicht mehr zeitgemäß vorgekommen war. Ich war damit aber fast vierzig Jahre zufrieden gewesen, auch wenn es wegen der umständlichen Handhabung nur zu Schnappschüssen kam, die zuvor ganz spontan arrangiert worden waren. So wünschte ich mir also zu Weihnachten eine neue Kamera.
Die Abbildung auf dem Kalender zeigte ein von Bäumen umgebenes, kleines Haus mit einem Stall oder einer Scheune; tief heruntergezogene Dächer berührten fast den Boden; hohe alte Bäume, Buchen und Eichen wohl, umstanden das kleine Gehöft. Und alles war tief verschneit, so tief, daß der Schnee fast bis zu den Fenstern hinaufreichte. Die vierundzwanzig Türchen, über denen kleine Ziffern standen, waren offenbar aus Spiegelglas geschnitten; in unregelmäßigen Abständen über das Bild verteilt, ließen sie die Grundzüge noch klar erkennen, gaben dem Motiv jedoch zugleich das Aussehen eines unvollständigen Mosaiks, in dessen Teilen sich das Licht der Lampe und der Kerzen spiegelte. Und wenn man sein Gesicht darüber hielt, sah man sich selbst aus vierundzwanzig Gesichtern entgegen.
Laura drückte jetzt mit den Fingernägeln an dem Türchen mit der Nummer eins herum, das sich am unteren, rechten Bildrand befand.
Laß mich mal, sagte Miriam.
Finger weg, schnappte Laura.
Das Türchen öffnete sich. Das Aquarell schien auf eine Sperrholzplatte geklebt worden zu sein, in die Aussparungen für die Quadrate aus Spiegelglas gesägt waren, und ein an die Glasrückseite fixierter, als Scharnier dienender Gazestreifen steckte zwischen dem Holz und der hinteren Schicht.
Das ist ja schon wieder ein Spiegel, sagte Laura verblüfft und merklich enttäuscht. Das find ich aber ätzend, wenn hinter den ganzen Spiegeln immer nur das gleiche steckt.
Dann mach ich jetzt mal Nummer zwei auf, schlug Miriam vor. Vielleicht gibt’s da was zu sehen.
Nummer zwei wird erst morgen aufgemacht, sagte ich. Das ist nun mal so. Das war auch schon immer so.
Och, Papa, maulte Laura, stell dich doch nicht so an …
Die erste Tür
Die merkwürdige Begebenheit jenes Weihnachtsfestes strahlt immer noch als Fixstern am dunkler werdenden Himmel meiner Erinnerung. Wenn ich heute, nach über dreißig Jahren, an den Winter 1946 zurückdenke, kommt es mir vor, als sei ich damals ein anderer gewesen, ein junger Mann, der mir fremder und fremder wird. Und er war sich damals wohl auch selbst fremd, bis zu jenem Ereignis jedenfalls, von dem ich erzählen will, damit es nicht verschwindet wie das Licht in der Nacht.
Ich sehe jetzt wieder die Dämmerung eines eisgrauen, kalten Morgens durchs Fenster ins Zimmer gähnen. In dieser Zeit voller Not und Zweifel schienen sich selbst die Tage nur widerstrebend aus den Nächten zu lösen. Manchmal beneidet der junge Mann jene Tiere, die den Winter verschlafen. In der Dunkelheit der frühen Stunden hat er schon lange wach gelegen, und bevor noch der Blechwecker in seine scheppernden Zuckungen fällt, steht er auf. Am Röhren und Glucksen der Leitung in der Wand kann er hören, daß das Badezimmer in der ersten Etage bereits besetzt ist.
Es ist eigentlich immer besetzt, leben in den acht Zimmern des Hauses doch vierzehn Personen, und das Bad im Erdgeschoß ist wegen eines Leitungsschadens unbrauchbar. Die beiden Flüchtlingsfamilien aus Pommern, zwei Elternpaare und insgesamt fünf Kinder, teilen sich das Erdgeschoß mit dem Wintergarten. In der ersten Etage wohnen im Schlafzimmer seiner Eltern zwei ältere Damen, unverheiratete Schwestern, deren Haus beim letzten Luftangriff des Krieges zerstört worden ist; im Zimmer seines Bruders ist ein anderer junger Mann einquartiert, der an der Universität Jura studiert, und sein eigenes Zimmer belegt ein ehemaliger Leutnant der Wehrmacht, der vor Leningrad ein Bein eingebüßt hat und jetzt das Lehrerseminar in der Stadt besucht. Ihm selbst hat der britische Offizier, der für die Verteilung des Wohnraums zuständig ist, das Mansardenzimmer zugewiesen, in dem früher das Hausmädchen wohnte. Seinen Protest, daß er immerhin der Hauseigentümer sei, hat der Engländer knapp mit der Bemerkung abgetan, er könne froh sein, nicht enteignet zu werden.
Obwohl er weiß, daß die fünf Torfsoden, mit denen er gestern abend das Zimmer auf knapp zehn Grad geheizt hat, längst zu weißer glutloser Asche zerfallen sind, öffnet er die Klappe des eisernen Kanonenofens und stochert in den schaumigen Resten herum. Das Wasser rumort immer noch in der Wand. Er hängt sich die beiden Wolldecken um die Schultern, hockt auf dem Bett und raucht eine der Zigaretten, die Werschmann ihm geschenkt hat. Als Vorschuß … Röchelnd verstummt die Wasserleitung.
Er hastet die Mansardenstiege hinunter und kommt gerade noch rechtzeitig, um einer der ausgebombten Schwestern die Badezimmertür vor der Nase zuziehen zu können. In der feuchtkalten Luft hängt der Gestank von Exkrementen. Er reißt das Fenster auf. Draußen ist es kaum kälter als drinnen, der Himmel mit einer hohen, hellgrauen Wolkenschicht überzogen. Vielleicht wird es Schnee geben. Und dann im Spiegel, der an den Rändern milchig angelaufen ist wie ein Bilderrahmen aus silbrigem Nebel, sein Gesicht. Es mißfällt ihm. Es erschreckt ihn. In jenen Tagen vermeidet er seinen eigenen Anblick, so gut es geht, aber eine Rasur ohne Spiegel ist unmöglich. Die Hagerkeit des Mangels ist häßlich, aber keine Schande. Was ihn erschreckt, ist die stumpfe Gleichgültigkeit. In drei Tagen ist Weihnachten. Heiligabend. Er will nicht an die Weihnachten seiner Kindheit denken, nicht an das Licht und die Wärme, die in diesem Haus geherrscht haben. Das war in einer Zeit, die ihm wie ausradiert erscheint. Er setzt die Klinge an den Hals und zieht eine erste Spur durch den Seifenschaum.
Wo hast du den gekauft, Mama, erkundigte sich Miriam, von ihrem eigenen Spiegelbild offenbar nachhaltig beeindruckt, diesen Kalender oder was immer das sein soll? Der ist ja irnkwie echt irre. Irnkwie geil …
Stacy lächelte. Sie lächelte fast schon geheimnisvoll. Den habe ich gar nicht gekauft, sagte sie. Den habe ich bekommen.
Wieso bekommen? So was bekommt man doch nicht einfach. Oder war das ein Werbegeschenk? Vielleicht steht ja irgendwo Coca-Cola drauf. Oder Parfümerie Douglas oder …
Bestimmt nicht, sagte ich. Das ist ein Einzelstück. Den hat jemand selbst gemalt und zusammengebastelt. Wir haben als Kinder in der Adventszeit auch immer gebastelt. Nicht so tolle Sachen wie diesen Kalender; der ist ja fast schon künstlerisch. Das ist wirklich gut, dieses Aquarell. Sehr gut sogar. Und die Spiegel darauf … seltsamer Effekt.
Ja, und der alte Herr, von dem ich den Kalender bekommen habe, war auch irgendwie so … so seltsam.
Alter Herr? Wovon redest du eigentlich? Manchmal konnte Stacy wirklich etwas … ja: seltsam sein.
Wahrscheinlich der Weihnachtsmann, gluckste Laura. Der läuft ja in mehreren Exemplaren durch die City. Wattebart und rote Zipfelmütze …
Stacy antwortete nicht gleich, sondern stellte den Kalender auf den Kaminsims zurück, rückte den Messingleuchter daneben, der in meinem Elternhaus auf dem Vertiko gestanden hatte, und zündete die weiße Kerze darin an. Ihre Flamme reflektierte zuckend auf der Oberfläche des Kalenders, brach sich in vierundzwanzig Spiegeln, so daß das Bild gar nicht mehr erkennbar war, sondern nur noch das vervielfältigte Flackern. Ich mach uns erst mal einen Tee, sagte sie, und dann erzähl ich euch die Geschichte.
Klingt ja echt spannend, sagte Miriam gedehnt. Der ironische Ton, den sie hatte anschlagen wollen, mißlang – ein ganz klein bißchen spannend fand sie es wohl wirklich. Trotz ihrer gut vierzehndreiviertel.
Stacy goß Tee in die Tassen. Knisternd zersprang der Kandis. Über der goldbraunen Fläche kräuselte sich weißer Dampf zu Mustern des Zufalls.
Gestern, begann sie, bin ich also in der Stadt gewesen. Mit Weihnachtseinkäufen muß man früh anfangen, dann spart man sich den Streß. An einen Adventskalender habe ich übrigens gar nicht gedacht; den hätte ich wahrscheinlich glatt vergessen. Als ich mich auf den Rückweg machte, begann es jedenfalls zu nieseln, und auf den gefrorenen Klinkern des Gehwegs wurde es sofort glatt. Spiegelglatt.
Blitzeis nennt man das, sagte Laura. Hab ich gestern im Fernsehen gesehen. Blitzeis. Massenweise Unfälle und …
So ist es, sagte Stacy. Die Leute auf der Theaterallee sind jedenfalls wie in Zeitlupe gegangen, um nicht zu stürzen, haben Beine und Arme gespreizt, um sich im Gleichgewicht zu halten. Und dann ist doch jemand gestürzt, direkt vor mir. Dieser alte Herr eben. Ist der Länge nach rücklings aufs Pflaster geschlagen. Schirm und Einkaufstüte, die er in den Händen gehalten hat, sind zur Seite gerutscht, und der Hut ist in den Rinnstein gerollt.
Und? Hat er sich was gebrochen, der Weihnachtsmann? fragte Laura.
Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich zu ihm hinuntergebeugt und gefragt, ob er sich verletzt habe. Er hat sich kopfschüttelnd aufgerappelt, wobei ich ihn gestützt habe. Er hat sich prüfend über die rechte Schulter getastet, ist ein paarmal unsicher mit den Füßen aufgetreten und hat dann gemurmelt, alles sei in Ordnung. Ich habe ihn gefragt, ob er es noch weit habe? Nein, hat er gesagt, er wohne nur wenige Minuten entfernt in der Uferstraße. Ich habe angeboten, ihn zu begleiten, was er erst abgelehnt hat, aber als ich ihm versichert habe, daß ich sowieso durch die Uferstraße gehen müßte, hat er den Vorschlag angenommen. Ich habe seine Sachen von der Straße aufgesammelt, er hat sich den Hut wieder auf die ziemlich langen grauen Haare gesetzt, die ihm etwas irgendwie Künstlerisches geben …
Lange Haare machen künstlerisch? unterbrach Miriam. Papa, laß dir doch mal die Haare wachsen.
Ich hatte mal Haare bis auf die Schultern, sagte ich, aber …
Wollt ihr nun die Geschichte hören oder nicht? fragte Stacy.
Ja, klar, sagte Miriam.
Also gut. Wir sind langsam weitergegangen, wobei ich ihn am rechten Unterarm gestützt habe. Als wir uns dem Haus genähert haben, hat er einen einigermaßen charmanten Scherz gemacht. Hat nämlich gesagt, die Nachbarn würden mich jetzt vermutlich für seine neue Geliebte halten.
Charmant? murmelte ich. Je oller, je doller.
Quatsch, sagte Stacy. Der ist wirklich charmant. Und hat ein sehr schönes Haus. Ein mannshoher Gitterzaun aus Schmiedeeisen, hinter dem noch eine dichte Buchsbaumhecke steht, schirmt das Gebäude von der Straße ab. Und durch das Zauntor, das mit so Jugendstilornamenten verziert ist, kann man von außen einen Blick auf die tief im Garten stehende Villa werfen – zweistöckig, aus rotem Backstein, Jugendstil, aufgelockert von Erkern und einem Wintergarten, das Dach verwinkelt und an der Frontseite so aufgezogen, daß dort Platz für eine Mansarde sein muß. An der Messingklingel im Tor ist die Hausnummer angebracht, aber kein Name, was den alten Herrn offenbar daran erinnert hat, sich noch nicht vorgestellt zu haben.
Wie charmant, sagte ich.
Blödmann, sagte sie. Vringsen heißt er, Vringsen mit V. Und ich habe ihm dann auch meinen Namen genannt. Er hat das Tor aufgestoßen, und über einen Weg aus grauem Kies sind wir in den Garten gelangt, während das Tor zugefallen und schnalzend eingeschnappt ist. Der Nieselregen war inzwischen in Schnee übergegangen. Die nassen Flocken haben auf den dunklen Ästen und Zweigen der Kastanienbäume, die den Weg säumen, weiße Ränder gebildet. Das hat dieser kleinen Allee etwas, wie soll ich sagen, etwas Nachdenkliches gegeben.
Eine nachdenkliche Allee? Miriam verdrehte die Augen. Also, ich weiß nicht …
In der Tiefe des Gartens, erzählte Stacy unbeirrt weiter, wo durch entlaubtes Buschwerk ein halb verfallenes Gewächshaus und das schwarze Band des Flusses durch die Dämmerung schimmerten, hat eine Krähe gekrächzt. Oder vielleicht ein Rabe.
Dann hat er bestimmt nevermore gekrächzt, sagte ich.
Wieso denn nevermore? fragte Laura.
Das ist Lyrik, sagte ich, und zwar von …
Schon gut, winkte Laura ab. Mamas Geschichte ist spannender.
Zur Eingangstür, sagte Stacy, führt eine kleine, geschwungene Steintreppe hinauf. Vringsen hat ein Schlüsselbund aus der Manteltasche genestelt und gefragt, während er die Tür geöffnet hat, ob er mir etwas anbieten könne. Einen Tee vielleicht? Oder einen Sherry?
Wird ja immer charmanter, sagte ich, was Stacy ignorierte.
Wir standen jetzt in einer geräumigen, mit Antiquitäten vollgestopften Diele. Die Wände sind mit Zeichnungen, Aquarellen und Gemälden übersät. Vringsen, der meinen Blick wohl richtig gedeutet hat, ist meiner Frage zuvorgekommen. Ich solle nicht allzu skeptisch hinsehen, hat er gesagt. Das seien alles nur Versuche. Er habe zu spät damit begonnen, eigentlich erst nach seiner Pensionierung. Wie es also mit einem Sherry wäre? Nun war es inzwischen aber so spät geworden, daß ich mich nicht länger aufhalten konnte und also abgelehnt habe, obwohl mir der Alte wirklich sympathisch gewesen ist. Und irgend etwas an ihm oder an dem Haus oder an der ganzen Situation hat mich auch neugierig gemacht. Ich muß noch einen Adventskalender für meine Kinder besorgen, habe ich gesagt, und …
Hast du echt Kinder gesagt, fragte Laura streng.
Äh, nein, natürlich nicht. Mädchen habe ich gesagt, Mädchen. Aber es ist wirklich sehr merkwürdig, daß mir das mit dem Adventskalender ausgerechnet in diesem Moment eingefallen ist. Er hat mich nachdenklich angesehen, hat sich mit der Hand über die Stirn und die buschigen grauen Augenbrauen gestrichen, als erinnere er sich an etwas. Ich solle einen Moment warten, hat er gesagt, vielleicht habe er da etwas für mich. Und dann ist er im Flur verschwunden. Ich habe zwischen all diesen Bildern gewartet, Landschaften, Seestücke, Porträts. Soweit ich es beurteilen kann, sind das aber durchaus keine Versuche, sondern ziemlich ausgereifte Arbeiten. Nach einigen Minuten ist Vringsen zurückgekommen und hat mir den Adventskalender in die Hand gedrückt. Den habe er für seine Kinder gemacht, sagte er. Damals, Anfang der fünfziger Jahre. Aber seine Kinder seien längst erwachsen und aus dem Haus, lebten woanders, und Enkelkinder gebe es keine. Ich habe den Kalender erst nicht annehmen wollen, aber Vringsen hat darauf bestanden. Er könne mir natürlich nicht das bedeuten, was er ihm bedeutet habe, hat er gesagt, aber vielleicht gefalle er meinen Kindern trotzdem. Dieser Kalender erzähle eine Geschichte, die ihm einmal passiert sei. Mir werde er vielleicht eine ganz andere Geschichte erzählen. Für ihn sei er eigentlich nur so lange wichtig gewesen, wie er an ihm gearbeitet habe. Und dann hätten seine Kinder ein paar Jahre Freude daran gehabt, bis sie nicht mehr geglaubt hätten. An Weihnachten. Und an diese gewissen Dinge, die mit Weihnachten zusammenhingen. Und dann hat Vringsen ganz leise geseufzt. Nun wollte ich den Kalender natürlich erst recht nicht mehr annehmen. Wenn er eine so große Bedeutung für Sie hat, habe ich gesagt, können Sie ihn doch nicht einfach verschenken. Aber Vringsen hat gelächelt und geantwortet, daß er die betreffende Geschichte schon nicht vergessen werde. Nie. Im übrigen, sagte er, habe er sie sogar einmal aufgeschrieben, weil … aber das führe nun wirklich zu weit und er wolle mich nicht unnötig aufhalten. Er hat mir die Hand gegeben, und dann bin ich gegangen. Und hier wäre also der Adventskalender.
Echt wahr? fragte Laura mißtrauisch. Klingt ziemlich ausgedacht.
Wieso ausgedacht? Da steht der Kalender doch.
Naja, aber ich mein’, ausgerechnet so’n netter alter Mann mit grauen Haaren? Fehlt nur noch der Rauschebart. Und dann so’n Märchenhaus mit Märchengarten? Und Gruselraben? Und dann auch noch ’ne Geschichte, die er angeblich aufgeschrieben hat? Ist ja voll herbe. Wer’s glaubt …
Inhaltsverzeichnis
2. Dezember
Ich stehe auf, wenn die Haustür hinter Stacy, Miriam und Laura zufällt. Bei den morgendlichen Dusch- und Schminkorgien gelte ich nämlich als männlicher, also unerwünschter Störfaktor. Da ihr Zentralorgan Young Miss (das die inzwischen als präpubertär, sprich: uncool, abgelegte Bravo beerbt hatte) den Mädchen vorschreibt, welche hygienisch-kosmetischen und modischen Bedingungen erfüllt sein müssen, um im Schulalltag »in« und »cool« zu sein, folgt dem besonders zur Winterszeit eher widerstrebenden Aufstehen ein temperamentvoller Kampf ums Bad, den gewinnt, wer als erster die Dusche besetzt hält, um sich dort bis zur Abflußverstopfung von allerlei Shampoos und Lotions berieseln zu lassen. Als zeitraubend erweist sich ferner die Anpassung ans cliquen-korrekte Outfit, die nur durch mehrfaches An-, Um- und Durchprobieren diverser Kombinationsmöglichkeiten erreicht werden kann, wobei recht regelmäßig festgestellt wird, daß man eigentlich gar nichts zum Anziehen hat und endlich und unbedingt neue Klamotten braucht.
Durch meinen Dämmer zieht halblautes Gemurmel vom Frühstückstisch, das Flair eines radebrechend geeinten Europas, wachgerufen durchs seit vorgestern fällige, in diesem allerletzten Moment jedoch erst realisierte Repetieren französischer und englischer Vokabeln. Bei Fragen nach arithmetischen Methoden, die nur von den Verfassern einschlägiger Schulbücher beantwortbar wären, tauchen im halbschlafenden Elternhirn Erinnerungen an die Selbstbescheidung des Sokrates auf: »Ich weiß, daß ich nichts weiß« – jedenfalls nicht das, was euer Mathelehrer gleich von euch wissen will. Noch ein Lamento über den Belag des Schulbrots (»nich’ schon wieder den Käse!«), ein letztes Wechseln des bereits zweimal gewechselten Schuhwerks (»total uncool, so was trägt bei uns in der Klasse keiner mehr«). Höchste Zeit für den Bus. Die Tür rummst ins Schloß. Stacy wird auf dem Weg zur Arbeit die Mädchen an der Bushaltestelle absetzen. Das Anlassen des Motors. Das Nageln des kalten Diesels in der Einfahrt. Stille im Haus.
Im Badezimmer war trotz der Kälte das Fenster aufgerissen. Zum Ausgleich röhrte die Heizung auf Hochtouren. Ich schloß das Fenster und dachte an die einschlägigen Merk- und Kernsätze meiner Kindheit. Lieber warmer Mief als kalter Ozon. Oder auch: Erstunken ist noch niemand, erfroren sind schon viele.
Vielleicht lag es an der klaren, klirrenden Kälte dieses Morgens, dessen Licht rosig durch die Dämmerung brach und die Baumschatten als Hieroglyphenschrift auf mich zufallen ließ, daß bestimmte Momente meiner Kindheit in mir wach wurden. Selbst die Zeitung, die ich beim Frühstück aufschlug, erinnerte mich an jene fernen Tage des Behelfs und Ersatzes. Damals war die Funktion der Tageszeitung freilich nicht nur auf Information und Meinungsbildung, Werbung und Unterhaltung beschränkt. Richtig brauchbar wurde das Blatt erst, wenn es von gestern war. In seine Seiten konnten dann die Briketts eingewickelt werden, damit sie über Nacht die Glut besser hielten. Auch Gemüse- und Fischhändler wußten die Saugfähigkeit des Zeitungspapiers als Verpackungsmedium zu schätzen, und so konnte es passieren, daß einem Adenauers Konterfei unter einem Kohlkopf entgegenblinzelte. Meine Großmutter, aus leidvoller Erfahrung schwerer Zeiten sehr sparsam geworden, die das Badewasser am Samstag in Eimern auffing, um damit am Mittwoch die Fußböden zu schrubben, führte die Zeitungsseiten, in handliche Blätter zerschnitten, auch einer sanitären Funktion zu, die, an heutigen Maßstäben der Wiederverwertung gemessen, zwar einer Pioniertat praktischen Umweltbewußtseins gleichkam, wegen der Glätte und Härte des Papiers jedoch gewisse Unannehmlichkeiten mit sich brachte.
Nachdem ich die heutige Ausgabe überflogen und mein Frühstück beendet hatte, räumte ich die Lebensmittel in den Kühlschrank und das Geschirr in die Spülmaschine. Auf dem Weg ins Arbeitszimmer fiel mein Blick auf den Adventskalender. Die Mädchen hatten die zweite Tür aufgeklappt. Das Motiv zeigte ein Paar Schuhe. Ich sah genauer hin. Eine Bleistiftzeichnung offenbar. Sehr fein ausgeführt. Ich hatte solche Schuhe schon einmal gesehen. Aber wo? Wann? Ich setzte die Lesebrille auf. Hochschäftige schwarze Schnürschuhe mit derber Sohle. Abgetragen, zerschlissen. Krumme Hacken. Möglicherweise Militärschuhe. Woher kannte ich diese Schuhe? Sie schienen mir plötzlich so vertraut, als hätte ich sie einmal selbst getragen. Sie hatten etwas mit der Erinnerung an die Zeitung zu tun, mit Mangel und Kälte. Aber auch mit Unbeschwertheit und Glück. Mit Kindheit jedenfalls, der versunkenen Landschaft. Es würde mir schon wieder einfallen. Ich durfte nur nicht darüber nachdenken.
Die zweite Tür
Die Klinke der verriegelten Tür wird heruntergedrückt. Zwei Faustschläge wummern dumpf gegen das Holz der Füllung. Bißchen Beeilung da drin! Der beinamputierte Ex-Leutnant und Lehrer in spe. Wer scheißt denn da so lange?
Und so weiter, das übliche Grauen dieser Tageszeit. Der junge Mann, der ich war, wischt sich mit dem Handtuch die kalten Schaumreste aus dem Gesicht, klebt einen Fetzen Zeitungspapier auf die blutende Schnittwunde am Kinn, rafft seine armseligen Toilettenartikel zusammen und geht wortlos an dem Mann vorbei.
Grüßen ist hier wohl ein Fremdwort geworden, was? brüllt der ihm nach. Armes Deutschland! und knallt die Tür zu.
Armes Deutschland, murmelt er wie ein tonloses Echo, als er sich im Mansardenzimmer an den sechseckigen Spieltisch hockt, der früher im Salon stand. An diesem Tisch haben seine Eltern mit ihren Freunden Doppelkopf und Rommé, Bridge und Canasta gespielt, und zu Weihnachten hat der Tannenbaum strahlend und funkelnd neben diesem Tisch gestanden, die Mahagoniplatte mit einer purpurroten Samtdecke überzogen, auf der die Geschenke ausgebreitet lagen. Der warme Glanz, den das Mahagoni in seinen Tönen wie schwarzer Tee und Cognac ausstrahlte, ist längst abgestumpft und ausgekühlt.
Der junge Mann stöpselt ein stoffumwirktes Elektrokabel in einen Tauchsieder, hängt ihn in einen Topf, starrt teilnahmslos hinein, bis das Wasser Blasen wirft und zu sprudeln beginnt, und gießt sich in einer abgestoßenen Tasse Ersatzkaffee aus Gerstenmalz und gemahlenen Eicheln auf. Dann öffnet er die Blechdose, in der früher, in unerreichbarer Höhe für naschende Kinderhände, auf dem Küchenschrank, selbstgebackene Kekse und Biscuits verwahrt wurden, und entnimmt ihr die letzten zwei Scheiben Maisbrot. Die gelbe, klebrige Masse ist bereits angetrocknet und zerbröselt in den Händen, klebt aber zwischen den Zähnen.
Würgend sieht er sich im Zimmer um. Bett, Kommode, Tisch, zwei Stühle. Von der Decke baumelt an einem Kabel eine nackte Glühbirne. An der Kommodenwand lehnen mehrere Mappen aus leinenüberzogener Pappe. Sie enthalten, was er einmal für die Anfänge seiner Kunst hielt. Für Kunst ist dies nicht mehr die Zeit. Mit einigen der Blätter hat er einmal den Ofen angeheizt. Aber als die Flammen das Porträt von Marion verzehrten, wie sie im Blütenrausch des Frühjahrs auf der Gartenbank saß und las, schreckte er wie aus einem Alptraum auf und legte die Skizzen wieder in die Mappen.
Am Haken neben der Tür sein Mantel. Die Mütze. Der Schal. Auf dem Fußboden die Schuhe. Damals hätte er sie vielleicht gezeichnet in ihrer stummen und doch eigentümlich belebten Traurigkeit. Die abgetretenen Absätze. Das vergraute Schwarz des Leders zerschlissen, schründig, von Schneewasser weiß gerändert. Die Schuhbänder mehrfach gerissen, mehrfach wieder geknotet. Die Schuhe haben einen langen Weg hinter sich. Im Herbst, als ihm der Regen die Halbschuhe durchweichte, hat er diese britischen Militär-Schnürstiefel auf dem Schwarzmarkt eingetauscht. Vermutlich war der Mann, der sie ihm überlief, ehemaliger Wehrmachtsoffizier. Vielleicht war er auch nur ein Angeber, denn als er ihm die Schuhe gab, kniff er ein Auge zu und flüsterte: Dünkirchen. Für zehn Zigaretten hat er sie bekommen. Für zehn Lucky Strike und einen der beiden alten Kerzenständer aus Messing, die kurz vor Weihnachten mit einer scharf riechenden weißen Paste eingeschmiert und mit einem Wolltuch poliert worden waren. Dann standen sie glänzend und Glanz zugleich spiegelnd auf dem Gabentisch.
Er zieht die schweren Schuhe zu sich heran, fährt mit den Füßen hinein, schnürt die Bänder fest. Schal. Mantel. In den löchrigen Taschen verfilzte Wollhandschuhe. Mütze. Er schließt die Tür hinter sich ab und steigt mit schweren Schritten die Treppe hinunter.
Mit einer nordöstlichen Strömung sorge das umfangreiche Rußlandhoch in den kommenden Tagen für die Zufuhr sehr kalter Festlandsluft, die in ganz Deutschland zu Dauerfrost führen werde. Soweit, verehrte Zuschauer, das Wetter für die nächsten Tage, womit der halbkahle Meteorologe Wesp vom ZDF bescheiden den Bildschirm räumte und dem vollkahlen Werbemanfred Raum für seinen vorweihnachtlichen Telekomkäse gab. Cool, sagte Miriam. Dann kriegen wir eisfrei.
Was eisfrei sei? erkundigte sich Stacy, und wurde belehrt, es handele sich um das Gegenteil von hitzefrei, um den Schülern Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen zu geben.
Hat’s aber noch nie gegeben, seufzte Laura. Ist vielleicht bloß so ein Gerücht.
Schlittschuh laufen könnt ihr ja wohl auch nach der Schule, sagte ich.
Ich brauch aber unbedingt neue Schlittschuhe, sagte Miriam. In den alten müßte ich mir die Zehen abhacken.
Ich auch, setzte Laura nach. Und die Fersen dazu.
Dir passen mit Sicherheit noch Miriams, sagte Stacy.
Igitt! schrie Laura, die sind ja schwarz. Ich will weiße. Außerdem steck’ ich doch meine Füße da nicht rein, wo Miriam ihre Käsemauken dringehabt hat.
Mein Gott, sagte ich, ihr seid aber wirklich sowas von …
… verwöhnt! riefen die Mädchen im Chor und grinsten sich an.
War dies verständnisinnige Grinsen Indiz für die Wiederkehr des Immergleichen? Hatten meine Eltern nicht auch uns als notorisch verwöhnt empfunden, nachdem sie selbst der nackten Existenznot ausgesetzt gewesen waren? Tod, Zerstörung, Hunger, Kälte? Aber war der Verdacht, verwöhnt zu sein, nicht schon schnell zur stereotypen Phrase geronnen, je mehr sich die hageren Falten der Not glätteten und unter den Nyltesthemden die Wohlstandsbäuche strafften? Kinder, ihr wißt ja gar nicht, wie gut ihr’s habt! Und in der Tat, wir hatten genug zu essen und froren nicht, aber um Milch mußte man, die Blechkanne in der Hand, in langer Reihe anstehen, und Slogans wie »Eßt mehr Obst und ihr bleibt gesund« klangen höhnisch, wenn ich mir mit meinem Bruder eine saure Apfelsine teilen durfte und als Festmahl empfand. Manche Dinge erwiesen sich bereits in der Art und Weise, in der Erwachsene davon redeten, als der pure Luxus: Wenn meine Mutter »echter Bohnenkaffee« sagte, dann tremolierte das wie ein Ding aus Tausendundeiner Nacht; und »gute Butter« – das klang fast wie »echtes Gold«. Wenn es im Winter für uns Kinder nicht für lange Hosen reichte, trugen wir ersatzweise lange Wollstrümpfe zu kurzen Hosen, und manche Besucher brachten als Gastgeschenk ein paar Briketts mit.
Im Winter, sagte ich, wenn der Teich im Stadtpark zufror, sind wir dort Schlittschuh gelaufen und haben Eishockey gespielt. Bei den Schlittschuhen handelte es sich natürlich noch nicht um diese Astronautenausrüstung, diese High-Tech-Geräte, mit denen ihr aufs Eis geht. Unsere Schlittschuhe, wie im Sommer übrigens auch die rappelnden Rollschuhe der Marke Hudora, wurden einfach unter die Schuhe geschnallt und zur passenden Größe geschraubt. Sehr zum Leidwesen unserer Eltern, weil Dauerfrost deshalb fast immer neue Sohlen und Absätze kostete. Und die Schuhe …
Was war mit den Schuhen? fragte Laura, als ich in meiner Erzählung stockte. Denn bei den letzten Worten hatte mich ein vager Reiz der Erinnerung berührt, wieso mir die Schuhe auf dem Adventskalender vertraut vorgekommen waren. Ich wußte jetzt, daß ich es wußte, aber das Wissen schlief noch.
Als Eishockeyschläger, fuhr ich fort, mußten derbe Astgabeln reichen. Und der Puck war eine leere Dose Libby’s-Milch. Wenn man dann, nach Stunden, vom Eis kam, die Schlittschuhe abschnallte und nach Haus marschierte, durchströmte Füße und Beine ein zwischen Schwerelosigkeit und Gelenkschmerzen pendelndes Glücksgefühl.
Das Gefühl kenn ich, sagte Miriam. Aber wieso Glück?
Vielleicht, sagte ich, weil etwas Selbstverständliches, über das man sonst nie nachdenkt, das Gehen auf eigenen Füßen nämlich, für einige Momente ins Bewußtsein drang.
Na ja, sagte Laura, vielleicht freut man sich auch nur, daß dann nix mehr weh tut. Hauptsache, die Schlittschuhe sind nicht zu klein.
Vom Schnee- und Eiswasser waren die Schuhe dann meistens aufgeweicht, hatten weiße Schlieren und rochen streng. Wir haben Zeitungspapier zusammengeknüllt, die Schuhe damit ausgestopft und zum Trocknen über den Ofen gehängt.
Die Schuhe, die alten Zeitungen, der Geruch nassen Leders. Irgend etwas fehlte noch …
Wie gefällt euch denn das Bild auf dem Adventskalender? fragte ich.
Diese abgelatschten Springerstiefel? Miriam zuckte mit den Schultern. Na ja, ganz schön irgendwie …
Im Lauf des Abends hatte der Ostwind beständig zugenommen, und als ich im Bett lag, orgelte er durch die Baumkronen und ballte sich zu dumpfen Stößen gegen das Fenster zusammen. Der Mond sichelte eisblank durchs Geäst der großen Kiefer, warf fahles Licht und schwankende Schattenrisse gegen Wände und Zimmerdecke. Irgendwo im Dachgebälk baumelten die Schuhe.
Inhaltsverzeichnis