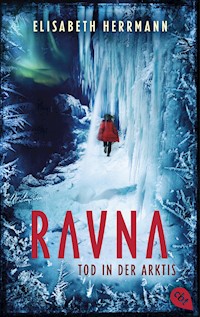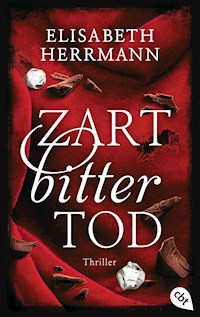8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Joachim Vernau
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Joachim Vernau ist ganz oben in der Berliner Gesellschaft angekommen. Er steht kurz davor, in die wohlhabende und einflussreiche Familie der von Zernikows einzuheiraten, nicht ahnend, dass ihre Ehrbarkeit nicht viel mehr als Fassade ist. Als eine ukrainische Frau auftaucht und behauptet, die von Zernikows hätten im Zweiten Weltkrieg eine Zwangsarbeiterin beschäftigt, lässt das Familienoberhaupt sie kurzerhand hinaus werfen. Wenig später wird sie tot aus dem Landwehrkanal geborgen. Vernau beginnt unangenehme Fragen zu stellen und kommt nicht nur der Identität der Frau sondern auch dem lukrativen Geschäft mit enteigneter Kunst auf die Spur …
Nominiert für den Glauser, den wichtigsten deutschen Krimipreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Ähnliche
Buch
Für den Anwalt Joachim Vernau stehen alle Zeichen auf Erfolg. Er wird die aufstrebende Politikerin Sigrid von Zernikow heiraten und damit nicht nur Eingang in die Berliner Gesellschaft finden, sondern auch Partner in der angesehenen Kanzlei von Sigrids Vater Utz werden. Mit einer großen Verlobungsparty soll er in die Familie eingeführt werden. Aber als plötzlich eine ukrainische Frau erscheint, die von Utz die Unterschrift auf einem Blatt voller kyrillischer Buchstaben fordert, bekommt die Fassade der Anständigkeit erste Risse. Denn Utz soll mit dieser Unterschrift bestätigen, dass seine Familie während des Zweiten Weltkriegs eine ukrainische Zwangsarbeiterin als Kindermädchen beschäftigt hat, um ihr jetzt eine Entschädigung zu ermöglichen. Utz streitet alles ab und lässt die Frau rausschmeißen. Der Auftritt wäre schnell vergessen, doch die Ukrainerin wird kurze Zeit später tot aus dem Landwehrkanal gezogen. Obwohl Vernau ahnt, dass er so seine Zukunft in der Familie aufs Spiel setzt, beginnt er unbequeme Fragen zu stellen. Und schon bald wird klar, dass die von Zernikows nicht nur einen dunklen Fleck auf ihrer weißen Weste haben. Denn die Geschichte der ukrainischen Zwangsarbeiterin scheint wahr zu sein, und Joachim findet eindeutige Spuren eines äußerst lukrativen Handels mit Kunstwerken, die von den Nationalsozialisten enteignet worden waren …
Autorin
Elisabeth Herrmann, geboren 1959 in Marburg/Lahn, arbeitet als Journalistin und lebt mit ihrer Tochter in Berlin. Zum Schreiben kam sie erst über Umwege – und hatte dann sofort durchschlagenden Erfolg mit ihrem Thriller »Das Kindermädchen«, der von der Jury der KimiWelt-Bestenliste als bester deutschsprachiger Krimi 2005 ausgezeichnet und vom ZDF mit Jan Josef Liefers und Natalia Wörner in den Hauptrollen verfilmt wurde.
Inhaltsverzeichnis
Für Shirin
Die Tage unserer Jahre, ihrer sind siebzig Jahre, und,wenn in Kraft, achtzig Jahre,und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit,denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.
DIE BIBEL, PSALM 90
Die Flugzeuge.
Mit zitternden Händen versucht sie, das Schwarzpapier dort zu befestigen, wo es sich am Fenster gelöst hat. Das Sirenengeheul kündigt sie an, die zehnten Reiter der Apokalypse. Noch ist es mehr zu ahnen, das dunkle Dröhnen, doch es kommt näher. Vielleicht Richtung Neukölln. Vielleicht wird es auch Spandau treffen. Oder Köpenick. Vielleicht aber auch den Grunewald dieses Mal, diese Straße und dieses Haus. Wo Olga jetzt sein mag? Nicht nachdenken. Bloß nicht nachdenken. Vielleicht hilft Wachs.
Sie löscht die Kerze und taucht den Finger in die heiße Flüssigkeit. Damit bestreicht sie den Holzrahmen und versucht erneut, das Fenster korrekt zu verdunkeln. Der Sirenenton jagt den Schrecken in den Körper, der nur noch einen Impuls kennt: fliehen, sich verkriechen, Schutz suchen. Beten.
Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Lehre uns, Herr, unsere Tage zu zählen. Du warst unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht.
»Paula?«
Die Tür zu dem kleinen Kabuff über dem Ofen wird aufgerissen. Im Licht einer Kerze erscheinen die angsterstarrten Züge eines Kindes.
»Paula!«
Flink klettert der Junge in den engen Raum, der sogar für ihn zu niedrig zum Stehen ist.
»Du sollst schlafen.«
Sie lächelt, als sie sein Gesicht unter den verstrubbelten Haaren sieht. Er stellt die Kerze ab und kriecht neben sie. »Was machst du da?«
»Ich stricke.«
Er deutet auf die vielen Päckchen mit Verbandmull. Eines ist geöffnet, sie hat gerade den weißen Strang zu einem Ärmel verarbeitet, als der Alarm begann.
»Das ist verboten. Ich muss das melden.«
Sie lacht und fährt ihm mit der Hand durch die Haare. Vor zwei Jahren, als sie in dieses Haus gekommen war, wäre ihr bei diesen Worten himmelangst geworden. Das war die Zeit, in der er sie kaum angesehen hatte und die einzigen Worte, die er an sie richtete, Befehle waren. Ihm fehlt der Vater. Die Mutter hat keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Sie ist oft außer Haus. Manchmal bringt sie die Männer auch mit, dann versucht sie, den Jungen abzulenken.
Der Junge hatte sie dafür gehasst, weil sie wusste, was seine Mutter tat. Er hatte sie gehasst, bis er das Fieber bekommen hatte und ihm nichts mehr helfen konnte. Nur noch nasse Umschläge und eine kühle Hand auf der Stirn. Ihre Hand, nicht die der Mutter. Als die Krise kam, hatte sie sich zu ihm gelegt und ihn festgehalten.
Er war nicht gegangen. Seitdem ist er ihr Sohn. Jetzt ist sie vierzehn und er elf, und die tausend Tage sind wie ein dunkler Tag. Herr, wann geht er vorüber?
»Der letzte Winter war kalt.«
Sie schiebt seinen Pyjamaärmel hoch und probiert die Länge an. »Du sollst nicht frieren dieses Mal.«
»Sie kommen«, sagt er.
Beide blicken auf das verdunkelte Fenster. Sie legt das Strickzeug zur Seite und zieht ihn an sich. Augenblicklich schmiegt er sich an ihre Schulter. Er tut es nur, wenn die Flieger kommen. Wenn es dunkel und die Mutter nicht zu Hause ist. Er ist kein zärtliches Kind. Manchmal kneift er sie, oder er boxt sie leicht. Das ist seine Art zu zeigen, dass er sie mag.
»Der Mai ist schon fast vorbei«, sagt er.
Sie nickt. Sie weiß, was die Leute flüsterten. Sie hat gute Ohren. Keiner zeigt seine Angst, aber ernst sind sie geworden, die Deutschen. Die Invasion muss direkt bevorstehen.
Sie weiß nicht genau, was das ist, die Invasion. Es muss der Auslöser für die längst überfällige Vergeltung sein, mit der man den Feind bestrafen will. Der Luftterror wird mit jedem Tag schlimmer. Die Verdunkelungen machen die Menschen nervös und trübsinnig. Der Junge erzählt flüsternd von Luftüberlegenheit, als ob er wüsste, wie frevlerisch allein schon das Denken dieses Wortes ist. Mit der Invasion soll alles anders werden. So wie ein Gewitter erst unangenehm ist und dann die Luft reinigt. Wir werden sie hereinlassen, sagt der Junge, sie werden sich sicher fühlen, und dann werden wir sie vernichten.
Der Sirenenton mahnt durchdringend und unmissverständlich. Sie versteht nicht, warum nicht wenigstens der Junge in den Keller darf. Warum die Freifrau es einen Tag lang gestattet und den anderen Tag verbietet. Der Sirenenton ist anders heute. Sie weiß nicht, ob es nur das Blut ist, das in ihren Ohren rauscht, oder der Wind in den Bäumen im Garten oder ob die Flugzeuge tatsächlich wiederkommen.
Lass sie woanders hinfliegen, Herr. Wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm, und wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. Sende das Feuer in die Hölle, aus der es kam, aber nicht hierher, nicht hierher, Herr. Herr, wende dich uns doch endlich zu. Hab Mitleid mit allen Knechten!
»Hör doch auf mit dem Beten! Wenn nicht bald was passiert, wird es in diesem Jahr für uns wieder zu spät sein.«
Zu spät für den Frieden, von Sieg redet keiner mehr. Nur der Junge glaubt noch daran. Kinder und Verrückte.
»Wir müssen Luft bekommen, um im Osten wieder stärker einzugreifen.«
»Ja,ja.«
»Und endlich die Vergeltungswaffen einsetzen. Mit der Invasion wird alles anders. Erst lassen wir sie rein, und dann …« Er fährt mit dem Zeigefinger über seine Kehle. Ihre Hand schnellt vor und hält ihn fest.
»Nicht«, sagt sie.
Der Bäcker am Roseneck hat seine Uk-Stellung verloren und muss die Uniform noch einmal anziehen. Im Weltkrieg ist er verwundet worden, und dazu ist er noch Jahrgang 84. »Die nehmen mich doch nicht mehr«, hatte er gesagt.
Jetzt ist er auf der Krim. Seine Frau hat es ihr erzählt. Eine robuste, zuversichtliche Frau. Sie hat sich heimlich mit der Schürze die Augen ausgewischt. Sind denn alle taub und blind?
Die Russen stehen schon in Rumänien, im Generalgouvernement und vor Ungarn und der Slowakei. Man muss nur den Wehrmachtsbericht hören, dann kann man sich denken, wie das alles enden wird. Noch vor einer halben Stunde haben sie gemeldet, das Reichsgebiet sei feindfrei. Und jetzt das.
»Dieses Mal kommen sie von Potsdam«, flüstert er.
Die Luft beginnt zu vibrieren.
Hoffentlich hat Olga dort einen Graben. Olga ist so zart und dünn, und sie hat doch ihrer Mutter versprochen, auf sie aufzupassen, Olga ist doch ein halbes Jahr jünger, ein Kind fast noch, Olga, die jetzt einen ganzen Hof versorgt, das schafft sie doch gar nicht. Aber er soll nett sein, ihr Bauer. Und eine Kirche haben sie da auch. Nur evangelisch, aber sie darf zum Gottesdienst.
»Die kommen hierher!«
Herr, du warst unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht. Von Jahr zu Jahr säst du die Menschen aus, sie gleichen dem sprossenden Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten wie Gras …
»Hör auf! Hör auf!«
Er reißt ihre betenden Hände auseinander und zieht die Pappe vom Fenster weg. Sofort bläst sie die Kerze aus. Tanzende Lichter senken sich aus dem tiefschwarzen Himmel herab und beleuchten den Garten wie ein stilles Feuerwerk. Weihnachtsbäume.
»Ist das schön!«
Er schaut verträumt durch das schuhkartongroße Fenster nach oben, wo das Verderben in den leuchtendsten Farben direkt auf sie zukommt. Das Dröhnen wird immer lauter, bis sie auftauchen wie riesige schwarze Hornissen.
Er weicht zurück. Dann öffnet er den Mund und will etwas sagen. In diesem Moment zerreißt ihr die Detonation fast das Trommelfell. Die Wände zittern und neigen sich auf sie zu. Staub und Putzbrocken regnen auf sie nieder.
»Raus!«, brüllt sie und kann sich selbst kaum hören. In fliegender Hast klettert sie aus dem Bett, springt hinunter in die Küche und hilft ihm, ihr zu folgen. Sie spürt die Scherben unter ihren Füßen und rennt zum Fenster, das kein Glas mehr hat. Sie beugt sich hinaus und sieht auf die Straße. Durch den dichten Staub erkennt sie den Widerschein eines Feuers. Zwei Häuser weiter muss es sein, oben auf der Ecke.
Wieder beginnt der Boden zu vibrieren.
»Es werden immer mehr!«, schreit er.
Sie nimmt seine Hand und hastet den Flur entlang. Das Haus scheint unversehrt, nur die Scheiben sind alle zu Bruch gegangen.
Der nächste Flieger ist so tief, dass er fast das Dach streift. Vielleicht stürzt er ab, genau hier, und verwandelt alles in eine Flammenhölle.
Sie rennen in das riesige Treppenhaus und jagen die Stufen hinunter, bis sie vor der Kellertür stehen. Sie ist abgeschlossen. Es heult. Ein grauenhafter Ton, etwas so Fürchterliches hat sie noch nie gehört. Als ob im Himmel die Hölle los sei. Es wird lauter und lauter, sie hält den zitternden Jungen fest an sich gepresst und duckt sich, macht sich so klein wie möglich, noch kleiner, fast unsichtbar, dann kommen der unglaubliche Schlag und die Druckwelle.
Das Haus ächzt und jammert in allen Fugen, aber es hält. Es ist ein gutes Haus, kräftig und solide. Es kann einiges aushalten. Aber nicht genug, wenn der nächste Einschlag es trifft.
»Wir dürfen da nicht rein«, sagt der Junge und klappert mit den Zähnen. Er kauert auf dem Boden. Die Angst übermalt sein Kindergesicht mit Blässe. Die Augen hat er aufgerissen, sie kennt den Blick, er ist überall gleich, wenn das Grauen kommt.
Sie zieht ihn hoch und packt ihn an den Schultern.
»Du musst.«
Sie läuft durch das Erdgeschoss hin zu dem kleinen Raum neben der Eingangstür, in dem die Besen, Putzeimer und Gartengeräte stehen. Mit einer Axt kommt sie wieder. Sie schiebt den Jungen zur Seite und holt aus.
Um sie herum geht die Welt unter. Die Kampfverbände fliegen Richtung Norden, vermutlich werden sie dieses Mal Moabit und den Wedding heimsuchen. Was hier herunterkommt, sind nur die Vorboten. Nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was den Menschen dort noch bevorsteht. Hoch im Himmel beginnt wieder das Heulen. Sie schlägt zu, noch einmal und noch einmal, dann tritt sie gegen die Tür, die sich mit einem Mal nach innen öffnet. Das Heulen pfeift und singt in ihren Ohren, sie reißt den Jungen hinter sich, beide fallen die Treppe hinunter, und in diesem Moment schlägt es ein.
Sie wirft sich über ihn und wartet. Er liegt unter ihr, sie erstickt ihn fast, er keucht vor Angst und Atemnot, doch sie bleibt auf ihm liegen und wartet.
Nichts geschieht. Das Dröhnen lässt nach, sie fliegen weiter. Gott sei den armen Seelen gnädig.
Sie öffnet die Augen.
Langsam steht sie auf und klopft sich den Staub aus dem Nachthemd. Hustend richtet sich der Junge auf. Beide starren durch das Kellerfenster in den Garten. Oder in das, was von ihm übrig geblieben ist.
Die Bombe liegt in den Kartoffeln. Ein 50-Tonnen-Ungeheuer. Dunkel, rauchend, und in seinem runden Bauch lauert der Tod.
Wie lange sie so stehen, weiß sie nicht. Sie kann den Blick nicht von dem Monster abwenden, gleichzeitig hat sie Angst, es zu provozieren. Sie spürt mit einem Mal die Ungeheuerlichkeit dieser Gnade, dass sie die Bombe sehen können und nicht sterben.
Der Junge klettert auf den Waschtisch und sieht hinaus. »Das ist ja ein Ding! Der Zünder funktioniert nicht.«
Sie geht zum Ofen und holt mit zitternden Fingern die Streichhölzer herunter, die immer neben dem Holz liegen. Dann zündet sie eine Kerze an und sieht sich um.
Heute war der Keller verschlossen. Nur die Freifrau weiß, warum. Einmal, als sie nicht schlafen konnte, hat sie einen Wagen mit laufendem Motor gehört. Sie war zum Fenster geschlichen und hatte vorsichtig durch die Vorhänge gespäht. Es war niemand zu sehen gewesen. Doch dann war eine Gestalt aus dem Haus gekommen, und sie war hastig zurückgetreten.
»Die Tommys«, sagt der Junge und schüttelt den Kopf. Dann springt er herunter und stellt sich neben sie. »Was ist das?«, fragt er.
Mehrere Kisten und zwei große, mit Decken verhüllte Gegenstände stehen in der Ecke vor den Regalen mit der Marmelade und den eingekochten Früchten.
Er nimmt die Kerze und geht darauf zu.
»Lass das«, sagt sie. »Das darfst du nicht.«
Doch er hat schon eine der Decken zurückgeschlagen. »Oh.« Er klingt enttäuscht. »Nur ein Bild.«
Er bedeckt es wieder. Dann setzen sich beide auf den Boden und warten auf die erlösende Entwarnung. Als es endlich so weit ist, schleichen sie schweigend nach oben.
Vor seinem Zimmer legt sie noch einmal den Arm um seine Schulter. Mehr wagt sie jetzt nicht mehr.
Er senkt den Kopf und stößt mit der Stirn sanft an ihren Bauch. »Wären wir tot, wenn die Bombe explodiert wäre?«
Sie greift ihm unters Kinn, hebt sein Gesicht zu sich hoch und leuchtet ihn mit der Kerze an. »Nein«, sagt sie. »Die Kellermauern sind viel zu dick.«
Er nickt, als ob er ihr glauben würde.
1
Ich kam immer zu spät zu Beerdigungen.
Die Trauergäste verließen gerade die Kapelle des Dahlemer Waldfriedhofes. Sigrun erschien als eine der Letzten und warf einen suchenden Blick Richtung Ausgang. Ich trat ein paar Schritte vor, sie entdeckte mich und winkte mich unauffällig heran.
»Das war nicht nett von dir.« Ärgerlich zog sie mich in die Kapelle. Vorne am Sarg stand die Familie des Verstorbenen. Schwerer Lilienduft mischte sich mit dem Geruch brennender Kerzen.
»Ich kannte ihn doch kaum«, flüsterte ich.
»Ich auch nicht«, gab sie zurück. »Aber er war der letzte Freund meiner Großmutter.«
Sie schob mich zur Seite, denn einer der Sargträger hatte sich aus dem Halbschatten gelöst und nahm ein großes Kissen hoch. Gemessenen Schrittes trug er es an uns vorbei. Auf dem Samt glitzerte es in allen Farben.
»Seine Orden«, wisperte Sigrun. »Sie haben sogar die Ehrennadel fürs Blutspenden draufgesteckt.«
Sie, das waren die Lehnsfelds, die heute den Patriarchen der Familie zu Grabe trugen: Abel von Lehnsfeld, verschieden im einundneunzigsten Jahr seines Erdendaseins, hochdekorierter Wehrmachtsoffizier, herausragender Gründervater der Bundesrepublik Deutschland, Freund der Künste und honoriger Wohltäter. Draußen, uns den Rücken zugekehrt, murmelten sein direkter Nachfahre Abraham und dessen Sohn Aaron mit dem Pfarrer. Abrahams Weib Verena stand wie immer stumm daneben.
Sigrun schnupperte hinüber zu einer abseitsstehenden Gruppe. Zigarettenrauch wehte herüber. »Eine«, flüsterte sie. »Nur eine einzige.«
Sie hatte sich das Rauchen abgewöhnt, weil es nicht zu einer erneut kandidierenden Stellvertretenden Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Familie und Soziales passte. Es fiel ihr schwer. Ich reichte ihr ein Pfefferminzbonbon. Sie wickelte es aus und steckte es in den Mund. Dabei grinste sie mich fröhlicher an, als es auf einer Beerdigung schicklich gewesen wäre.
»Du bist zu spät.«
Utz, mein Fast-Schwiegervater, war unbemerkt zu uns getreten. Er hakte sich in Sigruns anderen Arm ein und zog sie in den Trauerzug. Wohl oder übel ließ ich sie los.
»Ich arbeite zu viel.«
Ich war immer noch in der Probezeit. Nicht nur in seiner Kanzlei, auch in seiner Familie. Utz tätschelte seiner Tochter die Hand. Es war eine liebevolle Geste, die verbarg, dass sie ihn vorsichtig und unbemerkt stützte. Er war über siebzig, und seine aufrechte Haltung und das immer noch volle, von grauen Strähnen durchzogene Haar machten ihn zu einer bemerkenswerten Erscheinung. Er hätte ein Patriarch sein können, wenn ihn nicht etwas daran gehindert hätte, sich zur vollen Größe zu entfalten.
Und dieses Etwas rollte nun auf uns zu: seine Mutter, Sigruns Großmutter.
Irene von Zernikow, geborene Freifrau von Hollwitz, brachte ihren Rollstuhl in Position. Und das bedeutete für sie: in die erste Reihe. Über ihr hochgetürmtes schlohweißes Haar hatte sie einen schwarzen Schleier geworfen. Sie saß kerzengerade, ihre magere Gestalt eingehüllt in ein schwarzes Wollkleid, dazu trug sie schwarze Handschuhe. Sie musste ungefähr im gleichen Alter wie der Verstorbene sein. Mit ihren über neunzig Jahren hätte sie zerbrechlich wirken können, wäre da nicht das eiskalte Desinteresse an den Menschen und dem Geschehen um sie herum, das ihr eine Aura der Unantastbarkeit verlieh, die manche mit Stärke verwechselten. Sie grüßte niemanden, auch nicht Utz, ihren eigenen Sohn. Nur Sigrun bekam die Winzigkeit eines Nickens ab. Mir fuhr sie fast mit dem Rollstuhl über die Schuhspitzen.
»Es ist erstaunlich, wie sie das trägt«, flüsterte Sigrun. »Abel war der Letzte von der alten Garde. Jetzt ist niemand mehr da, der die Erinnerung teilt.«
Hinter dem Rollstuhl der Freifrau stand, bemerkenswert unsichtbar, Walter. Walter war Mädchen für alles in diesem merkwürdigen Haus, in das ich durch Sigrun hineingeraten war. Sein Vater war bei der Reichsbahn gewesen, und deshalb pflegte er zu den seltenen Gelegenheiten, bei denen seine Meinung gefragt war, immer das Gleiche zu sagen: Der Zug fährt auf Gleisen, und die verlässt er nicht.
Im Übrigen wurde er nicht sehr häufig gefragt.
Die Freifrau hob den linken Zeigefinger. Das Zeichen genügte, und Walter schob den Rollstuhl sanft an. Der Trauerzug setzte sich in Bewegung. Utz und Sigrun hielten den Kopf gesenkt. Ich tat das Gleiche, bis ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung bemerkte.
Am Wegrand stand eine alte Frau. Sie musterte den Zug sorgfältig, als ob sie nach jemandem suchen würde. Sie wirkte arm und deplatziert, während die Generation der glücklichen Erben schweigend an ihr vorbeidefilierte. Ein Zaungast. Es war ein prominenter Friedhof, eine der ersten Adressen sozusagen, falls man auf so etwas Wert legte. Das lockte bei größeren Beerdigungen auch Neugierige an. Die Frau zog sich zurück, als wolle sie die Trauernden durch ihre Anwesenheit nicht stören.
Der Trauerzug hielt langsam auf ein bereits ausgehobenes Grab am Ende einer langen Reihe zu. Dutzende Kränze mit malerisch drapierten Schleifen waren schon hierhergebracht worden. Es sah ganz nach dem Gegenteil einer schnellen, unauffälligen Beerdigung aus. Auch der Pfarrer blätterte jetzt sehr konzentriert in seiner Bibel, obwohl doch alles Wichtige bereits in der Kirche gesagt worden war. Dachte ich. Dann sah ich die Blaskapelle und ließ alle Hoffnung fahren.
Die Freifrau bemerkte die Musikanten und entfernte als einzige Reaktion ihr Hörgerät. Sie reichte es Walter, der es ohne mit der Wimper zu zucken einsteckte. Während die Sargträger Abel langsam in das ausgehobene Grab hinunterließen, legte sie den Kopf zurück und schlief ein.
Utz senkte den Blick und faltete die Hände. Der Pfarrer trat an das Grab und räusperte sich. Der letzte Akt am Ende eines langen Lebens hatte begonnen.
2
»Und, wie war’s?«
Jeder, der in die Kanzlei wollte, musste an Connie vorbei. Sie hatte das Büro im ersten Stock gleich links neben der Tür. Heute trug sie eine pinkfarbene Escada-Jacke, die sie für acht Euro bei ebay ersteigert hatte.
»Wie Beerdigungen so sind«, antwortete ich. Ich mochte Connie.
Sie wusste das und vertiefte instinktiv ihr Lächeln. Es war ihr ganz persönlicher Reflex. Junggeselle, heiratsfähig, obere Gehaltsklasse.
»Ich war noch nie auf einer«, sagte sie. »Ich meine, es ist noch nie jemand gestorben, den ich kannte.«
»Doch. Abel von Lehnsfeld.«
»Den kannte ich nicht. Nicht richtig, meine ich. Außerdem war er alt.«
Selektives Wahrnehmungsvermögen. Ich beugte mich über ihren Schreibtisch und tippte auf ihren Terminkalender. »Denk an die Testamentseröffnung. Morgen, fünfzehn Uhr.«
»Kommt Aaron auch?«
Junggeselle, heiratsfähig, oberste Gehaltsklasse, vor allem nach dem Ableben des Großvaters. »Ich habe extra seine Lieblingskekse besorgt. Schokocremewaffeln. Magst du probieren?«
Sie zog die Schublade auf, in der sie ein halbes Dutzend Packungen gehortet hatte. Vermutlich alle in der Hoffnung, Aaron eines Tages damit zu füttern.
»Nein danke«, sagte ich. »Post? Anrufe?«
Sie stand auf und drückte sich mit wiegenden Hüften etwas zu nahe an mir vorbei. »Post, ja, Anrufe, nur einer. Von deiner Mutter. Sie will wissen, was mit Reinickendorf ist.«
Ich hatte keine Zeit, um mich jetzt mit meiner Mutter und ihrem Problem, nach Reinickendorf zu kommen, auseinanderzusetzen. Früher, als meine Kanzlei noch in einer Kreuzberger Einzimmerwohnung war und ich sehr, sehr wenig zu tun hatte, war das kein Problem gewesen. Jetzt hatte ich sehr, sehr viel Arbeit. Ich arbeitete dermaßen viel, dass ein Nachmittag beim Bridge unter Jahresurlaub lief und mehr als eine Beerdigung pro Quartal nicht drin war. Aber das verstand meine Mutter nicht.
Auf dem Weg zu meinem Büro nickte ich Hogersand, Versicherungen und Offshore-Trusts, und Meinerz, Verbindungsmann zu Londoner Steuerberatungskanzleien, zu. Sie waren zwanzig Jahre älter als ich, strebsam, klug, in ihren Äußerungen zurückhaltend und genau die Mischung aus Vaterfigur und Gentleman-Verbrecher, die ich mir für ein Vermögen ab zehn Millionen aufwärts wünschen würde.
Harry Baumgarten kam mir entgegen. Er hatte die Stirn in Falten gelegt und sah erst auf, als er kurz davor war, mit mir zusammenzustoßen.
»Wie war’s?«, fragte er hastig. Bei Harry musste alles schnell gehen. Die Gespräche, die Prozesse, die Karriere.
»Wie Beerdigungen so sind«, erwiderte ich.
Harry nickte schnell. »Die Testamentseröffnung. Du bist morgen dabei.« Er kniff die Lippen zusammen. Ich war ein Pflock, den das Schicksal vor seinen Füßen in die Erde gerammt hatte. Ohne mich säße er morgen dabei. Ohne mich wäre er vielleicht in ein paar Jahren Partner von Utz, statt in eine freudlose Zukunft als unentbehrliche rechte Hand zu starren. Ich vermutete, dass Harry nicht mehr lange bei uns bleiben würde.
»Tja, dann komm mal mit in mein Büro. Warum soll ich die ganze Arbeit alleine erledigen?«
Er lief voraus und riss die Tür zu seinem Arbeitszimmer auf. Ich folgte ihm. Es war ähnlich geschnitten wie die anderen Räume im ersten Stock: quadratisch, holzgetäfelt, mit einem wunderschönen Ölbild an der Wand hinter dem Schreibtisch, die hervorragende Kopie eines impressionistischen Seerosenteiches.
Harry legte einige Handakten auf einen Stapel und reichte sie mir. »Lass Georg Kopien machen, und schließ sie ein. Sind ein paar heikle Sachen dabei.«
»Heikel?«, fragte ich.
Er legte mir ungerührt eine weitere Akte dazu. »Lehnsfeld ist immer heikel.«
Das Telefon klingelte. Harry hob ab und reichte mir mit einem säuerlichen Lächeln den Hörer. Es war Connie.
»Kannst du mal kommen?«, fragte sie. »Es steht schon wieder jemand im Garten.«
Immer wieder verirrten sich Touristen und Neugierige in den Garten. Die Zernikow’sche Villa war eine der wenigen, die die Modernisierungswut der siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts unbeschadet überlebt hatten.
1896 als eines der ersten großen Anwesen in der neu geschaffenen Kolonie Grunewald errichtet, ruhte es in einem zweitausend Quadratmeter großen Park, der wohl eher aus Desinteresse denn Fürsorge nie verändert worden war und deshalb langsam ein Fall für die Denkmalpflege wurde. Spaziergänger und Führungen durch die ehemalige Villenkolonie machten hier mit Vorliebe Halt. So hatte ich eines stillen Nachmittags am offenen Fenster durch die penetrante Stimme eines vor Sozialneid fast vergehenden Stadtbilderklärers erfahren, dass dieses Haus, ebenso wie das ganze Viertel, durch eine der größten Grundstücksspekulationen der wilhelminischen Epoche entstanden war.
Jetzt war die Villa alt, fraß Unsummen und keuchte das Geld durch die Ritzen und Schornsteine, die berstenden Rohre und das immer wieder undichte Dach geradezu asthmatisch aus. Nie im Leben wäre ich freiwillig hierhergezogen. Man saß, in familiärem wie auch in städtebaulichem Sinn, immer auf dem Präsentierteller. Schließlich wurde hier nicht nur gearbeitet. Wir wohnten auch hier.
Es kam nicht oft vor, dass wir ungebetene Gäste hatten. Aber sie wurden immer frecher. Weder durch verschlossene Tore, hohe Hecken noch schmiedeeiserne Jugendstilzäune ließen sie sich zurückhalten.
Doch die Frau, die sich durch den Garten schlich, wollte nicht in unseren Garten. Sie kümmerte sich nicht um den Park, sondern stand unter einem der Bürofenster und versuchte vergeblich, einen Blick hineinzuwerfen. Ich ging auf sie zu und rief sie an. Erschrocken drehte sie sich um. Sie war klein, steinalt und wirkte sehr, sehr arm.
»Pascholsta«, sagte sie und drückte eine dunkle Plastikhandtasche an die Brust. »Ich suche Utz.«
Ich blieb erstaunt stehen. »Herrn von Zernikow?«
Sie nickte. »Ist er da?«
Deutsch kam ihr schwer über die Zunge. Eine Russin, vermutete ich.
»Was wollen Sie von ihm?«
Sie kramte in ihrer Tasche und zog einen Zettel hervor, den sie mir überreichte. Es war ein mehrfach gefaltetes Papier, ein Durchschlag, wie er bei uns im Computerzeitalter schon lange nicht mehr erstellt wurde. Die Buchstaben waren kyrillisch.
»Was ist das?«
»Bescheinigung«, sagte die Frau. »Soll er unterschreiben.«
»Das wird er vermutlich nicht tun. Um was geht es denn?«
Ich faltete den Zettel zusammen und reichte ihn ihr. Doch sie weigerte sich, ihn anzunehmen.
»Um Natalja«, flüsterte sie. Sie war nervös. »Natalja Tscherednitschenkowa. Es ist wichtig.«
»Warum?«
Sie lächelte und zeigte dabei vier einsame Vorderzähne. »Eine Sache zwischen Utz und Natalja.«
Ich kannte wenige Leute, die Utz beim Vornamen nannten. Eine alte Russin wäre die Letzte, von der ich diese Anrede erwartet hätte.
»Geben Sie ihm«, bat sie mich. »Es ist wichtig.«
»Brauchen Sie Hilfe, Herr Vernau?« Walter stand an der Ecke. Er trug noch den schwarzen Hut von der Beerdigung, also musste auch die Freifrau gerade eingetroffen sein.
»Nein«, rief ich zurück. »Die Dame wollte gerade gehen.«
Ich bot ihr meinen Arm an und geleitete sie zur Gartenpforte. Dort blieb sie stehen. »Darf ich … das Haus sehen?«
Ich sah zur Eingangstür. Walter stand dort wie ein Zerberus, die Arme vor der Brust verschränkt, und beobachtete missbilligend den ungebetenen Besuch.
»Nur einen Blick«, sagte sie. »Ich will es Natalja erzählen.«
Ich ließ die rätselhafte Fremde los und nickte Walter zu. Unwillig trat er einen Schritt zur Seite. Sie ging in die Eingangshalle und sah sich konzentriert um. Als ob sie jede Einzelheit fotografisch in ihrem Gedächtnis speichern wollte. Die schweren Kristalllampen, die breite Treppe, die alten Teppiche. Die großformatigen Landschaftsbilder an der Seidentapete, die jugendstilverglasten Fenster. Dann fiel ihr Blick auf Walters Kabuff neben dem Eingang und den Überwachungsmonitor. Sie tastete sich rückwärts zur Tür.
»Danke«, sagte sie. »Es ist tatsächlich so schön, wie Natalja immer erzählt hat.«
»Natalja?«
Aaron von Lehnsfeld stand hinter uns. Ich war verblüfft, wie leise er sich uns genähert hatte.
Die Frau drehte sich rasch zu ihm um. Ihre Schultern strafften sich, ihr Blick wurde streng. »Natalja Tscherednitschenkowa. Kennt man den Namen nicht mehr? In diesem Haus?«
Es kam zum ersten und meines Erachtens auch einzigen Moment der minimalen Verbrüderung zwischen Walter, Aaron und mir. Wir sahen uns ratlos an.
»Sollten wir den Namen denn kennen?«, fragte ich.
Walter trat auf sie zu. »Ich denke, Sie sollten gehen. Die Besichtigung ist beendet. Falls Sie nichts dagegen haben, Herr Vernau.«
Er funkelte mich böse an, griff nach dem Arm der Frau und führte sie hinaus. Aaron war bereits die Treppen hochgesprungen und lief in den zweiten Stock. Also hatte er einen Termin bei der Freifrau und würde ihr vermutlich brühwarm von diesem merkwürdigen Besuch erzählen.
»Was wollte die denn?« Walter zog den Staubmantel aus.
Ich musterte unentschlossen den Zettel in meiner Hand, dann steckte ich ihn ein. »Keine Ahnung.«
Von oben war ein Quietschen zu hören. Ein Schatten glitt hinter eine Tür, die sich leise schloss.
»Ich sehe gleich nach ihr«, sagte Walter und verschwand in seinem Reich.
Ich tastete nach dem Zettel. Die Russin war die Frau, die ich auf dem Friedhof gesehen hatte.
Am Abend erzählte ich Sigrun von ihr. Wir standen nebeneinander vor dem Spiegel im Badezimmer und mussten uns beeilen, denn wir hatten Karten für die Oper und wollten Utz gegen sieben Uhr abholen.
»Vielleicht spioniert sie für die Russenmafia, ob sich ein Einbruch lohnt. Und du hast sie hereingelassen?«
»Nur ins Entree.«
Sie drehte sich zu mir um. »Das reicht ja schon. Jeder, der den Kasten von vorne betritt, denkt doch gleich, wir sind die Rockefellers.«
Ich grinste. »Stimmt das etwa nicht?«
Sigrun bekam ihre winzig kleine Falte zwischen den Augenbrauen. »Das weißt du genau. Es ist mir ein Rätsel, warum wir noch nicht pleite sind. Aber offensichtlich hat Omi immer noch einen Trumpf in ihrer Aussteuertruhe. Ich sage dem Personenschutz Bescheid. Sie sollen die Augen offen halten.«
Als Senatorin und Stellvertretende Bürgermeisterin stand Sigrun ein vom Land Berlin bezahlter Wagen mit Fahrer sowie eine Rundumbewachung zu.
Sie putzte sich mit Leidenschaft die Zähne und sagte dabei: »Morgen kommen die Leute von der Berliner Tageszeitung. Bist du dabei?«
»Wann?«
»Zwischen drei und vier.«
»Geht nicht.« Ich suchte meine Manschettenknöpfe. »Die Testamentseröffnung für die Lehnsfelds.«
Sigrun spuckte ins Waschbecken. »Es wäre mir aber wichtig.«
»Und deinem Vater ist es wichtig, dass ich dabei bin. Es ist ein umfangreicher Nachlass, und es gibt schon jetzt Probleme damit.«
»Und das ist ein verdammt wichtiger Wahlkampf, und ich will das Innere.«
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und begutachtete ihr strahlend weißes Gebiss.
»Inneres«, stöhnte ich und hielt ihr die manschettenknopflosen Ärmelenden entgegen. »Ich habe dir schon hundert Mal gesagt, das Ressort bekommt keine Frau. Familie, Kultur, Justiz – kein Problem. Aber an das Innere lassen sie dich nicht ran.«
Sigrun fädelte mir die Manschettenknöpfe ein. »Schon möglich. Wenn ich noch nicht mal von meinem eigenen Lebensgefährten unterstützt werde …«
»Was soll ich denn auf diesen Fotos?«
»Sie würden zeigen, dass ich in der Lage bin, eine politische Karriere und ein glückliches Privatleben unter einen Hut zu bekommen.«
»Reicht es nicht, wenn wir das wissen?«, fragte ich sie leise.
»In diesem Fall nein.«
Ich versuchte es mit der Krawatte. »Fünf Minuten. Zwischendurch. Und nur, wenn es sich einrichten lässt.«
Sie schenkte mir ein strahlendes Lächeln. »Mehr will ich doch gar nicht.«
Ich hätte sie gerne geküsst, aber wir hatten nicht die Zeit. »Porsche, Jaguar, Mercedes?«
Sie lächelte. »Mercedes. Heute Abend sind wir brav.«
3
Immer noch tiefschwarz wie eine Pinguinfamilie und mit einem sehr ernsten Ausdruck im Gesicht traten erst Abraham, dann seine Frau Verena und zum Schluss Aaron in den Konferenzraum. Connie hatte Kaffee gekocht und die Schokoladenwaffeln angerichtet. Harry ordnete die Akten. Vielleicht hoffte er, doch noch bei dieser Sitzung dabei sein zu können. Selbst Meinerz streckte seinen hageren Kopf herein, um dem hohen Besuch seine Aufwartung zu machen. Es nutzte ihnen nichts. Wenig später erschien Utz und schickte beide mit einer Kopfbewegung hinaus.
»Bitte, nehmt Platz«, sagte er.
Die Lehnsfelds setzten sich. Ich wartete, bis Utz sich am Kopfende des Tisches platziert hatte, und nahm mir dann den Stuhl zu seiner Linken.
»Sind alle so weit?«
Die Pinguine nickten. Dann verlas Utz eine hochkomplizierte Nachlassregelung, nach der Abraham mit der Villa in Dahlem und sämtlichem Mobiliar bedacht wurde, zudem mit den Früchten einer konservativen Anlagestrategie und dem Ferienhaus in den Schweizer Bergen.
Verena ging leer aus. Abraham legte ihr die Hand auf den Arm, sie senkte den Blick und blieb eine Weile so sitzen. Schließlich unterschrieb Abraham und sah Utz zufrieden an. »Ich danke dir.«
Er stand auf, Verena stand auf, Aaron blieb sitzen.
»Habe ich etwas vergessen?«, fragte Abraham sichtlich irritiert.
Utz räusperte sich. »Dein Sohn. Er hat auch etwas geerbt.«
Abraham und Verena setzten sich wieder.
Utz’ Blick heftete sich auf Aaron. »Dein Großvater hat dir ein Haus in Grünau vermacht. Ein schönes, aber baufälliges Anwesen.«
Aaron nickte. Er wusste also schon davon. Vermutlich hatte Utz doch ein wenig geplaudert am Rande der Trauerfeier. Der Junge machte jedenfalls ein wichtigtuerisches Gesicht und freute sich sichtlich, mehr zu wissen als sein Vater.
»Noch ein Haus?«, fragte Abraham. Er warf einen missbilligenden Blick zu Verena, als ob sie für diese Überraschung verantwortlich wäre. Verena hob die Schultern und enthielt sich, wie immer, jeden Kommentars.
Utz holte einige Unterlagen aus seiner Ledermappe, die er umständlich vor sich sortierte. »Es ist ein kriegsbedingt verlorenes Anwesen, das erst jetzt wieder – eventuell – restituiert werden könnte. Sagen wir es so, Aaron: Dein Großvater hat dir kein Haus, sondern lediglich den Anspruch darauf vermacht.«
Abraham griff nach dem Bauplan. »Ein vager Anspruch auf ein baufälliges Haus. Wie baufällig?«
»Ziemlich.« Utz breitete die Unterlagen vor Aaron aus. Grundbuchauszüge, diverse amtliche Schreiben. »Aber das scheint mir noch das geringste Problem zu sein. Der Erblasser hat mich zu Lebzeiten mit der Vertretung seiner Interessen beauftragt. Es ist ein komplizierter Fall, aber das Haus lag ihm sehr am Herzen.«
Aaron warf nicht mehr als einen flüchtigen Blick auf die Unterlagen. »Wie viel ist es wert?«
Utz hob die Hände. »Schwer zu sagen. Wenn wir Pech haben – gar nichts.«
»Nichts?«
»Anders gesagt – es ist nicht klar, ob es euch, ob es dir überhaupt gehört.«
Abraham sah stirnrunzelnd von den Grundbuchauszügen auf. »Hier ist mein Vater als rechtmäßiger Besitzer eingetragen.«
Utz nickte. »Das ist richtig. Aber sieh dir bitte das Datum an.«
»1933«, murmelte Abraham. Dann raffte er die Unterlagen zusammen und schob sie zurück zu Utz. »Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich will diesen Ärger nicht.«
Aarons Hand krachte auf die Papiere. »Moment! Das ist mein Haus. Ich will es haben.«
»Du schlägst es aus.«
»Ich nehme es«, sagte Aaron leise.
Spannungsgeladenes Schweigen breitete sich aus. Verena räusperte sich kurz, dann lehnte sich Abraham zurück. »Du weißt wie immer nicht, was du sagst. Eine baufällige Villa und ein Anspruch der Jewish Claims Conference. Dafür hast du nicht das Geld und nicht die Ausdauer. Du überblickst das doch gar nicht.«
»Aber du, ja? Du hast das Haus ja noch gar nicht gesehen.«
»Du etwa?«
Aaron warf Utz einen schnellen Blick zu. Utz tat so, als ob er nichts gehört hätte.
»Ja«, sagte Aaron. »Opa hat mir einen persönlichen Brief hinterlassen. Er will, dass ich mich um das Haus kümmere.«
Abraham beugte sich vor. »Er wollte, dass du … Du sollst dich um etwas kümmern?«
Ich konnte Abrahams Verblüffung verstehen. Aaron sah mit seinen fast dreißig Jahren blendend aus. Aber er hatte ein lächerliches Abitur an einem Internat abgelegt, das auf Fälle wie ihn spezialisiert war. Im Moment versuchte er sich in seinem dritten Grundstudium, das wohl auch nur den einen Sinn hatte, ihn von der Straße fernzuhalten, wie es meine Mutter ausgedrückt hätte. Niemand mit Verstand würde dem Jungen zutrauen, dass er sich um mehr als den Ölstand seines Lexus kümmerte. Ein Haus war geradezu absurd.
Das wusste auch sein Vater. Also wandte er sich an Utz. »Wie sind die Chancen bei diesen Ansprüchen?«
Utz räusperte sich und griff nach seinem Füllfederhalter. »Nicht schlecht, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Nur …« Sein Blick fiel auf Aaron. »Das Gebäude soll wohl wieder einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Es muss renoviert und dann an eine gemeinnützige Einrichtung verpachtet werden.«
»Gemeinnützig?«, piepste Verena. Sie sah sich offenbar mit einer völlig neuen Variante gesellschaftlichen Daseins konfrontiert. »Gemeinnützig?«
»Das ist doch alles Unsinn.« Abraham stand auf und marschierte ärgerlich zum Kopfende des Raumes. »Aaron, du übernimmst dich. Lass es sein. Es ist wie immer ein Kuckucksei, das er uns ins Nest gelegt hat. Eine 1933 gekaufte Villa. Von wem eigentlich gekauft?«
Utz studierte die Unterlagen. »Von einem Felix Glicksberg, Zuckerfabrikant.«
»Glicksberg«, wiederholte Abraham. »Mein Gott, Aaron, verstehst du nicht?«
»Doch«, erwiderte der Sohn. »Ich verstehe. Du willst die Ausschreibung für die Jüdische Bibliothek in Madrid gewinnen. Es würde deine Chancen um einiges mindern, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass der Vater eines international renommierten Stararchitekten sich im Zuge der Machtergreifung der Nationalsozialisten bereichert hat.«
»Ja«, sagte Abraham. »Das wäre sehr unglücklich. Aber das ist es nicht allein. Ob du es glaubst oder nicht, ich will tatsächlich nichts damit zu tun haben.«
»Hast du auch nicht. Das ist mein Erbe. Und ich will es behalten.«
Ich wunderte mich, dass Aaron den Rat seines Vaters so vehement ausschlug. Ein kurzer Blick auf die Unterlagen zeigte, dass außer der Arbeit auch die Kosten enorm sein würden. Aaron wusste wirklich nicht, was auf ihn zukam. Vermutlich war er noch dümmer, als bisher zu befürchten war. Ich stand auf und öffnete das Erkerfenster, damit etwas frische Luft in den Raum hereinströmte. Sigruns Wagen stand in der Einfahrt. Das war ungewöhnlich. Doch dann fiel mir ein, dass sie heute den Termin mit der Zeitung hatte. Hinter mir breitete sich Stille aus.
Aaron saß ungerührt am Tisch. Ganz lässig, ganz Herr der Lage, die ihm mit Sicherheit in kürzester Zeit über den Kopf wachsen würde.
Verena sah verstohlen auf ihre Armbanduhr. Solche Sitzungen waren nicht ihre Sache. Sie gehörte auf Polo- und Golfplätze und ertrug diese eigenartige Testamentseröffnung nur, weil sie ihren Mann so selten zu Gesicht bekam.
Utz war beinahe unsichtbar. Er sagte nichts, er rührte sich nicht, er wartete darauf, dass eine Entscheidung gefällt wurde. Erst dann würde er wieder in Erscheinung treten. Das einzige Geräusch kam von einer dicken Fliege, die traumselig an mir vorbeiflog und Kreise unter dem Kronleuchter drehte.
Abraham räusperte sich. »Also. Wie viel könnte der Kasten wert sein?«
»Schwer zu sagen«, meinte Utz. »In diesem Zustand zählt wahrscheinlich mehr der Grundstückswert. Der könnte enorm sein, wenn er nicht an diese Auflagen gebunden wäre. Ich würde sagen, im Moment ist das Grundstück nicht verkäuflich.«
Abraham griff nach Verenas Hand. »Ich zahle dir aus meinem Erbe eine Million, wenn du das Haus ausschlägst.«
Ich blickte zu Aaron, gespannt auf seine Reaktion.
»Nein.«
»Eins Komma fünf Millionen.«
Verena hielt den Atem an. Abraham hielt sie immer noch fest.
»Nein«, antwortete Aaron.
Abraham ließ Verena los. »Ich gebe es auf. Was willst du?«
»Das Haus. Es ist, wie soll ich sagen, meine familiäre Verpflichtung, es anzunehmen.« Sein Gesicht verzog sich zu einem schiefen Lächeln.
In diesem Moment war ich froh über meinen Entschluss, niemals Kinder in diese Welt zu setzen. Aaron spielte mit seinem Vater, aber niemand im Raum außer ihm wusste etwas von den Spielregeln. Wollte er sich für etwas rächen? Wollte er seinen Vater erpressen? Es war offensichtlich, dass sich nicht einmal Abraham und Verena das Verhalten ihres Sohnes erklären konnten. Und sie hatten ihn schließlich gemacht.
Abraham stand auf. »So sei es. Es geschieht gegen meinen ausdrücklichen Wunsch.«
Er ging langsam um den langen Tisch herum und blieb einen Moment dicht hinter seinem Sohn stehen. Dann beugte er sich zu ihm. »Es wird dir kein Glück bringen.«
Verena nickte uns mit einem unsicheren Lächeln zu und erhob sich ebenfalls. Beide gingen hinaus. Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, schob Utz Aaron die Unterlagen zu. »Bitte sehr.«
Aber Aaron reichte sie ihm zurück. »Ziehen Sie diesen Fall für mich durch. Ich will das Haus. Koste es, was es wolle.«
Utz deutete auf mich. »Herr Vernau wird das übernehmen. Es wird ein langer, schwieriger Prozess mit ungewissem Ausgang. Das können Jüngere besser.«
Aaron grinste mich an. »Gut. Wann kann ich eigentlich anfangen zu renovieren?«
»Ich muss mich erst einarbeiten. Geben Sie mir ein paar Tage. Vorläufig würde ich jedoch nichts unternehmen, was den Liegenschaftsfonds überraschen würde.«
»In Ordnung.«
Utz schraubte den Federhalter auf. »Sie nehmen das Erbe also an?«
»Ja.«
»Dann bitte ich Sie, hier zu unterschreiben.«
Ich hob die Hand. »Einen Moment noch. Sie wissen, was gemeinnützig bedeutet?«
»Klären Sie mich auf.«
»Behindertenverbände, Sportvereine, Tierheime, Frauenhäuser zum Beispiel.«
»Frauenhäuser«, grinste Aaron. »In meinen Kreisen nennt man das anders.«
Er unterschrieb, dann griff er zu seiner Jacke, die er über einem Stuhl abgelegt hatte. »Sie machen das schon. Ich melde mich.«
Damit ging auch er.
Utz ordnete die Unterlagen und steckte sie in seine Ledermappe. Dann stand er langsam auf.
»Was war das?«, fragte ich. »Aaron von Lehnsfeld, Bewahrer des Erbes und Schützer der Witwen und Waisen?«
»Das war der Weggang eines Kindes von den Eltern«, sagte er leise. Wie ein Zuschauer in einem leeren Theater, der noch einmal auf die Bühne blickt, musterte er den Tisch und die verschobenen Stühle.
»Es sind immer die Kinder, die gehen«, sagte er.
4
Sigrun saß mit dem Reporter am Tisch im Garten, der Fotograf langweilte sich und trank schwitzend ein Glas Weißweinschorle. Ich schaute auf die Uhr, kurz nach drei. Gerade noch rechtzeitig.
»Wie schön, dass du kommen konntest!« Scarlett O’Hara stand auf und umrundete den Tisch mit ausgebreiteten Armen. Sie flog Rhett Butler an die Brust, schmiegte ihr Köpfchen an seine Schulter und flüsterte: »Noch eine Minute länger und ich jage dem Dicken den Korkenzieher in die Brust.«
Der Dicke griff nach seiner Kamera und schoss nicht gerade motiviert ein paar Bilder von uns. Dann wischte er sich stöhnend den Schweiß von der Stirn.
Wir gingen gemeinsam zum Gartentisch, und ich begrüßte den Reporter. Er stand auf und reichte mir höflich die Hand. »Brettschneider, von der Berliner Tageszeitung. Und das ist mein Fotograf Alexander Dressler.«
Der Fotograf schaute missmutig in sein leeres Weinglas.
»Möchtest du auch einen?«, fragte Sigrun.
»Lieber Wasser, danke.«
»Wo kann man denn hier mal ...?«, fragte Dressler.
Ich sprang auf und zeigte ihm den Weg. Dann wartete ich im Haus, bis er fertig war. In der Küche schenkte ich mir ein Glas Wasser ein. Durch das Fenster konnte ich sehen, wie Sigrun und Brettschneider sich verabschiedeten. Sie begleitete ihn nach vorne und verschwand aus meinem Blickfeld.
»Schöne Wohnung.« Dressler lehnte im Türrahmen. Den rechten Arm hatte er zum Abstützen erhoben, unter seiner Achsel blühte ein ausgedehnter Schweißfleck. Ich nickte ihm zu und stellte das Glas in die Spülmaschine.
»Zahlt man da eigentlich Miete?« Er stellte sich neben mich ans Fenster. Dann begutachtete er die Espressomaschine, die maßgefertigte Edelstahlküche und den riesigen Kühlschrank. »Oder gibt’s das alles umsonst?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, erwiderte ich und ging zur Tür.
Aber Dressler machte keine Anstalten, mir zu folgen. Stattdessen holte er eine Packung Zigaretten aus seiner Hosentasche und zündete sich eine an. Dabei beobachtete er mich aus zusammengekniffenen Augen. »So ein Glück hätte ich auch gerne mal. Die einzige Tochter aus steinreichem Haus, die alteingesessene Kanzlei des Herrn Papa, eines der letzten Anwesen im Grunewald im Originalzustand. Es passt alles wie aus dem Bilderbuch.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Möchten Sie mir sagen, was Sie bedrückt, bevor ich Ihnen den Weg nach draußen zeige?«
Dressler zog an seiner Zigarette. Die Asche fiel auf den gefliesten Boden. »Das würde ich gerne, aber ich weiß es nicht. Es ist alles ein bisschen zu schön. Zu sauber. Eine wunderbare Show, aber ich glaube sie nicht. Ich rieche es, ob es jemand ehrlich meint. Bei ihr rieche ich nur ein teures Parfüm.«
»Kann es sein, dass Sie neidisch sind?«
Dressler warf die Kippe in den Ausguss und ließ Wasser darüberlaufen. Die Glut erlosch mit einem leisen Zischen. »Neid? Neid kenne ich nicht. Aber ich kann ziemlich sauer werden. Wenn man mich verarschen will. Guten Tag.«
Er drückte sich an mir vorbei und hinterließ neben dem Zigarettengestank einen üblen Schweißgeruch.
Ich folgte ihm nach draußen und sah, wie er sich knapp von Sigrun verabschiedete. Brettschneider beobachtete ihn dabei argwöhnisch. Sigrun winkte ihnen zu, als sie davonfuhren.
»Wie ist es gelaufen?«, fragte ich.
»Gut.«
Sie wollte an mir vorbei ins Haus, ihre Tasche holen. Ihr Wagen wartete schon. Ich hielt sie zurück.
»Was ist mit dem Fotografen?«
Sie blieb stehen. »Was soll mit ihm sein?«
»Hast du irgendetwas gesagt oder getan, das ihn verärgert haben könnte?«
»Dressler? Der ist immer so. Warum?«
»Nichts«, antwortete ich. »Erkläre mir bitte, warum es unbedingt die Berliner Tageszeitung sein musste.«
Sigrun richtete zärtlich meinen Krawattenknoten und fuhr mir sanft über die Haare. »Weil ich jetzt vom Büro aus mit zwei Redakteuren der dir genehmen intellektuelleren Blätter ein Hintergrundgespräch führe. Unter drei.«
Unter drei bedeutete nach den Statuten der Berliner Pressekonferenz absolute Verschwiegenheit, definitiv nicht zur Veröffentlichung bestimmt.
»Und was wirst du ihnen beichten?«
»Meine ganz geheimen Sehnsüchte.«
»Das Innere.«
»Genau. Das macht dann die Runde. Und Brettschneider wird verrückt, wenn er davon erfährt, weil er es nicht von mir hat. Natürlich wird er seine Geschichte nicht bringen, ohne gewisse Spekulationen über meine Zukunft zu verbreiten. Also wird er das, was ihm die anderen hinter vorgehaltener Hand flüstern, in seinem Artikel bringen. Und zwar unter der Rubrik: Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautete …«
Ich nahm sie in den Arm und zog sie an mich. »Wie nennt man das?«
Sie küsste mich flüchtig auf die Wange. »Lancieren. Aber Vorsicht. Das kann nicht jeder. Nur bedingt zur Nachahmung empfohlen. Du musst dich ganz auf dein Netzwerk verlassen können.«
Sie befreite sich aus meiner Umarmung. »Ich muss los.«
Ich ging in den Garten, um den Tisch abzuräumen. Das Mädchen kam nur vormittags. Drei leere Flaschen. Côte Chalonnaise. Und das als Schorle.
5
Sigrun war Frühaufsteherin. Aus einem mir nicht geläufigen Grund erwartete sie Ähnliches von mir. So standen wir um kurz nach sechs nebeneinander im Badezimmer und putzten uns die Zähne. Wir putzten uns länger gemeinsam die Zähne, als wir miteinander schliefen.
»Der Artikel erscheint schon Sonnabend«, gurgelte sie.
Sie band ihre schulterlangen Haare nach oben und ließ dann den Bademantel fallen. Was ich sah, machte mir bewusst, dass wir uns die letzten zwei Wochen kaum gesehen hatten.
»Bist du heute Abend zu Hause?«
Sigrun schlüpfte in die Dusche. »Fraktionssitzung.«
Fraktionssitzungen endeten normalerweise um zehn, wenn man nicht den Rest des Abends seine Hausmacht stärken, die Netzwerke knüpfen und gegnerische Lager knacken musste. Sigrun stand im Moment auf dem Prüfstand. Sie war die Quotenfrau, die plötzlich ernst genommen werden wollte. Sie war kein Darling mehr, sie musste kämpfen. Jede Fraktionssitzung ein Shakespeare’sches Drama, jeder Ortsverband ein römischer Senat. Das Lächeln guter Freunde ein geschliffener Dolch im Gewand. Es hatte sie verändert. Es hatte uns verändert.
Das Wasser prasselte an das Glas.
Sigrun stieg aus der Dusche und trocknete sich ab. Sie war wunderschön. Ihre schlanke, kräftige Gestalt ließ sie größer wirken, als sie eigentlich war. Sie hatte zarte Schultern und einen atemberaubenden Schwanenhals. Ich hatte Sehnsucht nach ihr und nach dieser Halsgrube, in die ich mich schmiegen wollte, um ihren Maiglöckchenduft einzuatmen. Sigrun lächelte. »Nicht jetzt. Es ist kurz vor halb.«
Sie hob ihren Bademantel hoch und wollte an mir vorbei. Ich griff nach ihr, zog sie an mich und küsste sie.
Sie war in Eile und erwiderte meinen Kuss nur flüchtig.
»Ich hab keine Zeit«, flüsterte sie.
Ich ließ sie los.
Sie ging ins Schlafzimmer und zog sich an. Ich stieg unter die Dusche. Eiskaltes Wasser betäubte das Verlangen und den leisen Schmerz. Er war schnell vorbei. Aber er kam immer öfter.
In der Kanzlei versammelten wir uns im Konferenzraum. Die anderen waren schon da bis auf Meinerz, der einen Termin in London hatte. Mit großer Aufmerksamkeit ließ Utz sich die Tagespläne vortragen, machte hier und da Anmerkungen. Wer einen Gerichtstermin hatte, wurde noch einmal genauestens von ihm instruiert. Gegen acht wurden wir entlassen.
»Joachim, noch eine Minute.«
Die anderen gingen hinaus, Harry warf mir noch einen aufmunternden Blick zu, den ich definitiv nicht nötig hatte.
Als sich die Tür hinter den anderen geschlossen hatte, bat mich Utz, noch einmal Platz zu nehmen.
»Es hat in der Kanzlei gestern einen Vorfall gegeben. So wurde mir berichtet.«
»Einen Vorfall?« Ich wusste nicht, was er meinte.
»Walter hat mir erzählt, eine Russin hätte sich auf unser Grundstück geschlichen.«
»Ja.« Die alte Frau hatte ich bereits völlig vergessen. »Ich habe sie auf der Rückseite des Hauses gefunden. Sie wollte dich sprechen.«
»Aus welchem Grund?«
Ich versuchte, mich so genau wie möglich zu erinnern. Dann fiel mir der Zettel ein, der jetzt in meinem Hemd in der Wäschetonne lag.
»Sie hatte ein Papier bei sich, das sie dir geben wollte. Ich hole es. Eine Minute.«
Ich rannte die Treppen hinunter, aus dem Haus, den Kiesweg entlang, sprang über die Bodendecker und Rabatten, verfluchte die Stufen vor dem Wirtschaftseingang und lief in unsere Wohnung. Das Mädchen war noch nicht da gewesen. Ich fand das Hemd im Schlafzimmer, nahm den Zettel und rannte zurück.
In der Kanzlei stieß ich mit Georg zusammen, der am Kopierer stand. Das Papier riss ein.
»Oh, das tut mir leid«, entschuldigte er sich. »Kann ich das kleben?«
»Nein danke.«
»Dann sollte ich es vielleicht kopieren?«
Das Papier wirkte unendlich dünn. Ein zarter Hauch, wie man ihn nur gelegentlich in den Fingern hielt, wenn man eine neue Uhr auswickelte. Ich reichte es ihm. Wenn Utz die Russin so wichtig war, dann sollte man auf dieses Papier besser aufpassen.
Georg gab mir das Original und die noch warme Kopie zurück. Dann warf ich einen Blick in den Konferenzraum und sah, dass Utz bereits gegangen war.
Ich fand ihn in seinem Büro, einem dunkel getäfelten Raum mit einer verglasten, deckenhohen Bibliothek. Direkt hinter dem Schreibtisch hing ein Bild der Berliner Sezession. Ich interessierte mich nicht für Kunst, eine Einstellung, die bei ihm einen kurzen, aber heftigen Anflug von Bedauern hinterlassen hatte.
»Hier.« Ich reichte ihm das Original. Die Kopie legte ich vor mich auf den Schreibtisch.
Utz griff vorsichtig nach dem Schreiben, um es nicht endgültig zu zerreißen, und begutachtete es gründlich. »Was ist das?«
»Ich weiß es nicht. Wir müssen es übersetzen lassen. Vielleicht eine Forderung.«
»Eine Forderung?«
»Die Russin wollte, dass du es unterschreibst.«
Utz vertiefte sich wieder in die fremden Buchstaben. Aber er wurde offenbar genauso wenig schlau aus ihnen wie ich. Dann tat er etwas Seltsames. Er hielt das Schreiben gegen das Fenster.
Anschließend ließ er sich von mir das schwere, in einem Marmorklotz versenkte Feuerzeug von dem Rauchertisch geben und hielt die Flamme so nahe an das Papier, dass es zwar erhitzt wurde, aber nicht verbrannte. Er hob es wieder gegen das Licht. Mit einem resignierenden Kopfschütteln ließ er es sinken.
»Was machst du da?«, fragte ich.
»Kinderkram«, brummte er. »Ganz alter Kinderkram.« Er faltete das Papier sorgfältig zusammen. »Erinnere dich bitte genau daran, was sie gesagt hat. Sie wollte zu mir. Wie war ihr Name?«
»Den hat sie nicht genannt.«
»Sie muss doch irgendetwas gesagt haben. Sie kann doch nicht erwarten, dass ich ein Dokument in einer fremden Sprache einfach so unterschreibe.«
Ich setzte mich auf. »Sie sagte, es sei eine Sache zwischen dir und … einer Frau.«
Ich beobachtete ihn scharf. Soweit ich wusste, hatte es in seinem Leben an Versuchungen nicht gemangelt. Er hatte keiner nachgegeben. Er war jemand, hatte mir Sigrun erzählt, der wohl nur einmal lieben konnte. Deshalb hatte er nicht wieder geheiratet, deshalb hatte er auch nur ein Kind.
»Natalja«, sagte ich. »Natalja, so war der Name.«
Für den Bruchteil einer Sekunde blitzte etwas in seinen Augen auf. Dann senkte er den Blick auf das Papier und schüttelte den Kopf. »Es wird ein Bettelbrief sein. Vergessen wir das alles.«
Er zerriss das zarte Papier und warf die Fetzen achtlos in den Papierkorb. Dann entließ er mich mit einem knappen Nicken und vertiefte sich in eine Handakte.
Ich stand auf und griff nach der Kopie. Ich hielt sie ihm entgegen, doch er schaute nicht mehr hoch.
In meinem Büro erledigte ich einige dringende Telefonate mit Mandanten und einer neuen Staatsanwältin, dann nahm ich mir Aarons Haus vor und stellte fest, dass ein Plan fehlte. Ich musste das Grundbuchamt kontaktieren. Das Telefon klingelte.
»Eine ziemlich penetrante Person«, erklärte Connie am anderen Ende der Leitung. »Sie sagt, du seist ihr Gegner in einem Strafprozess. Hast du was angestellt?« Sie kicherte.
»Wer ist es denn?«
»Sie heißt Marie-Luise Hoffmann und vertritt angeblich jemanden, der gegen einen unserer Mandanten klagt.«
»Stell sie durch«, sagte ich.
Es klickte. »Hallo? Ist da jetzt endlich jemand?«
»Joachim Vernau«, sagte ich.
Am anderen Ende der Leitung atmete jemand überrascht aus. Dann war es still.
»Hallo?«, fragte ich, »du wolltest mich sprechen?«
Marie-Luise fasste sich. »Dein zickiger Kollege, mit dem ich bereits das Vergnügen hatte, erklärte mir, dass du seit neuestem für so was zuständig bist. Meine Mandantin wurde von euch übers Ohr gehauen. Es geht um den Nachlass des ehemaligen Burgschauspielers Gustav Weinert. Seine kinderlose Witwe wird von euch vertreten, und ich habe dir die freudige Mitteilung zu machen, dass meine Mandantin beim Nachlassgericht beantragt, ebenfalls Erbin zu werden.«
Ich musste lächeln. Marie-Luise konnte allein mit ihrer Stimme Glas ätzen. »Gibt es außer deiner Unterstützung irgendetwas, das diese Hoffnung nähren könnte?«
»Muss ich das jetzt im Einzelnen erklären? Ich schicke dir den ganzen Wust zu und mache einen Termin vor dem Erbschaftsgericht. Ende, aus, Banane.«
»Wie hoch ist der Streitwert?«
»Schätzungsweise zwei Millionen, dazu einige Immobilien.«
»Wir sollten uns sehen.«
Marie-Luise schwieg. Ich spielte mit der Kopie, die vor mir lag. »Bei der Gelegenheit musst du mir einen Gefallen tun.«
»Ich muss?«
»Ich faxe dir was rüber, du wirfst einen Blick darauf und sagst mir, was es ist.«
»Und wenn nicht?«
Ich legte die Kopie in das Faxgerät. »Dann werde ich gnadenlos sein. Und du weißt, das kann ich gut.«
»Ich kann es besser.«
»Tu mir den Gefallen. Okay? Ich lade dich zum Essen ein. Und dabei besprechen wir die ganze Erbschaftsgeschichte. Ich sage dir offen und ehrlich, was sie erwarten kann. Wenn nicht …«
»Was, wenn nicht?«
»Kann ich es auch auf die lange Bank schieben. Möglich, dass sich dann unsere Erben mit ihren Erben auseinandersetzen.«
»Schwein.«
»Bitte.«
»Hör zu, ich habe kein Problem damit, dich im Gericht zu sehen. Ich links, du rechts. Wie im richtigen Leben. Mehr aber auch nicht. Behalte dein Fax. Wenn ich schon so dämlich bin, warum brauchst du dann ausgerechnet meine Hilfe?«
»Weil du Russisch kannst.«
»Das hat mir noch nie geholfen. Ich pfeife auf deine Ratschläge.«
»Verjährungsfrist, Rückabwicklung, DNA-Analyse. Ich schätze, bis zu einer gerichtlichen Verhandlung lassen sich damit gut und gerne drei Jahre und mehrere laufende Meter Akten füllen.«
Sie kannte mich immer noch gut genug, um zu wissen, dass ich Recht hatte. Ich war der Meister der Eingaben, der Hohepriester der verzögernden Beweisführung, der Schrecken des BGH, der Zauberer, der unwiderlegbare Einsprüche wie weiße Kaninchen aus dem Hut zauberte.
»Also?«
»Hinten die 2.«
1. Auflage
Taschenbuchausgabe Februar 2012
Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © 2005 by Elisabeth Herrmann
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: plainpicture/whatapicture
LT · Herstellung: sc
eISBN 978-3-641-08123-2
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe