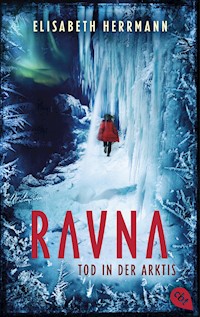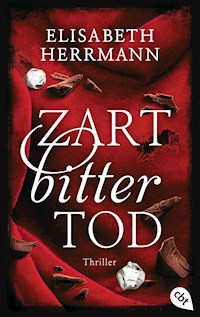10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Joachim Vernau
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Joachim Vernau macht Ferien in der Uckermark und hat sich im Bootshaus einer wunderbaren Villa einquartiert. Sie gehört dem ebenso charismatischen wie zweifelhaften Philosophieprofessor Christian Steinhoff, der sich dort als Anführer einer neuen Freiheitsbewegung feiern lässt. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Vernau entdeckt die Leiche Steinhoffs am Ufer des Sees, und wenig später wird im Dorf eine Einheimische ermordet. Vernau beginnt zu recherchieren und kommt einem alten Geheimnis auf die Spur, das in Steinhoffs Vergangenheit verborgen liegt. Allerdings leben Mitwisser von Steinhoffs Machenschaften gefährlich – und meist nicht mehr lange …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Ähnliche
Buch
Joachim Vernau macht Ferien in der Uckermark und hat sich im Bootshaus einer wunderbaren Villa einquartiert. Sie gehört dem ebenso charismatischen wie zweifelhaften Professor Christian Steinhoff, der sich dort als Anführer einer neuen Freiheitsbewegung feiern lässt. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Vernau entdeckt die Leiche Steinhoffs am Ufer des Sees, und wenig später wird im Dorf eine Einheimische ermordet. Vernau beginnt zu recherchieren und kommt einem alten Geheimnis auf die Spur, das in Steinhoffs Vergangenheit verborgen liegt. Allerdings leben Mitwisser von Steinhoffs Machenschaften gefährlich – und meist nicht mehr lange …
Weitere Informationen zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elisabeth Herrmann
Düstersee
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen. Copyright © der Originalausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München Covermotiv: Hayden Verry /Arcangel; FinePic®, München Redaktion: Regina CarstensenCN · Herstellung: ik Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-28934-8V003www.goldmann-verlag.de
Für Shirin
Prolog
Bianca sah sich ängstlich um. »Chris? Wo bist du?«
Es knackte und raschelte im Unterholz. Vom nahen Seeufer wehte ein kalter Wind, der sie frösteln ließ. Eben noch war er direkt hinter ihr gewesen, nun sah es so aus, als ob Bäume und Gebüsch einen dunklen Wall bildeten, der niemanden mehr durchließ.
»Chris!«
Sie hätten nicht herkommen dürfen.
Das Haus wollte das nicht. Es wirkte abweisend mit seinen vernagelten Fensterhöhlen, dem blatternarbigen Putz und den Löchern im Dach. Obwohl immer noch etwas Stolzes, Majestätisches von ihm ausging, wie es da auf seiner Anhöhe stand. In der Umarmung des Waldes, den lange niemand mehr im Zaum gehalten hatte und der näher und näher herankroch.
Alt war es, sehr alt. Mit einer Terrasse zum See, die vom Unkraut überwuchert war, der geschwungenen Steintreppe und dem Paradebalkon, wie gemacht dazu, in früheren Zeiten den an- und abreisenden Gästen huldvoll zuzuwinken. Eine schlafende Schönheit, die das Alter und den Verfall wegträumte und nicht mitbekam, dass es an allen Ecken und Enden bröckelte. Sie liebte es, und sie fürchtete es.
Das Brechen der trockenen Sommerzweige ließ Bianca zusammenfahren. Ein Schatten löste sich vom dunklen Dickicht, und sie atmete auf.
»Chris! Du darfst mich nicht so erschrecken!«
Der junge Mann ging auf sie zu, nahm sie in die Arme und küsste sie. Bianca fühlte, wie Nervosität und schlechtes Gewissen explosionsartig auf ihre Sehnsucht trafen. Sie durften nicht hier sein, es war verboten. Und was sie jetzt vorhatten – auch. Genau das versetzte sie in eine fiebrige Stimmung.
Erhitzt löste sie sich von ihm und trat einen Schritt zurück. Er hielt ihre Hände fest. »Tut mir leid. Ich musste pinkeln.«
Männer. Sie unterdrückte einen Seufzer.
»Es ist unheimlich hier. Schau mal.«
Sie wies auf den blassroten Mond, der nebelverhangen am Nachthimmel stand. Chris nickte und wollte sie wieder an sich ziehen. »Der Blutmond.«
»Wir sollten reingehen.«
»Reingehen?«, wiederholte Bianca bestürzt.
Er grinste. »Was denn sonst? Ist geil da drinnen.«
Sie hatte gedacht, sie würden es sich in dem halb verfallenen Bootshaus gemütlich machen. Oder auf der ungemähten Wiese unter den Bäumen am Ufer, wo nichts mehr daran erinnerte, dass alles einmal ein Park gewesen sein musste. Vom Reingehen war nie die Rede gewesen. Sie hatte eine Decke dabei, eine Flasche Wein und drei Kondome. Ihr war klar, dass es heute Nacht so weit war.
»Komm schon.«
Er zog sie mit sich, heraus aus dem Gebüsch, das noch etwas Sichtschutz geboten hatte. Sie sah sich hastig um. Vielleicht kam gerade jetzt oben auf der Straße jemand vorbei und beobachtete sie? An der Biegung war der Blick auf das Grundstück fast frei und fiel ungehindert bis ans Ufer des Düstersees. Aber Chris schien sich darum keine Sorgen zu machen. Er lief über das riesige Grundstück, umrundete ausufernde Büsche und zerbröckelnde Mauerreste, bis er die Terrasse erreichte, wo sie vor Blicken von der Straße geschützt waren. Dort küsste er sie wieder, gierig und schnell, und seine Hände ließen keine Zweifel daran, was er vorhatte.
Er war nicht der Schönste. Aber er war kräftig und hatte Erfahrung. Es ging nicht um Liebe, sondern darum, etwas hinter sich zu bringen. Sie war einundzwanzig, und es war Zeit. Nicht der beste aller Gründe, und deshalb war sie auch nicht so sehr bei der Sache wie er.
»Da ist jemand«, stieß sie hervor.
Chris, der ihr das T-Shirt hochgeschoben hatte und sich bereits dem Verschluss ihres Büstenhalters widmete, hielt inne.
»Wo?«
»Ich weiß nicht.«
Vielleicht war das doch keine so gute Idee gewesen. Aber wo sollte man hingehen, wenn man kein eigenes Auto besaß und irgendwann einmal, als Bianca kein Kind mehr war, der Schlüssel zu ihrem Zimmer verschwunden war? Egal wen sie mit nach Hause brachte, ob Schulfreundinnen oder die ersten, zaghaften Flirts – irgendwann stand ihre Mutter im Zimmer und fragte scheinheilig, ob jemand Kaffee und Apfelkuchen haben wolle.
Sie zog das T-Shirt herunter und trat an die steinerne Brüstung der Terrasse. In ihrer Erinnerung war der See immer düster gewesen, dunkel und kalt.
»Vielleicht schwimmt noch einer?«
»Bei diesem Wetter?«
Anfang September. Der Sommer öffnete bereits dem Herbst die Tür, und auf dem Wasser schwebten zarte Nebelschleier. Chris wandte sich mit einem Seufzen den Brettern zu, mit denen die Terrassentür verrammelt war. Vermutlich aus Schutz vor Vandalismus. Dabei war Vernachlässigung doch genauso zerstörerisch. Ein Schandfleck war dieses Haus. Und sie fürchtete sich vor ihm.
»Chris …«
Mit bloßen Händen hob er eine der Querlatten aus der Verankerung. Es gelang ihm so mühelos, als wäre er schon des Öfteren auf diesem Weg hineingekommen.
»Lass uns gehen.«
»Warum?« Er warf die Latte auf den Boden und widmete sich der nächsten.
»Chris! Was machst du denn da? Wenn das einer hört!«
»Wer denn?«, lachte er.
Das Mondlicht tauchte den See, seine dunklen, bewaldeten Ufer und das verfallene Bootshaus in ein gespenstisches Licht. Schilf wisperte, und irgendwo weit weg schlug ein Hund an, der sich aber gleich wieder beruhigte. Chris hatte recht. Hier war niemand. Warum ängstigte sie sich dann so?
Die zweite Latte fiel. Damit waren die hochkant aufgestellten Bretter frei, die den Zugang von der Terrasse ins Haus versperrten. Er hob das erste heraus, hatte aber dieses Mal die Geistesgegenwart, es auf den Boden zu legen statt zu werfen.
Der Spalt war breit genug, um ins Innere zu gelangen. Sie hörte, wie er eine rostige Türklinke drückte, und dann den wehen Ton von lange nicht geölten Zargen.
»Bitte einzutreten.«
Er machte ihr Platz. Mit klopfendem Herzen kam sie zu ihm und sah noch einmal über die Schulter zurück.
»Willste Wurzeln schlagen?«
Sie schüttelte den Kopf und zwängte sich durch den Spalt. Die ganze Situation war bei weitem nicht so romantisch, wie sie sie sich ausgemalt hatte. Auch wenn der alte Kasten leer stand, sie begingen gerade einen Einbruch. Dazu wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie jemand beobachtete.
Chris befand sich nun ebenfalls in dem stockdunklen, muffigen Raum. Er schloss die Tür, und sie sah die Hand nicht mehr vor Augen. Als jemand sie am Arm berührte, schrie sie panisch auf.
»O Mann«, knurrte er. »Jetzt werd nicht hysterisch!«
»Wie kannst du mich dauernd so erschrecken? Macht dir das Spaß?«
Sein Handy leuchtete auf. Das blaue Licht hielt er erst auf sie gerichtet, dann leuchtete er einmal rundherum.
Verdreckter Steinboden, blätternder Putz. Vielleicht ein Gartenzimmer, mit dieser hohen Tür zur Terrasse. Bretter, Müll, huschende Schatten.
»Sind hier Ratten?«
»Keine Ahnung.«
»Sorry.« Sie wandte sich zum Gehen. »Das war keine gute Idee.«
Schon hatte er sie am Arm gepackt. »Jetzt warte doch mal. Wir gehen nach oben. Da ist es heller und nicht so feucht.«
Ohne auf ihr Widerstreben zu achten, nahm er sie im Schlepptau aus dem Raum mit, hinaus in eine große Eingangshalle. Das Wenige, was Bianca erkennen konnte, waren das blinde Schachbrettmuster der Fliesen, eine hölzerne Wandvertäfelung und Tapetenbahnen, die sich von der Wand lösten. Nichts war mehr übrig geblieben von denen, die hier Hof gehalten hatten. Eine breite Steintreppe, flankiert von einem kunstvoll geschnitzten Holzgeländer, war wie gemacht für einen theatralischen Auftritt. Aber ihre Schuhe knirschten auf den Stufen, überall Steinstaub und Verfall.
Sie war froh um seine Hand, die sie hielt. Er zog sie die Treppe hinauf auf eine Galerie, von der links und rechts ein breiter Flur führte.
Er wandte sich nach links. Wieder leuchtete er über die Wände. Sie waren hüfthoch mit Holz vertäfelt und darüber vor langer Zeit einmal mit einer Streifentapete beklebt worden. Jetzt war sie fleckig und zum Teil abgerissen. Bianca stolperte, denn auf dem Boden lag noch ein löchriger Läufer über dem welligen Parkett. Wahrscheinlich war das Dach undicht.
»Hier.«
Er stoppte vor einer Tür. Tiefe Risse durchfurchten das Blatt, aber man ahnte noch, wie sorgfältig es einmal gearbeitet worden war. Er öffnete, ging über den knarrenden Holzboden voran und hielt ihr die Tür auf.
»Na, was sagst du?«
Auf dem Boden lag eine stockfleckige Matratze. Halb abgebrannte Kerzen steckten auf leeren Weinflaschen. Er legte das Handy ab, suchte nach seinem Feuerzeug und zündete sie an.
Es roch schimmelig und feucht. Bianca trat an das verrammelte Fenster, aber es ließ sich nicht öffnen, zudem war es auch noch von außen vernagelt.
»Vergiss es.« Eine der leeren Flaschen fiel um und rollte über den Boden. »Alles dichtgemacht. Komm her.«
Sie drehte sich um. Auf dieser Matratze sollten sie … zusammen sein?
»Du bist öfter hier.«
Chris steckte das Feuerzeug wieder weg und schaltete das Handy aus. Der Schein der Kerze verbreitete ein warmes, weiches Licht. Immerhin. »Ich brauch auch mal meine Ruhe.«
»Allein?«
Er trat auf sie zu und nahm sie in die Arme. Sein Mund suchte ihre Lippen. Den Impuls, sich wegzudrehen, unterdrückte sie. Genau deshalb hatte sie sich in dieser Nacht mit ihm getroffen. Nun waren sie schon so weit gegangen, da konnte sie keinen Rückzieher mehr machen.
Beinahe übergangslos setzte er das, was er für Verführung hielt, fort. Seine Hände fuhren unter ihr T-Shirt und ertasteten nicht gerade sensibel ihre Brüste.
»Ich hab Wein mitgebracht.«
Bianca wand sich aus seinem Griff und warf ihre Tasche auf die Matratze. Als Erstes holte sie die Decke hervor und breitete sie aus. Auf keinen Fall wollte sie mit dem dreckigen Stoff in Berührung kommen oder mit irgendetwas, das darauf übrig geblieben war. Dann reichte sie ihm die Flasche. Er schraubte den Drehverschluss auf und genehmigte sich einen tiefen Schluck. Nachdem er ihr den Wein zurückgegeben hatte, ließ er sich auf die Matratze fallen.
Sie trank und überlegte, ob es sich dafür lohnte. Chris war im Dorf bekannt dafür, nichts anbrennen zu lassen. Sie wollte, wenn es so weit war, jemanden haben, der wusste, was er tat. Langsam aber beschlichen sie Zweifel. In einer feuchten Ruine auf einer Matratze? Hätten sie das im Wald nicht schöner haben können?
Bianca setzte sich neben ihn. »Seit wann machst du das? Hier einsteigen, meine ich.«
Er ließ sich die Flasche reichen. »Hat sich so angeboten. Vor ein paar Monaten. Ist doch cool, oder?«
Er trank und wies mit der Flasche auf Wände und Decke. Der Stuck war immer noch wunderschön: Blütenranken, in den Ecken Medaillons. Wahrscheinlich war dies einmal das Zimmer der Besitzer gewesen oder das für eines ihrer Kinder. Die beiden bodentiefen Fenster wiesen, wenn sie sich nicht irrte, direkt hinaus auf den See. Sie waren mit zweiflügeligen Läden verschlossen, durch die kein Licht nach innen drang, und von außen mit Holzlatten gesichert. An der rechten Seite des Raums befand sich ein Kamin, völlig verrußt und verdreckt. Sie wollte nicht so genau hinsehen, aber sie hatte das Gefühl, dass dort mehrere Vogelskelette vor sich hin moderten.
Chris stellte die Flasche ab und zog sie an sich. Er öffnete den Knopf ihrer Jeans und dann den Reißverschluss.
»Warte.«
Die Jeans war eng. Sie stand auf und streifte sie sich ab. Wieder angelte sie nach der Flasche und trank, als ob sie sie in einem Zug leeren wollte. Sie reichte sie an ihn weiter und legte sich neben ihn. Jetzt wollte sie es nur hinter sich bringen.
Sein Atem roch nach Wein und Zigaretten. Er war gröber, als sie erwartet hatte. Die Liebkosungen eher einstudiert als echt, aber immerhin zielführend. Sie hoffte, die halbe Flasche Wein würde dafür sorgen, dass sie endlich in Stimmung kam.
»Stopp.«
Er hatte schon die Hose offen.
»Ich hab was gehört.«
»Was?«
»Irgendwas. Ein Geräusch. So ein Klopfen.«
Er hob den Kopf und lauschte. Nichts war zu hören außer dem Rauschen des Windes durch die Baumwipfel. Und ein Knarren.
»Da!«, flüsterte sie.
Er stützte sich auf dem Oberarm ab und schüttelte den Kopf. »Das ist das Holz. Das arbeitet.«
Er küsste sie hastig und in der Hoffnung, endlich zum Zug zu kommen. Aber jetzt war sie sich sicher.
»Riechst du das nicht?«
»Ich riech nichts. Außer dir.« Seine Hand fuhr völlig unerwartet zwischen ihre Beine. »Vielleicht isses das?«
Bianca wusste: Das wurde nichts mehr mit der Stimmung. Wütend schob sie ihn weg.
»Geh runter und schau nach.«
»Was?«
»Ich will, dass du nachsiehst, ob da unten jemand ist!«
»Spinnst du jetzt?«
Er wollte wieder nach ihr greifen, aber der Vorteil der Matratze war, dass sie sich von ihr auf den Boden rollen konnte. In Sekundenbruchteilen war sie auf den Beinen und suchte ihre Jeans.
»Wenn du nicht gehst, gehe ich.«
Der Geruch wurde stärker, schärfer. Sie schnupperte. »Irgendwas stimmt hier nicht.«
Mit einem aufgebrachten Stöhnen schlug er mit der flachen Hand neben sich. »Alles, was nicht stimmt, bist du! Ich war hier schon, hier ist keiner!«
Sie zog die Hose hoch, schloss Reißverschluss und Knopf und schlüpfte in ihre Schuhe. Die Decke würde sie abschreiben. Hauptsache, raus hier. Es war spooky, und dieses Gefühl, nicht allein zu sein, verstärkte sich mit jedem Atemzug.
»Ich will nur nachsehen.«
»Aber beeil dich!«, schallte es hinter ihr her. »Sonst fang ich ohne dich an.«
Schon im Flur stutzte sie. Benzin, schoss es ihr durch den Kopf. Es riecht nach Benzin. Sie erreichte die Galerie.
»Chris? Kommst du mal?«
Von unten drang ein schwacher Lichtschein herauf. Keine Taschenlampe, kein Handy. Es war offenes Feuer. »Chris!«
Er trat in den Flur, barfuß, die Hose auf halb acht. »Was ist denn los?« Seine ärgerliche Stimme verriet, dass er sich den Verlauf des Abends anders vorgestellt hatte.
Sie ging zum Geländer und sah hinunter in die Eingangshalle. »Irgendwo da unten brennt es! Und es stinkt so fürchterlich!«
Er näherte sich ihr, und kaum hatte er begriffen, raste er an ihr vorbei die Treppe hinunter. Ohne sich umzusehen, nahm er den Weg zum Gartenzimmer.
»Warte!«
Sie rutschte auf den staubigen Stufen aus und konnte sich gerade noch fangen. Unten angekommen, erkannte sie, dass das Feuer bereits an der Holzvertäfelung der Eingangshalle leckte. Der Gestank war unerträglich. Qualm stieg hoch und verätzte ihr die Kehle. Mit tränenden Augen wandte sie sich nach links. Raus hier, schoss es ihr durch den Kopf. Nichts wie raus.
Aber am Eingang zum Gartenzimmer stieß sie mit Chris zusammen. Panik verzerrte sein Gesicht. »Es ist zu!«
»Was?«
»Jemand hat von außen alles dichtgemacht.«
»Das kann nicht sein!« Sie schob ihn zur Seite und rannte auf den rettenden Ausgang zu. Die Tür stand zwar weit offen, aber die Bretter dahinter bildeten eine fast geschlossene Fläche. Sie hämmerte dagegen, nichts rührte sich. Jemand musste die Querlatten wieder vorgelegt haben. Ihr Herz raste wie verrückt.
»Hilfe!«, schrie sie und hieb mit bloßen Fäusten auf das Holz. Hinter ihr hörte sie Chris husten und wie wild gegen irgendwelche Fensterbarrikaden schlagen. Sie waren gefangen. Ihr Verstand weigerte sich zu glauben, was gerade geschah. »Hilfe!«
Auf Schulterhöhe befand sich ein Astloch. Sie bückte sich panisch und spähte hindurch. Die Terrasse war leer, weiter unten ruhte der See.
»Um Gottes willen! Helft uns! Helft uns doch!«
Entsetzt drehte sie sich um. »Gibt es noch einen anderen Weg? Im Keller? Hinten? Irgendwo?«
Chris warf die Tür zur Eingangshalle zu. Er hustete und ging keuchend in die Knie. »Alles dicht. Wir kommen hier nicht raus.«
»Nein. Nein!« Sie trat gegen die Bretter. Sie versuchte in ihrer Panik, die Tür aus den Angeln zu heben, um sie gegen das Hindernis zu werfen, aber sie hatte keine Chance. Ohne Werkzeug, nur mit bloßen Händen, gab es kein Entrinnen. Sie schob ihr T-Shirt hoch und hielt es sich vor die Nase. Dann beugte sie sich wieder zu dem Astloch.
»Hilfe!«, brüllte sie erneut und hämmerte mit der freien Hand gegen das Holz.
Und da sah sie ihn. Einen Schatten am Rande des Waldes, fast verschmolzen mit der Dunkelheit um ihn herum.
»Da ist jemand!«
Chris kam mühsam auf die Beine und taumelte zu ihr.
»Da draußen. – Hilfe! Retten Sie uns!«
Der Schatten löste sich aus dem Schwarz und trat langsam, zögernd auf die Wiese. Chris stieß sie unsanft weg. »Hol uns hier raus! Sofort!«
Er beugte sich zu dem Astloch und spähte hinaus.
»Komm her, du Arschloch!«
Es war, als hätte sie in eine Steckdose gegriffen. Flatternder Puls, zitternde Knie. Sie sehnte sich nach frischer Luft und presste das T-Shirt noch fester unter die Nase.
Chris richtete sich wieder auf.
»Da ist niemand.«
»Quatsch. Ich hab ihn doch gesehen«, hustete sie. Fast mit Gewalt musste sie ihn von dem Guckloch wegschieben. Sie sah hinaus, und dann war es, als ob sie den Boden unter den Füßen verlieren würde, und eine Welle unendlicher Verzweiflung erfasste sie.
Der Wald stand still. Der See schimmerte dunkel. Der Schatten war verschwunden.
Chris wimmerte. »Was machen wir denn jetzt?«
Wie sie ihn verachtete. Ihn und ihre eigene Dummheit. Sie hätte auf ihr Gefühl hören sollen.
»Wir steigen aufs Dach. Vielleicht sind da ein paar Ziegel lose, und wir schaffen es an die Luft. Hier unten ersticken wir.« Durch die Ritzen unter der Tür zur Eingangshalle kroch fetter schwarzer Rauch. »Drück dir dein T-Shirt vors Gesicht. Wir müssen rennen. Egal was passiert, wir müssen da durch. Verstanden?«
Er nickte. Hastig zog er sein T-Shirt aus, knüllte es zusammen und hielt es sich vor Mund und Nase. Als Bianca die Tür erreicht hatte und öffnete, schlug ihr das Inferno entgegen.
»Los!«, schrie sie.
Chris stieß sie zur Seite und sprintete Richtung Treppe. Nach wenigen Metern war er von schwarzem Rauch verschluckt. Sie atmete noch einmal durch den Stoff ein, hielt die Luft an und rannte mitten hinein in einen tödlichen schwarzen Nebel. Es polterte und krachte um sie herum. Die Flammen züngelten gerade an der holzvertäfelten Decke und fraßen sich, durch den Luftzug aus dem Terrassenzimmer entfacht, unersättlich weiter.
Bianca erreichte die Stufen. Auf halber Treppe knickte sie um. Der Schmerz raste durch ihren Körper wie ein Fanal. Keuchend kroch sie vorwärts. Sie spürte, wie sie ihre Kräfte verließen. Die Flammen erreichten das Holzgeländer und würden in wenigen Augenblicken die Treppe verschlingen, um sich auf die Galerie und das Obergeschoss zu stürzen. Sie konnte nichts mehr erkennen. Der Rauch stach wie Messer in ihre Augen und verätzte ihre Kehle. Die Luft wurde knapp, und sie wusste, wenn sie jetzt tief einatmete, wäre es vorbei.
Mama, schluchzte sie. Mama, hilf mir!
Sie dachte an die versteinerten Körper von Pompeji und Herculaneum. Wie man sie finden würde, zusammenkrümmt, die Arme schützend um den Kopf gelegt. Sie dachte daran, wie sie aufgebrochen war, mit klopfendem Herzen und drei Kondomen, und sie hasste Chris, der ihr das angetan hatte und sie hier unten im Stich ließ, hasste ihn so sehr, dass es kein anderes Gefühl mehr gab, das sie ins Jenseits hinübertragen würde.
Hände packten sie und zogen sie hinunter. Ihr Kopf schlug auf die Stufen, als sie mit letzter Kraft das T-Shirt vors Gesicht presste. Sie wollte schreien, aber der Rauch schnürte ihr die Kehle ab. Jemand riss sie an den Armen hoch und legte sie sich über die Schulter. Mehr geschleift als getragen ahnte sie, dass es zurück zur Terrasse ging. Das Feuer streifte sie mit seinem glühenden Atem. Chris, dachte sie, und der Hass, den sie eben noch gespürt hatte, wandelte sich schlagartig in überwältigende Liebe. Chris …
Sie wurde herabgelassen und durch einen engen Spalt nach draußen geschoben. Keuchend, hustend und spuckend wand sie sich auf den kalten Steinen und fühlte sich wie ein Auswurf der Hölle. Jemand beugte sich über sie. Die Haut versengt, rußgeschwärzt, ein Haupt voll Blut und Wunden. Der Anblick war entsetzlich, aber es war nicht Chris. Sie hatte dieses Wesen noch nie in ihrem Leben gesehen.
»Da … da drinnen ist noch jemand«, keuchte sie.
Das Ungeheuer nickte und verschwand aus ihrem Blickfeld. Sie kroch auf allen vieren über die Terrasse und erbrach sich in einer Ecke, wo sie anschließend zitternd und kaum noch Herrin ihrer Sinne liegen blieb.
Die Zeit verging.
Das Feuer fraß das Haus.
Das Ungeheuer kam nicht mehr zurück, und Chris auch nicht.
Zehn Jahre später
1
»Always look on the bright side of life …«
Steinhoff hob sein leeres Glas und deutete damit auf die andere Seite des Sees. Sonnenstrahlen vergoldeten das Ufer. Das Strandbad hatte noch geöffnet. Samstag, früher Abend, Sommerwochenende. Lachen, Rufe und Schreie drangen hinüber zu uns, die wir im Schatten auf der Terrasse standen.
»Sonnenwalde.« Er griff nach dem Rosé, der in einem Weinkühler auf dem Buffet stand. Leise Jazzmusik perlte aus unsichtbaren Lautsprechern. Es roch nach Holzkohle und Chanel N° 5. Die Gäste flanierten an Blumenbeeten vorbei hinunter ans Ufer oder saßen auf der Terrasse. Obwohl es ein heißer Tag gewesen war und die Wärme immer noch in der Luft lag, wurde es auf der schattigen Seite des Sees schnell kühl.
»Und Düsterwalde.« Steinhoff schenkte sich nach und spähte in der Schar seiner Gäste nach lohnenswerteren Objekten. Er war einen halben Kopf größer als ich, zehn Jahre älter, wirkte aber wesentlich fitter. Ein Alphatier mit eisgrauen Haarstoppeln, Dreitagebart und einem Gesicht, dem man die Vorbestimmung seit Kindheitstagen ansah: Du wirst Großes erreichen, wenn du nur genug Willige um dich scharst, an die du die Aufgaben weiterreichen kannst. »Das ist das Dorf, durch das Sie gekommen sind.«
Ich nickte. Mit diesem Namen war einfach alles gesagt. Von der Hauptstraße führte am Ortsende eine Abzweigung in einen dichten Forst, sodass man aus dem Hellen direkt hinein ins Dunkle fuhr. Tannen, Eichen, Unterholz. Eine Biegung, ein Wegweiser: »Akademie am Düstersee«, am Ende einer schmalen Zufahrt ein großes schmiedeeisernes Tor, das sich wie von Geisterhand öffnete und die Einfahrt in Steinhoffs Privatpark freigab. Das halbe Seeufer gehörte ihm. Leider ab mittags im Schatten. Wenn es in seiner Macht gewesen wäre, hätte er ohne zu zögern den Lauf der Sonne verändert. Der Grimm in seiner Herrschermiene verriet, dass er sich immer noch nicht damit abgefunden hatte.
Ich sah mich nach Marie-Luise um, die kurz im Haus verschwunden war. »Sehr nett.«
Der Duft vom Grill wurde konkret.
Steinhoff nickte einer gertenschlanken, extravagant wirkenden Dame zu, die schon die ganze Zeit auf eine Gesprächspause gewartet hatte, in die sie hineingrätschen konnte. Ermuntert durch seine Aufmerksamkeit, trat sie noch einen Schritt näher und harrte darauf, dass er das Wort ergriff.
»Darf ich vorstellen? Felicitas von Boden. Ihr gehört eine Galerie in Berlin, und sie eröffnet im Dorf eine Dependance.«
»Ah«, sagte ich überrascht und ergriff ihre Hand. Düsterwalde hatte beim Durchfahren nicht den Eindruck erweckt, es bräuchte dringend Kunst. Die Infrastruktur verlangte eher nach einem Supermarkt oder einer Kneipe, am besten beides. Aber was wusste ich, welche Sehnsüchte sich hinter den Fenstern Marke VEB Bauelemente verbargen?
Felicitas von Boden war es offenbar gewohnt, Pionierarbeit auf dem mageren uckermärkischen Boden zu leisten, und lächelte mich mit blutrot geschminkten Lippen an. Von ihren Ohren baumelten abstrakt und gefährlich aussehende scharfkantige Gehänge, die ihre asketischen Züge und die schmale Nase betonten. Wasserblaue Augen, die mich musterten und als uninteressant, weil Kulturbanause, aussortierten. Ein bleiches Gesicht, vollendet von einem winzigen Kinn, die blonden, zum akkuraten Bob geschnittenen Haare von ersten grauen Strähnen durchzogen. Als sie sich an Steinhoff wandte, wurde ihr Tiefkühlblick immerhin um einige Grad wärmer.
»Ich hatte Sie eigentlich zu meiner Vernissage in Berlin erwartet. Landscapes Uckermark. Kompositionen von Luft und unendlicher Weite. Die Authentizität, von der Natur inszeniert, inhaliert und …«
»Sorry.«
Steinhoff fiel ihr mitten ins Wort, schob sie zur Seite und gesellte sich zu einer Dreiergruppe von Neuankömmlingen, die in der Terrassentür stand und darauf wartete, begrüßt zu werden.
Felicitas wandte sich an mich.
»Am Montag eröffne ich die Dependance mit einer Apero-Vernissage. Oben, an der Hauptstraße, direkt hinter der Kirche. Sie kommen doch auch? Es wird …« Sie drehte sich noch einmal nach Steinhoffs breitem Rücken um. »Spektakulär. Ganz und gar außergewöhnlich.«
In den nächsten zwei Wochen wollte ich eigentlich nur Urlaub machen und die Kompositionen von Luft und unendlicher Weite nicht an irgendwelchen Wänden bestaunen. Aber sie tat mir leid, so unhöflich unterbrochen worden zu sein. »Bin ich denn eingeladen?«
»Professor Steinhoffs Gäste sind jederzeit willkommen. Ich würde ja gerne selber an seiner Sommerakademie teilnehmen, aber leider habe ich so gar keine Zeit. Es tut sich so viel in der Uckermark, finden Sie nicht auch? Ausstellungen, offene Gärten, Atelierbesuche, und dann diese Highlights, wie sie nur Menschen von seinem Schlag zustande bringen.« Sehnsuchtsvoller Blick auf Steinhoffs Ansicht von hinten. Es sah nicht danach aus, dass er in den nächsten zwei Stunden zu uns zurückkehren würde.
Ich war eher durch Zufall an diesen Ort geraten. Ich wollte raus aus der Stadt, und Steinhoffs frisch saniertes Bootshaus stand leer. Am Rande des Jahrestreffens der Anwaltskammer nebenbei erwähnt, gegen Mitternacht zum Plan gereift und irgendwann nach zwei Uhr morgens, kurz vor dem Besiegeln der Blutsbrüderschaft, beschlossen. Er war auf dem Weg nach ganz oben. Allianzen schmieden und Verbündete suchen machten einen großen Teil seines Charmes aus. Er wollte Präsident der Berliner Anwaltskammer werden und sich von da aus in die Bundesebene sprengen. Ich war gegen seine Avancen bisher immun gewesen, denn in meinen Augen war er jemand, der seine persönlichen Ziele über die Verantwortung stellte, die so eine Position mit sich brachte. Aber irgendwann nach dem dritten, vierten, fünften Cognac hatte er mich. Er war brillant, ein begnadeter Demagoge mit genau der Prise Besonnenheit, die ihn zu einem ebenbürtigen Sparringspartner machte. Wir redeten uns die Köpfe heiß, er, indem er gnadenlos die Schwächen des Staats angriff, ich, indem ich die Stärken verteidigte. Wir schieden singend und als beste Freunde.
Wahrscheinlich rechneten wir beide nicht damit, uns am nächsten Morgen noch daran zu erinnern. Aber ein paar Wochen später rief er an und erneuerte sein Angebot. Von Geld wollte er nichts hören. Manus manum lavat1 , sagte er nur. Ich hatte nach diesem zweiten Angebot nicht weiter darauf gedrungen, und so war ich glücklicher Gewinner von zwei Wochen Uckermark. Am sagenumwobenen, romantischen Düstersee, nicht weit von dem gleichnamigen Dorf, ohne Metzger oder Laden, aber bald mit Galerie.
Allerdings hatte Steinhoff mit keinem Wort erwähnt, dass der idyllische Park samt hochherrschaftlicher Villa für eine Woche von sinnsuchenden Hobbyphilosophen okkupiert sein könnte.
»Hat die Ausstellung auch einen Titel?«, fragte ich höflich.
Felicitas von Boden hob ihr halb volles Weinglas und leerte es in einem Zug.
»Ja. ›Todesreigen‹.«
»Oh.«
»Ein junges, hoffnungsvolles Nachwuchstalent, das sich mit der Transformation des Lebens in jenseitige Zustände beschäftigt.«
»Interessant.«
»Dies wird meine Außenstelle für junge Avantgarde.«
»In Düsterwalde.«
»Ja«, sagte sie knapp und sah sich nach erfolgversprechenderen Kontakten um.
»Ich bin leider nicht bei der Tagung dabei«, sagte ich. Dabei wies ich mit dem Weinglas zu meinem Ferienhaus, das, versteckt von Rabatten und liebevoll gehegten Sträuchern, weiter unten, direkt am Ufer des Sees, lag. »Ich mache Urlaub. Professor Steinhoff war so nett, mich für zwei Wochen einzuladen.«
»Dann gehören Sie nicht dazu?« Ihre sorgsam aufgemalten Augenbrauen hoben sich leicht.
»Nein«, erwiderte ich lächelnd. »Ich denke, wir werden uns gegenseitig nicht stören.« Zwischen Villa und altem Bootshaus lagen mindestens zweihundert Meter abschüssiges Gelände, Buchsbaumlabyrinthe und lauschige Lauben. »Ich bin eigentlich nur hier, weil es so gut wie unmöglich ist, in diesem Sommer irgendwo Urlaub zu machen. Da kam …«
Felicitas ließ mich grußlos stehen.
»… das Angebot …«
Sie ging auf ein verhärmt wirkendes Ehepaar zu, das sich strategisch günstig in der Nähe des Grills positioniert hatte.
»Pech bei den Frauen, Glück mit den Ferien.«
Marie-Luise war aus dem Nichts aufgetaucht. Mit einem Grinsen hob sie eine Flasche Rosé, die sie von der Bar geklaut hatte, und verließ die Terrasse über ein paar Steinstufen. Von dort gingen sorgfältig geharkte Kieswege in verschiedene Richtungen. Einer schlängelte sich unter Weinlaubgängen zum Wald, der andere hinunter zum See, der ganz rechts zum Bootshaus. Davon zweigten weitere Pfade ab, führten zu Bänken unter Rosenbüschen oder kleinen Springbrunnen, gekrönt von pausbäckigen Engeln auf Zehenspitzen. Wir setzten uns auf eine Steinbank in Rufnähe, aber weit genug entfernt, um ungestört reden zu können.
»Unter Urlaub in der Uckermark hatte ich mir etwas anderes vorgestellt.«
Sie trug ein leichtes Sommerkleid mit einem unverschämt tiefen Ausschnitt. Ihre roten Haare hatte sie hochgesteckt, sodass ich von der Seite nicht nur ihr Profil, sondern auch ihren Marmorstatuenhals bewundern konnte.
»Was denn?«, fragte ich zurück.
Die Blicke der Männer auf sie waren mir nicht entgangen. Nach all den Jahren, die wir uns kannten, störte es mich immer noch. Wie oft hatten wir uns aus den Augen verloren, wiedergefunden, völlig verkracht, versöhnt und stillschweigend festgestellt, dass wir unverrückbar Teil des Lebens des anderen geworden waren. Mehr als Freunde und Familie, Lebenspartner vielleicht, wenn dieser Begriff nicht gleichzeitig etwas beschrieben hätte, zu dem es dann doch nicht gereicht hatte. An diesem sommerwarmen Abend, den dunkelglühenden Himmel über uns und den Geruch von Wasser, Blüten und Gras in der Nase, bedauerte ich das.
»Auf keinen Fall so etwas Großkotziges.« Sie schenkte uns ein und stellte die Flasche zu ihren Füßen ab. Dann glitt ihr Blick über die beleuchtete Fassade mit ihren Schmuckelementen, Vorsprüngen und den klassizistischen Säulen, die den Zugang zur Terrasse umrahmten. »Ich frage mich, woher er das Geld hat. Der Kasten muss doch Millionen gekostet haben.«
»Vielleicht hat er geerbt? Oder seine Frau?«
Regina Steinhoff wurde erst am nächsten Tag erwartet. Sie entsprach allen Erwartungen, die man an die Gattin des zukünftigen Präsidenten der Berliner Anwaltskammer stellen konnte: dezent gut aussehend, geschmackvoll gekleidet, gewandt im Small Talk. Die durchschnittlichen zehn bis fünfzehn Jahre jünger als ihr Mann, Studium an der Londoner St Mary’s University und der Pariser Sorbonne, ein paar Jahre in mittlerer Leitungsebene bei internationalen Konzernen, und bevor sich überhaupt die Frage nach Karriere stellte, ab ins Private, um den Nachwuchs zu hegen. Sie hatten zwei Töchter, wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich ließ.
Marie-Luise zuckte mit den Schultern und sah sehnsuchtsvoll über den See nach Sonnenwalde, das gerade in den letzten goldglühenden Sonnenstrahlen badete.
»Und dann feiert er noch diese rauschenden Sommerfeste. Die halbe Anwaltskammer ist hier. Hast du Schlevogt gesehen?« Der amtierende Präsident der Kammer, ein barocker, immer leicht schnaufender Mittsechziger. Natürlich war er mir aufgefallen, und ich war, so schnell es ging, hinter einem Rhododendron in Deckung gegangen. Immerhin steckte ihm bereits ein unsichtbares Messer im Rücken, und ich wollte nicht, dass er vermutete, ich würde zu Brutus’ Handlangern gehören. »Bis zur Wahl im Herbst werden sie sich verbal die Köpfe einschlagen. Aber vorher wird noch zusammen gefeiert. Seit wann bist du denn dazu eingeladen? Ich dachte, du hängst nur deine Beine in den See.«
Ich trank meinen Wein – hervorragend – und versuchte, dabei ein ebenso ratloses wie unschuldiges Gesicht aufzusetzen. »Keine Ahnung.«
»Glaube ich dir nicht. Steinhoff tut nichts ohne Gegenleistung. Bist du Referent in seiner Akademie?«
»Nein.«
Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Ich muss bald los.«
»Danke fürs Fahren.«
Wir stießen an. Dann schob sie die Flasche mit ihrem Fuß einen Millimeter in meine Richtung. »Damit du heute Abend nicht auf dem Trockenen sitzt. Hast du das Programm gelesen?«
Steinhoffs Privatvorträge interessierten mich nicht. Ich wollte schwimmen, lesen und Boot fahren. Wie die beiden jungen Frauen, die gerade in die Mitte des Sees ruderten, der bereits tief im Schatten lag. Und sie vielleicht kennenlernen, die zwei hübschen Damen, deren Lachen bis zu uns herüberklang.
»Veranstaltet vom Institut für Staatsemanzipation.« Sie rieb sich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken. »Mich würde schon interessieren, was die hier ausbrüten. Hört sich jedenfalls nicht sehr verfassungskonform an.«
»Das tust du nach dem dritten Glas Wein auch nicht.«
»Das ist was anderes.«
»Warum ist das bei dir was anderes? Nur weil du links bist?«
Sie stellte ihr Glas auf der Steinbank ab. »Ich habe nicht vor, diesen Staat ersatzlos zu streichen.«
»Steinhoff auch nicht.« Ich fühlte mich nicht wohl, mich zum Verteidiger dieses Mannes zu machen. In diesem Moment wäre ich vielleicht sogar mit ihr zurück in die Stadt gefahren, aber ich hatte meine Berliner Wohnung für zwei Wochen über Airbnb vermietet und heute Morgen die Schlüssel übergeben. »Er hat mir das Bootshaus angeboten, weil es leer steht. Wo ist das Problem?«
»Hast du ihm was bezahlt?«
»Nein«, gab ich widerwillig zu. »Es ist ein Gefallen unter Kollegen.«
»Und welchen Gefallen erweist du ihm dafür?«
Ein Königreich für einen reitenden Boten, der in diesem Moment »Krieg mit Dänemark!« oder ähnlich Hilfreiches ausgestoßen hätte. Da keiner auftauchte, konnte ich nur mit den Schultern zucken.
»Es hat sich so ergeben. Neulich. Eine Schnapsidee. Aber dann …«
Ich hielt ihrem prüfenden Blick stand.
»Also nichts weiter?«
»Nichts weiter«, bekräftigte ich. »Das habe ich dir doch schon erklärt.«
Sie nickte. Aber es war keine Zustimmung. »Er ist ein Menschenfänger, das weißt du. Pass nur auf, dass er dich mit dem kleinen Gefallen nicht unter Druck setzt.«
»Inwiefern?«
Sie schwieg.
»Inwiefern sollte Steinhoff mich unter Druck setzen?«
Keine Antwort.
»Weil ich in seinem Bootshaus bin?«
Sie stand auf und reichte mir ihr Glas. »Lass dich einfach nicht von ihm einwickeln. Schönen Urlaub.«
Und schon wandte sie sich ab und ging davon. Ich stellte die Gläser ab und wollte ihr folgen.
»Marie-Luise! Warte!«
Nach ein paar Schritten blieb ich stehen. Ich hätte sie sowieso nicht eingeholt. Die Gäste standen Schlange am Grill, Steinhoffs dröhnende Stimme drang durch die Geräuschkulisse bis zu mir hinunter. Nachzügler und Spaziergänger, die noch am Ufer und im Park gewesen waren, trudelten ein und wurden von ihm begrüßt. Felicitas, die gestresste Galeristin, stand an der Brüstung der Terrasse, eine hoch aufgerichtete, reglose Gestalt. Sie hatte Marie-Luises Abgang bemerkt, aber nichts verriet, was sie dachte.
Von hier unten sah es schön aus. Lichter, Lachen, leise Musik. Ich hätte hinaufgehen und ein paar wichtige Kontakte machen können, aber mir fehlte der Elan. Es schien, als hätte sich ein Grauschleier über das Bild gelegt, als ob die Freude und Lebenslust dort oben mit einem Mal einen anderen, dunkleren Ton bekommen hatten.
Vielleicht lag es nur an der Dämmerung und dem Park, der sich an seinen Rändern übergangslos dem Wald öffnete. An den schattigen Wipfeln, die wie Scherenschnitte vor dem ausglühenden Abendhimmel standen; dem kühlen Wind vom See, der einen nach diesem heißen Tag frösteln ließ. An etwas, das nicht stimmte an diesem Bild. Eine winzige Irritation, die Marie-Luises Bemerkungen in mir ausgelöst hatten. An all den Menschen dort, deren Verbindung zu Steinhoff klar war, nur meine nicht. Mit diesem Aufenthalt war eine verwischte, kaum wahrnehmbare Linie übertreten worden. Sie hatte recht: Irgendwann würde er einen Gefallen von mir fordern. Es gab nichts geschenkt im Leben, schon gar nicht von einem Mann wie Steinhoff.
Ich würde mit Marie-Luise zurückfahren.
Aber oben am Haupteingang angekommen, wo die Autos standen, war sie schon weg. Nur etwas Dieselgestank lag noch in der Luft. Mein Koffer stand in der Eingangshalle, zusammen mit einem Dutzend weiterer Gepäckstücke, die darauf warteten, von ihren Besitzern in die Zimmer gebracht zu werden.
Die Holzvertäfelung und die kassettierte Decke sahen neu aus. Eine gewaltige, geschwungene Treppe führte ins Obergeschoss. Das ganze Haus wirkte luftig und, unter Bewahrung der Architektur, dem Zeitgeist angepasst. Moderne Kunstwerke zierten die Wände und die Nischen. Indirekte Beleuchtung verbreitete ein warmes Licht. Ich wandte mich nach rechts und gelangte in einen als Bibliothek eingerichteten Raum, von dem aus eine zweiflügelige Glastür mit Stahlrahmen direkt auf die Terrasse führte.
Überall waren kleine, intime Sitzgruppen arrangiert, in denen drei oder vier Personen zusammensitzen konnten. Einige waren besetzt, und die Gäste sahen bei meinem Eintreten kurz hoch und erwiderten meinen Gruß mit einem freundlichen Nicken. Sie sahen nicht so aus, als ob sie daran dachten, an diesem Abend noch nach Berlin zurückzukehren.
Ich ging zurück in die Empfangshalle und war nicht mehr allein. Dort, am Fuß der Treppe, stand eine seltsame Frau und spähte hinauf ins erste Obergeschoss. Ihr Mut, sich mit diesem bodenlangen, schwingenden Hippiekleid und dem zerknautschten Anglerhut unter die Gäste zu mischen, nötigte mir Respekt ab.
»Guten Abend.«
Erschrocken drehte sie sich um. Sie mochte Mitte vierzig, Anfang fünfzig sein, mit Sommersprossen in einem breiten, kindlich wirkenden Gesicht und zerzaustem, schulterlangem Haar in fahlem Braun. Beim Näherkommen fiel mir auf, dass ihre Kleidung etwas zerschlissen wirkte und sie den Eindruck machte, damit auch gerne in freier Natur zu übernachten. Sie hielt einen mehrfach gefalteten Zettel in der Hand.
»Guten Abend.« Sie trat einen Schritt von der Treppe zurück.
»Herr Steinhoff ist draußen auf der Terrasse«, sagte ich. Vielleicht suchte sie jemanden oder gehörte zum Catering.
Die Sommersprossen tanzten ein kleines Lächeln. »Oh. Ich bin gar nicht hier. Ich meine, ich bin hier, aber ich gehöre nicht dazu.«
Sofort hatten wir etwas gemeinsam. Die etwas zerrupfte Waldfee, oder was immer sie sein mochte, ging zu der Treppe und ließ sich auf den ersten Stufen nieder. Ihre Bewegungen waren fließend, fast tänzerisch.
»Die Villa stand lange leer, wussten Sie das? Ich wollte nur mal schauen, wie es jetzt hier aussieht.«
Ich blieb unschlüssig vor meinem Koffer stehen, nicht wissend, ob die Art, wie sie sich jetzt die Haare zurückstrich, einladend oder eher gedankenverloren war.
»Vor ewigen Zeiten war sie mal ein Herrenhaus, dann im Krieg ein Lazarett, danach ein Kinderheim. Und dann ist sie abgebrannt.« Sie wartete, als ob sie sich von mir eine Erinnerung erhoffte. Als die nicht erfolgte, sagte sie: »Ich bin Sanja. Man nennt mich auch die Verrückte. Und Sie?«
»Vernau. Joachim Vernau. Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Im Bootshaus.«
»Dann wohnen Sie nicht in der Villa Floßhilde?«
»Floßhilde?«, fragte ich irritiert und kam näher.
»So hieß das Haus früher einmal. Nach einer der drei Rheintöchter.« Mich traf ein amüsierter Blick aus braunen, kajalumrandeten Augen.
»Dann stammen Sie aus der Gegend?«
»Ich bin hier geboren und aufgewachsen.«
»Woher hat der Düstersee seinen Namen?«, wollte ich wissen.
Die Antwort war ein leises Lachen. »Woher wohl? Das war mal ein Moorsee, bevor die Gegend trockengelegt und das Dorf gebaut wurde. Zwei Kilometer weiter liegt der Klare See, der sieht ganz anders aus.«
Ich nickte und hatte schon die Frage auf den Lippen, ob sie ihn mir vielleicht bei einer Wanderung mit romantischem Picknick zeigen würde, da fuhr sie fort: »Das sagen die einen.«
»Und die anderen?« Ich setzte mich neben sie. Sie duftete nach Wald, Wiesen, Lagerfeuer und einem Hauch Zitronenmelisse. Als sie sich vorbeugte, berührte sie mich fast mit der Krempe ihres Anglerhuts. »Die sagen, weil so viel in ihm versenkt worden ist.«
»Was?« Ich musste ziemlich begriffsstutzig wirken.
»Viel Dunkles. Niemand will in die Tiefe, um nachzusehen. Was einmal im Düstersee verschwindet, kommt nie wieder hoch.«
Ihre Stimme war fast zum Flüstern geworden. Sie wartete, ob ich verstand, was sie meinte, und als das nicht der Fall war, kehrte sie in ihre ursprüngliche Körperhaltung zurück und fächelte sich mit dem Papier, das sie in ihrer Hand hielt, etwas Luft zu.
»Die Sagen und Legenden der Uckermark«, scherzte ich.
»Man kann es natürlich auch als Hirngespinst abtun«, sagte sie kühl. »Wo finde ich Herrn Steinhoff?«
»Vermutlich hinterm Haus auf der Terrasse am See. Was ist das?«
Ich wies auf den Zettel in ihrer Hand.
»Nichts«, sagte sie schnell. »Etwas Persönliches. Passend zu diesem Abend und der Geschichte des Hauses.«
»Ich bringe Sie zu ihm.«
Sanja überlegte, dachte nach, wog die verschiedenen Optionen gegeneinander ab und erhob sich schließlich mit einem Nicken.
»Wohnen Sie im Dorf?«, fragte ich auf dem Weg zur Terrasse.
»Ja. Ich arbeite dort auch.«
»Was machen Sie denn?«
»Ich bin energetische Heilerin. Ich lehre, wie Sie Ihre Dämonen füttern.«
Sie blieb an der Tür nach draußen stehen und wartete auf meine Reaktion.
In meiner Praxis als Anwalt bleibt nichts Menschliches fremd. Jeder Mandant hat das Recht, ernst genommen zu werden. Vor einigen Jahren war eine Frau bei mir aufgetaucht, die bei ihrem Vermieter einen besseren Schallschutz durchsetzen wollte, weil sich auf dem Balkon die Geister der Verstorbenen jede Nacht lauthals stritten. Man braucht Fingerspitzengefühl, in solchen Fällen zu raten, es vielleicht mit einem Therapeuten zu versuchen. Sanja hingegen wirkte durchaus diesseitig. Aber man kann sich in Menschen täuschen.
»Meine Dämonen?«
Jemand hatte die Gartenfackeln angezündet. Ein Paar kam uns entgegen, offenbar weinselig genug, um im Haus nach einem diskreten Platz zu suchen.
»Ängste, Süchte, Sorgen, negative Gefühle – ich arbeite viel mit Identifikation und Visualisierung.«
Wir machten dem Paar Platz, das leise kichernd Richtung Empfangshalle wankte.
»Und es gibt so viele Dämonen in der Uckermark, dass es sich lohnt?«
»Sie würden staunen. Was machen Sie denn?«
Ich ließ ihr den Vortritt. Auf der Terrasse hatte sich mittlerweile die entspannte Stimmung ergeben, wie sie nach der Fütterung der Raubtiere herrschte. Aber es gab noch Grillwürstchen.
»Ich bin Anwalt in Berlin. Wollen Sie eins?«
Sanja rümpfte die Nase. »Ich bin vegan.«
Ich hatte nichts anderes erwartet. Aber mein Magen knurrte. Obwohl es hier offenbar üblich war, seine Gesprächspartner grußlos stehenzulassen, setzte ich zu einer kurzen Verabschiedung an, wurde aber rüde unterbrochen.
»Wie kommen Sie hier rein?« Steinhoff tauchte aus der Menge direkt vor uns auf. »Weg hier, sofort. Bevor ich Sie wegen Hausfriedensbruch anzeige!«
Ein paar der Leute, die in direkter Nähe standen, drehten sich irritiert um. Der Rest bekam nichts mit.
»Die Dame wollte nur einen Blick aufs Haus werfen«, sagte ich.
»O ja, die Nummer kenne ich, und sie zieht nicht bei mir.« Der Gastgeber streifte mich mit einem wütenden Blick, bevor er sich wieder an Sanja wandte. »Ihr könnt den ganzen See haben, jedes einzelne Schilfrohr! Aber Ihr habt nichts auf meinem Grund und Boden zu suchen! Verschwindet!«
»Vielleicht sollten Sie einmal einen Blick hierauf werfen.«
Sie faltete das Papier auseinander und hielt es Steinhoff unter die Nase. Ich konnte nicht erkennen, was sich darauf befand, aber er nahm es in die Hand, knüllte es zusammen und warf es in die Terrassenbepflanzung.
»Raus hier.«
»Wir wollen mehr als den See. Wir wollen Gerechtigkeit. Es wird Zeit, dass alle Welt erfährt, was damals wirklich hier passiert ist!«
Steinhoff drehte sich suchend um. Niemand tauchte auf.
»Wössner!«
Der Mann hinterm Grill legte die Zange ab, wischte sich mit den Händen über die Schürze und kam zu uns.
»Kurti!« Sanja musterte ihn von oben bis unten. »Ist es so eng bei dir, dass du hier arbeiten musst?«
Kurti war groß, schlank, weißhaarig und bestimmt zehn Jahre älter als Steinhoff, also nicht meine erste Wahl, wenn es um die Sicherheit auf diesem Gelände ging.
»Sanja«, begann er, wurde aber sofort von Steinhoff unterbrochen.
»Schaffen Sie mir diese Frau aus den Augen!«
»Aber …«
»Sofort! Ehe ich mich vergesse!«
Mittlerweile hatten fast alle, die sich in Hörweite befanden, ihre Gespräche unterbrochen, um kein Wort des Eklats zu verpassen.
Sanja lächelte. Sie war vom Dämonenfüttern wohl schlimmere Situationen gewohnt. »Sie sind ein Mörder, Steinhoff.«
Es war, als würde die ganze Partygesellschaft den Atem anhalten.
»Was?«, fragte er gefährlich leise.
»Ein Mörder.«
Ich stellte mich zwischen die beiden. »Sanja, es ist wirklich besser, wenn Sie jetzt gehen.«
Steinhoffs Pranke schob mich zur Seite. »Das bin ich nicht. Aber ich werde zu einem, wenn Sie sich nicht sofort verpissen!«
Es war das erste Mal, dass ich Steinhoff erlebte, wie er kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren.
»Nehmt euren Hokuspokus und lasst euch nie wieder blicken! Ihr habt Hausverbot, alle! Niemand betritt mein Eigentum ohne mein Einverständnis!«
»Herr Steinhoff!«, sagte ich laut. »Bitte! Die Dame wollte sowieso gerade gehen.«
»Die Dame …« Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte vor ihr ausgespuckt. »Die Dame macht, dass sie verschwindet. Wössner!«
Kurti ließ fast die Grillzange fallen.
»Schaff sie hier weg! Und such das Grundstück ab, ob sie nicht wieder jemanden eingeschleust hat, der sich an Bäume kettet oder meine Ruderboote versenkt. Das seid ihr nämlich: Terroristen! Grün angemalte Ökoterroristen!«
Wenn energetisches Heilen einem solch eine Ruhe verlieh, wie Sanja sie bei diesen Anfeindungen ausstrahlte, wollte ich mindestens drei Sitzungen. Steinhoffs Tirade perlte an ihr ab, und immer noch nistete ein kleines Lächeln in ihren Mundwinkeln. Sie drehte sich zu mir um.
»Danke. Ich finde allein hinaus.«
Damit schwamm sie über die Terrasse davon. Ich kann es nicht anders beschreiben: Dieses Schwebende, als gäbe es keine Schwerkraft, als flösse statt Blut Quecksilber durch ihre Adern, ließ sie im dichtesten Gedränge den Weg finden, ohne auch nur eine Person zu berühren.
Ich sah zu Steinhoff und erschrak. In seinen Augen stand der blanke Hass.
»Sie ist doch harmlos«, sagte ich.
»Harmlos? Diese Irre? Sie kennen sie nicht. Es fing an mit Ausräuchern und Geisterbeschwörungen, mit irgendeinem schamanistischen Unsinn, den sich nur Leute ausdenken, die zu viel Zeit haben. Und jetzt kommt sie mit irgendwelchem Gekritzel und …« Steinhoff brach ab und atmete tief durch. »Es ist heute Abend ein offenes Haus, da kann wohl jeder hereinspazieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn die Party vorbei ist, ist alles wieder dicht. Dann sind wir hier sicherer als in Fort Knox.«
»Sie hat Sie einen Mörder genannt.«
»Weil ich Bäume gerodet habe und dabei vielleicht auf einen doppelschwanzigen Schnarchkackler getreten bin.«
Er lachte, aber der Ton hatte eine minimale Dissonanz. Er merkte es, schlug mir auf die Schulter und tauchte ohne ein Wort des Abschieds in der Menge unter. Ich drängelte mich zum Grill und holte mir das letzte Würstchen.
Sicherer als Fort Knox. Niemand kam herein. Aber auch keiner heraus.
2
Nach Sanjas Rauswurf war ich zurück in die Eingangshalle gekehrt und hatte meinen Koffer geholt. Ich trug ihn hinunter zum Bootshaus, öffnete die Tür mit einer Zahlenkombination, die mir Steinhoff zuvor aufs Handy geschickt hatte, und richtete mich ein.
Aus dem alten Schuppen war ein äußerst modernes, kleines Gästehaus mit zwei Zimmern entstanden. Das vordere hatte er mit Küchenzeile, Frühstücksecke und Couchgarnitur sowie einer bodentiefen Glastür ausgestattet, die auf den Anleger führte. Keramikvasen von Hedwig Bollhagen lenkten den Blick auf ein Sideboard, es gab Leinenvorhänge, eine Stereoanlage und einen Flachbildmonitor. Der dunkle Teppich harmonierte mit den neu ausgelegten gekalkten Holzböden. Für kalte Nächte wartete ein Gaskamin auf seinen Einsatz. Alles wirkte neu und unbenutzt, soweit ich das beurteilen konnte. Im zweiten, zum nahen Wald ausgerichteten Zimmer standen ein Bett und ein Schrank, schlichtes Massivholz, Eiche hell. Frotteemantel, Hausschuhe und Handtücher lagen im Bad. Der Blick aus dem Fenster führte in grüne Finsternis.
Im Kühlschrank wartete eine Flasche Riesling. Ich öffnete sie, goss mir ein Glas ein und schnupperte – ebenfalls hervorragend. Damit trat ich hinaus auf den Anleger, aber erst, nachdem ich den Mechanismus der Fensterverriegelung durchschaut und sicherheitshalber mein Handy mit dem Code eingesteckt hatte.
Zwei Loungechairs und ein kleiner, quadratischer Tisch befanden sich dort. Unter dem Bootssteg schwappten die Wellen ans Ufer. Ringsum wuchs Röhricht, das den Blick zur Villa Floßhilde verbarg. Ich war mir sicher, irgendwo im Sideboard eine Furtwängler-Aufnahme des Rings zu finden.
Der Gartensessel, auf den ich mich setzte, kehrte dem Haus den Rücken zu. Musikfetzen und leises Gelächter wurden vom Wind ans Ufer getragen. Sonst war es still, bis auf das leise Schmatzen und Gurgeln der Wellen und den verschlafenen Gesang der letzten Vögel, ab und zu gekontert durch das Rufen eines Waldkäuzchens. Ich trank einen Schluck, lehnte mich zurück und vermisste Marie-Luise.
So lange, bis Stimmen sich näherten und mich aus meinen Betrachtungen hochschreckten. Die eine weiblich und flehend, die andere ärgerlich und männlich.
»Aber du kannst mich nicht einfach hängen lassen!«
Felicitas von Boden.
»Blödsinn.« Steinhoff, angetrunken. »Komm mir jetzt nicht so! Ein Deal ist ein Deal. Ein Wort ist ein Wort.«
»Das reicht nicht! Schon lange nicht mehr!«
»Dann halte dich an unsere Vereinbarung.«
»Aber ich bin ruiniert, wenn ich das mache!«
»Du hast dich selber ruiniert, vergiss das nicht.«
Als heimlicher Lauscher konnte ich nichts tun, um die Peinlichkeit der Situation nicht noch dadurch zu steigern, indem ich mich bemerkbar machte. Also rührte ich mich einfach nicht und hoffte, die beiden blieben so mit sich selbst beschäftigt, dass sie den Zeugen ihrer Auseinandersetzung nicht bemerkten.
Felicitas setzte zu einer Erwiderung an, aber Steinhoff hob die Hand, als ob er sie schlagen wollte. Sie schreckte zurück, es blieb bei der drohenden Geste.
»Es ist Schluss. Hörst du? Ende. Ich hab es satt. Wenn du denkst, das geht ewig so weiter …«
»Da irrst du dich aber«, erwiderte sie. »Vergiss nicht, was ich gegen dich in der Hand habe.«
»Nichts hast du. Du tust mir leid. Das ist alles. Du tust mir leid.«
Er wankte los, genau in meine Richtung, und brach sich Bahn durch Büsche und Rabatten, begleitet von ärgerlichem Grunzen und brechenden Zweigen. Seine massige Gestalt schälte sich aus dem Kirschlorbeer und erreichte schnaufend die zwei Treppenstufen zum Bootshaus.
Er schwankte, hatte also ordentlich einen sitzen. Als er mich auf dem Steg entdeckte, stieß er ein befriedigtes Schnaufen aus und wankte auf mich zu.
»Joe«, sagte er. Im nüchternen Zustand war ich Herr Vernau. »Du bist noch wach. Ich muss mit dir reden.«
Ich spähte in die Richtung, aus der er gekommen war. Felicitas war verschwunden. Er erklomm die Distanz zwischen Ufer und Steg und zog einen der Sessel so herum, dass wir uns gegenübersaßen. Dann ließ er sich fallen, atmete schwer und stierte nach unten, dort, wo das Wasser leise an die Pfähle klatschte. Zusammengesackt saß er da, denn die Sessel waren mehr nach Design denn Bequemlichkeit ausgesucht worden. Der untere Knopf seines Hemds hatte sich geöffnet, und ein Stück bleicher Bauch schimmerte in der Dunkelheit.
Mir schwante Böses. Vielleicht würde das jetzt jeden Abend auf mich warten: ein betrunkener Steinhoff, der hinüber zum Bootshaus ging und reden wollte.
Trotzdem fragte ich: »Ein Glas Wein?«
Er nickte und fuhr sich durch die derangierte Frisur. Ich ging ins Haus und kam mit einem weiteren Glas zurück, goss aber nur zwei Fingerbreit ein. Er nahm es an und leerte es in einem Zug. Dann sagte er unvermittelt: »Der Schlevogt muss weg.«
Das trieb ihn also um: der amtierende Kammerpräsident. Ich nickte verstehend. Schlevogt war ein Mann der Kompromisse, dem es immer gelungen war, die Kammer nach außen hin geschlossen zu vertreten. Für jemanden wie Steinhoff, der Diskussionen um Gender, Diversity und Frauenquote als neumodisches Gedöns abtat, ein feuerrotes Tuch.
»Du musst mir helfen.«
»Soll ich ihn um die Ecke bringen?«
Er sah mich aus trüben Augen an. »Kannst du das denn?«
Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass er meinen Scherz ernst nahm.
»Ich bin in dieser Hinsicht gerade ausgebucht«, erwiderte ich mit einem Grinsen, das der Situation die dringend benötigte Leichtigkeit geben sollte. »Aber im Herbst sind ja Wahlen.«
»Genau!«, trompetete er. »Deshalb muss ich mit dir reden. Du weißt, wem du deine Stimme gibst.«
Das wusste ich nicht, aber Steinhoff wäre es ganz bestimmt nicht. Deshalb schwieg ich, trank einen Schluck Riesling und drehte das Glas in meinen Händen.
»Also.« Er rückte auf die Vorderkante des Sessels, nah genug, um mir seine Hand aufs Knie zu legen. »Du bist doch mit den ganzen Linken so eng, mit der Hoffmann und so.«
Die Hoffmann und so waren Marie-Luise und ein Dutzend junge, aufstrebende Anwältinnen und Anwälte, für die seine Ära in die Steinzeit gehörte. Ich hielt mich aus diesen Ränkeschmieden heraus. Es war wichtig, in der Kammer ab und zu Präsenz zu zeigen, aber in das Gerangel um Posten und Funktionen mischte ich mich nicht ein. Marie-Luise übrigens auch nicht.
»Frau Hoffmann ist eine Freundin«, erwiderte ich, um ihm gleich jeden Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber er schürzte nur die Lippen, zog die Hand weg und lehnte sich zurück. Eben noch sturzbetrunken, kehrte er nun die Restbestände seines Kalküls zusammen.
»Genau die meine ich. Die stehen alle in den Startlöchern, wie die Hyänen. Wenn die ans Ruder kommen, dann Gute Nacht. Das müssen wir verhindern, auf jeden Fall.«
Dieses wir gefiel mir nicht. Es war exakt das, vor dem Marie-Luise mich gewarnt hatte: zwei Wochen Steinhoffs zweifelhafte Nähe und staatsemanzipatorische Zündeleien. Ich unterdrückte einen Seufzer.
»Also, Junge. Eine ganze Menge Leute sind auf unserer Seite. Wenn wir Berlin haben, ist es nicht mehr weit bis zur Bundeskammer. Und von da zum Verfassungsgericht. Jeder anständige Patriot sieht doch, dass dieses Land vor die Hunde geht. Die Linke hat uns voll im Griff. Medien, Politik, Verwaltung und Justiz.«
Ich hob die freie Hand. »Ich bin eigentlich hier, um Urlaub zu machen. Wenn Sie etwas anderes von meinem Aufenthalt erwarten, muss ich Sie enttäuschen.«
Er kniff die Augen leicht zusammen, um seinem getrübten Blick mehr Schärfe zu verleihen. »Was sollte ich denn von dir erwarten?«
»Dass ich Ihnen im Herbst meine Stimme gebe?« Ich siezte ihn deutlich, aber entweder merkte er das nicht mehr, oder ab einem gewissen Grad von Intimität und Trunkenheit duzte er alle.
Er lehnte sich abermals zurück und sah hinauf in den unfassbar schönen Sternenhimmel. Dann kam er mit einem Ruck wieder vor. »Ich setze auf Überzeugung, nicht auf Korruption. Wenn ich dich für jemanden gehalten hätte, der sich kaufen lässt, würde ich dir ganz andere Dinge anbieten.«
Ich fragte mich, was er Felicitas angeboten hatte und ob er ahnte, dass ich Zeuge ihrer Auseinandersetzung geworden war. Vielleicht tat er das, denn nach kurzem Nachdenken sagte er: »Ich kann das ganz gut unterscheiden.«
»Wer sich kaufen lässt und wer nicht?«, fragte ich.
Er nickte. »Das sind Leute, die nützlich sind. Aber ich verachte sie. Weißt du das? Ich verachte sie. Vor allem, wenn sie nicht zufrieden sind mit dem, was man ihnen bietet, und sie mehr wollen. Mehr und mehr und mehr … Du denkst, das ist eine Sache der Großstadt? Nein. Das gibt es überall. Und hier sind sie am schlimmsten.«
Er stierte auf die dunkle Wasseroberfläche.
»Das halbe Dorf gehört mittlerweile mir. Damals, als ihnen das Wasser bis zum Hals stand, habe ich ihnen geholfen. Und jetzt? Ist alles nicht mehr wahr.«
Langsam schüttelte er den Kopf.
»Das halbe Dorf«, sagte ich höflich. »Das ist eine ganze Menge für einen Mann.«
Aber er achtete gar nicht auf meinen Einwurf. Wer weiß, wo er mit seinen Gedanken war, er riss sich jedenfalls mit einem beherzten Klopfen auf die Schenkel aus ihnen heraus.
»Komm morgen zu meinem Vortrag. Vielleicht öffnet er dir die Augen. Überzeugung ist immer noch der bessere Weg.«
»Als?«
Er stand ächzend und schwankend auf. Noch bevor ich auf die Beine kam, um ihm zu helfen, hatte er sich schon wieder gefangen. Wie nicht anders zu erwarten, stolperte er grußlos in die Nacht.
Das halbe Dorf. Und die Anwaltskammer in Berlin dazu. Steinhoff machte sich die Menschen untertan und verstand nicht, warum nicht alle es liebten, beherrscht zu werden.
Es war still geworden in seinem großen Haus. Die Gäste waren gegangen oder hatten sich in ihre Zimmer zurückgezogen. Ich war zu faul, um auf die Uhr zu sehen, aber ich schätzte, dass Mitternacht noch nicht lange vorüber war. Etwas an meiner harschen Ablehnung störte mich. Er hatte ehrlich geklungen, nicht wie jemand, der mich tatsächlich für käuflich hielt. Ich ging ins Haus und holte mein Handy. Nach dem vierten Klingeln nahm jemand meinen Anruf an.
»Hallo?«, fragte ich. »Herr Steinhoff?«
Es raschelte und rauschte, als ob er sein Gerät wieder in die Jackentasche stecken würde, dann wurde die Verbindung beendet. Wahrscheinlich war es besser so. Entschuldigungen nach Mitternacht behielten selten ihre Gültigkeit bis zum Morgengrauen.
Aber das Gespräch mit ihm ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Steinhoff hatte vor, den langen Marsch durch die Institutionen anzutreten. Ganz im Sinne von Rudi Dutschke und Mao Tse-tung, allerdings mit entgegengesetzter Zielrichtung. Ich würde mir seinen Vortrag nicht anhören. Seine Überheblichkeit, die Welt in Blinde und Sehende einzuteilen, hatte mir schon genug die Augen geöffnet. Ich fragte mich, warum Sanja ihn einen Mörder genannt hatte. Aber bevor ich mich wieder ärgern konnte, dass ich ihn nicht danach gefragt hatte, wurde ich abgelenkt.
Ein leises, unterdrücktes Kichern war von der Mitte des Sees zu hören.
Ich stand auf, das Glas in der Hand, und lief bis zum Ende des Bootsstegs. Die Straßenlampen und Lichter vom gegenüberliegenden Nordufer schimmerten durch den sanften Nebel, der von der Wasseroberfläche aufstieg. Vielleicht waren noch ein paar Leute in Sonnenwalde schwimmen gegangen? Das Kichern kam näher. Ich drehte mich um und sah, dass ein Boot weitab vom Ufer trieb. Jemand musste Laternen auf ihm angezündet haben, die den kleinen Nachen beleuchteten – und die zwei nackten Körper, die sich eindeutig in großer Freude miteinander beschäftigten. Ich wollte mich gerade abwenden, als die oben sitzende Gestalt mich bemerkte und sich zu mir umdrehte. Es war eine junge Frau mit kurzen dunklen Haaren und einer sportlichen Figur. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, und hob das Glas zu einem kurzen Gruß. Die Person unter ihr schob sie zur Seite und richtete sich interessiert auf. Es war ebenfalls ein nacktes junges Mädchen mit schulterlangen, helleren Haaren. Mehr konnte und wollte ich nicht erkennen. Ich drehte mich um, und das amüsierte Lachen der beiden folgte mir bis ins Haus und, wenn ich ehrlich sein soll, auch noch bis in den Schlaf.
3
Es war ein luzider Traum. Einer, bei dem man weiß, dass man eigentlich nur aufwachen muss, und die Welt ist wieder in Ordnung.
War sie aber nicht.
Jemand schlich ums Haus.
Für ein paar gesegnete Momente lang verwob sich das Knacken und Rascheln der Zweige mit dem Kichern von jungen Frauen, dem Plätschern des Wassers beim sanften Anlegen eines Boots und dem klagenden Ruf eines Nachtvogels. Ich wusste nicht, wo genau ich mich in diesem Kaleidoskop befand. Saß ich im Boot und sah die Nixen des Sees tief unten im Wasser, die mich hinablocken wollten? War ich am Ufer und hatte mich verirrt in Düsterwalde, das kein Dorf mehr war, sondern ein finsterer Märchenhain, wo unter den gewaltigen Wurzeln der Bäume geheime Zugänge verborgen lagen, durch die man ins finstere Herz des Waldes gelangte?
Ich schreckte hoch. Vor dem Fenster, das ich für die Nacht geöffnet hatte, bauschte sich der leichte Vorhang im Wind. Zog ein Unwetter auf? Ich schlug die Decke zurück und hielt inne. Etwas trat heraus aus dem Hintergrundrauschen, das nicht hineinpasste. Der Rhythmus vorsichtiger Schritte, die sich näherten.
Es war dunkel im Zimmer, nur das matte Licht das Nachthimmels drang herein und ließ mich die Konturen der wenigen Möbel erkennen. Ich stand auf und schlich barfuß zum Fenster.
Die Schritte waren verklungen. Ich schob den Vorhang zur Seite, beugte mich heraus – und starrte einer Fratze ins Gesicht, die mir das Blut in den Adern stocken ließ. Wulstige Narben, ein feuerrotes Geäst auf blasser Haut, war es kaum noch als menschlich zu erkennen. Ein Auge fehlte, das andere war fast verschwunden. Es war ein Mann, groß und kräftig, und er sah aus, als hätte er Jahre auf dem Grund des Sees gelegen. Ein Untoter. Ein Zombie. Klatschnass und schlammverschmiert, vor Schreck keuchend, denn er schien genauso erschrocken wie ich. Das gab mir den Mut, ihn anzubrüllen.
»Wer sind Sie? Was machen Sie hier?«
Er drehte ab und rannte in den Wald. Ich schlüpfte in meine Schuhe, schnappte mir den nächsten Kerzenleuchter und rannte hinaus. Der Wassergeist war verschwunden.
»Hallo?«, rief ich ihm hinterher. Er sollte wissen, dass ich mich nicht vor ihm fürchtete. Aber schon nach ein paar Metern hinein in den Wald stieß ich an einen Zaun. Zwecklos, ihn weiter zu verfolgen.
»Hallo!«
Ich lauschte meinem Atem. Von diesem Wald ging etwas Unheimliches aus. Als würde er mit einem Mal tief Luft holen, bevor er sich um mich schloss. Geräusche und der schwere Geruch ließen ihn wie eine feindliche, unbekannte Welt erscheinen, in die man zu dieser Uhrzeit besser nicht seinen Fuß setzte.
Ich kehrte zum Bootshaus zurück. Der Mond war von Wolken verdeckt, doch ab und zu schimmerte er durch die grausilbernen Gebilde, und das Licht verlieh der Landschaft eine zeitlose Starre.