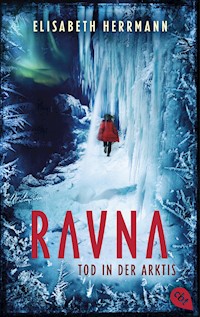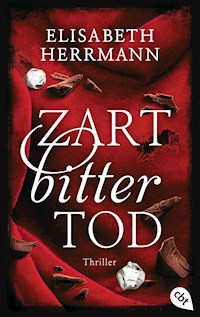9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Joachim Vernau
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eines Tages bekommt der Berliner Anwalt Joachim Vernau eine Betriebsprüfung. Zu seinem Erstaunen verbeißt sich der Beamte in eine Jahre alte Restaurantquittung – und liegt wenig später erschossen in Vernaus Büro. Die Polizei geht von Selbstmord aus, aber Vernau hegt Zweifel. Vor allem als er herausfindet, dass der Beamte heimlich im Fall einer prominenten Steuerfahnderin ermittelt hat, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war. Ein Netz aus Korruption und Gewalt zieht sich bis in die höchsten Kreise Berlins - und Vernau gerät ins Visier der Schattenmänner, die jeden aus dem Weg räumen, der ihre Kreise stört …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Ähnliche
Buch
Staatsanwältin Carolin Weigert steht kurz davor, einen riesigen Bestechungsskandal aufzudecken, und stirbt plötzlich einen rätselhaften Tod. Jahre später schickt das Finanzamt dem Berliner Anwalt Vernau einen Mitarbeiter zur Betriebsprüfung. Kurz darauf liegt der Mann erschossen in Vernaus Büro. Die Polizei geht von Selbstmord aus, aber Vernau hegt Zweifel. Vor allem als er herausfindet, dass der Beamte heimlich für die tote Staatsanwältin weiter ermittelt hat. Ein Netz aus Korruption und Gewalt zieht sich bis in die höchsten Kreise Berlins, und Vernau gerät ins Visier der Schattenmänner, die jeden aus dem Weg räumen, der ihre Kreise stört ….
Weitere Informationen zu Elisabeth Herrmann sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Elisabeth Herrmann
Requiem für einen Freund
Kriminalroman
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch
unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder
öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer
Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
©Yolande de Kort / Trevillion Images
CN · Herstellung: kw
Satz: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-21428-9V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Die Handlung und die Personen dieses Buches sind rein fiktiv.
Für Shirin
Ibi fas ubi proxima merces
Wo der Gewinn am höchsten, da ist das Recht.
Lucanus
Blick auf die Uhr: noch zwei Stunden.
Ich stehe auf der Terrasse im zweiundvierzigsten Stock des Peninsula Hotels in Hongkong. Die Luft ist feucht und heiß, eine Kombination, die ich nicht gut vertrage. Erst recht nicht nach dem Knock-out im letzten Jahr, den ich immer noch nicht ganz verwunden habe.
Livrierte Kellner bringen Drinks, irgendwo ist es immer siebzehn Uhr, aber ich halte mich an Wasser. Der Himmel ist bleigrau, die Sehnsucht nach einem Gewitter groß. Ich sollte hineingehen in die Welt hinter Glas. Klimaanlage, Pianomusik, abstrakte Kunst. Geschäftsreisende an ihren Laptops. Arabische Großfamilien. Ein paar verirrte Touristen, die irgendwo gelesen haben, dass man nicht Gast im Hotel sein muss, um hier oben einen Drink zu nehmen. Aber ich bleibe draußen, lasse mich an einem der Tische nieder und versuche, das alles zu begreifen.
Ich hier, mitten in dieser asiatischen Metropole, nach einem unüberlegten, von wilden Fantasien und Befürchtungen gedrängten Aufbruch. Nicht gerade der Ort, an dem ich mich noch vor wenigen Tagen vermutet hätte. Aber da saß ich auch noch am Schreibtisch in meinem Büro und dachte an nichts Böses, als es klingelte und dieser Mann vor mir stand, dieser Behördenmensch mit seinem Dienstausweis, und ein Drama von unfassbarem Ausmaß seinen Anfang nahm.
Stopp. Konzentration, bitte. Noch eine Stunde und vierundfünfzig Minuten. Dann werden sie kommen, und du musst Antworten parat haben, Argumente, Lösungsvorschläge. Verhandeln, Verständnis zeigen, Auswege anbieten. Am besten solche, bei denen es keine weiteren Opfer gibt. Das Leben eines Menschen hängt davon ab, was du in zwanzig Jahren als Anwalt gelernt hast. Also komm zur Sache. Geh alles noch einmal durch. Zeig ihnen, dass sie keine Chance haben. Es gibt nur die bedingungslose Kapitulation.
Und genau die werden sie nicht schlucken.
In Berlin ist es jetzt elf Uhr vormittags. Es ist bewölkt, aber es stehen andere Wolken am Himmel als hier. Ein unfreundlicher, kühler Vorfrühlingstag, an dem man überlegt, vielleicht doch noch den Wintermantel mitzunehmen. Es wird fast still sein. Nur die Verkehrsgeräusche dringen durch die geschlossenen Fenster. Ich müsste einen Schriftsatz ausarbeiten, eine Akteneinsicht anfordern, Rechnungen schreiben, Mandantengespräche führen. Stattdessen sitze ich im »duftenden Hafen« – so heißt Hongkong in der Landessprache – und warte auf einen Killer.
Reiß dich zusammen, Vernau. Du bist ein Unterhändler. Ein Mediator. Du vermittelst zwischen Justiz und Selbstjustiz, zwischen zwölf Jahren Knast in Deutschland oder der Todesstrafe in China. Er wird es einsehen. Ich muss nur gut genug argumentieren und ihm nachweisen, welche Fehler er begangen hat. Vielleicht komme ich dann lebend hier raus.
Mein Wasserglas ist beschlagen. Dicke Tropfen rinnen herab und bilden schon eine kleine, runde Lache auf dem Terrassentisch. Fokussiere dich. Geh noch mal alles durch. Mach ihm klar, dass es keine Rettung für ihn gibt. Beginne einfach mit dem ersten großen Fehler. Wenn all das hier vorüber ist, könnte ich einen Leitfaden für Mörder schreiben, eine Art Gesetzbuch der Gesetzlosen. Und der erste Paragraf trüge die Überschrift:
§ 1
Töte keine kleinen Hunde
1
Fangen wir an mit Carolin Weigert. Ihr Name ist vergessen, niemand außer denen, die sie persönlich gekannt haben, wird sich noch an sie erinnern. Das kollektive Gedächtnis ist löchrig wie ein Sieb. Dabei liegt die Sache nur ein paar Jahre zurück, sie ging durch alle Nachrichtensendungen, Zeitungen und Social-Media-Kanäle. Mit Fotos. Einige wenige seriöse Agenturen hatten den Anstand, wenigstens Weigerts Gesicht zu pixeln. Ihr Schicksal bewegte die Stadt und das Land, wurde aber ein paar Tage später von der nächsten Skandalmeldung abgelöst. Weigert … Carolin Weigert. Vierundvierzig Jahre alt, Single. Da war doch was …
Es hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge, wenn man ein paar weitere Namen nennt: Zumwinkel, Hoeneß und Schwarzer. Schon erhellen sich die Gesichter, und eine durchaus nachvollziehbare Genugtuung knipst ein Lächeln an: Ja! Da wurden doch endlich mal die Richtigen erwischt!
Carolin Weigert arbeitete als Staatsanwältin für Wirtschaftsstrafsachen am Kriminalgericht Moabit. Dazu muss man wissen: Berlin ist, was Geldwäsche und Steuerhinterziehung im großen Stil betrifft, nur bedingt ein place to be. Ich rede nicht von den kleinen Fischen, sondern den großen Haien. Die tummeln sich lieber da, wo es warm ist und der Sozialneid nicht so groß.
Deutschland liegt zwar mit so ehrenwerten Staaten wie dem Libanon, Bahrain und natürlich der Schweiz weit vorne im Ranking der internationalen Steueroasen. Aber sein Geld versteckt man nur ungern in einer bankrotten, rot-rot-regierten Stadt. Trotzdem war Carolin Weigert eine Art stille Berühmtheit in gewissen Kreisen. Wenn sie sich in einen Fall verbissen hatte, ließ sie nicht mehr los. Sie ließ den Neuköllner Autohändler, der sein Schwarzgeld im Kofferraum spazieren fuhr, genauso einbuchten wie den Drei-Sterne-Koch. Sie ahndete gnadenlos Konzertveranstalter wie Eisverkäufer, machte weder vor Politikern noch Handwerkern halt, und jeder, der es mit ihr zu tun bekam, wusste, aus dieser Chose kam er nicht mehr heraus. Ihre Erfolgsquote war einzigartig, ihre Unbeliebtheit auch. Sie war unangreifbar, unbestechlich, gnadenlos. Doch dann geschah etwas, das diese geradlinige, in stetem Winkel nach oben weisende Karriere beendete. Gut vier Jahre ist es her, dass das Blatt sich zu ihren Ungunsten wendete. Weigert, die Unangreifbare, die in Drachenblut Gebadete – sie war verwundbar.
Es gibt ein Foto von ihr aus jener Zeit, das ich nicht vergessen habe. Sie verlässt die Staatsanwaltschaft durch einen Seiteneingang und versucht, das Gesicht mit einer Zeitung zu schützen. Ihre Kleidung wirkt wie von einem Stylisten für Netflix-Anwaltsserien: teuer und perfekt. Durch die offenen, schulterlangen Haare fährt ein Windzug, sie wirkt wie Amal Clooney auf dem Weg zur nächsten Verhandlung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie ist cool, man kann es nicht anders sagen. Cool und eine Augenweide, in Berlin kann das schon ein Grund sein, die Messer gegen sie zu wetzen. Den Hund hatte sie nicht dabei.
Wie aus der Boulevardpresse zu erfahren war, hatte sie ihn sich erst ein paar Tage später angeschafft. Einen reinrassigen Dobermann-Rüden, der dominanteste seines Wurfs, für knapp zweitausend Euro von einem brandenburgischen Züchter erstanden, der auch Rottweiler und Rhodesian Ridgebacks anbot. Der Hund war gerade mal acht Wochen alt, noch nicht stubenrein und brauchte »eine starke Hand«, um nicht zu einer tickenden Zeitbombe heranzuwachsen. Weitere Bedingungen, außer Barzahlung ohne Quittung, stellte der Züchter nicht. Es ist erstaunlich, dass Carolin Weigert sich darauf einließ, zweitausend Euro schwarz zu zahlen, aber vielleicht hatte sie sich den Mann auch nur still für eine spätere Sanktion vorgemerkt, zu der es nicht mehr kommen sollte.
Da war ihr Leben bereits aus den Fugen geraten. Äußerlich merkte man ihr das nicht an. Sie erledigte ihren Job, sie funktionierte, aber es gibt aus dieser Zeit zwei Anzeigen gegen unbekannt, die beide ohne Erfolg geblieben sind. Carolin Weigert fühlte sich verfolgt. Es begann mit den zerschnittenen Reifen ihres Autos, setzte sich fort mit anonymen Anrufen, dazu verschwanden wichtige Akten aus ihrem Büro. In der Tiefgarage hatte ihr ein Mann aufgelauert, aber sie konnte nicht erkennen, wie er aussah. Sie hatte ihn als bedrohlich empfunden, aber der Beamte, der die Anzeige aufnahm, konnte mit diesen Angaben keine Fahndung ausschreiben.
Mitarbeiter beschwerten sich über sie. Sie sei unkonzentriert und aggressiv. Mehrfach suchte sie den Arzt auf, weil Schwindelattacken und Übelkeit sie plagten. Die Kantine betrat sie nicht mehr, ihr Essen nahm sie abgepackt von zu Hause mit. Als sie eines Abends nach Hause kam, musste sie feststellen, dass sich jemand Zugang zum Schlafzimmer verschafft und in ihr Bett ejakuliert hatte.
Die herbeigerufenen Beamten rieten ihr, sich eine Alarmanlage anzuschaffen. Die Polizistin musste aufs Klo, und als sich die beiden verabschiedeten, lag etwas Unausgesprochenes in der Luft. So wie ein Vorwurf, den man nicht machen will, oder ein Hinweis auf einen Fleck, den man zwar sieht, sich aber nicht traut anzusprechen.
Erst nachdem sie gegangen waren, checkte Carolin Weigert, dass der Einbrecher auch in ihrem Badezimmer gewesen war. Er hatte nichts gestohlen, sondern etwas dagelassen. Im Waschbeckenschrank hinter dem Spiegel lagen zwei angebrochene Packungen Psychopharmaka. Sie kannte die Medikamente nicht, aber die Polizistin musste sie gesehen haben. Sie konnte sich denken, was die beiden Beamten auf dem Weg zurück auf die Wache miteinander besprachen: völlig durchgeknallt, weiß nicht mehr, mit wem sie die Nacht verbracht hat …
Carolin Weigert musste da bereits ahnen, wer hinter diesen Angriffen steckte. Doch sie war noch klar – und klug – genug, um zu erkennen, dass ein reiner Verdacht nicht ausreichte. Sie musste verdeckt ermitteln und Beweise zusammentragen. Vor allem aber musste sie überleben. Sie erkannte: Die Einschüchterungsversuche erreichten von Mal zu Mal ein höheres Level. Noch nicht mal mehr der Generalstaatsanwalt glaubte ihr noch. Auf der Polizei die dämliche Frage: Haben Sie Feinde? Natürlich! Als Staatsanwältin für Wirtschaftsstrafsachen sammelte sie Feinde wie Panini-Bilder. Aber die saßen hinter Gittern oder führten ein Leben, in dem sie sich sogar für eine Kugel Eis eine Quittung geben ließen, um bloß nicht noch einmal in Carolin Weigerts Mühlen zu geraten. Es ging um etwas ganz anderes, und ich begriff erst viel später die ganze Tragweite: Sie war einer Sache auf der Spur, die sich mit Zumwinkel, Hoeneß und Schwarzer messen konnte. Die im politischen und wirtschaftlichen Berlin keinen Stein mehr auf dem anderen lassen würde. Aber irgendjemand hatte davon Wind bekommen, und die berufliche und private Demontage einer der qualifiziertesten, unbestechlichsten Fahnderinnen hatte ihren Anfang genommen.
Erzählen Sie das mal einem schlecht gelaunten Bereitschaftspolizisten nach einer harten Nacht. Er wirft einen Blick in seinen Computer und sieht auf einen Blick, dass die Frau, die ihm gegenübersitzt, seine Kollegen schon mehrmals mit falschem Alarm auf die Schippe genommen hatte. Dass sie stammelt, ab und zu verwirrt wirkt, und das Glas Wasser mit der Begründung ablehnt, sie wäre nicht dabei gewesen, als es eingegossen wurde.
»Schaffen Sie sich einen Hund an.«
Das war der einzige Rat, mit dem Carolin Weigert etwas anfangen konnte.
Sie nannte ihn Tobi. Obwohl sie wusste, dass der Name eher zu einem verspielten kleinen Wesen passen würde als zu einem muskelbepackten Rüden, der er in ein paar Monaten sein würde. Mutig, loyal und angstfrei. Sie kam wieder gerne nach Hause, und sie dachte nicht im Traum daran, ihre Ermittlungen gegen die Verdachtspersonen einzustellen. Sie war nur vorsichtiger geworden, inner- und außerhalb ihrer eigenen Behörde. Auch wenn es ihr von Tag zu Tag schwerer fiel, sich zu konzentrieren. Zu dieser Zeit ernährte sie sich nur noch von abgepackten Müsliriegeln, die sie jedes Mal in einem anderen Bio-Supermarkt kaufte. Es gab noch Menschen, denen sie vertrauen konnte. Nicht viele, eigentlich nur einen einzigen, den sie nie ganz ernst genommen hatte. Aber der ihr in den letzten Wochen zu einer großen Stütze geworden war. Aber der konnte ihr auch nicht mehr helfen an diesem Freitag, dem dreizehnten März vor vier Jahren.
Es gibt keine Zeugen, und die Überwachungskameras hatte sie ausgeschaltet, als sie nach Hause gekommen war. Eindeutig in den Akten belegt ist, dass sie gegen neunzehn Uhr noch einmal die Wohnung verließ, sich hinters Steuer setzte und den Motor startete, noch bevor das Garagentor hochgefahren war. Dass Tobi vermutlich auf dem Rücksitz lag und später zu ihr gekrochen sein musste, als klar war, dass keiner von beiden das Auto mehr lebend verlassen würde. Dass die Zentralverriegelung zuschnappte und die Abgase über einen umfunktionierten Staubsaugerschlauch ins Wageninnere gelangten. Dass es ein Selbstmord war, so steht es in den Akten. Heute noch. Vermutlich psychische Probleme. Im Haus fand man Psychopharmaka und einen Abschiedsbrief. Im Wagen, am nächsten Morgen, Carolin Weigerts Leiche und einen toten Hundewelpen.
Es sagt eigentlich eine ganze Menge über unsere Gesellschaft, dass der grausame Tod des kleinen Hundes in den kommenden Tagen mehr Gemüter bewegte als eine tote Staatsanwältin. Ich erinnere mich noch, dass ich die Schlagzeilen las und mich fragte, wer so etwas durchgehen ließ: »Musste Tobi leiden?« Mein alter Kumpel Marquardt, der mittlerweile alle Delikte, auch solche, die es noch gar nicht gab, in seiner Kudamm-Kanzlei bearbeitete, hatte sie gekannt. Wir unterhielten uns darüber, ein paar Tage, ein paarmal, dann wurde Carolin Weigerts einsamer Tod vom Alltag eingeholt, an den Rand gedrängt und schließlich vergessen. Aber ich erinnere mich noch an eine U-Bahn-Fahrt kurz nach dem Bekanntwerden der Tragödie. Zwei ältere Damen, wahrscheinlich auf dem Weg zum Konditor, unterhielten sich über die Schlagzeile.
»Wer schafft sich denn erst einen Hund an und bringt sich dann um?«
»Das arme Tier.«
»Ja. Das arme Tier.«
Ich denke, Tobi hat seine Treue und Loyalität auch posthum noch unter Beweis gestellt. Er war, meine Freunde, euer erster großer Fehler. Und ihm sollten weitere folgen. Denn wenn eine Tat nur um der Vertuschung willen geschieht, dann darf das Motiv niemals mehr das Licht des Tages sehen. Ihr dachtet, es wäre mit Carolin Weigerts Tod ausgestanden. Ihr hattet vier Jahre lang Ruhe und Zeit zum Vergessen. Nie hättet ihr geglaubt, dass jemand wie ein Maulwurf beharrlich in der Dunkelheit gräbt und gräbt und gräbt.
Und damit meine ich nicht mich. Vorläufig wenigstens.
2
Für mich begann die ganze Geschichte damit, dass ich gerade dabei war, nach einer schlimmen Zeit im Krankenhaus (und nicht nur da) wieder auf die Beine zu kommen. Dazu gehörte, mein Leben neu zu ordnen, privat und beruflich. Privat gab es da nicht viel, beruflich musste ich eine Menge besänftigende Telefonate und komplizierte Korrespondenzen führen. Aber die meisten wussten Bescheid. Auf die Buschtrommeln ist selbst in Berlin Verlass. Ich hatte ein eigenes Büro, es Anwaltskanzlei zu nennen wäre vielleicht übertrieben, aber es gab wieder Fälle und Mandanten, und die ganze Herrlichkeit des Lebens und das Geschenk, dem Tod so haarscharf entronnen zu sein, gipfelte in der Bearbeitung von Eigentumsdelikten, Schwarzfahren und leichter Körperverletzung. Also genau das, was man einem Rekonvaleszenten wie mir zumuten konnte.
Die Post bestand hauptsächlich aus Rechnungen, die ich bezahlen musste, und Rechnungen, die meine Mandanten mit fantasievollen Entschuldigungen nicht bezahlen wollten. Ich war wieder dort, wo ich schon vor zehn Jahren gewesen war, nur dass der Zauber des Anfangs vom Fluch der Wiederholung getrübt wurde. Ich fühlte mich wie in einer Warteschleife, und jedes Mal, wenn es so klang, als ob in der Leitstelle Leben jemand rangehen würde, begann nach einem vielversprechenden Knacken und Rauschen das ewig gleiche Dudeln wieder von vorn.
Ich war an jenem Tag in Eile. Frühmorgens nichts Ungewöhnliches. Ich hatte mir in der Küche unserer Bürogemeinschaft einen Kaffee geholt und wie so oft unserer alten, asthmatischen Trägermaschine hinterhergetrauert. Um sie hatten Marie-Luise und ich gestritten wie ums Sorgerecht für den Familienhund. Ich hatte nachgegeben, und sie konnte jetzt ihre von glücklichen bolivianischen Pflückern geernteten Bohnen in ihrer Hinterhofbutze zu so viel dunklem, duftendem Espresso verarbeiten, wie sie wollte. Der Verlust war noch nicht verarbeitet. Sie hatte mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, und wer jetzt rätselt, was ich damit meine – Marie-Luise oder die Kaffeemaschine? –, dem muss ich beipflichten, dass es mir genauso geht. Vor allem abends, wenn aus den anderen Büros junge Menschen mit seltsamen Kopfbedeckungen hinausschwärmen ins Berliner Nachtleben, sich die Klinke in die Hand geben mit denen, die gerne nachts im geisterhaften Licht ihrer Laptops und riesigen Monitore arbeiten, ein stetes Kommen und Gehen, eine freundliche Unverbindlichkeit, ein locker gewebtes Netz, an den Knotenpunkten durch gemeinsame Projekte verbunden, die Wanderarbeiter der neuen Zeit, das Prekariat der Information Technology. Ich fühlte mich manchmal wie ein Relikt aus den Anfängen des Manchesterkapitalismus. Einer, der den Anschluss verliert an all das Neue. An meinen Schreibtisch war ich durch einen ganz altmodischen Aushang gekommen, Coworking Space, wöchentlich kündbar, nichts auf Dauer, aber wer wollte das schon in Berlin haben? Wir arbeiteten nebeneinander her. Ich gewöhnte mich ziemlich schnell an diesen Zustand und daran, der Älteste von allen zu sein. Immerhin hatte ich bei Computerproblemen sofort jemanden zur Seite.
Der Brief, den ich also an einem hastig durchschrittenen Morgen in meinem Eingangsfach fand, kam vom Finanzamt Wilmersdorf, bei dem ich immer noch geführt wurde. Ein Umschlag aus grauem Recyclingpapier, Portostempel, Absender im Sichtfenster. Genau die Sorte Post, mit der man sich als Letztes beschäftigen möchte. Als Volljurist hatte ich gleichzeitig mit dem zweiten Staatsexamen auch die Prüfung zum Steuerberater abgelegt, deshalb hatten Marie-Luise – ebenfalls Volljuristin, man wollte es manchmal nicht glauben – und ich unsere Jahresabschlüsse immer selbst gemacht. Als wir noch eine Kanzleipartnerschaft hatten, war das stellenweise in ein verbales Gemetzel ausgeartet, denn natürlich war ich derjenige, der seine Belege ordentlich aufbewahrte, während sie das Schuhkartonsystem aus Studentenzeiten bevorzugte. Nur einer von vielen Gründen, weshalb wir seit einiger Zeit getrennte Wege gingen und ich mir täglich aufs Neue sagte, dass dieser Zustand von klinischer Ordnung, in dem sich mein Arbeitsleben gerade befand, genau das war, wonach ich mich jahrelang gesehnt hatte.
Der Brief war dünn und außergewöhnlich, denn eigentlich sollte es ein paar Monate Ruhe geben. Das vorvergangene Jahr war abgesegnet, für das vergangene hatte ich Zeit bis Jahresende. Es lag also kein Grund vor, Post vom Finanzamt zu erhalten. Er konnte nur zwei Dinge bedeuten: Ich bekam aus unerfindlichen Gründen Geld zurück, oder das Finanzamt wollte welches. Ich riss den Umschlag auf – besser, man hat es hinter sich.
Nach den ersten Sätzen war mir klar, dass es nicht nur um die Negativbilanz dieses Tages, sondern die der kommenden Wochen ging. Eine Prüfungsanordnung für die letzten vier Jahre, die in der Amtsstelle begann und als Außenprüfung in meinem Büro fortgesetzt werden würde. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff: eine Betriebsprüfung.
Der Mann oder die Frau würde nächste Woche hier auftauchen, sich mit Dienstausweis vorstellen und einen »geeigneten Arbeitsplatz sowie die erforderlichen Hilfsmittel« erwarten.
Holy shit.
Es war kaum auszudenken, was mich erwartete. Die letzten vier Jahre! Jede Rechnung, jede Kontobewegung, jede Quittung würden kontrolliert werden. Alles musste vorliegen. Fahrscheine. Restaurantbelege. Nachweise für Kopierpapier und Druckerpatronen. Das Finanzamt würde mein berufliches Dasein komplett auf den Kopf stellen und durchleuchten. Damit hätte ich vielleicht noch umgehen können, bis mir einfiel, dass ich dieses Dasein mit jemandem geteilt hatte.
Reflexartig, wie immer, wenn die Leitstelle Leben mir den Mittelfinger zeigt, rief ich Marie-Luise an.
»Vernau? Hey! Wie geht es dir?«
Sie klang etwas außer Atem. Den Hintergrundgeräuschen nach zu urteilen befand sie sich an einer dicht befahrenen Kreuzung.
»Gut. Danke. Also nicht gut, eigentlich.«
»Was ist?«
»Ich habe eine Betriebsprüfung. Und wenn ich ich sage, dann meine ich: wir.«
Schweigen. Es hupte, Menschen riefen, irgendjemand brüllte in ein Megafon. Es war Freitag. Andere haben Yoga-Termine. Marie-Luise ging auf Demos.
»Wie? Wir?«
»Es geht um die letzten vier Jahre. Davon waren wir zwei in einem gemeinsamen Büro aneinandergekettet. Du erinnerst dich?«
»Jep. Vage. Wie an einen Unfall, den man am liebsten verdrängen möchte.«
»Geht mir genauso. Was soll ich der Amtsperson sagen?«
Fischer, stand unter dem Schreiben. U. Fischer.
»Einspruch.«
»Gegen eine Betriebsprüfung? Ich kann sie schieben. Aber nicht verhindern. Und das auch nur mit wichtigen Gründen. Nenn mir deine wichtigen Gründe.«
»Ähm …«
»Sehe ich ähnlich. Dieser Fischer, Mann oder Frau, kommt nächste Woche.«
»Was?«
»Also, bis dahin bitte alle Unterlagen der letzten vier Jahre zu mir.«
»Moment. Vernau, sorry, aber du hast den Dreck am Schuh, nicht ich.«
Ich hätte genauso reagiert. Was die Gegenseite niemals merken darf.
»Da, werte Frau Hoffmann, befinden Sie sich in einem Ereignistatbestandsirrtum. Wir hatten eine Bürogemeinschaft. Du erinnerst dich?«
Schweigen. Irgendjemand in der Nähe von Marie-Luise brüllte Parolen in sein Megafon, die etwas mit Umwelt, Klimakatastrophe und dem Bauernstand zu tun hatten. Ich sprach besonders laut und deutlich.
»Egal, was dir dein Therapeut weismacht, ich brauche die Unterlagen. Und zwar geordnet, mit sämtlichen Originalen. Bis Montag.«
»Nee, Vernau. Wirklich?«
»Bis Montag.«
Eine Trillerpfeife legte los und zerfetzte mir fast das Trommelfell. Ich legte auf und suchte in meinem Gedächtnis nach den angesagtesten Demos des heutigen Tages. Berlin bietet auch in dieser Hinsicht für jeden Geschmack etwas. Schüler gegen den Klimawandel, Enteignung von Wohneigentum, mehr Fahrradwege, weniger Kopftuchmädchen. Jeder konnte im Herzen der Hauptstadt den Verkehr lahmlegen und seine Wünsche an das Universum der genervten Umwelt entgegenschleudern.
Herr oder Frau Fischer hatte sein oder ihr Kommen für Mittwoch nächste Woche avisiert. Früh am Morgen, wenn man Beamtenarbeitszeiten zugrunde legt. Geeigneter Arbeitsplatz vorausgesetzt, für den ich auch noch zu sorgen hatte. In meinem Büro standen ein Schreibtisch und zwei Stühle. In den anderen Räumen der Etage sah es nicht anders aus. Ich verließ den Raum und kam über einen Flur in die offene Küche, die wir Co-Worker uns teilten. Genau wie den Konferenzraum. Meine Hoffnung, er wäre wie durch ein Wunder ab Mittwoch frei, erfüllte sich natürlich nicht. Meine Mitmieter hatten sich bereits eingetragen. Es waren zwei Start-up-Unternehmen, beide im Bereich veganer Fertiggerichte und klimaneutraler Auslieferung unterwegs. Dann hatten wir noch einen irgendwie hungernd aussehenden britischen Wirtschaftsjournalisten unter uns, der in ständiger Angst vor der Abschiebung lebte, und eine junge Koreanerin, die kurz nach mir eingezogen war, von der keiner genau wusste, was sie eigentlich machte und gegen die wir den Verdacht hegten, in ihrer Bürobutze zu wohnen. Was ihr bei den Mietpreisen, die mittlerweile in Berlin verlangt wurden, keiner richtig übelnehmen konnte. Ich zahlte für meine zwanzig Quadratmeter mit Concierge und ständig ausgebuchtem Konferenzraum mehr, als unsanierte Sechs-Zimmer-Altbauwohnungen in Kreuzberg noch vor einigen Jahren gekostet hatten.
Der Brief kam erst einmal in die Ablage, und dort blieb er, bis ein ereignisloses Wochenende vorüber war.
Am Montagnachmittag tauchte Marie-Luise auf. Wie immer eine irgendwie fliegende, ätherische Gestalt, auch wenn sie versuchte, sich mit Cowboystiefeln und nietenbeschlagenen Gürteln etwas mehr Erdschwere zu geben. Die roten Locken trug sie schulterlang und offen, an ihren Handgelenken klimperten tibetische Gebetsarmbänder und vermutlich dem Klang nach ausgesuchter weiterer Silberschmuck. Sie schien eine Back-to-the-roots-Phase zu haben, denn der Strickmantel sah aus, als hätte er schon Generationen von Open-Air-Festivals überlebt, und die lederne Umhängetasche war blank gewienert vom Gebrauch. Was man bei all dem alternativen Gedöns schnell übersehen konnte – sie brauchte nur den Strickmantel auszuziehen und sich einen Blazer überzuwerfen, die Haare zurück und drei Pfund Silber weg, schon stand man einer durchaus attraktiven und halbwegs seriös wirkenden Anwältin gegenüber. Offenbar hatte sie heute keinen Termin mehr am Gericht und sich deshalb bereits am frühen Nachmittag in ihr Coachella-Outfit geworfen.
»Hier bist du also gelandet.«
Die Hände in die Taille gestützt, mit skeptischem Blick und mäkelig verzogenen Lippen sah sie sich um.
»Jep.«
»Gab’s nichts anderes?«
»Nope.«
Ich sagte das wie Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und fühlte mich immer ziemlich cool damit. Sogar mein Zurücklehnen in den Schreibtischsessel und das Zusammenlegen der Fingerspitzen, das leichte Hin- und Herdrehen, dabei sein Gegenüber nicht aus den Augen lassen, gab mir, wie ich fand, etwas Filmreifes. Sie runzelte die Stirn, verkniff sich aber einen weiteren Kommentar. Stattdessen trat sie ans Fenster und suchte einen Griff. Den gab es natürlich nicht. Wie alle Bürohäuser der Neuzeit, und damit meine ich die letzten Jahrzehnte, waren die Fassaden in Fertigbauweise hochgezogen worden. Für individuelle Wünsche wie Frischluft hatte es keinen Platz gegeben. Vielleicht wollte man auch nur das Sicherheitsrisiko verkleinern. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es das, was mich an dieser Bürosituation am meisten nervte: Alles war geradlinig, leicht zu reinigen, effizient und suiziderschwerend.
»Das ist …«
Sie führte nicht näher aus, was sie damit meinte. Sogar die Wände waren keine Wände, sondern verschiebbare Trennelemente. Ich hatte Schränke, aber keine Möglichkeit, auch nur einen Nagel einzuschlagen. Es war ihr anzusehen, was sie von dieser Art Käfighaltung hielt.
»Ich steh im Halteverbot. Man kriegt ja nirgends mehr einen Parkplatz.«
»Wir haben eine Tiefgarage.«
»Hab ich gesehen, ist mir zu teuer. Die zwei Minuten … kommst du mit runter?«
»Klar.«
Ich schnappte mir Mantel und Chipkarte, dann verließen wir mein Reich. Marie-Luise linste begehrlich in die Kaffeeküche – Obst, Croissants, ein gut bestückter Kühlschrank mit Preisliste, aber ich wollte es hinter mir haben.
»Brauche ich eine Sackkarre?«
»Quatsch.«
Wir liefen zum Lift.
»Es sind nicht mehr als vier Ordner. Und dann hab ich noch zwei Kisten mit irgendwelchem Zeug. Ich glaube, die Originale. Oder Sachen, die ich in die Steuererklärung reingeschrieben, aber nicht angeheftet habe.«
Wir waren getrennt veranlagt, aber es gab enorme Überschneidungen. Zum Beispiel hatte immer der die Miete bezahlt, der mehr eingenommen hatte im Monat.
»Wie?«, fragte ich. Mir schwante Böses. »Reingeschrieben, aber nicht angeheftet?«
»Keine Ahnung.« Sie drückte auf den Knopf. »Ist doch alles durchgegangen bisher.«
»Bisher. Ja. Warte mal ab, was Prüfer alles beanstanden.«
»Warum machst du dir im Vorhinein eigentlich so viele Sorgen? Vielleicht sind sie ja ganz nett.«
Ich hatte noch nie von netten Betriebsprüfern gehört.
»Sie tun auch nur ihren Job«, fuhr sie fort. In der Tonlage, mit der man Pferde vorm Kastrieren beruhigt. »Im Übrigen bin ich absolut für Steuergerechtigkeit. Also, von mir können sie haben, was sie wollen. Mein Herz ist rein.«
»So.«
Die Fahrstuhltüren öffneten sich, die Kabine war leer. Auf dem Weg nach unten versuchte ich, ihr reines Herz mit meiner Sicht der Dinge nicht zu sehr zu schocken.
»Ich erinnere dich an die Schublade.«
Erstaunt sah sie mich an. »Welche Schublade?«
»In der du das Geld für deine kostenlosen Mietberatungen gebunkert hast.«
»Wie bitte? Das waren Spenden!«
»Quittung?«
»Was denn für eine Quittung, wenn ich sie eins zu eins weitergebe?«
»An wen?«
»Sag mal, bist du jetzt unter die Inquisitoren gegangen?« Sie pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Sie haben dich in der Mangel, nicht mich. Das ist echt ein Gefallen, den ich dir tue.«
Ich sah das anders. Sie ritt mich mit ihrer Buchhaltung nur noch tiefer in den Morast. Aber es hatte keinen Sinn, das mit einer linken Miet- und Familienrechtsanwältin in einem Aufzug zu thematisieren.
Ihr Wagen stand auf dem Bürgersteig. Immer noch ein alter Volvo. Diese Treue rührte mich. Vor allem, als sie den verbeulten Kofferraum nicht aufbekam und ich ihr half. Es war wie früher.
Was ich sah, überstieg meine schlimmsten Befürchtungen.
Ich blickte auf offene Kartons, aufeinandergeworfene Aktenordner, dreckige Gummistiefel, Leergut, eine brüchige Yogamatte und andere unidentifizierbare Gegenstände, die offenbar seit der Erstzulassung des Wagens nicht mehr das Licht der Sonne gesehen hatten.
»Warst du …« Ich zog den obersten Ordner heraus, der bis zum Bersten gefüllt war, und es geschah, was geschehen musste: Die Träger hielten nicht mehr. Drei Kilo Papier klatschten auf den Boden.
»Vernau! Pass doch auf!«
Wir gingen in die Hocke und versuchten, von dem nassen, dreckigen Pflaster zu retten, was zu retten war. Ihre Hände flogen zu den Papieren, stapelten sie aufeinander und stopften sie zurück zwischen die Pappdeckel. Ihre Haare kitzelten mich, als wir zusammen unter den Auspuff krochen, um Thermodrucke und Belege einzusammeln. Ich roch ihr Parfum, nicht mehr so schwer wie früher, ein leichter, angenehmer Duft von Weißem Moschus und Patschuli. Ich hatte den Impuls, in dieses Auto einzusteigen und mit ihr loszufahren, irgendwohin. An die Ostsee von mir aus oder einen dieser bleigrauen brandenburgischen Fischweiher. Einfach nur raus. Einfach Sonne. Die Scheiben runter, den Fahrtwind im Haar. Neuland unterm Pflug. Frei. Unschlagbar.
Man hatte solche Impulse, wenn man unvorbereitet auf Marie-Luise traf. Ich hätte mir vor unserer Begegnung besser vor Augen gehalten, warum es gut war, dass wir genau diese Dinge nicht mehr taten.
»Echt jetzt?« Sie hielt ein verdrecktes, nasses Papier hoch und betrachtete es mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Die Rechnung an Marquardt! Er hat sie immer noch nicht bezahlt! Jedes Jahr schicke ich sie ihm, und nie kommt was. Drecksack.«
Ich nahm ihr das Schreiben aus der Hand. Es ging um den Fall Otmar Koplin, und der war fast zehn Jahre her. Ich hatte mich nach dem Urteil »Lebenslänglich« nicht mehr um ihn gekümmert.
»Ist er raus?«, fragte ich und merkte, dass meine Stimme belegt war. Lebenslänglich, damit war man in diesem Alter eigentlich nach ein paar Jahren wieder auf freiem Fuß.
»Er ist gestorben.«
Ich reichte ihr das Papier zurück. Sie sah mich an mit schmalen Augen, rätselhaft, ein bisschen wie eine Meerjungfrau, die nicht wusste, ob sie ihr Gegenüber ignorieren oder ertränken sollte.
»In der Haft. Er war krank. Ich hab ihn ein paarmal besucht. Er ist in Görlitz begraben, anonym. Er wollte das so.«
Vorsichtig nahm sie mir die Rechnung ab, legte sie auf den Ordner und strich sie glatt.
»Unser ganz großes Ding«, sagte sie. Es klang tatsächlich wehmütig.
»Unser ganz großes Ding«, wiederholte ich. Der Verkehr auf der Torstraße brandete um uns herum, Fußgänger warfen uns zornige Blicke zu. Aber Marie-Luises Wagen, gepaart mit ihrer Erscheinung, bekam in dieser Gegend noch so etwas wie Bestandsschutz. Man erinnerte sich plötzlich wieder, was man vertrieben hatte.
»Also?« Sie richtete sich auf und trat einen Schritt zurück. »Unsere letzten gemeinsamen Jahre. Bitte sehr.«
Ich holte die Ordner heraus, sie legte sie mir auf den Arm und die Kartons obendrauf, stopfte den Rest in Jutebeutel und hängte sie mir über die Schultern. »Mach was draus.«
Und dann beugte sie sich vor und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Mit einem fröhlichen Lächeln stieg sie ein, warf die Tür zu – die sprang wieder auf, sie warf sie wieder zu, startete, der Auspuff knallte, und dann boxte sie sich in den Verkehr, und alle machten ihr Platz. Ich stand da, beladen wie die Altpapier-Müllabfuhr, sah ihr hinterher und versuchte zu vergessen, wie es gewesen war, damals, neben ihr zu sitzen und ins Ungewisse zu starten.
3
Ich fühlte mich also bestens vorbereitet auf den Besuch der Amtsperson. Ohne auch nur einen Gedanken an den Müllberg in meinem Büro zu verschwenden, konzentrierte ich mich auf meine Arbeit und hatte Herrn Fischer sogar fast schon vergessen, als er am Morgen, am verdammt frühen Morgen Mitte der Woche unten auf der Straße auf mich wartete.
Kann man Menschen ansehen, dass sie vom Finanzamt kommen? Natürlich nicht. Trotzdem wusste ich sofort, wer sich da auf der anderen Seite des Fußgängerübergangs vor dem Eingang herumtrieb, frierend von einem Fuß auf den anderen trat, auf seine Uhr schaute und eine Aktenmappe unter dem Arm trug. Viel zu dünner Mantel, nicht gewohnt, draußen zu sein. Hochgezogene Schultern, blasses, schmales Gesicht. Ein kleines Käppi auf dem Kopf, vielleicht aus dem Anglergeschäft. Würde zu ihm passen. Angeln, meine ich. Ungefähr meine Größe, aber um die Leibesmitte wesentlich fülliger (hoffte ich wenigstens, meine Selbstwahrnehmung begann sich als Zeichen zunehmender Rekonvaleszenz schon wieder zu trüben).
Er hätte auch klingeln können. Irgendjemand hätte ihm aufgemacht und ihn in Empfang genommen. Aber trotzig wie ein kleines Kind stand er in der eisigen Zugluft auf dem Trottoir und spähte mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ich erinnerte mich nicht, eine Uhrzeit auf dem Schreiben gelesen zu haben. Aber sehr wohl, dass Finanzbeamte Gleitzeit haben und die Härtesten von ihnen schon um sechs Uhr am Schreibtisch sitzen. Angeblich, ich hatte mich noch nie persönlich davon überzeugt. Es diente als Rechtfertigung, wenn ab mittags keiner mehr ans Telefon ging. Jetzt war es halb acht. Ich hatte um neun einen Telefontermin mit einer Richterin – Betrug durch Manipulation eines Pfandflaschenautomaten. Ich war der Pflichtverteidiger, es ging weniger um die lächerliche Summe als ums Prinzip. Armut hatte in dieser Stadt genügsam und duldend zu sein. Dass es in diesem Fall mehr ums Überleben als um Bereicherung ging, war wesentlicher Bestandteil meiner Strategie. Ich kannte die Richterin, es würde auf Bewährung hinauslaufen. Ein vorhersehbarer Vormittag. Um zwei hatte ich mich nach längerer Zeit einmal wieder mit Marquardt verabredet, danach Büroarbeit, gegen sechs in ein günstiges Fitnessstudio bei mir um die Ecke, Telefonat mit Saskia, einer schleppend verlaufenden Beziehung, die eigentlich nur noch fortgesetzt wurde, wenn wir beide nichts Besseres vorhatten. Der Tag war die Blaupause meines Daseins, das sich montags bis freitags in dieser Weise wiederholte.
Ich überquerte die Kreuzung und ging direkt auf den wartenden Mann zu. Ich hatte Glück: Er starrte gerade wieder Richtung Rosa-Luxemburg-Platz, der Überraschungsmoment war auf meiner Seite.
»Herr Fischer?«
Er fuhr zusammen und drehte sich um. Im gleichen Moment tat es mir leid, ihn so erschreckt zu haben. Panik stand in seinen Augen, Fluchtreflex. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er sich wieder in der Gewalt und streckte mir seine eiskalte Hand entgegen.
»Herr Vernau, wie ich vermute.«
Wir standen auf der Torstraße wie David Livingston und Henry Morton Stanley, zwei Fremde, die der Zufall zusammengewürfelt hatte. Zumindest für die nächsten Tage. Sein Händedruck war erstaunlich kräftig und ehrlich. Er dauerte auch etwas, als ob er sich dadurch Körperwärme von mir abzapfen könnte.
»Ist kalt hier draußen«, sagte ich und löste mich schließlich aus dieser seltsamen Begrüßung.
»Ja, ja«, pflichtete er mir hastig bei. »Ich bin etwas vor der Zeit, verzeihen Sie bitte. Normalerweise sitze ich schon längst am Schreibtisch. Im Amt. Aber extern nie vor acht.«
»Ein Frühaufsteher?«, fragte ich munter. Vielleicht gelang es ja, den Schwung dieses freundlichen Erstkontakts mitzunehmen. »Kommen Sie erst mal rein.«
Ich gab die PIN ein, und das Schloss öffnete sich mit einem leisen Sirren. Fischer folgte mir, wobei er interessierte Blicke auf die Details warf. Die große Tafel im Eingangsbereich, auf der die Firmen aufgelistet waren, die ihren Sitz in diesem Haus hatten. Die Sicherheitsschleuse, an der kein Mensch saß und wohl ein vergessenes Planungsdetail gewesen war, immerhin befanden wir uns nah am Regierungsviertel. Die drei Fahrstühle, von denen zwei in Betrieb waren und einer mit geöffneten Türen auf uns wartete. Das Display, das die altbekannten Knöpfe ersetzte, das Kameraauge schräg gegenüber. Ein Spiegel, in dem ich mich weniger aus Eitelkeit musterte, eher, um die halbe Minute mit einem wildfremden Mann, der gleich bis in die intimsten Details meiner letzten vier Jahre eindringen würde, irgendwie zu überspielen.
»Sie sind noch nicht lange hier, oder?« Er nahm das Käppi ab. Fischers Haarfarbe war nicht zu erkennen. Er trug Vollglatze.
»Seit knapp drei Monaten. Ich hatte eine Auszeit.«
Das konnte er nicht wissen, es würde frühestens im übernächsten Jahr bei meiner Steuererklärung eine Rolle spielen.
»Weiterbildung?«
»Nein, man hat mich …«
Fast umgebracht, wäre die Wahrheit gewesen.
»… angefahren«, sagte ich. »Drei Monate Reha, sechs Monate krankgeschrieben. Ich hoffe, das wird steuermindernd beurteilt.«
»Oh. Das tut mir leid.« Es klang ehrlich betrübt. »Geht es denn wieder?«
»Es muss.«
Der Aufzug hielt im achten Stock. Die Koreanerin schlich über den Flur, eine Zahnbürste im Mund und gekleidet in etwas, das genauso gut der letzte Schrei in der Kastanienallee sein konnte oder ein Frotteebademantel. Als sie uns sah, huschte sie in die Damentoilette. Fischer ließ sich nichts anmerken. Er musste seltsame Dinge in fremden Büros gewohnt sein.
»Dies ist ein sogenannter Coworking Space. Ich habe einen eigenen Raum für meine Kanzlei, aber die Vorteile von Rezeption, Telefondienst und Konferenzraum. Meine Kanzleipartnerin und ich haben uns getrennt.« Er wollte neben mir laufen, aber ich war zu schnell. »Keine Sorge. Ich habe alle Unterlagen für den betreffenden Zeitraum von ihr bekommen. Hoffe ich wenigstens.«
»Jaja, die Hoffnung.«
Er kicherte. Es hörte sich an, als ob er Knallerbsen äße. Überhaupt war mir im Fahrstuhl schon aufgefallen, dass er seltsame Geräusche machte. Er räusperte sich unterdrückt, zog die Luft durch die Zähne und schnaufte leise. Alles nicht aufdringlich, aber es verhalf ihm zu einer seltsamen Präsenz.
»Bitte sehr. Hier sind wir.«
Er hielt gleich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch zu und legte die Aktenmappe darauf. Dann suchte er mit einer seltsamen Verrenkung nach etwas in der Innentasche seines Anzugs. Es war ein Dienstausweis.
»Nicht nötig«, wiegelte ich ab. »Sie hatten sich ja avisiert. Kaffee? Dürfen Sie das annehmen?«
Wieder dieses leise, sanfte Knallen, das sein Lachen begleitete.
»Natürlich. Ich habe mir aber alles mitgebracht. Das ist besser. Immer vorbereitet sein.« Er öffnete seine Aktentasche, die sich als erstaunlich geräumig erwies, und holte eine Thermoskanne und eine Brotbox heraus.
»Darf ich?«
Beides landete auf meiner Schreibtischunterlage. Als Drittes gesellte sich ein Keramikbecher hinzu.
»Möchten Sie ablegen?«
Er nickte und schälte sich aus seinem Mantel, dann brachte er es fertig, sich mit seinem Schal beinahe zu strangulieren. Ich nahm beides entgegen und verschwand Richtung Flur und Garderobe. Als ich mit meinem Kaffee zurückkehrte, saß er schon. Vor sich vier dicke Hefter, in denen ich meine Steuerbescheide der letzten Jahre erkannte. Den ersten hatte er schon aufgeschlagen und sich darin vertieft. Neben sich einen verknitterten Stapel aus Marie-Luises Schuhkartons. Das Büro roch nach Kamille, ein Duft, der mich an Kinderkrankheiten erinnerte.
»Sie scheinen mir ein sehr organsierter Mensch zu sein«, sagte er und trank einen Schluck Tee. Ich nahm hinter meinem Schreibtisch Platz und wusste nicht, ob das ein Kompliment, reine Konversation oder schon der Beginn der Prüfung war. »Im Gegensatz zu Frau Hoffmann.«
Er nahm den Altpapierstapel und versuchte, ihn zusammenzuschieben.
»Haben Sie jemals in Erwägung gezogen, einen Steuerberater hinzuzuziehen?«
»Wir sind Steuerberater.«
»Ja. Natürlich.« Er riss sich von dem Stapel los. Ganz oben lagen die Belege, die wir aus dem Dreck geklaubt hatten. »Da Sie in einer zwar voneinander getrennten, aber sich doch in gewissen Bereichen überschneidenden Gemeinschaft gelebt haben …«
»Bürogemeinschaft«, verbesserte ich ihn.
»Selbstverständlich, in einer Bürogemeinschaft, müsste ich vielleicht bei der einen oder anderen Frage auch Ihre ehemalige Partnerin befragen. Ihre Kontaktdaten haben Sie?«
»Ja.«
Er nickte mir freundlich zu und vertiefte sich in seine Unterlagen. Ich fuhr den Computer hoch und fragte mich, wie lange ich ihn ertragen musste. Vier Jahre Steuerunterlagen. Machten sie Stichproben? Oder arbeiteten sie sich tatsächlich durch jede einzelne Seite, durch jede Quittung, durch jeden Beleg? Ernähren musste ich ihn glücklicherweise nicht. Aber auf Dauer würde es mit ihm, seinem Kamillentee und Marie-Luises Schuhkartons eng in dieser Butze werden.
Es folgte ein langer Vormittag. Ich konnte noch nicht einmal einen Termin außerhalb vortäuschen, weil ich mehrere telefonische Mandantengespräche zu führen hatte. Alle vor den Ohren meines Steuerprüfers, der still vor sich hinblätterte, Notizen machte, ab und zu leise knallte und sich mit einem beginnenden Schnupfen plagte, denn zuweilen schnäuzte er sich herzhaft. Die Geräusche seiner Anwesenheit, so dezent sie auch sein mochten, störten mich. Er war wie ein tropfender Wasserhahn: Den ganzen Tag über hört man ihn nicht. Aber abends, wenn man im Bett liegt und alles zur Ruhe kommt, kann sogar ein leiser Ton das Nervenkostüm zerfetzen. Fischer fetzte auch. Anders, aber genauso penetrant. Meine Bürokabine war fast schalldicht, deshalb konnte ich nach einer Zeit der Gewöhnung sogar seinen Atem hören. Ich schickte Marquardt eine SMS mit dem Inhalt: »Dringend! Treffen schon um 13 Uhr!«, um einen Grund zu haben, das Haus zu verlassen.
So nervig er war, so spürte ich dennoch Anwandlungen von Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Ich wollte ihn nicht belügen. Er war durchdrungen von Wahrhaftigkeit und beseelt von dem gesellschaftlichen Nutzen seines Tuns. Das dachte ich über meine Arbeit auch, aber ich hatte nicht das Gefühl, damit mehr als nötig auf meine Klienten abzufärben.
»Sie spenden an die Berliner Tafel?«, fragte er in die Stille zwischen zwei Tropfen.
»Ja. Es könnte mehr sein, aber bei mir lief es letztes Jahr nicht so.«
Ein dünnes Lächeln, und er legte die Quittung zur Seite.
»Und die Bahnhofsmission«, fuhr er fort. »Hier sind auch fünfzig Euro für den Kältebus. Da ist ein Dreher im Datum. Ich lass das aber mal so durchgehen.«
Er riss mich damit aus einer kompliziert zu kalkulierenden Rechnung. »Danke«, knurrte ich und fing wieder von vorne an.
»Waren Sie einmal obdachlos?«
»Bitte?«
Er nippte einen Schluck erkalteten Kamillentee. »Nun, das sind alles Zuwendungen in eine bestimmte Richtung. Viele spenden fürs Tierheim, viele für die Kunst. Sie für Obdachlose. Warum?«
»Gehört das zu Ihrer Prüfung?«
Er lehnte sich zurück und rieb mit zwei Fingern über seine Nasenwurzel. Kontaktlinsenträger, wahrscheinlich erst seit Kurzem. »Nein. Natürlich nicht.«
»Warum fragen Sie dann?«
»Wissen Sie, ich bekomme oft einen sehr intimen Einblick in das Leben meiner Prüflinge. Die meisten, mit denen ich zu tun habe, wollen Steuern vermeiden. Ausgaben in die Höhe treiben. Alles Mögliche am Fiskus vorbeischleusen. Bei Ihnen ist das anders. Man hat fast das Gefühl, es ist Ihnen egal, wie viele Steuern Sie zahlen.«
Egal? Ich begriff nicht ganz. »Könnten Sie das etwas präzisieren?«
»Sie liegen vor mir wie ein offenes Buch, Herr Vernau.« Wieder ein dünnes Lächeln. »Ich kann sehen, wie oft Sie für Frau Hoffmann die Miete übernommen haben. Wer von Ihnen den Kaffee eingekauft hat – das waren meistens Sie. Dass Sie für Papier, Druckerpatronen und fast alles andere aufgekommen sind. Der Lieferservice, wenn es wieder mal spät wurde. Und Unmengen an Toastbrot und Erdnussbutter. Die kann ich mir aber nicht erklären.«
»Das habe ich eingereicht?«
»Als Bewirtungskosten. Es wurde aber von meinen Kollegen nicht akzeptiert. Zu Recht, selbstverständlich. Aber …« Er hielt den Kassenzettel eines Discounters hoch. »Sie hatten harte Zeiten.«
»Stimmt. Das alles lesen Sie aus meinen Steuerunterlagen?«
»Das alles und noch viel mehr.«
»Herr Fischer«, sagte ich, »Sie machen mir Angst. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sie wissen ja alles von mir. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen.«
Er winkte ab. »Nur, was elektronisch erfasst oder quittiert worden ist.«
Damit holte er eine alte Kreditkartenabrechnung heraus und begann, einzelne Posten miteinander zu vergleichen.
»Sagen Sie …«
Er sah hoch. »Ja, bitte?«
»Warum ich? Würfeln Sie? Bin ich aufgefallen? Wonach suchen Sie sich …«, IhreOpfer, wollte ich sagen, besann mich aber noch rechtzeitig, »Ihre Prüflinge aus?«
Er dachte nach. »Statistisch gesehen wären Sie alle siebenundneunzig Jahre an der Reihe.«
»Und warum jetzt?«
Wieder dieses Lächeln. »Sie haben einfach Glück gehabt.«
»Glück«, wiederholte ich.
Sebastian Marquardt starrte mich an, dann hieb er sich krachend auf die Schenkel und lachte.
»Glück gehabt! Meine Herren!«
Er lachte, dass ihm beinahe die Hemdknöpfe absprangen. Im Gegensatz zu mir (hoffte ich wenigstens) hatte er in den letzten Jahren zugelegt. Sein gut geschnittenes Gesicht mit der schmalen Nase und dem markanten Kinn hatte sich gerundet, ebenso wie der Bauch. Nur die Beine waren dünn geblieben, aber das bemerkte man nur, wenn man ihn schon lange kannte. Seine Anzüge ließ er beim selben Schneider am Kurfürstendamm nähen, der schon Helmut Kohl ausgestattet hatte, der für mich aber weder modisch noch in sonstiger Hinsicht ein role model gewesen war. Für Marquardt waren die Anproben Gelegenheit, den gesamten Klatsch und Tratsch der Berliner Gesellschaft zu hören und auf dem Laufenden zu bleiben. Besonders gerne in Fällen, wo diskreter rechtlicher Beistand angeraten schien. Seine Kanzlei blühte und gedieh. Da er sich mehr und mehr auf Steuer- und Wirtschaftsdelikte spezialisiert hatte, konnte ich mir denken, für welche Klientel er mittlerweile arbeitete. Goldene Uhr, goldener Siegelring, goldene Krawattennadel. Handgenähte Schuhe, für die er zweimal im Jahr nach London flog. Ein nagelneuer Jaguar parkte im Halteverbot vor dem Restaurant in einer Seitenstraße des Boulevards, er wurde als Stammgast empfangen und hofiert.
Er trank einen Schluck Wasser, um wieder zu sich zu kommen.
»Der hat ja Humor, dein Prüfer.«
»Mehr war nicht aus ihm herauszukriegen. Kein Anfangsverdacht, keine Auffälligkeiten. Einfach nur purer Zufall.«
Marquardts Gesichtsfarbe blendete langsam wieder von Rot zu Braun. Das ganze Jahr über sah er aus, als verbrächte er die Wochenenden an karibischen Stränden. Das Haar immer noch voll, dunkel und vor Pomade glänzend nach hinten gestrichen. Ein vom Leben verwöhnter Bengel, arrogant und charmant zugleich, für mich eine wohltuende Abwechslung von meiner Computer- und Soja-Latte-betäubten Bürogemeinschaft. Wir hatten zusammen studiert und uns in dieselbe Frau verliebt. Wir hatten es beide nicht geschafft, sie für uns zu gewinnen. Er war bei ihr abgeblitzt, ich hatte es vergeigt. Vielleicht hielt uns das über alle Gegensätze hinweg zusammen: Marie-Luise war eine der wenigen wirklich wichtigen Niederlagen in unserem Leben.
»Meinst du?« Marquardt goss Wasser nach. Den Wein zum Mittagessen hatte er sich zu meinem Leidwesen aus Gesundheitsgründen abgewöhnt. In solchen Läden zahlte er. Früher war ich so in den Genuss von einigen wirklich außergewöhnlichen Tropfen gekommen. »Im Moment geht es rum wie eine Seuche. Von allen Seiten: Betriebsprüfung, Betriebsprüfung. Meine Mandanten schmeißen mich sogar nachts deshalb aus den Federn.«
Mein Handy klingelte. Ich kannte die Nummer nicht, nahm aber trotzdem an. Sie stand auf meinen Visitenkarten, die ich rege in Umlauf brachte.
»Vernau. Einen Moment, bitte.«
Marquardt nickte mir zu und widmete sich wieder seinem Essen. Ich verließ den Speisesaal und ging zur Garderobe, die mittags nicht besetzt war.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Fischer hier. Udo Fischer.«
»Ja?«
»Es gibt da eine kleine Unstimmigkeit bei Ihren Zahlungseingängen. Sie betreffen die Monate Februar und März vor vier Jahren. Es fehlen einige Belege.«
In mir stieg eine minimale Anwandlung von Ärger auf. Kurz nach eins, Mittagspause. Meine Mittagspause. Seine hatte er wohl zwischen zehn und zehn Uhr dreißig.
»Ja?«
»Insgesamt nur ein marginaler Betrag, aber wir wollen ja genau sein, oder?«
Ich unterdrückte einen Seufzer. »Um welche Eingänge handelt es sich?«
»Die Einzahlungen kommen von einem Herrn Whithers, kein Betreff, keine Rechnungsnummer.«
»Das ist der … ähm … Lebensgefährte meiner Mutter. Dann war es was Privates.«
Genauer wollte ich Familienfremden das Chaos in den Beziehungen meiner hochbetagten Erzeugerin nicht erläutern.
»Da wäre noch eine Zahlung von der Lufthansa. Offenbar eine Stornierung.«
»Offenbar.«
»Dann waren Sie zu diesem Zeitpunkt in Berlin?«
»Zu welchem Zeitpunkt?«
Fischer hatte mich schon im Büro genervt. Ich hatte nicht erwartet, dass das in meiner Freizeit so weitergehen würde.
»Dreizehnter März 2015. Vor vier Jahren.«
»Wissen Sie, wo Sie März vor vier Jahren waren?«, fragte ich und bemerkte einen Anflug von Aggression in meiner Stimme.
Ein leises Lachen. »Ich weiß noch nicht einmal, was ich letzte Woche zu Mittag gegessen habe.«
Das erinnerte mich an meine Mahlzeit, die gerade kalt wurde. »Haben Sie noch weitere Fragen?«
»Wenn Sie bitte die Flugbuchung finden könnten? Dann kann ich die Stornierungszahlung herausnehmen. Und einen Beleg oder eine Quittung für die Einzahlung dieses Herrn Whithers an Sie?«
Mir schwante, dass es sich dabei um das Bücherregal eines schwedischen Möbelherstellers in komplizierter Leichtbauweise handelte. Von der Zeit her müsste es hinkommen. Wir hatten es gemeinsam gekauft, aber keiner von den dreien, denen es in Zukunft dienen sollte, hatte Geld dabeigehabt. Es war ein kleiner Betrag, keine zweihundert Euro. Im Vergleich zu dem, was andere an der Steuer vorbeischmuggelten, kam mir Fischer pedantisch vor.
»Ich kümmere mich darum.«
»Das wäre nett. Vielleicht bis morgen?«
Ich wollte ihn fragen, welche Vorstellungen er von meinem Beruf hatte. Aber dann legte ich lieber auf und kehrte zu Marquardt an einen abgeräumten Tisch zurück.
»Sie wärmen es dir auf.«
»Nicht nötig.« Ich ließ mich auf den Stuhl krachen. »Mir ist der Appetit vergangen. Jetzt will er eine Ikea-Rechnung von vor vier Jahren. Und ich soll eine stornierte Flugbuchung nachweisen. Ist es noch zu fassen?«
Marquardt wiegte mitfühlend sein Haupt. »Einer meiner Klienten musste mal eine Selbstanzeige wegen fünfhundert Euro machen. Fünfhundert! Weil er einen Scheck aus Versehen auf seinem Privatkonto eingelöst hat. Letztes Jahr. Ich dachte, die kehren das Unterste zuoberst bei ihm. Drei volle Tage war er komplett außer Gefecht gesetzt. Dazu okkupieren sie noch dein Büro und breiten sich da aus, als wären sie zu Hause.«
Ich winkte ab. Das Thema war einfach zu leidig, um es weiter zu vertiefen.
»Und das alles wegen Schnee von gestern. Bis zu zehn Jahren können sie zurückgehen. Also nichts wegschmeißen.«
»Nein«, sagte ich und dachte an Marie-Luises Abfallhaufen und daran, was geschehen würde, wenn Fischer sich den auch noch vornehmen würde. Ich sah auf meine Uhr. Ich musste zurück ins Büro, aber ich würde mich in Gegenwart dieses gedämpft knallenden Maulwurfs auf nichts konzentrieren können.
Mein Gegenüber merkte jetzt auch, wie spät es war. Marquardt stand auf und klopfte mir herzlich auf die Schulter.
»Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Selbst das. Wenn du Ärger kriegst, melde dich. Ich hau dich raus.«
Zu meinem Büro fuhr ich einen Umweg, holte einen Anzug von der Reinigung ab und ließ mir noch die Haare trimmen. Alles nur, um Fischer nicht zu begegnen. Erst um halb vier war ich wieder an meinem Schreibtisch. Von der Amtsperson war nichts geblieben außer einem Teerand dort, wo sein Becher gestanden hatte. Mit einem Seufzen machte ich mich an die liegen gebliebene Arbeit. Er würde morgen wiederkommen, übermorgen, wer weiß wie oft noch. Ich checkte meinen Terminkalender auf dem Handy und stellte fest, dass ich erst vor drei Jahren begonnen hatte, ihn zu führen. Davor hatte ich noch mein Filofax benutzt. Wo war das eigentlich?
Ich war mir sicher, dass ich es noch nie in diesem Büro mitgehabt hatte. Aber auch zu Hause war es mir seit Ewigkeiten nicht mehr zwischen die Finger gekommen. Es fiel mir wieder ein, als ich im Gehen die Koreanerin mit dem IT-Nerd, der ständig den Konferenzraum blockierte, zusammen auf dem Flur in einen Streit verwickelt sah. Beide vollkommen davon überzeugt, im Recht zu sein und zu genervt voneinander, um dem anderen zuzuhören. Es ging, soweit ich das erfasste, um die Stifte für das Whiteboard, die einer von beiden zu klauen schien. Eigentlich war es nur der eine Satz, der bei mir hängen blieb:
»Immer wenn du irgendwo warst, ist etwas weg!«
Der Nerd hatte sich in Rage geredet, die Koreanerin machte sich kopfschüttelnd auf den Weg in ihre Wohnwabe.
Ich kannte diesen Vorwurf. Er kam aus dem Mund meiner Mutter, die vergesslich wurde und andere dafür verantwortlich machte. Irgendwo bei ihr musste es sein, zusammen mit dem anderen Krempel, den ich beim letzten Umzug in ihrem Loft stehen gelassen hatte.
4
Wer meine Mutter und ihre beiden Lebensgefährten persönlich kennt, dem muss ich die Situation nicht beschreiben. Für alle anderen: Wir sehen uns des Öfteren an den Wochenenden, die durch diese Besuche eine Struktur erhalten und mich nicht im beziehungsleeren Raum verloren gehen lassen. Saskia hatte mich zweimal begleitet und bis heute nicht begriffen, dass diese Wohngemeinschaft von drei Leuten über siebzig eigentlich nichts anderes als deren Spätinterpretation von freier Liebe war. Ich wusste nicht, mit wem George Whithers genau Tisch und Bett teilte, und bekam Schüttelfrost, wenn meine Gedanken nur in die Nähe dieser Vorstellung abdrifteten. Ich wollte auch nicht wissen, ob meine Mutter nun ein Verhältnis mit ihrer ehemaligen Haushälterin, Frau Huth, hatte, oder mit George, einem der bekanntesten Komponisten zeitgenössischer Musik. Wer welche Rolle in diesem Konkubinat übernahm, entzog sich meiner Kenntnis. In meiner Gegenwart benahmen sie sich gesittet, waren aber mittlerweile dazu übergegangen, sich auch mal mit Kosenamen wie Hase oder Schatz zu rufen. Alles nichts Ehrenrühriges. Drei ältere Herr- und Damenschaften unter einem Dach. Ich glaube, Whithers hat das Loft vor ein paar Jahren gekauft, sonst könnten sie sich diese Lage gar nicht leisten. Mitten in Mitte, ein ganzer Hinterhof nur für den Schrott, den er zum Komponieren brauchte, dazwischen Hüthchen und Mutter, die der Erschaffung seiner Werke mit Ergriffenheit lauschten und ihm die Lendenwirbelsäule mit Rheumasalbe massierten. Für mich waren seine Werke schwer zugänglich, aber ab und zu schaffte er es, mich zu packen.
Es war ungewöhnlich, an einem Mittwochabend bei ihnen aufzutauchen. Ich hatte nicht angerufen und war auf gut Glück losgefahren. Nur drei U-Bahn-Stationen, und schon stand man mitten im Scheunenviertel. Auf dem kurzen Fußweg in die Mulackstraße kamen mir Kohorten von Touristen entgegen, alle auf der Suche nach Berlins rauem Charme, den man hier allenfalls noch in homöopathisch kuratierten Dosen fand. Den Rest hatten die üblichen Kettenläden, die man auch in jeder ordentlich heruntergekommenen Kleinstadt fand, die coolen Bars, teuren Restaurants und noch teureren Galerien einfach verschluckt.
Whithers Hinterhof, vor zwanzig – ach was, vor zehn Jahren noch ein alltäglicher Anblick, müsste mittlerweile unter den Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes gestellt werden. Ich hatte keine Ahnung, wie es ihm gelungen war, die gierigen Krakenarme der Immobilieninvestoren und Bauträger abzuwehren, aber ich spürte an diesem Abend wieder einmal Wehmut. Die alte Odessa-Bar gab es schon lange nicht mehr. Keiner legte nach Mitternacht zerkratzte russische Platten auf, und die Berliner Vampire hatten sich längst einen anderen Ort gesucht oder waren in die Sonne gegangen. Die Kellerkneipen hatten sich schick gemacht und die Preise verdreifacht. Der Vietnamese war einem hawaiianischen Poke-Laden gewichen, der den Charme einer Zahnarztpraxis versprühte. Ein stetes Kommen und Gehen, nur die Fenster in den klotzigen Neubauten blieben dunkel, weil sie nicht zum Wohnen, sondern zum Geld-Anlegen gebaut worden waren. Ich hatte keine Ahnung, warum mich das nicht mitriss. Ich wich den Leuten aus, die sich lachend ihren Weg bahnten, und fragte mich, wann und warum ich dem Neuen gegenüber so ablehnend geworden war. Das Tor war verschlossen.
Ich spähte durch das verrostete Stück Maschendrahtzaun und sah Licht hinter den halb blinden Fenstern der Baracke. Es gab zwar eine Klingel, aber auf die hörte keiner. Der Riegel ließ sich mit beherzter Kraftanstrengung zur Seite schieben. Das Tor öffnete sich mit einem gequälten, wehen Ton, der mich an den Beginn eines von Whithers Musikstücken erinnerte.
»Jemand da?«, rief ich und durchquerte den Hof. Es gab eine Art Trampelpfad, über den man, vorbei an unkrautbedeckten rostigen Metallbergen, zu dem lang gestreckten Gebäude gelangte. In früheren Zeiten musste es eine Werkstatt mit Ställen gewesen sein, meist Pferde, von denen das Scheunenviertel seinen Namen hatte. Überfüllt, bitterarm, geprägt von osteuropäischen Einwanderern. Rotlicht und Unterwelt, Absinth und Morphium. Nicht nur meine drei Nächsten, auch die Vergangenheit hatte in diesem vergessenen Hof Asyl gefunden. Ich erreichte die Tür, ohne mir die Beine zu brechen, und klopfte.
»Hallo? Mutter? Frau Huth?«
Die Tür wurde geöffnet. Hüthchen starrte mich an, ich starrte zurück.
Sie hatte nicht mehr mit Besuchern gerechnet, denn statt der seltsamen Turbane, die sie sich sonst um den Kopf wand und die mich an herabgestürzte Vogelnester erinnerten, trug sie die spärlichen grauen Haare in einer Art Out-of-bed-Look für fortgeschrittene Semester. Sie standen ab in alle Himmelsrichtungen. Immerhin trug sie noch ihren Kaftan. Grün-schwarz changierend und zerknittert, was den Eindruck einer aus dem Schlaf gerissenen Medusa noch verstärkte. Busen und Bauch bildeten eine vollkommen gerundete Einheit, die Füße steckten in Pantoffeln, die Brille im Ausschnitt. Sie tastete danach und setzte sie umständlich auf.
»Herr Vernau.«
Als ob sie mich nicht schon längst erkannt hätte.
»Was verschafft uns das späte Vergnügen?«
»Ist meine Mutter da?«
Ich schob mich an ihr vorbei in den Vorraum des Lofts. Der Geruch von nasser Kleidung schlug mir entgegen. Dazu Knoblauch und angebratene Zwiebeln. Und Apfelkuchen. Ich kannte diese Melange, sie erinnerte mich an meine Kindheit. Mutter kocht. Es gibt was Warmes.
Hüthchen schloss die Tür mit einer Handbewegung von großer Grandezza, die sie sich von der Bühne eines Kudamm-Theaters abgeguckt haben musste. »Ja. Aber wir sind gerade beschäftigt.«
Ich kannte diese Abwimmeleien gut genug, um gar nicht mehr darauf einzugehen. Als Sohn mache ich nach wie vor ein Besuchsrecht bei meiner Mutter geltend, das von Hüthchen immer wieder infrage gestellt wird. Der Ursprung unserer Antipathie liegt weit zurück und hat etwas mit unterschiedlichen Auffassungen von dem zu tun, was in den Aufgabenbereich einer Haushälterin fällt. Eines war klar: Hüthchen betrachtete mich als ewige Attacke auf das Seelenheil meiner Mutter. Sie beanspruchte mittlerweile den Platz zur Rechten von Hildegard Vernau. Ich ließ sie gewähren, meistens jedenfalls. Aber ab und zu schadete es nicht, die neue Familienaufstellung einfach mal vom Tisch zu fegen.
Mutter stand am Herd. Es war eine offene Küche, und die Gerüche zogen ungefiltert direkt in den riesigen Wohn- und Arbeitsraum. Ich konnte Whithers nirgendwo entdecken, und auf meine Frage direkt nach den beiden hingehauchten Wangenküssen strahlte meine Mutter mich an und sagte: »Philadelphia. Er ist schon wieder in Übersee.«
In der Pfanne brutzelten Apfelscheiben und Zwiebeln. Im ausgeschalteten Ofen kühlte der Kuchen ab. Ein Blick verriet, dass als erster Gang Kalbsleber Berliner Art auf dem Speiseplan stand.
»Willst du mitessen?«
Ich nickte und versuchte dabei, so wenig gierig wie möglich auszusehen. Meine Mutter kocht fantastisch. All die wunderbaren Gerichte, die es kaum noch auf die Karte eines Restaurants schaffen: Rinderrouladen. Schweinebraten. Saure Nierchen. Königsberger Klopse. Eisbeinsülze. Heute Mittag hatte ich wegen Fischer auf irgendein Gericht verzichtet, das noch nicht mal mehr einen Namen gehabt hatte: irgendeine geschäumte Sache an Praline mit Mille-feuille. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Dafür blieben mir die Sonntagsbraten meiner Mutter meist noch die ganze Woche über im Gedächtnis.
»Das wird dann aber knapp«, raunzte Hüthchen, die mir gefolgt war wie ein Hütehund in Sorge um das schwächste Schäfchen.
»Dann mache ich einfach etwas mehr Kartoffelbrei.«
Mutter lächelte selig. Wie immer, wenn sie füttern konnte. Hüthchen grummelte etwas in sich hinein und begann mit großem Getöse, ein weiteres Gedeck auf dem schartigen Holztisch zu arrangieren.
»Sag mal …«, begann ich.
Dann fiel mir ein, dass ich jeden Besuch außerhalb geweihter Feiertage mit einem unaufschiebbaren Anliegen verband, und fuhr fort: »Wie geht es dir?«
»Gut!«, zwitscherte sie. »Ich habe meinen Lehrgang beendet und kann jetzt endlich selber anfangen mit dem Schweißen.«
»Mit was?«
»Du weißt doch. Meine Kunst.«
»Deine … Kunst?«
Im Scheunenviertel ist es so, dass die Hälfte der Menschen, die noch dort wohnen, in der Gastronomie arbeitet. Die andere Hälfte macht was mit Kunst. Meine Mutter hatte es mit weit über siebzig erwischt. Bis dahin hatte sie ihre Kreativität beim Stricken von Eierwärmern ausgelebt.
»Ja!« Mit leuchtenden Augen schüttete sie die gebratenen Zwiebeln und Äpfel in eine Schüssel und griff nach einer Packung Speisestärke. »Ich hab schon zwei Stücke verkauft. An Freunde von George.«
Wie ich schon erwähnte: George Whithers ist ein Komponist von Weltruhm. Es hatte gedauert, bis diese Information bei mir angekommen war. Und noch länger, bis ich kapierte, dass das keine Übertreibung war. Mir kam ein lästerlicher Gedanke: Vielleicht hatten die Käufer der Kunstwerke meiner Mutter nur versucht, über sie an ihn heranzukommen.
»Welche denn?«, fragte ich mäßig interessiert.
Soweit ich wusste, zog sie nachts mit Hüthchen und dem jungen Herrn Jonas, einem dieser Freunde und Helfer, ohne die man mit zwei linken Händen aufgeschmissen ist, durch die Straßen Berlins, um Fahrradleichen zu erlösen. Verrostete, vergessene, verbogene Räder, oft mit dicken Schlössern irgendwo angekettet, die sie mit dem Bolzenschneider durchtrennten und dann in die Mulackstraße verschleppten. Hier wartete ihre Auferstehung als Sinnbild von Vergänglichkeit und Mobilität. Zumindest interpretierte meine Mutter das in die Rosthaufen hinein, die aussahen, als warteten sie auf die Sperrmüllabfuhr.
»Das Schweigen und Morgenstille.«
»Du hast ihnen Namen gegeben?«
»Macht man das nicht so? Ich hätte sie auch Versuch 3.0 nennen oder ihnen einfach nur eine Nummer geben können. III/2019 vielleicht. Das klingt moderner. Klingt das moderner?«
Hüthchen angelte ein Wasserglas vom Regal. »Ja.«
Mutter schüttete Speisestärke in einen Teller und wendete dann die leicht gesalzenen Kalbsleberscheiben darin. »Vielleicht beim nächsten Zyklus.«
»Zyklus«, sagte ich.
»Zyklus«, wiederholte sie. »Meine Fahrrad-Phase. Ehrlich gesagt: Es ist ein bisschen anstrengend. Und wir dürfen uns auch nicht erwischen lassen. Aber wie komme ich sonst an den Rohstoff? Ist das Diebstahl?«
»Nicht, wenn es sich um erwiesenermaßen aufgegebenes Eigentum handelt. Verlust beendet den generellen Gewahrsams- und Herrschaftswillens, auch wenn es um keinen räumlich umgrenzten Bereich geht. Das habt ihr euch doch zusichern lassen, oder? Haben die Besitzer ihr Fahrrad nämlich nur vergessen, sieht das anders aus. Da befinden die Sachen sich noch im Gewahrsam des Opfers.«
Es folgte das leicht pikierte Schweigen, weil ich mal wieder in meinen Dozententon gefallen war.
»Opfer«, murmelte meine Mutter schließlich und wendete die Leber.
»Immerhin knackst du ein Schloss, das geht schon in Richtung schwerer Diebstahl. Paragraf 243 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2 StGB. Schutzvorrichtungen gegen Wegnahme sind von Menschenhand geschaffene Vorrichtungen und technische Mittel, die ihrer Art nach geeignet und auch dazu bestimmt sind, die Wegnahme einer Sache erheblich zu erschweren. Also begeht ihr, juristisch gesehen, Diebstahl in besonders schweren Fällen.«
Beide sahen mich reglos an. Mutter die Hände in der Speisestärke, Hüthchen am Tisch. Freeze.