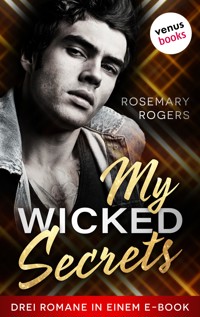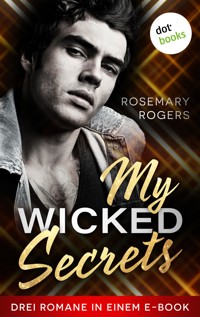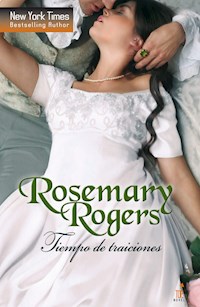4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Morgan-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Stern von Mexiko: Die epische Saga »Das Leuchten der Kaktusblüte« von Rosemary Rogers jetzt als eBook bei dotbooks. Anfang des 20. Jahrhunderts: Laura, die schöne Tochter einer europäischen Adligen und eines Armeeoffiziers, wächst behütet unter dem weiten Himmel Mexikos auf. Als sie dem draufgängerischen Trent Challenger begegnet, entfacht er in ihr zum ersten Mal die Sehnsucht nach einem Leben, das sie sich bisher nie vorzustellen gewagt hat: voller Leidenschaft, Freiheit und ungezügelter Freude. Doch Lauras Eltern sind gegen die unstandesgemäße Verbindung, Unsicherheit und Intrigen treiben sie auseinander. Jahre später begegnen Laura und Trent sich in Paris und London erneut, aber mehr denn je steht zwischen ihnen: Sie legt sein Herz in Fesseln – er ist der Einzige, der das Schloss ihres goldenen Käfigs öffnen könnte. Wird ihre Liebe alle Hindernisse überwinden können? Eine große Saga über eine epische Liebesgeschichte – voller Sturm und Hoffnung. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »Das Leuchten der Kaktusblüte« von Bestsellerautorin Rosemary Rogers ist das berauschende Finale ihrer großen Exotiksaga über die Familie Morgan. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Ähnliche
Über dieses Buch:
Anfang des 20. Jahrhunderts: Laura, die schöne Tochter einer europäischen Adligen und eines Armeeoffiziers, wächst behütet unter dem weiten Himmel Mexikos auf. Als sie dem draufgängerischen Trent Challenger begegnet, entfacht er in ihr zum ersten Mal die Sehnsucht nach einem Leben, das sie sich bisher nie vorzustellen gewagt hat: voller Leidenschaft, Freiheit und ungezügelter Freude. Doch Lauras Eltern sind gegen die unstandesgemäße Verbindung, Unsicherheit und Intrigen treiben sie auseinander. Jahre später begegnen Laura und Trent sich in Paris und London erneut, aber mehr denn je steht zwischen ihnen: Sie legt sein Herz in Fesseln – er ist der Einzige, der das Schloss ihres goldenen Käfigs öffnen könnte. Wird ihre Liebe alle Hindernisse überwinden können?
Über die Autorin:
Rosemary Rogers (1932–2019) kann mit Fug und Recht als Legende gefeiert werden: Wie kaum eine andere hat sie das Genre der Liebesromane geprägt. Geboren in Ceylon, schrieb sie mit acht Jahren ihre erste längere Geschichte, der schon in ihrer Teenagerzeit erste Liebesromane folgten. Mit 22 Jahren wurde sie gegen den Willen ihrer Eltern Reporterin und zog nach London. Viele Jahre später zog es sie jedoch zurück nach Kalifornien, in das »Land der Mandelblüten«. Ihre zahlreichen Bücher haben sich weltweit über 50 Millionen Mal verkauft.
Bei dotbooks veröffentlichte Rosemary Rogers auch ihre Romane:
»Das Flüstern der Orangenblumen – Die große Exotiksaga 1«
»Im Land der Pelikane – Die große Exotiksaga 2«
»Die Insel der Tabakblüten – Die große Exotiksaga 3«
»Das Land der Mandelblüten«
»Der Himmel über der Zimtinsel«
Außerdem erschienen bei dotbooks ihre Dark-Romance-Romane:
»Royal Player«
»Bad Boy Player«
»Hollywood Player«
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Mai 2021
Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel »Die Geliebte des Abenteurers« bei dotbooks und 1989 unter »Der Stern von Mexiko« im Wilhelm Goldmann Verlag.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Titel »Bound by Desire« bei Avon Books, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Rosemary Rogers
Published by Arrangement with Rosemary Rogers.
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 1989 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover 30161.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Natalia Bostan / Le Do / Hannamariah / Jayne Chapman / T photography / soft_light / Vanilllla / Quanrong Huang
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-669-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Leuchten der Kaktusblüte« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rosemary Rogers
Das Leuchten der Kaktusblüte
Roman
Aus dem Amerikanischen von Waltraud Götting
dotbooks.
Prolog
Aus der Wüste sprießt eine Blüte hervor
Sie drehte sich, der Rhythmus ergriff sie – sie überließ sich ihm. Ihr Körper verschmolz mit der Musik, mit der Bedeutung des halb gesungenen, halb geschluchzten spanischen Flamenco und der Wildheit des durch und durch mexikanischen Jarabe.
Es war lange her – zu lange –, daß Ginny so getanzt hatte, natürlich mit bloßen Füßen auf der nackten Erde. Der Schein des Feuers und der Fackeln ließ die Fülle ihres kupfergoldenen Haars aufflammen, das ihr bis auf die Taille fiel – eine Taille, die immer noch so gertenschlank war wie vor der Geburt ihrer Zwillinge Franco und Laura, die glücklicherweise, wie Ginny einen flüchtigen Augenblick lang überlegte, zur Hacienda de la Nostalgia vorausgefahren waren.
War es nur Zufall gewesen, daß sie und Steve alte Freunde getroffen hatten, als sie nach einem Besuch bei Renaldo, Missie Lind ihren Kindern auf dem Weg zur Hacienda de la Nostalgia gewesen waren? Und daß sie geblieben waren, um mit dem früheren Comanchero Sanchez, seinen Söhnen und einigen der Vaqueros, die für Don Francisco Alvarado gearbeitet hatten, in dieser Nacht ein ausgelassenes Fest zu feiern? Zufall oder Schicksal – das spielte für die beiden keine Rolle!
»Weißt du noch, wie wir alle auf deiner Hochzeit mit Esteban getanzt haben, he?« rief Sanchez ihr mit einem Zwinkern in Erinnerung, als Steve nicht hinsah.
»Dios! Das ist lange her – aber du hast dich nicht verändert! Ich kann mich noch erinnern, wie eifersüchtig meine treue Conceptión war.«
Tanzen heißt, sich zu verlieren, dachte Ginny ... zurückzugehen in die Vergangenheit, zu der Zeit, als Tanzen das einzige gewesen war, das ihr half, für das Schicksal zu überleben, von dem sie immer gewußt hatte, daß es für sie bestimmt war – ein Mann, den sie nie hätte lieben dürfen und dem sie nie hatte widerstehen können. Ihr Ehemann.
»Grünauge ... für wen tanzt du jetzt?« Leise geflüsterte Worte, die sie sekundenlang atemlos verstummen ließen, bevor sie, ohne zu zögern oder darüber nachzudenken, antwortete: »Für dich, Steve, mein Liebster, immer und ausschließlich für dich!«
Später trug er sie auf seinen Armen zu ihrem provisorischen Lager für diese Nacht – draußen unter den Sternen und einem untergehenden Viertelmond. Und dort liebte er sie; mit Worten und mit Berührungen, tastend und eindringlich, bis sie erfüllt war, ihr Körper an der Oberfläche wie im Innern bebte und sie zur gleichen Zeit das schweißfeuchte Vibrieren seines Körpers auf und in sich spürte. Plötzlich fiel ihr ein, wie unsäglich verzweifelt sie gewesen war, als sie vor langer Zeit geglaubt hatte, sie würde das nie wieder erfahren und es nie wieder spüren.
Eigentlich müßte ich böse auf ihn sein, dachte Ginny schläfrig, immer noch an ihn geschmiegt. Er hatte kein Recht, sie so zu behandeln, als wäre sie seine Geliebte ... oder seine unfreiwillige Gefangene, wie sie es einmal gewesen war. Aber ... es hatte schon so viele Anfänge gegeben ... und so oft ein Ende, das nur wieder ein neuer Anfang war! Die eigentliche Wahrheit, an der sie ewig festhalten konnten, war, daß sie sich liebten – vielleicht sogar am meisten dann, wenn sie sich bekämpften.
Er hatte sie verschleppt ... und ihr dann die Freiheit gegeben, zu tanzen – zu wählen! Weil er sie liebte und wollte, daß sie frei wählte.
Was zählte die Vergangenheit? Das waren für sie beide Lehrjahre gewesen. Die Gegenwart zählte, und was sie jetzt lernten, würde wachsen und in die Zukunft wirken. Und es war aufregend, von dem Mann, den man liebte, überwältigt zu werden! Die Verwirklichung einer Phantasie! Jedenfalls wurde ihr das jetzt klar. Ob sie ihn gehaßt oder geliebt hatte, Steve war für sie immer Gegenstand ihrer Phantasie gewesen – wie sie vielleicht für ihn?
»Steve, du bist meine einzige Liebe, meine einzige wahre Liebe ... auf ewig. Ich habe Mittel gesucht, um dir weh zu tun ...«
»Und ich genauso, weil ich es nicht gewohnt war, daß eine grünäugige Verführerin meine Gedanken beherrscht! Bruja! Ich glaube, ich habe zugelassen, daß du Besitz von meiner Seele ergriffen hast – jedenfalls gehst du mir nicht aus dem Sinn, ob es mir nun gefällt oder nicht. Wir sind einander verfallen, querida.«
»Ich töte jede Frau, die dich anrührt!«
»Und ich würde jeden Mann töten, der versucht, dich anzurühren – ob du ihn dazu aufgefordert hast oder nicht!«
Wieder bewegten sie sich im Einklang miteinander – hielten sich schwellend und einander entgegenwachsend umschlungen.
Diesmal war es nicht nötig, die Worte ›Ich liebe dich‹ zu sagen. Diesmal wußten sie es beide.
Teil IMexiko
Das Spiel der Verstellung
Kapitel 1
Während Laura Morgan sich von ihrer mürrischen Zofe ergeben die zerzauste Haarmähne kämmen und bürsten und das hübsche Kleid über einem Spitzenmieder zuknöpfen ließ, das sie nicht brauchte und – ebenso wie das Kleid – ausziehen würde, sobald Filomena sich zurückzog, um ihre Siesta zu halten, dachte sie an ihre Eltern, ihre merkwürdige Beziehung, die sie nicht verstehen konnte und vielleicht auch niemals verstehen würde.
Was hatte sie zusammengeführt? Und was hatte sie, nach ihren zahlreichen Trennungen und Auseinandersetzungen, erneut miteinander verbunden und hielt sie am Ende zusammen?
Liebe? Die Herausforderung? Was? Aus irgendeinem unerfindlichen Grund und trotz all der Dinge, die sich ereignet hatten, und der verschiedenen Richtungen, in denen das Leben der beiden verlaufen war, liebten ihre Eltern sich, soviel wußte Laura sicher, auch wenn es nicht die brave, romantische, stille Liebe war, wie sie in den Büchern, die sie las, beschrieben war. Irgendwie teilten sie die Gefühle des anderen, spürten sich gegenseitig ... und sie wußte das – mehr als ihr Bruder Franco – instinktiv, ohne die Komplexität ihrer Beziehung tatsächlich zu begreifen.
Es fiel ihr schwer, sich ihre Eltern als Liebende oder nur getrennte Individuen vorzustellen. Und obwohl Laura sich für sie freute, daß sie sich in der Gesellschaft des anderen offensichtlich so wohl fühlten, kam sie sich manchmal ausgeschlossen vor aus ihrer besonderen, engen Gemeinschaft. Es gab sogar Augenblicke, in denen sie voller Selbstmitleid war – in denen sie sich einsam fühlte, trotz ihrer geliebten Bücher und des Tagebuchs, in das sie manchmal stundenlang alles, was sie bewegte, schrieb, zurückgezogen in ihr Zimmer oder an ein kühles, geschütztes Plätzchen, wo die Bäume, behangen mit Ranken voller schwer duftender Blüten, die ebenso gelb leuchteten wie die Sonnenstrahlen, die durch das Bogendach der Zweige über ihr hereindrangen, sich dicht aneinander drängten.
Seitdem Franco sich mehr mit der hübschen, scheuen Mariella aus dem nahe gelegenen Dorf beschäftigte, fühlte sich Laura noch einsamer, und ihr blieb nichts als ihre Phantasie, in der sie alle möglichen aufregend& und romantischen Situationen heraufbeschwor – und die Tagebücher, in denen sie, über sich selbst wie über eine andere Person schreibend, alle ihre geheimen Phantasien festhielt.
Nun mußte Laura sich allerdings widerwillig eingestehen, daß es ihr, da sie viele Gefühle noch nicht selbst erfahren hatte, schwerfiel, darüber zu schreiben.
Die einzigen Liebenden, die sie kannte, waren ihre Eltern und Tante Missie und Onkel Renaldo. Aber die Liebe zwischen Missie und Renaldo war anders – sauber und weniger stürmisch; nicht die leidenschaftliche Liebe, die sie bei ihren Eltern spürte, die zu Wutausbrüchen führte und dazu, daß sie sich verhielten, als würden sie sich hassen, nur um gleich darauf die Schlafzimmertür mit dem Fuß hinter sich zuzustoßen. Und dann blieben sie eine halbe Ewigkeit in dem verschlossenen Raum.
Aber die Liebe, überlegte Laura. Was war das? Wie viele Gesichter hatte sie, und aus wie vielen Facetten setzte sich dieses Gefühl zusammen, über das seit so vielen Jahrhunderten Lobpreisungen geschrieben wurden? War die Liebe etwas, das einen Menschen wie ein unbändiger Wirbelwind mitriß, oder war sie eine Falle? Laura schwor sich grimmig, daß sie sich niemals dem Gefängnis überlassen würde, dessen Mauern die eigenen Gefühle waren!
»So, das wär's, endlich geschafft!« erklärte Filomena und trat zurück, um ihr Werk zu begutachten. »Und heute siehst du zumindest wie eine junge Dame aus, wenn du deinen zukünftigen novio begrüßt.«
Augenblicklich flammte Lauras launisches Temperament auf. Sie fuhr von dem Spiegel herum, in dem sie ihre neue und ungewohnte Erscheinung nachdenklich betrachtet hatte, und runzelte zornig die Stirn.
»Mein novio? Ich habe keinen Verlobten – und werde auch nie einen haben, es sei denn, ich entschließe mich, einen Mann zu wählen, der nach meinem Geschmack ist. Hast du mich verstanden? Mein Vater und meine Mutter erwarten heute abend einen Besucher nicht ich! Mir ist er völlig gleichgültig – vielleicht beschließe ich sogar, diesen Fremden aus Kalifornien überhaupt nicht kennenzulernen. Ich habe jedenfalls unangenehme Dinge über diesen Mann gehört, als wir das letzte Mal auf der rancho in Monterey waren. Und noch dazu von seinem eigenen Bruder! Ich habe nicht die Absicht, eine seiner vielen Frauen zu sein – und noch viel weniger seine novia –, und das habe ich meinen Eltern auch gesagt! Mein Urgroßvater und sein Großvater hatten kein Recht, eine so lächerliche Vereinbarung zu treffen.« Als sie Filomenas bestürzten Blick sah, holte sie tief Atem und fuhr mit beherrschter Stimme fort: »Ach, es tut mir leid, liebe Filomena! Es ist schließlich nicht deine Schuld, nicht wahr? Ich – ich bin nur im Augenblick ein wenig durcheinander – bitte, hab Verständnis, und verzeih mir!«
Sie umarmte die Frau liebevoll, um sie zu besänftigen, aber nachdem Filomena unter leisem Murren und Gebrummel hinausgegangen war, wandte sich Laura wieder dem Spiegel zu und zog ihrem Bild darin eine Grimasse. Eine Dame, wahrhaftig! Bah! Das Haar aufgesteckt und in Zöpfe geflochten und in Locken gelegt. Ein Kleid, das in der Taille so eng geschnürt war, daß ihr das Atmen schwerfiel. Wie konnte eine Frau, Dame oder nicht, es ertragen, sich so zu kleiden, wie männliche Modeschöpfer, denen die natürlichen Bedürfnisse einer Frau gleichgültig waren, es so willkürlich als modisch diktierten?
Mode, Etikette, was sich schickte und was sich nicht schickte, waren Dinge, die sie ebenso einengten wie die Mieder, die sie verabscheute und nicht brauchte, und alles wegen eines törichten Mannes und einer lächerlich feudalistischen Vereinbarung, die zwei Familien miteinander getroffen hatten, als sie noch ein kleines Kind gewesen war! Sie wußte natürlich, daß die ganze Sache unsinnig war; und sie hätte diesen sogenannten novio mit einem Lachen aus ihren Gedanken vertreiben können, wäre nicht das Wissen gewesen, daß ihr nur noch so kurze Zeit hier blieb – an einem Ort und in einer Umgebung, die sie liebte, unter Menschen, die sie liebten und verstanden.
Immer noch ihr Spiegelbild anstarrend, drängte Laura mit einem Blinzeln die aufsteigenden Tränen der Wut zurück. Warum mußte sich ihr freies, glückliches Leben so plötzlich ändern? Warum konnte sie nicht zu Hause oder bei Missie und Renaldo bleiben, anstatt nach Europa gehen zu müssen, um dort zu einer vorbildlichen, eleganten jungen Dame erzogen – nein, zurechtgebogen war das zutreffendere Wort zu werden; eine Leibeigene, die auf den Hochzeitsmarkt getrieben wurde wie eine Sklavin zum Verkauf?
Ihr Zwillingsbruder Franco dagegen freute sich auf seine große Europareise. An die arme kleine Mariella, die ihn liebte und von der er in seiner typisch männlichen, unverbindlichen Art gesagt hatte, daß er sie mochte, schien er dabei überhaupt nicht zu denken. Mariella würde wahrscheinlich verheiratet sein, wenn Franco zurückkehrte – falls er überhaupt wieder nach Hause kommen wollte, nachdem er die Fleischtöpfe Europas kennengelernt hatte. Laura liebte dieses Wort; es lenkte ihre Gedanken für einen Augenblick von ihrem gegenwärtigen Problem ab. ›Fleischtöpfe‹ beschwor alle möglichen, herrlich dekadenten Bilder herauf!
Es gab Zeiten, in denen Laura weder sich selbst noch ihre wechselnden Launen und Stimmungen verstehen konnte. Sie war fast achtzehn – ein Alter, in dem man hier in Mexiko schon beinahe als alte Jungfer betrachtet wurde –, aber man sah ihr dieses Alter nicht an, wenn sie bequem, wie sie es zu nennen bevorzugte, gekleidet war in ihrer gewohnten schäbigen und zwanglosen Aufmachung, in der sie wie ein junges, kindliches Bauernmädchen oder wie eine Zigeunerin aussah. Und doch war sie in mancher Hinsicht bereits eine Frau, die sich in der Welt jenseits ihrer geborgenen, vertrauten Umgebung auskannte – in einer Welt, die sich ihrem suchenden, wißbegierigen Geist durch die Bücher öffnete, die sie so hungrig verschlang, die meisten davon aus der umfangreichen Bibliothek Onkel Renaldos ausgeliehen. Ihr verständnisvoller Tio Renaldo, ein Cousin ihres Vaters, war es auch gewesen, der sie als erster ermutigt hatte, ihre Empfindungen und knospenden Gefühle in Worte zu fassen und zu Papier zu bringen – Augenblicke der Schönheit, der Ungewißheit und des Staunens über die Welt und ihre Verheißungen in Wortbildern und kleinen Skizzen festzuhalten.
Sie hatte zwei Jahre lang ein exklusives Internat für junge Damen in San Francisco besucht, hatte aber viel von Tio Renaldo, der von Beruf Lehrer war, und von ihrer Mutter, die, wie Laura mehr als nur vermutete, alles am eigenen Leibe erfahren hatte, gelernt. Von ihren Eltern hatte Laura Sprachen, Weltgewandtheit und Benehmen gelernt, und sie hatten ihr das Reiten, das Schießen und die Kunst, sich, wenn nötig, mit dem Messer oder mit den bloßen Händen zu verteidigen, beigebracht. Sie war darin ebenso geschickt wie Franco, aber was nutzte ihr das jetzt?
Unvermittelt schüttelte Laura ihre düsteren Gedanken ab, entschlossen, diesen Tag zu genießen und barfuß und ohne Sattel, wie sie es bevorzugte, auf ihrem rotbraunen Hengst Amigo auszureiten. Wie würde sie ihren Amigo vermissen! Wer würde ihn so ausgiebig und so zügellos reiten wie sie?
Ich will jetzt nicht einmal daran denken, beschloß Laura bei sich. Ich werde einfach jeden Augenblick, der mir hier noch bleibt, auskosten, und wenn ich über diesen Tag und seine Gefühle in meinem Tagebuch schreibe, trage ich ihn für immer bei mir und erlebe ihn immer wieder mit Wehmut und Traurigkeit neu.
»O perdición! Genug!« sagte Laura laut und betrachtete ihr Spiegelbild mit einer neuerlichen Grimasse. Eine Fremde erwiderte ihren Blick, eine junge Frau in einem eng geschnürten, hübschen, in den Farben Orange und Grün gemusterten Kleid, durch dessen Ösen aus Baumwollspitze ein Band gefädelt war.
Abgesehen von den Augen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte und die von so dunklem Blau waren, daß sie manchmal schwarz wirkten, konnte sie plötzlich ihre Mutter in sich erkennen – in der zigeunerhaften Schrägstellung der Augen und Brauen; dem ganz leicht gespaltenen Kinn, das in diesem Augenblick trotzig hochgereckt war. Ihr Haar war, gleichermaßen trotzig und unbändig, gelockt, trotz aller Anstrengungen gen der armen Filomena, es auch nur annähernd in eine modische Frisur zu verwandeln, mit Hilfe von Kämmen, die ihr in die Kopfhaut stachen, und zahllosen Nadeln, denen es nicht gelang, die Strähnen und Löckchen, die sich um ihre Schläfen und Wangen ringelten und sogar vereinzelt um den schlanken Nacken stahlen, zu bändigen.
Ihr Haar, das in jüngeren Jahren fast so dunkel gewesen war wie das ihres Vaters, hatte in der heißen Sonne Mexikos die Farbe geändert, und es zeigten sich jetzt kupferrote Strähnen in ihrer ›wilden Mähne‹, wie ihre Zofe diese Pracht mißbilligend genannt hatte. Wenigstens, dachte Laura, habe ich Mamas Wangenknochen. Entschlossen streifte Laura das Kleid ab und zog statt dessen ihre bevorzugte Reitkleidung an: eine dünne baumwollene camisa und einen weiten, verblichenen Baumwollrock, der es ihr ermöglichte, bequem im Herrensitz zu reiten. Sie scherte sich nicht im geringsten darum, ob sie unverschämt viel Bein zeigte. Jeder hier in der Gegend kannte sie und war es gewohnt, sie in dieser Kleidung reiten zu sehen; im übrigen würde es niemand wagen, die Tochter des Padrón und der Padrona zu kritisieren.
Filomena würde sich inzwischen zum Mittagsschläfchen zurückgezogen haben, überlegte Laura, während sie aus ihrem Zimmer trat; es würde also keinen unerfreulichen Auftritt mit ihr geben. Und Marisa, die ihre Mutter vor langer Zeit als Baby aufgenommen hatte und die darauf bestand, das Kochen auf der Hacienda de la Nostalgia zu übernehmen, wenn ›ihre‹ Familie da war, konnte Laura nichts abschlagen, selbst wenn sie wußte, daß das Mädchen irgendeinen Unfug im Schilde führte, den Filomena ohne Zweifel mißbilligen würde!
Laura ging in die Küche hinunter und verkündete unter Schmeicheln und Schöntun, daß sie ein wenig mit Amigo auszureiten beabsichtigte. Ob sie eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken haben könnte, die sie genießen könnte, wenn sie anhielt, um das Pferd verschnaufen zu lassen?
»Natürlich«, erklärte Marisa, ohne zu zögern. Und nein – sie würde es niemandem erzählen, es sei denn, die Señora selbst fragte sie danach.
»Nicht einmal meinem verabscheuungswürdigen Bruder? Versprochen?«
»Nein, nein, ich werde es niemandem sagen außer der Señora. Und dann auch nur, wenn sie mich fragt«, wiederholte Marisa.
Nachdem sie ihr Mittagessen und einen Weinschlauch in einem der kleinen, an beiden Enden eines Ledergurtes befestigten Lederbeutel verstaut hatte, die sie immer vor sich über den Pferderücken hängte, wenn sie sich nicht die Mühe machte, Amigo einen Sattel aufzulegen, führte Laura das unruhige Tier außer Hörweite des Hauses, bevor sie aufsaß und die Fersen in seine Flanken stieß – das Zeichen für einen wilden Galopp.
Franco sah, wie seine Schwester auf ihrem stürmischen Hengst, der fast ebenso ungezähmt war wie sie selbst, vorüberjagte, und schüttelte den Kopf. Laura war unverbesserlich eigensinnig und halsstarrig, und der Mann, der es einmal wagen würde, sie zu zähmen, tat ihm leid.
»War das nicht deine Schwester?« Seine Begleiterin richtete sich mit vor Verwunderung gerunzelter Stirn auf einem Ellbogen auf. »Aber ich dachte –«
»Ich glaube, wir alle haben gedacht, daß sich meine Schwester wenigstens heute wie eine Dame benehmen würde! Aber du weißt ja, wie Laura ist! Wütend auf alle Welt, wenn sie ihren Willen nicht bekommt, und wehe dem, der versucht, sie zu bändigen. Sie kennt den Mann, der ihr novio sein soll, nicht einmal. Aber sie wird ihn bestimmt so vor den Kopf stoßen, daß er entsetzt das Weite sucht! Ich kann ihr allerdings keinen Vorwurf für diesen wilden Ausritt heute machen. Sie braucht das Gefühl der Freiheit noch einmal, bevor sie das alles hinter sich lassen muß.«
Galten seine Worte nur Laura, oder sprach er auch für sich selbst, so fragte er sich. Francos Blick hatte sich ein wenig umwölkt, und sein Körper hatte sich gestrafft, als er seine Schwester wie eine bruja, eine Hexe auf dem Besen mit ihrer Mähne, die wild hinter ihr herwehte wie eine im Wind flatternde Fahne, an sich vorüberreiten gesehen hatte. Würde auch er es bedauern, von diesem Ort mit all seinen Erinnerungen wegzugehen, wenn sie im nächsten Monat nach Europa abreisten? Und Mariella – wie konnte er es ertragen, Mariella zu verlassen?
Er befand sich jetzt mit ihr an ihrem liebsten Treffpunkt – einer verschwiegenen kleinen, grasbewachsenen Lichtung, die auf zwei Seiten von Bäumen und auf der anderen Seite von einem hohen Felsüberhang geschützt war. Ein kleines Bächlein rieselte von den Felsen herunter und bildete einen kleinen Teich.
Sie konnten durch den Pflanzenvorhang hinausblicken, aber niemand, der im vollen Sonnenlicht vorüberkam, konnte sie hier in ihrer schattigen grünen Laube sehen.
Er und Mariella trafen sich hier nun schon seit einigen Jahren heimlich – wann immer er aus der Schule im Osten nach Hause zurückkehrte, wann immer sie es einrichten konnten. Seine süße Maya-Indianerin, seine Mariella. Er sah in ihr besorgtes Gesicht und beantwortete ihre unausgesprochenen Fragen mit Küssen, leidenschaftlich, zärtlich, fordernd – dann wieder zärtlich, bis sie beide alles und jeden außer sich selbst und diesen Augenblick vergessen hatten.
Laura hatte auf ihrer überstürzten Flucht niemanden bemerkt – und eine Flucht war es ohne Zweifel, das mußte sie sich eingestehen. Eine Flucht vor dem Unbekannten, eine Flucht vor etwas, mit dem sie sich plötzlich und unerwartet konfrontiert gesehen hatte. Ja, es war ein Schock für sie gewesen.
Ihr fiel ein, wie sie ihre Mutter und ihren Vater ungläubig angestarrt hatte, überzeugt, daß sie einen Scherz mit ihr machten! Verlobter? Und sie erfuhr zum ersten Mal davon? Zur Abwechslung sagte ihre Mutter, die mit den Fransen ihres hellen Schals spielte, einmal nichts.
»Wovon redet ihr überhaupt, um Himmels willen?« hatte sie gesagt. »Ich verstehe das einfach nicht! Ihr meint doch nicht im Ernst – ihr könnt doch nicht wirklich ...«
»Ich weiß nicht, ob du dich an deinen Urgroßvater erinnerst«, hatte ihr Vater erwidert, »aber er war ein Mann aus dem alten Land, der seine Gewohnheiten und seine Lebensweise oder seine Überzeugungen niemals änderte.«
»Aber was hat das alles mit mir zu tun? Oder mit einer Heirat? Einer für mich arrangierten Heirat? Du hast bisher nie etwas davon erwähnt; niemand hat mir je gesagt –«
»Laura, Liebes«, unterbrach sie ihre Mutter hastig. »Ich möchte nicht, daß du glaubst, du würdest zu einer Ehe gezwungen. Selbstverständlich nicht! Ich hoffe, du kennst/deinen Vater und mich gut genug. Was wir dir zu erklären versuchen, ist, daß es so etwas wie ... wie würdest du es nennen, Steve?«
»Es gibt eine Vereinbarung oder eine ›Übereinkunft zwischen den Familien‹«, erklärte er mit unbewegtem Gesicht, nicht ohne das boshafte Funkeln in den Augen seiner Frau zu bemerken.
Lauras Blick flog zwischen ihren Eltern hin und her, dann sagte sie und stampfte dabei fast mit dem Fuß auf vor Zorn: »Hört auf, ihr zwei, hört auf! Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um –« Sie faßte sich und holte tief Atem, bevor sie mit ruhigerer Stimme fortfuhr: »Ich verstehe immer noch nicht, und ihr habt mir nichts erklärt!«
»Oh, es ist etwas, das – wie soll ich es sagen? –, das sein Großvater und der Großvater deines Vaters miteinander vereinbart haben. Sie glaubten natürlich noch an die alten feudalen ...« Ginny brach lachend ab, als sie der finstere Blick ihres Mannes traf.
»Bräuche«, vervollständigte Steve ihren Satz, den Blick jetzt auf Lauras zorngerötetes Gesicht gerichtet.
»Aber Papa – was meinst du damit, wenn du sagst, daß bestimmte Vereinbarungen getroffen wurden?«
»Ja, wie diejenigen, die dein Vater mit dieser Ana getroffen hatte, wie ich mich erinnere«, warf Ginny sanft ein und beantwortete Steves drohenden Blick mit einem liebenswürdigen Lächeln.
»Ich bemühe mich, geduldig zu sein«, sagte Laura hitzig und mit gepreßter Stimme. »Aber ich muß gestehen, daß ich immer noch kein Wort von dem, was ihr sagt, verstehe. Was meint ihr mit einem Verlobten? Und warum habe ich nie zuvor von dieser albernen Vereinbarung gehört, die doch sicher keine Gültigkeit hat? Das wollt ihr damit doch nicht sagen, oder?«
»Alles, was wir dir zu sagen versuchen«, erklärte Ginny beschwichtigend, »ist, daß wir uns bemühen müssen, uns in dieser Angelegenheit, nun, sagen wir, manierlich zu betragen. Ich bin sicher, daß Mr. Challenger die Vereinbarung nicht besser gefällt als dir!«
»Mr. Challenger, hast du gesagt? Doch sicherlich nicht Johnny?«
»Ich fürchte, nein. Ich weiß, wie gut du dich mit John Challenger verstanden hast, als du in Kalifornien warst. Aber, nein, in diesem Fall handelt es sich um seinen älteren Bruder.«
»Du meinst das schwarze Schaf? Der Verräter, der –«
»Nimm dich in Acht, junge Frau«, fiel Steve ihr ins Wort. »Er ist zufällig ein Freund von mir!«
»Oh, diese Art Freund!« sagte Laura und reckte das Kinn in einer Weise in die Höhe, die Steve viel zu sehr an seine dickköpfige Frau erinnerte.
»Alles, was ich dazu zu sagen habe«, fuhr Steve entschlossen fort, »ist, daß du Mr. Challenger begrüßen wirst und daß du höflich zu ihm sein wirst; mehr wird nicht von dir verlangt!«
»Oh, es ist unmöglich, unerträglich, und ich mache das Spiel nicht mit!« brauste Laura auf. »Wie konntet ihr nur? Wahrscheinlich ist er in deinem Alter Papa, und –«
»Laura, Trent Challenger ist erst dreißig! Sicherlich nicht zu alt, um interessant zu sein.«
»Aber viel zu alt für mich!«
»Laura!« fiel Ginny feinfühlig ein, »du mußt begreifen, daß wir früher oder später einmal alle lernen müssen, uns zu verstellen – zumindest aber höflich zu sein, wenn die Angelegenheit nicht von allzu großer Bedeutung ist. Mein Liebes, du mußt wissen, daß weder dein Vater noch ich die Absicht haben, dich zu einer Verlobung zu zwingen – ganz zu schweigen von einer Heirat! Alles, was wir von dir verlangen, ist, daß du dich höflich benimmst, wenn Trent Challenger hier eintrifft, und wenn die Sprache auf diese Vereinbarung kommt – was gar nicht sicher ist –, wird er zweifellos mit deinem Vater reden, und dann wird er die Sache ein für allemal aus der Welt schaffen.«
»Was meinst du damit, daß er mit Papa reden wird?« entgegnete Laura mit erhobener Stimme. »Was hat Papa damit zu tun? Was ist mit mir?«
Unvermittelt erhob sie sich mit merkwürdig ruhiger Miene. »Also gut«, brachte sie kühl hervor. »Ich nehme an, daß ohnehin nichts, was ich sage, etwas ändern wird.« Damit machte sie kehrt und verließ, die Tür mit einem lauten Knall hinter sich zuschlagend, den Raum. Das alles ging Laura wieder durch den Kopf, während sie auf Amigos Rücken vom Hause fortgaloppierte.
Ihr zu verkünden, daß sie einen Verlobten hatte, von dem sie nie etwas gehört hatte und dem gegenüber sie sich höflich benehmen sollte – diesmal gingen ihre Eltern zu weit. Sie würde diesen Trent Challenger nicht begrüßen, und wenn es sein mußte, würde sie ganz sicher nicht vorgeben, höflich zu sein! Sie hatte alle Geschichten über ihn gehört – ein Revolverheld, ein Abtrünniger, manche nannten ihn sogar einen Gesetzlosen.
Er war nie wieder nach Hause zurückgekehrt, nachdem er fortgegangen war; nicht einmal, als seine Mutter im Sterben gelegen hatte. Es war immer dem armen Johnny überlassen geblieben, mit allem fertig zu werden, und nun wagte es Johnnys nichtsnutziger Bruder, aufzutauchen und sich als ihr Verlobter ankündigen zu lassen! Finster fragte sich Laura, ob er wohl Geld brauchte. Vielleicht war er enterbt worden oder würde es werden, wenn er sie nicht heiratete, wie es zwei alte Männer bestimmt hatten. Ihr fiel ein, daß Johnny ihr einmal erzählt hatte, daß sein Großvater mütterlicherseits ein unbeugsamer und autoritärer Mann gewesen war, der, ebenso wie ihr Urgroßvater, keine Skrupel gehabt hatte, das Erbe für seine Nachkommen mit bestimmten Bedingungen zu verknüpfen. Nun, das war nicht ihr Problem! Ihr war es gleichgültig, ob sie das Geld ihres Urgroßvaters erbte oder nicht!
Nein, dachte Laura jetzt trotzig. Ich werde ihm nicht begegnen! Sie würde einfach dem Haus fernbleiben; sie würde Anita im Dorf besuchen und über Nacht bleiben, und ihre Eltern würden sie entschuldigen müssen. Sie würde die Folgen später auf sich nehmen, zum Teufel!
Laura hoffte inständig, daß Trent Challenger nicht die Absicht hatte, lange auf der Hacienda zu bleiben.
Kapitel 2
Trent Challenger – hätte Laura es nur gewußt! – hatte nicht die. geringste Absicht, länger auf der Hacienda de la Nostalgia zu verweilen, als er benötigte, um Steve Morgan und seiner reizenden Frau seine Ehrerbietung zu erweisen und das Paket, das er aus Mexiko City mitgebracht hatte, abzuliefern. Er hoffte inständig, daß Laura Morgan abwesend sein würde; auf diese Weise würde die Peinlichkeit und Unannehmlichkeit eines Treffens zwischen ihnen vermieden werden. Wenn sein Geschäft mit Steve erledigt war, konnte er zur Abwechslung ein paar Stündchen in einem Bett schlafen, bevor er morgen in aller Frühe wieder aufbrach.
Er blieb nirgendwo länger als unbedingt notwendig, wollte und mußte niemals irgendwohin oder zu irgend jemandem zurückkehren. Nicht mehr. Es hatte einmal so etwas wie eine Heimat für ihn gegeben, aber nur, solange seine Mutter noch am Leben gewesen war und alles mit ihren kleinen, zarten und trügerisch zerbrechlich wirkenden Händen, die in Wirklichkeit so kräftig waren, zusammengehalten hatte. Seine Mutter hatte es geschafft, stark zu sein, obwohl ihr Mann sie verlassen hatte, um seinen reichen Freunden und einem englischen Adelstitel hinterherzujagen.
Wie gewöhnlich, wenn Trent an seinen Vater dachte, verfluchte er ihn bei sich, weil er ein so egoistischer, dünkelhafter Kerl gewesen war und seine Mutter mit derartiger Gleichgültigkeit und Arroganz behandelt hatte.
James Challenger hatte sich nach dem Studium in Harvard nichts sehnlicher gewünscht, als eine große Europareise mit seinem Freund Arthur Singleton, Sohn eines mit einer reichen Amerikanerin verheirateten englischen Auswanderers, zu unternehmen.
Mamacita – Carmen Maria Teresa de Avila – stammte aus einem alten spanischen Geschlecht. Ihre Familie besaß fast vierhunderttausend Hektar Land im rasch erblühenden südlichen Teil von Kalifornien, und der aristokratische Don Manuel de Avila war ein kluger und gerissener Geschäftsmann gewesen, der seine Millionen dort angelegt hatte, wo sie den größten Profit abwarfen – in Mexiko, überall in den Vereinigten Staaten und, so wurde gemunkelt, sogar in Europa und Südamerika.
Wenn Don Manuel eine Schwäche hatte, dann war das seine einzige Tochter, seine Carmencita mit den dunklen, funkelnden Augen und der unbändigen Fülle schwarzen Haares. Sie hatte die engelhafte Schönheit ihrer Mutter und die Klugheit und den Geschäftssinn ihres Vaters geerbt. Trotz alledem war sie ebenso fröhlich und temperamentvoll wie jede siebzehnjährige Frau, die gerne tanzte und Feste feierte.
Warum, fragte sich Trent immer wieder bitter, hatte sie es zugelassen, mit einem Mann verheiratet zu werden, den sie kaum kannte? Nur weil Christian Challenger und Don Manuel seit Jahren Geschäfte miteinander machten und Partner in zahlreichen Geldanlagen waren?
»Aber, mein Sohn – ich habe mich auf den ersten Blick in deinen Vater verliebt!« hatte seine Mutter ihm einmal vorgehalten. »Eines Tages wirst du auch lernen, die Liebe zu verstehen, die keine Rücksicht nimmt auf die Gefahr, verletzt zu werden. Er sah so gut aus, dein Papa – gerade aus Harvard zurück und wie ein Mann aus dem Osten gekleidet. Es war nicht seine Schuld. Ich wollte ihn, sagte das meinem padre, und wie gewöhnlich gab er mir nach.«
James hatte ebenfalls nachgegeben, wenn auch ziemlich mißmutig. Aber, was diese Heirat anbetraf – eine Vereinigung zweier Familien, die bereits durch Freundschaft, gegenseitige Hochachtung und Geschäfte miteinander verbunden waren –, hatte sich Christian Challenger entschlossen und unnachgiebig gezeigt. Wenn sein ältester Sohn seine zukünftige Frau auch im Augenblick nicht ›liebte‹, würde sich diese Liebe mit der Zeit und den gemeinsamen Kindern schon einstellen.
James durfte sechs Monate in Europa verbringen, und nachdem er sich die Hörner abgestoßen hatte, kehrte er zurück, um zu heiraten und Verantwortung zu übernehmen ... eine Verantwortung, die nicht viel mehr umfaßte, als vier Kinder zu zeugen – und sich so oft wie möglich fern der Einsamkeit und Langeweile der Carmel-rancho aufzuhalten.
Vorgeblich als Feriensitz für die Familie gedacht, hatte er ein palastartiges Anwesen mit gepflegtem Park in einer der beliebtesten und vornehmsten Gegenden San Franciscos erworben. Leland Stanford, Charlie Crocker und die sogenannten Silberkönige Hunt, Fair und McKay waren, zusammen mit ihren aufgeputzten, blasierten Frauen, seine Nachbarn. Er ritt mit ihnen aus, ging mit ihnen auf die Jagd und veranstaltete Saufgelage mit ihnen, während seine Frau sich um alles kümmerte: Geschäftsangelegenheiten, die Versorgung der Ranch, die Buchhaltung – einfach alles.
Gelegentlich kam James für ein Wochenende zu Besuch; wenn er Geld brauchte, blieb er auch ein paar Tage länger. Diese Besuche und die Besessenheit, mit der sein Vater seinen rechtmäßigen Anspruch auf einen alten englischen Herzogtitel verfolgte, hatten Trent mit einer Wut und Abneigung erfüllt, die an Haß grenzte.
Wie seine Mutter strahlte, aufgeregt wie ein Schulmädchen, wenn ihr Mann erwartet wurde! Und wenn er, unter herablassenden Ermahnungen an die Kinder, wieder verschwunden war, hatte sie stets einen traurigen Ausdruck in den Augen, den sie zu verbergen versuchte.
Zum einen, um den erzwungenen Besuch einer ›guten‹ Universität im Osten zu umgehen, zum anderen, weil er den Schmerz seiner Mutter nicht mit ansehen konnte, ohne gegen seinen Vater Mordgelüste zu hegen, war Trent mit sechzehn von zu Hause fortgegangen. Seine Mutter hatte ihn voller Verständnis und Liebe ziehen lassen – mit der Liebe, die sie so sanft und selbstlos verströmte, selbst an ihren Mann, der ein solches Gefühl weder verstand noch zu würdigen wußte.
Zum Teufel mit seinem Vater! Es wäre das beste, wenn sich ihre Wege nie wieder kreuzten – denn Trent hatte im Laufe der Jahre gelernt, sicher und mühelos und ohne Bedauern zu töten; mit dem Revolver, dem Messer oder den bloßen Händen.
Tatsächlich hatte sein Ruf dazu geführt, daß er in New Mexiko fast gelyncht worden wäre. Der ›mächtige Mann‹ der Stadt hatte festgestellt, daß seine Revolverhelden es nicht mit dem Mann, der nur unter dem Namen Trent bekannt war, aufnehmen wollten, und hatte es, da der Sheriff nach seiner Pfeife tanzte, so eingerichtet, daß er sich seiner auf legalem Wege entledigen konnte. Aber die Stadt und ihr mächtiger Mann wurden um das Vergnügen des Lynchens und des üblicherweise auf ein solches Ereignis folgenden Trinkgelages betrogen. Dem Sheriff wurde von einem Bundesmarshal kurzangebunden mitgeteilt, daß sein Gefangener zur Vernehmung an höherer Stelle gebraucht wurde – und damit war die Sache erledigt.
Sein Großvater, Don Manuel, hatte die Pinkertons auf die Spur seines vermißten Enkels gesetzt, und er hatte überdies einen einflußreichen Freund – einen gewissen Mr. James Bishop. Auf diese Weise war Trent ›gerettet‹ worden und hatte erfahren, daß seine Mutter gestorben war. Nach dieser Nachricht schien ihm alles gleichgültig, und er empfand nur noch Haß gegen sich selbst, weil er so lange von zu Hause weggeblieben war, und Haß gegen seinen Vater.
Don Manuel, der ein kluger Mann war und spürte, daß sein Lieblingsenkel ein Ventil brauchte für seine Wut und Bitterkeit, erhob keine Einwände dagegen, daß Trent für Mr. Bishop und seine Spießgesellen ›arbeitete‹. Denn Mr. Bishop trieb, wie Trent erfahren sollte, alle seine Schulden ein – und benutzte seine Schuldner für seine Zwecke.
Wie leicht und bereitwillig hatte Trent sich in Bishops Netzen einfangen lassen! Natürlich war er zuerst auf seine Tauglichkeit geprüft worden, indem man ihm schwierige Aufgaben zuwies – zum Beispiel, Ärger zu suchen oder heraufzubeschwören, wie es die Situation erforderte; und so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Wenn dabei getötet werden mußte, so tat er es in dem Wissen, daß er keine Gnade mehr zu erwarten hatte, wenn er gefaßt wurde. In gewisser Weise hatte er die Gefahr und das Abenteuer genossen – denn es hatte ihm keine Zeit gelassen, allzuviel und zu lange über die Vergangenheit mit ihren Schmerzen nachzudenken. Mit der rancho waren zu viele Erinnerungen für ihn verbunden, und er hatte keine Zeit gehabt, eine enge Beziehung zu seinen Schwestern und seinem jüngeren Bruder zu entwickeln. Besitz bedeutete ihm nichts, und er scheute, zu Recht mit dem Ruf des Einzelgängers behaftet, vor jeglichen Bindungen zurück.
Keine Bindungen – Gott, wie er Bindungen haßte –, das Gefühl, unterdrückt und eingeschlossen zu sein. Die Liebe und vor allem die Ehe waren für andere Menschen geschaffen, nicht für ihn. Die Lust und ihre Befriedigung, wenn ihm danach zumute war, reichten ihm vollkommen. Keine Fesseln wie seine Mutter, die durch ihre Liebe und Ergebenheit an einen Mann gebunden gewesen war, der sich nicht einmal die Mühe gemacht hatte, so zu tun, als läge ihm etwas an ihr!
Trent zwang sich, die häßlichen, bösen Gedanken, die sich ihm düster wie eine nagende Krankheit aufdrängten, beiseite zu schieben. Es gab zu viele andere Dinge, an die er im Augenblick denken mußte, wie zum Beispiel an die versiegelten Briefe, die er in der Satteltasche mit sich führte.
Morgen, wenn er – diesmal in Richtung Kalifornien – wieder aufbrach, blieb ihm genug Zeit, über sich und sein Leben nachzudenken. Seine Lippen in dem bärtigen Gesicht verzogen sich zu einem flüchtigen, sarkastischen Lächeln, als ihm einfiel, was diese unangenehmen Gedankengänge ausgelöst hatte.
Warum bestanden diese förmlichen alten Spanier, die die selbstherrlichen Gewohnheiten des letzten Jahrhunderts noch pflegten, immer noch darauf, Ehebündnisse zu arrangieren? Sein Großvater Avila beispielsweise und der Freund seines Großvaters, Don Francisco Alvarado. Weil sie den Reichtum, der sich in bestimmten Familien angesammelt hatte, wahren wollten? Nun, dieses arme Mädchen – wahrscheinlich noch ein Kind –, das ohne sein Wissen und Einverständnis zur passenden Braut für Don Manuels ältesten Enkelsohn bestimmt worden war, ängstigte sich vermutlich halb zu Tode! Einen lausigen Ehemann würde er abgeben für ein blauäugiges Fräulein, das keine Ahnung hatte vom Leben und der Leidenschaft! Sie würde zweifellos erleichtert sein, von ihm zu erfahren, daß er keinerlei Absichten hatte, ihr ein vorausgeplantes Schicksal aufzuzwingen, gleichgültig, was Mr. Bishop bei ihrer letzten Begegnung angedeutet haben mochte! Keine verdammte Zweckheirat für ihn – das hatte er klipp und klar gesagt. »Sie ist keine schlechte Partie«, hatte Bishop, seine Weigerung mißverstehend, hinter seinem Schreibtisch erklärt, während sich Trent zum Gehen anschickte.
»Na und?« hatte er damals gedacht, aber jetzt ertappte er sich bei der Überlegung, wie das Mädchen wohl sein mochte und wem sie nachschlug. Die Tochter von Steve Morgan – und Ginny. Ginny Brandon Morgan mit den blitzenden Smaragdaugen, dem glänzenden Kupferhaar und dem verheißungsvoll sinnlichen Mund.
Vor einigen Jahren, als er sie auf einem Bankett bei Sam Murdock, einem von Morgans Teilhabern und engsten Vertrauten, zum ersten Mal gesehen hatte, hatte er den Blick nicht von ihr wenden können – von diesem süßen, vielversprechenden Mund. Er hatte sie begehrt – stärker, als er je zuvor eine Frau begehrt oder begehren zu können geglaubt hatte, diese zigeunerhafte Zauberin, die sogar tanzen konnte wie eine echte gitana. Er hätte sich sogar vorstellen können, sich in sie zu verlieben, bis er erfuhr, daß sie Steve Morgans Frau und die Mutter seiner Kinder war.
Spaßeshalber fragte sich Trent, ob Laura Luisa Encaranción Morgan ihren Eltern im Aussehen oder Wesen glich. Er sagte sich, indem er mit einem Achselzucken ein zerkautes Zigarillo anzündete, daß er es bald herausfinden würde hoffentlich, nachdem er Gelegenheit gehabt hatte, ein Bad zu nehmen. Er war, nur mit kurzen Unterbrechungen, um zu essen oder ein wenig Schlaf zu bekommen, von Mexiko City bis hierher geritten – und heute hatte er sich noch vor Sonnenaufgang in den Sattel geschwungen.
Er konnte ein bißchen frisches Wasser vertragen – ebenso wie der kräftige Rappe, den er ritt. »He du, Laredo, riechst du irgendwo Wasser, Junge?« Er hatte weiter vorn Bäume und Gebüsch entdeckt. Ganz grün anstatt des üblichen dürren Brauns. Und als Laredo den Kopf hochwarf und mit geblähten Nüstern leise schnaubte, tätschelte Trent ihm den Hals.
»Na schön, Junge. Sieht aus, als bekämst du was zu trinken und ich ein kleines Bad.«
Trent Challenger war aus Gewohnheit vorsichtig – stets auf der Hut nach Zeichen möglicher Gefahren. Er lebte jetzt schon so lange mit der Gefahr, daß ihm die Vorsicht zur zweiten Natur geworden war. Wasser konnte auf einen Bach oder eine aus dem Felsen sprudelnde Quelle hinweisen. Fast immer wies es aber auch auf ein Tier hin, das dort trank – und möglicherweise auch auf Menschen. Winzige Siedlungen entstanden in der Nähe einer natürlichen Wasserversorgung.
Aber in diesem Fall hatte Trent noch keine Spur von Leben entdeckt. Keine Geräusche, kein schrilles, Kindergeschrei, kein Hundegebell. Nicht einmal das Meckern der unvermeidlichen Ziegen, die gewöhnlich frei umherstreiften.
Trent trieb sein Pferd langsam und vorsichtig durch dichtes Unterholz und herunterhängende Ranken voran, bis es auf eine kleine, grasbewachsene Lichtung trat, wo der von Bäumen und Büschen gesäumte Bach ein wenig breiter und tiefer wurde.
Laura war geritten, bis sie und Amigo müde waren – und überdies hungrig und durstig. Der Gedanke, ihre Freundin Anita zu besuchen, erschien ihr immer verlockender, besonders wenn Anitas gutaussehender älterer Bruder zu Hause war. Es würde ihr Spaß machen, mit ihm zu flirten, besonders weil er plötzlich begonnen hatte, die Frau in ihr zu bemerken. Und dann sollten sie doch später alle auf sie schimpfen und ihr vorhalten, wie unhöflich und unverantwortlich sie sich betragen hatte. Es war ihr gleichgültig! Sie hatte es satt, daß immer alles für sie bestimmt wurde!
Amigo schnaubte und erinnerte Laura daran, daß zumindest er Durst hatte und eine wohlverdiente Ruhepause vertragen konnte.
Laura beugte sich schuldbewußt vor und tätschelte seinen schweißnassen Hals.
»O Amigo! Wie gedankenlos von mir! Ich glaube, es ist Zeit für uns beide, uns ein bißchen abzukühlen, was?«
Ich liebe dieses Fleckchen, dachte Laura. Es ist so friedlich, so ruhig – abgesehen vom Vogelgezwitscher und dem leisen Gurgeln des Baches, der über Steine und Sand dahinplätscherte. Unter den Bäumen wuchs Gras, an dem Amigo knabbern konnte, nachdem sie ihn mit einem alten zerrissenen Unterrock, den sie stets bei sich trug, trockengerieben hatte. Als er zufrieden schien, aß Laura ihr frischgebackenes Sauerteigbrot mit großen Stücken Ziegenkäse und spülte ihr provisorisches Mahl mit Rotwein aus dem Schlauch hinunter.
Dies hier war eines ihrer Lieblingsplätzchen zum Nachdenken und Schreiben; manchmal lag sie dabei halb im, halb außerhalb des Wassers, das zu niedrig war, um ihren ganzen Körper zu bedecken, und schrieb, die Ellbogen auf die Uferböschung gestützt.
Heute gab es so vieles, worüber sie nachdenken, das sie auskosten und spüren wollte.
Laura war erhitzt, und so streifte sie Rock und Bluse ab und watete, nur mit ihrem ältesten und kürzesten Hemd bekleidet, in das himmlisch kühle Wasser. Sie beugte sich hinunter, um ihr Haar einzutauchen, bevor sie es zu einem Zopf flocht, der ihr schwer über die Schulter hing.
Der Bach war viel zu seicht, um ein richtiges Vollbad darin zu nehmen, aber sie konnte sich in das Wasser legen und sich dem Gefühl der Wellen überlassen, die so vergänglich waren wie dahinschießende, schillernd geflügelte Libellen.
Laura ließ ihre Gedanken in sonnendurchdrungener, ruhiger Trägheit wandern – fühlte sich wie ein Blatt, das auf dem Bach dahintrieb und nach überall und nirgendwo getrieben wurde.
Und dann war plötzlich alles zerstört, verschwand mit dem Eindringen einer lauten, unbekannten Stimme, die rief: »Hola, muchacha! Bist du eingeschlafen da drin, oder versuchst du, dich zu ertränken?«
Laura fuhr erschrocken in die Höhe und blickte in das bärtige Gesicht eines Fremden im Sattel eines staubbedeckten schwarzen Hengstes, der nervös den Boden scharrte und mindestens ebenso gefährlich aussah wie sein Reiter.
»Ah, ich sehe, du bist noch am Leben! Machst du das oft?« Und dann fuhr er ungeduldig auf spanisch fort: »Hast du die Sprache verloren?«
Er war ein hochgewachsener Mann mit harten Zügen, die Augen vom tief ins Gesicht gezogenen Rand eines zerbeulten, flachen schwarzen Hutes beschattet. Mit seinen überkreuzten Pistolengurten und den Gewehren, die auf beiden Seiten des Sattels in ihren Hüllen steckten, konnte er ein Gesetzloser, ein Söldner, sogar ein bandido sein. Überdies trug er Pistolen mit schmucklosem, abgenutztem Knauf.
»Sie haben kein Recht, mich so zu erschrecken!« fuhr Laura, nachdem sie ihre Stimme wiedergefunden hatte, ihn wütend auf spanisch an. Widersinnigerweise empfand sie keine Angst, sondern nur Zorn. Dieser Fremde war in ihr privates Plätzchen, in ihre Abgeschiedenheit eingedrungen, und sie wollte, daß er verschwand! »Und passen Sie auf, daß Ihr großes Biest von einem Pferd meinem nicht zu nahe kommt!«
Sie erhob sich, der Tatsache nicht bewußt, daß sie so gut wie nichts am Leibe trug, bis sie das leise Flattern seiner Nasenflügel und eine plötzliche Starre an ihm bemerkte, die sie daran erinnerte, daß sie ebensogut hätte nackt sein können, so wie das nasse Hemd auf ihrer Haut klebte.
Ein kalter Schauer lief über ihre sonnenerwärmte Haut. O Gott! Was, wenn ... »Gehen Sie endlich! Nachdem Sie sich nun satt gesehen haben!«
Sie würde keine Angst zeigen. Als er nicht gleich antwortete, trat Laura zwei Schritte vor; sie dachte an die Pistole, die sie unter ihrem Rock zurückgelassen hatte, die Pistole, die sie bei ihren Ausflügen immer mit sich führte. Und das Messer – aber das hatte sie in der Satteltasche steckenlassen!
»Hören Sie, es wäre besser, wenn Sie jetzt gleich verschwinden würden, Fremder!« sagte sie kühn. »Gehen Sie augenblicklich! Wenn meine Familie von dieser Szene wüßte, wären Sie trotz all Ihrer Pistolen ein toter Mann. Sie sehen aus wie ein ladrón – oder ein gringo von der falschen Seite der Grenze. Wir mögen Ihresgleichen hier nicht. Haben Sie verstanden? Was wollen Sie überhaupt hier?«
»Ich hatte vermutlich dasselbe vor wie du!« sagte der Mann, und zu ihrer Verärgerung lag eine Spur von Belustigung in seiner ruhigen Stimme. »Ich wollte mir den Staub ein bißchen abwaschen und mein Pferd tränken, das ist alles.« Er grinste. »Und wenn du Angst hast, ich würde dir zu nahekommen, brauchst du dir keine Sorgen zu machen! Ich verschwende meine Zeit nicht mit kleinen Mädchen«, fügte er verächtlich hinzu.
Zu ihrem Entsetzen ließ er sich aus dem Sattel gleiten und kam auf sie zu.
»Unterstehen Sie sich, näher zu kommen!« brauste Laura auf und warf ihm einen finsteren Blick zu.
Er war im Stehen noch größer, als es zuerst den Anschein gehabt hatte, so groß wie ihr Vater. Und er sah wirklich gefährlich aus – jetzt, da er ihr näher war, noch mehr als zuvor.
»Hör zu, Kleine«, sagte er, indem er den Hut abnahm und am Knie abstaubte. »Entweder können wir uns das Wasser teilen, oder du läufst, da du dein Bad schon genommen hast, nach Hause zu deiner Mutter. Comprende?«
»Oh!« stieß Laura wütend hervor.
Später dachte Laura, sie hätte ihren Zorn hinunterschlucken sollen. Hätte ihn bitten sollen, sich wenigstens umzudrehen, bis sie ihre Kleider angezogen hatte. Dann hätte sie an ihre Pistole gelangen können. Statt dessen nannte sie ihn törichterweise ein schmutziges Gringoschwein – und schnappte nach ihrer Pistole. Sie erreichte sie auch wirklich und packte sie in dem Augenblick, als ein staubiger Stiefel ihr Handgelenk fast lähmte und sie zwang, die Waffe fallen zulassen. Dann wurde sie hochgerissen und aus dem Bach gezogen.
»Hör zu, muchacha, ich mag Mädchen nicht, die versuchen, mir üble Streiche zu spielen!«
Er packte sie an den Schultern und schüttelte sie heftig, und Laura – außer sich vor Wut – schlug alle Vorsicht in den Wind.
»Bastardo! Cuchano! Hijo de putana! Laß mich los! Laß mich sofort los, oder es wird dir sehr leid tun, das verspreche ich dir! Du wirst getötet werden – ich werde dich umbringen, ich werde –«
»Du hast also die Ausdrucksweise einer puta und das Temperament einer wild gewordenen Wölfin! Und außerdem sprichst du Englisch«, bemerkte Trent, ebenfalls ins Englische zurückfallend. »Das ist eine hübsche Pistole, die du gegen mich benutzen wolltest – und kein schlechtes Pferd, das du da reitest! Hast du die Sachen gestohlen – oder hat der Sohn eines reichen haciendado sie dir als Gegenleistung für deine Gunst geschenkt? Hast du deinen Wutanfall jetzt überwunden, kleine puta? Kann ich dich jetzt ohne Gefahr loslassen?«
»Bastardo – ich bringe dich um!« Laura drehte sich in seinem Griff und konnte sich, indem sie das Knie hochschnellen ließ, fast losreißen. Aber er wich ihr mühelos aus und stieß ein hartes Lachen aus.
»Manche Männer mögen solche Furien wie dich – ich nicht!«
Sprachlos und fast wahnsinnig vor Wut, konnte Laura ihre Hand lange genug freibekommen, um nach seinem Gesicht zu schlagen, aber sie verfing sich nur in seinem dichten Bart. Oh, wie ihr sein höhnisches Lachen verhaßt war!
»Eine Wildkatze, so, so? Ich frage mich, ob überhaupt jemand weiß, daß du ganz allein hier bist. Hör auf zu zappeln. Sieh mich an, chica.« Er packte sie fester an den Handgelenken, bis sie gezwungen war, ihm in die Augen zu blicken ... sturmgrau ... eissilberne Augen eines Teufels; die einen starken Kontrast zu seiner sonnengebräunten Haut und dem schwarzen Haar bildeten, das ebenso lang und zerzaust war wie sein Bart.
Laura war, sekundenlang erstarrt unter diesen silberbewehrten, gnadenlosen Blicken, in seinem Griff gefangen und schnappte nach Luft. »Wirst du jetzt vernünftig sein und dich fortmachen, während ich ein Bad nehme? Ich habe nicht die Absicht, lange zu bleiben.«
»Gib mir meine Pistole!« stieß Laura mit erstickter Stimme hervor.
»Das tue ich lieber nicht, Herzchen. Ich traue dir nicht. Und ich will wirklich baden. Entweder gehst du jetzt brav weg, oder ich knebele dich und fessele dich an einen Baum, bis ich fertig bin. Was ist dir lieber? Und reiz mich nicht noch einmal. Keine Tricks mehr.«
Sie wandte den Blick nicht von seinem bärtigen Gesicht ab, sagte aber nichts. Er hatte ihre Handgelenke hinter ihrem Rücken festgehalten. Jetzt lockerte er seinen Griff ein wenig, worauf Laura eine Hand losriß und ihm mit aller Kraft ins Gesicht schlug und dabei ihn und alle seine Vorfahren mit Worten und Ausdrücken verfluchte, die sie sich nicht einmal erinnern konnte, je gehört zu haben, geschweige denn, gut genug zu kennen, um sie selbst zu benutzen.
»Was bist du für ein starrköpfiges Miststück!« fluchte er, bevor er sie mit dem Rücken in das schlüpfrige Gras warf und mit seinem Körpergewicht niederdrückte, während er ihr die Hände über dem Kopf festhielt und sich sein Waffenarsenal schmerzhaft in ihre weiche Haut bohrte.
Laura konnte kaum glauben, was geschah, als er über den Ansatz ihrer Brüste strich, bevor er eine Hand in Richtung ihrer Schenkel wandern ließ und sie küßte, hart und unnachgiebig, bis sie kaum noch Luft bekam.
»Hör zu, chica, das war nur eine kleine Kostprobe von dem, was dir passieren kann, wenn du nicht vorsichtiger bist! Ich habe dich vorher gewarnt ...«
Im ersten Augenblick war ihr nicht klar, was er mit ihr zu tun beabsichtigte.
Er fesselte sie an einen Baum, nachdem er sie mit seinem schmutzigen Halstuch geknebelt und ihr die Hände hinter dem Rücken gebunden hatte.
»Mach die Augen zu, wenn du nicht zusehen willst, chiquita«, sagte er, während er sich auszog.
Er läßt sich Zeit mit dem Baden, der Mistkerl, dachte Laura erbost, die Augen mit Tränen der Hilflosigkeit und Wut gefüllt. Sie wollte ihn und seine nackte Männlichkeit nicht sehen, Tier, das er war, ein häßliches, ungehobeltes Tier! Und doch konnte sie trotz ihrer Wut nicht umhin, gegen ihren Willen verstohlen neugierige Blicke auf ihn zu werfen – von oben bis unten.
Männer waren widerlich mit ihren raubtierhaften Instinkten! Er war groß – es war beängstigend groß. Nie wollte sie, daß solch ein unbeseeltes Ding Besitz von ihr ergriff. Und er hatte sich eingebildet, das wäre alles, was sie wollte – dieses Ding, das die Männer zwischen den Beinen hatten und auf das sie aus irgendeinem albernen Grund so ungemein stolz waren.
Während sie gezwungen war, in ihrer schäumenden Wut zu warten, wandte er ihr, indem er sich der Sonne zudrehte, den Rücken zu und trocknete sich mit ihrem Rock ab, wobei er wie ein Hund den Kopf schüttelte, um sein Haar zu trocknen.
»Ah! Das tut gut!« verkündete er, indem er sich ungeniert vor ihr streckte und saubere Kleider aus seinen Satteltaschen anzulegen begann. Ein verblichenes blaues Hemd und eine ebenso verblichene Hose, die viel zu eng saß. Er streifte dieselbe Lederweste über, die er zuvor getragen hatte, wusch die alten Kleider aus und schlang sie um den Sattelknauf, wo sie trocknen würden, wenn er seinen Ritt fortsetzte. Dann zog er ein frisches Paar Socken und seine Stiefel an. Er trug keine Sporen; diese Nebensächlichkeit war ihr aufgefallen. Was für ein Mann war er? Wer war er? Und wann, wenn überhaupt je, würde er sie freilassen?
Aus Lauras Blicken sprühten ihm Haß und Trotz entgegen, als er endlich zu ihr trat und nachdenklich auf sie heruntersah, was sie schmerzlich daran erinnerte, dass sie kaum bekleidet und hilflos war.
»Nun, das Bad war ausgezeichnet. Irgendwie finde ich es fast schade, daß ich nicht länger bleiben kann, kleine Wildkatze!« Sie zuckte zurück, als er wieder mit den Fingern über ihre Brüste strich.
Hatte er die Absicht, sie so zurückzulassen und einfach weiterzureiten?
Als sich dieser Gedanke in Lauras Bewußtsein brannte, versuchte sie mit aller Kraft, sich zu befreien.
Er saß bereits im Sattel! Er ... und dann beugte er sich zu ihr herunter, und Sekunden später sah sie das Messer in der Sonne blitzen und war frei.
»Du kannst dein Pferd behalten, muchacha. Was die Pistole betrifft, die nehme ich lieber mit. Wenn sie dir gehört, kannst du auf der estancia von Don Esteban Alvarado danach fragen. Adiós!«
Als Reaktion auf diese Worte zitterten Lauras Finger. Sie bebte am ganzen Leibe so sehr, daß es ihr wie eine Ewigkeit vorkam, bevor es ihr gelang, sich von dem Knebel in ihrem Mund zu befreien.
Hatte sie wirklich gehört, was er gesagt hatte, oder hatte sie es sich nur eingebildet?
Sie zog sich hastig an, schwang sich auf Amigos Rücken und machte sich zu Anita auf. Sie konnte noch nicht nach Hause zurückkehren und durfte auch ihrer Freundin niemals erzählen, was passiert war, aber sie brauchte ihre beruhigende Gegenwart, um ihren Geist und den wirren Wirbel ihrer Gedanken zu beschwichtigen.
Nein – nein! Er konnte es nicht sein – genau der Mann, dem zu begegnen sie sich gefürchtet hatte, vor dem sie davongelaufen war!
Nicht einmal ihr selbstherrlicher Urgroßvater hätte eine Verbindung zwischen ihr und einem so gemeinen, niederträchtigen Schuft wünschen können!
Und wie unbarmherzig Franco sie auslachen und necken würde, wenn sie wagte, ihm von diesem Erlebnis zu erzählen!
Nein, sie würde sich nur selbst in Verlegenheit bringen, wenn sie jemandem ihre tiefe Erniedrigung durch diesen villain, diesen groben, lüsternen Kerl eingestand ... Ah – wäre sie doch nie geboren worden! Die Erinnerung daran, wie er sie behandelt hatte, an seine Worte, an die Art, wie er sie angefaßt und gezwungen hatte, sich seinen schmerzhaften Küssen auszuliefern, von denen ihre Lippen immer noch zerschunden und geschwollen waren, war unerträglich.
Sie wollte nicht daran denken – sich nicht daran erinnern, niemals! Sie wollte sich nicht in einem verborgenen, geheimen Winkelöhres Bewußtseins fragen, was hätte passieren können, wenn ... wenn ...
Laura spürte, wie sie zitterte – vor Abscheu und Schamgefühl gleichermaßen. Was war los mit ihr? Warum prickelten ihre Brüste noch, als würde er sie berühren? Warum hatte sie seinen Kuß so lange geduldet, anstatt die Zähne in seine unerbittlichen Lippen zu bohren, die sie verspottet hatten, bevor sie die ihren berührt hatten? Warum konnte sie nicht vergessen, wie er nackt ausgesehen hatte?
Kapitel 3
Trent Challenger war in überaus finsterer Stimmung, als er seinen Weg zum Bestimmungsort dieses Abends fortsetzte.
Dieses wilde kleine Zigeunerweib hatte ihn vorsichtig gemacht, nur für den Fall, daß sie all ihre Drohungen wirklich ernst gemeint hatte. Er hatte keine Lust, sich gegen rachsüchtige Väter und Brüder zu verteidigen, besonders da er das Mädchen nicht einmalgenommen hatte, auch wenn er ein plötzliches Nachgeben in ihr gespürt zu haben glaubte, bevor er von ihr abgelassen hatte.
Zum Teufel mit ihr! Er wußte nicht, warum er seine Gedanken an sie verschwendete, da es doch so viele andere Dinge gab, die ihn beschäftigten.
Die lächerliche Idee, die sein Großvater und Don Francisco Alvarado miteinander ausgeheckt hatten, zum Beispiel. Zwei alte Männer, die zusammensaßen und ihre Zigarren rauchten und dabei das Leben ihrer Nachkommen planten. Die versuchten, sie miteinander zu verheiraten, obwohl sie sich noch nie begegnet waren – und es auch nicht tun würden, wenn er es verhindern konnte.
Aber Mr. Reynolds, der amerikanische Vizekonsul in Mexiko City, hatte darauf bestanden, daß Trent und kein anderer Mr. Morgan bestimmte Informationen überbringen sollte. Schließlich hatte Mr. Challenger einen ausgezeichneten Vorwand, um die Hacienda de la Nostalgia zu besuchen, nicht wahr? Selbst Präsident Díaz würde nicht fragen, warum er diesen Umweg machte, bevor er nach Kalifornien zurückkehrte. Zum Teufel mit den veralteten Vorstellungen – und zum Teufel mit dem alterslosen Mr. Jim Bishop, der in der Mitte des Geschehens hockte wie eine graue Spinne, die ihre endlosen Intrigennetze spann. Mr. Bishop kannte, wie es schien, jedermanns Schwächen und nutzte seine Kenntnisse für seine Ziele.
Selbst sein Besuch auf der rancho in Kalifornien – ›um die Angelegenheiten des Familienbesitzes in Ordnung zu bringen‹ – gehörte zweifellos zu einem von Mr. Bishops Plänen! Was hatte Mr. Bishop noch alles ausgeheckt?
Während Trent Challenger so, begleitet nur von seinen bitteren Gedanken und Erinnerungen, dahinritt, entschied Franco Alvarado Morgan widerstrebend, daß es Zeit war, seine süße Mariella nach Hause zurückkehren zu lassen und den Gast seiner Eltern zu begrüßen, seinen, wie er seine Schwester erst gestern gehänselt hatte, zukünftigen Schwager.
Obwohl er ihr verschwiegenes Plätzchen nur ungern verließ und den Wunsch hatte, noch zu bleiben – die weiche Haut seiner Geliebten zu berühren und ihre bereitwillige Reaktion zu spüren –, wußte er, daß er derjenige war, der sich losreißen mußte. Sie wäre die ganze Nacht bei ihm geblieben – hätte ihm in ihrer Liebe zu ihm alles gegeben, worum er sie bat.
»Mi corazón – wir müssen jetzt gehen, bevor dein Onkel und deine Tante böse auf dich werden.« Er straffte seine Muskeln und richtete sich, indem er sie in ihrer weichen Nachgiebigkeit mit sich hochzog, auf. Einen Augenblick lang hielt er sie so fest in seinen Armen, als wollte er sie nie wieder loslassen.
»Yo te amo, mi Mariella!«, flüsterte er stürmisch, bevor er seine Lippen auf ihren Mund drückte. »Vergiß es nie, Kleines – was auch geschieht. Hast du verstanden?«
»Sí, amor