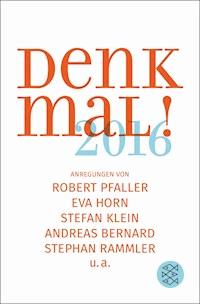
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
+++ Was sind die Themen, die uns 2016 bewegen? +++ Ein guter Text kann uns die Augen öffnen und unsere Art, die Welt wahrzunehmen, für immer auf den Kopf stellen… In diesem Buch sind sie versammelt: einige der klügsten Köpfe der Gegenwart. Sie bieten uns ein Kaleidoskop an Ideen, Impulsen und Anregungen zum Nachdenken, die uns Hinweise und Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit liefern. »Denn es ist nicht genug, einen guten Kopf zu haben; die Hauptsache ist, ihn richtig anzuwenden.« René Descartes Mit Denkanstößen u.a. von ROBERT PFALLER über das Hierbleiben, EVA HORN darüber, wie unterschiedlich man die Zukunft betrachten kann, STEFAN KLEIN über Nehmen und Geben, ANDREAS BERNARD über das Verschwinden der Kunst aus der künstlichen Reproduktion, Stephan Rammler darüber, wie wir in Zukunft unterwegs sein werden … Mit Beiträgen von Andreas Bernard, Jörg Blech, Klaus Brinkbäumer, Byung-Chul Han, Eva Horn, Bas Kast, Stefan Klein, Constanze Kurz und Frank Rieger, Nils Minkmar, Robert Pfaller, Stephan Rammler, Ortwin Renn und Uwe Walter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Ähnliche
Denk mal! 2016
Anregungen von Robert Pfaller, Eva Horn, Stefan Klein, Andreas Bernard, Stephan Rammler u.a.
FISCHER E-Books
Inhalt
Stephan Rammler
»Von Ikarus lernen«
»Der wesentliche Unterschied einer Politik des ›Weiter wie bisher‹ zu einer Politik der Entschleunigung ist, dass die Politik der Entschleunigung auf freiwilliger Basis Verhältnisse herbeiführt, wie sie im ersteren Fall auftreten werden, allerdings plötzlich. Um im Bild des Verkehrs zu bleiben: Man kann am Ende einer Straße ein Fahrzeug dadurch zum Stehen bringen, dass man es mit voller Kraft auf eine Mauer auffahren lässt, oder dadurch, dass man rechtzeitig abbremst. Abbremsen bedarf der Voraussicht. Den Ereignissen freien Lauf zu lassen zeugt nicht von Intelligenz. Tollkühnheit kann sich ein Individuum leisten, aber nicht eine Gemeinschaft von Menschen. Das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich: Das Fahrzeug kommt letztendlich zum Stehen.«
Walter Molt[1]
Die »Menge in der Enge« – dieses Bild beschreibt die aktuelle Situation am treffendsten: Immer mehr Menschen, die immer älter werden, leben auf immer engerem Raum, verbrauchen immer mehr Nahrungsmittel und Rohstoffe und erzeugen dabei immer mehr Emissionen. Durch die Konkurrenz um Ressourcen und durch die ungleiche Verteilung von Reichtum und Lebensrisiken werden zugleich auch die Grenzen der geopolitischen und kulturellen Tragfähigkeit erreicht. So weit eine Quintessenz aus den beschriebenen Zukunftstrends, die von den meisten Zukunftsforschern geteilt wird. Damit entsteht, trotz aller unbestreitbaren, vor allem technologischen Fortschritte in einzelnen Bereichen der Nachhaltigkeit, gegenwärtig eine so rasante Transformationsdynamik, dass die Welt in wenigen Jahrzehnten völlig anders aussehen könnte. Die Tore unkontrollierter Transformation öffnen sich dort, wo Risiken in konkrete, politisch und sozial nicht mehr kontrollierbare Gefährdungslagen umschlagen, wie es heute bereits vielerorts der Fall ist. In dieser Situation – so könnte man argumentieren – wäre die Systemfrage radikal zu stellen und wären ab sofort alle Handlungen und Entscheidungen an einer Art Zukunftsfähigkeits-Apriori auszurichten. Dieses ginge davon aus, dass der Systemwechsel hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaftsform prinzipiell machbar ist und dass sich jede weitere Entwicklung vor allem an diesem Ziel auszurichten hätte. Es basierte auf der Annahme von sozialer Lernfähigkeit, der Bereitschaft zu konzertiertem Handeln, der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Technologie und der Voraussetzung, dass die wichtigsten Kipppunkte irreversibler Zerstörung der Ökosysteme nicht bereits hinter uns liegen. Diese selbst gewählte und auf das Ziel der Zukunftsfähigkeit ausgerichtete kulturelle Transformation wäre das Gegenteil der potentiell chaotischen Transformationsdynamik, die sich im Falle von Nichthandeln sehr wahrscheinlich einstellen wird. Es ginge um die Gestaltung einer neuen globalen Kultur des guten Lebens, um ein Transformationsdesign, das die wachstumsverliebte Moderne überwindet hin zu einer nachmodernen, wie auch immer zu benennenden Epoche.
Ziele und Kriterien nachhaltiger Mobilität
Nachhaltige Mobilität lässt sich definieren als die ökologisch verträgliche und sozial auch gegenüber kommenden Generationen gerechte Gestaltung und Gewährleistung der Erreichbarkeit von Einrichtungen und Kommunikationszugängen in einer globalen Gesellschaft. Für eine nachhaltige Mobilität sollten Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategie – die drei Grundkonzepte zur Gestaltung von Nachhaltigkeit – in einem gleichberechtigten und ausgewogenen Verhältnis ineinandergreifen,[2] wobei mit Hilfe stetiger Produkt-, Nutzungs- und Systeminnovationen der Verkehrsträger einerseits, mit den Planungsinstrumenten einer integrierten Siedlungs- und Standortpolitik andererseits die Prozesse der Entstehung von Raumüberwindungsbedarf wie dessen tatsächliche Abwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht beständig optimiert werden können. Wird nur die Effizienzstrategie eingesetzt, kommt es nach anfänglichen Entlastungen mittel- und langfristig zu Effekten der Überkompensation von ökologisch sinnvollen Einsparungen.
Welche große Bedeutung die Forderung einer integrierten, also auf alle drei Strategien zurückgreifenden Nachhaltigkeitspolitik in der Mobilität hat, lässt sich gut an der aktuellen Debatte um die Elektromobilität aufzeigen.
Die die Nachhaltigkeitspolitik nach wie vor dominierende Effizienzstrategie verfolgt das Ziel einer Entkopplung von Bedürfnisbefriedigung und Ressourcenaufwand durch technologische und organisatorische Optimierung von Produkten und Prozessabläufen. Beispiele hierfür sind in der Mobilität etwa die Optimierung von Motoren, Gewichtsreduktionen oder die telematische Verkehrsflussoptimierung. Die Konsistenzstrategie zielt vor allem auf einen klugen und effektiven Umgang mit Materialressourcen zur Verringerung der ökologischen Rucksäcke von Produkten und Infrastrukturen. Neue Materialtechnologien, Gestaltungsphilosophien und Produktionsweisen können zusammengreifen, um einmal verwendete Rohstoffe im maximalen Ausmaß nach dem Ablauf eines Produktlebenszyklus wieder in einen neuen Produktlebenszyklus zu überführen. Auch kollaborative Nutzungsphilosophien können den Materialaufwand pro Serviceeinheit minimieren. Die Suffizienzstrategie zielt schließlich auf die Lebensstile, Konsumwünsche und Verhaltensweisen von Verbrauchern, wie das Verkehrsmittelwahlverhalten oder die Auswahl der Verkehrsziele, zum Beispiel bei Reisen. Entscheidungen für Wohnformen, etwa die Abwägung des relativ verkehrsarmen Wohnens in einem dicht gepackten urbanen Zusammenhang gegenüber dem strukturell verkehrsaufwendigeren Wohnen in einer suburbanen Eigenheimsiedlung fallen ebenfalls unter die Kategorie der Suffizienz.
Bezieht man diese Begrifflichkeiten nun auf die aktuelle Diskussion und innovationspolitische Praxis zur Elektrifizierung der Mobilität, so zeigt sich, dass hier bislang vor allem an der Effizienzstrategie festgehalten wird. Metaphorisch gesprochen, geht es nach einer hoffnungsfroh stimmenden und offenen Aufbruchsphase heute im Grunde darum, den neuen technologischen Wein des batterieelektrischen Fahrzeugs (und seiner verschiedenen Variationen) in die alten Schläuche der überkommenen und offenbar bislang nicht anzutastenden Nutzungskultur der privaten Massenmotorisierung zu gießen. Ging es in den konzeptionell breit angelegten Zielvisionen der Aufbruchsphase vor einigen Jahren durchaus noch um die umfassende energie- wie verkehrswirtschaftliche Integration der Elektromobilität als systemischen Gesamtzusammenhang aller Verkehrsträger, so steht heute vor allem das telematisch vernetzte und automatisierte Elektroauto im Privatbesitz im Vordergrund. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass diese Engführung der neuen Technologie mit der alten Nutzungsform – insbesondere vor dem Hintergrund der Globalisierung des westlichen Motorisierungsmodells – hoch problematisch ist. Elektrofahrzeuge sind aufgrund der für Motor, Energiespeicher, Steuerung und Fahrzeugaufbau benötigten seltenen Metalle und Rohstoffe in der Herstellung enorm ressourcenaufwendig und werden der Konsistenzanforderung der nachhaltigen Mobilität bislang nicht gerecht. Nur durch den flächendeckenden, bislang aber eher noch für Nischenmärkte diskutierten Betrieb in den nutzungsoptimierten Anwendungskontexten einer Sharing-Kultur könnte die Materialintensität pro elektromobiler Serviceeinheit konsequent gesenkt werden. Kreislaufwirtschaftliche Produktions- und Rückführungssysteme werden bislang nicht diskutiert. Hinzu kommt, dass das Elektroauto seine Vorteile nur dann voll ausspielen kann, wenn es mit regenerativen Energien betrieben wird. Dieses würde die energiewirtschaftliche Integration über sogenannte SmartGrid-Konzepte erfordern, die ebenfalls deutliche Veränderungen von Anspruch und Verhalten der Nutzer mit sich bringen würde. Weltweit betrachtet, ist allerdings eher ein Trend beobachtbar, Elektroautos mit dem jeweils vorherrschenden, meist auf Kohle oder Atomkraft basierenden Energiemix zu betreiben.
Beide Aspekte verweisen nun darauf, dass sich die Fortführung der bisherigen Philosophie der Produktinnovation (die der Effizienzstrategie zugeordnet werden kann) in der Elektromobilität zu einer Sackgasse entwickelt, die den Anforderungen der nachhaltigen Mobilität nicht gerecht wird. Nur durch die Kombination mit die Konsistenzanforderung adressierenden Nutzungsinnovationen und schließlich die Einbindung in die umfassende Systeminnovation eines intermodalen, also verkehrsträgerübergreifenden – und damit massive Verhaltensänderungen implizierenden – Mobilitätskonzeptes (dieses entspricht der Suffizienzstrategie) würde eine nachhaltige Elektromobilität entstehen.
Aufgrund der im historischen Teil beschriebenen fundamentalen Bedeutung der Mobilität für die moderne Gesellschaft wird die nachhaltige Mobilitätspolitik einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte einer solchen kulturellen Transformation sein. Angesichts dieser Ausgangslage gleichen die aktuellen mobilitätspolitischen Konzepte jedoch eher Wartungsmaßnahmen auf der Titanic als einer wirklichen Schubumkehr und Kursänderung, die sicher am Eisberg vorbeiführt. Die technologisch brillante, aber konzeptionell eher phantasielose Mobilitätsindustrie ist mit der Entwicklung völlig neuer Verkehrskonzepte gefordert, sieht sich aber in der Pfadabhängigkeit unserer Mobilitätskultur ebenso gefangen wie die Verkehrspolitik und große Teile der Verkehrswissenschaften. Man sollte aufräumen mit der Lebenslüge der kritischen Mobilitätsdiskurse, es ließe sich innerhalb des geltenden Entwicklungspfades allein mit Hilfe der Effizienzbestrebungen ökologischer Modernisierung etwas substantiell ändern. Alle Optimierungs- und Lenkungs-, Verflüssigungs- und Verlagerungskonzepte für den Verkehr – so sinnvoll sie im Einzelnen auch sein mögen – beheben den Umstand nicht, dass wir auf dem falschen Pfad sind, solange wir uns nur innerhalb des geltenden, rein wachstumsorientierten Gesellschaftsmodells bewegen. Wirklich nachhaltige Mobilität wird im großen Stile auch auf der bestmöglichen Vermeidung von Raumüberwindung basieren müssen, was im Kern die Frage nach unseren Lebensstilen und Bedürfnisniveaus und damit letztlich nach unserem Wohlstandskonzept stellt.
Der Blick in die Zukunft der Mobilität zeigt neben spannenden technologischen Entwicklungen wie der Digitalisierungsdynamik also vor allem, von welchen Grenzen und Herausforderungen sich Gestaltungskriterien einer nachhaltigen Mobilität ableiten lassen. Betrachtet man alle Trends und Treiber zusammen, so lassen sich die sich daraus ergebenden Anforderungen vor allem in vier Kriterien bündeln: Mobilitätslösungen der Zukunft sollten so schnell wie möglich den Pfad der fossilen Energienutzung verlassen, sie sollten eine geringstmögliche Materialintensität haben und verwendete Materialien in maximal möglichem Ausmaß wiederverwerten, sie sollten Menschen und Natur vor tödlichen Unfällen, dauerhaften körperlichen und seelischen Schäden und irreversiblen Verlusten an ökologischer Vielfalt schützen, und schließlich sollten sie robust sein gegenüber natürlichen Stressfaktoren, menschlichem und technologischem Versagen in komplexen Systemen oder gezielten militärischen wie terroristischen Attacken.
Erneuerbare Mobilität
Die einzige Möglichkeit, dauerhaft auf den Einsatz fossiler Treibstoffe in der Mobilität zu verzichten, sind Antriebssysteme auf der Basis regenerativer Energie. Mittel- bis langfristig ist die Elektrizität neben Wasserstoff das beste Speichermedium für regenerative Energie aus solaren und geothermischen Quellen und der Windkraft. Dementsprechend werden zukünftig vor allem elektrische Antriebe für Fahrzeuge in allen Verkehrssystemen zum Einsatz kommen. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen batterieelektrischen, brennstoffzellenelektrischen und hybridelektrischen Antriebssystemen. Bislang ist nicht abzusehen, ob eine dieser Technologielinien dominant wird oder ob die Entwicklung aller drei Optionen zeitgleich vorangetrieben wird, was aus heutiger Sicht am sinnvollsten erscheint. Auch ist im Augenblick nicht genau abzusehen, welche Rolle Wasserstoff als Energiespeichermedium in der Mobilität spielen wird. Seine Einsatzchancen in Brennstoffzellen zur Stromproduktion für Elektroantriebe steigen mit der Verbesserung sicherer und zugleich platz- und gewichtsoptimierter Speichermöglichkeiten.
Insbesondere im Schwerlastbereich der Mobilität, also bei den Lkw-Transporten, dem Schiffsverkehr, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe, der Industrie und der Luftfahrt ist der Ersatz von fossilen Treibstoffen durch regenerativ erzeugte Elektrizität schwierig. Während bei Schiffen mittelfristig brennstoffzellenelektrische Antriebe in Kombination mit neuartigen Drachenzugsystemen eine aussichtsreiche Entwicklungsperspektive bieten, könnte in den anderen Bereichen der Einsatz von regenerativ erzeugten Biokraftstoffen der zweiten und dritten Generation – etwa auf Algenbasis – eine Lösung sein. Voraussetzung ist allerdings, dass es bei ihrer Produktion nicht zur Konkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung kommen darf.
Eine wichtige Bedingung dafür, möglichst viel regenerative Energie in das Mobilitätssystem zu bekommen, ist der Ausbau der kollektiven Verkehrssysteme – also E-Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen im urbanen Bereich und Fernbahn und Nachtzüge im regionalen und überregionalen Verkehr. Insofern hier ein flächendeckender und durchgängiger Betrieb mit Strom möglich ist, kann die Verlagerung von der Straße auf die Schiene und von der Luft auf das Wasser helfen, das Gesamtniveau dieser strukturell eher konversionsresistenten Verkehrsformen zu reduzieren. Damit würde die Menge des in diesen Bereichen dann noch nötigen Biokraftstoffs ebenso verringert wie der Ressourcenaufwand der im Straßenverkehr eingesetzten E-Fahrzeugflotte. Denn aufgrund der enormen Ressourcenintensität elektrischer Antriebssysteme und ihrer Energiespeicher ist es geboten, das Ausmaß individualisierter Transporte im Privat- und Geschäftsverkehr wie auch in der Güterlogistik generell zu reduzieren.
Eine technologische Transformation dieses Ausmaßes ist nicht von heute auf morgen zu bewältigen. Für die Übergangszeit sind die weitere Effizienzoptimierung bestehender Antriebs- und Fahrzeugsysteme (etwa über die weitere Verbesserung der Motorentechnologie) und der Einsatz von Gas – zum Beispiel im Schwerlastverkehr – Wege, um die Gesamtmenge der eingesetzten fossilen Ressourcen zu reduzieren bzw. deren spezifische Emissionslast immer weiter zu verkleinern. Schließlich sind die Reduzierung von Gewicht und Geschwindigkeit Möglichkeiten, den Aufwand der einzusetzenden fossilen Treibstoffe zu verringern. So kann eine Geschwindigkeitsdrosselung im Schiffsverkehr um nur wenige Prozent signifikant Treibstoff und Kosten sparen. Viele Reeder gehen deswegen diesen Weg und gleichen den Verlust an Ladekapazität durch den Einsatz zusätzlicher Schiffe aus. Insgesamt wäre eine Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus über alle Verkehrsträger zur Verbrauchs- und Emissionsverringerung sofort umsetzbar. Ohne den Trend zum Upsizing im Automobilmarkt wären auch hier die realisierbaren Einsparungen aufgrund der enormen Fortschritte in der Motorentechnologie theoretisch viel größer, als sie es im Moment sind. Zum einen bringt die Anpassung der Assistenz- und Sicherheitstechnologie und der Aufbauauslegung der Fahrzeuge an hohe Endgeschwindigkeiten einen Teil des Gewichtszuwachses mit sich, zum anderen ist der Gewichtszuwachs, insbesondere im Bereich des Sport and Utility Vehicle (SUV)-Segments, einem Markt- und Designtrend geschuldet. Eine generelle, politisch forcierte Senkung des Geschwindigkeitsniveaus und damit der Sicherheitsanforderungen könnte hier gegebenenfalls dazu beitragen, auch den Trend zum Gewichtsanstieg und den damit immer verbundenen erhöhten Energieverbrauch zu verhindern.
Dematerialisierte Mobilität
Die Verkehrsnachfrage und mit ihr der Material- und Ressourcenverbrauch der Mobilität sind bereits heute enorm, werden in der Zukunft jedoch weiter stark ansteigen. Prinzipiell sind drei Wege denkbar, um diesen Anstieg in den Griff zu bekommen.
Erstens die Etablierung kreislaufwirtschaftlicher Produktionsprinzipien, bei denen die Schrott- und Abfallprodukte eines Produktlebenszyklus wieder zum Ausgangspunkt eines neuen Produktlebenszyklus werden. Eine solche Produktion »von der Wiege bis zur Wiege«[3], wie man sagt, wäre im Idealfall vollkommen in sich geschlossen und käme ohne oder mit einem sehr reduzierten Maß weiterer Ausbeutung von Primärressourcen aus. Allerdings setzt die Kreislaufwirtschaft die Etablierung eines vollkommen neuen Produktionsmodells voraus und ist insofern zunächst noch ein elegantes theoretisches Modell.
Zweitens können vermehrt Baustoffe, Farben und Textilia eingesetzt werden, die einer »solaren Chemie«[4] entstammen, also letztlich auf natürlichen Rohstoffen basieren und damit die Unabhängigkeit von der momentan allgegenwärtigen Petrochemie mit sich bringen.
Als Leitbild der Etablierung neuer Designphilosophien und Produktionsmethoden in der Verkehrsgüterindustrie können heute beide Ansätze dienen. Gerade die Automobilwirtschaft wird zukünftig wahrscheinlich gar nicht ohne sie auskommen, da im Zuge der Umstellung auf Elektromobilität (ganz gleich, ob batterie- oder brennstoffzellenbasiert) einerseits und den weiteren Trends zur digitalen Vernetzung und Automatisierung des Fahrzeugs andererseits enorm seltene, hochwertige und teure Rohstoffe zum Einsatz kommen, deren Zugang schon jetzt prekär ist.
Den dritten Weg zur Dematerialisierung der Mobilität bietet die Strategie der Nutzungsinnovation, also der möglichst effizienten Auslastung alles fahrenden Geräts auf allen Strecken und zu allen Zeiten. Die Tatsache, dass heute Pkws im Privatbesitz im Durchschnitt 23 Stunden am Tag nicht genutzt werden, ist letztlich ein betriebs- wie volkswirtschaftlich höchst irrationaler Luxus, der in der zukünftigen Mobilitätswelt so nicht weiter aufrechtzuerhalten sein wird. Alle Konzepte und Geschäftsmodelle der Mobilitätswirtschaft, die das Nutzen dem Besitzen vorziehen und die anteilige Nutzung eines Fahrzeuges ökonomisieren, sei es als Carsharing, Carpooling, Mitfahrzenrale etc., und damit die Auslastung des einzelnen Produktes erhöhen, minimieren zugleich – unter ceteris paribus-Bedingungen – den absoluten Produkt- und Materialaufwand der Mobilität.
Fahrzeuge konsequent auf diese Formen des kollaborativen Konsums und der »Shareeconomy« auszurichten würde auch bedeuten, neue Gestaltungsphilosophien und Produkteigenschaften zu entwickeln. Das Ziel wäre dann womöglich die Entwicklung extrem hochwertiger und auf permanente und langlebige Nutzung durch unterschiedliche Kunden ausgelegter Fahrzeuge statt – im Extremfall – kurzlebiger Niedrigpreis-Produkte, etwa für den chinesischen Low-Budget-Massenmarkt. Solche hochwertigen Fahrzeuge wären dann zu teuer für den durchschnittlichen Privatkunden und würden sich auch für die Automobilwirtschaft betriebswirtschaftlich nur in Kombination mit neuen Wertschöpfungskonzepten für Mobilitätsdienstleistungen rechnen.
Sichere Mobilität
Mangelnde Verkehrssicherheit ist weltweit vor allem ein Problem des Straßenverkehrs. Hier treffen unterschiedliche Verkehrsarten und die Ansprüche und Verhaltensweisen einer großen Menge von Verkehrsteilnehmern in sehr komplexer Weise aufeinander. Insofern ist die Frage der Verkehrssicherheit in erster Linie eine Frage der Verkehrskultur. Natürlich kann durch technologische Anstrengungen (Sicherheitsgurt, Assistenzsysteme, Fahrzeugdesign), durch planerische Konzepte (Fahrradstraßen, Shared Space, Spielstraßen, Gestaltung von Kreuzungen), ordnungsrechtliche Maßnahmen (Tempo-30-Zone, Tempolimit, Promillegrenzen für Blutalkohol) und hoheitliche Überwachung (Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen) bereits ein hohes Maß an Sicherheit erreicht werden; die Reichweite der genannten Maßnahmen ist allerdings noch gar nicht ausgeschöpft. Ein einheitliches und konsequentes Tempolimit auf der Autobahn könnte in Deutschland zum Beispiel dazu beitragen, sowohl Energie zu sparen als auch die Sicherheit zu erhöhen. Der eigentliche Schlüssel zur Verkehrssicherheit liegt allerdings in der Veränderung von inneren Einstellungen und Verhaltensmustern der einzelnen Verkehrsteilnehmer. Eine umfassende Mobilitätserziehung, die neben der Vermittlung von regelgerechten Verhaltensmaßstäben vor allem die zentrale Rolle subjektiver Kooperationsbereitschaft betont, kann hier eine wichtige Rolle spielen.
Der Blick in die Regionen nachholender Mobilisierung zeigt, dass die Zahl der Verkehrsopfer mit der Geschwindigkeit der Motorisierung steigt. Ein alternatives Verkehrssystem, das auf der Kombination von kollektiven Verkehrsträgern, Fahrradverkehr und temporeduzierter Mikromobilität (elektrobetriebene Klein- und Leichtfahrzeuge) basiert, ist nicht nur den zukünftig zu erwartenden Dichteverhältnissen der entstehenden urbanen Megazentren und ihrer prinzipiell problematischen Luftqualität angemessen, sondern wird auch mit einer massiven Verbesserung der Verkehrssicherheit einhergehen. Es wird sich zeigen, ob und wann die Bevölkerung, die Planer und Entscheider in diesen Regionen in der Lage sein werden, den jetzt eingeschlagenen Weg der Motorisierung zugunsten von alternativen Lösungen zu überspringen oder zumindest abzukürzen und damit auch in der Verkehrssicherheit einen großen Schritt zu tun.
Resiliente Mobilität
Resilienz bezeichnet die Widerstandsfähigkeit und Festigkeit eines Individuums, einer Gesellschaft oder einzelner ihrer Funktionssysteme gegenüber Störungen, Krisen und Katastrophen. Diese Fähigkeit sollte insbesondere für die Gestaltung zukünftiger Mobilitätssysteme aus verschiedenen Gründen eine wichtige Rolle spielen.
Erstens: Je abhängiger Gesellschaften von einem hohen Niveau an Mobilität und sicher planbaren Transportdienstleistungen sind, desto größer ist das Schadenspotential von Störfällen und Verzögerungen. In einer Zeit, in der der überwiegende Teil der Bevölkerung in der industrialisierten Welt sich mit Nahrungsmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs über den Einzelhandel versorgt, statt sie selbst zu produzieren, können größere Versorgungskrisen schon in wenigen Tagen entstehen. Im Vergleich dazu war es vielleicht ärgerlich, aber in keiner Weise systemrelevant, wenn in einer bäuerlich-dörflichen Kultur von Selbstversorgern die Lieferung von Salzheringen, Zucker oder Kaffee mit einer Woche Verspätung eintraf.
Zweitens: Je feingliedriger, komplexer und (digital) vernetzter ein Verkehrssystem aufgebaut ist, desto größer ist das Risiko, dass sich externe oder interne Störfälle schnell im gesamten System fortsetzen und sich die Schadenswirkungen akkumulieren. Auf diese Weise können heute Bahnbetriebsstörungen in Süddeutschland mit ein wenig Pech schnell zu massiven und weit ausgreifenden Verspätungen in Norddeutschland führen, ein Kälteeinbruch in Chicago oder ein Vulkanausbruch in Indonesien den Flugverkehr in Europa tangieren.
Drittens: Ein Verkehrssystem ist umso verletzbarer, je größer das Ausmaß an digitaler Technologie ist, das zu seiner Betriebsführung eingesetzt wird. Als Weichen noch mechanisch gestellt wurden und der Straßenverkehr noch ohne Verkehrsleitsysteme auskam, war es deswegen natürlich auch nicht möglich, mit Hilfe von Software-Manipulationen von entfernter Stelle aus Störungen zu provozieren.
Alle drei Problemlagen betreffen unsere modernen Verkehrssysteme. Das wird in der weiteren Entwicklung dieser Systeme immer deutlicher werden. Verstärkend wirkt hierbei, dass die Vielfalt potentieller externer wie interner Störfaktoren beständig zunimmt. Klimabedingte Starkwetterereignisse, technisches wie menschliches Versagen in den hochkomplexen Abläufen der modernen Systemarchitekturen sowie Manipulationen und Hackerangriffe jeglicher Provenienz sind zu erwarten. Deswegen ist Resilienz heute eine Qualitätsanforderung an Verkehrssysteme, um Störfälle mit großem Schadenspotential zukünftig auszuschließen. Mögliche Lösungen sind der Aufbau robuster Infrastrukturen durch redundante Systemarchitekturen, die Ersatzmöglichkeiten, Vervielfältigung, Verlinkung, Spiegelung und den Erhalt mechanischer Steuerelemente ebenso einschließen wie besondere Systemkontrollen und den Einbau von Zeitpuffern.
Deutlich wird bei genauerer Betrachtung auch, dass die Störfallproblematik durch externe, nicht im Aufbau und dem Betrieb der Verkehrssysteme selbst liegende Anforderungen noch verschärft wird: so zum Beispiel durch eine engmaschige Just-in-time-Logistik, mit der eigentlich privatwirtschaftlich zu erbringende Lagerhaltungskosten in die Infrastrukturen verlagert und damit auf die Gemeinschaft externalisiert werden. Transportintensive Geschäftsmodelle mögen die einzelwirtschaftlichen Kosten minimieren, erhöhen aber die externen Kosten, die von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Hier ist grundsätzlich zu fragen, ob solche Strukturen nicht zurückzufahren wären. Dadurch würden die Risiken für einzelne Unternehmen, letztlich aber auch für gesamte, in ihren Wertschöpfungsketten hochvernetzte Branchen wieder geringer. Zugleich würden Umweltkosten minimiert.
Die richtige Flughöhe finden
»Flieg nicht so hoch«, riet Dädalus seinem Sohn Ikarus. Doch berauscht vom Gefühl der grenzenlosen Freiheit und der Macht über die Elemente, verlor dieser rasch jegliche Demut und Vorsicht. Er überging die Warnung seines Vaters, flog zu nahe an die Sonne, und das Wachs seiner Schwingen schmolz. Der Ausgang der griechischen Sage ist bekannt. Wie Ikarus sind wir alle sehr gut darin, angesichts der Faszination der Mobilität ihre Schattenseiten auszublenden. Wir sind ambivalente Wesen zwischen Einsicht und Ignoranz. Wir wissen durchaus um die Gefahren der Mobilität, halten sie aber für beherrschbar, obwohl sie das immer weniger sind. Raumüberwindung ist aufwendig und in vielerlei Hinsicht unmittelbar wie mittelbar gefährlich, und je höher die Geschwindigkeit wird, mit der wir das System betreiben, desto höher wird letztlich auch das Risiko, das wir in Kauf nehmen. Die Ermöglichung von Mobilität an der einen Stelle ist letztlich immer erkauft durch Zerstörung von Lebensqualität an einer anderen Stelle. Ebendiese Botschaften stecken in der Sage von Ikarus, die den Wunsch nach Überwindung der organischen Beschränktheit des Menschen ebenso ausdrückt, wie sie als Ursprung aller technikkritischen Warnungen – verbunden mit der Warnung vor menschlicher Selbstüberschätzung – verstanden werden kann: Bedenke die Folgen. Du kannst fliegen, aber flieg nicht zu hoch. Fliege in angemessener Höhe.
Eva Horn
»Zukunft als Katastrophe«
Seit die künftige Katastrophe nicht mehr Teil der Heilsgeschichte oder einer göttlichen Vorsehung ist, sondern nichts als ein plötzlicher und kontingenter Zusammenbruch alles Bestehenden, ist sie einerseits ein Spiegel der Erkenntnis, andererseits ein Gebot vorsorgenden Handelns. Der Mensch beschaut sich und seine Welt im erhellenden Blitz des Desasters, er beleuchtet seine Enden und Grenzen. Aber in dem Maße, wie er nun die Verantwortung für eine offene und gestaltbare Zukunft trägt, befindet er sich auch im permanenten, dringlichen Zustand der Sorge: Es gilt, künftige Übel zu erkennen und zu verhindern. Dabei hat die katastrophische Zukunft, nicht einfach ein »Zeitregime der Moderne« abgelöst, das in der aktiven, fortschritts- und hoffnungsfrohen Planung und Zukunftsgestaltung bestand.[5] Die Katastrophenszenarien sind vielmehr ein fortlaufender, pessimistischer Einspruch gegen eine Moderne des Zukunftsoptimismus, ihre dunkle Begleiterin seit Ende des 18. Jahrhunderts. Byrons und Malthus’ Visionen wollen nichts anderes, als die optimistische Anthropologie der Aufklärung als blind und naiv zu kritisieren (während Grainville zumindest noch auf eine aufklärende Selbstkorrektur des Menschen setzt). Im Kalten Krieg enthüllen die Filme und Romane der atomaren Apokalypse unter der Stabilisierungslogik der MAD das obszöne Begehren nach der Selbstvernichtung. Die Abkühlungsszenarien des 19. Jahrhunderts konterkarieren sehr präzise den zeitgenössischen technischen Fortschritt auf der Basis von Wärme- und Drucktechnologien und imaginieren gegen die herrschende Evolutionstheorie ein Bild menschlicher Devolution. Und das aktuelle Zerstörungsbild eines »Letzten Klimas« – sei es als globaler Winter oder eskalierende Erwärmung des Planeten – kommentiert die Instabilität einer Welt, die glaubt, die Natur des Menschen unabhängig von der Natur der Dinge denken zu können. Auch die Desaster der Technik erweisen sich bei näherer Betrachtung als exakte Inversionen technischer Sicherheit, wenn sie die komplexen Kopplungen technischer Systeme als potentielle »Verkettungen unglücklicher Umstände« umdeuten. – Ebenso präzise wie dramatisch zugespitzt kehrt das katastrophische Imaginäre die Hoffnung auf Zukunftsgestaltung um in das düstere Bild der jeweils schlimmsten Furcht einer Epoche. Die aktive und produktive Formierung der Zukunft, die so oft zur Signatur der Moderne erklärt worden ist, ist also nicht erst heute, sondern schon von ihren Anfängen an begleitet von einer insistierenden, nicht selten schrillen Gegenrede, die in der Zukunft die kommende Katastrophe erblickt. So erweist sich der Letzte Mensch nicht nur als Doppelfigur eines Opfers und Betrachters des Desasters, sondern als eine Figur, die in der Gegenwart gerade gegen das ewige »Vorwärts!« Einspruch erhebt, ein Spielverderber in der Morgenröte endlosen Fortschritts. Anders jedoch als der andere ewige Spielverderber, der Kulturkritiker, verweist der Letzte Mensch nicht auf eine alternative und bessere Form menschlicher Lebensgestaltung, sondern auf die blinden Flecken, das Nichtgewusste und Nichtbedachte eines Verhältnisses zur Zukunft, das diese als unendlichen, offenen Raum der Planung, Gestaltung, der Steigerung und des Wachstums betrachtet. Der Letzte Mensch sieht genau das, was die Gegenwart fatalerweise nicht bemerkt.
Das Spezifische der heutigen Situation ist also nicht so sehr der plötzliche Verlust einer mit Hoffnung und Fortschritt schwangeren Zukunft. Es ist vielmehr die Einsicht, dass genau in diesem Fortschritts- und Wachstumsprogramm die Katastrophe verborgen liegen könnte. Die Gegenwart fühlt sich auf ein Desaster zutreiben, das sich als ein tipping point vielfältiger, scheinbar harmloser, kaum wahrnehmbarer Tendenzen und Handlungsformen erweisen könnte. Sie erwartet das Kippen einer Situation, die dem Anschein nach immer »so weiter« gehen könnte. Eine Situation jedoch, in der die Zukunft nicht mehr so sehr gestaltet als vielmehr zunehmend für die Gegenwart vernutzt wird. Das Unheimliche daran ist, dass niemand weiß, wann ein tipping point erreicht ist, wie lange ein System belastbar ist, wo seine Bruchstellen liegen. All das zeigt sich erst im Kollaps. Ex post wird man gewusst haben, dass eine Grenze erreicht worden ist, die man nicht zur Kenntnis genommen hat. Anders als noch im Kalten Krieg ist daher das Spezifische gegenwärtiger Katastrophenerwartungen nicht nur ihre Unerwartbarkeit, sondern auch das Diffuse ihrer Szenarien: »Tsunami, Wassermangel, Lawine, Großfeuer, Stromausfall, Seuche, Zusammenbruch des Staates, Zusammenbruch des GPS-Systems«, wie National Geographic mit schöner Beliebigkeit listet – hinzuzufügen wären Überbevölkerung, Meteoriteneinschlag, nuklearer Winter, technische Großunfälle, Nahrungsknappheit, irreparabler Ausfall elektronischer Systeme, Umweltvergiftung, globale Erwärmung etc. Ihr wohl triftigstes Szenario ist darum eine »Katastrophe ohne Ereignis« – oder genauer: eine Katastrophe mit vielfältigen, unabsehbaren, dispersen und widersprüchlichen Desasterereignissen wie die Folgen des Klimawandels, die diejenigen am schlimmsten treffen werden, die ihn nicht verursacht haben. Das gegenwärtige Zeitgefühl spürt eine »Metakrise« auf sich zukommen, deren schwer überschaubare Faktoren sich unerkannt und unauffällig zu einem Desaster verknüpfen und aufaddieren, das seinerseits in diffuse Bilder zerfällt.[6] Genau darum sind die aktuellen Katastrophenszenarien so unterschiedlich und sogar teilweise so umstritten, wie wir gesehen haben. Vor allem aber sind sie so unheimlich und unabsehbar wie jene rätselhaften »Verkettungen unglücklicher Ereignisse« in der Großtechnik oder die unabsehbaren Langzeitfolgen und Nebeneffekte von fast allem, was wir gegenwärtig nutzen und konsumieren. Die »Metakrise« der Gegenwart ist ein Phänomen der Latenz: ein lauerndes, verstecktes und unerkennbares Geschehen, das sich möglicherweise nicht großen Ereignissen oder spektakulären Entscheidungen verdankt (wie der berühmte »Knopfdruck«, der den Nuklearkrieg startet), sondern winzigen alltäglichen Handlungen und Unterlassungen, unwesentlichen Innovationen, vernachlässigten Nebeneffekten und einfach dem schieren quantitativem Anwachsen bestimmter Praktiken und Technologien (wie Auto fahren oder Wälder roden).
Genau in dieser Latenz, so meine ich, liegt der Grund dafür, dass wir uns gegenwärtig so gern mit Katastrophen, aber auch den Möglichkeiten der Vorbereitung und Resilienz gegen kommende Desaster beschäftigen. Es scheint, als gäbe es geradezu ein Bedürfnis nach immer neuen apokalyptischen und post-apokalyptischen Szenarien in Wissenschaft, Literatur, Film und Kunst. Die Fiktionen geben der latenten, unfassbaren Bedrohung durch künftige Katastrophen greifbare Formen, Bilder und Narrative – Szenarien also, die eine mögliche Zukunft analysierbar, konkret, antizipierbar und gegebenenfalls auch politisch operativ machen. Einher geht dieses seltsame Vergnügen an katastrophischen Gegenständen jedoch mit einer bemerkenswerten Ratlosigkeit über die Möglichkeiten des Handelns. Das Starren auf die Katastrophe scheint weniger zu aktivieren, als von der schwierigen individuellen und kollektiven Aufgabe zu entlasten, angesichts dieser Katastrophe zu handeln – von der kollektiven Revolte gegen eine Politik des ungebremsten Ressourcenverbrauchs über das individuell tugendhafte Fahrradfahren und Wassersparen bis hin zum ganz privaten Bau eines überschwemmungssicheren, mit Lebensmitteln gefüllten Schutzraums. Angesichts der »Katastrophe ohne Katastrophe« ist es schwer, überhaupt zu bestimmen, was ein sinnvolles »Sorgen« für die Zukunft sein könnte. Prävention klassischen Stils braucht – das weiß schon Kafkas Tier – eine greifbare Bedrohung und ein Subjekt des vorsorgenden Handelns. Aber es gibt kein klar bestimmbares Subjekt eines solchen Handelns, außer Abstrakta wie »die Industrienationen«, »der Kapitalismus«, »der Mensch als Spezies« oder gar »der kinetische Expressionismus«.[7] Oder möglicherweise wir alle, die wir heizen, reisen, konsumieren? So gefasst, sind die Akteure entweder zu groß oder zu klein, um handlungsfähig zu sein. Bruno Latour hat diese seltsame Rolle des Menschen als zugleich Akteur und Opfer in der Katastrophe als Problem einer »réflexivité aveugle« beschrieben:
Die Wasser der Sintflut kommen nicht von oben, um die Sünden der Menschen zu ertränken; vielmehr sind es die sündigen Menschen selbst, deren vielfältige Handlungsweisen die sündigen Menschen ertränken. Durch einen betäubenden Effekt blinder Reflexivität (réflexivité aveugle) bringen wir das Ende der Zeiten über uns selbst. Jeder von uns – je nachdem, ob wir reich oder arm, einflussreich oder mittellos, verschwenderisch oder asketisch sind – ist zugleich unschuldiges Opfer, Übeltäter und Racheengel.[8]
Genau dies ist die neue Position des Letzten Menschen: Er ist zugleich Akteur, Opfer und Betrachter eines Katastrophengeschehens, das er hat kommen sehen, aber nicht erkannt hat. Günther Anders hatte der Moderne eine »Apokalypse-Blindheit« bescheinigt, die darin besteht, die Folgen des eigenen Handelns weder sehen noch vorstellen zu können: »Wir werfen weiter, als wir Kurzsichtige sehen können.«[9] Die gegenwärtige Haltung dagegen ist durchaus nicht blind, sondern genau jene »blinde Reflexivität«, die es immer schon gewusst hat, aber keine Ahnung hat, was hier und jetzt zu tun wäre. Die nicht weiß, dass überhaupt etwas zu tun wäre, was über die gemütlichen kleinen Gesten des Fahrradfahrens, Energiesparlampen-Benutzens, Kurzduschens und Elektrogeräte-Reparierens hinausginge, wie die zahllosen Ratgeber für »350 Wege, die Erde zu retten« suggerieren. Die Aufgabe würde überhaupt erst einmal darin bestehen, eine politische Einheit zu konstituieren, die in der Lage wäre, die Verantwortlichkeit für den sich wandelnden Zustand des Planeten zu übernehmen. Der mächtige Mensch des Anthropozäns muss sich darüber verständigen, dass er auch der ohnmächtige Letzte Mensch zu sein droht – aber dies in einer Situation, in der Handeln und Erleiden, Macht und Ohnmacht, Wissen und Nichtwissen von der Katastrophe kaum voneinander zu unterscheiden sind.
Genau darum sind wir auf den Raum der Imagination angewiesen – und zwar nicht einen Raum fix hergezauberter »erfinderischer« Lösungen, sondern der präzisen Ausmalung all dessen, was wir am meisten fürchten. Eine Imagination, die die Bruchstellen der Wirklichkeit ausleuchtet, in der wir leben. Die Frage ist dabei allerdings, wie die Fiktionen und Szenarien des katastrophischen Imaginären genutzt und gelesen werden. Vordergründig gibt es dafür zwei einfache Modi der Lektüre: Einerseits können Katastrophenfiktionen als hochgradig wirksame, alarmistische Narrative verstanden werden, die im Verweis auf das kommende Desaster eine Dringlichkeit des Handelns fordern, die alle weiteren Reflexionen und Bedenken suspendiert. Andererseits lassen sie sich als Formen einer Beschäftigung mit der Katastrophe konsumieren, die von jeder weiterführenden Konsequenz gerade entlastet. Mit Blick auf das Material, das wir betrachtet haben, spricht viel für die erste, mobilisierende Funktion: Katastrophenfiktionen greifen die jeweils akutesten Befürchtungen einer Epoche auf und sehen sich dabei als dringliche Intervention oder »cautionary tale«. Oder sie werden nicht selten zumindest gern so verstanden, wenn etwa Cormac McCarthys Roman The Road als »Öko-Roman« verbucht wird. Das heißt jedoch nicht, dass sie dabei stets ähnliche Intentionen verfolgen: Nevil Shutes melancholische Atomtod-Allegorie On the Beach, Stanley Kubriks Dr. Strangelove und Sidney Lumets Fail-Safe wenden sich als aktive Einsprüche gegen die Politik der atomaren Abschreckung; Leo Szilards Erzählungen oder Kahns Szenarien dagegen sind ernstgemeinte Vorschläge zu ihrer Stabilisierung. Emmerichs Blockbuster The Day After Tomorrow versteht sich ebenso wie Al Gores Aufklärungsfilm An Inconvenient Truth als nachdrückliche Warnung vor einem menschengemachten Klimawandel – während umgekehrt Michael Crichtons Roman State of Fear aus dem gleichen Jahr ein polemisches Plädoyer des Klimaskeptizismus ist. Auch wenn ihre politischen Stoßrichtungen also diametral entgegengesetzt sind, so ist ihnen allen ihr aktivistisches und alarmistisches Potential gemeinsam. In ihnen zeigt sich exemplarisch ein Appellcharakter katastrophischer Fiktionen: Sie wollen warnen, kritisieren oder auch lächerlich machen; sie wollen zu Tätigkeit (oder auch Untätigkeit) aufrufen; sie wollen die Sicht der Dinge durch eine exemplarische Erzählung verändern. Oder sie lassen sich zumindest als solche alarmistischen Appelle lesen. Am deutlichsten und zugleich problematischsten wird dieser aktionistische Effekt in zwei Kernbegriffen des Katastrophismus: dem »Ernstfall« und der »Prävention«. Der Verweis auf die drohende große Katastrophe rechtfertigt die beschriebenen »tragischen Entscheidungen« ebenso wie das Gebot einer radikalen Vernichtung von »Feinden« und ermöglicht so die Verschiebung oder Aufhebung ethischer und politischer Handlungsnormen im Hinweis auf den absoluten Notstand. Und er rechtfertigt jenen präventiven oder präemptiven Aktionismus im Namen der »Sicherheit«, der in Filmen wie Spielbergs Minority Report oder in Grusins Überlegungen zur ›premediation‹ seziert wird. Wie die Prophezeiungen, die ihre Adressaten zum unmittelbaren Handeln aufrufen, kann das katastrophische Imaginäre so in Handlungsgebote und Appelle übersetzt werden, denen es gerade durch die Schrillheit seiner Szenarien eine scheinbare Alternativlosigkeit verleiht. Im antizipierten Desaster, so die Überzeugung des aktionistischen Diskurses, zeigt sich ein unter der Oberfläche unserer Zivilisation liegendes »Reales«, auf das wir uns einstellen müssen, auch wenn es noch lange nicht sichtbar ist. In der (vielleicht allzu kurzen, vielleicht gemütlich langen) Spanne zwischen der Imagination und der Manifestation dieses Realen liegt der Zeit- und Handlungsdruck, den Katastrophenimaginationen ausüben.
Gegenwärtig spricht allerdings vieles für die zweite, handlungsentlastende Funktion des katastrophischen Imaginären. Wir konsumieren Desasterszenarien und Desasterwissen, aber das tun wir weitgehend mit einer Haltung des Zuschauers.[10] Mit anderen Worten: Wir lassen untergehen. Denn die Desaster stoßen ja anderen zu, mal heldenhaften Filmhelden oder armen Collegeprofessoren, mal gesichtslosen Opfern wie den Anrainern von Kernreaktoren, fernen Inselvölkern oder Landschaften. In den Katastrophenfiktionen kann man sich mit diesen anderen identifizieren, man kann so erfahren, was es z.B. heißt, mit Will Smith der Letzte Mensch zu sein oder wenigstens – bei DeLillo – ein chemieverseuchter Professor. Man kann so die Reflexivität eines Blicks aus der Zukunft zurück, eine Perspektive nach der Katastrophe einnehmen, sei es durch eine wissenschaftliche Prognose, sei es in der Stellvertretung durch einen fiktiven Letzten Menschen, der gewusst haben wird, wie alles zugrunde gegangen ist. Aber diese ›Erfahrung‹ geschieht in einem Raum, den wir säuberlich trennen von dem Raum, in dem wir leben, Entscheidungen treffen, Pläne machen. Es ist ein anderer, der in dieser Zukunft untergeht – selbst wenn ich weiß, dass das, was mir da vorgeführt wird, auch meine Zukunft sein kann. Slavoj Žižek und Robert Pfaller haben für diesen Mechanismus den Begriff »Interpassivität« vorgeschlagen.[11] Interpassivität bedeutet, ein Wissen, eine Erfahrung oder einen Glauben an einen anderen zu delegieren, ihn »erfahren zu lassen«, was man selbst nicht erfahren will (oder kann oder darf), ihn »glauben zu lassen«, was man selbst vorgeben möchte, nicht zu glauben. Interpassivität hat nicht selten mit einer theatralen Situation des Beobachtens und der Stellvertretung zu tun, eine Stellvertretung des Handelns, des Empfindens oder des Glaubens: Das »canned laughter« in amerikanischen Sitcoms oder der kommentierende Chor in der Tragödie wären Beispiele. Im imaginierten oder prognostizierten Katastrophenszenario – man verzeihe das Wortspiel – lässt man einen anderen dran glauben. Das verschafft den Wissens- und Reflexionsvorteil der Alarmbereitschaft – und zugleich eine ganz praktische Distanzierung von allen Konsequenzen dieser Einsicht. Denn die sympathischen Kleinfamilien oder kernigen Amerikaner, mit denen man sich bei Emmerich und anderen identifizieren darf, überleben ja am Ende doch. Gerade diejenigen Szenarien, in denen der Untergang der Menschheit im Hintergrund einer rührenden Rettungs- und Familienzusammenführungsgeschichte stattfindet, laden zu dieser interpassiven Haltung ein – oder trainieren sie sogar.[12] Am deutlichsten aber wird sie den seltsam irrealen aktuellen Fiktionen einer ›Erde ohne Menschen‹ eines Glavinic oder Weisman: Sie bieten den gemütlichen Blick in eine Katastrophe ohne Katastrophe, ein Verschwinden des Menschen ohne Blutvergießen – jedenfalls nicht für mich.
Dabei verkennen beide Lesarten – die alarmistisch-mobilisierende wie die interpassiv-entlastende – allerdings jene epistemische Stärke der katastrophischen Imagination, die ich versucht habe, ins Zentrum meiner Lektüren zu stellen: ihre analytische, erhellende Kraft. Die intensive Aktualität der hier betrachteten Katastrophenszenarien besteht weder in ihrem Plädoyer für dieses oder jenes noch in der stellvertretenden ästhetischen Untergangserfahrung, die sie bieten, sondern in der Einsicht, die sie vermitteln: Sie greifen zeitgenössisches Krisenwissen auf – von der Ökonomie über die Optionen nuklearer Vernichtung bis zur Klimaforschung und Sicherheitswissenschaft – und setzen es in »dichte Beschreibungen« möglicher Desaster um, Szenarien, an denen sich die Belastbarkeit sozialer Institutionen ebenso studieren lässt wie die Risiken allzu enger technischer Kopplungen. Die fiktiven Katastrophen sind Experimentalanordnungen. So ermöglichen es die desolaten Welten, die Byron oder Beckett, Kubrick und Lumet, Wells oder Ballard, McCarthy, DeLillo, Kafka oder Gilliam entwerfen, ein Desaster gleichermaßen von innen – aus der Perspektive eines Betroffenen – und von außen – vom Standpunkt eines reflektierenden Beobachters – auszuleuchten. Sie ermöglichen zu zeigen, was von diesen jeweiligen Standpunkten sichtbar wird – und was genau durch diesen Blick verborgen wird. Sie führen vor, welches die Erkenntnisbedingungen und die kognitiven Schemata sind, die den Blick in den Abgrund des Desasters strukturieren. Dadurch eröffnen sie nicht zuletzt einen Blick auf die Kontingenz und Willkür im Inneren jener scheinbar schicksalhaften Notwendigkeiten, die im Angesicht des Desasters so oft beschworen werden. Sie ermöglichen es, zu begreifen, dass dieses Desaster vielleicht doch nicht so unvermeidlich war, wie es sich präsentiert. Dass es nur einer winzigen Verschiebung des Blicks bedurft hätte, um es aufzuhalten oder im »Ernstfall« andere Entscheidungen zu treffen. Die fiktive Experimentalanordnung der Katastrophe verweist in ihrem Kern immer auf eine Einsicht, eine Erkenntnis, deren Bitterkeit darin liegt, dass sie zu spät kommt – aber nicht zu spät hätte kommen müssen.
Wenn Herman Kahn über Szenarien sagt, sie seien »aids to the imagination«, Werkzeuge für das Vorstellungsvermögen, dann lässt sich das auch über Texte, Filme, Bilder und Figuren sagen. Sie sind nicht nur Werkzeuge der Vorstellungskraft, sondern auch Werkzeuge des Denkens. Oder jedenfalls könnten sie so genutzt werden. Und zwar in einer ganz präzisen Weise: Sie könnten uns helfen, jene »blinde Reflexivität« (Latour) oder auch reflexive Blindheit zu überwinden, die alles immer schon weiß, aber nicht geneigt ist, dieses Wissen auch in die eigene Wirklichkeit zu integrieren. Genau diese Haltung hat der französische Philosoph Jean-Pierre Dupuy als das Kernproblem des gegenwärtigen Verhältnisses zu drohenden – technischen, ökologischen, ökonomischen, klimatischen – Gefahren beschrieben:
Angenommen, wir sind sicher oder fast sicher, dass die Katastrophe vor uns liegt, […]. Das Problem ist, dass wir das nicht glauben. Wir glauben nicht, was wir wissen. Was unsere Vorsichtigkeit herausfordert, ist nicht der Mangel an Wissen darüber, wie die Katastrophe in der Zukunft wirksam werden wird, sondern die Tatsache, dass diese Wirksamkeit nicht glaubwürdig ist. […] Alles weist darauf hin, dass wir unsere gegenwärtige Entwicklung nicht endlos werden ausdehnen können, weder räumlich noch zeitlich. Aber all das in Frage zu stellen, was wir mit dem Fortschritt in Verbindung zu bringen gelernt haben, hätte so phänomenale Folgen, dass wir das nicht glauben, von dem wir doch wissen, dass es der Fall ist. Es gibt hier keine Unsicherheit, oder jedenfalls nur sehr wenig. Unsicherheit ist bestenfalls ein Alibi. Aber sie ist kein Hindernis, ganz sicher nicht.[13]
Dupuys Plädoyer für einen »aufgeklärten Katastrophismus« fordert, dass wir das, was wir wissen, auch glauben müssten, d.h., es zum integralen Teil unserer Lebenswelt machten. Es ginge darum, das möglicherweise Drohende nicht nur als Hypothese, sondern als Gegebenheit zu studieren: so wie eine Prophezeiung, die sagt, was kommen wird, nicht was kommen könnte. Genau durch diese Gegebenheit – oder den Glauben an die Prophezeiung – aber kann diese zum Instrument ihrer eigenen Verhinderung werden: »Wenn wir der Zukunft eine Realität, eine Tatsächlichkeit geben könnten, die gleichwertig wäre mit der, die wir der Gegenwart unterstellen, dann hätten wir es geschafft.«[14] Das erfordert, dass eine mögliche Bedrohung glaubhaft, greifbar, konkret vorstellbar wird – nicht als mögliche, sondern als gegebene Zukunft. »Die Zukunft«, schreibt Jorge Luis Borges, »ist unvermeidlich, präzise; aber es mag sein, daß sie nicht zustande kommt. Gott lauert in den Intervallen.«[15] Die Zukunft als gegebene schildern: Genau dies leisten Fiktionen. Sie stellen etwas Imaginiertes so vor Augen, dass es als gegenwärtige Situation erfahrbar wird, fixiert und überzeugend wie eine »Erinnerung an die Zukunft«.[16]





























