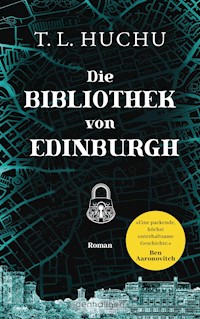
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Edinburgh Nights
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In dieser magischen Bibliothek lernen die Lebenden von den Toten ... Der Auftakt der Edinburgh Nights!
Ropa hat die Schule abgebrochen, um Geistersprecherin zu werden - und nun spricht sie mit den Toten von Edinburgh und überbringt den Lebenden deren Botschaften. Ein scheinbar harmloser Job, um sich, ihre kleine Schwester und ihre Großmutter über Wasser zu halten. Doch Ropas Leben ändert sich schlagartig, als die Toten ihr zuflüstern, dass jemand Kinder verzaubert und sie zu leeren Hüllen macht. Auf einmal findet sich Ropa mitten in einem Spiel mit dem Tod wieder, in dem sie mit ihrem blitzgescheitem Verstand, ihrer geheimnisvollen afrikanisch-schottischen Magie und mit ihrer unnachahmlichen rotzigen Art nach Hinweisen sucht, um die verhexten Kinder zu retten. Als sie dabei auf eine okkulte Bibliothek stößt, ist sie sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sie Jägerin oder Beute ist ...
Alle Bände der »Edinburgh Nights«-Saga:
Die Bibliothek von Edinburgh 1
Das Hospital von Edinburgh 2
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Ähnliche
BUCH
In dieser magischen Bibliothek lernen die Lebenden von den Toten … Der Auftakt der Edinburgh Nights!
Ropa hat die Schule abgebrochen, um Geistersprecherin zu werden – und nun spricht sie mit den Toten von Edinburgh und überbringt den Lebenden deren Botschaften. Ein scheinbar harmloser Job, um sich, ihre kleine Schwester und ihre Großmutter über Wasser zu halten. Doch Ropas Leben ändert sich schlagartig, als die Toten ihr zuflüstern, dass jemand Kinder verzaubert und sie zu leeren Hüllen macht. Auf einmal findet sich Ropa mitten in einem Spiel mit dem Tod wieder, in dem sie mit ihrem blitzgescheiten Verstand, ihrer geheimnisvollen afrikanisch-schottischen Magie und mit ihrer unnachahmlichen rotzigen Art nach Hinweisen sucht, um die verhexten Kinder zu retten. Als sie dabei auf eine okkulte Bibliothek stößt, ist sie sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sie Jägerin oder Beute ist.
DERAUTOR
T. L. Huchu ist ein schottischer Schriftsteller mit simbabwischen Wurzeln, dessen Kurzgeschichten in Publikationen wie Lightspeed, Interzone, AfroSF und anderen erschienen sind. Er ist der Gewinner des Nommo Award für afrikanische SF/F und stand auf der Shortlist für den Caine Prize und den Grand Prix de l’Imaginaire. Zwischen seinen Romanprojekten übersetzt er Belletristik aus dem Shona ins Englische und umgekehrt. »Die Bibliothek von Edinburgh« ist sein Debüt auf dem deutschsprachigen Markt und der erste Band seiner Edinburgh-Nights-Reihe.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
T.L. HUCHU
Die
BIBLIOTHEK
von
EDINBURGH
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Vanessa Lamatsch
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Library of the Dead« bei Tor, London, 2021.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 by T.L. Huchu
First published 2021 by Tor, an imprint of Pan Macmillan,
a division of Macmillan Publishers International Limited.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Penhaligon Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -motiv: © bürosüd
LO Herstellung: MR
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26570-0V001
In memoriam
Josephine Huchu
1949–2017
I
Ich sollte das eigentlich nicht tun, aber ich bin jung und brauche das Geld, also los geht’s.
Es war ein langer Tag. Superlang. Bin über die B702 gewandert, bis nach Liberton, um meine Aufträge zu erfüllen. Zurück über die Umgehungsstraße, letzter Halt in der Lanark Road in Juniper Green. Ich schätze, das war ein Fünfzehn-Meilen-Trip, plus/minus ein bisschen. Meine Oberschenkel tun weh, und meine Füße brennen wie heißes Blei. Echt ein gutes Gefühl, meinen Hintern auf dieses Sofa zu pflanzen und für einen Mo auszuruhen.
»Hättest du gern eine Tasse Tee?«, fragt Mrs McGregor.
»Nur, wenn es auch Kekse gibt«, sage ich. Immer rausquetschen, was möglich ist, und ich bin ausgehungert wie die Kinder auf diesen Oxfam-Postern.
»Wie magst du ihn?«, fragt sie.
»Weiß, fünf Stück Zucker und Sahne.«
Mrs McGregors Augenbrauen wandern unwillkürlich nach oben. Sie öffnet den Mund, überlegt es sich aber anders und schließt ihn wieder. Sie brauchen mich.
»Ich werde dir helfen, Liebes«, sagt Mr McGregor mit volltönender, rauer Stimme. Er steht auf, und zusammen verschwinden die beiden in der Küche.
Ich nehme mir hier diese Freiheiten heraus, weil die beiden so viele Moneten haben, dass ich fast Allergien davon bekomme. Schaut euch die riesige Hütte an. Muss sogar meine Jacke ausziehen, weil es so warm ist. Das ist eins von diesen Cottages aus dem neunzehnten Jahrhundert, dermaßen massiv, dass es noch weitere dreihundert Jahre durchhalten kann. Gebaut, als es jede Menge Land gab, alles in einem Stockwerk, abgesehen vom Loft-Ausbau. Die McGregors sind wirklich stolz auf ihr Haus; sobald ich drin war, haben sie mich damit vollgeschwallt. Haben gesagt: »Wusstest du, dass Thomas Carlyle und seine junge Frau Jane Welsh nach ihrer Hochzeit in genau diesem Cottage gewohnt haben?« Kopfschütteln von mir, obwohl ich die kleine blaue Plakette am Eingangstor gelesen habe. Ich will ja nicht urteilen, aber wenn ich heiraten würde, würde ich meine Hochzeitsreise an einem exotischen Ort verbringen, wie Irland oder was Ähnliches, aber doch nicht in dem verdammten Juniper Green. Trotzdem, jedem das Seine und so. »Du weißt doch, wer Thomas Carlyle ist, oder?«, haben sie gleichzeitig gefragt. Ich habe so getan, als wüsste ich es nicht, und habe sie labern lassen. Machen sie anscheinend mit jedem, der auf ihrer Türschwelle auftaucht.
Ich bin keine Supercheckerin oder irgend sowas, aber wie die meisten Leute interessiere ich mich auch für Geschichte. Also weiß ich, dass Carlyle ein Historiker war, der in früheren Zeiten über dies und jenes geschrieben hat. Er stand auf Helden und einflussreiche Männer und hatte viel dazu zu sagen, wie sie den Lauf der menschlichen Geschichte beeinflusst haben. Immer nur Männer, niemals Jungen und Mädchen und auch ganz selten Frauen. Ich erzähle den McGregors nicht, dass ich seine Ehefrau Jane interessanter finde.
Über dem Kamin mir gegenüber hängt ein gerahmter Druck von Carlyle. Älterer Kerl, grau meliertes Haar und gepflegter Bart. Sein Kopf ruht sanft auf der Hand, den Zeigefinger Richtung Schläfe gestreckt, Daumen unter dem Kinn und die drei restlichen Finger eingerollt. Eine Pose, die ihn als Denker darstellen soll. Die Stirn leicht gerunzelt, aber auch mit einem träumerischen Ausdruck in den Augen, den ich irgendwie knuffig finde. Ich schwöre, der alte Historiker wirkt ganz so, als telefoniere er mit der Zukunft. Ich weiß allerdings nicht, ob er dabei wirklich an unsere heruntergekommene Gegenwart gedacht hat. Er hat doch in der Zeit der großen Reisen gelebt. Also in einer Zeit, in der seltsame und wundervolle neue Dinge aus den entlegensten Winkeln des Britischen Empire über den Hafen von Leith ins Land geströmt sind – wo es heute nur noch Treibgut gibt. Sie haben in dieser Zeit an den Fortschritt geglaubt, an hochtrabende Ideale und das ganze Zeug. Jetzt können wir kaum weiter sehen als bis zum nächsten Morgen. Der Historiker, der von der Historie verschlungen wurde … ist die Zeit nicht wirklich fies?
Ich lasse mich in die Kissen des großen Sofas zurücksinken, auf dem ich sitze. Der Raum ist genauso wie das Ehepaar Carlyle in einer anderen Ära hängengeblieben. Wände in hellem Terrakotta, antike Truhe als Couchtisch, Kupfereimer mit daran hängender Zange neben dem Kamin und ein altmodischer Schaukelstuhl in einer Ecke. Der Teppich unter meinen Füßen wirkt persisch, könnte allerdings von überallher stammen. Er ist abgetreten, doch der fadenscheinige Look passt zum altmodischen Feeling des Raums.
Vor den massiven Fenstern ist es dunkel. Das Licht aus dem Raum taucht die Hecken davor in unheilvolle Schatten. Ich höre, wie die McGregors irgendwas in der Küche tun. Mrs McGregor ist eine kleine Frau und ihr Ehemann eher lang als groß, weswegen mich die Ehe an die Verbindung zwischen einer dänischen Dogge und einem Cockapoo denken lässt.
»Ich bin mir einfach nicht sicher«, sagt Mrs McGregor. Sie versuchen, leise zu sein, versagen dabei aber kläglich. Ich höre, wie etwas Metallisches gegen die Arbeitsfläche knallt.
»Sie wirkt ein bisschen jung«, antwortet Mr McGregor. »Wie alt ist sie wohl, zwölf? Sie hat grüne Dreadlocks und trägt schwarzen Lippenstift, um Himmels willen. Ich weiß nicht, was für ein Stil das sein soll. Grufti? Punk?«
»Mir wurde gesagt, es käme eine ältere Frau mit Erfahrung. Ich glaube, wir sollten lieber …«
»Leute, ich kann euch hören!«, rufe ich. »Ich sitze doch direkt hier, schon vergessen?«
In der Küche wird es still. Sehr still. Nur noch das Geräusch des kochenden Kessels. Ich reibe mir die Oberschenkel. Ich hätte nichts sagen sollen, aber ich bin müde und hungrig, und das macht mich gereizt. Und ich bin keine Stümperin. Ich bin hier, um einen Job zu erledigen, und außerdem brauche ich das Geld.
Die McGregors kommen zurück, Tee in der Hand und die Köpfe leuchtend rot. Mrs McGregors Hand zittert leicht, als sie das Tablett vor mir abstellt. Ich schnappe mir einen Scone, beiße hinein und fühl mich sofort besser. Lecker. Muss hausgemacht sein und ist mit genau der richtigen Menge Butter bestrichen.
»Ich weiß, dass Sie mit meiner Großmutter gerechnet haben, aber sie macht keine Hausbesuche mehr. Ich werde mich für Sie um das Problem kümmern«, sage ich mit vollem Mund. Ich spüle den Bissen mit Tee aus einer echten Porzellantasse herunter. Für einen Moment bin ich versucht, den kleinen Finger abzuspreizen.
»Wir wollten nicht … es ist nur so, dass wir schon mehrere Leute hier hatten, die haben alle versucht, sich des Problems anzunehmen, aber das ist nicht ganz so gelaufen wie geplant«, erklärt Mrs McGregor.
»Wen haben Sie denn gerufen?«
»Den Bischof persönlich – Episkopalkirche.«
Ich kapiere sofort. Diese Kerle stürmen den Raum, kampfsegnen wie die Irren, spritzen vielleicht sogar ein wenig Weihwasser hierhin und dorthin und intonieren irgendwelches Zeug aus dem Buch für gelegentliche Gottesdienste, um dann gleich wieder zu verschwinden. Der Erfolg lässt natürlich zu wünschen übrig. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber wenn in der Nachbarschaft etwas Seltsames passiert, wen soll man schon rufen?
»Diese Scones sind köstlich«, sage ich. Könnte sein, dass die ganze Sache eine Weile dauert.
Ich habe die McGregors gebeten, das Haus zu verdunkeln. Das einzige Licht stammt jetzt von einer Lampe in der Ecke des Zimmers. Der Schein kriecht an den Wänden nach oben, zeichnet einen Halbmond an die Decke, während alles andere im Schatten des Lampenschirms liegt. Die Glotze ist aus, und in der Stille können wir die anderen Anwesenden atmen hören. Das Ehepaar hält sich an den Händen. Es hat sich auf dem kleinen Sofa direkt vor dem Fenster niedergelassen, sodass ich allein auf dem großen Sofa sitze.
Ich bin jetzt schon seit drei Stunden hier. Es ist zwar noch nicht Geisterstunde, aber ich spüre einen gewissen Biss in der Luft, einen subtilen Temperaturabfall, der dafür sorgt, dass ich nach meiner Jacke greife, bevor ich mich besinne.
»Wie lange noch?«, fragt Mr McGregor flüsternd.
Ich hebe meine Hand, um ihn vom Sprechen abzuhalten. Genauso gut könnte er sich nach der Länge einer Schnur erkundigen. Auf jeden Fall, wenn jetzt das Schweigen gebrochen wird, würde das alles zerstören. Hab sie schon gebeten, brave kleine Kirchenmäuse zu sein.
Sie spüren die Kälte in der Luft. Ihr Atem kondensiert vor ihren Mündern. Sie rutschen näher aneinander heran. Der Mister legt den Arm um die Missus. Gänsehaut bildet sich auf meinen Armen, sodass sich die kleinen Härchen darauf aufstellen.
Das Bild von Thomas Carlyle schlägt klappernd gegen die Wand, ein schreckliches Geräusch in der Stille. Ich richte mich auf, beuge mich vor und stemme die Ellbogen auf die Knie, die Finger verschränkt. Die Lampe flackert. Die Blumen auf dem Kaminsims rascheln und werfen frische Blütenblätter auf den Boden. Ein knirschendes Geräusch erklingt aus den Deckenbalken. Etwas Widerwärtiges wabert durch die Luft. Es ist weniger ein Duft als vielmehr ein Gefühl des Verbotenen, der Sünde, der Dekadenz. Eines Tabubruchs, der eine offene Wunde in der Seele der Welt zurückgelassen hat. Die Kohlenzange schlägt gegen den Eimer und erzeugt ein Geräusch wie ein chinesischer Gong.
Mr McGregor ballt eine Hand zur Faust und beißt sich in die Knöchel. Etwas dreht den Türknauf, und dann entkommt ein Quietschen Mrs McGregors Kehle. Die Tür schwingt auf, um mit einem Knall wieder zuzuschlagen. Öffnet und schließt sich nochmal. Öffnet und schließt. Der Eimer. Das Bild. Eine Statuette fällt zu Boden.
»Gott helfe uns«, klagt Mr McGregor und bekreuzigt sich – erst die linke Schulter, dann die rechte.
Vorhänge flattern, die verriegelten Fenster klappern in den Rahmen. Aufruhr und Chaos, kleine Gegenstände, die durch die Luft fliegen. Eine wabernde graue Gestalt huscht im Halbdunkel hin und her und wirft Möbel um. Oh, das muss ein altes Gespenst sein, wenn es die Macht besitzt, die materielle Welt auf diese Art zu beeinflussen. Ich beobachte, wie es schon wieder die Tür aufreißt.
»Bist du jetzt fertig?«, frage ich, den Blick direkt auf die abscheuliche Erscheinung gerichtet.
Der Geist sieht mich an. Dunkle Augen und ein unheimlicher Tunnel in seinem Gesicht, der als Mund dient. Er heult, ein schreckliches Kreischen, wie ein langsamer Kehlschnitt im Schlachthof. Der Schrei bewegt die Luft, dann schießt der Geist auf mich zu, das Maul vom Boden bis zum Gesicht geöffnet, als wolle es mich verschlingen. Ein Heft auf dem Tisch öffnet sich mit flatternden Seiten, als das Gespenst zu mir gesaust kommt und mit einem schrecklichen Heulen direkt vor meinem Gesicht anhält.
»Ich habe gefragt: ›Bist du mal fertig, Freundchen?‹«, sage ich, greife nach meinem Rucksack und stehe auf. »Du veranstaltest hier einen ziemlichen Aufruhr.«
Es antwortet, stößt abstoßende, gebrochene Geräusche hervor, ein qualvolles Wutgeschrei. Das Fast-Gesicht ist mit grauen Erdklumpen verklebt. Eine Wunde zieht sich über seine Kehle, so weit offen wie ein zweites Paar Lippen. Alte Gespenster können schrecklich aussehen, und dieses hier bildet da keine Ausnahme. Ich mustere die Gestalt, als ich die Mbira aus dem Rucksack ziehe. Das ist ein traditionelles Musikinstrument von der ungefähren Größe eines Laptops. Meine ist aber ganz einfach, ohne Schmuck, nur Tasten aus Metall auf einem Stück Holz – so dick wie ein schweres Schneidebrett. Die McGregors sitzen immer noch aneinandergedrückt auf dem Sofa und beobachten mich. Sie können nicht sehen, was ich sehe, aber das Getöse verklingt schon. Das Resonanzbrett der Mbira liegt fest in meiner Hand, die Metallzungen drücken hart gegen meine Daumen. Ich spiele eine langsame Melodie, Gavakava, einfach etwas, um das Tempo zu reduzieren, den Zorn zu beruhigen und die Stimmung aufzuhellen. Ich möchte keinen Ärger.
»Klatschen Sie im Takt«, sage ich zu dem Paar. Dann wende ich mich wieder dem Ghul vor mir zu. »Wir können das auf die einfache oder auf die harte Tour durchziehen. Hängt ganz von dir ab.«
Der Geist kreischt und macht erneut Anstalten, mich zu bedrohen, aber ich beschleunige das Tempo, treibe ihn mit einer wilden Melodie an die Wand und nagele ihn dort fest. Ich verändere die Oberschwingungen meiner Musik, um das Band zu packen, das den Toten in dieser Welt festhält. Das Gespenst heult vor Schmerz, und ich verlangsame den Rhythmus wieder zu der getragenen Melodie, die ich zu Beginn schon gespielt habe. Ich habe hier das Sagen, und der Geist versteht diese Botschaft. Nachdem er dieses Haus seit Jahren heimgesucht hat, hat er gefühlt, wie ihm die Wurzeln abgeschnitten wurden, die ihn halten. Ich entferne quasi einen Baumstumpf … und das kann ein bisschen knifflig sein, selbst mit den richtigen Werkzeugen. Der Geist schrumpft vor meinen Augen, wird immer kleiner und schluchzt schließlich wie ein Kind.
»Du solltest nicht hier sein. Ich weiß nicht, was für unerledigte Geschäfte du noch hast, aber dies hier ist deine letzte Nacht auf dieser Ebene. Du hast eine Wahl frei. Du kannst entweder eine kleine Forderung stellen – innerhalb vernünftiger Grenzen – und aus eigenem Antrieb verschwinden, um nie wieder zurückzukehren. Oder ich kann dich auf die Andere Ebene austreiben. Mir ist es egal. Sprich jetzt.«
In der Ecke, in der es kauert, hebt das Gespenst den Kopf. Jetzt sehe ich das Gesicht eines jungen Mannes, kaum zwanzig Jahre alt, dessen Schicksal von Halsabschneidern besiegelt wurde – um dann in einem flachen Grab in dem Feld begraben zu werden, das lange Zeit später zum Baugrund für dieses Haus wurde. Durch die zwei Münder, die das Gespenst besitzt – der zweite ist durch eine scharfe Klinge geschaffen worden –, höre ich seine Geschichte und werde Zeuge einer Ungerechtigkeit, die sich nicht von Zeit und Erde begraben lassen wollte.
II
Es liegt eine Leiche – wobei man es eigentlich nicht mehr so nennen kann, eher ist es ein Skelett – unter dem Holzapfelbaum am Ende des Gartens. Der Körper lag dort schon seit Jahrhunderten, feucht und zerfressen von Würmern, während die Wurzeln des Baums darum gewachsen sind. Der Name des jungen Mannes war Andrew Turnbull, er hat gelebt, geliebt, gelogen und ist dann vor seiner Zeit gestorben.
Ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass wir alle vor unserer Zeit sterben, selbst wenn wir hunderteins werden. Das hält mich im Geschäft.
»Ist es weg?«, fragt Mrs McGregor nervös.
»Die Abmachung lautet, dass Sie Andrews Skelett ausgraben und auf geweihtem Boden beerdigen sowie eine Messe zu seinem Gedenken abhalten lassen«, antworte ich, als ich die Jacke anziehe. »Eine presbyterianische Zeremonie. Er war ein echter Protestant, also bitte nicht diesen Episkopalkirchen-Papisten-Mist.«
Ihr Nicken wirkt fast erleichtert. Auch etwas ängstlich. Ich nehme an, jeder wäre ein wenig verschreckt von dem Gedanken, dass im eigenen Garten Skelette liegen. Sowas ist beängstigender als die übliche Leiche im Keller. Aber letzten Endes ist mein Lieblingsteil das Eintreiben meiner Kohle. Ich schließe den letzten Knopf an meiner Jacke; es ist eine deutsche Bundeswehrjacke mit der schwarz-rot-goldenen Flagge an beiden Schultern.
»Da wäre noch die Bezahlung«, sage ich.
»Ja, natürlich«, antwortet Mrs McGregor.
»Möchten Sie eine Quittung?«
»Wenn du so freundlich wärst.«
Ich nehme die Dukaten, die sie mir in frischen Scheinen anbietet. Zwanzig davon ergeben einen Prinzling. Verschafft mir ein warmes Gefühl, meine Taschen damit zu füllen. Normalerweise verdiene ich nicht so viel. Andererseits, normalerweise mache ich sowas auch gar nicht. Mein üblicher Job ist viel banaler. Ich ziehe mein Quittungsbuch und einen Stift aus der Brusttasche. Kritzele einen Beleg für eine ›Sonderleistung‹. Ich darf nicht sagen, was ich wirklich getan habe, weil mich das meine Praktizierenden-Lizenz kosten könnte, falls es herauskommt. Ich reiche Mrs McGregor die Quittung.
Das Paar folgt mir zur Tür. Zu dritt stehen wir dicht gedrängt im Flur. Ich dreh mich um und schüttele ihnen die Hände.
»Gute Nacht, Leute«, sage ich. Ich kann mir einen letzten Spruch einfach nicht verkneifen. »Und nur, damit Sie es wissen, ich werde bald fünfzehn.«
Mein Geburtstag ist zwar erst in sieben Monaten, aber ich bin mir sicher, dass das besser klingt als »Ich bin vierzehn«. Eigentlich ist es dasselbe, aber es geht nicht darum, was man sagt, sondern darum, wie man es sagt. Jetzt will ich nur nach Hause, mich hinhauen und chillen. Nie bummeln, wenn der Job erledigt ist. Die Kunden sind nicht meine Freunde – das habe ich auf die harte Tour gelernt. Ich werfe mir meinen Rucksack über die Schulter und gehe zur Straße.
Mit beschwingten Schritten wandere ich die Lanark Road entlang. Mit Zaster in der Tasche fällt jeder Stress von einem ab. Es ist spät und die Straßen sind verlassen – bis auf zwei Pferde, die vor einer nahen Gemeindekirche angebunden sind. Ist eine nette Gegend hier. Niedrige Steinmauern und Hecken säumen meinen Weg durch die leeren Straßen in Richtung der Umgehungsstraße. Es ist unglaublich dunkel, weil die Straßenlaternen hinüber sind, aber die Leute hier können sich Solar leisten, also dringt Licht aus den Fenstern.
Ich ziehe mein Handy heraus, drücke die Pod-App und höre weiter meiner Vorlesung zu, aber mit dem Ohrstecker nur im linken Ohr. Auf keinen Fall will man riskieren, dass man seine Umgebung nicht mehr wahrnimmt. Deswegen halte ich nichts von richtigen Kopfhörern – das ist der sicherste Weg, wie ein Trottel überfallen zu werden. Ich mag meine Podcasts und Audiobooks; meistens höre ich Geschichts- oder Wissenschafts- oder True-Crime-Lesungen. Verschiedenstes Zeug. Wenn es gut ist, hör ich es mir an. Ich latsche den ganzen Tag rum … und so wie ich es sehe, nutze ich die Zeit doppelt, wenn ich dabei auch noch etwas lerne. Damit bekommt ein Vierundzwanzig-Stunden-Tag quasi zweiunddreißig Stunden, weil ich acht davon aufdrösele wie Klopapier und damit zwei zum Preis von einem bekomme. Im Moment lausche ich Arthur Hermans Buch über die Schottische Aufklärung.
Ich höre laute, selbstbewusste Schritte hinter mir und entferne den Ohrstöpsel.
Lege die rechte Hand an den Dolch an meiner Hüfte. Ich muss meine Atmung kontrollieren. Wenn man in Panik verfällt, hört man auf zu denken und hat den Kampf schon verloren. Wenn irgendwer heute Abend was versucht, werde ich nicht schreien, sondern schneiden.
»Du da, stopp«, ruft ein Mann hinter mir.
Ich beschleunige meine Schritte.
»Polizei, Trottel. Halt jetzt an oder wir lassen den Hund los. Deine Wahl.«
Scheiße. Huren … Ich halte an. Dreh mich in Richtung der grellen Taschenlampe. Ich erkenne zwei Silhouetten und einen Köter, der sich gegen den Zug der Leine stemmt. Schweine, Mann. Schweine. Die alten Leutchen erzählen, die Bullen wären in der alten Zeit bloß mit dem Auto herumgefahren. Hätten niemanden belästigt. Sobald sie die Autos losgeworden sind und angefangen haben, zu Fuß herumzuwandern oder auf Pferden zu reiten, ist die Hölle ausgebrochen. Lasse besser mal meinen Dolch los, für den Fall, dass sie auf die falsche, naja eigentlich auf die richtige Idee kommen.
»Tut mir leid, Officer. Das hatte ich nicht verstanden«, rufe ich.
Sie schlendern zu mir, als hätten sie alle Zeit der Welt. Einer von ihnen pfeift die Titelmelodie von Zwei glorreiche Halunken. Versetzt mich in Schrecken wie alle bekannten und vergessenen Götter zusammengenommen.
»Was denkst du, Johnson?«
»Vorsätzliches Ignorieren der rechtmäßigen Anweisungen eines Gesetzeshüters, Versuch, sich der Festnahme zu entziehen, Landfriedensbruch.«
»Oh, bitte, so ist es nicht«, sage ich.
Der Hund stößt ein drohendes Knurren aus. Ein Schauder läuft mir über den Rücken. Instinktiv gleitet meine Hand in Richtung meines Dolches, und ich muss sie bewusst bremsen. Muss mich daran erinnern, wer diese Typen sind und was sie tun können. Der mit dem Namen Johnson ist über eins neunzig groß, gebaut wie ein Panzer. Der andere sieht ein bisschen normaler aus. Sie gehen breitbeinig, ihre Signaljacken leuchten.
»Sind das ernsthafte Vergehen, Johnson?«
»Ich fürchte schon. Der Jugendknast ist voll, also werden wir sie wohl zu den großen Jungs werfen müssen. Könnte ein paar Monate dauern, bis sie den Sheriff zu Gesicht bekommt, so verstopft wie das System gerade ist.«
»Das wäre wirklich eine Schande«, sagt der Cop, der die Hundeleine hält.
»Aber da können wir nichts machen. Gesetz ist Gesetz«, antwortet PC Johnson.
»Leute, Officer, Sirs, ich wollte nicht …«
»Bedroht sie jetzt einen Polizeibeamten, Johnson?«
»Ich glaube schon.«
»Ich fürchte gerade um mein Leben«, sagt der zweite Bulle, die freie Hand am Pistolenhalfter.
Heutzutage versuchen sie nicht mal »guter Cop – böser Cop« zu spielen … weil es nur noch eine Sorte Cop gibt.
Das Licht schmerzt in meinen Augen. Ich hebe die Hände vor den Körper und schiebe sie dann ganz langsam in meine Tasche. Ich ziehe das Geld heraus und strecke es ihnen auf der offenen Handfläche entgegen. Das ist alles, was ich bei mir trage. Ich verstecke nichts. Man will auf keinen Fall so wirken, als wolle man diese Kerle hinhalten. Denn wenn sie es herausfinden, findet man sich in einer Welt aus Schmerz wieder.
PC Johnson tritt vor. Statisches Rauschen dringt aus seinem Funkgerät, dann redet eine fast unhörbare Stimme eine ganze Weile, bevor sie wieder verstummt. »So viel sollte ein Straßenkind zu dieser Nachtstunde nicht mit sich herumtragen«, sagt er, als er sich die Kohle schnappt. »Keine Sorge, ich werde für dich darauf aufpassen.« Ich sehe ihm nicht in die Augen, starre auf seine schwarzen Stiefel, nicht in sein Gesicht.
Er lässt zwei Mini-Pennys in meine Handfläche fallen.
»Die Schwachen sind Hackfleisch … schaff deinen Hintern nach Hause, Kindchen. Du müsstest schon längst im Bett sein.«
»Danke, Sir«, murmele ich und ziehe mich langsam zurück. Der Hund tigert auf und ab, zerrt an der Leine. Ich drehe mich um und gehe weiter. Typisch für mich, dass das genau an dem Tag passiert, an dem ich tatsächlich gutes Geld verdient habe. Verdammt und zur Hölle, ich hätte die andere Route nach Hause nehmen sollen.
III
Man sagt, ein Narr und sein Geld sind schnell geschieden, aber verdammt. Ich hätte wirklich den anderen Weg nehmen sollen. Über die B-Road durch Wester Hailes und dann wieder raus. Dämlich. Ich bin keine Hellseherin, ich konnte nicht wissen, dass sowas ausgerechnet heute passieren würde. Es ist wie in diesem Lied von früher, über den alten Kerl, der im Lotto gewonnen hat und am nächsten Tag gestorben ist. Fliegen im Champagner und so. Stirnrunzelnd reibe ich mir den Nasenrücken.
Zumindest hat mir das Gesetz nicht in den Hintern getreten, aber ich bin trotzdem am Arsch.
Wahrscheinlich bin ich ein wenig erschüttert. Ist eine Weile her, dass Johnny Law mich durchgeschüttelt hat. Bin schon fast zu Hause. Der Asphalt der Umgehungsstraße besteht aus Rissen und Stücken, wie ein Puzzle. Unkraut wächst stolz aus den Spalten. Die alten Leutchen haben mir erzählt, dass es auf dieser Ringstraße früher meilenlange Staus gab. Vielleicht stimmt das sogar, aber jetzt ist das Ding tot.
Metallstücke stehen aus dem Boden, wo früher mal die mittlere Leitplanke stand. Der Großteil davon wurde schon vor Urzeiten für den Schrottwert abgebaut. Jepp, noch vor ein paar Jahren bin ich bei solchen Gaunereien dabei gewesen. Jetzt ist es vorbei, und die Menge ist weitergezogen.
Eine hellgraue Gestalt erscheint vor mir, fast durchsichtig, nur eine Andeutung von Nebel vor der Dunkelheit der Nacht.
Normalerweise würde ich auf einer solchen Straße keine Geschäfte machen, aber die Umgebung ist dunkel und verlassen, mein Hirn ist Matsch und ich will das Geld wieder reinholen, das ich gerade verloren habe. Also halte ich an und ziehe meine Mbira aus dem Rucksack. Das hier ist ein frischer Geist. Wahrscheinlich weit von seinem Friedhof entfernt. Er flackert wie eine alte Glühbirne, bemüht sich, in diesem Gefilde zu verweilen. Jedes Mal, wenn er kurz in das Land der Toten gesaugt wird und zurückkehrt, erscheint er in einer leicht anderen Position. Kann noch nicht lange tot sein, wenn er noch nicht gelernt hat, sich auf dieser Existenzebene zu verankern.
»Halt durch, ich mach das«, sage ich und wärme mein Instrument auf.
»Booga wooga wooga«, antwortet der Geist.
Gib mir Kraft. Ich kann Geister nicht ohne die richtige Musik verstehen, die ihre Stimmen zu Worten entwirrt. Bis ich die richtige Melodie finde, höre ich nur Kauderwelsch. Doch bevor wir anfangen, muss ich ihm den Vortrag über Liefer- und Zahlungsbedingungen halten. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben.
»Okay, ich kann in deinem Namen eine Nachricht überbringen, an jede Person innerhalb der Stadtgrenzen, auch wenn ich momentan die Innenstadt nicht abdecke, tut mir leid. Liefer- und Zahlungsbedingungen: Es gibt drei Stufen von Honorar für diesen Service, eine niedrige, eine mittlere und eine hohe Pauschale plus zwanzig Prozent Mehrwertsteuer. Die Stufe, die berechnet wird, hängt von der Länge, Komplexität und dem Inhalt der Botschaft ab. Wenn du die Rechnung nicht bezahlen kannst, gibt es eine Nachnahme für den Empfänger, mit einem kleinen Aufschlag. Hinweis: Dieser Service übermittelt keine vulgären, obszönen, kriminellen oder in anderer Hinsicht unzulässigen Botschaften, doch es kann trotzdem eine Gebühr anfallen, falls wir beschließen, eine redigierte Fassung der Nachricht zu übermitteln. Hast du verstanden?«
»Booga.« »Ich deute das mal als Ja.«
Ich zupfe ein paar Noten auf der Mbira, um die richtige Frequenz für dieses spezielle Gespenst zu finden. Sie hat ein Proto-Gesicht, mit Hügeln als Wangen und zwei leuchtenden Flächen als Augen. Neue Tots durchlaufen gewisse Phasen. Zuerst neblige Wolke, dann eine vage menschliche Form. Mit Übung können sie danach sogar bekleidet oder in anderen Gestalten erscheinen. Die Bekleideten sind gewöhnlich schon eine Weile unterwegs. Sie wollen kaum Botschaften überbracht haben, weil sie selten noch lebende Verwandte haben, denen man Geld abnehmen könnte.
Ich persönlich finde dieses ganze Spukerei-Ding ja ein wenig jämmerlich. Also, falls ich sterbe – wenn ich sterbe –, würde ich niemals in diese Dreckswelt zurückkehren. Damit wäre ich durch. Finito. Ich hab Besseres mit meinem Nachleben anzufangen. Auf keinen Fall komme ich wie ein Loser aus dem AllDort zurück. Das ist der erste Halt nach dem Tod – ein finsterer, grauer Ort. Man könnte es Hades-Hotel nennen, eine Art Unterwelt für den kleinen Geldbeutel, die mit unserer Welt verbunden ist. Doch jenseits des AllDort gibt es so viel mehr … Ebenen voll von Licht und Musik und mystischem Zeug, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Doch sobald ein Geist das AllDort hinter sich lässt, verliert er für immer die Verbindung zu unserer Welt – und ich nehme an, das ist hart.
Ich entscheide mich für den ersten Akkord von Chiwoniso Maraires Lied Mai. Sie gehörte zu meinen allerliebsten Mbira-Spielerinnen jemals und diese besondere Melodie ist ein dynamischer Jig mit genug Macht, um die Geisterwelt zu berühren. Ich spüre Chiwoniso in meinen Daumen, als sie über die Tasten gleiten, wo Schwielen auf hartes Eisen treffen. Ka-ra-ka-kata, ka-ra-ka-kata, ka-ra-kata. In uralten Zeiten wurde die Mbira von den Shona eingesetzt, um während Zeremonien und Ähnlichem mit den Ahnen zu kommunizieren. Mein Instrument besteht aus dem Holzbrett eines Mubvamaropabaums mit verrosteten eisernen Lamellen, die darauf festgebunden sind. Ziemlich schwer.
Der Geist wird klarer. Es ist mir gelungen, sie auf dieser Ebene zu verankern.
»Sag mir deinen Namen«, sage ich. Im Umgang mit Besuchern von der anderen Seite ist es wichtig, sofort mit Autorität aufzutreten, deswegen formuliere ich es als Befehl, nicht als Frage.
»Nicola Stuart.«
»Woher stammst du?«
»Baberton, aber ich bin in Murrayburn aufgewachsen.«
Super, sie stammt aus dieser Gegend. Ich werde den Auftrag annehmen, ein paar Shilling verdienen und fertig.
»Kannst du zahlen oder willst du, dass die Gebühr dem Empfänger der Botschaft in Rechnung gestellt wird?«
Sie wabert. Ihr Gesicht wandert von einer Seite zur anderen. Dann flackert sie. Ich verliere sie, also beschleunige ich das Tempo, um sie zu erden.
»Mein Sohn, Ollie, Oliver, wird vermisst. Er wurde schon vermisst, bevor ich …« Die Worte bleiben ihr in der Kehle stecken. Geister vermeiden es wenn möglich, über ihr Dahinscheiden zu sprechen. Muss irgendwas in der Art von PTBS sein. »Er ist eines Tages mit seinem Freund Mark verschwunden. Mark kam zurück, aber er konnte uns nicht sagen, was passiert ist. Kannst du …«
»Kann Mark zahlen?«
»Nein, er ist sieben.«
»Dein Partner?« Sie schüttelt den Kopf. »Gibt es irgendjemand anderen, der zahlen kann?«
»Meine Eltern leben in Sighthill, aber sie sind knapp bei Kasse. Wir können es uns nicht leisten.«
»Nicola, Nikki, Nik, stopp mal. Lass mich ganz offen sein. Ich kann jeder Person deiner Wahl eine Botschaft überbringen, solange sie bereit und willig ist, dafür zu zahlen. So funktioniert diese Sache.«
»Bitte, du bist die Einzige, die mir helfen kann, meinen Sohn zu finden.«
Tsss. Was für eine Zeitverschwendung. Ich bin doch damit durch, besondere Dienste zu leisten und bestimmt nicht gratis. Anscheinend denkt sie, ich bin hohl im Schädel oder irgendwas.
»Tut mir leid, ich arbeite nicht umsonst. Ich muss meine Tötchen …« Ups, das war mal ein Freudscher Versprecher. »Ich wollte sagen, ich muss meine Brötchen verdienen. Darum geht es im Leben, für den Fall, dass du es vergessen hast. Mein Ratschlag: Informier die Polizei oder finde einen Hellseher. Das ist nicht meine Hausnummer. RIP.«
Ich höre auf zu jammen. Es ist spät und ich bin platt. Ich muss mal die Augen zumachen, bevor ich morgen früh wieder arbeiten kann. Nicola booga-woogat, aber ich hör gar nicht mehr zu. Die Nacht geht langsam in den Tag über und das AllDort wird nach dem Verklingen meiner Musik noch mehr an ihr zerren. Doch ich haue einfach ab und lasse sie verblassen.
IV
Aufsteigender Rauch, das vage Flackern offener Feuer. Der Geruch von verbranntem Holz und Kohle wabert durch die Luft, als ich auf meiner Straße weitergehe. Stimmen murmeln in Gassen, Lachen dringt um die Ecken. Schafe blöken und Hühner gackern. Dieser Ort hat einen ganz eigenen Pulsschlag, einen eigenen Rhythmus, der ihn vom Rest der Stadt unterscheidet. Ich springe über einen Entwässerungsgraben und gehe an den Hütten am Rand entlang. Sie sehen wie kleine Bungalows auf Stelzen aus. Dahinter erstreckt sich eine bunt gewürfelte Masse aus Zelten, Wellblechhütten, Holzschuppen und anderen notdürftigen Konstruktionen an den Seiten schmaler Gassen, und all das steht auf etwas, das einmal ein Feld war.
Die Universität am Ende der Straße behauptet, wir wären ein Schandfleck; dass wir nicht hier sein sollten. Zum Teufel mit ihnen. Ich trete in eine Pfütze, und Wasser durchnässt meine Socke. Meine Stahlkappen sind schon seit Urzeiten nicht mehr wasserdicht. Aber auf den ersten Blick, im dämmrigen Licht, sehen sie wie normale Docs aus.
Ich erreiche unseren Wohnwagen und werde mit einem Kläffen aus der Dunkelheit unter ihm begrüßt. Ich gehe in die Hocke, schnippe mit den Fingern und pfeife. Ich höre Hecheln im Bau, doch mein Mädchen River kommt nicht zu mir. Ihre glänzenden Augen beobachten mich aus der Röhre. Totale Mistkröte, hätte sie schon vor Ewigkeiten in den Topf werfen sollen, denke ich, als ich aufstehe. Ist sowieso zu kalt, um hier rumzuhängen. Selbst der Türknauf ist eisig, als ich ihn drehe.
Warme Luft begrüßt mich. Eilig kontrolliere ich, ob die Fenster leicht geöffnet sind. In der Feuerschale auf der Arbeitsfläche glühen Kohlestücke. Wenn man die Fenster nicht öffnet, schläft man ein und wacht nie wieder auf. Auch eine Art zu verschwinden.
»Hey, Gran, wie war dein Tag?«, sage ich und werfe ein bisschen Spargel auf den Herd.
»Bist du das, Ropa?« Wer sonst?, frage ich mich.
»Ja, ich bin zurück.«
»Hattest du einen guten Tag?«
»Supertoll, danke. Habe einen Poltergeist ausgetrieben.« Ich erzähle Gran nicht von meiner Begegnung mit Johnny Law. Ihrem Herzen geht’s nicht so gut, sie nimmt jede Menge Medikamente, und sie soll Stress vermeiden, damit die Pumpe nicht noch explodiert. Ich weiß nicht, was ich ohne sie anfangen sollte, also muss ich auf sie aufpassen.
»Ich hoffe, du bist nett gewesen. Besonders die Verlorenen verdienen Freundlichkeit – manchmal hilft das, ihnen den Weg zu zeigen«, sagt Gran. Ihre Stimme ist rau und knisternd, wie trockene Blätter, die im Herbst unter den Füßen knirschen. Gran klopft auf die Bank neben sich. Ich werfe meinen Rucksack auf die Arbeitsfläche und lasse mich auf die Bank fallen. Dann lege ich den Kopf an Grans Schulter. Seltsam weich und gemütlich. Gran strickt etwas, und ihr Ellbogen reibt sanft über meine Seite. Sieht wie eine kleine Jacke aus. Zu klein für uns, muss für ein Nachbarskind sein oder so. Gran sieht nicht mehr allzu gut, aber sie kann immer noch stricken. Die Muster sind alle in ihrem Kopf.
»Izwi?«, frage ich nach ein paar Minuten.
»Unter dieser Decke, schläft tief und fest«, antwortet sie.
»Hat sie dir heute Abend den Tee gemacht?«
»Ja.«
»Ihre Hausaufgaben?«
»Das auch und dann noch alle anderen Aufgaben, die du ihr gegeben hast. Wieso ruhst du dich nicht aus, Kind? Iss etwas und erzähl mir von deinem Tag.«
Ich hatte bereits Tee und Gebäck bei den McGregors gegessen, also wird uns das heute ein paar Lebensmittel sparen. Was bedeutet, dass Gran morgen zu Mittag essen kann, drei Mahlzeiten statt zwei. Ich entspanne mich und erzähle ihr von meinem Besuch, lasse aber alles Schlechte aus. Ich möchte die Atmosphäre zu Hause nicht killen. Gran brummt und grummelt, um Interesse zu zeigen. Wenn sie einem so zuhört, ist es, als würde für sie das gesamte Universum verstummen. Nur du selbst zählst. Deine Stimme ist das Einzige, was es wert ist, gehört zu werden. Nur du bist wichtig.
V
Ich steh am Herd und koche Haferbrei. Die Stromversorgung ist in den letzten Tagen ziemlich wackelig. Eigentlich sollten wir nicht mal am Netz hängen, aber für einen Riesenbatzen Geld gibt es da einen Kerl, der das regeln kann. Er schließt einen an die riesigen Leitungen an, die in die Stadt führen. Es ist relativ sicher; bisher ist deswegen nur ein Wohnwagen hochgegangen.
Immer noch ein bisschen hässlich draußen. Die Sonne versteckt sich hinter dicken, grauen Wolken, die den gesamten Himmel bedecken. Jemand hämmert brutal gegen die Tür. Ich schaue durch das Lukenfenster und erkenne den Troll, wie wir ihn nennen.
»Okay, okay. Nicht die verflixte Tür einschlagen«, grummele ich.
Ich schalte den Herd herunter, gehe an den Schrank, in dem ich mein Einmachglas aufbewahre, und zähle das Geld darin.
»Ich komme schon, Himmel«, rufe ich, als das Hämmern wieder anfängt, diesmal noch heftiger.
»Wer ist das?«, fragt Gran von ihrem Platz.
»Niemand, Gran. Schlaf weiter.«
Also … manche Leute. Er weiß doch, dass ich komme, aber trotzdem macht er Aufruhr. Wenn ich je genug Kohle zusammenkratze, bin ich hier weg. Hasta la vista, Schwachköpfe, man riecht sich später. Und ohne Nachsendeadresse.
Ich öffne die Tür. Die Morgenluft ist frisch und ein bisschen neblig. Vogelgesang und eine Brise. Der speckige grüne Traktor des Trolls steht vor der Tür. Ich übergebe mein Glas und stemme dann beide Hände in den Türrahmen, damit der Troll nicht reinkommen kann. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes unser Grundherr. Unser Wohnwagen gehört ihm zwar nicht, aber das Land, auf dem unser Zuhause steht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man es Grundzins nennt. Das bedeutet, strenggenommen und informell-illegal, dass wir auf Pachtland stehen … was so ein englisches Ding ist. Die Sache ist die: Eines Tages, nachdem sich die ersten illegalen Siedler in Hermiston eingenistet hatten, hat Farmer McAlister kapiert, dass er hier kostbaren Grund und Boden besitzt. Wo ein weniger gerissener Mann vielleicht das Gesetz gerufen hätte, hat er eine Chance gesehen – Geld von uns einzutreiben. Ist einfacher, als morgens aufzustehen und sich um die Felder zu kümmern, wie es ein echter Farmer tun sollte. Lange Rede, kurzer Sinn, so ist der Slum seiner Majestät in Hermiston geboren worden.
Wir nennen Farmer McAlister den Troll. Nicht, weil er Geld aus uns rauspresst, sondern weil er tatsächlich wie einer aussieht. Er hat eine riesige, verquollene, rote Nase, aus der Haare wachsen, seine Ohren sind haariger als alles andere auf dieser Seite des Äquators und sein Gesicht wird von tiefen Falten durchzogen. Er ist klein und breit gebaut, mit dürren Beinen unter einem breiten Rumpf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Missing Link ist.
»Das ist nur die Hälfte«, sagt er mit einem Schnauben.
»Der Rest ist unterwegs«, antworte ich.
Er tut so, als sehe er sich um, und kratzt sich an der Schläfe.
»Von wo? Kann nichts sehen«, sagt er. Ich runzele die Stirn. »Ich bin kein Wohltätigkeitsverband. Könnte auf diesen Feldern auch Weizen und Gerste anbauen. Wenn du willst, dass du und deine Nan weiter hier leben können, dann bring das in Ordnung.«
»Sie werden Ihr Geld schon kriegen«, sage ich.
»Aye, damit hast du recht, Mädchen. Gäbe es mich nicht, säßest du auf der Straße. Vergiss das nicht.«
Der Troll kippt das Geld in einen kleinen Sack und wirft mir das Glas wieder zu. Er geht zu dem grünen John-Deere-Traktor, über dessen Mitte sich ein gelber Streifen zieht, steigt hinauf – agil wie ein junger Mann – und startet den Motor. Er legt den Gang ein und fährt mit röhrendem Diesel davon.
Mir ist der Appetit vergangen, aber ich muss immer noch Frühstück für Izwi machen, bevor sie zur Schule geht. Und Gran kann ihre Tabletten nicht nehmen, bevor sie nicht etwas Warmes im Bauch hat. Ich kehre zum Herd zurück und rühre, dann mische ich noch Erdnussbutter in die Haferflocken. Lecker.
»Haben sie den Jungen schon gefunden?«, fragt Gran. »Willie Matthews – gestern sind sie auf ihrer Suche hier vorbeigekommen. Wird schon seit Wochen vermisst.«
»Er hängt wahrscheinlich besoffen irgendwo rum«, antwortet Izwi.
»Und was weißt du über sowas?«, frage ich. »Beeil dich, iss dein Porridge auf.«
Ich kenne Willie, netter Typ, keinen bösen Knochen im Körper. Die Matthews leben in einem Trailer auf der anderen Seite des Kanals. Bin früher mal mit ihm zur Schule gegangen. Sieht ihm gar nicht ähnlich, so zu verschwinden. Aber, hey, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist es, meine kleine Schwester rechtzeitig zur Schule zu bringen. Ich weise sie an, sich ihren Ranzen zu schnappen, und küsse Gran zum Abschied, bevor wir aufbrechen.
Unser Wohnwagen ist innen und außen klein. Es ist ein 89er Rallyman aus der Zeit, als man Dinge noch baute, damit sie lange halten. Er ist wirklich klein, aber trotzdem cool. Die aufgemalten Gänseblümchen und Sonnenblumen auf den Seiten lassen ihn fröhlich wirken. Die Reifen sind platt, hohes Gras wuchert um sie herum. Die Felgen sind vollkommen verrostet. In nächster Zeit werden wir nirgendwohin gehen. Für River stelle ich eine Schale Haferbrei neben eines der Räder und hoffe, dass sie mir nicht den Arm abkaut. Ich höre, wie sie in ihrem Bau die Luft wittert.
Ein paar Leute wandern herum. Der Tag beginnt später, wenn man keine Arbeit hat und auch nicht in die Schule muss. Die meisten Leute sind wahrscheinlich drin, schnarchen oder sehen fern. Eddie sagt Guten Morgen. Er wartet auf uns, mit einem viel zu großen Rucksack, der ihm als Ranzen dient. Das Ding reicht ihm bis zu den Kniekehlen. Er und Izwi gehen beide in die sechste Klasse.
Stromleitungen erstrecken sich von den Masten um uns herum, als würde jemand von hoch oben nach unseren kleinen Häusern angeln. Wenn es windig ist, schwanken die Leitungen, und wenn sie sich berühren, sprühen Funken.
In gleichmäßigem Tempo gehen wir zum Kreisverkehr und betreten The Calders.
In den Bäumen vor uns bewegt sich etwas.
»Pscht«, sage ich zu den Kindern.
Die Birken tragen keine Blätter, aber trotzdem kann ich schwer erkennen, was sich zwischen den Ästen versteckt. Dann sehe ich, wie es sich an den schmalen Stamm eines der Bäume klammert. Sein graues Fell fällt vor der silbernen Rinde kaum auf. Ich greife in die hintere Hosentasche und ziehe meine Zwille heraus. Hab sie selbst gemacht, aus Hartriegel, habe einen netten, Y-förmigen Ast verwendet, so dick wie der Daumen eines erwachsenen Mannes. Das Holz ist fahl wie ausgebleichte Knochen, mit dünnen Wachstumsstreifen darauf. Ich habe sogar zwei dicke Gummibänder mit einer Schusskuhle aus Leder in der Mitte. Das Ding ist spitzenmäßig. Ein echter Hammer.
Ich ziehe einen Stein aus der Tasche und lade.
»Ihr solltet lieber wegschauen«, flüstere ich den Kindern zu. Tun sie natürlich nicht, weil das nun mal die Art ist, wie die Neugier die Katze jedes verdammte Mal tötet.
Ich beruhige mich, atme tief durch. Mein Arm ist leicht wie eine Feder. Ich spanne den Gummi, und zwar so weit, wie es möglich ist. Meine linke Hand hält sicher den unteren Teil des Y. Ich fühle mich, als wäre ich gar nicht hier. Ich denke nicht einmal nach, als ich den Stein fliegen lasse. Es ist, als hätte die Zwille den Moment selbst gewählt. Der Gummi sproingt.
»Ich werd verrückt, du hast es erwischt!«, schreit Eddie. Er rennt zu dem Gebüsch, in das es gefallen ist. »Superschuss.«
Ich halte den linken Arm immer noch ausgestreckt. Der Gummi hängt locker herunter. Meine rechte Hand ist geöffnet, als wäre ich Artemis, die gerade einen Pfeil freigegeben hat. Izwi ist still. Sie mag Töten nicht. Das Mädchen ist Veganerin. Und deswegen auch dürr wie ein Zweig. Sie wendet sich ab, als Eddie mit dem toten Eichhörnchen in der Hand zurückkommt.
»Bringst du mir das bei?«
»Nö«, antworte ich, als ich ihm das Tier abnehme.
»Biiiitte.«
»Wird nicht passieren. Willst du, dass mir deine Mom Stress macht, wenn du dir ein Auge ausschießt?«
Eddie schmollt, aber er wird es überleben. Ich untersuche meine Beute. Sauberer Schuss, genau am Kopf getroffen. Nur dort klebt ein wenig Blut. Das Fell ist in Ordnung. Gran wird den Pelz gerben wollen. Es ist ein graues Eichhörnchen, also habe ich vermutlich sogar dem Umweltschutz gedient. Habe die bedrohten roten Eichhörnchen beschützt und so. Ich stecke das Tier in meinen Rucksack.
»Du weißt, dass ich das tun muss«, sage ich zu Izwi und lege ihr eine Hand auf die Schulter.
Sie schüttelt die Berührung sanft ab. Ihre Weichherzigkeit macht ihr das Leben nicht gerade leichter. Ich habe Angst, dass die Welt sie zu Hackfleisch verarbeiten wird, wenn sie so weitermacht. Niemand kann sich harte, unbeugsame Prinzipien leisten. Die Welt wird einen entzweibrechen.
Die Leute in The Calders mögen uns nicht, sie mögen keinen, der aus dem Slum Seiner Majestät kommt, nennen uns SSM. Wir leben nur auf der anderen Seite der Umgehungsstraße, aber es könnten auch Meilen dazwischenliegen. Sie leben in, naja, in Sozialwohnungen, am falschen Ende der Stadt, in Junkieville … und trotzdem schauen sie auf uns herab. Mögen es auch nicht, wenn ihre Kinder mit uns spielen. Für mich geht das in Ordnung, aber Sighthill Primary ist immer noch die nächstgelegene Schule und wir müssen sie uns teilen. In dieser Gegend gibt es auch echte Wohnungen, die volle Nummer. Drei Hochhäuser dominieren die Skyline. Ich würde eine Niere und die Hälfte meiner Leber für eine Wohnung da geben. Aber es ist anders hier als bei uns. Niemand grüßt, als wir zum Schultor gehen.
»Sei brav. In Ordnung, Schwesterchen?«, sage ich, als Izwi und Eddie auf den überfüllten Schulhof treten.
Der Zaun, die Barriere, die die Schule von der Außenwelt abtrennen sollte, ist während der Zeit der großen Schrottverwertung gestohlen worden. Damals konnte man mit Altmetall noch gutes Geld verdienen. Ich habe einen oder zwei Duks mit Kupfer von den alten Bahnschienen verdient, aber niemals wäre mir eingefallen, eine Schule so auszuräumen. Man muss doch Prinzipien und Moral wahren. Ethische Standards. Grenzen, die man einfach nicht übertritt, weil man sonst ein Arsch ist.
Die Kiddies erzeugen mit ihren hohen Stimmen eine Menge Lärm. Ich beobachte, wie die beiden in die See aus Vorpubertären eintauchen, dann ziehe ich wieder los. Zumindest kann ich für heute schon zwei Punkte von meiner Liste streichen.
Die Brücke zwischen Sighthill und Plaza ist zusammengebrochen, und es sind nur Trümmer übriggeblieben. Hin und wieder gibt es zwar vage Ankündigungen, sie zu reparieren, aber das ist nur heiße Luft, gerade mal genug, um einen Ballon zum Fliegen zu bringen. Die Stützpfeiler liegen wie umgefallene griechische Säulen auf der Straße. Eine helle Wolke lungert im Schatten eines Asphaltstücks, das halb aufgerichtet daliegt. Sie beobachtet mich, bewegt sich wie Dampf aus einem Teekessel. Ganz schön verzweifelt für einen Tot, zu dieser Tageszeit unterwegs zu sein. Ich ignoriere das Gespenst und gehe weiter. Ich bin noch nicht im Dienst, und außerdem habe ich meine Mbira nicht dabei.
Ich bin unterwegs zur Apotheke, um zu schauen, ob ich die Pillen von Grans Verschreibung bekomme. Sie nimmt Entwässerungstabletten und Simvastatin für ihre Pumpe. Dann ist da noch Metformin wegen ihres Diabetes. Letzte Woche war ich da, und sie haben gesagt, ihnen wären die billigen Generika ausgegangen. Etwas anderes kann ich mir aber nicht leisten, also hoffe ich, dass sie heute was auf Lager haben.
»Roparistic!«, ruft eine Stimme hinter mir.
»Jomo?« Ich drehe mich um. Er bewegt sich in einer kleinen Gruppe von Jungs in schwarzen Stoffhosen, weißen Hemden und Jacketts. Das ist die Uniform der Sekundarstufe des Western Hailes Education Center. »Ist ne Weile her.«
»Gott schütze den König«, sagt er, weil ihm plötzlich auffällt, dass er nicht allein ist.
»Möge er lange regieren«, antworte ich.
»Ich hole euch später ein, Leute«, sagt Jomo und löst sich von der Gruppe.
»Jomo hat ne Freundin«, stichelt einer von ihnen. Kichernd wie Hyänen gehen die anderen Jungs auf das klotzige Gebäude zu, das ihre Schule ist. Früher bin ich auch mal dorthin gegangen. Naja, ich habe nur ein Jahr Sekundarstufe durchgezogen, das hat mir gereicht. Nein, Sir, solange man seine Pennys plussen und minussen kann, braucht man diesen Unsinn nicht im Schädel.
Jomo hatte einen Wachstumsschub, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Er wirkt ein bisschen größer. Der Eindruck wird noch durch seinen überlangen Afro verstärkt, den kein Kamm jemals durchdringen konnte. Er sieht immer noch wie ein Trottel aus, mit seiner Brille und der Akne auf der Stirn. Ich habe in der Grundschule zwei Jahrgangsstufen übersprungen, und er war mein bester Freund, bis ich dem System Sayonara gesagt und mich vom Acker gemacht habe. Alle in der Klasse sind älter als ich gewesen. Sie waren nett, aber mit ihm bin ich am besten klargekommen. Allerdings hab ich ihn jetzt eine Weile nicht gesehen.
Auf dem Weg zu mir stolpert er über seine Schnürsenkel, und ich fange ihn auf.
»Die solltest du vielleicht binden«, sage ich. »Wo hast du dich rumgetrieben?«
Wir begrüßen uns mit der Ghettofaust.
»Sorry, ich hätte dich anrufen und es dir erzählen sollen. Ist eine Menge passiert, und ich hatte keine Zeit, dich auf den neuesten Stand zu bringen. Ich hab nen Job in der Bibliothek meines Dads in der Stadt. Ist, naja, ist der coolste Ort der Welt. Bin dort von Unmengen Büchern umgeben. Ist zwar nur Teilzeit, aber trotzdem. Ich muss an den Wochenenden arbeiten und manchmal auch nach der Schule.«
»Aber du kennst doch dieses Ding in deiner Hosentasche, das deinen winzigen Schwanz tarnt, oder? Man nennt es Handy. Du kannst es hin und wieder auch benutzen, um was zu schreiben.«
»Tut mir leid.« Seine Stimme schwankt und bricht.
»Bin wirklich stolz auf dich, Jomo. Vielleicht kannst du mich irgendwann mal mitnehmen und rumführen.«
Er verzieht das Gesicht, schnappt nach Luft und lächelt schief.
»Tut mir leid, würd ich gern, aber da dürfen nur Mitglieder rein. Sie haben mich eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben lassen. Sorry.«
»Verscheißerst du mich grade? Es ist doch eine dämliche Bibliothek.« Er schüttelt den Kopf und starrt auf seine Füße. »Was auch immer, leck mich doch. Deine Stunde fängt gleich an – schreib mir einfach, und wir können uns mal treffen oder irgendwas.«
VI
Es ist eine mondlose Nacht. Die Welt um mich herum ist dunkel. Kleine Lichtstreifen entkommen durch die Vorhänge der Wohnungen in einiger Entfernung. Jeder, der zu dieser Stunde unterwegs ist, braucht wirklich dicke Cojones. Ich halte meine wöchentliche Sprechstunde neben dem Spielplatz am Hailey Quarry ab, gleich neben den Gruben. Für alle Fälle habe ich River mitgenommen. Ihr warmer Körper streift mein linkes Bein.
Ich hatte River als Welpen in einem Unterholz in der Nähe von Ratho gefunden. Sie war süß. Ich dachte, ich füttere sie fett und esse sie eines Tages, aber Izwi hat sich in sie verliebt, und dann haben wir eine Abstimmung gemacht. Gran hat gegen mich gestimmt, daher hat River überlebt. Manchmal glaube ich fast, River weiß, was passiert ist, weil sie manchmal ziemlich zickig ist. Doch überwiegend kommen wir gut miteinander klar. In manchen Nächten nehme ich sie mit, weil man ja nie weiß, wann man ein zweites Paar Beißerchen brauchen kann.
Früher war hier ein echter Steinbruch, lange vor meiner Geburt. Hat den Stein geliefert, aus dem Häuser und Treppen in Edinburgh und Umgebung erbaut wurden. Dann wurde eine riesige Müllkippe daraus, bis das Loch gefüllt war, und dann hat man Erde drüber geschoben und Bäume darauf gepflanzt. Vor ein paar Jahren haben Kumpel angefangen, hier nach Altmetall zu graben. Alle nennen den Bereich die Gruben, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, irgendwas wieder aufzufüllen. Überall gibt es Löcher, und hier liegen sicher auch ein oder zwei Leichen. Wenn es regnet, füllen sich die Löcher und sehen wie hübsche Teiche aus – wenn man weit genug entfernt steht.
Ich warte seit zehn Minuten, dann taucht mein erster Kunde auf, kommt von dem Weg am Kanal herüber.
Es ist ein Schwachleuchter, wie eine Bootslaterne im Nebel. Er nähert sich in ruckartigen Bewegungen. Mal wirkt er nah, im nächsten Augenblick wieder weiter entfernt. Erinnert an einen betrunkenen Twostep beim Ceilidh. River stellt die Ohren auf. Ihr Körper verspannt sich an meinem Bein, und dann winselt sie.
»Ruhig, Mädchen«, flüstere ich und streichele ihr rotes Fell.
Drei weitere Lichter erscheinen in der Ferne. Sie flackern und nähern sich langsam, doch der Erste kommt zuerst an. Es ist ein alter Mann, splitternackt bis auf ein schütteres Haarbüschel auf seinem Kopf. Er schwankt und wiegt sich wie eine Kerzenflamme im Wind.
Mehrfachkunden sind einfach wunderbar.
Dann tritt er direkt vor mich hin und sagt: »Booga-wooga-wooga.«
»Warte, Bob, bin gleich soweit«, antworte ich und greife nach meiner Mbira.
»Wooga-wooga.«
»Ich hab doch gesagt, gleich, Buddy.«
Meine Mbira ist ein kleines Daumenklavier mit 22 Tasten. Gehörte meinem biologischen Großvater, aber er hat es Gran hinterlassen, die sie an mich weitergegeben hat. Mir wurde erklärt, er hätte sie mit eigenen Händen angefertigt. Das war sein Ding, Instrumente bauen. Marimbas, Mbiras, Hoshos und Ngoma. Es ist ein Nischenhandwerk gewesen, aber er hat sie in die ganze Welt verschickt. Ich beginne in C-Moll, krieg es aber nicht so richtig hin, weil es kalt ist und die Lamellen weniger hergeben als im Sommer. Mit diesem Problem muss man eben leben; man muss wissen, welche Lieder es in welcher Jahreszeit wirklich bringen.
»Ihr da bleibt zurück. Haltet einen Diskretionsabstand ein«, sage ich zu den Lichtern in der Ferne. River bellt zu mir auf. Dann halte ich Bob den Vortrag: »Okay, ich kann eine Botschaft von dir an jeden innerhalb der Stadtgrenzen überbringen, auch wenn ich momentan nicht in die Innenstadt gehe …«
»Booga.«
»Ich deute das als ein Ja.«
Die Litanei ist sperrig, aber Regeln und Vorschriften et cetera. Totaler Dreck, aber was will man machen? Jetzt, wo die Belehrung erledigt ist, kann ich mich dranmachen, diesem Tot zu helfen. Mich mit ihnen abzugeben ist sooo langweilig. Ist nämlich immer derselbe Mist. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt. Wenn ich nur gewusst hätte … Buhuhu, wieso denkt niemand mehr an mich? Ich, ich, ich, ich. Und so weiter und so fort. Aber ich kriege keinen anderen Job, also hänge ich hier fest. Ich spiele eine sanfte Melodie, so beruhigend, wie wenn sich Gerstenfelder im Wind wiegen.
Bob schimmert, als sich seine Schwingungen mit der Musik verbinden. Es ist, als würden sich zwei Wellen treffen und bei der richtigen Frequenz überlagern, bis sie zu einer Einheit verschmelzen. Bobs Booga-wooga verwandelt sich in Sprache.
»Haben sie meine Nachricht bekommen?«, fragt er.
»Natürlich.«
»Und was haben sie gesagt? Verrat es mir, bitte.« Er ist nervös.
»Es ist ein bisschen schwierig, Kumpel. Sie sind nicht gerade begeistert von der Idee, dass du wieder einziehst.« Ich bemühe mich hier, diplomatisch zu sein.
»Sie sind doch meine Familie. Ich möchte bei ihnen sein. Ich kann sie für immer beschützen.«
»Ich verstehe das. Wirklich, Bob. Aber, stell dich mal den Tatsachen, da draußen gibt es nicht allzu viele Leute, die dauerhaft mit einem Geist zusammenleben wollen. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Ich bin mir sogar sicher, sie lieben dich. Tatsächlich wollten sie, dass ich dir das unbedingt sage.«
»Was meinst du damit, dass die Leute nicht mit einem Geist zusammenleben wollen? Das ist Diskriminierung, oder? Ist … das … nicht … richtig?« Er regt sich ein bisschen auf. Ich muss ihn beruhigen und die Situation deeskalieren. Temperamentsausbrüche von Geistern sind der häufigste Grund für interfamiliäre Heimsuchungen – in meinem Arbeitsfeld ein unerwünschtes Resultat.
»Betrachte es wie bei Kindern, die zum Studium weggehen. Danach beschaffen sie sich einen Job, ihre eigene Wohnung, vielleicht heiraten sie sogar, weißt du? Du möchtest einfach, dass sie wachsen, auf eigenen Beinen stehen, das Nest verlassen, sozusagen. Wenn sie wieder bei dir einziehen, ist das ein Versagen, mein Freund.«
»Sie wollen, dass ich ohne sie weiterziehe?«





























