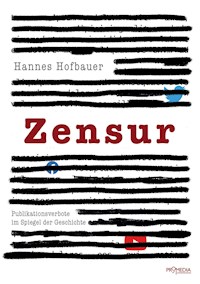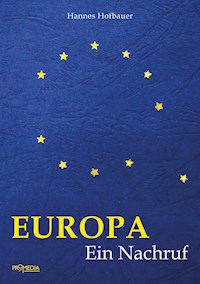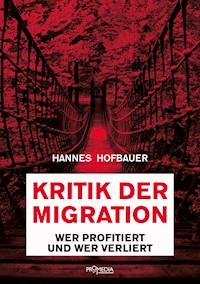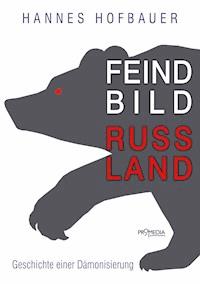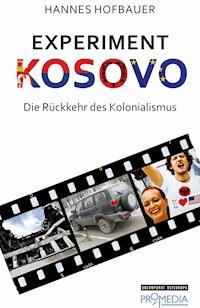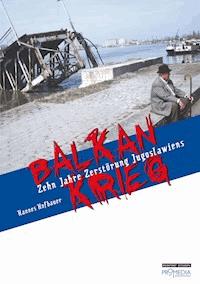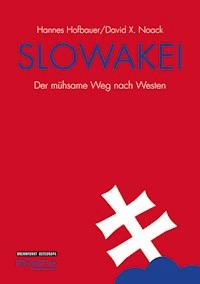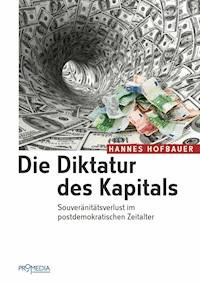
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Global agierende Kapitalgruppen, euphemistisch "Märkte" genannt, treiben Parlamente und Regierungen vor sich her. Die Wirtschaft steht längst nicht mehr im Dienste des Menschen. Hannes Hofbauer geht in seinem neuen Buch "Die Diktatur des Kapitals" einer Entwicklung nach, die die Logik der kapitalistischen Akkumulation als einzig zulässige akzeptiert, nach der sich Gesellschaft zu richten hat. Damit herrscht eine Diktatur des Kapitals, die von ihren Ideologen als "liberale Demokratie" oder als "konstitutioneller Liberalismus" definiert wird. Das Buch versucht einen Brückenschlag von einer ökonomischen Analyse einer vom Prinzip der Akkumulation und des Profits getriebenen Gesellschaft zu den tagtäglichen Auswirkungen dieser Entwicklung. Die Durchsetzung liberaler Reformen und der kollektive und individuelle Souveränitätsverlust hängen miteinander zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Ähnliche
Hannes Hofbauer Die Diktatur des Kapitals
© 2014 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., WienLektorat und Satz: Christian Frings
ISBN: 978-3-85371-825-4 (ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-376-1)
Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected]
Über den Autor
Hannes Hofbauer, Jahrgang 1955, hat Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien studiert. Er arbeitet als Publizist und Verleger. Im Promedia Verlag sind von ihm u. a. erschienen: „EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökonomische Triebkräfte – soziale Folgen“ (2007) und „Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung. Rechtsprechung als politisches Instrument“ (2011).
Inhalt
Vorwort
Global agierende Kapitalgruppen, euphemistisch »Märkte« genannt, treiben Parlamente und Regierungen vor sich her. Die Wirtschaft steht längst nicht mehr im Dienste der Menschen. Die Politik ordnet sich dem ökonomischen Primat unter. Spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 2008 ist es in immer mehr Ländern nicht mehr der Souverän, sondern die »Troika« aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission, die Regierungen einsetzt bzw. abberuft. Volksentscheide werden von ihr als unkalkulierbares Risiko betrachtet. Wer dennoch das Volk politisch mobilisieren will, gilt den herrschenden Medien – je nach Richtung und Gusto – als links- oder rechtspopulistisch, womit zugleich der lateinische Ausdruck für Volk diskreditiert wird. Politische Interventionen, die den zügellosen Wirtschaftsliberalismus bremsen könnten, finden kaum mehr statt. Halb leere Urnen an Wahlgängen sind die logische Folge, die ironischer Weise von denselben Kräften als »Politikmüdigkeit« beklagt wird, die den Kanon der Alternativlosigkeit zur herrschenden Logik der Kapitalverwertung anstimmen.
Die Grundlagen dieses als Kapitalismus benannten Gesellschaftssystems bestehen zwar seit langem, und man könnte versucht sein, den schon mit dem Titel des Buches ausgedrückten radikalen Befund als aufgeregt und übertrieben zu bezeichnen. Doch die Transformation von immer mehr gesellschaftlichen Bereichen in verwertbare Warenform sowie fortschreitende, scheinbar unbegrenzte Markterweiterungen sind in eine neue Qualität umgeschlagen. Der Kommodifizierungs- und Verwertungsdruck hat jeden Einzelnen und jede Einzelne erreicht, und das nicht nur als ProduzentIn und/oder KonsumentIn, sondern als ganze Person, die sich zunehmend als im Wettbewerb stehend verstehen muss.
Die Diktatur des Kapitals betrifft Gesellschaft und Individuum gleichermaßen. Die parlamentarische Demokratie, altehrwürdige Begleiterin unserer auf Eigentum beruhenden Gesellschaftsordnung, ist spätestens in den 1990er-Jahren zu einer »liberalen Demokratie« mutiert. Der darin bestimmende konstitutionelle Liberalismus definiert Gesellschaft nach Parametern der Profitfähigkeit. Die einzelnen Individuen werden in dieses enge Korsett privatisierter, verrechtlichter und alle Lebensbereiche kontrollierende Muster geschnürt. Multiple Souveränitätsverluste sind die Folge, sie betreffen das kollektive Gemeinsame genauso wie die Beziehung von Einzelnen zueinander.
Das Buch versucht einen Brückenschlag von der ökonomischen Analyse dieser vom Profit getriebenen Gesellschaft zu den tagtäglichen Auswirkungen der Entwicklung. Es zeigt auf, wie die Durchsetzung liberaler Reformen und der kollektive und individuelle Souveränitätsverlust miteinander zusammenhängen.
Nach dem Versuch einer Begriffsbestimmung wird der Text in drei Kapitel unterteilt. Diese beschäftigen sich – im Wesentlichen am Beispiel der Europäischen Union – mit der Ökonomie, der Politik und der Gesellschaft. »Der Durchmarsch neoliberaler Globalisierung« fokussiert auf die enormen Liberalisierungen im Anschluss an die welthistorische Zäsur der Jahre 1989/1991, die von Maastricht über den Fiskalpakt bis zu den weitum durchgesetzten Austeritätsmaßnahmen den europäischen Kontinent vollkommen verändert haben. Das Kapitel »Totalisierung der Macht« widmet sich der personellen Trägerschaft der Kapitaldiktatur. Der Bogen spannt sich dabei von elitären Think Tanks wie dem »Council on Foreign Relations« bis zur hegemonialen Stellung der »Goldmänner« auch in EU-Europa. Unter der Überschrift »Gesellschaftliche Konsequenzen totalitärer Verhältnisse« werden die Auswirkungen der postdemokratischen Entwicklungen auf das menschliche Zusammenleben beschrieben. Die Ersetzung fundamentaler gesellschaftlicher Grundlagen wie Vertrauen und Verantwortung durch Transparenz und Verrechtlichung führt zu neuen, asozialen Kulturtechniken. Der dritte Teil, der die gesellschaftlichen Auswirkungen untersucht, bewegt sich zwischen der analytischen Makro-Ebene und beschreibenden Mikro-Elementen. Die dabei auf den ersten Blick fehlende Systematik ist allerdings der tagtäglichen Lebenswirklichkeit geschuldet. In ihr findet sich der Mensch als Einzelner und als Mitglied unterschiedlicher Kollektive gleichermaßen wieder, die verschiedenen Betroffenheiten rechtfertigen den Perspektivenwechsel.
Mit einer Reihe von Beispielen habe ich versucht, den Text lesbar und lebendig zu machen. Exkurse zu Zypern, der Ukraine und dem Zusammenbruch der Hypo-Alpe-Adria-Bank zeichnen plastische und drastische Bilder eines postdemokratischen Zeitalters, das der Herrschaft des Kapitals ausgeliefert ist.
Wie jede geistige Kraftanstrengung ist auch diejenige, die zur Entstehung dieses Buches geführt hat, nur im Austausch mit vielen KollegInnen und FreundInnen möglich. Stellvertretend für alle, die sich mit mir zum Thema auseinandergesetzt haben, möchte ich mich an dieser Stelle bei Andrea Komlosy bedanken. Ihre kritischen Bemerkungen waren notwendig, um meinen Blick zu schärfen. Ein Dankeschön auch an den Lektor Christian Frings, der viel Mühe darauf verwendet hat, nicht nur den Text zu glätten, sondern auch Schwachstellen offenzulegen, die damit hoffentlich beseitigt werden konnten. Und dann möchte ich noch mein Privileg als Verleger des Promedia Verlages ansprechen, das mir über die Jahre erlaubt hat, wichtige Texte zum Thema beruflich durchzuarbeiten. Der eine oder andere Autor von Promedia wird sich zitiert in diesem Buch wiederfinden.
Hannes HofbauerWien, im Juli 2014
Demokratie oder Kapital? Versuch einer Begriffsklärung
Es geht um das Verhältnis von Demokratie und Ökonomie. In welcher Beziehung stehen die beiden Anfang des 21. Jahrhunderts zueinander? Eine Begriffsklärung vorweg tut Not.
Nimmt man die Bedeutung der griechischen Wortstämme dieser beiden Begriffe ernst, so reicht das Themenfeld von der Volksherrschaft (»demos« steht für Volk; »kratia« für Herrschaft) zum Haushalt als Wirtschaftsgemeinschaft (»oikos«). Zeitgemäßer könnte man darunter Politik und Wirtschaft verstehen. Im modernen Sprachgebrauch werden solche oder ähnliche Definitionen regelmäßig unterstellt, obwohl die Wirklichkeit sich weit davon entfernt hat.
Wer heute von Demokratie spricht, kann alles Mögliche im Sinn haben. Spontan und mehrheitlich würden wohl freie Wahlen damit assoziiert, die allgemein, gleich und geheim abgehalten werden, wobei sich nur wenige daran stoßen mögen, dass in einzelnen Ländern der Europäischen Union zwischen knapp 10% (Österreich und Deutschland) und 40% (Luxemburg) der anwesenden Bevölkerung aufgrund ihres Status als Migranten bzw. Nicht-Staatsbürger vom Wahlrecht auf nationaler Ebene ausgeschlossen bleiben. Diese auf die Staatsbürger beschränkte Exklusivität von Demokratie führt uns zurück zur Wortwurzel.
Das antike Griechenland kannte im Wesentlichen drei politische Herrschaftsformen: »monarchia«, »oligarchia« und »demokratia«. Dem griechischen »monos« entsprechend bedeutet Monarchie die Herrschaft des Einzelnen bzw. der einzelnen Familie. In der Europäischen Union kennen noch sieben Flächenstaaten diese Staatsverfassung: Vereinigtes Königreich, Spanien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Schweden und Dänemark. Der Terminus Oligarchie – von »hoi oligoi« für wenige – hat im aktuellen Diskurs, anders als die Monarchie, einen schlechten Beiklang und findet eher im wirtschaftlichen als im politischen Milieu Verwendung. Bleibt die Demokratie als vorherrschende Herrschaftsform, wobei ihr begrifflich definierter Antagonismus zur Monarchie fast nirgendwo rezipiert wird. Die Frage, wie viele TeilhaberInnen Demokratie umfassen solle, stellt z.B. der bekannte französische Philosoph Jacques Rancière1; der Terminus selbst gibt darüber keine Auskunft. Begonnen hat die »demokratia«, wie allgemein bekannt, im antiken Griechenland mit der attischen Epoche ca. 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Damals waren in der Region Attika mit der Hauptstadt Athen geschätzte 30 000 volljährige Männer (von 300 000 Einwohnern) mit demokratischen Rechten ausgestattet. Diese galten als Bürger, im Griechischen »polites« – die zur Stadt gehörenden – genannt. Abhängig nach Besitz (Großgrundbesitz, Händler) und Status (Beamte) übten sie ihre demokratischen Rechte aus, machten Politik – griechisch: »politea«, also das, was den Bürger und die Stadt betrifft. Alle Übrigen – Sklaven, Frauen, Minderjährige und Fremde – galten als Nicht-Bürger und durften an gesellschaftlichen Entscheidungsfindungen nicht teilnehmen.
Das antik-griechische Leitbild von »demokratia« wird im 4. Jahrhundert v.u.Z. von Aristoteles geprägt, der sich mit einem seiner Hauptwerke, »Politik«, von seinem Lehrer Platon emanzipiert, die »monarchia« als schlechteste aller möglichen Verfassungen ablehnt, ohne allerdings damit zu einem glühenden Demokraten zu werden. Für Aristoteles birgt Demokratie die Gefahr in sich, dass Gleichheit in bestimmten, genau zu definierenden Bereichen als allumfassende Gleichheit interpretiert wird.2 Folgerichtig nennt er die Demokratie die »verfehlte Form« von Politik. Eine auf dem Prinzip der allgemeinen Gleichheit aufbauende Volksherrschaft würde, so der Urvater der westlichen Philosophie, nicht das Wohl der Gemeinschaft, sondern das der Mehrheit, mithin der Armen, garantieren. Um dies zu verhindern, plädiert der einflussreiche Philosoph für eine aus demokratischen und oligarchischen Elementen zusammengesetzte Staatsform. 2 350 Jahre später scheint die Debatte über den Nutzen von Volksherrschaft im Angesicht ökonomischer Konzentrationsprozesse in den Händen weniger Superreicher nicht vom Fleck gekommen zu sein. Die Staatsform des 21. Jahrhunderts mischt – nach aristotelischem Vorbild – demokratische und oligarchische Herrschaftsprinzipien. Nur in jenen Fällen, in denen dies unter monarchischer Obhut passiert, hätte sich der Altvater der Philosophie dagegen ausgesprochen.
Moderne Auseinandersetzungen mit demokratischen Staatsformen schließen nahtlos an die Ideen des 322 v.u.Z. verstorbenen Philosophen an. So erkennt man beim französischen Staatstheoretiker und Publizisten Alexis de Tocqueville mühelos die aristotelische Brille, durch die er Mitte des 19. Jahrhunderts die Welt betrachtete.3 In seiner Auseinandersetzung mit der ersten republikanischen Verfassung weltweit, jener der Vereinigten Staaten, die auch als eine erste demokratische gelesen werden kann, warnt Tocqueville vor den darin enthaltenen Gefahren einer »Tyrannei der Mehrheit«, pocht auf den Vorrang von Freiheit gegenüber Gleichheit und baut im Übrigen wie die Gründungsväter der amerikanischen Unabhängigkeit darauf, diesen Gefahren mit politischen Dezentralisierungen und einer »Erziehung zum Bürgersinn« begegnen zu können. An anderer Stelle offenbart der bis in die Gegenwart reichlich rezipierte Franzose seine Distanz zu volksherrschaftlichen Staatsformen. Aus Vernunftgründen, so schreibt er 1853 in einem Kommentar in der New York Daily Tribune, könne er demokratischen Institutionen etwas abgewinnen, im Herzen jedoch bleibe er Aristokrat. Und weiter: »Ich verachte und fürchte die Massen. Ich liebe die Freiheit und die Gesetzestreue zutiefst, aber nicht die Demokratie.«4 Das Diktum von der gefürchteten »Tyrannei der Mehrheit« findet in den liberalen Ideen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wohligen Unterschlupf. Noch bei den Argumenten gegen die Einführung des allgemeinen Wahlrechts ist es stark in Gebrauch und wird durch den denunziatorisch verwendeten Begriff der »Gefälligkeitsdemokratie« ergänzt.5
Die Demokratie hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Staatsform erhoben, die als Hülle unumstritten ist, solange sie breiten Interpretationsspielraum lässt und nicht von Demokraten in die Pflicht genommen wird. »Nachdem man die Staaten als Demokratien definiert hat«, erklärt Jacques Rancière diesen nur vermeintlichen Widerspruch, »präsentiert man den Demokraten als Feind der Demokratie.«6 Als ein wichtiges Bespiel dieser handelnden Kraft nennt Rancière die Trilaterale Kommission, ein seit 1954 jährlich stattfindender informeller Treff der einflussreichsten Wirtschaftsmagnaten in der westlichen Welt, zu denen auch Politiker und Medienmenschen vornehmlich aus NATO-Staaten geladen werden. Der Soziologe Rudolf Stumberger spricht im selben Zusammenhang von einer »Tendenz der Re-Feudalisierung« und meint damit »inoffizielle Strukturen selbsternannter Eliten«, die sich zunehmend von demokratischen Mustern abschotten würden.7
Die Tocqueville’sche Verachtung gegenüber der Volksherrschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die herrschaftliche europäische und US-amerikanische Nachkriegsgeschichte. Sie beginnt beim Ökonomen Milton Friedman, dessen Kritik sich vordergründig an der »mangelnden Effizienz« demokratischer Strukturen aufhängt, weil er den WählerInnen nicht zutraut, die Notwendigkeit seiner monetaristischen ökonomischen Theorie zu verstehen – was freilich eine Unterstellung ist, weil es angesichts der leicht erkennbaren sozialen Folgen seiner Austeritätsvorstellungen nicht am Verstehen, sondern an der Akzeptanz mangelt. Und sie endet bei der Neudefinition von Demokratie als »liberale Demokratie«, wie sie von US-amerikanischen Think Tanks vor allem seit der Wende 1989/1991 in Osteuropa in Umlauf gebracht wird. Schon für den 2006 verstorbenen Friedman war Demokratie ohne freien Markt undenkbar, und der leitende Redakteur der US-amerikanischen Fachzeitschrift Foreign Affairs, Fareed Zakaria, definiert Demokratie generell als »liberale Demokratie« und warnt in Zusammenhang mit den neo-demokratischen Staaten in Osteuropa vor einem Aufkommen »illiberaler Demokratien«.8
Die aktuelle Positionsbestimmung zur Frage »Wo steht Demokratie heute?« hat der britische Soziologe Colin Crouch im Jahr 2003 um den Begriff der Postdemokratie9 bereichert, die er in den Zentrumsgesellschaften in Europa und den USA heraufdämmern sieht. Er versteht darunter eine weitgehend mediatisierte Form von Partizipation, in der reale politische Macht sukzessive an wirtschaftliche Lobbys übergeht.10 Die Crouch’sche Analyse, 2008 auch in deutscher Sprache erschienen, hat einen wahrhaften Schwall an Reaktionen von Philosophen und Soziologen ausgelöst, wobei die Debatte in Frankreich, Italien und Großbritannien heftiger als im deutschen Sprachraum geführt wird. Ein schmales Bändchen11, 2012 auf Deutsch erschienen, fasst die wichtigsten von ihnen zusammen. Darin erinnert der italienische Denker Giorgio Agamben12 an die von Jean-Jacques Rousseau vorgenommene Differenzierung von Souverän und Regierung, die dieser in seinem 1762 veröffentlichten Contrat sociale13 (Gesellschaftsvertrag) zum Thema Demokratie vorgelegt hatte und an der sich Generationen von Philosophen bis zu Michel Foucault14 abarbeiteten.
In der Differenzierung von Souverän und Regierung ist die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive angelegt, die für eine moderne bürgerlich-parlamentarische Demokratie konstitutiv ist. Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Wendy Brown und der französische Philosoph Alain Badiou finden es unlauter, Demokratie ohne Kapitalherrschaft erklären zu wollen. Sie folgen damit inhaltlich-konzeptionell der marxistischen Staatstheorie, die den Staat als Ausdruck der Klassenherrschaft versteht; der bürgerliche Staat wird darin von der Kapitalherrschaft geformt, seine Überwindung bedürfe nicht nur einer politischen Revolution, sondern einer Änderung der Produktions- und Eigentumsverhältnisse hin zu einer – dann – klassenlosen Gesellschaft. Strukturell folgen Brown und Badiou aber auch dem Gedanken neoliberaler Ökonomen wie Milton Friedman, verstehen ihre Analyse allerdings als Kritik und nicht als Zustimmung zum Ist-Zustand.
Brown betrachtet den Kapitalismus historisch wie aktuell als »zweieiigen Zwilling der Demokratie«.15 Badiou wiederum lehnt sich stark an Karl Marx an, wenn er ihn mit dem Gedanken zitiert, der bourgeoise Staat möge so demokratisch sein, wie er wolle, seines fehlenden Gleichheitsprinzips wegen müsse er zerstört werden.16 Auch Badiou identifiziert Demokratie mit Kapitalismus. Die »Wählerdemokratie« ist für ihn nur »insofern repräsentativ, als sie zuerst konsensuelle Repräsentation des Kapitalismus ist«.17 Sehr kritisch äußert sich die Literaturwissenschaftlerin Kristin Ross zum gängigen unreflektierten Gebrauch des Begriffs Demokratie, der für sie von seinem früheren emanzipatorischen Beiklang vollständig entkleidet wurde. »Demokratie ist zu einer Klassenideologie zur Rechtfertigung von Systemen geworden, die das Regieren einem kleinen Personenkreis überlassen«.18 Ross identifiziert die von Aristoteles begrüßte, gemischt demokratisch-oligarchische Staatsform als eine, die in neuem Gewand aufersteht, wenn sie »›alle fortschrittlichen industriellen Demokratien‹ von heute (als) oligarchische Demokratien sieht: Sie stehen für den Sieg einer dynamischen Oligarchie, einer Weltregierung, die um den Reichtum und dessen Huldigung zentriert ist, aber gleichzeitig Konsens und Legitimität durch Wahlen herzustellen vermag.«19 Volksherrschaft müsste anders aussehen.
Die landläufig als Gegenteil von Demokratie verstandene Herrschaftsform firmiert unter der vom Lateinischen sich herleitenden Bezeichnung Diktatur. Diktatur wird lexikalisch verstanden als »eine auf unbegrenzte oder unbestimmte Dauer angelegte, besonders als Gegensatz zur Demokratie begriffene Herrschaftsform«, die in »enger Verwandtschaft zum autoritären Staat (steht).«20 Es kann zwischen autoritärer, totalitärer und Übergangsdiktatur unterschieden werden, wobei die Differenzierungen letztlich fließend sind.
Diese ganz von der bürgerlichen Spielart der »liberalen Demokratie« überzeugte Definition ihres angeblichen Gegenpols, der Diktatur, leugnet indirekt den alt-griechischen Ursprung des Wortes Demokratie, die Volksherrschaft. Nicht die Monarchie oder die Oligarchie/Aristokratie werden in den meinungsbildenden Medien als Antipoden begriffen, sondern die Diktatur, wobei damit nur jene Systeme als negativ punziert werden, die in der bürgerlichen Gesellschaft als missliebig betrachtet werden. Das Fehlen von Demokratie alleine ergibt noch keine Zuordnung zur Diktatur.
Auf der Lexikon-Plattform Wikipedia wird diese Sichtweise beim Stichwort »Diktatur« deutlich, wenn darauf hingewiesen wird, dass – in historischer Perspektive – »nicht jede Staatsform ohne freie Wahlen als Diktatur (gilt)«. Und weiter: »In der Monarchie kann der Zugang zur Herrschaft durch Erbschaft oder Wahl geregelt sein. Wenn dieser Herrschaftsanspruch allgemein als legitim anerkannt ist, wird nicht von Diktatur gesprochen.«21 Wem die Feststellung der Legitimität obliegt, bleibt unbenannt.
Durch die ausschließliche Anerkennung von Demokratie als »liberale Demokratie« sowie die Weigerung, Monarchie als Gegenstück dazu zu definieren, haftet dem Gegenbegriff Diktatur etwas Ideologisches an. Wie die Demokratie auch, kann er für vielerlei missliebige Staatsformen zu diffamierendem Gebrauch verwendet werden. Nach dem Ende der kommunistischen Regime in Osteuropa wollte von der »Diktatur des Proletariats« niemand mehr etwas wissen. Der französische Gelehrte Alain Badiou dreht den Spieß um, indem er mehr als ein Gedankenspiel wagt. Für ihn ist »das Gegenteil der Demokratie – verstanden in dem Sinn, den ihr der Parlamentarismus des Kapitals während seines unendlich langsamen Untergangs gegeben hat – (…) nicht der Totalitarismus und auch nicht die Diktatur, sondern der Kommunismus.« Und das deshalb, weil er als größter Feind der liberalen Demokratie geortet wird, wozu Badiou Georg Wilhelm Friedrich Hegel in den Zeugenstand ruft, wenn er die Kraft des Kommunismus darin sieht, »den beschränkten, weil leeren Formalismus der Demokratie« in sich aufnehmen und überwinden zu können. Echte Demokraten, meint Badiou abschließend, müssten die Selbstherrschaft der Völker und damit die Überwindung des Staates proklamieren, mit einem Wort: »wieder Kommunisten werden.«22
Lassen wir die sehr unterschiedlichen Einschätzungen zum Begriff »Demokratie« und seinen möglichen Antipoden Monarchie, Oligarchie, Diktatur oder Kommunismus nochmals Revue passieren, so macht – wenig überraschend – die unterschiedliche politische und/oder historische Position des Betrachters die entscheidende Differenz aus. Die »Diktatur des Proletariats« als klassenkämpferische Aussage nimmt für sich in Anspruch, volksherrschaftliche Elemente in sich zu tragen. In dem Moment, in dem sie die Klassengesellschaft als überwunden betrachten, definieren ihre Propagandisten das Volk als Ganzes als an der Macht befindlich. Umgekehrt kann eine »liberale Demokratie«, wenn sie an ihr logisches Ende gedacht wird, den Anspruch der Volksherrschaft und jenen der Oligarchie als ökonomisch führende Klasse nicht als Widerspruch, sondern als komplementär sehen, solange ein weitgehender gesellschaftlicher Konsens darüber aufrechterhalten bleibt. Sie kommt mit vergleichsweise wenigen demokratischen Elementen aus, definiert Demokratie als parlamentarische Vertretung, die sich auf die Sphäre der Politik beschränkt, und klammert die Sphäre der Ökonomie aus.
Womit wir bei einer Sichtweise angekommen sind, die wirtschaftliche und soziale Verhältnisse berücksichtigen muss, um die Wirkungsweise von »Demokratie« einschätzen zu können. Eine von der ökonomischen Produktionsweise mit ihren sozialen oder regionalen Auswirkungen abstrahierende Begriffsdefinition vernebelt den Blick auf wesentliche Parameter menschlichen Zusammenlebens. Die ökonomische, genauer: die kapitalistische Rationalität spielt darin zumindest seit dem Ende des 15. Jahrhunderts eine wesentliche Triebkraft, die Immanuel Wallerstein in seinem Opus Magnum23 nachgezeichnet hat.
Begriffsdefinitionen von »Kapital« existieren in großer Zahl. Für unseren Bedarf ist es der Prozess der Akkumulation und der dabei zu erzielende Profit mit seinem Wachstums- und Verwertungszwang und der diesen innewohnenden Ausbeutungsstrukturen, der die Wirtschaftsform charakterisiert. Kapitalismus ist die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit24, also die aus regional oder sozial unterschiedlichen Produktionsverhältnissen Gewinne erzielende Produktionsweise. Der Markt als reiner Platz des Austausches von Waren und Dienstleistungen muss damit überhaupt nichts zu tun haben und hat es auch – historisch gesehen – nicht. Dies unabhängig davon, ob er über direkten Tausch oder vermittelt über ein Äquivalent, das Geld, funktioniert. Wie drückte dies der große Historiker Fernand Braudel in seinem Hauptwerk Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts aus? »Der kleine Laden, in dem ich meine Zeitung kaufe, hat nichts mit Kapitalismus zu tun, es sei denn, er gehört zu einer Kette.«25 Braudel setzt sich mit seiner historisch hergeleiteten Differenzierung von Marktwirtschaft und Kapitalismus explizit von marxistisch-leninistischen Vorstellungen ab. Lenins Sicht, wonach »auf dem Dorfmarkt« der Kapitalismus beginnen würde und »die Marktproduktion im kleinen (…) täglich, in jedem Augenblick, spontan den Kapitalismus und die Bourgeoisie« hervorbringt26, nennt Braudel einen »fundamentalen Irrtum«27. Eine letztgültige Antwort, ob es einen historisch nachzeichenbaren Weg vom Braudel’schen Marktplatz zum Lenin’schen Monopol gibt und vor allem ob dieser zwingend ist, muss an dieser Stelle unterbleiben.
Festzustellen ist allerdings, dass die Frage der Eigentumsordnung jener der politischen Konstitution bürgerlicher Verfassungen vorausgegangen ist. So befassten sich die im Anschluss an die Französische Revolution verabschiedeten bürgerlichen Gesetzbücher – z. B. das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 in Österreich oder das Allgemeine Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 zuerst mit individuellen bürgerlichen Freiheitsrechten und sicherten damit die Eigentumsordnung ab, bevor es überhaupt um politische Rechte ging. Die sukzessive Zurückdrängung monarchischer und oligarchischer Herrschaftsformen seit der Französischen Revolution von 1789 blieb bis zur Russischen Revolution von 1917 auf den politischen Bereich beschränkt.
Die Ökonomie bestimmte (und bestimmt auch heute) die Zusammensetzung der Parlamente. Die Ständeversammlungen im feudalen Europa, mit denen die Herrscher die Zustimmung des Adels für zentrale Steuereinhebung einholten, banden die Mitbestimmung an Eigentum und Stand. Im 19. Jahrhundert definierte die Steuerleistung den Zugang zur politischen Sphäre. Das sogenannte Kurien- und Zensuswahlrecht war direkt an Klasse sowie – durch die Abhängigkeit des Stimmgewichts von der Steuerleistung – an Eigentum gebunden. Nicht zuletzt um die Sprengung dieser Eigentumsklauseln ging es der Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Bewegung für ein allgemeines Wahlrecht.
Eine radikale Politisierung der ökonomischen Sphäre fand dann nach dem Ersten Weltkrieg im revolutionären Russland statt. Diese als Demokratisierung zu bezeichnen, fällt indes schwer, weil die Sowjetunion über die Jahrzehnte ihres Bestehens ein politisches System mit Parteikadern ausgebildet hat, die zunehmend oligarchisch agierten. Die Nomenklatura, die wir in unserem Zusammenhang auch als Parteioligarchie bezeichnen können, bemächtigte sich – bis zum Zusammenbruch 1991 – zwar nicht des (Volks)Eigentums im Sinne privater Aneignung, richtete sich jedoch in einem System der »Herrschaft der Wenigen« mit entsprechenden Nutzungsrechten ein. Die Vorschaltung der kommunistischen Partei vor das Parlament trug zur Entsowjetisierung bei.
Parallel dazu gelang es der bürgerlich-parlamentarischen Welt im Westen Europas (und in den USA), jede Demokratisierung der ökonomischen Sphäre zu verhindern und die Eigentumsverhältnisse als einen außerhalb demokratischer Willensbildung bestehenden – angeblich unveränderbaren – Zustand festzuschreiben. Die Beibehaltung des Privateigentums kennzeichnet dieses System bis heute. Bestrebungen insbesondere in den 1970er-Jahren, die über wirtschaftspolitische Eingriffe auf gerechtere Verteilung setzten, ohne freilich die Rationalität der Kapitalverwertung als solche in Frage zu stellen, sind seit den 1990er-Jahren wieder rückläufig.
In der Folge wollen wir uns am Beispiel der Europäischen Union ansehen, wie es zur historischen Kräfteverschiebung von Politik zu Kapital kam. Das politische Primat, das freilich per se nicht demokratisch legitimiert sein muss, umgekehrt aber die Voraussetzung für Volksherrschaft darstellt, ist in einem länger andauernden Prozess systematisch zurückgedrängt worden. An seine Stelle trat das pure Kapitalinteresse, unter dem heute weite Teile der Welt leiden.
1. Jacques Rancière, Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die intellektuelle Emanzipation. Wien 2007
2. Aristoteles, Politik, V 1, 1301a25-36, zit. in: https://de.wikipedia.org/wiki/Aristoteles (20.5.2013).
3. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Paris 1835/1840.
4. New York Daily Tribune vom 25. Juni 1853.
5. Siehe: Frank Deppe, Autoritärer Kapitalismus. Demokratie auf dem Prüfstand. Hamburg 2013, S. 82.
6. Demokratien gegen die Demokratie. Jacques Ranière im Gespräch mit Eric Hazan. In: Giorgio Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 91.
7. Vgl. http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1195261/ (9.6.2013).
8. Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy. In: Foreign Affairs Nov/Dec 1997.
9. Colin Crouch, Postdemokratie. Frankfurt/Main 2008.
10. Ebd., S. 11
11. Giorgio Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012.
12. Giorgio Agamben, Einleitende Bemerkung zum Begriff der Demokratie. Ebd. S. 10/11.
13. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social. Paris 2001 (Amsterdam 1762).
14. Michel Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I. Berlin 2006.
15. Wendy Brown, Wir sind jetzt alle Demokraten … In: Giorgio Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 55.
16. Alain Badiou, Wofür steht der Name Sarkozy? Zürich/Berlin 2008, S. 106.
17. Ebd., S. 97, zit. in: Daniel Bensaid, Der permanente Skandal. In: Giorgio Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 30.
18. Kristin Ross, Demokratie zu verkaufen. In: Giorgio Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 113.
19. Ebd., S. 114.
20. Brockhaus-Enzyklopädie in 24 Bänden, Mannheim 1988, Bd. 5, S. 504.
21. http://de.wikipedia.org/wiki/Diktatur (8.6.2013).
22. Alain Badiou, Das demokratische Wahrzeichen. In: Giorgio Agamben u.a., Demokratie? Eine Debatte. Berlin 2012, S. 22.
23. Immanuel Wallerstein, Das moderne Weltsystem, 4 Bd.: Das moderne Weltsystem I. Die Anfänge kapitalistischer Landwirtschaft und die europäische Weltökonomie im 16. Jahrhundert. Wien 2004 (1986); Das moderne Weltsystem II – Der Merkantilismus. Europa zwischen 1600 und 1750. Wien 1998; Die große Expansion. Das moderne Weltsystem III. Die Konsolidierung der Weltwirtschaft im langen 18. Jahrhundert. Wien 2004; Der Siegeszug des Liberalismus (1789-1914). Das moderne Weltsystem IV. Wien 2012.
24. Der Begriff »Ungleichzeitigkeit« ist dem philosophischen Denkgebäude von Ernst Bloch entnommen. Siehe: Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit. Frankfurt/Main 1985.
25. Fernand Braudel, Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Bd. 3, Aufbruch zur Weltwirtschaft. München 1986, S. 705.
26. W. I. Lenin, Gesammelte Werke, Bd. XXXI, S. 7f., zit. in: Fernand Braudel, Sozialgeschichte, S. 707.
27. Braudel, S. 707.
Der Durchmarsch neoliberaler Globalisierung
Der Verlust des politischen Primats über ökonomische Prozesse zieht nicht erst seit der 2008 offen zutage getretenen Weltwirtschaftskrise eine Spur der sozialen Verwüstungen und des regionalen Auseinanderbrechens durch Europa. Schmerzlich musste die Bevölkerung im Osten des Kontinents bereits in den Jahren der Wende nach 1989/91 erfahren, welche gesellschaftlichen Auswirkungen eine forciert durchgesetzte kapitalistische Rationalität mit sich bringt und wie ohnmächtig demokratisch gewählte Strukturen der Kapitalmacht gegenüberstehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!