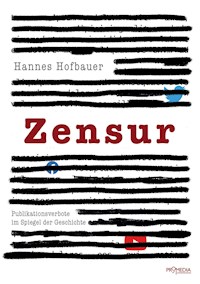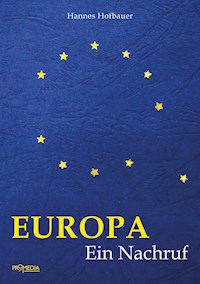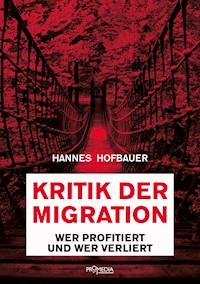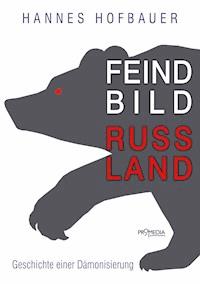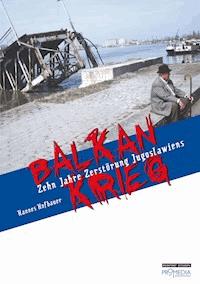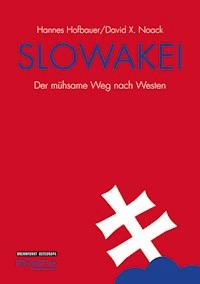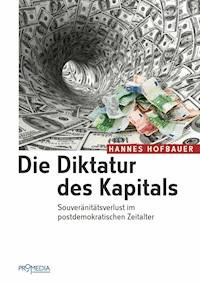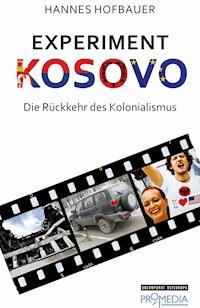
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Kosovo startet als "gescheiterter Staat" in eine neue Epoche. Die Kernelemente seiner Wirtschaft funktionieren nicht, sozialer Aufstieg spielt sich zwischen Schwarzmarkt und Massenemigration ab und seine politische Elite folgt äußerem Druck. Dies in Rechnung stellend war von Seiten Washingtons und Brüssels niemals an eine echte Selbstbestimmung gedacht. Der von der UNO verworfene und gleichwohl von den USA und der EU in Kraft gesetzte Ahtisaari-Plan schreibt eine überwachte Unabhängigkeit vor, die sowohl Legislative als auch Exekutive in fremde Hände legt. Militärisch herrscht die von den USA geführte KFOR-Truppe, zivil wird das Land mittels allerlei Kürzeln von der Europäischen Union verwaltet. Der Übergang vom UN-Protektorat zur EU-Kolonie passiert schleichend. Eine "Koalition der Willigen" abseits der UNO bestimmt über das Schicksal des kleinen, knapp zwei Millionen EinwohnerInnen zählenden Landes. Von der Rechtsprechung über politische Verwaltung bis zur polizeilichen und militärischen Exekutive öffnet sich ein weites Experimentierfeld für hauptsächlich westeuropäische und nordamerikanische Institutionen. Gesellschaftliche Abläufe jenseits bürgerlicher Gewaltenteilung und demokratischer Selbstbestimmung können nach erfolgreichen Probeläufen im Kosovo später anderswo, nötigenfalls auch in Kerneuropa, Platz greifen. Zum besseren Verständnis der aktuellen Situation zeichnet Hannes Hofbauer die Geschichte des Kosovo von der 500 Jahre dauernden osmanischen Fremdherrschaft über die verschiedenen Befreiungsansätze bis zur serbisch-nationalen Epoche im 20. Jahrhundert nach. Der Eingliederung des Kosovo in das titoistische Jugoslawien sowie dessen katastrophales, von Bürgerkriegen gezeichnetes Ende wird im Buch ebenso behandelt wie die hinter der kosovarischen Unabhängigkeitsbestrebung stehende "albanische Frage".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Ähnliche
Hannes HofbauerExperiment Kosovo
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
© 2008 Promedia Druck- und Verlagsges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Stefan Kraft
Lektorat: Erhard Waldner
ISBN 978-85371-285-6
eISBN 978-3-85371-845-2
Fordern Sie einen Gesamtprospekt des Verlages an bei:
Promedia Verlag, Wickenburggasse 5/12
A-1080 Wien, Fax: 0043/1/405 715 922
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.mediashop.at
Der Autor
Hannes Hofbauer, Jahrgang 1955, studierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Er arbeitet als Journalist und Publizist. Seit 1989 bereist er die Länder Osteuropas. Zuletzt erschien von ihm im Promedia Verlag der Titel „EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökonomische Triebkräfte – soziale Folgen“. Sein Buch „Balkankrieg. Zehn Jahre Zerstörung Jugoslawiens“ erlebte mehrere Auflagen.
Vorwort
Am 17. Februar 2008 hat das Parlament in Priština die Unabhängigkeit des Kosovo ausgerufen. Der 47. Staat in Europa spaltete damit nicht nur Serbien, sondern auch die internationale Gemeinschaft. Die Gegner der Sezession berufen sich auf das Völkerrecht, auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki und auf die UN-Resolution 1244 aus dem Jahr 1999, die die territoriale Integrität Jugoslawiens garantiert. Die Befürworter der Unabhängigkeit argumentieren mit dem nationalen Selbstbestimmungsrecht, mit von Serbien verletzten Menschenrechten der kosovo-albanischen Mehrheitsbevölkerung vor dem NATO-Angriff des Jahres 1999 und mit dem Recht des Stärkeren danach.
Als Präzedenzfall einer einseitig deklarierten Grenzverschiebung setzte die Entwicklung im Kosovo einen völkerrechtlichen und politischen Schlussstrich unter die europäische Nachkriegsentwicklung, die auf der Unverletzlichkeit staatlicher Souveränität basierte. Die unmittelbar erfolgte Anerkennung der einseitig ausgerufenen Unabhängigkeit des Landes durch die wichtigsten westlichen Staaten sowie die Verweigerung desselben Schrittes durch Russland, China und die Mehrzahl der Staaten dieser Welt führte zum Phänomen einer doppelten Wahrnehmung staatlicher Existenz. Der Bruch des Völkerrechts in Hinblick auf territoriale Souveränität bildete zudem den Auftakt für staatliche Neuordnungen an der postsowjetischen Peripherie. Moskaus Politik im Kaukasus folgte einer von der NATO angestoßenen imperialen Logik, die auf militärischer Macht beruht und doppelte Standards nicht scheut.
Kosovo startet als „gescheiterter Staat“ in eine neue Epoche. Die Kernelemente seiner Wirtschaft funktionieren nicht, sozialer Aufstieg findet zwischen Schwarzmarkt und Massenemigration statt und seine politische Elite steht unter äußerem Druck. Dies in Rechnung stellend, war von Seiten Washingtons und Brüssels niemals an eine echte Selbstbestimmung gedacht. Der von der UNO verworfene und gleichwohl von den USA und der EU in Kraft gesetzte Ahtisaari-Plan schreibt eine „überwachte Unabhängigkeit“ vor, die sowohl Legislative als auch Exekutive in fremde Hände legt. Militärisch herrscht die von den USA geführte KFOR-Truppe, zivil wird das Land mittels allerlei Kürzeln unter der Schirmherrschaft der UNO von der Europäischen Union verwaltet.
Der Übergang vom UN-Protektorat zur EU-Kolonie passiert schleichend. Eine „Koalition der Willigen“ abseits der UNO bestimmt über das Schicksal des kleinen, knapp zwei Millionen EinwohnerInnen zählenden Landes. Von der Rechtsprechung über die politische Verwaltung bis zur polizeilichen und militärischen Exekutive öffnet sich ein weites Experimentierfeld für hauptsächlich westeuropäische und nordamerikanische Institutionen. Gesellschaftliche Abläufe jenseits bürgerlicher Gewaltenteilung und demokratischer Selbstbestimmung können nach erfolgreichen Probeläufen im Kosovo später anderswo Platz greifen.
Zum besseren Verständnis der aktuellen Situation wird im ersten Teil des Buches die Geschichte des Landes von der 500 Jahre dauernden osmanischen Fremdherrschaft über die verschiedenen Befreiungsansätze bis zur serbisch-nationalen Epoche im 20. Jahrhundert nachgezeichnet. Die Eingliederung des Kosovo in das titoistische Jugoslawien sowie dessen katastrophales, von Bürgerkriegen gezeichnetes Ende werden ebenso behandelt wie die hinter der kosovarischen Unabhängigkeitsbestrebung stehende „albanische Frage“.
Die spezifische Geschichte des Balkans ist es auch, die mich veranlasst hat, die Entwicklung Kosovas als eine „Rückkehr zum Kolonialismus“ zu bezeichnen. Damit ist freilich nicht die von den westeuropäischen Großmächten betriebene asiatische und afrikanische Kolonialpolitik des 18. und 19. Jahrhunderts gemeint, sondern die Fremdherrschaft in ihren unterschiedlichen Arten, wie sie für die Balkanhalbinsel bis zum Ersten Weltkrieg prägend waren. Erinnert sei hierbei an die nach dem Rückzug der Osmanen erfolgende Neuordnung des Raumes, die politisch von außen betrieben wurde, um den Interessen der damaligen Großmächte zum Durchbruch zu verhelfen. Die neuerliche Verzahnung von militärischer Präsenz, politischer Oberherrschaft und wirtschaftlicher Macht in den Händen auswärtiger Institutionen schließt in diesem Sinn an koloniale Traditionen an.
Zuletzt sei noch ein kurzer Verweis auf die Schreibweise von Ortsnamen erlaubt. Ich habe versucht, historisch jeweils möglichst passend serbische und albanische Bezeichnungen parallel zu gebrauchen. Dies beginnt bereits beim Namen des Landes selbst, das auf Serbisch Kosovo und auf Albanisch Kosovë bzw. Kosova genannt wird. Die Form der Verwendung enthält eine historische und politische Sichtweise, die unumgänglich, aber auch beabsichtigt ist.
All jenen, die mir dabei geholfen haben, mich auf dem glatten Parkett unterschiedlicher nationaler Geschichtsschreibung und Gegenwartsdarstellung aufrecht zu halten, sei gedankt. Nötig waren mir diese vielen FreundInnen und KollegInnen sowohl bei der Literatursuche an meinen Schreibtischen in Wien und Gmünd als auch anlässlich zahlreicher Recherchen vor Ort in Prishtinë, Beograd und Tiranë. Ihnen gilt meine Dankbarkeit.
Hannes Hofbauer
Wien, am 1. September 2008
Kapitel 1:Von der Wiege des Serbentums zur albanischen Wiedergeburt (1389-1989)
Kosovo Polje. Zu Deutsch: Amselfeld. Der geographische Begriff umschreibt eine etwa 60 Kilometer lange Ebene rund um Priština/Prishtinë, die einem ganzen Landstrich seinen Namen gab und seit 2008 einen eigenen Staat bezeichnet, den auch die Albaner Kosova nennen.
Historisch steht das Amselfeld für ein Ereignis, das über 600 Jahre zurückliegt. Der Vormarsch der Osmanen nach Europa erzielte hier im Sommer 1389 einen seiner militärischen Durchbrüche. Der schleichende, Jahrhunderte dauernde Zerfall des byzantinischen Reiches, der durch die römisch-katholischen Kreuzzüge gegen Konstantinopel wesentlich beschleunigt worden war, ließ in Kleinasien eine neue Macht entstehen. Auch der Mongolensturm in der Mitte des 13. Jahrhunderts konnte die türkische Besiedelung Kleinasiens und die Festsetzung ihrer Eliten, die in der deutschsprachigen Literatur oft als „Hordenführer“ bezeichnet werden, nicht aufhalten, mutmaßlich jedoch ihre Zusammensetzung verändern. Zirka um 1300 errichtete einer dieser selbständigen türkisch-anatolischen Militärs ein kleines Fürstentum, das zum Kern der wohl am längsten (bis 1922) herrschenden Dynastie in Europa werden sollte. Sein Name: Osman. Wie sein Vater Ertogrul verstand er sich als Glaubenskrieger („Gazi“) gegen die christliche Herrschaft in Byzanz. Er sollte in den folgenden Jahren die türkisch-islamischen Kräfte in Kleinasien konsolidieren und in der Folge das Land osmanisch machen. Osmans Sohn Orhan setzte mit seinen Kriegern erstmals 1352 über die Dardanellen auf das europäische Festland über. Weitere 50 Jahre später war das Osmanische Reich zu einer bestimmenden politischen Größe auf dem Kontinent geworden. Erst viele Generationen später, im Jahr 1529, stieß die Ausdehnung der auf tributärer Ökonomie und halbsouveräner politischer Suzeränität der lokalen Fürsten beruhenden osmanischen Verwaltung an ihre Grenze. Vor Wien musste einer der Nachfahren Osman Ghazis, Sultan Suleiman („der Prächtige“), die Zelte abbrechen und erkennen, dass der lange Steuerarm der Hohen Pforte über Ungarn nicht hinausreichte. Zu diesem Zeitpunkt war Kosovo bereits seit 130 Jahren dem Sultan abgabenpflichtig.
Osmanischer Drang nach Westen
Die Schlacht auf dem Amselfeld, die am 15. Juni 1389 – laut moderner gregorianischer Kalenderzählung der 28. Juni – ihren Höhepunkt fand, war militärisch gesehen nur einer von vielen Kriegsgängen, durch die osmanische Herrschaft in christlichen Gebieten Platz griff. Den Türken wurde sie zum Schock, weil an diesem Tag Sultan Murad I. einem Mordanschlag durch ein serbisches Kommando unter der Führung von Miloš Obilić zum Opfer fiel. Die christliche Allianz, die hauptsächlich aus serbischen, aber auch aus bosnischen und albanischen Heeren bestand und von den osmanischen Chronisten als weit überlegen beschrieben wurde1, musste dennoch ihre vollständige Niederlage und die Gefangennahme sowie Hinrichtung des serbischen Herrschers, Fürst Lazar Hrebeljanović, hinnehmen.
1389 war übrigens nicht das erste Mal, dass der mittelalterliche serbische Staat von den Osmanen besiegt wurde. Bereits 20 Jahre zuvor fanden die Heerführer Vukašin und Uglješa am Flüsschen Marica bei einem osmanischen Überfall den Tod. Die serbische Oberhoheit über weite Teile des Balkans war schon damals im Zerfallen begriffen und Lazars Niederlage auf dem Amselfeld nur der Schlusspunkt eines politischen und wirtschaftlichen Erosionsprozesses.
Längst vorüber waren die Zeiten der von der serbischen Geschichtsschreibung glorifizierten Nemanjiden-Dynastie, die Ende des 12. Jahrhunderts mit der Familie der Nemanjiden eine mittelalterliche Staatlichkeit aufgebaut hatte, welche auch den Kosovo umfasste. Großfürst („Župan“) Stefan Nemanja und sein Sohn Raško, der unter dem Mönchsnamen Sava auf dem Berg Athos das Kloster Hilander erbauen ließ und 1219 die serbisch-orthodoxe Autokephalie begründete, wurden zu Heiligen der serbischen Orthodoxie. Die kirchliche Unabhängigkeit vom griechisch-orthodoxen Patriarchen in Konstantiopel definiert in den Ostkirchen bis heute zugleich nationale Identität. Staat, Nation und Religion gehen dabei Hand in Hand. Die liturgische Selbstbestimmung erlaubte und förderte, anders als im universalistisch-weströmischen Kontext, die Verwendung der serbischen bzw. kirchenslawischen Sprache anstelle des Griechischen. Und während die Gläubigen im Einflussbereich Roms noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg in lateinischer Sprache beteten, waren die oströmischen autokephalen Nationalkirchen immer auch Horte slawischer Sprache und Literatur. Anders als im lateinischen Weltkreis waren die Wortverkünder Gottes in der Orthodoxie auch in der Liturgie für die Gläubigen verständlich. Ihr Ende des 9. Jahrhunderts durch die Wandermönche Kyrill und Method kodifizierter „altbulgarischer“ Dialekt wurde in den einzelnen Nationalkirchen dem jeweiligen regionalen Sprachduktus angepasst. Der einfache serbische Bauer, so steht zu vermuten, konnte – anders als sein germanisches Pendant – die Handlungen der Priester verstehen, was eine enge Verbindung zwischen Volk und Klerus im „griechischen“ Europa erklärt.
Zwei Jahre vor der Selbständigkeit der serbischen Kirche hatte sich Stefan Nemanjas Nachfolger, sein Sohn Stefan Nemanjić, noch vom römischen Papst zum Serbenkönig krönen lassen. Auf dem Höhepunkt der Nemanjiden-Macht nahm dann 125 Jahre später Stefan Dušan 1346 den Zarentitel an. Es ist diese Zeit zwischen Stefan Nemanja und Stefan Dušan, in der Kosovo zu dem wurde, was Jahrhunderte später als „Wiege des Serbentums“ bezeichnet werden sollte. In der serbisch-orthodoxen Aufbruchstimmung der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts baute man Hunderte Kirchen und Klöster, die in enger Verbindung mit dem geistigen Zentrum Hilander auf dem Berg Athos standen. Unter ihren Dächern fanden sich die modernsten Fresken, in ihren Bibliotheken studierten und kopierten die Mönche byzantinische und andere Schriften. Es war die Blütezeit serbisch-mittelalterlicher Kultur. Auch wirtschaftlich stellte die Kirche eine Macht dar. So muss man sich z.B. das 1330 gegründete Kloster Dečani als einen riesigen Landsitz vorstellen, der sich über 2.500 Quadratkilometer erstreckte und an die 40 Dörfer samt ihrer Bevölkerung umfasste, die auf 26.000 Menschen geschätzt wird.2 So sicher die Herrschaft serbisch-orthodox war und betete, so unsicher sind die Quellen über die ethnische Zusammensetzung der ländlichen untertänigen Bevölkerung. Eines kann allerdings ohne Zweifel festgestellt werden: Das über die Schrift der politischen und religiösen Eliten vermittelte Serbentum betraf das einfache Volk nur am Rande. Schreib- und Lesekundigkeit waren schließlich nicht gerade weit verbreitete Erscheinungen und so kann man getrost das ethnisch-nationale Bewusstsein – anders als das religiöse – im 14. Jahrhundert als nur spärlich vorhanden beschreiben. Neben Serben lebten auf dem Gebiet des Kosovo Albaner und Vlachen, also romanisierte Bewohner des Balkanraumes, deren Bezeichnung auf den römischen Begriff „vallum“ zurückgeht – mit einem Wort: Grenzlandbewohner.
Alte Quellen nennen dann noch von den serbischen Königen ins Land geholte ragusische und sächsische Fachleute, die hauptsächlich im Bergbau in den Minen von Trepča gebraucht wurden, um dort Gold und Silber abzubauen. Als Kapitalgeber fungierten oft reiche Kaufleute aus Ragusa, dem späteren Dubrovnik, bzw. aus der heute in der Slowakei liegenden Landschaft Zips.3 Ein Schriftstück von König Uroš II. Milutin aus dem Jahr 1318 bestätigt die wirtschaftlichen Privilegien der „Sasbi Trebbčkii“, der sächsischen Bergarbeiter aus Trepča.4 Die Existenz einer katholischen Kirche sowie deutscher Ortsnamen wurde noch ein Jahrhundert später, als das Land längst unter osmanischer Herrschaft stand, im Reisebericht des Franzosen Bertrandon de la Broquiere erwähnt.5
Über die Ethnogenese der unterschiedlichen Volksgruppen, die damals wie heute das Land besiedeln, lässt sich vortrefflich streiten. Angesichts oft fehlender schriftlicher oder archäologischer Quellen sind der Mythenbildung dabei Tür und Tor geöffnet. Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass eine durch die nationale Brille gesehene Ethnisierung der Forschung über die Zusammensetzung von Bevölkerung (nicht nur) auf dem Balkan erst im Zeitalter der Romantik ihre höchste Blüte erfuhr. Die im 19. Jahrhundert gewonnenen, oft wenig fundierten Erkenntnisse bestimmen noch heute die unterschiedlichen nationalen Vorstellungen. Und diese korrelieren in auffälliger Weise mit den im Zeitenlauf sich ändernden politischen Gegebenheiten. Im heutigen Zeitalter nachholender ethnischer Legitimierungen, das auf dem Balkan seit Anfang der 1990er Jahre viel Blut hat fließen lassen, verbinden sich alte Mythen mit moderner Geschichtsschreibung. Auf albanischer Seite wird Kosova als die Heimstatt des vorrömischen Dardanien konstruiert, in dem ab dem 8. Jahrhundert vor Christus illyrische – und fallweise thrakische – Stämme, allesamt indo-europäisch, das Land besiedelten. Daraus speisen sich ethnische Argumente exklusiver oder zumindest bevorzugter albanischer Daseinsberechtigung in Kosova. Erstmals tauchte die These vom illyrischen Hintergrund der Albaner übrigens bei dem deutschen Historiker Johann Thunmann in seinem Buch „Über die Geschichte und Sprache der Albaner und Wlachen“ auf, das 1774 erschien.6 Die Bezeichnung „Albaner“ soll Dardan Gashi zufolge dem illyrischen Stamm „Albanoi“ folgen.7 Anders interpretiert der Historiker Michael Weithmann die Herkunft des Namens: „Albani“ sei seiner Meinung nach erst im 11. Jahrhundert als Fremdbezeichnung aufgetaucht, während sich die Albaner selbst „Skipetaren“ genannt hätten.8
Die serbische Seite ruft weniger die historisch unumstrittene slawische Einwanderung nach Europa, die ab dem 6. Jahrhundert in mehreren Wellen stattfand, in ihre kollektive Erinnerung, sondern operiert mit dem Nemanjiden-Staat und dem hl. Sava als Vätern alles Serbischen. Die Frage, wer zu welchem Zeitpunkt welche Gegenden mehrheitlich besiedelte, wurde ebenfalls erst im 19. Jahrhundert zum Streitfall. Für die Zeit davor sind ethnographische Karten kaum vorhanden, und wenn es solche gibt, dann weisen sie nicht nur die Ethnie, sondern in erster Linie die Religion aus. Darin wird deutlich, dass nach der türkischen Eroberung die Islamisierung vor allem Albaner, aber ebenso Serben – wenn auch in geringerem Ausmaß – betraf.9 Allein durch diese Tatsache ist ein nationaler Charakter als völkische Identität vor dem 19. Jahrhundert wenig glaubhaft. Wen trotzdem ethnisch-nationale Herkünfte interessieren, der sei darauf verwiesen, dass eine albanische Mehrheit im Kosovo erst Ende des 19. Jahrhunderts gegeben war. Erstmals weist eine Statistik für das Jahr 189910 eine knappe albanische Mehrheit an der Gesamtbevölkerung (47,9%) vor der serbischen (43,7%) aus, während 187111 noch 63,6% SerbInnen im Kosovo lebten (gegenüber 32,2% AlbanerInnen).
Den osmanischen Vormarsch begreifen Albaner wie Serben übrigens gleichermaßen als Anfang einer Fremdherrschaft, legen jedoch sehr unterschiedliches Gewicht auf diese These. Die Differenz liegt weniger in der Beurteilung der Eroberung vor 600 Jahren als in der Art und Weise der nachfolgenden Kooperation mit Sultan und Hoher Pforte.
Der Mythos vom Amselfeld
Im Juni 1389 blieben sowohl der Heerführer der islamischen „Glaubenskrieger“ als auch jener der christlichen Allianz tot auf dem Schlachtfeld zurück. Die osmanische Geschichtsschreibung vermeldet den Tod Sultan Murads I. als Meuchelmord, den ein Trupp serbischer Soldaten verübte, die sich zuvor als Überläufer ausgegeben und ihren Wunsch geäußert hatten, zum islamischen Glauben konvertieren zu wollen. Demgegenüber wissen die serbischen Chronisten von einem Märtyrer Miloš Obilić zu berichten, der den gefürchteten Feind im Kampf zur Strecke brachte, indem er den türkischen Herrscher in dessen Zelt überfiel und durch mehrere Stiche tödlich verletzte.12
Die Schlacht selbst gilt Forschern als einer der großen mittelalterlichen Kämpfe mit schätzungsweise 100.000 bis 120.000 Teilnehmern, von denen ein Drittel bis die Hälfte auf dem Kosovo Polje den Tod fanden. Während die osmanische Historiographie die christlichen Heere als quantitativ überlegen beschreibt – wohl auch, um die eigenen hohen Verluste erklären und den Sieg noch glorreicher darstellen zu können –, gehen westliche Forscher von einer höheren Schlagkraft des Sultans aus. Auf türkischer Seite stand jedenfalls, darüber dürfte es keinen Zweifel geben, ein straff organisiertes und hierarchisiertes Heer unter der Führung von Murad I. und seinen beiden Söhnen Bayazid und Jakub, das jedenfalls mit seinen sagenumwobenen Pfeilschützen defensiver eingestellt war als das christliche Aufgebot. Dem Sultan entgegen ritten – mit ihrem jeweiligen von ihnen abhängigen Gefolge – der Serbenfürst Lazar Hrebeljanović, der bosnische König Tvrtko, ein weiterer serbischer Fürst und Schwiegersohn Lazars, Vuk Branković, sowie die albanische Herrscherfamilie der Balsha. Feudale bzw. tributäre Abhängigkeit bildeten die bestimmenden Faktoren für die Zugehörigkeit zu einer der beiden Seiten, was dazu führte, dass mutmaßlich auch auf osmanischer Seite serbische und albanische Untertanen kämpften.
Die fehlende Disziplin auf serbischer Seite und der Streit um die Oberhoheit über das gesamte christliche Heer dürften den Ausschlag für den osmanischen Sieg gegeben haben. Nachdem Bayazid im Anschluss an den Tod seines Vaters Murad I. den Oberbefehl über die osmanische Streitmacht übernommen hatte, zerschellten die ersten Linien von Lazars Reitern an der Sultansschanze.13 Diesen Zeitpunkt dürfte Vuk Branković genützt haben, um seine mutmaßlich 10.000 bis 12.000 Mann aus dem Feld zu ziehen, was den Waffengang als Niederlage der christlich-serbischen Seite besiegelte.14 Inwieweit diese Vorgangsweise als Verrat oder als Vernunft eingeschätzt werden soll, kann die Geschichtsschreibung nicht beantworten. Fürst Lazars Gefangennahme endete vor Ort mit seiner Hinrichtung.
Zeitgenossen in Westeuropa erfuhren von der Niederlage der Christenheere übrigens vorerst nichts. Im Gegenteil – die Kunde verbreitete einen Sieg über die Osmanen, weshalb sogar die Kirchenglocken von Notre Dame in Paris aus lauter Freude geläutet haben sollen.15 Materiell erwies sich der Tod Lazars für das ohnedies bereits in mehrere Fürstentümer zersplitterte mittelalterliche Serbien als nicht besonders einschneidend. Ein mongolischer Angriff im Osten Anatoliens bedrohte in jenen Jahren die osmanische Herrschaft und erzwang den Abzug wesentlicher Teile des Sultansheeres; 1402 wurde Sultan Bayazid vom Führer des zentralasiatischen Heeres, Timur Leng, besiegt.
Für die folgenden 70 Jahre war Serbien der Hohen Pforte tributpflichtig, bis im Jahr 1459 – also erst nach dem Fall Konstantinopels – das Land verwaltungstechnisch in das Osmanische Reich eingegliedert werden konnte und als selbständiger Staat von der Landkarte verschwand.
Lazars Niederlage wurde zum serbischen Mythos. Dies ist wohl in erster Linie der orthodoxen Kirche zu verdanken, die den nach seiner Gefangennahme getöteten Fürsten umgehend heiligsprach. Gleichzeitig wurde der Mord an Murad I. als Tat christlicher Märtyrer dargestellt. Auch ist nicht zu unterschätzen, dass sich für die Zeitgenossen die serbische Niederlage nicht so eindeutig darstellte wie für den Historiker heute. Immerhin waren beide Heerführer tot und Serbien war zwar in die Tributpflicht gezwungen, aber nicht verschwunden, und die Osmanen waren in den folgenden Jahren vornehmlich mit den tatarischen Reiterheeren im Osten ihres Reiches beschäftigt. Einzig unvorstellbar bleibt, wie und wann nach einer Schlacht mit Zehntausenden Toten das Leben im Kosovo wieder einen geordneten Gang aufnehmen konnte.
In Gebeten, Volksliedern und Gedichten – freilich auch in historischen Abhandlungen – werden seither, vor allem im 19. Jahrhundert und erneut wieder seit 1989, auf serbischer Seite die Helden des Amselfeldes geehrt. Der „Bergkranz“ des Dichters und montenegrinischen Fürstbischofs Petar II. Petrović-Njegoš16 erweckte die „heldenhaften Ahnen“ ebenso zu literarischem Leben wie unzählige Heldenepen und Litaneien, die im Kampf fallende Märtyrer und ihnen beim Sterben helfende Marketenderinnen besingen. Und kaum ein großer Historiker des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, der den Amselfeld-Mythos nicht ein Stück weit befördert hätte. Von Leopold von Ranke bis Nicolae Iorga reicht der Bogen der Klassiker, die der Schlacht auf dem Kosovo Polje – entgegen der Anzahl ihrer Toten – einen unsterblichen Nimbus verliehen haben.
Viel prosaischer und ans Materielle gebunden gingen die Sieger des Völkermordens ans Werk. Murads Sohn Bayazid („Der Blitz“) ließ unmittelbar nach der Ermordung seines Vaters seinen Bruder Jakub hinrichten und kam damit jedem Streit um eine Thronfolge der Osmanen zuvor. Er begründete damit den bis Ende des 16. Jahrhunderts praktizierten „prophylaktischen Brudermord“17, eine osmanische Praxis der Nachfolgeregelung des Sultanats.
Der Kosovo diente den neuen islamischen Herren – wie schon den serbischen Königen – als Rohstofflieferant. Die Gold- und Silbervorkommen, aber auch das Kupferbergwerk im Norden hatten es den Osmanen angetan. Ihr zeitgenössischer Chronist, Derwisch Ahmed, berichtet über einen wesentlichen Sinn des Kriegsganges: „Was Bayezid Han unternahm, nachdem er den Thron bestiegen hatte: Er entsandte Leute in das Land des Laz (gemeint ist Lazar; HH) und ließ das Bergwerk von Kiratova mit seinem Gebiet und seinen sämtlichen Gruben in Besitz nehmen. Nach Üsküb (Skopje; HH) sandte er den Pașa Yigit Beg, (…) nach Vidin (im heutigen Bulgarien an der Donau gelegen; HH) sandte er den Firüz Beg.“18 Mit den ergiebigen Bodenschätzen aus dem Kosovo, die schon die Römer für sich entdeckt hatten und die auch heute im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Interesses der neuen Okkupanten stehen, konnte Bayezid neue Waffen und Kanonen gießen. Seinen erfolgreichsten Kriegern gewährte er Pfründe („timar“) und motivierte so die kommende Generation von Soldaten im Dienst der Osmanen.
Vidovdan
Die kollektive Erinnerung an die Schlacht auf dem Amselfeld ist serbisch. Der türkische Vormarsch unterjochte die von Fürst Lazar geführte mittelalterliche serbische Staatlichkeit und beseitigte sie schließlich für mehr als 400 Jahre. Dieses Trauma wurde vor allem von der orthodoxen Kirche mythologisch verarbeitet. Den Albanern blieb zwar das Ereignis im Gedächtnis, Emotionen sind damit allerdings nicht verbunden.
Der 28. Juni gilt in Serbien als Feiertag. Am Tag des hl. Vitus, dem Vidovdan, steht nicht nur die Kirche ganz im Zeichen des Amselfeld-Mythos. Benannt ist der 28. Juni – laut julianischem Kalender der 15. Juni – übrigens nach einem französischen Heiligen aus dem 3. Jahrhundert. Veit (oder Vitus) starb der Legende nach während der Christenverfolgungen Kaiser Diokletians. Er spielt in der weströmischen Gedächtnispflege, insbesondere auch in Mitteleuropa, eine wichtige Rolle: Nach ihm sind viele Orte benannt, z.B. St. Veit an der Glan (in Kärnten), Ober St. Veit und Unter St. Veit (in Wien), St. Veit an der Pflaum (auch: St. Veit am Flaum; deutscher Name von Rijeka) etc.; in Böhmen hat Vitus die Rolle des Schutzheiligen übernommen.
„Vidovdan hajduški ustanak“ – „Vidovdan ist der Tag des Haidukenaufstandes“, also des Widerstands – lautet ein serbisches Sprichwort, das die kirchliche Namensgebung politisiert. Der 28. Juni brachte auch in der jüngeren serbischen Geschichte immer wieder entscheidende politische Weichenstellungen mit sich. So z.B. genau 525 Jahre nach der Schlacht auf dem Amselfeld, als der habsburgische Thronfolger Franz Ferdinand, auf Inspektionsreise durch das von den österreichisch-ungarischen Truppen annektierte Bosnien, am 28. Juni 1914 von dem serbisch-nationalen Freischärler Gavrilo Princip in Sarajevo ermordet wurde. Diese Tat gilt gemeinhin verkürzt als Auslöser des Ersten Weltkrieges. Für die Kriegserklärung Wiens an Serbien, die dann in das große Völkerschlachten führte, hatte sie jedenfalls entscheidende Bedeutung. Der Geheimbund „Einheit oder Tod“, besser bekannt unter dem Namen „Schwarze Hand“, dem Gavrilo Princip über dessen Jugendorganisation „Mlada Bosna“ angehörte, war drei Jahre zuvor von serbischen Offizieren gegründet worden. Als Ziel setzte er sich die Befreiung serbisch besiedelter Gebiete von türkischer und österreichischer Besatzung. Er verstand sich somit – zumindest was die Osmanen anbelangte – in der Traditionslinie des Lazar Hrebeljanović. Der Besuch des Thronfolgers in Sarajevo ausgerechnet am Tag des Amselfeld-Gedächtnisses konnte von den national erwachten, antimonarchistisch und demokratisch gesinnten serbischen Offizieren nur als Provokation empfunden werden. Und die Kugel, die Franz Ferdinand schließlich traf, fand für die zeitgenössischen Beobachter ihren Weg ins Ziel als Analogie zum Tode Murads I. 525 Jahre zuvor. Symbolträchtig auch die Rezeption der Tat in den Jahrzehnten danach. Noch zu Ende des Habsburgerreiches, am 28. Juni 1917, ließ Kaiser Karl – der Letzte seiner Art – am Tatort bei der Lateinerbrücke über das Flüsschen Miljačka zu Ehren von Franz Ferdinand und dessen Gattin Sophie, die das Attentat ebenfalls nicht überlebte, ein Denkmal errichten. 1919 wurde das kaiserliche Gusswerk vom Sockel gesprengt und ins Depot überstellt. An seiner Stelle erinnerte fortan eine Gedenktafel an den Täter Gavrilo Princip, der im Gefängnis gestorben war. Bis die deutsche Wehrmacht 1941 das Andenken an den Freischärler, der nun wieder als Terrorist gehandelt wurde, demontierte. 1945 erfolgte die Umbenennung des Ortes in „Gavrilo Princip-Brücke“. In der Folge wurde im titoistischen Jugoslawien eine Steinplatte, angeblich mit den Fußabdrücken des Attentäters, am Tatort montiert, in jener Stellung, in der der Befreier von der Fremdherrschaft gestanden sein soll, bevor er auf den Wagen der Kaiserlichen sprang und die tödlichen Pistolenschüsse abgab. Nach dem Ende Jugoslawiens zerstörten bosnisch-muslimische Kämpfer das an Princip erinnernde Denkmal und die Brücke erhielt wieder ihren früheren Namen „Lateinerbrücke“. Der symbolische Kampf um die Definitionsgewalt dieses Vidovdan des Jahres 1914 wird auch damit noch nicht sein Ende gefunden haben.
Nur sieben Jahre, nachdem die „Schwarze Hand“ unter Anleitung des serbischen Geheimdienstes ihren Beitrag zur serbischen Geschichte geleistet hatte, war es wieder ein Veitstag, der in die Annalen der Politik Eingang fand. Der 28. Juni 1921 brachte dem neu entstandenen südslawischen Staat die sogenannte „Vidovdan“-Verfassung, die eine konstitutionelle Monarchie vorsah.
Die kommunistischen Partisanen und später die regierenden Titoisten lösten sich mehr als alle ihre Vorgänger von der Amselfeld-Mythologie des Jahres 1389.
Zum 600. Jahrestag der großen Schlacht war es dann der serbische Präsident Slobodan Milošević, der seine Anhänger auf das Amselfeld lud. Eine Million von ihnen waren gekommen, um aus dem Mund des aufsteigenden Politstars jenes Versprechen zu vernehmen, das er zehn Jahre später nicht einlösen konnte. Milošević garantierte damals den anwesenden Massen, mit der Kraft der neuen serbischen Führung einen weiteren Exodus von Serben aus dem Kosovo verhindern bzw. aufhalten zu wollen. Vor allem die wirtschaftlichen – aber auch die ethnisch-politischen – Verhältnisse im Kosovo waren so drängend und drückend geworden, dass in den 1980er Jahren immer mehr Serbinnen und Serben das Land verlassen hatten. Nun, im Angesicht der serbischen Minderheit im Kosovo, freilich unterstützt von SerbInnen aus dem Kernland, bot der neue Herrscher aus Belgrad seine Hilfe an. Sie war nicht explizit antialbanisch ausgerichtet, doch die Symbolik des Ortes, aber auch die Art der Garantieerklärung musste für die albanisch-kosovarische Mehrheitsbevölkerung als serbischer Aufruf zum nationalen Kampf empfunden werden. In einem solchen befand sich der Kosovo, so viel ist zumindest post tragoediam klar, ohnedies bereits. Slobodan Milošević gelang am 600. Jahrestag der Türkenschlacht ideologisch eine Transformation vom Jugoslawismus zum Serbentum. Sein damaliger Gegenspieler Ibrahim Rugova, der Führer der Albaner im Kosovo, antwortete auf die Frage eines Journalisten, ob er die 600-Jahr-Feier als Provokation empfinde: „Natürlich ist das eine Provokation. Es ist eine rein serbische, chauvinistische Feier.“19
Nicht nur der Aufstieg von Slobodan Milošević war eng mit dem Vidovdan verbunden, auch sein Ende steht mit diesem symbolträchtigen Tag in Verbindung. Es war der 28. Juni 2001. Diesmal nützten die Häscher der NATO unter Mithilfe von Serbiens damals erst kurz amtierendem Ministerpräsidenten Zoran Djindjić die nationale Symbolik, um dem Tag des Sieges und der Niederlage, dem Tag der „Wiege des Serbentums“ ihre Geschichtsmächtigkeit aufzudrücken. An diesem Tag erfolgte die Auslieferung des früheren Staatschefs nach Den Haag, wo ihn das „Internationale Tribunal für das frühere Jugoslawien“ (ICTY) in Empfang nahm. Dass sich diese per NATO-Hubschrauber erfolgte Überstellung rechtlich als Entführung entpuppte, weil nur wenige Stunden zuvor der oberste serbische Gerichtshof eine fragwürdig zustande gekommene Regierungsentscheidung sistierte, die eine Außerlandesbringung von Milošević überhaupt erst ermöglicht hatte, sagt viel über die Strahlkraft des Vidovdan und die Auseinandersetzung darüber aus, wer sich ihrer in wessen Dienst bemächtigen kann.
Nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Februar 2008 war es dann wieder ein Vidovdan, als am 28. Juni 2008 im serbisch besiedelten nördlichen Teil der Stadt Kosovska Mitrovica gegen den Willen der internationalen Verwalter ein eigenes serbisches Parlament für Kosovo und Metochien gegründet wurde. Damit war ein erster Schritt zu politischen Parallelstrukturen getan.
500 Jahre unter der Hohen Pforte
Zwischen 1459 und 1912 wurde Kosovo/Kosova direkt vom Regierungssitz des Sultans in Konstantinopel, der sogenannten Hohen Pforte, verwaltet. Schon 70 Jahre zuvor hatten die Osmanen das auf dem Amselfeld geschlagene serbische Fürstentum tributpflichtig gemacht, sodass die türkische Periode insgesamt länger als 500 Jahre andauerte. Der Norden des Kosovo, heute mehrheitlich von Serbinnen und Serben bewohnt, wurde beim Berliner Kongress 1878 dem serbischen Fürstentum zugesprochen, während der Rest des Vilayets weiterhin osmanisch verblieb.
Die osmanische Verwaltung war in Militärbezirke eingeteilt, die Sandschaks genannt wurden und einem sogenannten Sandschakbeg unterstellt waren. Land und Menschen gehörten zu Anfang der osmanischen Zeit zum Großbezirk Rumelien („Römerprovinz“), der mehrere solche Sandschaks umfasste. Ab dem 17. Jahrhundert wurden die Militärbezirke auf ziviler Ebene in Vilayets zusammengefasst, wobei das Vilayet „Kosova“ seinen Namen erst im 19. Jahrhundert erhielt. Es reichte nordwestlich über Novi Pazar ins heutige Kernserbien hinaus und umfasste auch die später in Makedonien liegenden Gegenden um Skopje und Tetova sowie die östlichen Gebirge Albaniens.
Als administratives Vorbild diente dem Sultan die „byzantinische bzw. byzantinisch-slawische Verwaltungsordnung“20, die als speziell osmanisches Lehenssystem funktionierte. Grundsätzlich waren alle eroberten Gebiete Staatsbesitz, „Sultansland“. Dieses wurde an verdiente Militärs, die sogenannten „Spahis“ (Schwertadel), oder in Form von Dienstlehen an zivile Verwalter verliehen. Die „Spahis“ bewirtschafteten das geliehene Land nicht eigenständig, sondern lebten von dem „Überlassenen“, weshalb Historiker auch von einem System des „Pfründenfeudalismus“21 sprechen. Diese Pfründe wurden nicht vererbt, sondern fielen nach dem Tod der Schwertadeligen an den Sultan zurück. Ein gewisser Teil des Landes blieb als Kronbesitz direkt dem Sultan in Konstantinopel unterstellt
Jeder Eroberung, und es waren ihrer bis zur Schlacht bei Mohács 1526 viele, folgten die osmanischen Tributspezialisten auf dem Fuß. Ihre erste Aufgabe bestand in der Erstellung von Steuerkatastern, die wie ein Netz über die örtliche Bevölkerung gelegt wurden und deren Abgabentauglichkeit festlegten. Weithmann beschreibt die osmanische Herrschaft als einen „um Ordnung bemühten Staatsapparat“, unter dem es der Landbevölkerung „besser erging als vorher unter ihrem Dutzend kleiner christlicher Tyrannen“.22 Dies scheint auch einem dieser „kleinen christlichen Tyrannen“, dem letzten bosnischen König, aufgefallen zu sein, der dem römischen Papst gegenüber die gute Behandlung der osmanischen Untertanen durch Konstantinopel beklagte: „Die Türken sind den Bauern gegenüber milde und lassen sie (während des Feldzuges) ungeschoren. Sie versprechen allen, die sich unterwerfen, einen festen Zins, und allen, die zu ihnen kommen, Abgabenfreiheit.“23 Nicht einmal die Haare mussten sich die Bauern also schneiden, wenn sie gegen den Feind ihres Grundherrn in den Krieg zogen!
Eine im Westen mit Abscheu betrachtete Steuer bestand in der sogenannten Knabenlese. Diese verpflichtete bis ins 17. Jahrhundert die Familien der osmanischen Untertanen auf dem Balkan zur Abgabe des Zehent in Form männlichen Nachwuchses – im Klartext: Jeder 10. Knabe gehörte dem Sultan. Auf eigenen Schulen in Konstantinopel wurden diese frühzeitig ihren Familien entrissenen Jünglinge für spezielle Aufgaben – u.a. für das berühmt-berüchtigte Janitscharenheer oder höhere Verwaltungsaufgaben – erzogen, wozu auch die Glaubenskonversion gehörte. Das Kalkül dahinter mochte gewesen sein, dass familiär und regional entwurzelte Kinder die Idee eines Großreiches besser verstehen würden als sich heimisch fühlende Jugendliche. Ein strukturell ähnlicher Gedanke steckt wohl auch in der Klösterwelt des Christentums, in der ebenfalls junge Männer – wenn auch nicht mittels Menschensteuer – aus ihren familiären Kreisen herausgenommen und für das „Reich Gottes“ umerzogen werden. Die osmanischen Umerziehungslager waren bei manchen Eltern gar nicht so unbeliebt, eröffneten sie doch dem Einzelnen Karrieremöglichkeiten, die ansonsten Menschen auf dem Lande verschlossen blieben. Dass diese Möglichkeiten auch genützt wurden, zeigt ein Blick auf die Herkunft hoher und höchster Würdenträger, der gleichzeitig offenbart, wie dynastisch und keinesfalls national oder regional begrenzt das Herrschaftsdenken der Osmanen war. Demnach waren bis zum Jahr 1623 nur fünf von 44 Großwesiren – immerhin die zweithöchste Position im Land der Hohen Pforte – türkischer Abstammung, elf werden als Slawen, elf weitere als Albaner, sechs als Griechen etc. in den Annalen geführt.24 Weithmann zählt bis zum Ende der Osmanenzeit gar 30 Großwesire albanischer Herkunft.
Die höchsten politischen Ämter und die lukrativsten Geschäfte waren Moslems vorbehalten. Im Osmanischen Reich herrschte der Glaube an den Propheten Mohammed. Dies bedeutete jedoch keinesfalls, dass – wie zur Zeit der Reconquista in Spanien oder der Gegenreformation in deutschen Landen – alle Untertanen mit Gewalt bekehrt wurden und, dem moslemischen Brauch folgend, ihren Gebetsteppich gen Mekka richten mussten. Die Islamisierung erfolgte schleichend, ohne großen Zwang, mittels Vergabe bzw. Entzug politischer und wirtschaftlicher Privilegien. So waren Christen von höchsten Staatsämtern ausgeschlossen. Auch durften Christen und Juden keinen Kriegsdienst leisten, was als schwere Diskriminierung galt. Zusätzlich zur Verweigerung gewisser Privilegien hatten die christlichen Schutzbefohlenen oder die „Rayah“ (Herde), wie sie im Osmanischen Reich hießen, eine Christensteuer auf jeden Kopf, die sogenannte „Haradsch“, zu leisten.
Christliche Riten und Gebräuche, die in der damaligen Zeit um vieles bedeutsamer waren als heute, konnten im Rahmen des „Millet“-Systems ausgeführt werden, das nicht-islamischen Religionsgemeinschaften eine Selbstverwaltung gewährte. Die dazu benötigte religiöse Struktur wurde von den Osmanen nicht angegriffen. Allerdings löste der Sultan nach der Schlacht auf dem Amselfeld das autokephale serbisch-orthodoxe Patriarchat von Peć auf und unterstellte Kirche und Gläubige dem griechisch-orthodoxen Ostrom. Es sollte bis 1557 dauern, bis ein zum Islam konvertierter bosnischer Großwesir, Sokollu Mehmed Pascha, die serbische kirchliche Selbstverwaltung wiederherstellte und Peć erneut zum Patriarchensitz erhob.25
Orthodox betende Albaner wurden in der Zwischenzeit seltener und seltener. Einerseits verfügten sie über keine Nationalkirche wie das serbische Patriarchat in Peć, andererseits schien ihre clanartige Familienstruktur, in der die Bindung an den Hausherrn größer war (und ist) als jene an den Gottesmann, Religion und religiöse Hierarchien zu überlagern. Die Konversion zum Islam ging vor diesem Hintergrund schnell und leicht; kulturelle Hindernisse, wie sie bei serbischen Orthodoxen vorhanden waren, konnten müheloser überwunden werden. Gegen Ende der Osmanenherrschaft gibt eine – mit gewisser Vorsicht zu genießende – habsburgische Statistik des Jahres 1903 Auskunft über 500 Jahre Islamisierung in den Sandschaks Peć, Priština und Prizren. Demnach zählte man bei der serbischen Bevölkerung 61,6% Christen und 38,3% Muslime, während man bei den Albanern 6,5% (fast nur katholische) Christen und 93,4% Muslime antraf.26 Aus selbiger Statistik geht übrigens hervor, dass sich die Albaner zu diesem Zeitpunkt in den drei angesprochenen Sandschaks – deren damalige Grenzen nicht mit dem heutigen Kosovo übereinstimmen – in der Mehrheit befanden.
Islamisierte Albaner werden in der historischen Literatur mit dem griechischen Wort „Arnauten“ bezeichnet, das ihnen im Übrigen die türkischen Eroberer wegen ihres damaligen (griechisch-)orthodoxen Glaubens gaben. Die osmanischen Behörden förderten sie in der nicht unberechtigten Hoffnung, damit die Loyalität eines Teils der Bevölkerung auf dem Balkan sicherzustellen. Arnauten bzw. deren Eliten repräsentierten in der Folge häufig selbst die osmanische Herrschaft und galten ab dem 17. Jahrhundert als gefürchtete Krieger27, die sich auch gegen die späteren serbischen und bulgarischen Aufstände ins Zeug warfen. Diese Tatsache prägt noch Jahrhunderte später die nationalisierten historischen Gedächtnisse von Albanern und Serben und ist damit eine der Grundlagen für lang andauernde Feindschaft.
Doch nicht nur politisch-militärisch fühlten sich Serben gegenüber islamisierten Albanern historisch unterlegen, auch sozial kam ihre Stellung nicht an jene der Arnauten heran. Im Stadtbild der Osmanenzeit spielten sie, die mehrheitlich christlich geblieben waren, eine untergeordnete Rolle, sie waren dort nur spärlich vertreten. Urbanität wurde von einer Mischung aus Verwaltern, Handwerkern und Kaufleuten gelebt. Die große Moschee (Cami) bildete den Mittelpunkt, um sie herum der Markt, fallweise eine Koranschule (Medrese) und das Haus des Richters (Kadi). An allen diesen Orten war für christliche Slawen kein Platz; Moschee, Medrese und Kadi waren muslimische Einrichtungen, die Zivilverwaltung ohnedies, und den Markt beherrschten armenische, jüdische und griechische – phanariotische – Händler. Die Mehrheit der Bevölkerung lebte auf dem Land. Wie dort, im „Serbenland“, die Menschen hausten, beschrieb der Berichterstatter einer kaiserlichen Gesandtschaft, die sich 1564 im Auftrag Maximilians II. von Wien nach Konstantinopel begab: „Von Bellegrad oder Griegisch Weißenburg aus reisen wir erstlich durch Serfien, ein edl Land, daselbst gar armes Volck, derffen keine Wehren tragen noch haben. Halten wenig Roß, dan die Türggen nemens innen. Aber Oxen haben sie. Wein und Traid (Getreide; HH) wechst ihnen genug. Ir Kleidung ist von groben Tuch … Man und Weib schier uberein geklaidt. Allain, dass der Weiber Kleider vornen auf der Prust ausgeschnitten und hinden drey Falten hat.“28
Mythos Skanderbeg
Auf das Gebiet des heutigen Kosovo hat der berühmteste albanische Feldherr des Spätmittelalters mutmaßlich nie seinen Fuß gesetzt. Für die Geschichte der Region und für das Nationalgefühl der AlbanerInnen ist er jedoch von so überragender Bedeutung, dass ein kurzer Exkurs gerechtfertigt ist. Die Rede ist von Gjergj Kastrioti oder, wie er auch genannt wird, Iskender (auf Türkisch), Alexander, Skënderbeu (auf Albanisch), Skanderbeg (1405-1468). Er stammte aus einer der mächtigsten albanischen Adelsfamilien. Sein Großvater selben Namens, Gjergj Kastrioti, kämpfte in der berühmten Schlacht auf dem Kosovo Polje als unabhängiger Fürst unter dem Serben Lazar Hrebeljanović gegen die Osmanen. Das Land der Kastrioti lag im heutigen Nordalbanien und erstreckte sich bis ins kosovarische Prizren.29 Seine geopolitische Lage zwischen den vorrückenden Türken und dem venezianischen Reich an der Adria ermöglichte es der Fürstenfamilie auch noch Jahrzehnte nach der christlichen Niederlage des Jahres 1389, zwischen den beiden Machtblöcken eigenständig Politik zu machen und wesentlichen Einfluss zu erhalten – bis Skanderbegs Vater, Gjon Kastrioti, 1430 einem weiteren Vorstoß des osmanischen Heeres nicht mehr standhalten konnte. In der Folge war er gezwungen, dem Sultan nicht nur Land abzutreten, sondern auch seine vier Söhne als Tribut zu übergeben. Einer von ihnen, Gjergi Kastrioti, erlangte in seiner Zeit Weltruhm. Am Hof der Osmanen, der vor der Einnahme Konstantinopels in Adrianopel/Edirne gelegen war, wurde Skanderbeg zum Krieger ausgebildet und trat zum moslemischen Glauben über. Er tat seine Sache hervorragend und focht für seinen Sultan Murad II. Schlachten sonder Zahl. Als dieser ihn jedoch 1443 gegen das Heer des ungarischen Fürsten Janos Hunyadi, den Vater von Matthias Corvinus, schickte, wechselte Skanderbeg die Seiten. Der siegreiche Feldzug des Magyaren, der mit päpstlichem Segen Soldaten aus allerlei Herren Länder gegen die „Ungläubigen“ schickte, ermöglichte den Verrat Skanderbegs an seinem Auftraggeber. Mit ein paar Hundert Bewaffneten, die er direkt befehligte, wandte sich Skanderbeg gegen die türkische Armee, schlug sie in die Flucht und nahm in den Monaten bis November 1443 die wichtigsten Festungen in Epiros, dem heutigen Albanien, ein. Zuvor hatte er Janos Hunyadi von seinem Vorhaben unterrichtet. Danach trat er zum katholischen Glauben über. Am 1. März 1444 trafen dann in Lezhë die regionalen albanischen Heerführer zusammen und bestimmten Skanderbeg zum „Hauptmann der albanischen Liga“ und Krujë im nördlichen Albanien zur Hauptstadt.30 Über die folgenden zwei Jahrzehnte verteidigte der „unbesiegbare Christensoldat“, wie er in Westeuropa ehrfurchtsvoll genannt wurde, seine Festung Krujë gegen oft monatelang andauernde türkische Angriffe, bis er, für einen Krieger seines Schlages ungewöhnlich, 1468 im Bett verstarb. Der bekannteste albanische Schriftsteller, Ismail Kadaré, hat 500 Jahre später Skanderbegs historischen Mythos in seinem Roman „Die Festung“31 literarisch modernisiert und dem „Helden von Kruja“ ein auch heute lesenswertes Denkmal gesetzt.
Wirtschaftlich lag das Land der Albaner nach dem jahrzehntelangen Kampf gegen die Osmanen Ende des 15. Jahrhunderts danieder. Schon vor der endgültigen türkischen Eroberung im Jahr 1479, als die Festung Krujë von Janitscharen eingenommen werden konnte, versuchten viele Bewohner aus den Bergen zur dalmatinischen Küste zu fliehen. Die soziale Situation war so schrecklich und das Land von den Feldzügen der Osmanen dermaßen verwüstet, dass von Albanern berichtet wird, die, in Ragusa/Dubrovnik angekommen, sich auf dem dortigen Markt selbst als Sklaven verkauften. Unter venezianischen Kaufleuten sollen in jenen Tagen Flüchtlinge aus den balkanischen Bergen beliebt gewesen sein. Die reichen Herren nahmen sie als Arbeitskräfte auf, wenn diese gewillt waren, zehn Jahre lang ohne Entlohnung für sie zu arbeiten.32
Die große Flucht der Serben
Das Jahr 1690 stellt in der Geschichte des Kosovo einen entscheidenden Wendepunkt dar. Zigtausende serbisch-orthodoxe Familien flohen damals das Land, das in der Folge mehr und mehr von Arnauten, islamisierten Albanern, besiedelt wurde. Die historischen Fäden für diesen Bevölkerungstransfer, der den Serben zum Trauma wurde, liefen in Wien zusammen.
Die Niederlage der osmanischen Armee vor Wien im Jahr 1683 zerstreute die türkischen Heerscharen bis hinter Belgrad. 1683 markiert den Anfang vom Ende der osmanischen Ausbreitung in Europa. Die habsburgische Armee unter Eugen von Savoyen war zu diesem Zeitpunkt in der Lage, die halb aufgeriebenen Truppenteile des Großwesirs Kara Mustafa die Donau abwärts bis Belgrad zu vertreiben und Teile Serbiens zu erobern. Emissäre Eugens von Savoyen nahmen im Zuge des Vormarsches mit unzufriedenen Serben Kontakt auf und stachelten diese an, eine innere, zweite Front gegen Konstantinopel zu errichten.33 Wie so oft in der Geschichte war der externe Faktor von entscheidender Bedeutung. Die Serben des Amselfeldes erhoben sich, ein Aufstand brach aus. Und die Wut der nun von den Habsburgern unterstützten orthodoxen Christen richtete sich gegen alles Muslimische. Das geopolitische Ziel Wiens bestand in der Gründung eines eigenen serbischen Königreiches zwecks Schwächung der Osmanen. Seine Hauptstadt sollte das heute an der kosovarisch-makedonischen Grenze gelegene Kumanovo werden. Doch die Habsburger überschätzten ihre militärischen Möglichkeiten. Die bedrängten Osmanen, die sich kurzzeitig aus dem Kosovo (sowie aus Bosnien und Makedonien) zurückziehen mussten, konnten ihre Truppen nicht zuletzt mit arnautischer Hilfe reorganisieren. Nach zwei Jahren, 1690, kehrten die Soldaten des Kaisers um – sie wurden an der Westgrenze des Reiches gegen Frankreich gebraucht – und überließen die orthodoxen Aufständischen ihrem Schicksal. Dieses war grausam. Die Rache der Osmanen kam in Gestalt albanisch-muslimischer Krieger. Wer ihr entgehen wollte, musste fliehen. Und so organisierte der serbische Patriarch Arsenije III. Crnojević im Jahr 1690 die große Flucht aus der Heimat.34 Den verschiedenen Quellen zufolge waren es bis zu 30.000 Familien, die dem Rückzug der Habsburger in Richtung Nordwesten folgten und sich im Banat, in Syrmien und der Fruška Gora niederließen. Ihr neues geistiges Zentrum wurde Sremski Karlovci/Karlowitz, wo Wien die Errichtung einer orthodoxen Metropolie gestattete, den Titel des Patriarchen allerdings – bis 1848 – verweigerte. Mit der Billigung einer „griechisch-orientalischen Kirche“ im römisch-katholischen Österreich übernahm Wien indirekt ein Stück des osmanischen Millet-Systems mit seiner religiösen Selbstverwaltung.35 Trotz Privilegierung war diese jedoch immer wieder dem Vorwurf des Schismatismus – der Kirchenspaltung – ausgesetzt.
Auch die Jahre nach dem großen serbischen Exodus waren von orthodoxen Wanderungsbewegungen in Richtung Westen geprägt. Als neue habsburgische Untertanen, nach einem ihrer Herkunftsorte „Raitzen“ (Raszien) genannt, besiedelten viele dieser Auswanderer nach dem Frieden von Karlowitz 1699 die nun auch in diesem Gebiet ausgebaute Militärgrenze, die „Vojna Krajina“. Die direkte Unterstellung unter die Zentralmacht in Wien erlaubte den Wehrbauern die Beibehaltung ihres orthodoxen Glaubens und schützte sie gegenüber den Abgabeforderungen des lokalen ungarischen oder kroatischen Feudaladels. Schon 1630 waren die „Grenzer“ des Habsburgerreiches in ihrem 1.800 Kilometer langen und 50.000 Quadratkilometer umfassenden Territorium direkt Wien unterstellt und im sogenannten „Statuta Valachorum“ privilegiert worden, solange sie bereit waren, als Soldaten überall am Rande des Reiches ihren Dienst zu tun. Im Zuge der Verdrängung der Osmanen aus Nordserbien, dem Banat und Transsilvanien wurde die Militärgrenze ausgedehnt.
Die Schwerpunkte des serbischen orthodoxen Siedlungsgebietes verschoben sich im Jahr 1690 eindeutig in Richtung Nordwesten; es erreichte mit dem im nahe Budapest gelegenen Szentendre/Sentandreja seinen nördlichsten Punkt, wo Serben im Übrigen noch heute als nunmehr autochthone Bevölkerung anzutreffen sind. Der Kosovo erlebte in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die Einwanderung albanisch-muslimischer Menschen, die vor allem in der Ebene um Prishtinë das Ackerland unter den Pflug nahmen. Die serbischen Klöster blieben von den Osmanen in ihrer Mehrzahl unangetastet, die orthodoxe Bevölkerung verschwand keineswegs, nahm jedoch deutlich ab.
Die Erosion des Sultanreiches
Dynastische Kämpfe dreier europäischer Großmächte eröffneten im 19. Jahrhundert von nationalen Ideen beseelte politische Handlungsspielräume und instrumentalisierten diese gleichwohl sofort. Ein Jahrhundert zuvor war die auf Expansion ausgerichtete Tributökonomie der Osmanen 1683 vor Wien an ihre Grenzen gestoßen und verlor in der Folge ihre ungarischen Gebiete an die Habsburger, die bis 1806 die Kaiser des „Heiligen Römischen Reiches“ stellten. Belgrad wurde ab 1718 – für 20 Jahre – von Wien aus regiert.
Für den Kosovo und seine BewohnerInnen fast noch wichtiger als die Auseinandersetzungen im Westen des Sultanreiches sollte das Erstarken der dritten Herrscherdynastie in Nordosteuropa werden: Die zaristischen Romanows wurden unter Peter dem Großen Anfang des 18. Jahrhunderts zum gefährlichsten Gegner der Osmanen. Peter I. gelang 1700 – auf Kosten Konstantinopels – erstmals ein russischer Zugang zum Schwarzen Meer. Dem schwächelnden türkischen stand mit einem Mal ein erstarkendes russisches Reich gegenüber. Und dieses wusste auch innerhalb der osmanischen Grenzen auf dem Balkan Unruhe zu stiften. Russische Emissäre agitierten im Auftrag von Petersburg unter der serbischen Bevölkerung36, der christlichen „Rayah“, und präsentierten sich den orthodoxen Untertanen – auch im Kosovo – als Schutzmacht der Rechtgläubigen. Diese Funktion wurde dem russischen Patriarchat auch unter Katharina der Großen 1774 vom Sultan gewährt.37 Zwischen 1711 und 1877 sah Europa acht russisch-türkische Kriege um die rumänischen Donaufürstentümer und den Zugang zum Schwarzen Meer und darüber hinaus zum Mittelmeer. Der Balkan war hiervon nicht direkt betroffen, die orthodoxen Slawen fühlten sich jedoch durch den schwächer werdenden Einfluss des Sultans, der im Norden von russischer Seite unter Druck geriet, bestärkt.
Zweimal schlossen Zar und Kaiser im 18. Jahrhundert anti-osmanische Bündnisse, beide Male schreckten Wien bzw. Paris und London wegen allzu großer russischer Gebietsgewinne auf und verhinderten weitere osmanische Verluste. 1739 führte dies zum Abzug der kaiserlich-habsburgischen Soldateska aus Belgrad und Nordserbien; wieder flohen Tausende Serben mit den österreichischen Truppen über die Donau nach Ungarn. Wie schon 40 Jahre zuvor, beim großen Auszug aus dem Kosovo, fühlten sich Serben von der österreichischen Außenpolitik missbraucht.
1781 kam es zu einem geheimen Abkommen zwischen Wien und Sanktpeterburg/Sankt Petersburg, die Aufteilung des Osmanischen Reiches betreffend, oder, wie es in Diplomatenkreisen hieß: zur „Lösung der Orientalischen Frage“. Als Vorbild diente den beiden Großmächten die – gemeinsam mit Preußen betriebene – Neuordnung in der Mitte des Kontinents, die ab 1772 (bis 1795) in drei Etappen Polen von der Landkarte strich. Ein sogenanntes „Griechisches Projekt“38 sollte Konstantinopel zur Hauptstadt eines griechischen Kaiserreiches machen, anders als 1.500 Jahre zuvor diesmal allerdings mit einem russischen Patriarchen an der Spitze. Für Österreich waren Teile des Balkans, Dalmatien und eine Handvoll ägäische Inseln als Beutestücke vorgesehen. Zum großen mörderischen Showdown, der ein solches „modernes“ Europa ohne Osmanen und Moslems auf dem Kampffeld erstritten hätte, kam es nicht. Vielleicht war ein diesbezüglicher Waffengang gar nicht vorgesehen. Die Habsburger zogen jedenfalls 1787 wieder einmal – für kurze Zeit – in Belgrad ein, allerdings nur, um ihrer Bündnistreue gegenüber dem Zaren Genüge zu tun.
Derweil erodierte die osmanische Herrschaft im Inneren. Die Hohe Pforte verlor an Einfluss in den einzelnen Paschaliks, deren Gouverneure zunehmend auf eigene Faust und oft mit eiserner Hand regierten und das Volk ausbluteten. Der langsame Zerfall der türkischen Herrschaft erweckte westeuropäische Ideen unter den Eliten der Untertanen. Sie entdeckten ihre Nation, ihr Volk, ihre Sprache und ihre Kultur, so wie es die Gelehrten in Westeuropa seit der Aufklärung predigten. Mit einem relativ friedlichen Zusammenleben – oder besser: Nebeneinanderleben – von Serben, Albanern, Türken, Griechen und anderen war es nun vorbei. Die einigende dynastische Klammer, so brutal sie im Zeitenlauf einmal für diese und ein andermal für jene Bevölkerungsgruppe gewesen sein mag, verlor im 19. Jahrhundert ihre Spannkraft.
Damit verschliss sich auch das Millet-System, das unter der Ägide einer religiösen Selbstbestimmung die ethnoreligiöse Vielfalt garantiert hatte. Das Osmanische Reich implodierte, der Balkan explodierte.
Die nationale Epoche
„Das (eingeborne) volk eines landes, einer groszen staatsgesamtheit“39 – mit diesen Worten umschreiben die Brüder Grimm in ihrem berühmten Wörterbuch den Terminus „Nation“. Vom lateinischen „Geborenwerden“ stammend, liiert sich die Nation seit der Französischen Revolution begriffsgeschichtlich mit Staat und Volk. Das war nicht immer so. So führten die Habsburger seit Jahrhunderten die Krone des „Heiligen Römischen Reiches“, dessen Zusatz „deutscher Nation“ im 15. Jahrhundert aufkam, jedoch nichts mit deutschem Staats- und Volkswesen zu tun hatte, sondern eine dynastische Umschreibung für das Kerngebiet des Reiches war. Am Kaiserhof sprach man Italienisch, später Französisch, und als der deutsche nationale Geist im romantischen Sinn des 19. Jahrhunderts auch in Wien Einzug hielt, gab es – ab 1806 – längst keine römisch-deutsche Kaiserkrone mehr; Napoleons Vorstoß ließ die Reichsinsignien in die Schatzkammer wandern.
Auch die „unio trium nationum“ der Sachsen, Ungarn und Szekler im Fürstentum Transsilvanien40 definierte ab dem 15. Jahrhundert weder Staatlichkeit noch Volk. Diese nationale Dreierallianz funktionierte als „brüderliche Vereinigung“ von drei privilegierten Ständen: dem ungarischen Adel, dem sächsischen Patriziat und den szeklerischen Militärherren. Sie hielt damit die Bauernschaft gleicher „ethnischer“ Herkunft sowie die rumänische orthodoxe Bevölkerung sozial auf Distanz.
Staatlich und völkisch wurde die Nation erst Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Französische Revolution mündete in der Vorstellung einer Staatsnation, freilich ohne die – schwarzen – BewohnerInnen der Kolonien gedacht. Die deutsche Nation hingegen machte sich als „Volk“ auf einen langen historischen Weg, der auch zum Vorbild der Nationalbewegungen auf dem Balkan wurde. Die fehlenden kolonialen Besitzungen dürften – neben der nicht existierenden territorialen Einheit – ein Mitgrund für die völkische Ausprägung des deutschen Nationsbegriffes gewesen sein, vermochten sich doch Engländer und Franzosen gegenüber der Bevölkerung riesiger kolonialer Gebiete, die für die Zentren Rohstoffe lieferten und mit diesen die beginnende Industrialisierung in Gang brachten, als weiße Rasse zu setzen, ohne damit den Nationsbegriff belasten zu müssen.
Die nachholenden balkanischen Nationalismen nahmen jedenfalls deutsche Denker als entscheidende Vorbilder. Johann Gottfried Herder und Georg Wilhelm Friedrich Hegel waren nur zwei von ihnen, welche das Geistesleben im Osten Europas beeinflussten. Umgekehrt prägten ihre Beschreibungen des Balkanraums die deutschsprachige intellektuelle Szene in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vor der eigenen hell strahlenden aufgeklärten Ideenwelt verdüsterten Philosophen wie Herder und Hegel das Bild der vom langen Schatten Konstantinopels überdeckten Völker Südosteuropas. Ihnen, den Slawen, Albanern und Walachen, wurden asiatische Züge angedichtet und namentlich die Bulgaren, Serben und Albanesen als Teilvölker „gebrochener barbarischer Reste“41 gesehen. Hegel weiter über seine Sicht der Balkanvölker, welche er nicht zu unterscheiden wusste: „Diese ganze Völkermasse ist bisher nicht als selbständiges Moment in der Reihe der Gestaltungen der Vernunft in der Welt aufgetreten.“ Ähnlich herrisch vorurteilsbeladen und von oben herab äußerte sich Herder über die orthodoxen Menschen auf dem Balkan. In seinen „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ bezeichnete er die Südslawen pauschal als „von Griechen verdorben“42, was ihm offensichtlich als Beweisführung Schimpf genug war. Sein Konzept des nationalen „Volksgeistes“, der menschliches Dasein idealistisch überhöht und von wirtschaftlichen und sozialen Fragen unberührt lässt, stieß bei balkanischen Intellektuellen nichtsdestotrotz auf großes Interesse. Mehr noch – sein „Slawenkapitel“ wurde von der serbischen Bildungsschicht heißhungrig aufgenommen und zum „Evangelium“43der slawischen Wiedergeburtsbewegung des 19. Jahrhunderts sowie insbesondere zum Impuls für eine entstehende Slawistik.
Intellektuell asynchron geht die gegenseitige Wahrnehmung weiter. Während vor allem serbische Bildungsbürger im Westen, in der deutschen Nation, in Wien ihre Vorbilder suchen – und finden, erklären ebendiese balkanische Völker für barbarisch, unbelehrbar, unproduktiv, kontemplativ, ja als inexistent. So auch Immanuel Kant 1790 in seiner „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, in der es über die Völker der europäischen Türkei heißt, „daß sie nie das gewesen sind noch sein werden, was zur Aneignung eines bestimmten Volkscharakters erforderlich ist“.44 Punktum. Kein Wunder, dass Staatsmänner von Bismarck bis Wilhelm II. sich vor solch einem intellektuellen Hintergrund nicht scheuen müssen, von „slawischen Hammeldieben“ oder den „Stämmen da unten“ zu sprechen, wenn sie bei großen Konferenzen über ihre Vorstellungen von Südosteuropa Auskunft geben.
Vuk Karadžić und Naum Veqilharxhi, Ilije Garašanin und Sami Frashëri
Jede Epoche hat ihre Helden, die oft erst nachträglich als solche gefeiert werden. Im Zeitalter der Nationsbildung des 19. Jahrhunderts waren dies nicht Krieger vom Schlage Lazars oder Skanderbegs, sondern Schriftsteller und Politiker. Das ist sowohl auf serbischer als auch auf albanischer Seite ähnlich.
Die Kodifizierung der Sprache kam vor der politischen Rede. Die gemeinsame Sprache war und ist das entscheidende Merkmal moderner Nationen, soziale und religiöse Gemeinsamkeiten treten in dieser Epoche in den Hintergrund. Idealtypisch drückte dies 1783 der große slawische Aufklärer und spätere erste serbische Kulturminister Dimitrije Obradović aus: „Gesetz und Glauben kann man wechseln, niemals aber Volkstum und Sprache. Die Südslawen sind eine Nation, unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit.“45
So ist es nicht verwunderlich, dass die „Schöpfer“ der Schriftsprachen als nationale Helden gelten. Auf serbischer bzw. serbokroatischer Seite ist dies der aus dem bosnischen Tvornik stammende Philologe Vuk Karadžić, der in den Jahren 1814 bis 1818 erfolgreich antrat, die Volkssprache zu standardisieren. Die anfängliche Skepsis der orthodoxen Popen, die liturgisch im alten Kirchenslawisch verankert waren, tat dem nationalen Aufbruch keinen Abbruch; eher schon der lang andauernde Streit über das Südslawische als Sprachnation. Von kroatischer Seite wurde (und wird) eine solche religions- und dialektübergreifende Gemeinsamkeit – in einzelnen Epochen unterschiedlich stark – abgelehnt. Den Serben gelten die Sprachreform von Vuk Karadžić’ und sein Wörterbuch (1818) als nationale Meilensteine.
Als Pendant auf albanischer Seite kann der Rechtsanwalt Naum Veqilharxhi gesehen werden, der 1844 ein erstes albanisches Alphabet herausgab.46 Die Widerstände gegen seine nationale Bildungsoffensive waren enorm. Sowohl die osmanische Bürokratie, die von Veqilharxhi als Fremdherrschaft stark angegriffen wurde, als auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die ihre Hirtenfunktion für die in der orthodoxen Hierarchie verbliebenen Albaner gefährdet sah, machten gegen den Reformer mobil. Als Verbreitngsverbote seiner in albanischer Sprache verfassten Rundbriefe nichts fruchteten, fiel Veqilharxhi einem Anschlag – mutmaßlich von griechisch-orthodoxer Seite – zum Opfer. Seine Schriften wurden verbrannt, im albanischen Nationalbewusstsein hat er einen prominenten Platz gefunden.
Die politischen Figuren nationaler Bewegungen verlieren in der Rückschau leicht ihre Sympathiewerte, jedenfalls dann, wenn sie mit den Augen des nationalen Gegenübers oder des distanzierten Betrachters gesehen werden. Das eigene Volk wird als groß, sein Siedlungsraum als ein auszudehnender und sein Wesen als historisch und kulturell dem „Anderen“ überlegen dargestellt. Der „Andere“ ist, je nach Lage der historischen Momente im 19. Jahrhundert, der Sultan – und/oder seine Janitscharen –, der Wiener Hof, der russische Zar und natürlich die Nationswerdung der Albaner bzw. Serben.
Auf serbischer Seite gibt Ilije Garašanin ein gutes Beispiel für politischen Nationalismus ab. In seinem „Entwurf“ – „Načertanije“ –, den er 1844 als Innenminister für internen Gebrauch verfasst hatte und der erst viel später, 1906, an die Öffentlichkeit gelangte, denkt er über ein Großserbien nach, das nach dem absehbaren Rückzug der Osmanen an Idee und Territorialität des mittelalterlichen serbischen Königreiches von Stefan Dušan aus dem 14. Jahrhundert anknüpfen soll. „Serbien“, heißt es in diesem „Entwurf“, dürfe sich „nicht auf seine gegenwärtigen Grenzen beschränken“, sondern müsse danach trachten, einer Aufteilung des türkischen Reiches durch Russland und Österreich zuvorzukommen und selbiges in einen „neuen, unabhängigen christlichen Staat verwandeln“.47 Kosovo als „Altserbien“ stellte in diesem Bild Garašanins das Kernstück der auf nationaler Grundlage zu erweiternden Staatlichkeit dar. Diese war indes weniger als Alternative zu einer albanischen Nation oder gar einem albanischen Staat gedacht – dies konnte Garašanin sich 1844 gar nicht vorstellen –, sondern sollte vor allem dem Wiener Großmachtstreben Einhalt gebieten und die südslawische Sache als eine einheitliche betrachten.
Albanisch-nationale Aufrufe wurden historisch erst etwas später auf Papier gedruckt. Die fleißigsten und berühmtesten Verfasser solcher Schriften waren die Brüder Naim und Sami Frashëri, die einer albanischen Adelsfamilie entstammten und der synkretistischen Bektashi-Religion angehörten. Dieser Derwisch-Orden, von Hadschi Bektash Veli im 13. Jahrhundert unter persischem Einfluss gegründet, vereinigt eine Mischung vorchristlicher, christlicher und muslimischer Elemente in sich. Er war damit wie geschaffen für die zum Islam konvertierten Albaner, die als Bektashis die Privilegien im Osmanischen Reich genießen konnten, ohne sich an strikte Glaubensregeln halten zu müssen. In späteren Jahrhunderten fand der Orden, dem ein „Baba“ – Papst (mit derzeitigem Sitz in Tirana) – vorsteht, vor allem unter den Janitscharen Zuspruch.48 In seinem Manifest „Albanien, was es war, was es ist und was es sein wird“, 1899 verfasst, konstruierte Sami Frashëri eine lang zurückreichende historische Identität eines albanischen Urvolkes, der „Pelasger“, deren Nachfahren, die Albaner, in Sprache und Blut deren legitime Erben seien. Sein Volk versteht er als „die älteste Nation Europas“ und sieht es über jede Religionsgrenze hinweg geeint, wenn er schreibt: „(…) es gibt keinen Türken und keinen Giaur (abschätzige Bezeichnung für Christen; HH), alle sind ja Albaner.“49 Der albanische Nationalgedanke richtet sich weniger gegen das Osmanische Reich als gegen die Serben vor allem im Kosovo, denen als Spätansiedler jede Legitimation auf Staatlichkeit abgesprochen wird. Welche Schrecken in der Folge der post-osmanischen Staatenbildungen auf die Völker des Kosovo und des gesamten Balkans zukommen werden, ahnte Frashëri, als er an anderer Stelle notierte: „Unter Nationen gibt es keine Freundschaft. Nationen sind wie Raubfische, die sich gegenseitig auffressen. Weh dem, der schwach ist.“50
Der serbische Aufstand (1804)
Die erste große Erhebung im Osmanischen Reich ging von orthodoxen Serben in der Šumadija südlich von Belgrad aus. Es waren leibeigene Bauern, die sich gegen eine sie erdrückende Janitscharen-Herrschaft zur Wehr setzten. Der Sultan im fernen Konstantinopel hatte die Kontrolle über die nur mehr in die eigene Tasche wirtschaftenden Großgrundbesitzer verloren und versuchte, stärkeren Einfluss im Paschalik rund um Belgrad zu gewinnen. Dafür wich er sogar von einem ehernen osmanischen Gesetz ab, dem zufolge die „Rayah“ – die christliche „Herde“ – keine Waffen tragen durfte. Er ließ die orthodoxen Untertanen in der Hoffnung bewaffnen, damit die Janitscharen loszuwerden und über seinen Statthalter vor Ort, einen osmanischen Pascha, seine eigene Herrschaft stabilisieren zu können.51 Doch es kam anders: Die um ihre Pfründe fürchtenden Großgrundbesitzer ermordeten