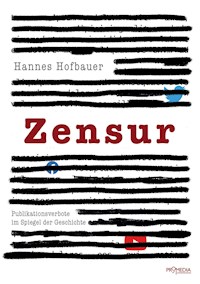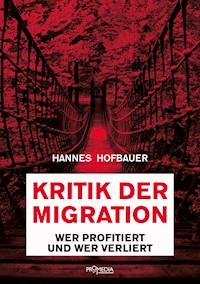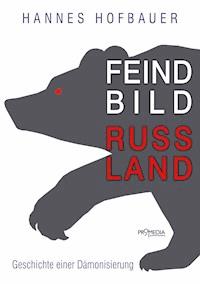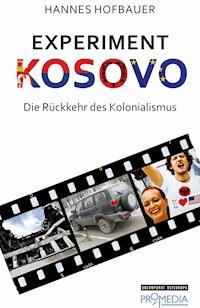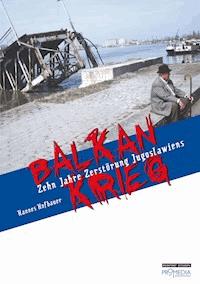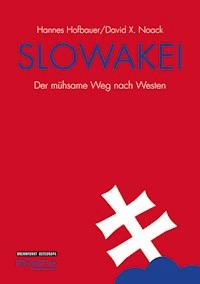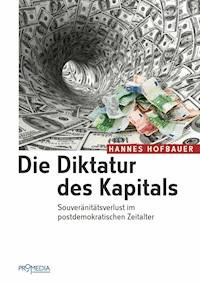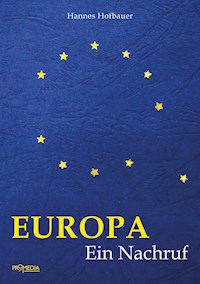
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der herrschende Diskurs erlaubt kein negatives Eigenschaftswort zum Begriff "Europa". Allenthalben wird über mehr Transparenz, bessere Kommunikation und effektivere Verwaltung debattiert. Das Konstrukt der Europäischen Union wird als alternativlos dargestellt; alternativlos als Großraum im weltweiten wirtschaftlichen Konkurrenzkampf ebenso wie als Garant für eine – angeblich – demokratische Wertegemeinschaft. Hannes Hofbauer entlarvt das in Brüssel, Berlin und anderswo gemalte Selbstbild als ideologische Begleiterscheinung ökonomischer Protagonisten, die für ihre Geschäfte einen supranationalen Raum und einen entsprechenden militärischen Flankenschutz brauchen. Und er weist den hegemonial-liberalen Ansatz, wonach eine Infragestellung des "europäischen" Selbstverständnisses quasi automatisch rechts wäre, entschieden zurück. Der Autor verfolgt die Europa-Idee bis ins Hochmittelalter zurück und zeigt, wie die Verschmelzung von Antike und Christentum schon vor 800 Jahren zu einem Drang nach Osten geführt hat. Das Selbstverständnis der Kreuzzüge war weströmisch-europäisch. Auch der Kampf von Herrscherhäusern um Vorherrschaft spielte sich auf dem europäischen Tableau ab. Und die zwei bislang verheerendsten Feldzüge in Richtung Osten, jener Napoleons und jener der Wehrmacht, folgten sehr unterschiedlichen, heute verquer wirkenden Europabildern. Nur wenige Europa-Visionen waren von sozialen Utopie- und Friedensvorstellungen geprägt. Der Großteil des Buches beschäftigt sich mit der Geschichte der EU-europäischen Einigung, die vom Kohle-Stahl-Pakt über die Einheitliche Europäische Akte, Maastricht und den Vertrag von Lissabon bis zu den Zerfallsprozessen unserer Tage reicht. Die vielfachen Warnungen an die Brüsseler Ratsherren, ablehnende Referenden in Frankreich, den Niederlanden, Irland und EU-feindliche Stimmungen in vielen Mitgliedsländern, wurden in den Wind geschlagen. Auch das britische Brexit-Votum im Jahr 2016 stellte keinen Weckruf für die Apologeten der Supranationalität dar. Wie stark die nationalen Fliehkräfte entwickelt sind, zeigt der Umgang mit der Bekämpfung eines Virus, dem sich das abschließende Kapitel widmet. Es ist Zeit, sich Gedanken über eine Welt nach dem Scheitern der Brüsseler Union zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
Hannes HofbauerEuropa. Ein Nachruf
© 2020 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
ISBN: 978-3-85371-883-4(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-475-1)
Fordern Sie unsere Kataloge an:
Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
Hannes Hofbauer, geboren 1955 in Wien, studierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Publizist und Verleger. Im Promedia Verlag ist von ihm u.a. erschienen: »EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökonomische Treibkräfte – soziale Folgen« (2. Auflage 2007) und »Feindbild Russland. Geschichte einer Dämonisierung« (2016).
Vorwort
Mitte März 2020 saß EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrem Brüsseler Büro und musste tatenlos zusehen, wie ein Mitgliedsland nach dem anderen Verordnungen zu Grenzschließungen erließ, ohne diese zuvor auf EU-Ebene abzustimmen. Am tschechischen Grenzübergang České Velenice fuhren Radpanzer auf, im dänischen Pattburg schleppten Baufahrzeuge Barrikaden heran und überall begann man eifrig damit, Menschen nach ihren Staatsbürgerschaften zu sortieren.
Nicht das auf Sars-CoV-2 getaufte Virus war es, das den Offenbarungseid der EU-europäischen Institutionen bewirkte, sondern die einzelstaatlichen, völlig unkoordinierten Maßnahmen dagegen. Dieses Management der 27 – Großbritannien hatte bereits kurz zuvor die Flucht ergriffen – förderte zutage, was Worthülsen wie »europäische Solidarität« und »Weltoffenheit« wert sind, wenn es auf sie ankommt: nichts.
Doch die EU scheitert nicht bloß am Umgang mit einer Seuche, deren Gefährlichkeit auch ein halbes Jahr nach ihrem Auftauchen umstritten ist. Das europäische Einigungsprojekt war von Anfang an nicht als solidarisches und demokratisches gedacht, sondern folgte immer spezifischen wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen. Es ging um die Herstellung eines Großraumes für ökonomische Protagonisten in einem angeblich alternativlosen weltweiten Konkurrenzkampf. Als ideologische Begleiterscheinung dieses Geschäftsmodells wird das Selbstbild einer Wertegemeinschaft gemalt, deren anhaftendes Beiwort »europäisch« etwas erklären soll, das für die meisten BewohnerInnen dieses Raumes keinen Sinn ergibt. Schon die unhinterfragte, auch militärische Einbettung in die transatlantische Allianz macht die Eigenwahrnehmung ihrer Eliten unglaubwürdig. Die Ablösung dieser amerikanisch-europäischen Achse durch den Aufstieg Chinas auf der einen Seite sowie zunehmende regionale und soziale Ungleichheiten auf der anderen Seite beschleunigen den Niedergang der Brüsseler Union.
Ein Blick zurück zeigt, dass Europa-Ideen eine lange historische Tradition aufweisen. Aus der Verschmelzung von Antike und Christentum entsteht im Hochmittelalter die Grundlage eines Europabildes, das in der Folge in den unterschiedlichsten Varianten auftaucht. Die allermeisten Vorstellungen eines solchen »Europa« waren exklusiv, das heißt, die Feindwahrnehmung bildete die entscheidende Gemeinsamkeit und den Zusammenhalt im Inneren. Neben dem Kampf dynastischer Herrscherhäuser um territoriale Erweiterungen, der mit jeweils unterschiedlichen Vorstellungen von Europa legitimiert wurde, verstanden sich die allermeisten Europa-Ideen als Gegenbilder zur muslimischen und zur russischen Welt. Ausnahmen davon waren selten, dafür umso interessanter.
Der Großteil des Buches beschäftigt sich mit der Entwicklung der europäischen Einigungsbestrebungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei wird deutlich, wie sehr die einzelnen Schritte hin zu einem größeren Europa von einer schmalen Schicht vorangetrieben werden, die ausschließlich wirtschaftlichen Interessen folgt. Vom »Komplott« des Kohle-Stahl-Paktes über die Missachtung einer ganzen Reihe von ablehnenden Volksentscheiden bis zur Konstruktion eines EU-»Parlaments«, das nicht einmal über ein gesetzgeberisches Vorschlagsrecht verfügt, steht die Geschichte der Europäischen Union für eine herrschaftliche Einrichtung von oben ohne demokratische Legitimation von unten.
Die Idee Europa faszinierte gleichwohl Menschen und Mächte in unterschiedlichsten Zeitaltern und Formen. Das wird auch nach dem absehbaren Zusammenbruch dieser aktuellen Europäischen Union so sein, weshalb am Ende dieses Buches ein Ausblick auf ein Europa ohne EU gewagt wird.
Mein spezieller Dank gilt den Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich seit Jahren über Sinn und Nutzen der Europäischen Union diskutiere. Insbesondere seit der großen Osterweiterung 2004/2007 habe ich den einen oder die andere mit meiner Beharrlichkeit vielleicht irritiert, wofür ich mich – gerade wegen meiner Beharrlichkeit – aber nicht entschuldigen kann. Ich hoffe, die Debatten dienten der gegenseitigen Bereicherung; für mich war es jedenfalls so. Meiner Erstleserin und Lebensgefährtin Andrea Komlosy sei ein besonderer Dank ausgesprochen. Ohne die Hunderten von Stunden, in denen wir miteinander auf- und abdiskutiert haben, wäre dieses Buch nicht entstanden.
Hannes HofbauerWien, im August 2020
1. Europa: Begriff – Mythos – Erdteil
Dunkelland. So könnte man den Begriff »ereb« bzw. »erp« übersetzen, mit dem die unter assyrischer Herrschaft stehenden Phönizier vor 3000 Jahren jenen Landstrich bezeichneten, in dem die Sonne unterging. Damit erklären Altertumsforscher die etymologischen Wurzeln des Wortes »Europa«. Von den BewohnerInnen der phönizischen Städte Kleinasiens aus betrachtet stand »ereb« für das Land der Finsternis, während »asia« den Osten beschrieb, in dem jeden Tag die Sonne aufging. Den Wortsinn übernahm später das Lateinische mit dem Begriffspaar Okzident und Orient. Auch wir sprechen heute noch im Deutschen vom Abendland in Blickrichtung untergehender Sonne und vom Morgenland im Osten. Konträr zu seinen sprachlichen Wurzeln ist es allerdings gelungen, »Europa« einem Bedeutungswandel zu unterziehen. Heute werden mit dem Begriff Helligkeit und Zukunft assoziiert, als ob die Sonne im Westen aufginge und das Dunkel im Asiatischen läge.
In der griechischen Mythologie, also der die Welt erklärenden Erzählung, kommt »Europa« als Frauengestalt vor, die von Göttervater Zeus, der in Gestalt eines Stiers auftritt, geraubt und geschwängert wird. Hier verbinden sich griechische mit phönizischen Gründungsmythen. Denn die von Zeus entführte Europa war die Tochter (oder Schwester) von Phoinix, dem Stammvater der Phönizier. Zeus zeugte mit ihr auf Kreta drei Söhne. Frauenraub war über Jahrtausende eine gängige Praxis, um die Reproduktionskapazitäten eines Stammes zu stärken. Dass der Raub und das anschließende Schwängern der Europa in der Literatur und auf bildlichen Darstellungen (Europa und der Stier) seit der griechischen Antike fast durchwegs als dynamisch und glücksbringend dargestellt wird, zeugt von der seit damals dominanten patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Man könnte die mythologische Figur der Europa aber auch als eine von der stärksten Macht, dem Göttervater, verschleppte und vergewaltigte Frau zeichnen. Dies ergäbe – schon von der Altertumserzählung her – ein anderes Europabild.
Wo Europa geographisch zu verorten ist, änderte sich im Zeitenlauf stark. Einem Bericht des Geschichtsschreibers Herodot aus dem 5. Jahrhundert v. u. Z. verdanken wir die vielleicht erste konkrete Territorialisierung. Herodot berichtet über einen Streit zwischen Perserkönig Xerxes und seinem Ratgeber und Onkel Artabanos. Letzterer will im Jahr 480 v. u. Z. einen persischen Feldzug gegen die Griechen verhindern, weil er große Verluste befürchtet, und warnt Xerxes: »Mein König! Es ist billig, daß ich Dir sage, was ich von dem Krieg befürchte. Den Hellespontos willst du überbrücken und das Heer durch Europa nach Hellas führen.«1 In dieser Quelle taucht Europa als Landstrich zwischen den Dardanellen (Hellespontos) und Griechenland (Hellas) auf. Tatsächlich war »Europós« damals als Bezeichnung für zwei Städte in Makedonien sowie einen Fluss in Thessalien in Gebrauch,2 während Herodot nur 30 Jahre später in seiner um 445 v. u. Z. erschienenen Landkarte die Welt in drei großen Blöcken zeichnete: Europa, Asia, Libya, wobei letzteres für damals bekannte afrikanische Gebiete steht.
Als Grenze zwischen Europa und Asia nimmt Herodot den Fluss Tanaïs (Don) sowie das Asowsche Meer an, fragt sich aber zugleich, wozu es überhaupt nötig sei, »drei Erdteile Libya, Asia und Europa zu unterscheiden«.3 Die Frage, wo Europa in Hinblick auf die eurasische Landmasse aufhört und wo Asien beginnt, treibt seit dem Altertum nicht nur Geographen um. Ein Blick auf die heutige Weltkarte könnte einem ob der aktuellen wirtschafts- und geopolitischen Verschiebungen zu der Ansicht verleiten, Europa wäre auch geographisch gesehen nur ein »Vorgebirge des asiatischen Kontinents« bzw. »eine Halbinsel Asiens«, wie der französische Philosoph Paul Valéry anmerkte.
Die Neuzeit hatte der Grenzziehung zwischen Europa und Asien, wie sie von Herodot vorgenommen wurde, nichts Wesentliches hinzuzufügen. Der bekannte kaiserliche Diplomat Sigismund von Herberstein vermerkte zur Mitte des 16. Jahrhunderts: »Tanais oder Don ist ein namhafftiger bekandter fluß, welcher Europam von Asia absünderet.«4 Das Russland östlich davon zählte Herberstein zu Asien. Erst im 18. Jahrhundert einigten sich westeuropäische und russische Experten auf Gebirge und Fluss Ural als Ostgrenze Europas, wobei bis heute der genaue Verlauf nicht zuletzt aufgrund von Achsenverschiebungen des Gebirges umstritten ist. Eine allgemein anerkannte Grenzlinie fehlt auch im Kaukasus zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Landvermesser kommen heutzutage auf 10,5 Millionen Quadratkilometer Land, die sie zu Europa rechnen.
Mit seiner Begriffsbestimmung und territorialen Festlegung hat der Erdteil für uns allerdings noch keine Bedeutung gewonnen. Was macht Europa aus? Wer bedient sich seiner? Und warum scheitern Europapläne immer wieder? Solchen Fragen wollen wir uns in diesem Buch widmen und hoffen, damit der vorherrschend apologetischen Debatte ein wenig historische Wirklichkeit und notwendige Nüchternheit entgegensetzen zu können. Denn es ist sicher nicht ausreichend, Europa als Teil des Zivilisationsprozesses zu definieren, wie es Norbert Elias vorgeschlagen hat.5 Eine solche Wahrnehmung läuft auch Gefahr, ein Europabild weiterzutragen, das sich Jahrhunderte lang als ein den Orientalen und den Barbaren zivilisierendes Projekt verstanden hat, um damit seinen expansiven Drang zu legitimieren. Seit der Kolonisierung Amerikas im 16. Jahrhundert hatte sich Europas Präsenz in der Welt in Form von Forts und Stützpunkten manifestiert, mit denen Handelsnetze über ganze Weltregionen gesponnen wurden.6 Europäisierung galt damals als Kontrolle der Schifffahrt und des Handels, Einwanderung weißer Abenteurer und Siedler mit dem nicht seltenen Effekt der Ausrottung einheimischer Bevölkerungen. Zugleich sorgte Kapitalexport aus den europäischen Zentralräumen Spaniens, Portugals, den Niederlanden, Frankreichs und Großbritanniens für Normierungen im wirtschaftlichen, rechtlichen und später kulturellen Bereich.
Vor diesem Hintergrund können wir uns nicht damit zufrieden geben, Europa dort zu sehen, »wo Menschen von Europa reden und schreiben, wo Menschen Europa malen oder in Stein meißeln, oder anders ausgedrückt, wo Menschen Europa imaginieren und visualisieren …«, wie der Historiker Wolfgang Schmale schreibt.7 Derlei postmoderne Zuschreibung hat zwar den Vorteil, dass sich jede und jeder sein Bild von Europa selbst anfertigen kann, einer allgemeinen, kollektiven Erkenntnis ist damit jedoch nicht gedient.
Demgegenüber stellt der Kultursoziologe Wolfgang Geier trocken fest: »Europa war in der Vergangenheit und ist in der Gegenwart als ›Einheit‹, als Ganzes, ein ›imaginärer Kontinent‹, eine Utopie oder Vision, eine in vielen Ausformungen erscheinende Antizipation eines möglicherweise gar nicht erreichbaren Zustandes«.8 Und die Wiener Historikerin Andrea Komlosy beantwortet die Frage, wo Europas Identität geistesgeschichtlich gefunden werden kann, mit der radikalen Feststellung: »Eine (…) Kontinuitätslinie stellt die Tatsache dar, dass Europa niemals eine politische oder kulturelle Einheit dargestellt hatte. Gleichwohl war die Vielfalt von Staaten und Kulturregionen, die sich als europäisch verstanden, stets mit dem Anspruch einzelner Teilregionen konfrontiert, als Pars pro Toto zu definieren, was als ›Europa‹ bzw. ›europäisch‹ zu gelten habe.«9 Im Umkehrschluss wird damit auch klar, was bzw. wer – je nach Zeitpunkt – als nicht-europäisch galt: Barbaren, Heiden, orthodoxe Christen, Muslime, Kommunisten, Nationalisten etc.
In Europa prallen seit alters her unterschiedliche Hemisphären aufeinander, mögen sie religiös, politisch oder ökonomisch inspiriert sein. Wie zu keinem anderen Kontinent gehören zu Europa Trennungen und Teilungen, die über Jahrhunderte in Kriegen, Friedensschlüssen, Verträgen und wieder Kriegen zum Ausdruck kommen. Auch heute wieder scheitert solch ein Vertrag an der Wirklichkeit. Die Europäische Union kann ihren europäischen Anspruch nicht erfüllen.
1 Herodot, Historien, Deutsche Gesamtausgabe, Buch VII. Stuttgart 1971
2 Wolfgang Schmale, Geschichte Europas. Wien-Köln-Weimar 2001, S. 21
3 Herodot, zit. in: Wolfgang Geier, Europabilder. Begriffe, Ideen, Projekte aus 2500 Jahren. Wien 2009, S. 8
4 Sigismund von Herberstein, Rerum moscoviticarum commentarii (erschienen 1567), zit. in: John Hale, Die Kultur der Renaissance in Europa. München 1994, S. 39
5 Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bern 1969
6 Andrea Komlosy, Europa und seine Grenzen, in: Thomas Ertl/Andrea Komlosy/Hans-Jürgen Puhle (Hg.), Europa als Weltregion. Zentrum, Modell oder Provinz? Wien 2014, S. 18
7 Schmale, S. 14
8 Geier 2009, S. 10
9 Komlosy 2014, S. 30
2. Die Vorgeschichte
Europas ideologisches Substrat: Die Verschmelzung von Antike und Christentum
Griechisches Altertum und Christianisierung sind die beiden Grundpfeiler, auf denen europäisches Sein und Bewusstsein errichtet wurden. Römisches Rechtsempfinden und ein universalistisches Weltbild entpuppten sich als wesentliche Zutaten. Ihr hegemonialer Anspruch begründete den expansiven Charakter des Europäertums.
»Die Griechen erfanden die Freiheit des Einzelnen«, definiert der Historiker Rolf Hellmut Foerster den Ursprung der europäischen Identität und setzt fort: »Der Schritt von verschleiertem Allgefühl zum klaren Weltbewußtsein ließ einen neuen Begriff vom Menschen entstehen. (…) Hier wurzelt unsere Wissenschaft, unsere Philosophie und folglich auch unser Staatsdenken.«10 Der antike griechische (eleutheria) und römische (libertas) Begriff von Freiheit hat mit seiner modernen Verwendung indes wenig zu tun. Im Weltbild von Aristoteles (350 v. u. Z.) war es in philosophischer Hinsicht die Freiheit des Denkens, die gemeint war, und politisch gesehen die Freiheit, »die staatliche Gewalt unter die Bürger des Landes aufzuteilen«, wie es Benjamin Constant schon 1819 beschrieben hat.11 Aus dieser proto-demokratischen Haltung speist sich, rückblickend, die Idee von einer griechisch-europäischen Identität.
Die große Mehrheit der Bevölkerung in der griechischen Antike konnte von Freiheit nicht einmal träumen. Wie das Verhältnis zwischen freien Bürgern und Sklaven war, lässt sich aufgrund fehlender systematischer Volkszählungen schwer schätzen. Einzig in der bevölkerungsreichen Region Attika gab es im 4. Jahrhundert unter Demetrios von Phaleron eine statistische Erhebung. Aus dieser geht hervor, dass dort 21.000 Bürger und 400.000 Sklaven lebten.12 Die antike Gesellschaft der griechischen Stadtstaaten zeichnete sich durch eine extreme soziale Differenz aus, was ihrer Inanspruchnahme als Ursprung europäischer Werte keinen Abbruch tat.
Es war die kulturelle Hegemonie über Küstenstriche, die Götterverehrung beispielsweise im Apollo-Kult, die über ganz Griechenland hinweg gemeinschaftsbildend wirkte. Sie äußerte sich ebenso in Pilgerfahrten nach Delphi. Foerster sieht in diesen kultischen Versammlungen Vorläufer von Bünden wie dem Attischen Seebund oder dem Peloponnesischen Bund, die zwischen den einzelnen Stadtstaaten Verträge schlossen und damit erste »europäische« Verbindungen darstellten.
Im Städtebund der pyläisch-delphischen Amphiktyonie waren seit dem 8. Jahrhundert v. u. Z. nicht zufällig zwölf Stämme zusammengeschlossen, galt doch die Zahl 12 den Griechen als heilig; so existierten zwölf olympische Götter und Herkules musste zwölf Aufgaben erfüllen, um den Mord an seiner Frau und drei Kindern zu sühnen. Im Laufe der Zeit erweiterte sich der Bund auf 30 Mitgliedsstaaten, die sich – dies war der heiligen Zahl geschuldet – die zwölf Stimmen auf gemeinsamen Versammlungen teilen mussten. Ob über 2000 Jahre später in Brüssel der Verantwortliche daran dachte, als er einem Grafikbüro die Aufgabe erteilte, eine Fahne für die Europäische Gemeinschaft zu entwerfen?
Die christlichen Wurzeln haben sich tief ins europäische Sein und Bewusstsein gegraben. Galten den Griechen des Altertums in erster Linie die Perser als Feinde, die sie ihr eigenes, später als europäisch interpretiertes Selbstbild prägen ließen, so betrachtete das christliche Europa die Muslime als entscheidendes Gegenbild. In vorislamischer Zeit dienten noch (germanische) Barbaren bzw. der Kampf gegen diese der christlichen Selbstfindung. Die Zerstörung Roms durch das Gotenheer Alarichs im Jahr 410, dem sich Hundertschaften von entlaufenen Sklaven anschlossen, hinterließ eine traumatisierte frühchristliche Gesellschaft, die sich in Selbstzweifeln aufzugeben drohte. Es war der lateinische Kirchenmann Augustinus (354−430) mit seinem Monumentalwerk »De civitate Dei« (»Über den Gottesstaat«), der der Christenheit wieder Mut einflößte. Augustinus entwickelte einen göttlichen Heilsplan zur Wiedererrichtung eines christlichen Roms und rettete damit – laut Foerster – die Idee Europa, die freilich erst in der Neuzeit als solche auftauchte.13 Augustinus’ Schrift gegen den Untergang, in der er auch den notwendigen, gottgefälligen Krieg preist, gilt seit damals als früh-europäischer Schlüsseltext. Das darin bestimmende christliche Element wurde also erst nachträglich in ein europäisches umgedeutet.
Parallel zu dem seit dem 7. Jahrhundert einsetzenden, wahrlich epochalen christlich-muslimischen Kulturkampf spaltete sich die Christenheit in zwei Lager. Rom und Byzanz/Konstantinopel standen sich bald feindlich gegenüber. Es entstand eine innereuropäische »›Antemurale Christianitatis‹ (Vormauer der Christenheit, d. A.) zwischen dem fränkisch-germanischen, römisch-katholischen ›Westen‹ auf der einen und dem überwiegend süd- und ostslawischen, griechisch-orthodoxen ›Osten‹« auf der anderen Seite.14 Das große Morgenländische Schisma von 1054, das der (west)römische Papst Leo IX. durch die Exkommunikation seines oströmischen Rivalen Michael I. Kerularios in die Wege leitete, vollzog die innerchristliche Scheidelinie formal – sie ist bis heute in Kraft. Nach der Plünderung Konstantinopels durch katholische Kreuzfahrer im Jahr 1204 wartet die Ostkirche bis heute auf eine Entschuldigung Roms. Patriarch Bartolomeos I. forderte eine solche 800 Jahre später anlässlich einer Einladung zum Gedenken an die massenmörderische Tragödie im Festsaal der Wiener Akademie der Wissenschaften. Eine Antwort bekam er nicht, nahm doch sein katholischer Gegenspieler, Papst Johannes Paul II., an der von der kirchlichen Arbeitsgemeinschaft Pro Oriente ausgerichteten Konferenz nicht teil.15
Ein bis in unsere Tage betriebener Europa-Mythos ist mit dem fränkischen König und späterem römisch-deutschen Kaiser Karl (dem Großen) verbunden. In der Geschichtswissenschaft kursiert über seine Wirkungsmacht eine eigene, sogenannte Translationstheorie. Der zufolge ging mit der Krönung Karls zu Weihnachten des Jahres 800 das byzantinische Kaisertum auf den Franken über, womit die Grundlage für das Heilige Römische Reich (später: deutscher Nation) geschaffen worden sei. Dieses bis 1806 bestehende Imperium gilt vielen als historisch bedeutendste Ausprägung einer europäischen Idee, weil seine Staaten-übergreifende Klammer sich als Vorbild für die Europäische Union interpretieren lässt.
Tatsächlich schlitterte der Frankenkönig Karl mitten hinein in eine innerrömische Intrige, von einer Belebung des (römischen) Reichsgedankens oder einer abendländischen Einheit, die ihm Generationen von nachgeborenen Europäern unterstellen, wollte er nichts wissen. Die Geschichte begab sich so: Papst Leo III. hatte Streit mit einem kirchlichen Rivalen, der Rom bürgerkriegsähnliche Zustände bescherte. Um den Rivalen auszuschalten bzw. wegen welcher Delikte auch immer schuldig sprechen zu können, bedurfte es eines kaiserlichen Schiedsspruchs. Doch der Kaiser saß in Byzanz und der Bosporus war weit weg, zudem herrschten winterliche Verhältnisse, die es nicht erlaubten, einen Sendboten in den Osten zu schicken. Also bat Papst Leo III. seinen damaligen Schutzherrn Karl nach Rom, lockte ihn in den Dom und krönte ihn zum Kaiser. Karl versicherte anschließend, dass er nicht in die Kirche eingetreten wäre, hätte er von dem Vorhaben gewusst.16 Papst Leo III. bekam seinen Schiedsspruch und wurde seinen Widersacher los – während Karl nicht zum Schöpfer eines gesamteuropäischen Reiches aufstieg. Im Gegenteil: In weiten Teilen Europas herrschten um das Jahr 800 anarchische Zustände; Spanien, England und Schottland spürten von der Macht des Kaisers ebenso wenig wie Polen, Skandinavien oder Ungarn. Im Jahr 814 erstreckte sich der Fränkische Reich im Westen bis Nantes, im Süden bis Rom und umschloss im Osten Bayern.
Umso verwunderlicher ist es, dass es ausgerechnet jener Karl ist, der dem wichtigsten und renommiertesten Preis »für die europäische Einigung« seinen Namen gibt. Der Karlspreis wird seit 1950 in Aachen vergeben, sein erster Preisträger war der alt-österreichische Adelige Richard Coudenhove-Kalergi (für seine Idee einer paneuropäischen Union; den Adelstitel hatten seine brabantinischen Vorfahren pikanterweise für die Teilnahme am Kreuzzug 1099 erhalten), es folgten u. a. 1952 Alcide De Gasperi (für den italienischen Einsatz zur Gründung der NATO), 1957 Paul Henri Spaak (für das Zustandebringen der Staatengemeinschaft Benelux), 1958 Robert Schuman (für die Gründung der Montanunion), 1963 Edward Heath (für die britischen Beitrittsverhandlungen), 1987 Henry Kissinger (für sein Verdienst um die Entspannungspolitik, zu der die Ausweitung des Vietnam-Krieges und der Putsch gegen Chiles Präsidenten Salvador Allende gehörten), 1988 François Mitterrand und Helmut Kohl (für die deutsch-französische Zusammenarbeit), 1991 Václav Havel (für die Verdienste um das Ende der kommunistischen Herrschaft in der Tschechoslowakei), 1995 Franz Vranitzky (für das Zustandekommen des EU-Beitritts Österreichs), 2000 Bill Clinton (offiziell für das Lancieren der irischen Friedensgespräche, inoffiziell für den Krieg gegen Jugoslawien), 2002 Wim Duisenberg als persönlicher Vertreter des »Euro« (für die Herstellung einer gemeinsamen Währung), 2006 Jean-Claude Juncker (für sein EU-europäisches Engagement), 2018 Emmanuel Macron (für seine Neubegründung des europäischen Projektes, wo immer die Jury ein solches gesehen haben mag).
Karl dem Großen wird jedenfalls bei jeder dieser Verleihungen Unrecht getan, erst seine Instrumentalisierung durch spätere Europabegeisterte auf ihrer Suche nach europäischen Ursprüngen machte ihn zum »Pater Europae«.
Ähnlich erging es den ottonischen Nachfolgern auf dem Kaiserstuhl. Ihre gewaltsam betriebene Christenmission der Slawen und Ungarn verliehen Otto I. (936−973) und Otto III. (980−1002) lange nach deren Tod »europäische« Würden. »Mit dem Sieg am Lechfeld«, schreibt der Historiker Michael Gehler in Anspielung auf die blutige Auseinandersetzung mit dem ungarischen Heer im Jahr 955, »der Slawenmissionierung und der Übernahme der Königsmacht in Oberitalien bekam sein (Ottos, d. A.) Königreich europäische und imperiale Züge.«17 Tatsächlich handelte es sich bei dem für die weitere Geschichte des Kontinents entscheidenden Kriegsgang um eine Konsolidierung Westeuropas, um eine apostolische Mission. Denn der ungarische Heerführer Bulscú war ein christlich getaufter »Patricius« des (ost)römischen Reiches, versehen mit byzantinischen Insignien. Auf dem Lechfeld standen sich also die lateinische und die griechische Welt im Herzen des europäischen Kontinents gegenüber. Otto I. ließ den besiegten Bulcsú unmittelbar nach dem Ende der Schlacht aufhängen, um ihn symbolhaft und weithin sichtbar seiner aus Byzanz mitgebrachten christlichen Heilkraft, die die Taufe mit sich bringt, zu berauben.18 Die Ungarn wechselten daraufhin ins römisch-katholische System. Diese »Heimholung« byzantinisch-orthodox getaufter Christen unter die Fittiche des römischen Papstes wiederholte sich in der späteren Geschichte übrigens immer dann, wenn orthodoxe Gläubige durch territoriale Machtausdehnung in ein weströmisches Umfeld gelangten.19 Die griechisch-katholischen Unierungen seit dem 16. Jahrhundert erfassten weite Teile Osteuropas.
Der bekannte polnische Historiker Oskar Halecki nimmt die Zeitenwende des Jahres 1000 in den europäischen Blick und stellt fest, dass neben der Unabhängigkeit Polens das »neubekehrte Ungarn« sowie die »Bekehrung zum Christentum der drei skandinavischen Königreiche zu selbstständigen Mitgliedern der europäischen Gemeinschaft« die großen Zäsuren jener Tage waren, die als »Enddatum im Aufbau Europas angesehen werden« können.20 Mit dem Begriff des »neubekehrten Ungarn« wird die ausschließliche Anerkennung einer europäischen Identität als eine (west)römische unterstrichen. In Byzanz Getaufte galten schon in der Schlacht am Lechfeld 955 nicht als wahre Christen, wurden 1054 im Zuge des großen Schismas exkommuniziert und während des Kreuzzugs 1204 massakriert. Die Konstruktion des europäischen Selbstverständnisses als ein exklusiv weströmisches, dessen Zentrum sich über die Jahrhunderte von Rom weg oftmals verlagert hatte und aktuell in Brüssel festgemacht werden kann, hat sich seither nicht substanziell verändert. Wir erinnern uns noch an den Fall des Eisernen Vorhanges, der von Politik und Medien im Westen unter dem Stichwort »Rückkehr nach Europa« abgefeiert wurde. Diese euphorisch gebrauchte Wortsentenz, die das Ende der kommunistischen Epoche im Osten des Kontinents beschrieb, stieß sich nicht daran, dass die Rückkehr der osteuropäischen Länder historisch streng genommen eine in die vorkommunistischen Zeiten war, also in die Zeit der Herrschaft von deutschem Nationalsozialismus, italienischem Faschismus und deren osteuropäischen Handlangerregierungen. Dies war mit dem Bild der Rückkehr freilich nicht gemeint, man hatte damit länger Gültiges, Universelles im Sinn, auch wenn dies auf die partikulare Situation in Osteuropa niemals zutraf: die Zugehörigkeit zu einem vom Westen dominierten Europa, dessen Wurzeln in der Verschmelzung von Antike und weströmischem Christentum liegt.
Tätiges Christentum: Die Kreuzzüge
Im mittelalterlichen Kreuzzugsgedanken fand sich eine erste, weite Teile Europas umfassende Bewegung wieder. Kreuzzüge waren, so sieht es die vorherrschende Geschichtswissenschaft, europäische, ja kosmopolitische Unterfangen.21 Zeitgenossen bezeichneten sie als Expeditionen (»expeditio«) oder Pilgerfahrten (»peregrinatio«). Sie waren anfangs sehr beliebt, Zehntausende Christen aus Italien, Frankreich, Spanien und deutschsprachigen Ländern schlossen sich ihnen an. Als Initialzündung für den ersten großen Kreuzzug gilt die Eroberung Jerusalems durch turksprachige Seldschuken im Jahre 1077. Die den Christen heilige Stadt befand sich zwar bereits seit dem 7. Jahrhundert in muslimischen Händen, gegen Ende des 11. Jahrhunderts wurden die Stimmen zur Befreiung Jerusalems allerdings lauter. Dies war auch darauf zurückzuführen, dass mit der Seldschuken-Herrschaft die bis dahin üblichen christlichen Pilgerfahrten immer gefährlicher wurden und Berichte über Schikanen und todbringende Übergriffe zunahmen. Solche Pilgerfahrten nach Jerusalem waren das gesamte Frühmittelalter hindurch ein einträgliches Geschäft für Handelsunternehmen aus Venedig und anderen italienischen Stadtstaaten gewesen. Nun drohten die Seldschuken diesem Wirtschaftszweig den Garaus zu machen.
Der päpstliche Aufruf von Urban II. zur ersten »expeditio«, zum ersten Kreuzzug im Jahr 1095 war also nicht nur gottgewollt, sondern hatte auch wirtschaftliche Hintergründe. Und mehr als das: zunehmende Landknappheit im Westen Europas stellte vor allem die jüngeren Söhne von Adelsfamilien vor das Problem, kein adäquates Einkommen und damit Auskommen erwirtschaften zu können. Im Heiligen Land entlang der Levante erhoffte man sich neuen Besitz und erlangte gleichzeitig per päpstlichem Beschluss Ablass für alle Sünden. Die Rechnung sollte – vorerst – aufgehen. Wirtschaftlich in Europa zu kurz gekommene Adelssprösslinge gründeten eine Reihe von Kreuzfahrerstaaten im moslemischen Morgenland. Keiner von ihnen erlebte seinen 200. Gründungstag.
Was die Kreuzfahrerei als europäische Bewegung auszeichnet, ist neben ihrer »internationalen« Teilnehmerschar und dem ökonomischen Antrieb auch eine besondere postulierte Gemeinsamkeit. Diese kommt in der Losung Papst Urbans II., mit der er zum Sturm auf das Heilige Land rief, zum Ausdruck: »Kein Christ streite mehr wider den anderen«, verkündete Gottes Stimme auf Erden im Jahr 1095, »damit das Christentum selbst nicht untergehe. (…) Es höre auf Mord und Feindschaft und Bedrückung.«22
Zwischen 1096, als das erste Ritterheer den päpstlichen Aufruf in die Tat umsetzte, und 1272 fanden sieben große Kreuzzüge statt, weitere kleinere folgten bis Ende des 14. Jahrhunderts.23 Sie wirkten über weite Strecken einigend auf die zerstrittenen europäischen Fürstenhäuser, konnten Kriegsgänge untereinander gleichwohl nicht verhindern. Kaiserliche, englische und französische Heere ritten gegen die Ungläubigen, konnten sich aber meist nicht auf ein gemeinsames Kommando einigen. Über zwei Jahrhunderte verwüsteten sie immer wieder ganze Landstriche im Nahen Osten, meuchelten die dortige muslimische Bevölkerung und scheuten im 4. Kreuzzug (1202−1204) auch nicht davor zurück, das christliche Konstantinopel in Schutt und Asche zu legen, weil die Glaubensbrüder und -schwestern aus dem Osten dem Papst in Rom als Häretiker galten.
Einzelne Theologen wie der Würzburger Gerhoch von Reichersberg übten schon damals Kritik an den gewalttätigen Vormärschen der Ritterheere, indem sie sich auf Bibelzitate z. B. aus dem Matthäusevangelium beriefen.24 Dort wird demjenigen, der das Schwert zuerst zieht, prophezeit, dass er durch das Schwert sterben werde. Päpste und Kreuzzugsteilnehmer ließen sich davon nicht beirren. Und auch in späterer Zeit mündete die Beschäftigung mit den Kreuzzügen in der westeuropäischen Historiographie kaum je in eine fundamentale Ablehnung. Vielmehr überwog bis ins 19. Jahrhundert die Ansicht, es handelte sich, trotz (oder vielleicht auch wegen) des expansiven Charakters um eine erste gemeinsame »europäische« Angelegenheit: den Kampf gegen den Islam. Einer der bekanntesten Kulturhistoriker des 19. Jahrhunderts, Jacob Burckhardt, brachte 600 Jahre nach all den päpstlich gedeckten Massakern diese Sicht auf den Punkt: »Der Kreuzzug vollendet das Gefühl eines gemeinsamen okzidentalischen Lebens.«25
Die Hochblüte der Kreuzzüge war längst vorüber, als im Jahre 1306 die Schrift »De recuperatione terrae sanctae« (»Über die Wiedergewinnung des Heiligen Landes«) erschien. Verfasser war der engste juristische Berater des französischen Königs Philipp IV. (des Schönen), Pierre Dubois (ca. 1255−1321). In Reaktion auf den 7. Kreuzzug und einem Massaker an muslimischen Händlern hatten die Mameluken zwischen 1289 und 1291 das libanesische Tripoli und das palästinensische Akkon erobert, womit das »europäische«, christliche Abenteuer im Nahen Osten beendet schien. Innenpolitisch stieß man sich in Frankreich Anfang des 14. Jahrhunderts an der Allmacht des Papstes, die sich erst vor wenigen Jahrzehnten herausgebildet hatte; zuvor gab es bischöfliche Versammlungen und Synoden, die eine Art demokratische Grundstruktur für Gottes Vertretung auf Erden darstellten. Pierre Dubois beschrieb beide Ursachen der grassierenden Unzufriedenheit, die Niederlage der katholischen Kreuzfahrer im Nahen Osten und die sich aufplusternde päpstliche Herrschaft, in seiner aus 142 Paragraphen bestehenden Flugschrift. Darin schlug er einen Zusammenschluss der (west)europäischen Reiche und Fürstenstaaten zu einem einzigen Staat vor. »Jede vereinte Kraft«, so der französische Scholastiker, »ist stärker als dieselbe Kraft im Zustand der Zerstreuung. Deshalb wäre es gut, wenn unter allen Katholiken (…) der Friede dadurch gesichert würde, dass sie sich gleichsam zu einem einzigen Staat zusammenschließen.«26 Konkret wandte sich Dubois gegen das Heilige Römische Reich (Sacrum Imperium), dessen Krone zu jener Zeit Albrecht I. von Habsburg trug. Statt des dort üblichen Systems der Königswahl, das Dubois für ineffektiv und untragbar hielt, forderte er die Installierung einer Erbmonarchie. Dubois trat ferner für eine großräumige »Welt«wirtschaft ein und einen stärkeren Handel mit dem Orient. Sein eigentliches Ziel einer geeinten Christenheit – gemeint als Katholiken – verband er mit dem Kreuzzugsgedanken. So sollte jeder am »europäischen Völkerverein« beteiligte Fürst eine ständige Truppenpräsenz in Palästina bereitstellen. Und jeder europäischen Nation wäre nach dem Plan Dubois’ ein ihrer Stärke entsprechendes Gebiet im Heiligen Land zugewiesen worden; wobei sich der Berater des französischen Königs für Jerusalem und Akkon eine gemeinsame Verwaltung vorstellte.27
Pierre Dubois im Wortlaut: »Zur Wiederbelebung und Behauptung des Heiligen Landes muß eine gewaltige Kriegsschar aufgeboten werden. Wenn so viele Menschen dorthin ziehen und dort bleiben wollen, wird es notwendig sein, daß die katholischen Fürsten in Eintracht leben und keine Kriege gegeneinander führen. (…) Um den Frieden zu sichern, soll der Papst ein Konzil sämtlicher Könige und Fürsten einberufen, das die Leitung aller Staatsgeschäfte in Händen hat. Der Krieg zwischen christlichen Staaten ist verboten.«28
Ein Auszug wie dieser lässt unschwer erkennen, warum Dubois bei aktuellen Rezeptionen und Anthologien über Europabilder nicht fehlen darf und was ihm darin einen so prominenten wie beliebten Platz verschafft: Europa als friedliches Projekt nach innen, dessen Einheit durch Aggression nach außen hergestellt wird. Realpolitisch ging es Dubois darum, die vorhandene Macht des französischen Königs weiter zu stärken. Dieser sollte der von ihm angedachten Delegiertenversammlung der Fürsten vorstehen. Den Papst wies er die Rolle als Schiedsrichter bei Meinungsverschiedenheiten zu. Oder anders gesagt: Dubois’ »Europa« war gegen die Institution des »Heiligen Römischen Reiches« gerichtet, in dem die Habsburger noch nicht die spätere Führungsrolle gepachtet hatten, und es sollte die aufsteigende Macht des Papstes bremsen. So gesehen erscheint seine Schrift über die Wiedergewinnung des Heiligen Landes nicht ein Entwurf einer föderativen Verbindung europäischer Mächte, wie er in der einschlägigen Geschichtswissenschaft heute dargestellt wird, sondern ein Werkzeug zur Legitimierung der Macht für Philipp den Schönen gewesen zu sein. Verwirklicht wurde all das nicht. Im Gegenteil: Philipp wurde von Papst Bonifatius VIII. exkommuniziert, worauf sich dieser mit einem Attentatsversuch revanchierte. Auf der Flucht vor Philipps Schergen starb Bonifatius, nachdem er den Habsburger Albrecht I. in dessen Funktion als Reichskönig um Hilfe angefleht hatte. Papst-Nachfolger Benedikt XI. starb nach nur wenigen Monaten im Amt an einer Vergiftung, die ihm mutmaßlich der Franzosenkönig Philipp zufügen ließ. Im Zuge dessen gelang es Philipp auch, die Residenz des nächsten, ihm nun ergebenen Papstes nach Avignon zu verlegen. So sah Europa zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Wirklichkeit aus.
Von einer weltumspannenden Monarchie träumte auch der florentinische Dichter und Denker Dante Alighieri (1265−1321). Eine solche Herrschaftsform konnte damals freilich nur »europäisch« gedacht werden. Anders als sein Zeitgenosse Dubois gründete Dantes Sehnsucht nach der Wiederherstellung des (römischen) Kaiserreichs nicht in der Idee, die stärkste westliche Macht auf dem Kontinent, Frankreich, in den Mittelpunkt zu stellen. Das war verständlich, galten doch zu jener Zeit die französischen Könige aus dem Hause Anjou im südlichen Italien als Fremdherrscher. Dantes Vision eines einheitlichen Staatsgebildes richtete sich dementsprechend gegen den französischen Herrschaftsanspruch. In den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die Ende des 13. Jahrhunderts in oberitalienischen Städten tobten, kämpfte er anfangs auf der Seite der eher papsttreuen Guelfen (gegen die kaisertreuen Ghibellinen), um sich bald einer Splittergruppe anzuschließen, die sich immer mehr Fraktionen zum Feind machte. Dantes Flucht aus Florenz folgte die Konfiskation seines Besitzes und 1302 die Verhängung der Todesstrafe, derentwegen er sein restliches Leben im Exil verbrachte.
Für den modernen Europaforscher sind Dantes Schriften insofern von Interesse, als darin erstmals der Konflikt zwischen Kaiser und Papst, der schon seit dem Investiturstreit des 11. Jahrhunderts brodelte, zur politischen Kraftprobe wurde.29 Die Aufgabe des Papstes sah der mittelalterliche Philosoph darin, so viele Menschen wie möglich zum ewigen Leben, zum Paradies, zu führen, während der weltliche Herrscher für das irdische Glück des Menschengeschlechts zuständig sei. Diese Ansätze eines Dualismus, die viel später in der Trennung von Kirche und Staat ihre Erfüllung gefunden haben, werden als konstitutiv für das (westliche) Europabild gesehen. Auf politisch-gesellschaftlicher Ebene setzte sich das System der zweigeteilten Herrschaft von Fürst und Ständen durch und letztlich in der Gewaltentrennung des bürgerlichen Parlamentarismus fort.
Die Eroberung Konstantinopels durch das osmanische Heer Sultan Mehmeds II. im Jahr 1453 löste Schockwellen bis an den Atlantik aus. Sie war zugleich der Auftakt für eine bislang nie dagewesene Europa-Identität unter führenden Intellektuellen. Einer von ihnen, der Priester, Dichter und Historiker Enea Silvio Piccolomini (1405−1464) warf sich diesbezüglich besonders ins Zeug. Mit seiner »Türkenrede« auf dem Frankfurter Reichstag 1454, den er als kaiserlicher Kommissar leitete, nahm er die Bedrohung aus dem Osten zum Anlass, um zum gerechten, europäischen Krieg gegen die Ungläubigen aufzurufen: »Wenn wir die Wahrheit gestehen sollen«, so Piccolomini, »hat die Christenheit seit vielen Jahrhunderten keine größere Schmach erlebt als jetzt. (…) Denn in früheren Zeiten sind wir nur in Asien und Afrika, also in fremden Ländern, geschlagen worden, jetzt aber wurden wir in Europa, also in unserem Vaterland, in unserem eigenen Haus, aufs schwerste getroffen. (…) Niemand dürfte daran zweifeln, wie ihr euch verhalten werdet, ihr edlen Deutschen, wenn ihr diesen Krieg übernehmt, zu dem der Kaiser uns ermahnt, um den der Papst uns bittet, den Christus uns befiehlt, zur Verherrlichung und in der Liebe zu ihm.«30
Es ist ein Aufruf zum Krieg als einer explizit europäischen Angelegenheit, dem Kaiser und dem Papst geschuldet, in der Liebe zu Christus. Piccolomini nutzte die Gunst der Stunde, um sich in Szene zu setzen. Einen neuen Kreuzzug brachte er schlussendlich nicht zustande, für seine Wahl zum Papst im Jahre 1458 reichte sein Engagement gegen die Türken allemal. Als Pius II. trat er in die Fußstapfen von Apostel Petrus. Als Gelehrter hatte er sich schon zuvor einen Namen und um den Europabegriff verdient gemacht. »Europa« hieß das unter seiner Federführung entstandene ethnographisch-kosmographische Hauptwerk, das auf den Band »Asien« folgte. Es war die einzige Schrift des Mittelalters, die mit der Titelzeile »Europa« erschien und es dementsprechend kultur-religiös definierte.31
Der Historiker und Europaforscher Rolf Hellmut Foerster wertet die berühmte Türkenrede Piccolominis als defensiv. »Man muß«, schrieb Foerster 1963, »in diesem Aufruf zum Kreuzzug nicht den Plan einer Aggression, sondern eines Verteidigungsaktes sehen.«32 Dieses im christlichen Westen gängige Narrativ sieht in der Eroberung von Konstantinopel durch die muslimische Soldateska korrekterweise eine die Christenwelt bedrohende Aggression, die es abzuwehren gilt. Ein tiefergehender historischer Rückblick zeigt allerdings, dass die Geschichte der Kreuzzüge ab 1096 einen expansiven Charakter aufweist. Und seit der 4. Kreuzzug 1204 mit der Zerstörung des damals christlichen, allerdings oströmischen Konstantinopels endete, kann eigentlich von einer Verteidigung des Christentums als europäische Aufgabe im Osten nicht mehr gesprochen werden.
Sein antitürkisches Abenteuer endet für Papst Pius II. elendiglich. Mitte Juni 1464 schifft er sich in Ancona ein, um seinen zehn Jahre zuvor gepredigten Kreuzzug zu starten. Allein, außer einer Handvoll heruntergekommener Abenteurer will ihm niemand folgen. Am 15. August 1464 stirbt der verhinderte Kreuzfahrer Piccolomini/Papst Pius II. auf seinem Schiff auf dem Weg zwischen Venedig und Istrien. Zuvor hatte er noch eine zweite »europäische« Front aufgemacht, nämlich jene gegen die tschechischen Hussiten, also eine mitten in Europa als ungläubig definierte frühreformatorische Bewegung. Mit Georg von Podiebrad (1420−1471) erwuchs dem Papst ein mächtiger Gegenspieler, der es ebenfalls verstand, auf die europäische Karte zu setzen.
Podiebrad stammt aus mährischem Adel und wandte sich in jungen Jahren von der katholischen Kirche ab, um dem tschechischen Reformer Jan Hus zu folgen. Als sogenannter Ultraquist gehörte er dem gemäßigten hussitischen Flügel an, der gegen die sozial radikaleren Taboriten zu Felde zog und diese besiegte. Die ultraquistische Ständemehrheit wählte Georg von Podiebrad im Jahr 1458 zum König von Böhmen. Seine religiöse Gesinnung rief sogleich den Papst von Rom, Pius II, auf den Plan. Schon die husstische Symbolik des Kelches, aus dem alle Gläubigen und nicht nur der Priester das Blut Christi in Gestalt des Weines trinken sollten, zeugt von der kirchenreformerischen Idee, die für den römischen Katholizismus mit seiner hierarchischen Struktur inakzeptabel war (und bis heute ist). Folgerichtig drohte Rom mit einem Kirchenbann, dem der Böhmenkönig angeblich mit einer heimlichen Rückkehr in den Schoß der römischen Kirche zuvorkommen wollte.33 Der Order des Papstes, zwecks Abbitte nach Rom zu reisen, entsprach Podiebrad nicht.
Stattdessen entwickelte er seinerseits die Idee eines Kreuzzuges gegen die »furchtbaren Mohammedaner«, um sich als wahrer Christ zu inszenieren. Und diese Idee ergänzte er mit einem europäischen Föderationsplan, der heute als Vorläufer von immer wieder auftauchenden Einigungsprozessen gilt. In 21 Kapiteln entwarf Podiebrad die Idee für einen Bund gleichberechtigter Fürsten, in dem alle fünf Jahre der Vorsitz wechseln, ein gemeinsamer Gerichtshof innereuropäische Streitigkeiten beilegen und ein Finanzierungstopf für föderative Organe aufgelegt werden sollte. Geplant war – wie auch bei seinem Gegenspieler Papst Pius II. – eine christlich-»europäische« Armee. Sein Plan fand anfangs Zuspruch beim polnischen König Wladimir IV., Albrecht von Brandenburg und dem reichsten italienischen Stadtstaat Venedig. Letzterer sprang jedoch bald ab, als sich der finanzschwache Vatikan erholte und seinerseits zu einem Kreuzzug aufrief. Alaun-Funde auf dem Territorium des Gottesstaates waren dafür mitverantwortlich, weil die Gewinnung dieses Rohstoffes zur Färbung von Wolle plötzlich die Kassen Roms füllte.
Podiebrads Vorhaben scheiterte; und nach dem Tod von Papst Pius II. wurde er von dessen Nachfolger exkommuniziert. Für uns ist dabei von Interesse, wie durchsichtig die europäischen Einigungsideen des Mittelalters, in diesem Fall jene parallel von Pius II. und dem Böhmenkönig Podiebrad entwickelten, als Mittel zum Zweck für die Erweiterung des jeweils eigenen Machtbereiches eingesetzt wurden. Dieser Instrumentalisierung werden wir auch in der Neuzeit und bis herauf in unsere Tage begegnen.
Europas Herrscherhäuser im Kampf um die Vorherrschaft
Der von Maximilien de Béthune, genannt Herzog von Sully (1560−1641), um das Jahr 1632 verfasste und vielfach kopierte und veränderte »Große Plan« (»Grand Dessin«) ist so eine Machtvision. Sully war Marschall von Frankreich und enger Berater des französischen Königs Henri IV. Hinter seiner Idee eines europäischen Staatenbundes stand der Wunsch des Hofes im Palais du Louvre, eine Allianz gegen die immer mächtiger werdenden Habsburger, die in Spanien und Österreich herrschten, zu schmieden. Der deutsche Historiker Michael Gehler nennt den »Großen Plan« eine Mystifikation.34
Schon seine Entstehungsgeschichte zeigt, welchem Unbill sich nachgeborene europäische Spurensucher auszusetzen haben. Das »Grand Dessin« erschien 22 Jahre nach dem Tod von Henry IV. und gilt als dessen Vermächtnis an die Welt, an Europa. Für die Veröffentlichung der endgültigen Fassung verstrichen nochmals mehr als 100 Jahre, bis sie ein Abbé de L’Écluse 1745 drucken ließ. Ausgangspunkt für Sullys Vorstellung einer europäischen Zukunft war – wie konnte es anders sein – ein Kriegsprojekt, oder besser gesagt: sogar zwei von Franzosenkönig Henry IV. angedachte Waffengänge: einen gegen die habsburgischen Niederlande und einen gegen das Osmanische Reich. Letzterer wird von der Geschichtswissenschaft als unseriöses Gerücht bezeichnet, stand doch Paris Anfang des 17. Jahrhunderts in gutem Einvernehmen mit dem Sultan. Dies auch deshalb, weil die Hauptstoßrichtung der französischen »Europa«-Pläne gegen Wien und Madrid zielte.
Im »Grand Dessin« wird ein Bündnis aus 15 christlichen Staaten, sogenannten Dominiationen, herbeiphantasiert, in dem u. a. die Erbmonarchien Frankreich, England und Dänemark, der päpstliche Gottesstaat, die Königreiche von Ungarn und Polen sowie die vier Republiken Schweiz, Niederlande, Venedig und Neapel-Sizilien vereint hätten werden sollen. Aus den mitteleuropäischen Besitzungen der Habsburger würden sich die am Projekt Sully beteiligen Staaten territorial bedienen (z. B. hätte die Schweiz Tirol bekommen) bzw. wären drei neue Fürstentümer entstanden. Auch war ein »Europa-Rat« vorgesehen, in den die Teilnehmer je nach eigener Größe zwei bis vier Kommissare entsenden sollten. Sully schreibt in seinem großen Wurf von einer »sehr christlichen Republik«, wobei sein Republikbegriff nicht antimonarchistisch gedacht war.
Sullys mitten im 30-jährigen Krieg verfasster Plan zur Neugestaltung Europas schloss das türkische Osmanenreich definitiv aus und sah auch für das russische Zarenreich keinen Platz vor. Zu Russland ist bei ihm zu lesen: »Dieses ungeheure Land (…) wird z. T. noch von Götzendienern bewohnt, z. T. auch von schismatischen Griechen und Armeniern, deren Gottesdienst mit tausenderlei abergläubischen Gebräuchen vermischt ist, und mit dem unsrigen eben deshalb sehr wenig Ähnlichkeit hat.«35 Die Geschichte ging über diesen französischen Europa-Plan hinweg; am 24. Oktober 1648 wurde in Münster und Osnabrück der Westfälische Friede geschlossen, der das europäische Staatensystem ohne einen »Großen Plan« bis zur Französischen Revolution weitgehend prägte. Dem nach langen Kriegsjahrzehnten in Münster und Osnabrück vereinbarten Frieden lag ein Konsensprinzip zugrunde, das an die Stelle der Berufung auf eine christliche Gemeinsamkeit trat.36
Was Europapläne des 17. Jahrhunderts betrifft, so kann der Philosoph, Mathematiker und Historiker Gottfried Wilhelm Leibniz (1646−1716) in gewisser Weise als das deutsche Gegenstück zu Herzog von Sully gesehen werden. Auch Leibniz stand – als dafür Spätgeborener – noch unter dem Eindruck des weite Teile Europas verheerenden 30-jährigen Krieges. Seine Friedensidee ging von der Zähmung französischer Expansionsgelüste aus und wollte auch die Macht der Habsburger in die Schranken weisen. Europas innere Befriedung sollte durch ein starkes, kraftvolles, vereintes Deutschland erfolgen. Sein Plan trägt den sperrigen Titel »Bedenken, welchergestalt Securitas publica interna et externa und Status praesens im Reich jetzigen Umständen nach auf festen Fuß zu stellen«. Erschienen ist die Schrift 1670 im Auftrag des kurfürstlich-mainzischen Rates. Ihr Ziel war die Überwindung der deutschen Kleinstaaterei zwecks Etablierung eines deutschen Reichsbundes. Und wieder stoßen wir auf aggressive Expansionsstrategien, die Streit und Krieg zwischen den christlich-europäischen Fürsten verhindern sollen. Der vielleicht letzte Universalgelehrte Leibniz schlägt in dankenswerter Offenheit den einzelnen europäischen Herrscherhäusern vor, ihre Energien und Aggressionen nach außen zu wenden; und er wird sehr konkret dabei: der Habsburger Kaiser, Polen und Schweden möchten gegen die Türken kämpfen (was mehr als ein Jahrzehnt später dann tatsächlich passierte); England und Dänemark könnten Erweiterungen in Nordamerika in Angriff nehmen; Spanien dasselbe in Südamerika betreiben; für Holland wäre eine Expansion nach Indien hilfreich und Frankreich könne die Levante und Ägypten »zivilisieren«. »Hierbei würde unsterblicher Ruhm, ruhiges Gewissen, applausus universalis, gewisser Sieg, unaussprechlicher Nutzen sein«,37 lobpreist der Gelehrte seinen Plan.
Das Besondere am Leibniz’schen Europagedanken ist, dass er unbedingt auch das zaristische Russland mit einbinden will. Dieses soll gefälligst seine Kraft gegen die Tataren wenden und Streit und Hader innerhalb der christlichen Welt vermeiden. Hier schwingt eine seltene Akzeptanz der orthodoxen Christenwelt mit, der Leibniz im europäischen Expansionsreigen einen speziellen Platz zuweist. Die Idee der Einheit des Christentums nicht bloß als weströmische zeichnet den Gelehrten aus.
Am ausführlichsten beschrieben hat Leibniz den sogenannten »Ägyptischen Plan«. Damit will er Frankreichs Kriegslust gegen seine Nachbarn, beispielsweise einen bevorstehenden Überfall auf Holland, nach dem osmanisch beherrschten Nordafrika ablenken. Dafür reist der Leipziger Aufklärer extra nach Paris, um König Ludwig XIV. (1683−1715) von seinem Vorhaben gegen Holland abzubringen. Den fertigen Plan für den Feldzug gegen Ägypten hat er in der Tasche, und schreibt, dass es zwischen 30.000 und 50.000 Soldaten brauche, um das Land, das kaum Befestigungen und dafür leicht einnehmbare Häfen habe, zu überrennen. Auch an eine mögliche militärische Hürde dachte Leibniz, nämlich das osmanische Heer. Dies sei aber derzeit, so will er den französischen König beruhigen, mit Angriffsplänen gegen Polen beschäftigt. Frankreich hätte also freie Bahn in Ägypten und, so der schlaue Zusatzgedanke, würde dort auch indirekt holländische Expansionsgelüste in Ostasien behindern können. Denn von Ägypten sei der Weg für Frankreich nach Osten offen.38 Den »Ägyptischen Plan« hat Ludwig XIV. nie zu Gesicht bekommen. Anstatt Ludwig XIV. traf Leibniz mit dem russischen Zaren Peter I. (dem Großen) zusammen. In ihm sah er jenen Mann, der Russland zivilisieren und für die Teilnahme an einem aufgeklärten Europa vorbereiten könne.
Leibniz’ Image als Europa-Vordenker hat darob über die Jahrhunderte allerdings nicht gelitten. Auch deshalb, weil er seinen »Ägyptischen Plan« als den letzten Krieg bezeichnet, nach dem jeder Streit innerhalb Europas zu Ende wäre und ein Tausendjähriges Reich heraufzöge, in dem Maschinen menschliche Fähigkeiten verstärken, Krankheiten besiegt würden und eine christliche Sittenlehre universelle Gültigkeit hätte. Geopolitisch stellte sich Leibniz sein Europa folgendermaßen vor: »Das Reich ist das Hauptglied. Deutschland das Mittel von Europa (…), wie anfangs Griechenland, hernach Italien.«39
Napoleons Europa: Durch Expansion zur Einheit
Die Französische Revolution des Jahres 1789 wurde ihrem Namen gerecht: revolvere, umdrehen, das Untere nach oben spülen, die Verhältnisse auf den Kopf stellen, im sozialen Sinn genauso wie in Fragen der politischen Herrschaft. Sie war die Antithese zu allen vorher erdachten Europavisionen. Von einer herbeigewünschten »christlichen Einheit« konnte keine Rede mehr sein; das Prunkstück der französischen Gotteshäuser, die allerchristlichste Notre Dame de Paris, diente als Lagerhalle für Lebensmittel und Waffen; und selbst den auf Jesu Geburt datierten Kalender ersetzte man durch eine neue Zeitzählung. Der selbstherrliche Sonnenkönig Ludwig XVI. starb unter der Guillotine, die Volkssouveränität trat an seine Stelle. Der Begriff Europa kam in den revolutionären Texten nicht vor, stattdessen berauschte sich das Volk am nationalen Hochgefühl, die absolutistische, ausbeuterische Schreckensherrschaft der Monarchie abgeschüttelt zu haben. Dass man selbst bald daran ging, mit der Guillotine auch Fraktionskämpfe auszutragen, blieb der Nachwelt als Grausamkeit in Erinnerung.
Die revolutionäre Friedensidee unterschied sich entscheidend von der vorrevolutionären, die den inneren Frieden nur durch die Bezwingung eines äußeren Feindes denken konnte. »Ich glaube«, meinte der jakobinische Revolutionär Maximilien de Robespierre in einer seiner Ansprachen an die französische Nationalversammlung am 15. Mai 1790, »daß ihr lieber den Frieden wahrt, als euch in einen Krieg einzulassen, dessen Gründe ihr nicht kennt.«40 Er forderte das Volk auf, sich nicht für fürstliche Erweiterungspläne abschlachten zu lassen, mit welchen Argumenten auch immer sie vorbereitet, ausgerufen und geführt werden.
Demokratie und Menschenrechte – freilich nur gültig für Männer in Frankreich und nicht in den Kolonien – waren die Leitlinien der modernen Verfassung, wie sie 1791 in der Nationalversammlung festgelegt wurden und bis heute als »europäisch« definiert werden, ohne allerdings damals diesen Anspruch gehabt zu haben. Es sollte nicht lange dauern, bis beide nichts mehr wert waren. Postrevolutionäre Fraktionskämpfe nehmen schaurige Ausmaße an. Das sogenannte Direktorium, die letzte Regierungsform der Französischen Revolution, putscht am 27. Juli 1794 gegen die parlamentarische Versammlung, weist die Forderung nach sozialer Gleichheit zurück und beendet damit die radikale Phase der Revolution. Ein 24-jähriger Korse, der kurz zuvor in revolutionären Diensten die von England unterstützten Royalisten in Toulon geschlagen hatte, rückt im Oktober 1795 gegen Aufständische in den Pariser Vororten aus und lässt sie zusammenschießen. Napoléon Bonapartes Aufstieg beginnt.41
In den späten 1790er-Jahren trieb er oft schlecht ausgebildete Soldatenhaufen in Feldzüge gegen Italien und Ägypten; seine Motivationskraft bescherte ihm Ruhm und Ehre in Militärkreisen. Am 9. November 1799 erklärt sich Napoléon zum Ersten Konsul und die Revolution für beendet. Fünf Jahre später krönt er sich selbst in Paris zum Kaiser. In Austerlitz schlägt er 1805 die österreichischen Habsburger (bereits zum zweiten Mal), erleidet allerdings im selben Jahr eine Niederlage gegen die englische Flotte bei Trafalgar. Nun verhängt der Selbstherrscher die Kontinentalsperre gegen England, das erste große Handelsembargo der neuzeitlichen Geschichte. England soll mit wirtschaftlichem Boykott ruiniert werden. Als sich Zar Alexander I. diesem Embargo nicht anschließen will, marschiert Napoléon am 24. Juni 1812 mit einer halben Million Soldaten in Russland ein. Der Rest ist Niederlage: vor Moskau und nahe Waterloo.
Warum uns diese Eroberungszüge des kleinen Korsen, die ihm zwischenzeitlich allerlei Königs- und Fürstentitel eingetragen und im Jahr 1806 auch zum Ende des Heiligen Römischen Reiches geführt hatten, im Zusammenhang mit Europabildern interessiert? Weil Napoléon seine multiplen europäischen Kriegsgänge am Ende seines Lebens, als Gefangener auf St. Helena, als großen Plan zur Föderalisierung Europas dargestellt hat. »Es war unser Ziel«, schrieb er im Nachhinein bzw. ließ er schreiben, »ein großes europäisches Föderationssystem zu schaffen. (…) Um es zu vervollkommnen und ihm die größtmögliche Ausdehnung und Stabilität zu geben, haben wir die Errichtung einiger innenpolitischer Institutionen befohlen, die besonders geeignet waren, die Freiheit der Bürger zu schützen.«42 Und an anderer Stelle liest sich sein Lieblingsplan einer europäischen Föderation folgendermaßen: »Europa (…) würde auf diese Art bald wahrhaft nur ein Volk gebildet haben, und jeder würde auf seinen Reisen überall sich in einem gemeinschaftlichen Vaterland befunden haben.«43 Der Russland-Feldzug, so versicherte Napoléon, würde die letzte militärische Aktion gewesen sein. Dann hätte er gemeinsame Maßeinheiten, ein allgemein gültiges Gesetzbuch, den Code civil, ein europäisches Münzwesen sowie ein einheitliches Steuer- und Finanzwesen eingeführt. Hätte er in Russland gesiegt, so sein heute zynisch anmutender Kommentar aus der Gefangenschaft, dann wäre ein »Europa freier Völker« entstanden. »Einer meiner großen Gedanken«, so spinnt er ihn weiter, »war die Verschmelzung und Konzentration aller Völker, die geografisch zu einer Nation gehören und durch Revolution oder durch die Politik zerstückelt worden waren.«44 Dieser imaginierten europäischen Nation rechnete er 30 Millionen Franzosen, 15 Millionen Spanier, 15 Millionen Italiener und 30 Millionen Deutsche zu. Dazu musste er, wie er ohne jeden Ansatz von Selbstkritik schreibt, »Europa mit den Waffen zähmen (…).« Und weiter: »Ich habe Frankreich und Europa neue Ideen eingepflanzt, die (…) Europa durch unauflösliche Föderativbande wiedervereinen, überall in der Welt, wo heute Barbaren wohnen, wovon Wohltaten des Christentums und der Zivilisation verkünden: darauf müssen alle Gedanken meines Sohnes gerichtet sein, das ist die Sache, für die ich als Märtyrer sterbe.«45