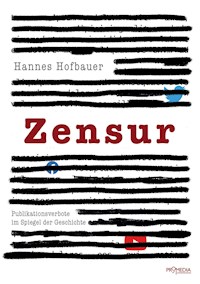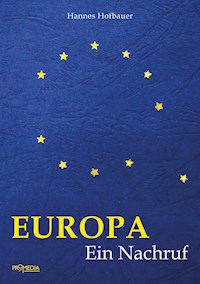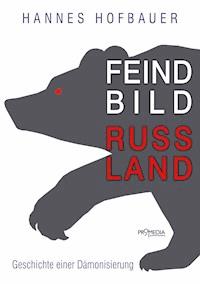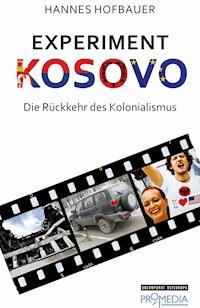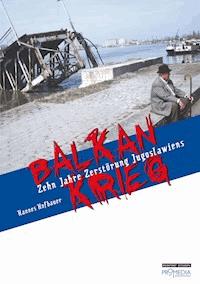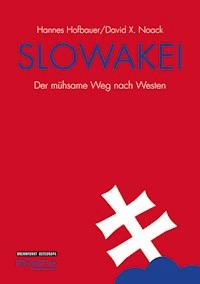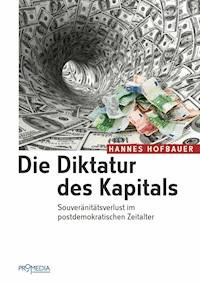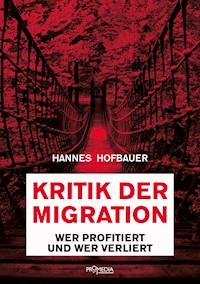
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ist Migration grundsätzlich zu bejahen? Oder ist sie nicht vielmehr ein wichtiger Bestandteil von Ausbeutungsstrukturen? Die Näherin in einer bengalischen Bekleidungsfabrik erfüllt jedenfalls vergleichbare Funktionen im weltweiten Konkurrenzkampf wie der aus Asien nach Europa gekommene Migrant. Beide sind gezwungen, ihre Arbeitskraft extrem billig auf den Markt zu werfen. Doch während sich die Öffentlichkeit darüber einig ist, Weltmarktfabriken in Billiglohnländern zu kritisieren, umgibt den Import billiger ArbeiterInnen in die Zentren der Weltwirtschaft ein Mythos von Mobilität, die als fortschrittlich gilt. Das sozial, regional und kulturell zerstörerische Potenzial der Migration in den Herkunfts- und Zielländern gerät damit aus dem Blickfeld. Hannes Hofbauer gibt einen historischen Überblick über die großen Wanderungsbewegungen und ruft die Ursachen dafür in Erinnerung, die von Umweltkatastrophen über Kriege bis zu Krisen reichen, von denen die allermeisten menschlichen Eingriffen geschuldet sind. So zeichnen allein von westlichen Allianzen geführte Kriege für Millionen entwurzelte Menschen verantwortlich, die ebenso ihrer Lebensgrundlagen beraubt sind wie jene, die von ihrem Land vertrieben werden. Diesen Verwerfungen ist es geschuldet, dass ganze Generationen junger Menschen im globalen Süden, aber auch im Osten Europas ihre persönliche Zukunft in der Emigration sehen. Mit der Massenmigration aus der Peripherie werden die Folgen der weltweiten Ungleichheit nun auch in den europäischen Zentralräumen – negativ – spürbar. Deregulierungen am Arbeits- und Wohnungsmarkt erreichen neue Dimensionen. Eine politische Antwort darauf scheint nur die Rechte zu haben, indem sie statt einer notwendigen Kritik an der Migration die Migranten zu Sündenböcken macht. Die Linke hingegen sträubt sich, den strukturell zerstörerischen Charakter von Wanderungsbewegungen zu erkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Ähnliche
Hannes HofbauerKritik der Migration
© 2018 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
ISBN: 978-3-85371-864-3
(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-441-6)
Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
Hannes Hofbauer, geboren 1955 in Wien, studierte Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien und arbeitet als Publizist und Verleger. Im Promedia Verlag sind von ihm u.a. erschienen: »EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökonomische Triebkräfte – soziale Folgen« (2008), »Die Diktatur des Kapitals. Souveränitätsverlust im postdemokratischen Zeitalter« (2014, 2. Auflage 2015) und »Feindbild Russland. Geschichte einer Dämonisierung« (2016, 5. Auflage 2017).
Vorwort
Es war das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem »i«, als die Chefin der deutschen Regierung, Angela Merkel, unter aufmunternden Zurufen aus Unternehmer- und Kirchenkreisen im Hochsommer 2015 die Migrationsschleuse für Muslime aus dem Nahen Osten öffnete. Das Kapital hoffte auf billige Arbeitskräfte und die Kirchen lieferten das ideologische Beiwerk der Menschlichkeit. Einem kritischen Beobachter fiel sofort auf, dass an dieser Inszenierung etwas nicht stimmen konnte.
Die Not von Kriegsflüchtlingen wurde im europäischen Zentralraum der Wirtschaft zum Nutzen und dem Gewissen zur Beruhigung angeboten. Mit diesem genialen Schachzug gelang es, die Diskussion über die auslösenden Faktoren für Migration sowie ihren zerstörerischen Charakter für die Herkunftsländer, aber auch die Zielländer der Auswandernden zu verdecken.
Die medial und politisch dominierende Darstellung von Migration als Zeichen von Weltoffenheit und Diversität prallt allerdings zunehmend auf die Wirklichkeit der gesellschaftlichen und politischen Kosten. Weil eine strukturelle sozioökonomische Kritik an Mobilität insgesamt – mit Ausnahme ökologischer Ansätze, die allerdings in der Migrationsfrage nicht vorkommen – fehlt bzw. bewusst hintertrieben wird, konnte die politische Rechte an ihrer Stelle das Opfer der weltweit zunehmenden ungleichen Entwicklung, den Migranten bzw. die Migrantin, zum Sündenbock stempeln. Sie befeuert damit einen rassistischen Diskurs.
Die politische Linke wiederum schwankt zwischen Schockstarre und der Übernahme liberaler Postulate. In diesen wird Migration, getreu ihrer Verwertbarkeit und in multikultureller Blauäugigkeit, zu einem nicht hinterfragbaren positiven Bekenntnis. Die ihr zugrunde liegende weltweite Ungleichheit bleibt ausgeblendet bzw. wird dem karitativen Denken untergeordnet. Damit verstellt der einzelne, von Krieg, Krise oder Umweltzerstörung gezeichnete Migrant den Blick auf die Funktion von Migration. Tatsächlich bildet diese den Schlussstein im Mosaik globalistischer Interventionen, deren wirtschaftliche und/oder militärische Ausgriffe Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage entziehen. An die Abfolge Schießen-Flüchten-Helfen und ihre ständige Wiederkehr haben sich nicht nur die Zyniker dieser Welt bereits gewöhnt. Sie zu durchbrechen, hat sich der vorliegende Text zur Aufgabe gemacht.
Wer es moralisch und politisch verwerflich findet, dass bengalische Näherinnen in einsturzgefährdeten Fabriken zusammengepfercht um einen Hungerlohn für den Weltmarkt roboten, kann den ständigen Import von Menschen aus dem »globalen Süden« in die Zentralräume dieser Welt nicht positiv konnotieren. Zu sehr ähneln einander die Auslagerung von Arbeitsplätzen an Billiglohnstandorte und die Masseneinwanderung entwurzelter Arbeitskräfte in den »globalen Norden« in ihrer Ausbeutungsstruktur.
Migration war immer. Eine Bedingung menschlichen Lebens, wie es uns die neue Migrationsforschung weismachen will, ist sie allerdings nicht. Von grenzüberschreitenden Wanderungen waren in den vergangenen Jahrzehnten jährlich zwischen 0,6% und 0,9% der Weltbevölkerung betroffen. Die Norm ist der Sesshafte.
Um Struktur und Funktion aktueller Migrationsbewegungen besser einschätzen zu können, ist ein Blick in die Geschichte hilfreich. Die Zerstörung von Lebensgrundlagen, Kriege und Vertreibungen sowie Umweltkatastrophen gehören seit Jahrhunderten zu den entscheidenden Ursachen für Wanderungen. Die meisten von ihnen sind von Menschen gemacht und Ausfluss ökonomischer und/oder geopolitischer Interessen. Wir verfolgen die Migrationsgeschichte zurück bis zur weißen/schwarzen Besiedelung Amerikas, dem mutmaßlich langwierigsten und brutalsten Migrationsgeschehen, betrachten in weiterer Folge die europäischen Arbeitswanderungen des 18. und 19. Jahrhunderts, beschäftigen uns mit den Flucht- und Zwangsarbeiterregimen der beiden Weltkriege, den »Gastarbeiter«-Wellen seit den späten 1950er-Jahren und der Mobilisierung von OsteuropäerInnen im Gefolge von politischen Zusammenbrüchen und Jugoslawienkrieg in den 1990er-Jahren, um mit einem Befund der großen Wanderung der Muslime zur Mitte der 2010er-Jahre zu enden.
In einem weiteren Schwerpunkt widmet sich das Buch den gesellschaftlichen Auswirkungen von Migration sowohl in den Herkunfts- als auch in den Zielländern der ein (besseres) Überleben Suchenden. Dabei stehen insbesondere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verwerfungen im Fokus.
Die Entstehung des Buches wäre ohne jahrelange Vorarbeiten zu Themenkreisen ungleicher regionaler und sozialer Entwicklung nicht möglich gewesen. Dass sich diese unter dem Titel »Kritik der Migration« bündeln, ist nicht zuletzt der Brisanz und Bedeutung des Wanderungsgeschehens geschuldet, das zunehmend auch die Gesellschaften der Europäischen Union erfasst. Speziell zu danken habe ich meiner Lebensgefährtin Andrea Komlosy und insbesondere deren Arbeiten zum Thema Grenze, die mich als einer ihrer ersten Leser für das vorliegende Buch inspiriert haben. Sehr gut getan hat dem Buch vor seiner Drucklegung dann noch der detektivische Blick des Lektors Stefan Kraft, dem Fehler und Ungereimtheiten zum Opfer fielen.
Hannes HofbauerWien, im August 2018
Zur Begrifflichkeit
Wer im Deutschen Wörterbuch der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm den Begriff Migration sucht, wird diesen, wenig verwunderlich, nicht finden. Lateinische Bezeichnungen haben dort nichts verloren. Das Wort »Wanderung« hingegen gibt einige beredte Hinweise, worum es auch im vorliegenden Buch gehen wird. »Der alte wanderungstrieb und kriegerische unternehmungsgeist setzte sich zugleich religiöse zwecke«,1 wird der große deutsche Historiker Leopold von Ranke in Grimm’scher Kleinschreibweise zitiert. Krieg als zwangsweise Mobilisierung stellt über die Jahrhunderte eine der Hauptantriebskräfte von Migration dar. Krieg treibt Menschen in die Flucht. Die Erwähnung von »religiösen Zwecken« weist auf kultische Ursprünge von Massenwanderungen hin, die in unseren religiösen Breiten als Pilgerreisen bekannt sind.
Mit Adalbert Stifter nahmen die Nachfolger der Brüder Grimm einen bekannten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts zum Stichwort »Wanderung« in ihr Wörterbuch auf. Der Romantiker erinnert an ein im europäischen Westen seit dem Mittelalter auftretendes Wanderungsphänomen, wenn er schreibt: »er hatte dann von seinem vater das handwerk gelernt, ist auf wanderung gegangen und ist endlich wieder zurückgekehrt.«2 Hunderttausende zogen zur Schulung in die Fremde, um ihre gewerblichen Fähigkeiten durch externe Impulse zu verbessern. Diese Art der freiwilligen, von Lernbegierde und persönlicher Neugier getriebenen Migration war auf Handwerker beschränkt. Sie benötigten dafür eigene passähnliche Genehmigungen, die sogenannten Wanderbücher oder Kundschaften, die ihnen von den Zünften ausgestellt wurden. Das Stifter’sche »endlich wieder zurück« kann als für die Mitte des 19. Jahrhundert typisch verklärender Blick auf Heimat interpretiert werden, die als Hort sozialer Sicherheit angesehen wurde; es zeigt aber zugleich auch, dass Wandern bzw. Migrieren nicht als Dauerlösung betrachtet wurde, sondern als ein zeitlich begrenzter Zustand, den es letztlich mit der Heimkehr zu überwinden galt.
In dieselbe Kerbe schlägt auch Johann Wolfgang von Goethe, den das Grimm’sche Wörterbuch aus seiner IphigenieaufTauris schreiben lässt: »Du stießest mich vielleicht, eh’ zu den Meinen frohe Rückkehr mir und meiner Wanderung Ende zugedacht ist, dem Elend zu.«3 Dieser Satz atmet die allermeisten auch der aktuellen Migrantenschicksale. Ausgestoßen bzw. ausgezogen, um in der Ferne bessere Chancen zu finden, die dereinst eine frohe bzw. finanziell ertragreiche Rückkehr sichern sollten, findet sich der Ausgewanderte stattdessen im Elend wieder. Versprechungen von Millionen Menschen auf ein besseres Leben in der Fremde endeten als persönliches Scheitern, das der Umgebung nicht eingestanden wird. Die entsprechenden negativen gesellschaftlichen Auswirkungen bleiben indes unübersehbar.
Das heute gebräuchliche Wort Migration wurzelt im lateinischen »migrare«, wandern. Im Duden des Jahres 1987 kommt es ausschließlich als »Wanderung (der Zugvögel)«4 vor, während 15 Jahre später dem Duden zufolge auch bereits der Mensch migriert. Dort ist unter dem Stichwort Migration »Biol., Soziolog., Wanderung«5 vermerkt.
Wir beschäftigen uns mit der menschlichen Wanderung. Eine allgemeingültige Definition, welche Bewegungen damit gemeint sind, gibt es nicht. Deswegen blühen in der einschlägigen Literatur alle möglichen (und unmöglichen) Typen von Migration, die neben der räumlichen auch die soziale Mobilität und zeitliche Faktoren als solche beschreiben. Lehrbuchhaft umfassend sind die unterschiedlichen Klassifikationen u.a. bei Felicitas Hillmann6 dargestellt, die Migrierende nach Distanz, Richtung, Dauer und Frequenz der Wanderungen unterscheidet, auch den Grad der Freiwilligkeit zu bestimmen versucht und die Gründe in ökonomische, soziale, politische, kulturelle und religiöse unterteilt. Wenn sie an anderer Stelle Migration allgemein als »gelebte Geographie« definiert, so klingt das im ersten Moment interessant, weist aber bereits in Richtung einer kritikwürdigen Auffassung, die Migranten als wirtschaftliche und/oder geopolitische Verschubmasse versteht.
Im neoklassisch-ökonomistischen Diskurs7 werden »Wanderungsbewegungen als Reaktion auf räumliche Ungleichgewichte« affirmativ gesehen, mehr noch: In dieser Wahrnehmung braucht es ständige Migration, um soziale Unterschiede auszugleichen. »Ähnlich wie Kapital auf der Suche nach profitablen Investitionsmöglichkeiten sollen Menschen auf der Suche nach besseren Verdienstmöglichkeiten regionale und internationale Arbitrageprozesse in Gang setzen und so zur regionalen und internationalen Integration beitragen.«8 Migration wird hier als unabdingbar notwendige Mobilität dargestellt, die überhaupt erst die unterschiedlichen Lohn-, Preis- und Zinsunterschiede – die sogenannte Arbitrage – generiert, auf deren Basis möglichst risikofreie Gewinne für Investoren möglich sind. Zum Um und Auf der Arbeitsmobilität äußert sich der Autor erfreulicherweise offen und ehrlich: »Wenn ökonomische Integration die Anreize zur lokalen Konzentration wirtschaftlicher Produktionstätigkeiten verstärkt, sollten Arbeitskräfte vermehrt in die Zentren ziehen, damit Agglomerationsvorteile ausgenützt werden können. Sind die Arbeitskräfte hingegen immobil, müssen Firmen durch entsprechende Lohnsenkungen dazu gebracht werden, in der Peripherie zu bleiben. Immobilität fördert so regionale Unterschiede …«9 Laut diesem Befund kann es der Mensch als Arbeiter drehen und wenden wie er will, er wird ausschließlich als Kostenfaktor betrachtet. Eine Zusammenballung von Migrierenden im Zentralraum macht es dem Unternehmer leicht, aus dem großen Angebot am Arbeitsmarkt die günstigsten Arbeiter auszuwählen und erspart ihm zusätzlich Overhead-Kosten. Mobilitätsunwillige an der Peripherie kann der Investor mit niedrigeren Löhnen abstrafen, so lange, bis sie sich zur Migration entschließen. Dass Immobilität regionale Unterschiede fördert, ist freilich vollkommen verquer gedacht, dann müsste ja im Umkehrschluss Mobilität soziale und regionale Differenzen einebnen. Das Gegenteil ist der Fall.
Worum es in diesem Buch nur am Rande gehen wird, ist das Thema Asyl. Schon die Bedeutung des griechischen Wortstammes zeigt, dass es dabei nicht um Wanderungen geht, sondern um eine spezifische Form der Aufnahme von Geflüchteten. Ásylon steht für das Unverletzliche, den Zufluchtsort, der in seiner ursprünglich religiösen Form eine Kultstätte oder ein Tempel war, wo sich ein Fliehender unter den Schutz einer Gottheit stellen konnte. Auch Kirchen und Klöster gewährten seit dem 4. Jahrhundert Flüchtenden Asylrecht, bis die katholische Kirche 1983 das Kirchenasyl nicht mehr in den überarbeiteten Kodex des kanonischen Rechts aufnahm, was seiner unausgesprochenen Abschaffung gleichkommt.10 Die Französische Revolution gab dann dem weltlichen Asylrecht entscheidende Impulse; einzelne Staaten begannen, politisch Verfolgten Schutz zu gewähren. Zu einer völkerrechtlichen Verbindlichkeit eines Rechts auf Asyl ist es allerdings bis heute nicht gekommen. Es existiert keine allgemeingültige UN-Resolution zum Thema. Einem Flüchtlingsschutz am nächsten kommt die Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951, die ursprünglich für politisch Verfolgte aus kommunistischen Ländern Verwendung fand. Diese verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, dem anerkannten Asylbewerber gewisse soziale Sicherheiten zuzugestehen, ein Anspruch auf Asyl ist darin allerdings nicht festgeschrieben. Als Fluchtgründe gelten politische, religiöse und rassische Verfolgung sowie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Krieg ist in der Genfer Flüchtlingskonvention kein Kriterium. 145 Staaten (von 193) haben bis 2018 diese Konvention unterzeichnet.
Die Vermengung von Migrationsbewegungen, die meist wirtschaftlichen oder geopolitischen Umbrüchen folgen, mit der speziellen Aufnahmeform von politisch, rassisch oder religiös Verfolgten soll hier tunlichst vermieden werden. Gleichwohl wird das Thema Asyl schon wegen dieser medial oft bewusst oder unbewusst vorgenommenen Vermischung nicht völlig ausgeklammert werden können.
Wanderung als menschliche Konstante
Migration war immer. Mit dieser zweifellos richtigen Feststellung reagieren links- und rechtsliberal gesinnte Medien, Politiker und WissenschaftlerInnen auf die seit Jahren zunehmende Kritik an der im Zuge der großen Fluchtbewegung des Sommers 2015 entstandenen »Willkommenskultur« für syrische, afghanische und andere Flüchtlinge. Migration verursachte auch immer soziale Verwerfungen. Dieser ebenso richtige Gemeinplatz der Erkenntnis wird hingegen in vielen meinungsbildenden Milieus ausgeblendet. Zu Unrecht, denn jede Massenwanderung ist bereits eine Reaktion auf gewaltige regionale oder soziale Katastrophen in den Herkunftsländern der Migrierenden, die mit ihnen logischerweise auch die Zielländer erreichen. Wer davor die Augen verschließt, endet im Extremfall bei der Position, Migration sei zu begrüßen. Die Antwort auf die Frage, für wen diese gut sei, führt uns bereits mitten hinein in die Geschichte eines weltweiten Verteilungskampfes, bei dem Mobilität zugleich Instrument und Ausdruck globaler Ungleichheit ist.
»Wanderungen gehören zur Conditio humana wie Geburt, Fortpflanzung, Krankheit oder Tod.«11 Mit diesem Satz leitet der Migrationsforscher Klaus Bade sein viel gelesenes Buch EuropainBewegung ein. Was auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als pure Ideologie der globalistisch-liberalen Moderne. Denn anders als Geburt, Fortpflanzung oder Tod, die dem Menschen wie anderen Lebewesen naturgesetzlich eingeschrieben sind, kann man das von Wanderungen keineswegs behaupten. Die Tatsache, dass Menschen zu allen Zeiten migrierten, heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass Migration – wie Geburt und Tod – Bedingung des menschlichen Lebens ist. Örtlich, zeitlich und dem sozialen Stand nach unterschiedlich gab es in den vergangenen Jahrhunderten Milliarden von Lebensläufen, die keine Wanderung kannten. Wer also Wanderung zur menschlichen Lebensbedingung erklärt, konstruiert damit ein nicht hinterfragbares Dogma, das eher seinen eigenen Blick auf die Gesellschaft als die Wirklichkeit abbildet. Der Titel von Bades Buch, »Europa in Bewegung«, unterstreicht dieses Wunschbild. Die neuere Migrationsforschung folgt allesamt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, dem Dogma von Mobilität als Normalfall menschlicher Lebensform.12
Die Herstellung von wirtschaftlichen Großräumen wie jenem der Europäischen Gemeinschaft bzw. der späteren Europäischen Union mobilisiert Menschen als Arbeitskräfte oder Studierende über ihren vormals kleinräumigeren Lebensraum hinaus. Diese Mobilisierung ist, wie wir noch sehen werden, beabsichtigt. Man kann sie als Chance begreifen oder beklagen, unredlich ist es allerdings, in dieser Tatsache eine gottgegebene oder genetisch verankerte »Conditio humana« zu sehen. Gleichwohl hält sich ein großer Teil der neueren Migrationsforschung in schlechtester, aber gewohnter herrschaftsapologetischer Tradition an dieses Dogma. Der entsprechende Bekenntniszwang in der Forschergemeinschaft scheint nahezu lückenlos. Migration wird als Lebensbedingung gesehen, eine Alternative soll damit undenkbar gemacht werden. Da fällt es schon gar nicht mehr auf, wenn im Eifer des Gefechtes um die Meinungshoheit übertrieben wird. »Unseres Erachtens ist Migration als Normalzustand menschlicher Gesellschaften zu verstehen«, schreiben die zwei Gewerkschafter Hartmut Tölle und Patrick Schreiner wohl in der Hoffnung, damit dem Einstiegscredo in die herrschende Migrationsdebatte genügend Tribut gezollt zu haben. Die Transformation vom Marx’schen »variablen Kapital« (für den ausgebeuteten, allzeit flexiblen Arbeiter) zur migrierenden Gesellschaft als Norm lässt große Kapitalgruppen frohlocken. Sie profitieren von Mobilisierung und Flexibilität, die nicht nur auf dem Arbeitsmarkt positiv zu Buche schlagen. Warum allerdings zwei DGB-Männer in den Chor des »There Is No Alternative« einstimmen, erschließt sich einem nicht sogleich.
Auffallend ist jedoch, dass es weite Teile der Linken sind, die der Mobilisierung von Arbeitskräften und Wanderungsbewegungen generell vorbehaltlos positiv gegenüberstehen, weil sie den sozialökonomischen Kontext von Migration zwar erkennen, diesen aber hinter genetischer oder gottgewollter menschlicher »Wesenseigenheit« verstecken. »Sich räumlich zu bewegen ist eine ›Wesenseigenheit‹ des Menschen, ein Bestandteil seines ›Kapitals‹, eine zusätzliche Fähigkeit, um seine Lebensumstände zu verbessern«, schreibt etwa der italienische Migrationsforscher und Abgeordnete des »Partito Democratico«, Massimo Livi Bacci.13 Er verklärt die »Anpassungsfähigkeit des Migranten« zur »fitness«, die er als Gemisch aus biologischen, psychologischen und kulturellen Eigenschaften beschreibt. Kein Wort von den sozioökonomischen Zwängen, kein Wort von Krieg oder Klimakatastrophe, die Menschen zum Wandern zwingen. Migration ist in dieser globalistisch-liberalen Vorstellung das Reine, in die menschliche DNA Eingeschriebene, nichts Gemachtes, nichts der wirtschaftlichen Verwertung Zugetriebenes.
Den Vorwurf solcher Verharmlosung braucht sich der slowenische Philosoph Slavoj Žižek nicht gefallen zu lassen. Was die Gründe für die heutigen Massenfluchtbewegungen betrifft, spricht er Klartext. »Die Hauptursache für die Flucht liegt im globalen Kapitalismus und seinen geopolitischen Spielen selbst. Und wenn wir ihn nicht radikal ändern, werden sich zu den afrikanischen Flüchtlingen bald welche aus Griechenland und anderen europäischen Ländern gesellen«14, schreibt er in bekannt flapsiger Manier und bringt auf den Punkt, worum es geht: um einen weltweiten Verteilungskampf. Warum Žižek dieser Klarsicht zum Trotz an gleicher Stelle schreibt, dass »Migrationen im großen Stil unsere Zukunft (sind)«, liegt an seiner eingestandenen – und berechtigten – Furcht vor der Alternative, die er »neue Barbarei« nennt. Dass diese allerdings mit der Politik einer Willkommenskultur, wie er sie befürwortet, aufzuhalten wäre, scheint angesichts der real herrschenden politischen Kräfteverhältnisse unrealistisch. Da beruhigt es dann doch, dass Žižek als einer der wenigen Denker unserer Zeit als die schwierigste Aufgabe nicht die Integration von MigrantInnen oder gar deren Abwehr versteht, sondern die Durchsetzung eines »radikalen ökonomischen Wandels, der die Verhältnisse abschaffen sollte, die zu den Flüchtlingsströmen führen.«15
Der wissenschaftliche Mainstream will sich mit einem solch notwendigen radikalen Wandel nicht beschäftigen. Er verschließt die Augen vor den Verhältnissen und versteift sich darauf, deren Auswirkung – die Migration – positiv zu konnotieren.
Stellt man dieser ideologischen Einstellung die Wirklichkeit entgegen, wird Erstere eindrucksvoll enttarnt. Das »Vienna Institute of Demography« hat in einer jahrelang durchgeführten, aufwändigen Studie weltweite Wanderungsbewegungen dokumentiert und dabei errechnet, dass die grenzüberschreitende Migration zwischen 1960 und 2005 jährlich 0,6% der Weltbevölkerung betroffen hat; im Zeitraum zwischen 2005 und 2010 ist sie auf 0,9% gewachsen. In absoluten Zahlen waren das in den Jahren 2005 bis 2010 41,5 Millionen Wanderungsbewegungen, denen 7 Milliarden Menschen gegenüberstehen, die dieses Schicksal nicht teilen.16 Die Norm ist der Sesshafte, Migration weicht davon ab.
Allerdings ist die zwischenstaatliche Migration in den vergangenen Jahren schneller gewachsen als die Weltbevölkerung, wie ein UN-Bericht aus dem Jahr 2015 belegt. Ihm zufolge erhöhte sich der Gesamtbestand der als MigrantInnen lebenden Menschen zwischen 2000 und 2015 von 2,8% auf 3,3%.17 Im Jahr 2015 waren dies 244 Millionen, die fern ihrer Heimat lebten, 2017 stieg die Zahl auf 258 Millionen.18
Warum die tatsächlichen Wanderungsbewegungen den globalistisch imaginierten so weit hinterherhinken, erklärt der Historiker Jochen Oltmer im Fall der Süd-Nord-Migration interessanterweise gerade mit der Armut der sesshaften Menschen, ihren fehlenden Netzwerken … und der restriktiven Migrationspolitik möglicher Zielländer: »Für den Großteil der Bewohner der Welt ist die Umsetzung eines solchen Migrationsprojektes illusorisch.«19 Enttäuscht stellt der Migrationsforscher Peter Fischer20 fest, dass die von ihm herbeigesehnten ökonomischen Möglichkeiten, die massenhafte Mobilisierung mit sich bringen könnte, an menschlichen Gewohnheiten und Sehnsüchten scheitern. »Deutlich höhere Wanderungsneigungen als der Durchschnitt hatten zwischen 18 und 28 Jahre junge Leute und kürzlich zugewanderte Ausländer«, beschreibt er die positive Seite seines Forschungsgegenstandes, um dann festzustellen zu müssen: »Allgemein jedoch gilt, daß immobiles Verharren die Regel und Migration die absolute Ausnahme ist. Geschlechtsspezifische Unterschiede scheint es dabei kaum zu geben. Praktisch völlig immobil sind Partner, die beide verdienen und/oder Kinder haben«, schließt er resigniert vor einer ökonomisch tragfähigen Familienstruktur.
1 Leopold von Ranke, Werke – 2,14,27 in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Bd. 27, Leipzig 1922, S. 1707
2 Adalbert Stifter, Werke 1901f. 5, 1, 210 in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Bd. 27, Leipzig 1922, S. 1702
3 Zum besseren Verständnis wurde hier die Kleinschreibweise aufgehoben. Johann Wolfgang von Goethe 10, 14, Weimar ausg. (Iphigenie 1,3) in: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Bd. 27, Leipzig 1922, S. 1702
4 Duden, Leipzig 1987
5 Duden, Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich 2000
6 Felicitas Hillmann, Migration. Eine Einführung aus sozialgeographischer Perspektive. Stuttgart 2016, S. 17
7 siehe z.B.: Peter A. Fischer, Richtige Antworten auf die falschen Fragen? Weshalb Migration die Ausnahme und Immobilität die Regel ist. In: Achim Wolter (Hg.), Migration in Europa. Neue Dimensionen, neue Fragen, neue Antworten. Baden-Baden 1999, S. 86
8 Ebd.
9 Ebd., S. 86/87
10de.wikipedia.org (25.4.2018); siehe auch: www.domradio.de (20.5.2017)
11 Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München 2000, S. 11
12 Vgl. dazu auch: Dirk Hoerder/Leslie Page Moch (Hg.), European Migrants. Global and Local Perspectives. O.O. (Boston) 1996
13 Massimo Livi Bacci, Kurze Geschichte der Migration. Berlin 2015, S. 8
14 Slavoj Žižek, Der neue Klassenkampf. Die wahren Gründe für Flucht und Terror. Berlin 2015, S. 82
15 Ebd.
16 Studie des »Vienna Institute of Demography«, siehe: www.global-migration.info. Siehe auch: Jochen Oltmer, Globale Migration. Geschichte und Gegenwart. München 2016, S. 114
17 UNO (Hg.), Trends in International Migrant Stock. The 2015 Revision, siehe: www.un.org (17.4.2018)
18www.un.org (11.3.2018)
19 Oltmer, S. 115
20 Fischer in: Wolter 1999, S. 86
Migrationsursachen
Die seit zwei Jahrzehnten boomende Migrationsforschung unterscheidet eine Unzahl von Wanderungsbewegungen, trennt zwischen Aus-, Ein- und Binnenwanderung, lang-, mittel- und kurzfristigem Aufenthalt in der Fremde und unterteilt die Gründe für das Verlassen der Heimat in soziale, wirtschaftliche, (geo)politische und kulturelle. Innerhalb dieses brauchbaren, groben Rasters soll hier eine kurze Typologie der Migrationsursachen gezeichnet werden.
Zerstörung der Subsistenz
»Die Wanderbewegung richtet sich aus dem Gebiet, wo der Nahrungsspielraum relativ (d.h. im Verhältnis zur Einwohnerzahl) kleiner ist, in das Gebiet, wo er relativ größer ist oder dank der Einwanderung selbst relativ größer werden kann«.21 Der veraltete, naturwissenschaftliche Duktus der bekannten Migrationsforscher der Zwischenkriegszeit, Alexander und Eugen Kulischer, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die damit getätigte Kernaussage allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann. Die »Mechanik der Völkerbewegungen«, wie die Brüder Kulischer ihr erstes Kapitel nennen, zielt auf die Erklärung früher menschlicher Wanderungsbewegungen, zieht Vergleiche mit dem Tierreich und scheut auch nicht vor der plumpen Analogie miteinander kommunizierender Gefäße zurück. Ausgangspunkt von Wanderungen ist demnach das menschliche Bestreben, »in bessere wirtschaftliche Bedingungen zu kommen«. Menschen bewegen sich von den »vollen« nach den »leeren« Plätzen.22 Diese nachgerade physikalische Sicht erklärt Migration als demografischen Ausgleich, der gleichwohl – so viel gesellschaftswissenschaftliche Erkenntnis kommt doch zum Tragen – nie erreicht werden kann. Ein möglicher expansiver Charakter von Migration wird dort angesprochen, wo »der Nahrungsspielraum dank der Einwanderung selbst relativ größer werden kann.« In diesem Nebensatz schwingen die Wirkungen der wohl bedeutendsten Wanderungsbewegung der Neuzeit mit, nämlich die Errichtung von weißen Siedlerkolonien in den Amerikas und in Australien.
Die neuere Forschung bezeichnet den Sachverhalt, den Kulischer die »Wanderung zum besseren Nahrungsraum« nennt, schlicht »Subsistenzmigration«.23 Gemeint ist dasselbe. Wenn den Menschen die Möglichkeit genommen wird, sich zu reproduzieren, das heißt, sich zu ernähren und ein entsprechend akzeptables Auskommen zu finden, dann suchen sie anderswo nach besseren Überlebenschancen. Die verkehrstechnischen Errungenschaften bestimmen im Zeitenlauf, ob die Migration klein- oder großräumig erfolgt.
Nicht übersehen werden darf dabei die soziale und wirtschaftliche Lage, mithin auch die Frage der Eigentumsverhältnisse. Diese kommt zwar in vielen Abhandlungen über Migrationsursachen nicht vor, bestimmt aber nicht nur über den Auswanderungswillen, sondern auch generell über die Möglichkeit, zu migrieren. Denn die Lebensbedingungen hängen wesentlich von der Verteilung der Güter und des Vermögens in der jeweiligen Gesellschaft ab. Die soziale Differenz gibt den entscheidenden Anstoß zur Wanderung, und zwar sowohl jene am Herkunfts- und möglichen Zielort der Migrationswilligen als auch insbesondere die überregionale Disparität zwischen den beiden Orten. Diese Ungleichheit wird größer. Das Entwicklungsgefälle zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden nimmt entgegen allen von Medien, Wirtschaftswissenschaftlern und Politikern ständig wiederholten Prognosen und Versprechungen zu. Dem »Human Development Report« des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) zufolge steigt die globale Armut von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Im Jahr 1996 lebte demnach jeder vierte Erdenbewohner, das sind 1,6 Milliarden Menschen, schlechter als 15 Jahre zuvor. In 70 Entwicklungsländern lag das Pro-Kopf-Einkommen, das als sozialer Indikator ohnehin nur eine sehr beschränkte Aussagekraft hat, unter dem von 1976.24 Selbst das World Economic Forum in Davos hielt in seinem Report des Jahres 2017 fest, dass die Schere zwischen Reichen und Armen weltweit und in den einzelnen Ländern auseinandergeht. Die liberalen Weltenführer aus Politik und Konzernen erklärten sich damit den Wahlsieg Donald Trumps in den USA vom 8. November 2016 und den Ausgang des Brexit-Referendums in Großbritannien vom 23. Juni 2016.25
Der Weltbank-Ökonom Branko Milanović stellt mit seinen Zahlenreihen zur ungleichen Welt für Anfang der 1980er-Jahre eine Kehrtwende in den Raum. Bis dahin nahm die soziale Ungleichheit zwischen den Staaten weltweit zu, ab dann nimmt sie statistisch ab. Demgegenüber vergrößerte sich die soziale Diskrepanz innerhalb der Staaten. Die leichte internationale Angleichung erklärt er mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in China (und Indien), der zugleich die Klassengegensätze innerhalb der beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt vergrößert. Dieses Argument ist einsichtig, weist aber zum einen den Mangel auf, dass während der chinesischen Kulturrevolution bis 1982 keine Haushaltserhebungen durchgeführt wurden und somit kein Vergleich der Perioden möglich ist, was Milanović selbst einräumt.26 Zum anderen spielt die Tatsache, dass die soziale Schere seit den 1980er-Jahren laut dem serbischstämmigen Ökonomen international nicht weiter auseinandergeht, sondern sich im Gegenteil sogar ein wenig schließt, für das Migrationsgeschehen in Europa keine Rolle. Der wachsende Wohlstand in China beendet keine Wanderungsbewegung, weil auch zuvor eine solche nicht gegeben war.
Zurück zur demografischen Triebkraft. Die Bevölkerungsexplosion nach 1750, die Europa verändert und bis zum Jahr 1800 zu einer Verdoppelung der EinwohnerInnenzahl geführt hat, bildet zweifellos den Ausgangspunkt für eine weltweite, den Atlantik überquerende Migrationsbewegung. Allerdings ist der europäische Pauperismus des 18. Jahrhunderts nur die Kehrseite des barocken Prunks der Herrscherhäuser, unter deren Ägide eine massenhafte Verarmung stattfand, die später in der Phase der (Proto-)Industrialisierung von Fabrikherren verwertet werden konnte. Ohne die Einbindung der sozialen Frage bleibt jede demografische Erkenntnis halbwahr.
Der Verlust der Subsistenzfähigkeit bildete eine der entscheidenden Voraussetzungen, damit Menschen als Arbeitskräfte mobilisiert werden konnten. Um sie von Grund und Boden, der ihnen gleichwohl nicht gehörte, sie aber ernährte, zu vertreiben, waren gesetzliche Maßnahmen notwendig. In England wurden dafür die sogenannten »Commons« – gemeinschaftlich nutzbare Weide- und Anbauflächen – eingehegt und privaten Agrarunternehmen zur ausschließlichen Nutzung zugeschlagen. Das modernisierende System dieser »Enclosures« fand zwischen 1760 und 1820 seinen Höhepunkt. Kleine Bauern und besitzlose Häusler verloren ihre Existenzgrundlage und mussten sich an anderer Stelle ihr Brot verdienen. In rasch aufgebauten Industriestädten warteten Maschinen darauf, von ihnen für möglichst geringen Lohn bedient zu werden. Die Massenwanderung innerhalb Englands und in der Folge nach Übersee erhielt einen quantitativ neuen Schwung.
In Kontinentaleuropa war diese Art der »Freisetzung« von Arbeitskraft oft mit dem Ende der Leibeigenschaft verbunden, die – etappenweise – in Österreich-Ungarn 1781 und 1848, in Preußen 1807 und 1848 und in Russland 1861 und 1906 abgeschafft wurde. Die vermeintliche Freiheit wollte bezahlt sein; für die Ablöse des Bauernlandes vom Feudalherren musste ein Drittel des Wertes aufgebracht werden; die beiden anderen Drittel trugen, dem Kompromiss der Bauernbefreiung entsprechend, der Staat und der Grundherr. Viele auf diese Art Befreite konnten sich die Freiheit nicht leisten und verschuldeten sich. Sie wurden in der Folge von ihren neuen Kleinbauernstellen vertrieben und mussten sich als Lohnarbeiter fern der Heimat ihre Überlebensgrundlage sichern. Die Wiener Wirtschaftshistorikerin Andrea Komlosy fasst die Transformation vom an die Scholle gebundenen Untertanen zum in die Fabrik oder ins Bergwerk wandernden Arbeiter zusammen: »Die Kodifizierung bürgerlicher Rechte verwandelte den Staatsuntertan in den Staatsbürger. Dieser war freilich nur vor dem Gesetz gleich, denn die unterschiedliche Ausstattung mit Grundbesitz, Immobilien, Geld und symbolischem Kapital ließ, nach dem Wegfallen der patriarchalen herrschaftlichen Sicherheitsnetze, die sozialen Unterschiede anwachsen. Auf diese Weise war die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, die keine Subsistenzmittel besaßen, gewährleistet. Da sich diese in der Regel nicht dort aufhielten, wo sie auf Baustellen, in Fabriken, Büros und Haushalten gebraucht wurden, setzte die bürgerliche Umgestaltung der Gesellschaft eine massive Wanderungsbewegung in Gang, die landwirtschaftliche Intensivregionen, Industriereviere und Städte mit temporären oder dauerhaften Arbeitskräften versorgte.«27
Neben der sozialen Frage besteht nichtsdestotrotz das demografische Problem. Vor der explosionsartigen Bevölkerungsentwicklung die Augen zu verschließen oder sie kleinzureden, wäre unverantwortlich. Bei Redaktionsschluss dieses Buches leben 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. 2000 Jahre zuvor waren es laut Schätzungen der UNO 300 Millionen. Damit gibt es heute 25 Mal mehr Erdbewohner als zur Zeit von Christi Geburt. Der exponentielle Anstieg der Weltbevölkerung begann allerdings erst nach dem Jahr 1700, bis dahin zählte die Welt nur etwa 500 Millionen Menschen. Das heißt, die Menschheit hat 1700 Jahre gebraucht, um sich zu verdoppeln, dasselbe gelang ihr innerhalb von nur 100 Jahren zwischen 1800 und 1900. Im 20. Jahrhundert wuchs die Weltbevölkerung von 1,5 Milliarden auf 6 Milliarden, um heute bei 7,5 Milliarden angekommen zu sein. Trotz einem seit den 1960er-Jahren prozentuellen Rückgang des jährlichen Wachstums rechnet die UNO damit, dass im Jahr 2050 der 10-millionste Erdenbewohner geboren werden könnte. Während die Prognosen für die nächsten 30 Jahre Europa einen leichten Rückgang und Amerika eine leichte Steigerung vorhersagen, soll sich die afrikanische Bevölkerung bis 2050 auf 2,5 Milliarden mehr als verdoppeln und in Asien – regional sehr unterschiedlich – ein Zuwachs von einer knappen Milliarde auf 5,3 Milliarden Menschen stattfinden.
Die demografische Lage ist explosiv. Wenn sich Hunderte von Millionen Menschen auf der südlichen Erdhalbkugel nicht ernähren können bzw. ihnen die Ernährung durch wirtschaftliche Interessen großer Konzerne aus dem Norden erschwert wird, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich ungeahnt massive und gewalttätige Migrationswellen von Süd nach Nord Bahn brechen. Einen ersten Vorgeschmack auf die Zukunft solcher globalen »Subsistenzmigrationen« brachte die zweite Jahreshälfte 2015, als sich durch Kriege entwurzelte und ihrer Lebensgrundlage beraubte Menschen aus Syrien, Afghanistan und anderswo in Richtung europäischer Zentralräume in Bewegung setzten.
Die Gründe für die große Flucht sind in der Struktur einer verwertungsorientierten Agrar- und Fischereiindustrie längst gelegt. Ortsansässiger bäuerlicher Bevölkerung wird systematisch ihre Lebensgrundlage entzogen. Der Ankauf oder die Verpachtung von riesigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen in Afrika – aber nicht nur dort – durch Konzerne aus dem europäischen und amerikanischen Norden sowie China und Saudi-Arabien, die damit ihr überschüssiges Kapital profitabel anlegen, entzieht den Menschen ganzer Landstriche ihre Reproduktionsfähigkeit. Dieses sogenannte »Landgrabbing« hat ausschließlich den Gewinn der Investoren im Sinne. Und dieser wird durch den Export der Agrargüter in die Herkunftsländer des Kapitals, mithin in die reichen Länder, realisiert. Angebaut werden neben essbaren Cash Crops diverse Genussmittel wie Kakao und Kaffee, aber auch Getreidesorten, die zur Energie- und Treibstoffgewinnung außer Landes gebracht werden. Die Einheimischen verlieren mit dem Grund und Boden, auf dem sie bis vor 15, 20 Jahren gewirtschaftet haben und der nun fremden Investoren gehört, ihre Subsistenzgrundlage. Der deutsche Zweig der britischen Entwicklungshilfeorganisation Oxfam hat errechnet, dass im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 230 Millionen Hektar agrarisch nutzbaren Landes in Entwicklungsländern von internationalen Konzernen gekauft oder verpachtet wurden. Das ist mehr als die Hälfte der Fläche der Europäischen Union und mehr als die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche innerhalb der EU.28 Britische Firmen führen die europäische Liste von Fonds und Investmentgesellschaften an, die vor allem afrikanischen Boden kaufen oder pachten, wobei Pachtverträge nicht selten auf 99 Jahre ausgestellt werden.
Im Senegal waren Mitte der 2010er-Jahre 70% der Reisanbaufläche von einem saudischen Konzern gepachtet, im Sudan teilen sich saudische, katarische und ägyptische Unternehmen die Flächen. Im Weltagrarbericht ist davon die Rede, dass nur ein geringer Teil dieses Landgrabbing für die Produktion von Nahrungsmitteln verwendet wird. Es sind überwiegend Fasern, Futtermittel, Ethanol oder Genussmittel wie Kaffee, Tee und Kakao, die auf gekauftem oder gepachtetem Land für den Export gewonnen werden.29 Mit welcher Brutalität dabei die bäuerliche Bevölkerung von ihren angestammten Ländern vertrieben wird, zeigt ein Beispiel aus Uganda. Dort wurden im Jahr 2001 für eine Kaffeeplantage eines deutschen Unternehmens vier Dörfer abgesiedelt. Nach kurzer Frist kamen Vertreter der Regierung, ließen die Häuser von 2000 BewohnerInnen mit Bulldozern niederwalzen und brannten die verbliebenen Hütten ab. Die Menschen standen vor Ruinen, die Männer versuchten, als Saisonarbeiter in den Plantagen Arbeit zu finden.30 Ihre Söhne trieb es über das Mittelmeer nach Europa.
Die auf ferne Exportmärkte setzenden globalen Agrarinvestitionen hinterlassen in den jeweiligen Ländern nicht nur überlebensunfähige, also unbrauchbar gewordene Menschen. Sondern sie bewirken in weiterer Folge, dass in den Ländern des Südens Lebensmittel importiert werden müssen, was die einzelnen Staaten in einer zweiten Verwertungsrunde von ausländischem Kapital und Importeuren abhängig macht. Diese neokoloniale Abhängigkeit – Slavoj Žižek nennt sie postkolonial31 – führt damit neben der materiellen Ausbeutung zur kulturellen Demütigung.
Das Muster der agrarindustriellen Vernutzung von Grund und Boden sowie Land und Leuten durch auswärtiges, einzig dem anonymen Aktionär rechenschaftspflichtigem Kapital, wiederholt sich auch auf hoher See. Riesige Trawler vornehmlich EU-europäischer und japanischer Herkunft fischen die Küstengewässer rund um Afrika leer. Die Fänge landen anschließend auf europäischen und japanischen Märkten. Zurück bleiben lokale Fischer, die ihre Familien nicht mehr ernähren können. Brüssel hat in den vergangenen Jahren mit 16 afrikanischen und karibischen Ländern Nutzungsverträge für Fischfanggebiete abgeschlossen und damit kapitalstarken Fischereiflotten einen Expansionsschub garantiert und diesen noch dazu mit Subventionen aus dem EU-Budget versüßt.
Landgrabbing-Unternehmen, Cash-Crop-Konzerne und Fischereifangflotten folgen mit ihrer aggressiven Expansionsstrategie den Vorstellungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank. Diese haben mit ihrer Politik der »strukturellen Anpassung« ihre Kreditvergaben an Länder der südlichen Halbkugel immer an Vorgaben wie »internationale Wettbewerbsfähigkeit« und »Weltmarktkompatibilität« geknüpft. Schutz für lokale Bauern oder Fischer galt und gilt ihnen bis heute als verabscheuungswürdiger Protektionismus. Sie von den Äckern und Fischgründen zu vertreiben ist kein unbedachter wirtschaftspolitischer Kollateralschaden, sondern Ergebnis einer geplanten Strategie.
Diese konnte man in den 1990er-Jahren auch mitten in Europa beobachten, als es darum ging, die (teil)subsistente Lebensform polnischer Bauernfamilien zu zerstören. Die polnische Landwirtschaft war während der gesamten kommunistischen Periode – anders als in der Tschechoslowakei oder in der Sowjetunion – kleinbäuerlich geblieben. 36% der polnischen Bevölkerung lebten Anfang der 1990er-Jahre hauptsächlich von dem, was ihre Erde hergab. Das stand dem in EU-Europa vorherrschenden liberal-globalistischen Konzept diametral entgegen. Ernährungssouveränität gehörte nicht zu den Prioritäten EU-europäischer Politik, ebenso wenig zu jener des IWF. Im Gegenteil: Diese galt es, wo sich noch Reste fanden, aufzubrechen. Mobilisierung hieß das entsprechende Schlagwort. Und die Europäische Gemeinschaft entwickelte – in Zusammenarbeit mit liberalen Kräften in Polen – ein Programm, das die drastische Verringerung der agrarischen Bevölkerung zum Ziel hatte. »Shaking out« der Bauern nannte sich dieser zynische Plan. Er sollte funktionieren und setzte bereits nach ein paar Jahren zigtausende Polen »frei«, sprich: zwang sie zur Migration nach Westen. Ein Mittel zum Erfolg war die Marktöffnung für EU-subventionierte Lebensmittel. Billige Milch aus Irland und billiges Fleisch aus den Niederlanden und Deutschland überschwemmten den polnischen Markt, die einheimischen Bauern konnten preislich nicht mithalten, sie wurden aus ihren Lebensverhältnissen »herausgeschüttelt«.
Seit Anfang der 2000er-Jahre betreibt die Europäische Union einen groß angelegten, strukturellen Angriff auf subsistente Lebensgrundlagen auf der südlichen Halbkugel. Spezielle Partnerschaftsabkommen mit 77 afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten sollen zu einer, wie es im Wirtschaftssprech heißt, »reziproken« Handelspolitik führen; oder anders ausgedrückt: tarifäre und nicht-tarifäre Handelshindernisse beseitigen. Ausgangspunkt war die Kritik der Welthandelsorganisation (WTO), die sich daran stieß, dass das 1975 abgeschlossene Lomé-Abkommen den »Dritte- Welt«-Staaten Handelspräferenzen für gewisse Warengruppen einräumte. Sie erlaubten den ehemaligen Kolonien einerseits Schutzmaßnahmen für nationale Märkte und andererseits Exporterleichterungen. Politischer und militärischer Druck der früheren Kolonialmächte sowie Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds (IWF) führten dazu, dass die ausverhandelten Vorteile des Lomé-Abkommens oft nur auf dem Papier bestanden und theoretischer Natur blieben. So zwang z.B. der IWF Ghana bereits in den 1980er-Jahren, Schutzzölle abzubauen, widrigenfalls Kredite fällig gestellt würden. Die Folge war, dass von Brüssel hoch subventionierte Agrarprodukte wie Zucker, Gemüsekonserven, Milchpulver und tiefgefrorene Hühnerteile die Märkte mit Billigwaren überschwemmten und die lokalen Produzenten dieser Konkurrenz nicht standhalten konnten. Der Marktanteil von heimischem Geflügel ging auf diese Weise von 95% im Jahr 1992 auf 11% im Jahr 2001 rasant zurück.32 Die ghanaischen Bauern verloren ihre Subsistenzgrundlage und die Beschäftigten der lokalen Agrarbetriebe ihren Arbeitsplatz. Ihre Kinder verdingen sich seither als Saisonarbeiter zu Zehntausenden in Süditalien und Spanien, wo sie in Plastikgewächshäusern Tomaten und Zucchini pflücken.33 Insbesondere die Kreditpolitik des IWF mit ihren wirtschaftsliberalen Bedingungen unterlief also bereits vor Jahrzehnten vertraglich vereinbarte Schutzzollabkommen.
Mit den neuen Partnerschaftsabkommen (Economic Partnership Agreements/ EPAs) soll es keinerlei »Diskriminierung« mehr für Importe aus Zentrumsländern geben und gleichzeitig auch diese für Waren aus dem Süden barrierefrei geöffnet werden. Das erste dieser EPAs wurde bereits 2007 zwischen der EU und Karibik-Staaten geschlossen, im Jahr 2014 erweiterte die EU die Freihandelszone in Richtung Afrika. Anfang Juli 2014 unterzeichnete Brüssel in Ghanas Hauptstadt Accra Partnerschaftsabkommen mit 15 westafrikanischen Staaten und Mauretanien, zwei Wochen später mit sechs Ländern des südlichen Afrika und im Herbst desselben Jahres mit Mitgliedern der ostafrikanischen Gemeinschaft. Auf heftigen Widerstand stieß das EU-Marktöffnungsbegehren vor allem in Nigeria, Niger und Gambia.
Freihandel zwischen ungleichen Partnern nützt dem ökonomisch (und militärisch) Stärkeren. Im Westen wird viel propagandistische Kraft darauf verwendet, diese Binsenweisheit zu verschleiern. Blumig wird in den Verträgen über »Präferenzabbau« und »Beseitigung von Diskriminierungen« geschrieben. Wer allerdings einen Blick auf die Details der oft unter wirtschaftlichem Zwang betriebenen Absprachen wirft, kann schnell erkennen, worum es tatsächlich geht: um Markterweiterung für Betriebe mit Überkapazitäten, die diese profitabel verkaufen wollen. Gegenseitigkeit steht bloß auf dem Papier. Das wird beispielsweise deutlich, wenn die EU großmundig die zollfreie Einfuhr für afrikanische oder karibische Agrarprodukte verkündet, diese aber nur die rohe Frucht, nicht jedoch verarbeitete Produkte betrifft. Die rohe Mango darf ohne Zoll auf den EU-Binnenmarkt, der in Tetra Paks abgefüllte Fruchtsaft wird besteuert; und zwar deshalb, weil die Verpackung nicht aus dem afrikanischen Ursprungsland kommt und daher das Partnerschaftsabkommen nicht gilt.34
Eine geradezu geopolitische Dimension nehmen die Economic Partnership Agreements zwischen der EU und afrikanischen Staaten an, wenn sich die eine oder andere frühere Kolonie erlaubt, mit Nicht-EU-Ländern wie beispielsweise China oder Brasilien ein Handelsabkommen abzuschließen, das bessere Bedingungen als jenes mit der EU aufweist. Dann nützt Brüssel das vertraglich abgesicherte Veto genau so, als ob der ökonomische Irrgänger Mitglied der EU wäre, und verbietet ihm Präferenzabkommen mit Nicht-EU-Mitgliedern. Im Klartext: Die afrikanischen und karibischen Staaten, die mit der EU ein solches Agreement abgeschlossen haben, dürfen chinesischen oder indischen Handelspartnern keine besseren Konditionen gewähren.35 Auch hier sind nationale Alleingänge, die Präferenzabkommen mit einzelnen Staaten abschließen, also nicht mehr möglich.
Die EU-Partnerschaftsabkommen mit den sogenannten AKP-Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks sind ein Musterbeispiel nicht nur dafür, wie durch den Kolonialismus erzeugte ökonomische Peripherisierung perpetuiert und verfeinert wird, sondern auch dafür, wie es zur Mobilisierung von Menschen kommt, die sich in der Folge in Massenmigrationen niederschlägt.
Die in vielfältiger Weise stattfindende Zerstörung der Subsistenz ist seit Menschengedenken eine der Grundursachen für Wanderungsbewegungen. Diese zu beschleunigen oder hintanzuhalten ist nichts Gottgegebenes, sondern Ergebnis gesellschaftlicher Verhältnisse, um die zu allen Zeiten gerungen wird.
Kriege und Vertreibungen
In der Typologie von Migrationsursachen dürfen die offen gewalttätigen nicht fehlen. Krieg, Flucht und Vertreibung gehen meist Hand in Hand. Dass Menschen vor den zerstörerischen Kräften des Krieges fliehen, bedarf keiner näheren Erklärung, diese Reaktion ist dem natürlichen Selbsterhaltungstrieb geschuldet. Die im Krieg angestrebte physische Vernichtung des Gegners ist die krasseste, weil schlagartig sich umsetzende Form der Zerstörung von Lebensgrundlagen. Kriege mögen Interventionen von außen sein oder innergesellschaftliche Auseinandersetzungen, die Folgen in Bezug auf die Bereitschaft bzw. Notwendigkeit zur Flucht ähneln einander. Ob die daraufhin einsetzende Migrationsbewegung kurzfristig oder dauerhaft, kleinräumig oder großräumig stattfindet, hängt von vielerlei Faktoren ab.
Dort, wo ein weitgehend friedliches Zusammenleben gegeben ist, gibt es in einer Gesellschaft wenig Grund zur Auswanderung. Ein Blick auf den »Global Peace Index«, eine von der britischen Zeitschrift Economist in Zusammenarbeit mit dem Friedensinstitut der Universität Sydney erstellte Rangliste von Ländern, unterstreicht dies eindrucksvoll. 24 Kriterien ergeben ein Ranking von 163 beurteilten Staaten entlang von Friedfertigkeit und Absenz von Krieg. Die Liste wird seit Jahren von dem kleinen Inselstaat Island angeführt, im Jahr 2017 folgen Dänemark, Österreich, Portugal und Neuseeland auf den Plätzen (Deutschland liegt an 16. Stelle). Das Schlusslicht bildet Syrien hinter dem Südsudan, Irak, Afghanistan und Somalia.36 Die Hauptherkunftsländer der MigrantInnen sind am unteren Ende des Weltfriedensindex ablesbar. Auch die Zahlen der Menschenrechtsorganisation »Pro Asyl« bestätigen die einfache Erkenntnis des direkten Zusammenhangs von Krieg und Flucht bzw. Migration; demnach stammen in Deutschland 69% derjenigen, die im Jahr 2015 um Asyl angesucht haben, aus Bürgerkriegsländern, allen voran aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.37
Kriege fallen nicht vom Himmel, Kriege werden gemacht. Hinter den unmittelbar kriegstreiberischen Kräften stehen ökonomische oder geopolitische Interessen. Es geht dabei um Eroberung bzw. Sicherung von Märkten oder Einflusssphären, die meist wiederum der Absicherung wirtschaftlicher Zwecke dienen. Dabei mag es um innere gesellschaftliche Verteilungskämpfe gehen oder um expansive Erweiterungspläne einzelner Mächte. Die Dynamik kapitalistischer Verwertung, die seit Jahrhunderten – zumindest seit dem Beginn der sogenannten Neuzeit – die gesellschaftlichen Entwicklungen auf dem Globus entscheidend prägt, ergibt den Befund, dass Kriege in aller Regel Kapital getriebene Ereignisse sind. Als solche verursachen sie migrierende Massenbewegungen. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sieht es als selbstverständlich an, »die eigentliche Ursache (…) in den Dynamiken des globalen Kapitalismus ausfindig zu machen wie in den Abläufen militärischer Interventionen.«38
Die klare anti-bellizistische Grundhaltung von Žižek sucht man bei anderen einflussreichen Autoren, die in jüngster Zeit zu Migration und gesellschaftlicher Verteilung geschrieben haben, vergeblich. Thomas Piketty z.B., der mit seinem Monumentalwerk DasKapitalim21.Jahrhundert39 vor allem für die (sozialdemokratische) Linke eine wegweisende Studie vorgelegt hat, unterstellt dem Krieg, den er ein katastrophales Ereignis nennt, nichtsdestotrotz eine positive, soziale Seite. Seine statistischen Reihen zur Einkommens- und Vermögensverteilung weisen für Kriegszeiten eine Verringerung der sozialen Ungleichheit auf. Die dem Krieg innewohnende Kapitalvernichtung sowie die Tendenz zu hohen Inflationsraten können tatsächlich dem Eigentum schaden, vor allem solchem, das nicht im militärisch-industriellen Komplex seine Rendite macht. Dies allerdings zu einer »Verringerung der Ungleichheit« umzuinterpretieren, lässt die physischen Leiden der direkten Opfer von Krieg und Vertreibung außer Acht. Diese mögen nicht als Zahlenkolonne darstellbar sein, wären aber in einer Gesamtrechnung menschlicher Gewinne und Verluste unbedingt zu berücksichtigen, auch wenn sie nicht das Vermögen betreffen. An Piketty anschließend ortet auch der serbisch-US-amerikanische Ökonom Milanović im Krieg eine, wie er schreibt, »böse Kraft«, die sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. »Kriege können die Ungleichheit verringern, führen jedoch auch zu einer Verringerung der Durchschnittseinkommen«, postuliert er.40
Eine ausgleichende Funktion des Krieges hat schon Thomas Robert Malthus41 vor 200 Jahren ins Treffen geführt. In seiner biologistischen Sicht sieht er die Ursache von Kriegen in der »Unzulänglichkeit von Raum und Nahrung« sowie in einer »überschäumenden Bevölkerung«, die nach neuen Lebensräumen drängt. Eine Verherrlichung des Krieges kann man Malthus nicht vorwerfen. Wenn er von ihm als »lasterhaftem Elend« spricht, weist das ein wenig in die Richtung der »bösen Kraft«, die ihm Milanović zuschreibt.
Der malthusianische Zugang zum Thema Krieg, der dessen Überbevölkerungstheorie zum Ausgangspunkt hat, ist heute zu Recht vollkommen aus der Mode geraten und wird fallweise als rassistisch denunziert. 200 Jahre später verwechseln Piketty und Milanović in streng ökonomistischer Lesart allerdings erneut Ursache und Wirkung von Krieg. Darauf, dass Krieg nichts gesellschaftlich Ausgleichendes hat, sondern umgekehrt die große soziale Differenz die Ursache für Krieg darstellt, hat im Übrigen schon Eugen Düring im Jahr 1867 hingewiesen: »Der Krieg ist nicht, wie Malthus meint, ein Mittel der Ausgleichung«, schrieb er, »sondern selbst eine Entstehungsursache von Mißverhältnissen zwischen Subsistenz und Bevölkerung.«42
Der aus sozialen Verwerfungen oder extremen regionalen Differenzen sich speisende Krieg kann diese Probleme nicht ausgleichen, sondern gebiert im Gegenteil neue, erzwungene Wanderungsbewegungen, Vertreibungen und Deportationen.
Der Umweltfaktor
Die Erwärmung der Erde mag viele Ursachen haben, doch die Klimaforscher sind sich in letzter Zeit darüber einig geworden, dass menschliche Eingriffe wesentlich dazu beitragen. Was in der Diskussion unterzugehen droht, ist die Antwort auf die Frage, wer von diesen Eingriffen profitiert und wer darunter zu leiden hat. Letzteres scheint offensichtlich, es ist meist die ärmere Bevölkerung auf der südlichen Halbkugel. Die wenigen – kurzfristigen? – Gewinner hingegen leben durchwegs im reichen Norden und lenken von dort aus ihre Geschäfte.
Die nicht mehr zu leugnende Klimaveränderung bewirkt Überschwemmungen und Verwüstungen gleichzeitig, aber an unterschiedlichen Orten. Als spürbarster Ausdruck der Klimaerwärmung stieg der Meeresspiegel zwischen 1990 und 2017 um fünf Zentimeter. Bis zum Jahr 2100 könnte es entsprechenden Berechnungen zufolge ein Meter sein; in den Küstengebieten von Bangladesch liegt der prognostizierte Wert noch darüber. Schon der Anstieg um einen Meter hätte im Golf von Bengalen eine Überflutung von 30.000 km² zur Folge, das entspricht fast der Fläche von Baden-Württemberg oder von Niederösterreich und Oberösterreich zusammengenommen. 15 Millionen Menschen wären unmittelbar davon betroffen. Ein von Indien errichteter 4000 Kilometer langer Grenzzaun zu Bangladesch soll historische Grenzstreitigkeiten regeln, dient aber auch zur Abhaltung erwarteter Klimaflüchtlinge.43
Die reichen Länder des Nordens sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu übergegangen, kontaminierte Abfälle wie Giftmüll und Elektroschrott in die arme, südliche Hemisphäre zu exportieren oder – wie im Fall von Somalia – Atommüll einfach in fremden Gewässern zu verklappen.44 In den Hafen der nigerianischen Hauptstadt Lagos werden monatlich 500 Container Elektroschrott geliefert; im ghanaischen Accra reihen sich Halde an Halde mit giftigen Stoffen wie Kadmium, Blei und Quecksilber, die allesamt aus Nordamerika oder Westeuropa kommen.45 Diese Externalisierung von Umweltproblemen und Umweltkosten trägt wesentlich dazu bei, dass in vielen afrikanischen oder südasiatischen Regionen die Lebensumstände immer prekärer werden.
Mit der Wirklichkeit belastbare Zahlen, wie viele Menschen in den kommenden Jahrzehnten wegen drastischer Umweltveränderungen aus ihren angestammten Lebensräumen fliehen müssen, gibt es keine. Im UNO-Hochkommissariat schätzte man Anfang des 21. Jahrhunderts, dass Überflutungen oder Wüstenbildungen 24 Millionen zu Umweltflüchtlingen machen werden, das Rote Kreuz hingegen geht von bis zu 500 Millionen Betroffenen aus.46 Der Umweltexperte Godfrey Baldacchino rechnet allein für Bangladesch mit 100 Millionen Menschen, deren Heimat in nächster Zeit von den Flutwellen des Meeres überschwemmt wird.47 Die Umweltschutzorganisation Greenpeace geht noch einen Schritt weiter und gibt sich nicht nur mit Prognosen ab, sondern behauptet in einer Studie, dass in den Jahren zwischen 2008 und 2015 insgesamt bereits 203 Millionen Menschen »durch wetterbedingte bzw. geophysikalische Katastrophen« vertrieben worden sind, über 100 Millionen davon durch Überschwemmungen.48