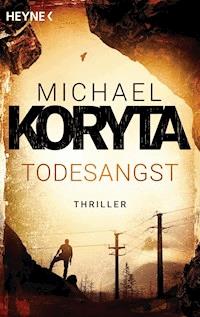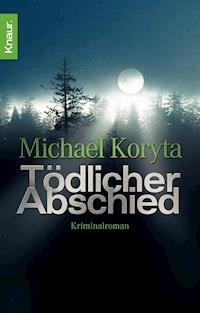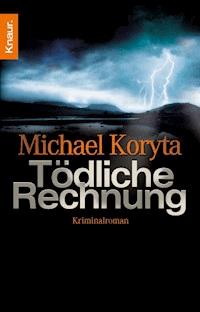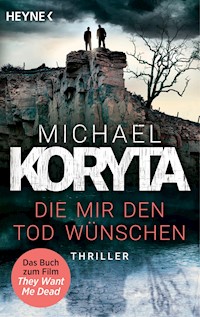
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mach dich bereit - für den letzten Tag deines Lebens
An einem stürmischen Tag wird der vierzehnjährige Jace Zeuge eines brutalen Mordes. Jace kann entkommen – doch er weiß, dass die Verbrecher ihn gesehen haben. Die Blackwell-Brüder, ein psychopathisches Killer-Duo, wollen seinen Tod. Jace kann niemandem mehr vertrauen. Unter neuer Identität soll er in Montana Zuflucht finden. Ethan Serbin, ein erfahrener Überlebensspezialist, steht ihm in der gnadenlosen Bergwelt zur Seite. Derweil bahnen sich die beiden Killer ihren blutigen Weg und kreisen ihre Opfer immer weiter ein. Für Ethan und Jace beginnt ein furioser Höllenritt …
- Das Buch zum Film »They Want Me Dead«!
- In der Hauptrolle: Angelina Jolie
- Mach dich bereit - für den letzten Tag deines Lebens
- »Der Thriller des Jahres! Wagen Sie es nicht, dieses Buch zu verpassen!« (Lee Child)
- »Unglaublich packend und intensiv! Michael Koryta macht süchtig, glauben Sie mir ... Aber sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt!« (Harlan Coben)
- »Für Koryta lege ich meine Hand ins Feuer!« (Stephen King)
- »Ein durchdachter, adrenalintreibender Action-Thriller, der dich eiskalt erwischt - das Spannungs-Ereignis des Jahres!« (Janet Maslin, The New York Times)
- »Michael Koryta ist beängstigend talentiert!« (Donald Ray Pollock)
- »Perfekt komponiert, brillant geschrieben - es ist unmöglich, mit dem Lesen aufzuhören. Koryta ist ein Hammer!« (Deon Meyer)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Ähnliche
MICHAEL KORYTA
DIE MIR DEN TOD WÜNSCHEN
THRILLER
AUS DEM AMERIKANISCHEN VON ULRIKE CLEWING
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe THOSE WHO WISH ME DEAD erschien 2014 bei Little,Brown and Company
Vollständige deutsche Erstausgabe 05/2016Copyright © 2014 by Michael KorytaCopyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: Johannes Wiebel/punchdesign, MünchenUmschlagmotiv: © Johannes Wiebel unter Verwendung von dreamstime.com und shutterstock.comSatz: Fotosatz Amann, MemmingenISBN: 978-3-641-18618-0V002www.heyne.de
ERSTER TEIL
DER VERBORGENE ZEUGE
1
Am letzten Tag des Lebens von Jace Wilson stand der Dreizehnjährige am Rand eines Steinbruchs, den Blick auf das kalte, ruhige Wasser gerichtet, und verstand endlich, was ihm seine Mutter vor ein paar Jahren einmal gesagt hatte: Du kannst Schwierigkeiten bekommen, wenn du Furcht zeigst; noch größere Schwierigkeiten bekommst du aber, wenn du die Angst leugnest. Damals hatte Jace nicht so richtig verstanden, was sie damit meinte. Heute schon.
Vom Dach, wie sie die höchste Stelle nannten, war es ein Sprung aus etwa zwanzig Metern ins Wasser, und Jace hatte hundert Dollar gewettet – hundert Dollar, die er nicht einmal hatte –, und das alles nur, weil er ein bisschen Angst hatte durchblicken lassen. Natürlich war es eine dumme Wette, auf die er sich auch niemals eingelassen hätte, wenn die Mädchen nicht da gewesen wären, zugehört und gelacht hätten. Aber sie waren nun mal da gewesen, und deshalb ging es nicht nur um hundert Mäuse, sondern um eine Menge mehr als das, und ihm blieben zwei Tage, sich zu überlegen, wie er das regeln konnte.
Nicht alle, die sich vom Dach runtertrauten, hatten es geschafft. Sie hatten schon Leichen aus dem Steinbruch gezogen, ältere Jugendliche, Collegestudenten, vielleicht sogar Taucher. So genau wusste er das nicht. Aber dass von denen keiner große Höhen gescheut hatte, glaubte er fest.
»Was hast du dir da nur eingebrockt«, flüsterte er und blickte zu der Lücke im Drahtzaun zurück, die von dem alten Easton-Brothers-Steinbruch zu seinem Hinterhof führte. Sein Haus stand gleich hinter dem aufgelassenen Steinbruch, und Jace verbrachte dort Stunden mit Entdeckungstouren und Schwimmen – und damit, sich von den Felsvorsprüngen fernzuhalten. Denn das Einzige, was er in dem Steinbruch niemals tat, war, sich mit einem Kopfsprung in den See zu stürzen. Ihm war schon nicht wohl, wenn er den Abbruchkanten zu nahe kam; immer wenn er sich ein wenig zu nah herantraute, nur um einen kurzen Blick hinunter zu riskieren, wurde ihm schwindlig, er bekam weiche Knie und musste ganz schnell den Rückzug antreten. Vor ein paar Stunden hatten ihm all die Stunden, die er allein im Steinbruch verbracht hatte, zu der Lüge gereicht, die er brauchte. Als Wayne Potter anfing, ihn wegen der Höhenangst zu foppen, nur weil Jace die Leiter nicht hinaufsteigen wollte, die ein Handwerker am Schulgebäude hatte stehen lassen und über die man aufs Dach gelangte, hatte Jace ihn damit abgespeist, dass er keine Leiter hinaufsteigen müsse, um zu beweisen, dass ihn Höhen nicht schreckten, weil er im Steinbruch schließlich immer schon von den Felskanten ins Wasser springen würde. Und er wähnte sich sicher, dass Wayne sich das noch nie getraut hatte.
Natürlich hatte Wayne ihn prompt beim Wort genommen. Natürlich führte Wayne sofort das Dach ins Feld. Und natürlich hatte Wayne einen älteren Bruder, der am Wochenende mit ihnen dort hinausfahren würde.
»Du bist ein Idiot«, sagte Jace laut zu sich, während er den Kiesweg hinabging, der mit Zigarettenkippen und Bierdosen übersät war und zu einer der breiten Steinplatten in dem alten Steinbruch führte, von der er auf einen Tümpel blicken konnte, von dem er sicher war, dass er die nötige Tiefe besaß, um hineinspringen. Fang klein an, hatte er sich überlegt. Aus dieser Höhe, die er auf etwa fünf Meter schätzte, würde er es schaffen. Dann würde er zum nächsten gehen, wo es etwas höher war, zehn Meter mindestens. Er sah über das Wasser, und ihm wurde schwindlig. Das Dach war mindestens zweimal so hoch?
»Versuch es«, sagte er. Sich laut Mut zuzureden tat gut. Hier draußen, so allein, vermittelte es ihm ein wenig mehr Selbstvertrauen. »Versuch es einfach. Ein Sprung ins Wasser wird dich schon nicht umbringen. Nicht aus dieser Höhe.«
Immer noch ging er am Rand auf und ab, stets auf einen sicheren Abstand von einem Meter bedacht, als könnten seine Beine einfach unter ihm nachgeben und er kopfüber die Klippe hinunterstürzen, um dann mit gebrochenem Genick da unten im Wasser zu treiben.
»Feigling«, sagte er zu sich, denn so hatte man ihn an diesem Tag schon beschimpft, vor den Mädchen, und das hatte ihn so wütend gemacht, dass er – fast – die Leiter hinaufgestiegen wäre. Stattdessen hatte er sich zur Rettung seiner Ehre den verlassenen Steinbruch ausgesucht. Im Nachhinein betrachtet, hätte er vermutlich gut daran getan, die Leiter hinaufzusteigen.
Das Grollen des Donners hallte von den hohen Felswänden und vom Wasser wider, was im Steinbruch noch dumpfer und bedrohlicher klang, als er das oben auf der Straße täte. Schon auf dem Heimweg von der Schule war es sehr windig gewesen, aber die Böen hatten an Kraft deutlich zugenommen. Staub wirbelte zwischen den Steinen auf, und von Westen her eilten zwei tiefschwarze Wolken heran, die zuckende Blitze mit sich schleppten.
Kein guter Zeitpunkt, ins Wasser zu gehen. An den Gedanken klammerte er sich, lieferte er ihm doch einen guten Grund, nicht zu springen. »Wayne Potter ist es nicht wert, sich von einem Blitz das Lebenslicht ausknipsen zu lassen.«
Also machte er sich auf den Rückweg und hatte die Lücke im Zaun schon fast erreicht, als er innehielt.
Wayne Potter war immer noch da. Und kommenden Samstag würde er mit seinem Bruder da sein, und sie würden Jace zum Dach mitnehmen und zusehen, wie ihm vor Angst die Pisse das Bein hinunterlief, und sich den Arsch ablachen. Und am Montag würde Wayne in die Schule kommen und alles erzählen, wenn er nicht schon vorher alle angerufen hatte. Oder, noch schlimmer, er würde sie alle mitschleppen, damit sie zusehen konnten. Und wenn er auch noch die Mädchen mitbringt?
Diese Vorstellung brachte ihn zu einem Entschluss. Ein Kopfsprung ins Wasser war schon schlimm genug, aber vor den Augen der Mädchen nicht zu springen? Das war schlimmer, und der Preis um einiges höher.
»Du solltest doch springen«, sagte er. »Los, Junge, reiß dich zusammen. Spring einfach.«
Zügig machte er sich auf den Weg zurück, denn wenn er sich jetzt zu viel Zeit ließ, baute sich nur Angst in ihm auf. Deshalb wollte er sich beeilen, es hinter sich bringen, damit er wusste, dass er es schaffen konnte. War der Anfang erst mal gemacht, wäre der Rest nur noch ein Kinderspiel. Er musste ja nur von ein wenig höher springen, das war alles. Er trat sich die Schuhe von den Füßen, zog T-Shirt und Jeans aus und ließ sie auf den Fels fallen.
Als der nächste Donner niederkrachte, hielt er sich die Nase mit Daumen und Zeigefinger zu – wie ein Kleinkind, ja, und es war ihm egal – und redete wieder auf sich ein.
»Ich bin kein Feigling.«
Mit zusammengedrückter Nase klang seine Stimme hoch und mädchenhaft. Ein letztes Mal sah er auf das Wasser hinab, schloss die Augen, ging in die Knie und stieß sich von der Felskante ab.
So hoch war es gar nicht. All seiner Angst zum Trotz war es schnell vorbei und endete schmerzfrei, abgesehen von dem Schreck, der ihn durchfuhr, als er in das eiskalte Wasser tauchte. Er ließ sich auf den Grund sinken – Wasser machte ihm nicht das Geringste aus, er schwamm gern, nur hineinspringen mochte er nicht – und wartete auf den Moment, in dem er glatten, kühlen Stein berührte.
Das passierte jedoch nicht. Stattdessen traf er mit den Füßen auf etwas Seltsames, etwas, das sich irgendwie weich und trotzdem hart anfühlte. Erschreckt zuckte er zurück, denn was es auch war, es gehörte nicht hierher. Er öffnete die Augen, blinzelte in das Wasser, das ihm in den Augen brannte, und sah den Toten.
Er saß fast aufrecht mit dem Rücken an den Stein gelehnt, die Beine vor sich ausgestreckt. Der Kopf war zur Seite geneigt, als wäre er müde. Das blonde Haar schwebte in der Strömung, die Jace erzeugt hatte, und erhob sich in Strähnen über dem Kopf des Toten, als tanzte es im dunklen Wasser. Die Oberlippe war hochgezogen, als würde er jemanden anlächeln, ein gemeines, höhnisches Grinsen, das Jace die Zähne zeigte. Die Füße waren an den Knöcheln mit einem Seil zusammengebunden, das an einer alten Hantel festgemacht war.
Einen kurzen Moment lang schwebte Jace über ihm, keine anderthalb Meter von ihm entfernt. Vielleicht lag es an dem trüben Wasser, durch das er ihn sah, dass er das Gefühl hatte, nichts zu tun zu haben mit dem, was er da sah, dass er sich die Leiche hier unten nur einbildete. Erst als er erkannte, warum der Kopf des Mannes zur Seite geneigt war, überkam ihn das Grauen, das ihn eigentlich gleich hätte packen müssen. Die Kehle des Mannes war durchschnitten. Der Spalt war so breit, dass das Wasser wie durch eine offene Rinne strömte. Der Anblick ließ Jace mit hektischen, zappelnden Bewegungen an die Oberfläche zurückschnellen. Es waren keine fünf Meter, die er zu bewältigen hatte, dennoch glaubte er nicht, es nach oben zu schaffen, war überzeugt, ertrinken und für immer neben der anderen Leiche liegen zu müssen.
Kaum an der Wasseroberfläche wollte er um Hilfe schreien, aber das Ergebnis war kläglich. Er bekam Wasser in den Mund, verschluckte sich, und ihn ergriff das Gefühl zu ertrinken, weil er auch über Wasser nicht atmen konnte. Schließlich bekam er Luft und spuckte aus, was sich an Wasser in seinem Mund gesammelt hatte.
Wasser, das den Toten schon umspült hatte.
Übelkeit stieg in ihm auf, und er schwamm um sein Leben, bis er feststellte, dass er die falsche Richtung zu den Steilhängen gewählt hatte, wo es keine Stelle gab, an der er herauskommen konnte. Von Panik ergriffen, drehte er sich um und erspähte ein paar niedrige Felsen. Um ihn herum hallte der Donner, als er mit dem Kopf untertauchte und schwamm. Der erste Versuch, sich mit den Armen herauszuziehen, misslang. Er glitt ins Wasser zurück und tauchte wieder mit dem Kopf unter.
Na los, Jace! Mach, dass du rauskommst, du musst raus hier …
Der zweite Versuch gelang. Er ließ sich auf den Bauch fallen, und das Wasser rann an ihm herunter. Wieder war es in seinem Mund, tropfte ihm von den Lippen, und erneut stellte er sich vor, wie es durch die klaffende Wunde in der Kehle des Toten geströmt war. Er würgte und erbrach sich auf die Felsen. Hals und Nase brannten. Auf allen vieren und mit letzter Kraft zog er sich vom Wasser weg, als könnte es nach ihm greifen, sein Bein packen und ihn wieder hineinziehen.
»Verdammte Scheiße«, keuchte er. Nicht nur seine Stimme zitterte. Er bebte am ganzen Körper. Als er glaubte, seine Beine könnten ihn wieder tragen, stand er vorsichtig auf. Die Böen der Gewitterfront ließen das Wasser auf seiner Haut und die tropfnasse Boxershorts noch kälter erscheinen. Er schlang die Arme um sich und erwischte sich bei dem albernen Gedanken: Ich habe mein Handtuch vergessen. Erst jetzt bemerkte er, dass er auf der falschen Seite des Steinbruchs aus dem Wasser gestiegen war. Seine Kleider lagen auf einem Haufen auf der gegenüberliegenden Seite.
Ihr wollt mich wohl verarschen, dachte er, während er die steilen Felswände hinaufsah, die seine Seite des Sees begrenzten. Dort hinaufzuklettern dürfte nicht einfach sein. Eigentlich war er nicht mal sicher, ob es überhaupt ging. Über ihm nichts als steil aufragender glatter Stein. Weiter unten, unterhalb des Sees, gab es einen Abhang, der zu einem Gelände hinabführte, das mit Büschen und Dornenhecken übersät war. Ohne Schuhe und Hose würde es ein beschwerlicher, schmerzhafter Weg werden. Dabei könnte es so schnell gehen: einfach zurück ins Wasser und hinüberschwimmen.
Er starrte auf den Kleiderhaufen, der so nah vor ihm lag, dass er mühelos einen Stein hätte hinüberwerfen können. Das Handy steckte in der Tasche seiner Jeans.
Ich muss Hilfe holen, dachte er, ich muss jemanden herholen. Und zwar schnell.
Aber er rührte sich nicht von der Stelle. Die Vorstellung, zurück in dieses Wasser zu springen … er starrte in das trübe, grüne Nass, das jetzt noch dunkler zu sein schien, als es zuvor schon gewesen war. Und plötzlich zuckte ein greller Blitz, das Gewitter zog schnell heran.
»Er wird dir schon nichts tun«, sagte er, während er in kleinen Schritten auf das Wasser zuging. »Er wird nicht aufwachen und dich schnappen.«
Während er sich das einredete, fiel ihm etwas auf, das er in dem verzweifelten Bemühen, wegzukommen, zuerst gar nicht bemerkt hatte. Wieder aufwachen würde der Mann nicht, nein, aber er war vor gar nicht langer Zeit seines Lebens beraubt worden. Die Haut, das Haar, seine Augen, die hochgezogene, an die Zähne gepresste Lippe … selbst die Wunde an seinem Hals war noch nicht in Zersetzung übergegangen. Jace war sich nicht sicher, wie lange so etwas dauerte, aber ihm schien, dass es schneller ging als das, was er gerade gesehen hatte.
Er ist noch nicht lange da …
Dieses Mal ließ ihn der Donner zusammenfahren. Er sah sich im Steinbruch um, sein Blick wanderte die oberen Abbruchkanten entlang, hielt Ausschau nach jemandem, der ihn vielleicht beobachtete.
Niemand zu sehen.
Mach, dass du hier wegkommst, wies er sich an, konnte sich aber nicht überwinden, loszuschwimmen. Unvorstellbar der Gedanke, wieder in dieses Wasser zu tauchen, über den Mann mit den durch eine Hantel beschwerten, zusammengebundenen Füßen, dem zur Seite geneigten Kopf und der durchgeschnittenen Kehle hinwegzuschwimmen. Also machte er sich auf den Weg zum Abhang. Dort bildete ein Wall aus Felsplatten eine Verbindung zwischen den beiden Seiten, der Tümpel, in dem er gerade gewesen war, auf der Rechten, der andere zur Linken. Zu dem See auf der linken Seite ging es ungeheuerliche zehn Meter hinab, die er sich als nächste Stufe zum Üben für das Dach ausgesucht hatte. Aus unerfindlichen Gründen konnten sich Pflanzen auf der schmalen Platte halten, wenn auch nur niedere. Die Gewächse zwischen den Steinen schienen ausnahmslos Dornen zu tragen. Fast wäre er in die Scherben einer zerbrochenen Flasche getreten, während er sich durch das Gestrüpp arbeitete. Dornen verhakten sich in seinem Fleisch. Er verzog das Gesicht, ging aber langsam weiter, während warmes Blut sich in das kalte Wasser an seinen Beinen mischte. Erste Regentropfen fielen herab, und über ihm grollte der Donner und hallte von den Steilwänden wider, als wollte die Erde ihm etwas entgegensetzen.
»Verdammt!« Er war auf einen Dorn getreten, der ihn in die Fußsohle stach und beim nächsten Schritt noch tiefer hineingetreten wurde. Auf einem Bein stehend, hatte er sich den Dorn gerade herausgezogen, das Blut quoll aus dem Stich hervor, als er Motorengeräusche vernahm.
Zuerst dachte er, dass es Sicherheitsleute wären oder etwas in der Art. Das wäre gut. Das wäre sogar wunderbar, denn, was immer er sich für seinen Ausflug in den Steinbruch einfangen würde, war es wert, hier rauszukommen. Eine Weile rührte er sich nicht vom Fleck, auf einem Bein balancierend, den blutenden Fuß in der Hand, und lauschte. Das Motorengeräusch kam näher, jemand fuhr den Kiesweg hinauf, der von einem verschlossenen Tor versperrt war.
Der Mörder kommt zurück, schoss es ihm durch den Kopf, und im selben Augenblick schlug starre Unentschlossenheit in blankes Entsetzen um. Er stand mitten auf dem Wall, auf der am besten einzusehenden Stelle im ganzen Steinbruch.
Er drehte sich um, wollte zu der Stelle zurück, von der er gekommen war, und hielt inne. Dort hatte er keine Deckung. Der Fels war kahl, nichts, wohinter er sich verstecken konnte. Er wirbelte wieder in die andere Richtung, versuchte sich durch das Gestrüpp zu kämpfen, beachtete die Dornen nicht mehr, die an ihm rissen und Rinnsale von Blut an seinem Oberkörper, an den Armen und an den Beinen hervortreten ließen.
Das Motorgeräusch war jetzt ganz nah.
Zur anderen Seite würde er es nicht mehr schaffen. Dazu war er nicht schnell genug.
Jace Wilson sah auf das Wasser unter ihm hinunter, ein hastiger Versuch, eine Stelle zu finden, wo er sicher landen könnte, obwohl das Wasser zu dunkel war, um erkennen zu lassen, was sich unter der Oberfläche befand. Dann sprang er. Fast schien es, als ginge es darum, bei seiner Angst noch einen draufzusatteln – Höhenangst war das eine, aber wer auch immer da kam, schürte ihn ihm keine Angst. Es war der blanke Schrecken.
Dieses Mal fühlte sich der Sprung echt an und lang, als hätte er sich von einem wirklich hohen Punkt hinabgestürzt. Er dachte an Steine und Metallteile, an all den Müll, der in solchen Steinbrüchen zurückgelassen wurde. All die Dinge, vor denen sein Dad ihn immer gewarnt hatte, als er mit dem Stock ins Wasser schlug und darin herumstocherte. Er versuchte, nicht zu tief hinabzugleiten, aber er sank schnell, und obwohl er versuchte, schnell wieder aufzusteigen, tauchte er bis auf den Grund hinab. Der Tümpel war nicht so tief, wie er erwartet hatte. Unsanft landete er mit den Füßen auf dem Stein. Ein stechender Schmerz schoss ihm in die Wirbelsäule. Er stieß sich ab, stieg langsam auf und konzentrierte sich darauf, dieses Mal möglichst geräuschlos an die Oberfläche zu kommen.
Genau in dem Moment, als er mit dem Kopf die Wasseroberfläche durchbrach, wurde der Motor abgestellt. Der Wagen blieb stehen. Er schwamm auf eine Kalksteinplatte zu, die schräg aus dem Wasser ragte und ihm einen engen Spalt bot, in den er hineinschlüpfen konnte. Kaum hatte er ihn erreicht, riskierte er einen Blick nach oben und entdeckte den Mann, der zum Wasser herunterkam. Groß und breitschultrig, mit langem, blassblondem Haar. Mit gesenktem Kopf ging er den Pfad entlang. Jace hatte er noch nicht gesehen. Die Gewitterwolken hatten es dämmrig werden lassen im Steinbruch. Aber beim nächsten Blitz sah Jace eine Marke aufleuchten, und er begriff, dass der Mann Uniform trug.
Polizei. Entweder hatte irgendjemand sie schon gerufen, oder sie hatten auf andere Weise Wind davon bekommen. Aber was auch immer sie hierher geführt hatte, interessierte Jace nicht. Sie waren hier. Hilfe war da. Er atmete tief aus, holte Luft und wollte schon laut um Hilfe rufen, als er die anderen erspähte.
Noch ein Polizist, ebenfalls blond, das Haar kürzer geschnitten, als wäre er beim Militär. Er trug ebenfalls eine Waffe am Gürtel, und er schob einen Mann in Handschellen vor sich her, dessen Kopf von einer schwarzen Kapuze verhüllt war.
Jace unterdrückte einen Schrei, rührte sich nicht, hielt sich mit den Füßen und einer Hand am Felsen fest, krampfhaft bemüht, sich ja nicht zu bewegen. Nicht zu atmen.
Der erste Polizist wartete, bis die anderen Männer ihn eingeholt hatten. Mit über der Brust verschränkten Armen stand er da und sah zu, wie der Mann, der wegen der Kapuze nichts sehen konnte, vorwärtsstolperte. Der Mann mit der Kapuze versuchte etwas zu sagen, vergeblich. Außer einer Reihe seltsam hoher Laute brachte er nichts hervor.
Er hat etwas über dem Mund, begriff Jace. Die Worte konnte er nicht verstehen, ihre Bedeutung jedoch war ihm klar: Der Mann flehte ihn an. Er hatte Angst und flehte um Gnade. Wie ein Hündchen wimmerte und winselte er. Als der erste Polizist mit dem Fuß ausholte und den Mann in der Kapuze zu Fall brachte, sodass er, blind wie er war und auf den Sturz nicht gefasst, hart auf dem Boden aufschlug, wäre Jace fast ein Schrei entwichen. Er musste sich auf die Lippe beißen, um unbemerkt zu bleiben. Der zweite Bulle, der den Mann vom Auto hierher gebracht hatte, kniete sich hin, rammte ihm ein Knie in den Rücken und riss ihm den Kopf an der Kapuze hoch. Dann beugte er sich vor und sprach mit ihm, ganz leise, als ob er flüsterte. Jace konnte es nicht verstehen. Der Cop sprach immer noch mit dem Mann mit der Kapuze, während er zugleich die Hand ausstreckte und ungeduldig mit den Fingern zappelte, als wartete er auf etwas. Der erste Cop reichte ihm ein Messer. Kein Taschenmesser oder Küchenmesser, sondern eines, wie es Soldaten haben. Ein Kampfmesser. Ein richtiges Messer.
Jace sah eine schnelle Bewegung mit dem Messer, dann ein Zucken des Kopfes und anschließend das Krampfen der Füße, die haltsuchend über den Boden schabten, während der Mann versuchte, die zusammengebundenen Hände zum Hals zu bringen, um das Blut zurückzudrängen, das unter der Kapuze hervorquoll. Schließlich packten ihn die beiden Polizisten mit flinkem, geübtem Griff, fassten von hinten die Kleidung, darauf bedacht, das Blut nicht zu berühren, und stießen ihn vom Felsen. Er stürzte hinab und fiel genau so, wie Jace es getan hatte. Er war schneller als sein eigenes Blut, das ihm in einer roten Wolke über dem Kopf stand, als er auf die Wasserfläche traf.
Bei dem Geräusch des Aufschlags zuckte Jace zusammen. Jetzt, da nur noch die beiden da oben übrig waren, nicht mehr abgelenkt, würden sie sich wahrscheinlich umsehen, ihn vermutlich entdecken. Er drückte sich unter den Felsen, zog sich ins Dunkel zurück und tastete sich mit den Fingern weiter, um möglichst weit nach hinten zu gelangen. Aber weit kam er nicht. Wenn jemand auf der anderen Seite auf gleicher Höhe stand, würde er ihn unschwer sehen. Aber dafür müsste er sich im Wasser befinden. Wenn sie so weit herunterkamen, würde ihm sein Versteck zum Verhängnis werden. Weglaufen konnte er nicht. Sein Atem wurde schneller, hastiger, ihm wurde schwindlig, und wieder hatte er das Gefühl, sich übergeben zu müssen.
Nur nicht jetzt, sei still, mach jetzt bloß kein Geräusch.
Sekundenlang war es still. Sie würden gehen. Er dachte, dass sie wahrscheinlich gehen und er endlich hier rauskommen würde, nach all dem heute noch nach Hause käme.
In diesem Augenblick vernahm er eine ihrer Stimmen zum ersten Mal laut und vernehmlich: »Na so was. Sieht so aus, als wäre hier jemand schwimmen gegangen und hätte dann seine Sachen zurückgelassen.«
Die Stimme klang so sanft, dass Jace gar nicht glauben konnte, dass sie einem der Männer gehörte, die da oben gerade noch jemanden mit dem Messer umgebracht hatten. Das schien unmöglich.
Eine Pause entstand, bis der zweite Mann antwortete: »Klamotten sind das eine. Aber auch die Schuhe?«
»Ziemlich unwirtliches Gelände«, stimmte die erste Stimme zu. »Ohne Schuhe geht es sich hier bestimmt nicht gut.«
Die seltsam gelassen klingenden Stimmen verstummten. Ein anderes Geräusch drang ihm ans Ohr, ein helles, metallisches Klicken. Jace war oft genug mit seinem Dad auf dem Schießstand gewesen, um zu wissen, was es war: das Durchladen einer Waffe.
Die Männer kamen um den Rand des Steinbruchs herum, und unten, unter ihnen, eingezwängt zwischen dunklen Felsen, fing Jace Wilson an zu schreien.
2
Sie wollten gerade zu Bett gehen, als der Wetterwarnfunk ansprang und mit körperloser Roboterstimme anfing, auf Ethan und Allison einzureden.
»Ein gewaltiges Frühjahrs-Sturmtief bringt weitere schwere Schneefälle in den Bergen … mit den stärksten Niederschlägen ist oberhalb von zweitausendzweihundert Metern zu rechnen … aber auch in geringeren Höhen bis zu eintausenddreihundert Metern sind bis zum Morgen mehrere Zentimeter Schnee möglich. Schwerer nasser Schnee auf Bäumen und Stromleitungen kann zu Stromausfällen führen. Eine Abschwächung der Schneefälle wird bis Sonntagmorgen erwartet. An den Nord- und Ostflanken der Berge werden dreißig bis fünfzig Zentimeter Neuschnee, und örtlich sogar mehr erwartet. Auf Gebirgsstraßen ist heute Nacht mit Schnee- und Eisglätte zu rechnen. Einige Straßen, einschließlich des Beartooth Pass, könnten unpassierbar sein.«
»Weißt du, was ich an dir so mag?«, fragte Allison. »Du hast das Ding eingeschaltet, obwohl wir schon seit vier Stunden zusehen, wie der Schnee vom Himmel fällt. Wir wissen doch, was los ist.«
»Vorhersagen können sich auch ändern.«
»Hm, ja. Und Menschen können schlafen. Lass uns lieber das tun.«
»Könnte lustig zugehen, da draußen«, sagte Ethan. »Bestimmt ist wieder jemand auf die grandiose Idee gekommen, heute Morgen vor dem Wettereinbruch noch eine kleine Wanderung zu unternehmen. Und natürlich braucht man keine Karte, denn es sollte ja nur eine kurze Wanderung werden.«
Wegen solcher und ähnlicher Einfälle wurde Ethan mitten in der Nacht immer wieder in die Berge gerufen. Besonders bei Unwettern am Saisonende, wenn die Temperaturen schon so lange sehr mild gewesen waren, sodass sich die Menschen in trügerischer Sicherheit wähnten.
»Dann hoffen wir mal, dass diese Irren zu Hause geblieben sind«, sagte Allison, küsste ihn auf den Arm und suchte sich eine gemütlichere Position. Ihre Stimme klang schon schläfrig.
»Ein frommer Wunsch«, entgegnete er, zog sie an sich und genoss ihre Wärme. Die Hütte hatte sich schnell abgekühlt, nachdem sie das Feuer im Holzofen hatten niederbrennen lassen. Neben ihnen prasselte unaufhörlich Graupel gegen die Fensterscheibe. Das CB-Funkgerät, das auf dem Regal über dem Bett neben dem Wettermelder stand, verstummte. Es war ein angenehmer Winter gewesen – nur ein Einsatz. Die Wintermonate waren in Montana meistens besser als die anderen Monate. Zu dieser Zeit hielten sich die Touristen fern. Aber Ethan war bei diesem Unwetter nicht wohl. Es war der letzte Tag im Mai, der Sommer stand vor der Tür. Hatte nicht gerade noch eine Woche lang die Sonne geschienen, und waren die Temperaturen nicht schon auf zehn Grad Celsius angestiegen? Richtig. Und genau deshalb wird es einige Irre, wie Allison sie nannte, in die Berge gezogen haben. Und kaum blieben sie irgendwo stecken, würde das Funkgerät über Ethan Serbins Kopf krächzend zum Leben erwachen, und der Such- und Rettungsdienst würde sich zusammenfinden.
»Ich habe ein gutes Gefühl«, murmelte Allison ins Kissen, während sie wie immer schnell wegdämmerte; sie gehörte zu den Menschen, die vermutlich auch auf dem Rollfeld eines stark frequentierten Flughafens problemlos Schlaf fanden.
»Ach ja?«
»Ja. Aber für den Fall, dass ich mich irren sollte, schalte dein Funkgerät ab. Zumindest diese Narrenfrequenz.«
Er lächelte sie im Dunkeln an, zwickte sie noch einmal, und machte die Augen zu. Innerhalb weniger Minuten war sie eingeschlafen, ihre Atemzüge wurden länger, und er spürte ihr langsames Atmen an seiner Brust. Er lauschte, während sich der Graupel wieder in Schnee verwandelte, das Prasseln gegen die Scheibe schwächer wurde, bis es still war und schließlich auch er wegdämmerte.
Als das Funkgerät ansprang, wachte Allison stöhnend auf.
»Nein«, entfuhr es ihr. »Nicht heute Nacht.«
Ethan sprang aus dem Bett, fingerte das Mobilteil von der Basis, verließ das Schlafzimmer und ging zum großen Frontfenster. In der Hütte war es vollständig dunkel; kurz nach Sonnenuntergang war der Strom ausgefallen, und den Generator hatte er nicht mehr eingeschaltet, da man fürs Schlafen keinen Brennstoff verschwenden musste.
»Serbin? Hören Sie.« Die Stimme gehörte Claude Kitna, dem Sheriff von Cooke County.
»Ja, ich höre«, antwortete Ethan, während er in die weiß verschneite Welt draußen vor der dunklen Hütte hinausblickte. »Wer wird vermisst, und wo, Claude?«
»Niemand wird vermisst.«
»Dann lass mich schlafen.«
»Jemand ist von der Straße abgekommen. Wollte den Pass überqueren, als wir ihn gerade sperren wollten.«
Der Pass war der Beartooth Pass auf dem Highway 212 zwischen Red Lodge und Cooke City. Der Beartooth Highway, wie der 212 auch genannt wird, war einer der schönsten – und gefährlichsten – Highways im Land, mit unendlich vielen sehr steilen Kehren, die sich zwischen Montana und Wyoming bis auf über dreitausend Meter hinaufwanden. In den Wintermonaten war er geschlossen. Der ganze Highway wurde einfach zugemacht und frühestens Ende Mai wieder freigegeben. Ihn zu befahren erforderte schon bei bestem Wetter höchste Konzentration, aber im Schneesturm und im Dunkeln? Viel Spaß.
»Okay«, sagte Ethan in das Funkgerät. »Wozu brauchen die mich?« Er rückte mit seinem Team nur aus, wenn jemand vermisst wurde. Wenn aber jemand vom Highway abkam oder, wie Claude einen richtigen Absturz gern nannte, einen Hüpfer machte, waren Sanitäter gefordert, oder der Leichenbeschauer, der Coroner, nicht aber der Such- und Rettungsdienst.
»Die Fahrerin, die auf die glorreiche Idee kam, es unbedingt zwingen zu müssen, sagt, sie wollte zu dir. Die Parkranger haben mich verständigt. Hab sie gerade in einen Schneepflug gesetzt. Willst du mit ihr sprechen?«
»Sie wollte zu mir?«, wunderte sich Ethan. »Wie heißt sie denn?«
»Eine gewisse Jamie Bennett«, sagte Claude. »Und für eine Frau, die gerade ihren Mietwagen vom Berg geschubst hat, ist sie ganz schön kess, muss ich sagen.«
»Jamie Bennett?«
»Genau. Kennst du sie?«
»Klar«, meinte Ethan verwirrt. »Natürlich kenne ich sie.«
Jamie Bennet war professionelle Personenschützerin. Seit er die Air Force verlassen hatte, verdingte sich Ethan als privater Überlebenstrainer und arbeitete mit Zivilisten und Gruppen, die ihm von der Regierung geschickt wurden. Jamie hatte zu einer Gruppe gehört, die er vor einem Jahr trainiert hatte. Er hatte sie gemocht, und sie war gut, professionell, wenn auch ein klein wenig überdreht. Aber er konnte sich nicht vorstellen, was sie dazu gebracht hatte, im Schneesturm über den Beartooth Pass zu fahren, um zu ihm zu kommen.
»Was ist los mit ihr?«, erkundigte sich Claude Kitna.
Ethan konnte ihm das alles jetzt nicht erzählen.
»Ich komme zu euch raus«, sagte er. »Dann werde ich es erfahren.«
»Verstanden. Sei vorsichtig. Es ist heute Nacht ziemlich ungemütlich hier draußen.«
»Ich pass schon auf. Bis gleich, Claude.«
Im Schlafzimmer stützte sich Allison auf einem Arm auf und sah ihm zu, während er sich anzog.
»Wohin fährst du?«
»Zum Pass hoch.«
»Versucht wieder jemand, sich nach einem Unfall selbst durchzuschlagen?«
Das war schon oft passiert. Aus Angst, nicht mehr wegzukommen, gerieten Menschen in Panik, marschierten auf dem Highway einfach los und verirrten sich im Schneegestöber. Sich zu verirren, schien eigentlich unmöglich, jedenfalls solange man noch keinen Blizzard in den Rocky Mountains erlebt hatte.
»Nein. Jamie Bennett hat versucht, zu uns durchzukommen.«
»Die von den Marshals? Letztes Frühjahr?«
»Ja.«
»Was macht sie denn in Montana?«
»Es heißt, sie wollte mich besuchen.«
»Mitten in der Nacht?«
»Haben sie gesagt, ja«, wiederholte er.
»Das kann nichts Gutes bedeuten«, sagte Allison.
»Es wird schon nichts Schlimmes sein.«
Aber als er die Hütte verließ und sich im dichten Schneetreiben zu seinem Schneemobil vorkämpfte, wusste er, dass es so nicht war.
In dieser Nacht wollte es auf eine magische Weise nicht vollständig dunkel werden, wie das nur in Schneenächten möglich war, in denen das Licht der Sterne und des Mondes verschluckt und die Landschaft in ein irisierendes Blau getaucht wurde. Claude Kitna hatte nicht gelogen – ein kräftiger Wind blies in ungestümen Böen aus nördlicher und nordöstlicher Richtung und trieb dicken, nassen Schnee vor sich her. Ethan fuhr allein auf der Straße, und er fuhr langsam, obwohl er den 212 kannte wie kaum ein anderer und er schon mehr Stunden bei schlechtem Wetter dort zugebracht hatte als sonst jemand. Und genau deshalb fuhr er mit mäßigem Tempo, obwohl er wusste, dass er aus seinem großen Schneemobil mehr herausholen konnte. An den Einsätzen, bei denen es galt, Tote zu bergen, waren nicht selten Schneemobile und Geländewagen beteiligt, deren Fahrer zu sehr davon überzeugt waren, ihre Fahrzeuge im Griff zu haben, die ja schließlich gebaut worden waren, um den Naturgewalten zu trotzen. Wenn er während seines Trainings überall auf der Welt eines gelernt hatte – und diese Lektion hatte er nicht zuletzt in Montana gelernt –, dann dieses: Der Glaube, mit welchem Gerät auch immer die Naturgewalten beherrschen zu können, führte direkt in die Katastrophe. Den Kräften der Natur passte man sich respektvoll an, man steuerte sie nicht.
Eine Stunde brauchte er für die Strecke, die er normalerweise in zwanzig Minuten zurücklegte, um zum Beartooth Pass zu kommen, wo er von orange leuchtenden Fahrbahnsignalen, den sich vor dem Nachthimmel abzeichnenden Gipfeln, einem Schneepflug und einem Polizeiauto empfangen wurde, die auf der Straße abgestellt waren. Ein schwarzer Chevy Tahoe war gegen die Leitplanke gekracht. Ethan begutachtete die Position des Wagens und schüttelte den Kopf. Das war verdammt knapp gewesen. Dasselbe Manöver in einer der Kehren, und der Tahoe wäre ein langes Stück durch die Luft geflogen, bevor er auf den Felsen aufgeschlagen wäre.
Er stellte das Schneemobil ab und beobachtete, wie der Schnee, von den Blinklichtern in orangefarbenes Licht getaucht, in den dunklen Schluchten unter ihm herumwirbelte. Er fragte sich, ob da draußen in der Wildnis irgendjemand herumirrte, von dem sie nichts wussten, jemand, der nicht so viel Glück gehabt hatte wie Jamie Bennett. An dem sich windenden Highway entlang waren in festen Abständen hohe dünne Stäbe aufgestellt, Markierungen, an denen die Schneepflüge sich orientieren konnten, wenn der Schnee die Straße in ein großes Ratespiel für Blinde verwandelte. Auf der windabgewandten Straßenseite hatte sich der Schnee schon einen halben Meter, in manchen Schneewehen sogar schon einen Meter aufgetürmt.
Die Beifahrertür des Räumfahrzeugs flog auf, und Jamie Bennet stieg aus der Kabine und trat in den Schnee hinaus, noch bevor Ethan den Motor abgestellt hatte. Die Füße rutschten unter ihr weg, und sie wäre fast auf dem Hintern gelandet, wenn sie sich nicht im letzten Moment am Türgriff festgehalten hätte.
»In was für einer Scheißgegend leben Sie eigentlich, in der es am letzten Tag im Mai noch einen Blizzard gibt?«
Sie war fast so groß wie er. Ihr blondes Haar lugte unter einer Skimütze hervor, und ihre blauen Augen tränten von dem beißenden Wind.
»Es gibt so wunderbare Sachen«, entgegnete er, »die man Wettervorhersagen nennt. Sind ziemlich neu, glaube ich, befinden sich noch in der Experimentierphase. Aber es lohnt sich trotzdem, hin und wieder hereinzuhören. Zum Beispiel wenn man, oder besser noch, bevor man nachts durch ein Bergmassiv fährt.«
Sie lächelte und reichte ihm ihre behandschuhte Hand.
»Ich habe den Wetterbericht gehört, dachte aber, ich würde durchkommen. Keine Sorge«, sagte sie, »ich halte immer an meiner positiven Grundhaltung fest.«
Das war einer von Ethans sieben Grundsätzen zum Überleben aus dem Kurs, an dem Jamie teilgenommen hatte. Eigentlich sogar der wichtigste.
»Schön, dass Sie das behalten haben. Aber trotzdem, was treibt Sie her?«
Claude Kitna beobachtete sie interessiert, hielt sich diskret im Hintergrund, nicht aber so weit, dass er das Gespräch nicht mehr mithören konnte. Ein Stück weiter die Straße hinauf tauchten die Scheinwerfer eines weiteren Pflugs auf, der vom nun geschlossenen Passeingang zurückkehrte. Der Beartooth Highway war ab sofort für den gesamten Verkehr gesperrt. Vor vier Tagen erst hatte der Pass zum ersten Mal in der die Saison wieder aufgemacht. Letztes Jahr war er sogar bis zum zwanzigsten Juni zugeblieben. Die Gegend war inzwischen um einiges zugänglicher als früher, was aber nicht hieß, dass es keine Wildnis mehr war.
»Ich hätte da ein Angebot für Sie«, sagte Jamie. »Eine Bitte. Kann sein, dass Sie ablehnen. Aber ich möchte, dass Sie es sich zumindest erst mal anhören.«
»Klingt verheißungsvoll«, sagte Ethan. »Ein Job, der einem mit einem Blizzard angetragen wird, kann nur Gutes bedeuten.«
Natürlich war das angesichts des Sturms, des Schneetreibens und der orange flackernden Absperrungsleuchten ein Scherz. Wochen später aber, unter sengender Sonne und inmitten all des Rauchs, würde er sich an diesen Satz erinnern, und es würde ihm eiskalt den Rücken hinunterlaufen.
3
Als sie zur Hütte zurückkamen, hatte Allison im Ofen schon Feuer gemacht.
»Soll ich den Generator anschalten?«, fragte sie. »Und etwas Licht machen?«
»Nein danke, ist nicht nötig«, sagte Jamie.
»Kann ich Ihnen wenigstens einen Kaffee machen?«, erkundigte sich Allison. »Zum Aufwärmen?«
»Ein Bourbon wäre mir, ehrlich gesagt, lieber. Wenn Sie einen da haben.«
»Wie gesagt, einen Kaffee gerne«, sagte Allison lächelnd. Dann gab sie einen Schuss Maker’s-Mark-Whiskey in einen Becher mit dampfendem Kaffee und reichte ihn Jamie, die noch dabei war, sich aus Jacke und Handschuhen zu schälen, und dabei so viel Schnee abschüttelte, dass sich auf den Dielen vor dem Ofen wässrige Rinnsale bildeten.
»Soll mir recht sein. Danke. Es ist eisig draußen. Leben Sie hier tatsächlich das ganze Jahr über?«
Ethan lächelte: »Tun wir, ja.«
Allison reichte auch Ethan einen Becher heißen Kaffee, den er dankbar annahm, um seine Hände zu wärmen. Selbst seine erstklassigen Handschuhe konnten dem Wind nicht trotzen. Allison suchte seinen Blick, um herauszubekommen, was diese Frau bei dem Schneesturm zu ihnen geführt hatte. Seinem angedeuteten Kopfschütteln entnahm sie, dass er es selbst noch nicht wusste.
»Ist ja traumhaft, hier bei Ihnen«, sagte Jamie, während sie an ihrem mit Whiskey versetzten Kaffee nippte. »Und das alles haben Sie selbst gebaut?«
»Mit ein wenig Hilfe, ja.«
»Haben Sie ihr einen Namen gegeben? Macht man das nicht mit einer Ranch?«
Er lächelte. »Es ist keine Ranch, aber wir haben sie ›das Ritz‹ getauft.«
»Dafür scheint es mir doch ein wenig zu rustikal.«
»Soll es ja auch«, sagte Allison. »Das ist ja der Witz.«
Jamie sah sie an und nickte. »Ach, tut mir übrigens leid, dass ich hier mitten in der Nacht und bei dem Unwetter einfach so hereinplatze, ins Ritz.«
»Wird schon seinen Grund haben«, entgegnete Allison. Sie trug eine weite Trainingshose und ein etwas engeres, langärmliges Oberteil. Barfuß war sie bestimmt fünfzehn Zentimeter kleiner als Jamie Bennett. Es war nicht der Sturm, der Allison zu schaffen machte – sie kam aus Montana, lebte hier in der dritten Generation und war die Tochter eines Farmers –, vielmehr hatte Ethan das Gefühl, dass es Jamie war. Und das nicht, weil sie mitten in der Nacht aufgetaucht war. An solche Einsätze hatte Allison sich inzwischen gewöhnt.
»Hat es, ja«, sagte Jamie und wandte sich wieder Ethan zu. »Machen Sie noch diese Trainingskurse im Sommer?«
»Im Sommer arbeite ich mit Jugendlichen«, erklärte er. »Bis September biete ich für sonst niemanden Kurse an. Der Sommer gehört den Kids.«
»Genau das meine ich.«
Er zog eine Augenbraue hoch. Ethan arbeitete mit Bewährungshelfern aus dem ganzen Land zusammen und nahm Jugendliche auf, denen sonst die Unterbringung in irgendwelchen Vollzugseinrichtungen drohte, und brachte sie stattdessen in die Berge. Zum Überlebenstraining, ja, aber es war viel mehr als nur das. Die Idee war nicht unbedingt seine gewesen, von diesen Kursen gab es eine ganze Menge überall im Land.
»Ich hätte da einen Jungen für Sie«, eröffnete sie ihm. »Und ich glaube, ich hoffe, dass Sie bereit sind, ihn zu nehmen.«
Ein Holzscheit barst in der Hitze des Ofens mit einem explosionsartigen Knall, und die Flammen hinter der Glastür schlugen hoch.
»Sie haben da einen Jugendlichen«, wiederholte er. »Das heißt … sie haben einen Zeugen.«
Sie nickte. »Schöne Bezeichnung.«
Er ließ sich vor dem Ofen nieder, und sie folgte seinem Beispiel. Allison blieb, wo sie war, an die Küchentheke angelehnt und beobachtete die beiden.
»Warum wollen Sie, dass er zu mir kommt?«
»Weil seine Eltern herkömmliche Zeugenschutzprogramme ablehnen.«
»Sie doch auch, dachte ich.« Ethan erinnerte sich, dass sich Jamie, seit sie nicht mehr bei den Marshals war, dem Personenschutz verschrieben hatte. Als hoch bezahlter privater Bodyguard.
Sie holte tief Luft. »Ich muss mich auf das Nötigste beschränken und bitte um Verständnis. Ich versuche, Ihnen so viel zu erklären, wie ich kann, auf die Gefahr hin, dass es bei Weitem nicht so ausführlich ist, wie Sie es gern hätten.«
»Einverstanden.«
»Der Junge ist … er ist viel mehr als nur ein wichtiger Zeuge. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. In diesem Fall aber trauen er und seine Eltern der Polizei nicht über den Weg. Und das, soweit wir wissen, aus gutem Grund. Der Junge ist in Gefahr. In großer Gefahr. Und die Eltern wollen bei ihrem Sohn bleiben, kein Zeugenschutzprogramm, und die Fäden in der Hand behalten. Sie haben mich um Verschwiegenheit gebeten. Aber …«
Sie hielt inne. Ethan ließ ihr einen Augenblick Zeit, aber als sie nicht weitersprach, forderte er sie auf: »Jamie?«
»Aber ich schaffe es nicht«, sagte sie leise. »Ich könnte Ihnen etwas vormachen, und ich hatte das zunächst auch vor. Ich wollte Ihnen erzählen, dass die Familie sich meinen Einsatz nicht leisten kann. Das stimmt zwar. Aber, Ethan, diesen Jungen würde ich auch schützen, ohne dafür bezahlt zu werden. Ich meine es ernst. Ich würde das sogar zu meiner ausschließlichen Aufgabe machen, ich würde …«
Wieder entstand eine Pause, dann holte sie tief Luft und fuhr fort: »Aber sie sind zu gut.«
»Wer?«
»Die Männer, die ihm auf den Fersen sind.«
Allison wandte sich ab, als Ethan ihren Blick suchte.
»Und warum ich?«, fragte er. »Sie sind bei so etwas viel besser als ich.«
»Sie können ihn von der Bildfläche verschwinden lassen. Und zwar vollständig. Denn genau da haben sie ihre Schwachstelle. Solange er sich in Reichweite eines Handys, einer Überwachungskamera, eines Computers oder eines dieser verdammten Videospiele befindet, bin ich mir sicher, dass sie ihn kriegen. Aber hier … hier ist er nichts weiter als ein winziges kleines Ding inmitten unberührter Wildnis.«
»Das sind wir doch alle«, sagte Ethan.
»Richtig. Die Entscheidung liegt natürlich bei Ihnen. Aber ich wusste mir keinen anderen Rat, und der Junge liegt mir am Herzen. Zuerst war es nichts weiter als eine fixe Idee. Aber dann habe ich es mir noch einmal durch den Kopf …«
»Und dabei an Ethan gedacht?«, warf Allison ein. Beide wandten sich gleichzeitig zu Jamie um.
»Zum Teil, ja«, fuhr Jamie Bennet mit unveränderter Stimme fort. »Aber es ging eher darum, ob es überhaupt machbar ist. Wir lassen ihn den Sommer über verschwinden. Er ist aber nicht in der Situation, über die sich seine Eltern so große Sorgen machen. Er befindet sich nicht zu Tode verängstigt in einer sicheren Einrichtung in einer anderen Stadt. Ich kann mich sehr gut in den Jungen hineinversetzen. Ich kann mir gut vorstellen, was er mag, worauf er gut ansprechen würde, was ihn beruhigen würde. Und ich kann Ihnen versichern, dass er im Augenblick alles andere als entspannt ist. Aber er ist ganz versessen auf Abenteuer. All diese Survival-Geschichten. Und da sind Sie mir eingefallen. So habe ich es ihnen verkauft. Ich habe denen erzählt, was Sie so machen, und ich glaube, ich konnte es ihnen schmackhaft machen. Und jetzt bin ich hergekommen, um auch Sie dafür zu erwärmen.«
»Wäre es andersrum nicht vielleicht besser gewesen?«, wandte Allison ein. »Die Möglichkeiten mit uns ausloten, und erst dann versuchen, es dem Kind und seinen Eltern zu verkaufen?«
Jamie sah sie einen Moment an und nickte kurz. »Ich kann Sie verstehen. Aber dass es diesen Jungen gibt, versuche ich möglichst unter Verschluss zu halten. Hätten die Eltern dem Plan nicht zugestimmt, hätte ich hier in Montana Leute umsonst ins Vertrauen gezogen. Das ist zu riskant.«
»Okay«, sagte Ethan. »Aber Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Es geht nicht nur darum, es mir oder uns beiden zu verkaufen. Hier oben werden auch andere Jugendliche sein. Andere Jugendliche, die wir, wenn wir einwilligen, möglicherweise in Gefahr bringen. Und ich bin es, der die Verantwortung trägt.«
»Bitte glauben Sie mir, dass es mir im Traum nicht eingefallen wäre, wenn ich befürchten würde, dass andere Kinder gefährdet sind. Als erstes muss es von außen so aussehen, als wäre der Junge verschwunden, bevor er hierher kommt. Das habe ich bereits bis ins Kleinste vorbereitet. Ich habe einen Weg gefunden. Ich würde ihn unter falschem Namen in das Programm schicken. Nicht einmal Sie wüssten, wer er ist. Und Sie sollten auch nicht versuchen, es herauszufinden.«
Ethan nickte.
»Unser zweiter Vorteil«, fuhr sie fort, »ist der, dass wir wissen, auf wen wir ein Auge haben müssen. Wir wissen, wer ihn als Bedrohung empfindet. Wenn die sich vom Fleck rühren, bekomme ich es mit. Die schnüffeln nicht hier oben in Montana herum, ohne dass ich Wind davon bekomme. Und sobald die sich bewegen, können Sie sich darauf verlassen, dass die ganze Gruppe geschützt wird. Jeder Einzelne.«
Ethan antwortete nicht. Jamie beugte sich zu ihm hinüber.
»Und wenn Sie meine Meinung dazu hören wollen: Dieser Junge braucht genau das, was Sie ihm vermitteln können. Es geht nicht nur darum, ihn hier zu verstecken, Ethan. Der Kleine ist traumatisiert und versucht, damit klarzukommen. Er hat Angst. Sie können ihn stärken. Ich weiß das, weil ich Ihr Programm hier schon mitgemacht habe.«
Ethan sah Allison an, ohne dass er ihrer ausdruckslosen Miene etwas entnehmen konnte. Die Entscheidung lag bei ihm. Er sah Jamie wieder an.
»Hören Sie zu«, sagte Jamie Bennett, »Ich habe mich nicht aus Lust und Laune auf den Weg zu Ihnen hier oben gemacht. Und ich will Sie auch nicht bedrängen. Ich sage Ihnen nur, was Sache ist und bitte um Ihre Hilfe.«
Ethan wandte sich um und sah zum Fenster hinaus. Die Flocken fielen immer noch schnell vom Himmel, und es würde noch lange dauern, bis die Morgendämmerung einsetzte. In der Fensterscheibe gespiegelt sah er Allison und Jamie Bennet, die darauf warteten, dass er etwas sagte. Jamie ungeduldiger als Allison, denn Allison wusste, dass Ethan nicht der Mann für schnelle Entscheidungen war, weil er das Gefühl hatte, dass vorschnelle Entscheidungen immer genau das waren, was einen in ernste Schwierigkeiten brachte. Er setzte sich, trank seinen Kaffee und betrachtete das Spiegelbild der beiden Frauen, wie sie dort im Feuerschein gefangen waren, während draußen der Schnee umherwirbelte, verschmolzen mit dem Mysterium von Glas, das einem, wenn man es nur aus dem richtigen Winkel betrachtete, nicht nur zeigte, was sich dahinter, sondern auch, was sich jenseits dessen befand.
»Sie sind also davon überzeugt, dass er umgebracht wird, wenn sich an der aktuellen Lage nichts ändert«, sagte er.
»Ja, das bin ich.«
»Und was haben Sie vor, wenn ich Nein sage?«
»Ich hoffe natürlich, dass Sie …«
»Ist mir klar, dass Sie das hoffen. Aber ich will wissen, was Sie tun, wenn ich Nein sage.«
»Ich werde versuchen, ihn in ein ähnliches Programm zu bekommen. Zu jemandem, der den Jungen von der Bildfläche verschwinden lassen, ihn beschützen kann. Aber ich werde vermutlich niemanden finden, dem ich das wirklich zutraue, niemanden, für den ich meine Hand ins Feuer legen würde. Das ist mein Problem.«
Ethan wandte sich von dem Fenster ab und sah Jamie Bennett in die Augen.
»Sie sind also fest davon überzeugt, dass er hier nicht verfolgt wird? Sie glauben, das garantieren zu können?«
»Hundertprozentig.«
»Nichts ist hundertprozentig.« Ethan stand auf und deutete in den dunklen Raum hinter ihnen. »Dort haben wir ein Gästezimmer. Nehmen Sie sich die Taschenlampe auf dem Tisch und machen Sie es sich bequem. Wir reden morgen weiter.«
Jamie Bennett starrte ihn an. »Bekomme ich auch eine Antwort?«
»Ich werde mich jetzt schlafen legen«, sagte Ethan. »Und dann bekommen Sie eine Antwort.«