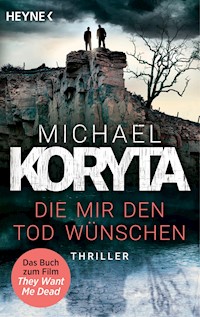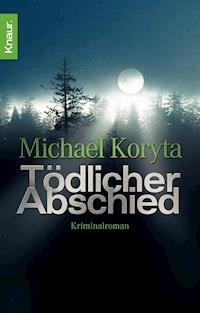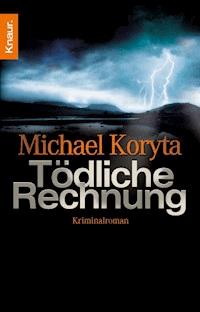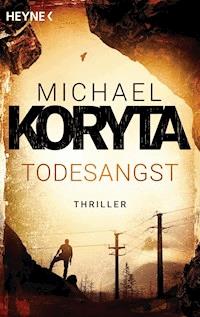
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Novak-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Fesselnd!« - Harlan Coben
Seit dem Tod seiner Frau ist Markus Novak nicht mehr derselbe. Früher hat er als Ermittler unschuldig Verurteilten geholfen, aus dem Gefängnis zu kommen. Doch als der Mörder seiner Frau freigesprochen wird, ist Novak fest entschlossen, das Rechtssystem zu umgehen und den Mörder auf eigene Faust zu jagen. Dafür kehrt er an den Ort zurück, an dem seine Frau starb. Was Novak jedoch nicht weiß – der Mörder wartet bereits auf ihn …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Ähnliche
Zum Buch
Seit dem Tod seiner Frau ist Markus Novak nicht mehr derselbe. Früher hat er als Ermittler unschuldig Verurteilten geholfen, aus dem Gefängnis zu kommen. Doch als der Mörder seiner Frau freigesprochen wird, ist Novak fest entschlossen, das Rechtssystem zu umgehen und den Mörder auf eigene Faust zu jagen. Dafür kehrt er an den Ort zurück, an dem seine Frau starb. Was Novak jedoch nicht weiß – der Mörder wartet bereits auf ihn …
Zum Autor
Michael Koryta begann bereits in jungen Jahren seine ungewöhnliche Karriere. Schon auf der Highschool arbeitete er nebenher für eine Privatermittler-Agentur. Später verdingte er sich als Reporter und unterrichtete an der Indiana University. Wenn er nicht gerade schreibt, begibt sich der Abenteurer und Outdoor-Fan Koryta bevorzugt in die Beartooth Mountains. Er gilt in den USA derzeit als einer der aufregendsten Thriller-Autoren.
Lieferbare Titel
Die mir den Tod wünschen
Die Gewalt der Dunkelheit
MICHAEL KORYTA
TODESANGST
ROMAN
AUS DEM AMERIKANISCHEN VON IRENE EISENHUT
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für Michael und Rita Hefron, die mir Montana gezeigt und mich stets zum Schreiben ermutigt haben. Und für meinen Vater, der die Lichter anließ, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Entschuldigung hierfür, Dad.
Unsere Tugenden und Mängel gehören zusammen wie Kraft und Materie. Getrennt existiert kein Mensch.
- Nikola Tesla
Der Geist eines jeden Attentäters verläuft auf einer Schmalspurbahn. Doch es gibt keine Einzelgänger. Kein Mensch lebt in einem leeren Raum. Alle seine Handlungen sind durch die Zeit und die Gesellschaft bedingt, in der er lebt.
William ManchesterDer Tod des Präsidenten
TEIL EINS
ECHOS
1
Vor drei Tagen hatte es begonnen, in einer Höhe von rund tausendachthundert Metern zu schneien, doch nur leicht, sodass die Stromleitungen stehen geblieben waren. Sabrina Baldwin hielt es für ein Geschenk nach einem für Montana üblich langen, hartnäckigen Winter.
Dann, am vierten Tag, nahm der Wind zu.
Und die Lichter blinkten.
Sie waren beide wach und hörten dem heulenden Wind zu. Als das allgegenwärtige Summen der Elektrogeräte im Haus zusammen mit dem Schein des Weckers verschwand und nach nur wenigen Sekunden wiederkam, sagten beide gleichzeitig »Eins« und lachten.
Diese Lektion hatten sie in ihrem ersten, gemeinsamen Haus in Billings gelernt. Es hatte draußen gestürmt, und die Lichter hatten zweimal hell geblinkt. Jay hatte ihr erklärt, dass das System auf Schwierigkeiten reagierte, indem es die Stromkreise öffnete und schloss, um so die Tragweite der Störung automatisch zu testen, bevor es sich endgültig abschaltete. Es würde einmal blinken, vielleicht zweimal, aber nie dreimal. Zumindest nicht dieses System.
In ihrem neuen Heim in Red Lodge setzten das Licht und das Summen der technisierten Welt erneut aus und kehrten zurück.
»Zwei«, sagten sie.
Alles war, wie es sein sollte. Der Wecker blinkte zwar und wartete darauf, neu eingestellt zu werden, doch der Strom blieb da, und die Heizung sprang wieder an. Sabrinas Hände wanderten über Jays Brust und Arme. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als hätte das System sich selbst wiederhergestellt und alles wäre in Ordnung, niemand müsste hinaus in den Sturm.
Dann fiel der Strom ein weiteres Mal aus, und beide stöhnten auf. Die Probleme der Welt waren gerade von draußen zu ihnen hineingezogen und kündigten sich durch wiederholtes Blinken an wie ein Klopfen an der Tür.
»Verdammt, gleich wird das Telefon klingeln«, seufzte Jay.
Sabrina schmiegte sich an seine Brust und küsste Jays Hals. »Dann lass uns keine Zeit verlieren.«
Genau das taten sie, sie verloren keine Zeit. Trotzdem klingelte das Telefon, bevor sie fertig waren, was sie aber ignorierten. Dieser Moment sollte ihr für den Rest ihres Lebens eigenartig klar in Erinnerung bleiben. Die besondere Stille im Haus durch den Stromausfall, der kalte heulende Wind und der warme Hals ihres Mannes, den sie spürte, als sie ihr Gesicht dagegen drückte, beide so sehr in dem anderen verloren, dass selbst das schrille Geräusch des Telefons sie nicht unterbrach.
Als sie fertig waren, klingelte das Telefon erneut. Leise fluchend küsste er sie, außer Atem, stand auf und ließ sie allein im gemeinsamen Bett zurück, um das Gespräch unten anzunehmen.
In einem neuen Bett mit neuen Laken. Es war einfach alles neu. Sie freute sich über Jays schlichten Duft. Das Einzige, was nicht neu oder anders war. Sie waren vor zwei Monaten nach Red Lodge gezogen, und alle hatten gemeint, dass sie dankbar sein würde für die Schönheit des Ortes, doch noch immer fand sie die Berge eher bedrohlich als bezaubernd.
Ihre Sicht würde sich wohl ändern, wenn der Frühling endlich Einzug hielt. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als das zu glauben. Im Moment wusste sie nur, dass sie es geschafft hatten, an einen Ort zu ziehen, der Billings wie eine Großstadt erscheinen ließ, was nicht einfach war.
Sie konnte seine Seite des Gesprächs hören, eine eigenartige Mischung aus aktuellen Neuigkeiten und den üblichen Themen. Stürme, heruntergerissene Leitungen, Umspannwerke, Stromkreise. Selbst das Wortspiel war vertraut: Wir wollen doch nicht, dass den Patienten im Krankenhaus das letzte Licht ausgeht.
Ein Witz, den nicht nur er, sondern auch schon sein Vater und sein Großvater gemacht hatten, doch er spiegelte die Lage wider. Die Stromausfälle waren so schlimm, dass das Krankenhaus über Notaggregate betrieben wurde, was bedeutete, dass Jay eine Weile weg sein würde. Bei so einem Wetter waren die Reparaturen selten eine einfache Angelegenheit. Nicht in Montana.
Sie folgte ihm nach unten und kochte Kaffee, während er ihr erklärte, was los war, den Blick schon in die Ferne gerichtet. Sie wusste, dass er gedanklich bereits bei der Landkarte und dem Stromnetz war, um die Probleme einzuordnen, bevor er sich auf den Weg machte. Eine seiner größten Sorgen war es, dass er mit dem lokalen Netz noch nicht genügend vertraut war. In Billings hatte er jedes Umspannwerk gekannt, jeden Abspanntransformator, wahrscheinlich sogar jeden Isolator.
»Es wird ein langer Tag werden«, meinte er und zog seine isolierten Stiefel an. Sie waren in der Küche, mit der Sabrina noch immer fremdelte, sodass sie häufig in die falsche Schublade griff oder den falschen Schrank öffnete. Doch es war ein wunderschönes Heim mit einem fantastischen Blick auf die Berge, der sich ihnen zumindest im Sommer durch diese Fenster bieten würde, die Jay so toll fand, da sie in Richtung der Beartooth Mountains lagen. Für Sabrina waren sie falsch ausgerichtet. Die schlimmsten Stürme kamen stets von diesen Bergen heruntergefegt, und sie konnte sie von hier aus sehen. Sie wünschte sich, die Fenster würden nach Osten zeigen und den Sonnenaufgang einfangen statt der nahenden Stürme.
Sie hatte die Nase voll von Unwettern.
Jay blickte derweil aus dem Fenster, und bestimmt lächelte er wieder. Die Gipfel waren durch die tief hängenden Wolken nicht zu sehen, und der Wind peitschte ein Gemisch aus Eis und Schnee gegen die Scheiben.
»Genieß den Schnee, solange er noch da ist!«, sagte sie. »Es könnte der letzte sein für diese Saison.«
»Brett hat mir erzählt, dass sie den Pass letztes Jahr Mitte Juni schließen mussten wegen fünfunddreißig Zentimeter Neuschnee.«
»Toll!«
Sie hatte Mühe, heiter zu klingen und zugleich eine Prise feinen, aber nicht beißenden Humors hineinzumischen. Sie waren immerhin wegen ihr hierhergezogen und hatten Billings verlassen, weil Jay bereit gewesen war, um ihres Seelenfriedens willen seinen geliebten Job aufzugeben. Er war da draußen Mitglied einer Mannschaft gewesen, eines Teams, das an direkt stromführenden Hochspannungsleitungen arbeitete, oben in der Gefahrenzone. Sie hatten wie Vögel auf diesen Kabeln gesessen, in denen tödlicher Strom pulsierte. Im November hatten sie erlebt, wie tödlich.
Sabrina hatte Jay durch ihren Bruder Tim kennengelernt. Sie waren Kollegen gewesen, wenngleich diese Bezeichnung nicht ganz zutraf, eher Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos. Jeder Anruf bedeutete eine Mission, die möglicherweise mit dem Tod enden konnte. Die Bindungen bei dieser Art von Arbeit waren tiefer, und ihr stets beschützender, älterer Bruder hatte nur in den höchsten Tönen von Jay gesprochen. Sie hatte Jay bei einem Grillfest getroffen, eine Woche später gingen sie zum ersten Mal aus, und ein Jahr danach waren sie verheiratet. Ihre Hochzeitstorte war mit winzigen Hochspannungsmasten verziert worden, die die Figuren der Braut und des Bräutigams einrahmten. Sie hatten das bereits für den ganzen Streich gehalten. Doch da hatten sie sich getäuscht. In den Miniaturleitungen floss tatsächlich Schwachstrom, den Tim einschaltete, als Jay den Kuchen anschnitt. Er sprang daraufhin fast zwanzig Zentimeter in die Höhe, und der Rest der Mannschaft krümmte sich vor Lachen.
So vergingen mehrere Jahre. Tim und Jay standen sich näher als die meisten Brüder. Dann kam der November. Ein Routineeinsatz. Tim befand sich auf der Leitung, um eine einfache Reparatur vorzunehmen, ganz sicher, dass kein Strom hindurchfloss. Was er jedoch nicht wusste, war, dass jemand, über einen Kilometer entfernt, einen riesigen Gasgenerator angeworfen hatte, da er nicht die Reparatur abwarten wollte. Der nicht fachmännisch angeschlossene Generator verursachte eine Nachspeisung. Die harmlose Leitung führte in dem Augenblick wieder Strom, als Tim das Kabel in den Händen hielt.
Er starb oben auf dem Mast. Jay kletterte hinauf, um die Leiche zu bergen.
Drei Wochen nach der Beerdigung erklärte Jay Sabrina, dass er die Arbeit als Leitungsmonteur aufgeben würde. In Red Lodge war die Stelle eines Vorarbeiters frei. Sie müsste sich nie wieder darüber Gedanken machen, dass er noch einmal auf einen Mast klettern und sie ihren Mann genauso verlieren würde wie ihren Bruder.
»Ich liebe dich«, sagte er und stand vom Tisch auf.
Sie küsste ihn noch einmal. »Ich dich auch.«
Er ging in die Garage. Sie hörte den Pick-up starten, marschierte zur Haustür, öffnete sie und stand in dem eisigen Wind, um ihm zum Abschied zu winken. Er hupte zweimal wie der Roadrunner und war weg. Sie schloss die Tür und spürte sowohl Verärgerung als auch ein schlechtes Gewissen. Immer wenn er bei solch einem Wetter hinausmusste, war sie hin- und hergerissen zwischen der Angst vor dem, was ihn draußen erwartete, und dem Wissen, dass sie auf seine Arbeit eigentlich stolz sein sollte.
Was sie in der Tat auch war. Wirklich. Dieser Winter war nur ungewöhnlich schlimm gewesen, mehr nicht. Es lag an dem schmerzhaften Verlust von Tim und dem aufreibenden Umzug, dass sie unzufrieden war, es lag nicht an Red Lodge. Der Schnee würde schmelzen und der Sommer kommen. Ihr Café in Billings hätte ohnehin keine Zukunft mehr gehabt. Der Vermieter wollte das Haus verkaufen, und sie hatte noch keinen Ersatz gefunden. So hatte sich der Sommer in Billings als unheilvoll abgezeichnet, wohingegen er jetzt vielversprechend aussah. Sie hatte bereits eine gute Immobilie gefunden, in der sie ein neues Café eröffnen konnte. Außerdem war es für sie beruhigend zu wissen, dass ihr Mann am Boden blieb, egal was heute dort draußen passieren würde.
Red Lodge war ein Neustart.
Er rief zum ersten Mal gegen Mittag an. Sie war draußen und schaufelte gerade den Schnee vom Gehweg. Als sie ins Haus zurückkehrte und den Hörer abnahm, war sie außer Atem.
»Eine 69-kV-Leitung ist neben der Landstraße heruntergerissen«, berichtete er.
Das waren 69.000 Volt. Eine Standardleitung zu Hause hatte 110 oder 220 Volt.
»Aber die Arbeit geht schnell voran, und die Wettervorhersage ist gut«, sagte Jay.
Das hatte sie bereits in den Nachrichten gehört. Ein sogenannter Alberta Clipper fegte aus Kanada herunter und trocknete die Luft aus. Der Schnee hatte nachgelassen, und die Straßen waren passierbar, zumindest bis Red Lodge. Jenseits davon, wo die Landstraße sich bis auf zweitausend Meter wand, war der Pass seit sechs Monaten geschlossen und würde es noch zwei weitere Monate bleiben.
»Vielleicht schaffen wir es, ganz normal zu Abend zu essen«, sagte sie.
»Vielleicht.« In seiner Stimme schwang Optimismus.
Ein paar Stunden später nicht mehr.
Der Anruf um fünf war kürzer als der erste, und Jay klang bekümmert.
»Es wird ganz bestimmt spät werden.«
»Wirklich?« Sie war überrascht, denn der Sturm war gegen ein Uhr abgezogen, und zu Hause gab es wieder Strom.
»So was hab ich noch nie erlebt. Irgendjemand fällt Bäume, und zwar so, dass sie in die Stromleitungen fallen. Wir kriegen immer mehr Störmeldungen von weiter oben in den Bergen, und jedes Mal sind es umgesägte Bäume. Irgendein Vollidiot fährt kurz vor uns auf einem Motorschlitten und spielt Fangen mit uns wie ein Kind. Er hat einen Riesenspaß mit seiner Kettensäge und lässt die Bäume in die Leitungen krachen. Wir bauen eine Leitung wieder auf, und er zerstört eine andere.«
»Ist die Polizei schon da?«
»Ich hab sie noch nicht gesehen. Ich würde dir gern sagen, dass ich fast fertig bin, aber im Moment kann ich die Lage nicht einschätzen. Diese Bäume sind frisch gefällt. Beim letzten Baum konnte ich sogar das Sägemehl im Schnee erkennen. So was Hirnverbranntes hab ich noch nie erlebt, dahinter verbirgt sich ein Muster. Es entfernt uns systematisch weiter von der Stadt. Der Typ schaut mir wahrscheinlich zu, wie ich meine Mannschaft auf die Masten schicke, und lacht sich kaputt.«
Materialermüdung war oft ein Grund, warum Leitungen nicht mehr funktionierten. Der Gedanke, dass Jays Team, Männer wie ihr Bruder, in einem allmählich nachlassenden Schneesturm einen Mast nach dem anderen hinaufkletterten, nur weil jemand die Leitungen mutwillig beschädigte, machte sie wütend.
»Ich muss los«, sagte er. »Hoffentlich geht dem Vollidioten bald das Benzin in seiner Kettensäge aus. Vielleicht hat es seinen Motorschlitten schon erwischt. Ich würde den Typ gern kennenlernen.«
Sie wünschte ihm Glück, legte auf und ging verschwitzt und müde die Treppe hoch, um zu duschen. Oben auf dem Absatz drehte sie sich um, blickte zu den Bergen, die bereits im Dunkeln lagen, und fragte sich, wo dieser Kerl wohl gerade steckte.
Was bringt das schon?, dachte sie. Vermutlich waren es selbstsüchtige, betrunkene Jungs mit mächtigen Spielzeugen.
Sie wollte es zumindest für Rücksichtslosigkeit halten. Doch während das Wasser warm wurde und sie in die Dusche stieg, stellte sie fest, dass Jays Worte sie beunruhigten. Es lag an seiner Schilderung der Bäume, die sie systematisch weiter von der Stadt entfernten.
Als sie aus dem Bad trat, noch dampfumhüllt, nur mit einem Nachthemd bekleidet, begriff sie, was sie beunruhigt hatte.
Auf ihrem Bett saß ein Mann in Motorschlittenkleidung, eine Schutzbrille um den Hals, eine Pistole in der Hand.
Sabrina schrie nicht, sondern erfasste in Sekunden die Situation und reagierte einfach ohne nachzudenken. Bedrohung im Schlafzimmer, Telefon im Schlafzimmer, Flucht durchs Schlafzimmer, also einzige Alternative: Rückzug. Sie stolperte nach hinten und schob die Tür zu. Es war eine Schiebetür, wie die meisten Innentüren ihres neuen Heims. Bei der Hausbesichtigung hatte sie dem Makler noch erklärt, dass ihr das sehr gefiel. Jetzt hasste sie diese Türen, denn sie hatten kein richtiges Schloss, nur einen lächerlichen Riegel, den ihre Hände nicht zuschieben konnten, weil sie so zitterten, und sie hörte, wie der Mann vom Bett aufstand und sich näherte. Sie schaffte es gerade noch, ihre Hände wegzuziehen, als der Mann gegen die Tür trat, das Metallschloss sich verbog, die Tür aus der Schiene sprang und der Rahmen zersplitterte. Eine große behandschuhte Hand griff hinein, umfasste die Türkante und stieß die Tür zurück, sodass Sabrina keine Möglichkeit zur Flucht mehr blieb. Alles, was sie retten konnte, lag hinter diesem Mann, an dem sie aber nicht vorbeikam. Er war so riesig, dass er den Türrahmen ausfüllte. Obwohl seine Kleidung ungewöhnlich dick war, konnte sie seinen kräftigen Körperbau erkennen. Er hatte dunkle, ausdruckslose Augen, und sein Haar auf dem klobigen Schädel war kurz rasiert.
»Wer sind Sie?«, fragte sie. Es war die einzige Frage, die für sie in dem Moment zählte. Sie wollte wissen, wer er war, nicht was er wollte, denn das war durch die Waffe offensichtlich.
»Ich heiße Garland Webb.« Seine Stimme war tief. Er sprach die Worte langsam aus, und sie hallten in dem gefliesten Raum nach. »Ich bin sehr müde, denn ich musste wegen Ihnen innerhalb kurzer Zeit sehr weit reisen.«
»Was wollen Sie?«
»Wir haben uns hierfür die Luft zunutze gemacht«, erwiderte er, als hätte er ihre Frage schon beantwortet. »Das ist alles, was wir benötigen. Die Menschen meinen, sie bräuchten so viel mehr. Sie irren sich.«
Er hob die Pistole an und schoss auf sie.
Ein leiser, zischender Knall ertönte, dann spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrer Bauchgegend. Schließlich schrie sie. Hoch, laut und lang, und er ließ es zu, ohne sich aus der Tür zu bewegen. Er senkte lediglich die Pistole und beobachtete, wie sie gegen die Wand taumelte, er lächelte dabei leicht. Ihre Hände wanderten zu ihrem Bauch und tasteten nach der Wunde. Ihre Finger streiften etwas Eigenartiges, das sanft und fast angenehm zu berühren war. Sie blickte an sich herunter und sah unterhalb ihrer Rippen einen Pfeil hervorstechen. Nein, keinen Pfeil. Dafür war es zu klein. Es hatte einen Metallstift und eine Plastikröhre mit abgewinkelten weichen Plastikfedern. Ein Dartpfeil.
Sie spürte, wie sich Wärme in ihrem Körper ausbreitete. Da war was drin, und jetzt ist es in mir, oh mein Gott, was war da drin?, dachte sie und versuchte, den Dartpfeil aus ihrem Bauch zu ziehen. Er ließ sich nicht lösen. Stattdessen spannte sich die Haut nur noch mehr, der Schmerz verschlimmerte sich, und Blut drang aus der Wunde. Sie konnte die Einstichstelle durch den dünnen blauen Stoff ihres Nachthemds nicht deutlich sehen, aber spüren, was es war. Am Ende des Dartpfeils befand sich ein Widerhaken, wie bei einer Angel, und hatte sich in ihr Fleisch gebohrt.
»Luft«, sagte der große Mann mit den ausdruckslosen Augen noch einmal und klang ungemein zufrieden. Die Wärme in Sabrinas Körper erreichte ihr Gehirn, und ihre Sicht verschwamm. In ihren Ohren summte es immer lauter wie im Inneren eines Hornissennests. Suchend blickte sie von dem Dartpfeil auf, um den Mann nach dem Warum zu fragen.
Dann glitt sie an der Wand herunter und fiel bewusstlos gegen die Toilette, die Frage noch immer auf den Lippen.
2
Der Mann, der angeklagt worden war, Markus Novaks Frau ermordet zu haben, befand sich wegen sexueller Nötigung einer anderen Frau im Gefängnis, als ein talentierter junger Strafverteidiger ihm seine Freiheit zurückerkämpfte, da er eine Reihe von Verfahrensfehlern nachweisen konnte, die Garland Webb seines Rechts auf einen fairen Prozess beraubt hatten.
Mark war bei der richterlichen Entscheidung nicht einmal anwesend, sondern mit seinem Mentor und früheren Arbeitgeber, Jeff London, auf einer gemieteten Angeljacht draußen vor Key West unterwegs. Der Ausflug war Londons Idee gewesen. Was immer in der Berufung passieren würde, hatte er gemeint, hätte keine Auswirkung auf das Beweismaterial, das Mark zusammengetragen hatte. Egal ob Garland Webb im Gefängnis saß oder nicht, er war noch immer nicht des Mordes an Lauren überführt worden. Das wäre der nächste Schritt.
Das alles klang sinnvoll, doch Mark kannte den wahren Grund für die Einladung auf ein Boot in den Golf von Mexiko, während Garland Webb sein weiteres Schicksal erfuhr. Er, Mark, hatte sich ein paarmal zu viel mit Jeff über das Thema unterhalten und dabei ein paar Versprechen zu viel gemacht. Versprechen, Kugeln in Webbs Kopf zu jagen, und Jeff glaubte sie.
Zwischen seinem gewonnenen Berufungsverfahren und seiner Entlassung aus dem Gefängnis traf sich Garland Webb ein letztes Mal mit seinem Anwalt, einem jungen Aufsteiger namens John Graham, für den dieser Fall sein bis dahin größter Sieg war. Der Staatsanwalt hatte einschließlich der Verurteilung eine Reihe entsetzlicher Fehler begangen, weshalb Graham mit seiner rechtlichen Argumentation in der Verhandlung stets zufrieden gewesen war, doch man konnte sich eines Sieges nie sicher sein, wenn der ursprünglichen Verurteilung ein abscheuliches Verbrechen zugrunde lag. In so einem Augenblick brauchte man mehr als nur das Gesetz auf seiner Seite, man musste es verkaufen können, und John Graham hatte sich in diesem Fall seiner beträchtlichen Überredungskunst bedient. Er war mit dem Erfolg der Berufung auch deshalb zufrieden, weil er ihn ganz einfach für richtig hielt. Sein Mandant hatte keinen fairen Prozess erhalten, und John Graham glaubte zutiefst an die Lauterkeit eines Gerichtsverfahrens.
Trotzdem …
Bei Garland Webb hatte er ein ungutes Gefühl.
John gab sich bei ihrem letzten Treffen größte Mühe, seinem Mandanten ein warmes Lächeln zu schenken, und reichte ihm die Hand. »Manchmal funktioniert das System doch«, sagte er. »Wie fühlt es sich an, ein freier Mann zu sein, Garland?«
Webb betrachtete ihn mit so ausdruckslosen Augen, dass sie undurchdringlich wirkten. Er war ein Meter dreiundneunzig groß und wog etwas über hundert Kilo. Als er Grahams Hand nahm und sie schüttelte, ließ die Kraft seines Griffes den Anwalt erschauern.
»Ich nehme mal an«, meinte er, da Webb noch immer kein Wort von sich gegeben hatte, »Sie gehören nicht zu denjenigen, die ihre Freilassung mit einem rauschenden Fest feiern. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es gibt ein begleitendes Entlassungsprogramm, das …«
»Ich habe alles Nötige«, unterbrach er ihn.
»Gut. Ich bin mir sicher, es wird für Sie eine Erleichterung sein, hier rauszukommen.«
»Ich widme mich einfach wieder meinen Geschäften«, erwiderte Garland Webb.
»Und das sind?
»Es ist nun Zeit für mich, zu den Geschäften zurückzukehren, es soll keine weiteren Umwege geben«, wich er ihm aus.
»Okay«, sagte John, obwohl er keine Ahnung hatte, was Webb damit meinte, und der Gedanke, was es womöglich sein könnte, bereitete ihm Unbehagen.
»Ich habe ein Ziel, verstehen Sie?«, fügte Webb hinzu, und seine leeren Augen starrten ihn an. »Dieser Umweg war bedauerlich, doch ich habe mein Ziel dadurch nicht aus den Augen verloren.«
»Okay«, erwiderte John noch einmal. »Meine Aufgabe ist es lediglich, Sie wissen zu lassen, dass, wenn Sie bei der Jobsuche Hilfe brauchen oder …
»Ich werde zu meinem Geschäft zurückkehren«, unterbrach ihn Webb erneut.
John verstummte. Er hatte mehrere Monate mit diesem Fall zugebracht, und er wusste verdammt genau, dass Garland Webb zum Zeitpunkt seiner Verhaftung arbeitslos gewesen war.
»Wo werden Sie denn arbeiten?«, fragte er. Webb lächelte. Es war lediglich ein leichtes Zucken seiner Lippen, doch zeigte er mehr Emotion als bei der Urteilsverkündung.
»Ich werde meine Möglichkeiten nutzen«, antwortete er. »Sorgen Sie sich deswegen nicht.«
»Großartig«, sagte John. Er wollte plötzlich nur noch raus aus diesem Zimmer und weg von diesem Mann. »Halten Sie sich von Ärger fern, Garland!«
»Auch Ihnen rate ich das, John.«
John Graham verließ das Gefängnis noch vor Webb, obwohl er ursprünglich vorgehabt hatte, ihn bis zum Gefängnistor zu begleiten. Doch das fühlte sich nicht mehr richtig an. Genauso wenig wie Garland Webbs wiedergewonnene Freiheit. Genau genommen fühlte die sich mit einem Mal überhaupt nicht mehr nach einem Sieg an.
An dem Tag, an dem Webb seine Habseligkeiten einsammelte und zur Bushaltestelle ging, schmierte er eine Wache, um einem anderen Häftling in Coleman eine Botschaft zukommen zu lassen. Als sie ihn erreichte, bat der Insasse um einen Anruf. Elf Kilometer entfernt von der südlichsten Küste der Vereinigten Staaten klingelte Markus Novaks Handy.
Der Tag auf dem Meer war schön gewesen, auch wenn sie nachmittags weniger geangelt hatten. Der Seegang im Golf von Mexiko begann, heftiger zu werden, und Jeff Londons Gesichtsfarbe nahm einen grünlichen Ton an, der dem des Wassers glich.
»Muss was Schlechtes gegessen haben«, sagte er, woraufhin Mark lächelte und nickte.
»Klar, was sonst?«
»Ich werde nicht seekrank.«
»Natürlich nicht.«
Als Jeff den Kopf in die Hände stützte, lachte Mark, legte die Angel weg und trat zum Bug. Er blickte hinaus zum Horizont. Nichts als Wellen mit Schaumkronen, so weit das Auge reichte. Er hatte nur gute Erinnerungen an das Meer, da sie alle mit Lauren verbunden waren. Doch manchmal, wenn das Licht und der Wind richtig waren, erinnerte es ihn auch an andere endlos wirkende Orte. Weite Ebenen im Westen, wo der Wind durch Weizen weht statt über Wasser, und wo Stürme über Spitzkuppen fegen.
Von diesen Erinnerungen waren viele nicht so gut.
Er betrachtete das Wasser bereits seit einer Weile, als er ein leises Klingeln hörte. »Das ist Ihr Handy, mein Freund«, sagte der Kapitän des gemieteten Boots, der es sich mit einer Zigarre im Mund und hochgelegten Füßen gemütlich gemacht hatte.
Mark fand das Telefon in seiner Jackentasche. Er blieb weiter ganz entspannt, bis er aufs Display sah: COLEMANCORRECTIONAL.
Einen Augenblick lang starrte er vor sich hin, doch dann begriff er, dass der Anruf auf die Mailbox weitergeschaltet werden würde, wenn er nicht rechtzeitig reagierte. Und so drückte er die grüne Taste und legte das Telefon ans Ohr.
Er kannte die Stimme am anderen Ende. Es war ein Mann, mit dem er schon viele Male gesprochen hatte. Ein Informant, der ihn wegen rechtlicher Hilfe kontaktiert und ihm im Gegenzug einen Tipp gegeben hatte bezüglich des Mörders seiner Frau. Die Polizei glaubte die Geschichte nicht. Der Informant hielt daran fest.
»Novak, er hat mir eine Nachricht zukommen lassen. Mir. Uns. Sie lautet: ›Bitte richte Mr. Novak aus, dass seine Bemühungen enttäuschend und all seine Drohungen umsonst waren. Ich hatte auf mehr gehofft. Sag ihm, ich werde, wenn ich draußen bin, genauso an ihn denken wie drinnen. Aber noch wichtiger, ich werde auch an sie denken, und daran, was sie am Schluss gefühlt hat. Dieser Moment ist für mich unvergesslich. Schade, dass er ihn nicht mit mir geteilt hat. Sie war so schön am Ende.‹«
Der Mann am Telefon hatte mal jemanden mit einem Aluminiumbaseballschläger zu Tode geprügelt, doch seine Stimme zitterte, als er die letzten Worte las. Dann wartete er auf eine Reaktion, doch Mark sagte nichts. Stille breitete sich aus, während das Boot auf den Wellen schaukelte. »Ich dachte, dass Sie das vielleicht wissen sollten«, sagte der Mann schließlich.
»Ja«, erwiderte Mark. »Es ist wichtig, dass ich das weiß.« Seine Stimme klang leer, und Jeff London hob besorgt den Kopf. »War das alles, was er zu sagen hatte?«
»Ja, das war alles. Sie wissen ja, dass er mir gedroht hat, doch bisher ist nichts passiert. Vielleicht ist er nur ein Riesenschwätzer, und das hier … hat ebenfalls nichts zu bedeuten. Vielleicht gehört er zu denen, die gern irgendeinen Scheiß behaupten, um sich wie ein harter Macker vorzukommen. Ich kenne diese Sorte von Typen.«
»Sie haben aber zu mir gemeint, dass Sie ihn nicht dafür halten«, entgegnete Mark. »Dass Sie glaubten, er würde die Wahrheit sagen.«
Es entstand eine Pause. »Ich weiß, was ich gesagt habe«, sagte er schließlich.
»Gibt es etwas, wodurch sich Ihre Meinung geändert hat?«
»Nein.«
»Okay. Danke für den Anruf. Ich werde Ihnen Geld auf Ihr Gefängniskonto überweisen.«
»Das müssen Sie nicht. Nicht dafür. Ich dachte nur … na ja, dass Sie das hier wissen sollten.«
»Ich werde Geld schicken«, sagte Mark noch einmal und legte auf. Jeff starrte ihn an, während der Kapitän des gemieteten Boots sich intensiv mit seinem Angelgerät befasste, den Rücken zu ihnen gewandt.
»In dem Anruf ging’s um Webb, oder?«, fragte Jeff.
Mark nickte. Er blickte wieder zum Horizont, doch konnte er sich nicht darauf konzentrieren.
»Er verspottet mich. Er hat sie umgebracht. Und er weiß, dass ich es weiß, und jetzt ist er ein freier Mann. Ich sollte erfahren, dass er auch in Zukunft, von draußen, an mich und an sie denken wird.«
»Das ist nur ein dämliches Spiel. Er wird wieder ins Gefängnis wandern.«
»Ach ja?« Mark drehte sich zu ihm um. »Wo ist er denn gerade?«
»Lass dich dadurch nicht wieder auf die dunkle Seite ziehen, Bruder. Du musst Beweise zusammentragen, und du musst …«
»Da gibt’s wegen ihr noch eine offene Rechnung zu begleichen.«
Jeffs Miene verdunkelte sich. »Ankündigungen wie diese haben schon viele Männer ins Grab gebracht.«
»Ich will in kein Grab. Wenn ich tot bin, bringst du meine Asche dahin, wo immer du willst. Nur vergewissere dich, dass genügend Wind weht. Ich möchte reisen.«
»Das ist ein schlechter Witz.«
»Das ist überhaupt kein Witz«, entgegnete Mark. »Ich hoffe, du erinnerst dich an meine Bitte, wenn es so weit kommen sollte.« Er sah zum Kapitän. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn Sie uns ein paar Stunden früher zurückbringen?«
Der Blick des Kapitäns wanderte von Mark zu Jeff, und er schüttelte den Kopf, als kein Einwand kam. »Sind Ihre Piepen, mein Freund.«
»Danke«, erwiderte Mark. »Wir hatten heute Vormittag einen guten Fang. Tut mir leid, dass der Ausflug vorzeitig beendet wird. So läuft es einfach manchmal.«
»Er wird nicht in Cassadaga sein, Markus.« Jeffs Stimme war sanft und traurig. »Und das weißt du auch. Er wird nicht dorthin zurückkehren.«
»Könnte er aber.«
Jeff schüttelte den Kopf. »Auf diese Weise gibst du nur der Dunkelheit Nahrung. Denk an Lauren. Denk an das, woran sie geglaubt und wofür sie gearbeitet hat! Denk daran, was sie wollte.«
»Du bittest mich, darüber nachzudenken, was sie in ihrem Leben gewollt hätte? Sie ist tot, Jeff. Wer weiß, was sie jetzt will? Vielleicht hat sie in diesen letzten Sekunden ihres Lebens ihre Meinung zu ein paar Dingen geändert.«
3
Die Sonne war gerade erst aufgegangen, als Jay das Haus für seinen Einsatz verlassen hatte. Bei seiner Rückkehr war sie einmal unter- und wieder aufgegangen, und er fand einen Fremden an seinem Küchentisch vor.
Jay war so erschöpft, so hundemüde, und der Mann saß so entspannt da, das eine Bein über das andere geschlagen, höflich lächelnd, dass er ihn nicht als Bedrohung empfand. Er war lediglich überrascht, allerdings auch nur ein bisschen. Die Anwesenheit des Fremden verwirrte ihn, doch beunruhigte sie ihn nicht, weil er so ruhig dahockte mit einem noch immer dampfenden Kaffee vor sich in einem von Jays Bechern, und er ging davon aus, dass seine Frau den Kaffee gekocht hatte. Alles, was er an dem Besuch nicht verstand, würde Sabrina ihm wohl erklären können.
»Wie geht’s?«, sagte Jay zu dem Fremden, zog seine Jacke aus und begann, die Stiefel aufzuschnüren.
»Langen Tag gehabt, was?«, fragte der Fremde freundlich und teilnahmsvoll. Der Mann war schlank, sein Gesicht schmal und blass, und er hatte sein langes Haar zu einem Knoten zusammengebunden.
»Sehr lang. Er begann schon gestern«, antwortete Jay dem Fremden, der ihm sympathisch war. Er ging an ihm vorbei von der Küche ins Wohnzimmer und rief nach seiner Frau.
»Sabrina ist nicht zu Hause«, bemerkte der Fremde, trank einen Schluck Kaffee und wandte sich nicht mal Jay zu.
»Wie bitte?«, meinte Jay verdutzt, und ihm ging durch den Kopf, dass der Mann wohl ein Nachbar sein musste, den er noch nicht kannte, denn Sabrina konnte nicht weit weg sein, ihr Auto stand in der Garage. Sabrina war die kontaktfreudigere von ihnen beiden. Sie kümmerte sich um die Nachbarn und zeigte ein Interesse für ihr Umfeld, das Jay niemals aufbringen würde. Seine erste Sorge hatte dem Stromnetz gegolten, das er kennenlernen wollte, nicht den Nachbarn.
»Ich meine damit, dass sie nicht im Haus ist«, erwiderte der Fremde.
Jay stand im Wohnzimmer, und er blickte zurück zu dem Mann in der Küche. Der Fremde stellte den Kaffee ab, griff nach einem Handy, das auf dem Tisch lag, und winkte Jay zu sich.
»Kommen Sie her, ich werde Ihnen was zeigen.«
Jay trat folgsam neben ihn. Er war sich nicht sicher, ob in dem Telefon eine Nachricht für ihn war, oder ob der Mann Sabrina anrufen wollte. Jay war sich in nichts sicher, nur dass von der Situation keine Bedrohung ausging, egal wie eigenartig sie auch war.
Dann blickte er auf das Display des Handys.
Zuerst hielt er das Bild für ein Standfoto. Eine Schrecksekunde lang war er davon überzeugt, doch dann bewegte sich seine Frau, und Ketten rasselten an ihr. Er begriff schließlich, dass es ein Video war.
»Wie Sie sehen, ist sie unverletzt«, ergriff der Fremde wieder das Wort mit gleichgültiger Stimme. »Im Moment etwas erschöpft, aber körperlich unversehrt. Wie lange sie in diesem Zustand bleibt, hängt ganz von Ihren Entscheidungen ab, Mr. Baldwin.«
Sabrina bewegte sich wieder auf dem Bildschirm. Sie trug ein hellblaues Nachthemd, das Jay ihr vorletztes Weihnachten geschenkt hatte. Ihr Handgelenk umschloss eine Handschelle mit einer langen Kette, deren weiterer Verlauf aus dem Bild verschwand. Jay nahm wie betäubt den Boden unter ihr wahr: saubere, unbehandelte Holzbohlen, auf denen kein Blut zu sehen war. Während Jay in seiner Küche stand und seine Frau beobachtete, blickte Sabrina auf ihr Handgelenk und warf den Kopf hin und her, als würde sie die Bedeutung der Handschelle nicht begreifen und versuchen, sich einen Reim darauf zu machen.
In dem Moment begann Jay loszuschreien. Eine Frage, eine Drohung. Er wusste nicht genau warum, denn als er sich von dem Display des Handys abwandte und dem Fremdem in seinem Haus zum ersten Mal seine volle Aufmerksamkeit schenkte, bemerkte er, dass der Mann mittlerweile einen kurzläufigen Revolver in seiner rechten Hand hielt und damit auf Jays Bauch zielte. Der freundliche Gesichtsausdruck war verschwunden, und der Blick seiner Augen war leer.
»Sabrinas Zukunft hängt von Ihren Entscheidungen ab«, wiederholte er.
Jay versuchte, sich auf den Mann vor ihm zu konzentrieren, auf die konkrete Bedrohung, doch seine Gedanken waren noch immer bei dem Bild von Sabrina. Er stand da und zitterte schweigend, wie ein verängstigter Hund.
»Lassen Sie uns keine Zeit vergeuden«, sagte der Fremde. »Ich weiß, dass Sie viele Fragen haben. Und Sie werden bald Antworten bekommen. Aber ich kann sie Ihnen nicht hier geben. Wir müssen an einen anderen Ort. Sie werden fahren. Es ist nicht so weit. Auf dem Weg können wir miteinander reden.«
»Warum?«, stieß Jay hervor. Nur ein Wort, doch eins, in dem das Ausmaß seines ganzen Schreckens lag.
»Sie sind ausgewählt worden, Mr. Baldwin. Betrachten Sie es als eine Ehre! Sie werden Teil einer historischen Tat sein.«
Der Fremde hielt die Waffe dicht auf Jays Kopf gerichtet, während dieser seine Stiefel wieder anzog. Während Jay sich nach unten beugte, wanderte sein Blick zu den Schuhen des Fremden, und er sah etwas, das ihn beunruhigte.
Er trug normal aussehende Arbeitsstiefel, doch hatten sie ungewöhnlich dicke Gummisohlen, und keine der Ösen war aus Metall. Alles war aus Leder oder Gummi. Es war jene Art Stiefel, die man trug, wenn man an Hochspannungsanlagen arbeitete und wusste, dass jede Spur von Metall tödlich sein konnte.
4
An dem Tag, als Mark nach Cassadaga fuhr, um zu sehen, wo seine Frau gestorben war, joggte er genau die gleiche Strecke wie Lauren an jenem letzten Morgen ihres Lebens.
Die Route am Ufer von St. Petersburg führte über die Fifth Avenue hinunter zum Straub Park an der Tampa Bay. Er bog links ab und lief die Ufermauer entlang, die auf dem Weg zur Brücke zwischen Old Northeast und Snell Isle eine leichte Kurve machte. An der Brücke hielt er an und ging die Strecke wieder zurück, um zu Atem zu kommen. Auf einer früheren Runde hatte er einmal einen Schatten im Wasser gesehen und lauthals verkündet, es sei ein Hai. In Wirklichkeit war es ein Delfin gewesen. Lauren, die an der Golfküste geboren und aufgewachsen war und in einem Alter mit dem Tauchen begonnen hatte, als die meisten Kinder das Fahrradfahren lernten, hatte so heftig lachen müssen, dass sie nicht mehr atmen konnte. Mark dachte häufig an jenen Moment – Lauren in ihren Laufshorts und dem Trägerhemd, nass geschwitzt, fit und unglaublich jung aussehend, den Oberkörper nach vorne gebeugt, gleichzeitig lachend und nach Luft schnappend, der Pferdeschwanz wippend, als würde er ihre keuchenden, erstickten Lacher zählen.
»Ich weiß ja, du stammst aus den Bergen«, hatte sie gesagt, als sie schließlich wieder sprechen konnte, »aber ich hab in meinem ganzen Leben noch nie jemanden ›Hai!‹ schreien hören so wie du, außer im Film Der weiße Hai. Das verrät mir viel über dich, mein Süßer. Richtig viel! Du siehst Flipper und schreist ›Hai!‹ …«
Er verteidigte sich, dass er nicht geschrien, sondern lediglich verkündet hatte. Der Deutlichkeit halber vielleicht ein wenig laut, fügte er hinzu. Daraufhin musste sie noch mehr lachen, was schließlich darin mündete, dass sie sich auf den Bürgersteig gesetzt, die Arme um die Knie geschlungen und mit Tränen in den Augen nach Luft gerungen hatte.
Nach dem heutigen Lauf ging er ins Kahwa, dem kleinen Café im Erdgeschoss des Hauses, wo er wohnte, um sich einen Becher Kaffee zu holen. Dann ging er nach oben, betrat seine Eigentumswohnung und spazierte hinaus auf die Dachterrasse. Er nippte an dem Kaffee, schüttelte eine Zigarette aus einer Packung American Spirits und zündete sie an. Das war der letzte und für ihn unerfreulichste Teil der Routine. Ihre Angewohnheit zu rauchen, hatte er gehasst, und es war der einzige Dauerstreitpunkt zwischen ihnen gewesen. Ihr Verhalten sei egoistisch gegenüber ihren Freunden und ihrer Familie, den Menschen, die sie liebten, denn sie könnten sie dadurch zu früh verlieren, hatte er geschimpft.
Komisch, wie hart und verurteilend man in manchen Dingen war.
Als sie starb und eine Packung Zigaretten hinterließ, brachte er es nicht übers Herz, sie wegzuwerfen. Stattdessen rauchte er die Zigaretten, so wie ein Katholik für die Toten Kerzen anzündet. Dann kaufte er eine neue Packung und behielt das Ritual der einen täglichen Zigarette bei. Wenn er morgens auf der Dachterrasse stand, nach Schweiß und Zigaretten riechend, konnte er die Augen schließen und einen Moment lang das Gefühl haben, sie stünde neben ihm.
Heute drückte er die Zigarette frühzeitig aus und ging duschen. Ihm stand eine Autofahrt bevor, die er schon zu lange vor sich hergeschoben hatte.
Mark hatte Laurens Auto neun Wochen nach ihrer Beerdigung zurückbekommen. Da sein und ihr Name im Kraftfahrzeugbrief standen, war er der rechtmäßige Besitzer. Außerdem konnte die Polizei nicht länger behaupten, der Wagen sei ein Tatort. Es wurde kein Beweismaterial gefunden.
Das Haus in St. Petersburg, in dem sich ihre Eigentumswohnung befand, war so entworfen worden, dass es einen geräumigen Eindruck vermitteln sollte, entgegen den tatsächlichen Gegebenheiten. So war mit der Garage der erstaunliche Versuch gelungen, zwei Autos auf einem Platz unterzubringen. Ein Fahrzeug wurde auf einer Bühne abgestellt, die hydraulisch angehoben wurde, sodass ein weiteres darunter parken konnte. Ein nahtloses System, vorausgesetzt, man selbst und die Ehefrau arbeiteten in strikt eingehaltenen, militärischen Schichten, oder es war einem egal, wer welchen Wagen fuhr. Lauren war es nicht egal. Sie liebte ihren Infiniti, seinen Look, sein Handling und seine Schnelligkeit. Es war ihr Auto. Marks alter Jeep, zugemüllt mit leeren Kaffeebechern, Notizblöcken und Trainingsklamotten, die er stets vergaß, mit nach oben zu nehmen und in die Schmutzwäsche zu werfen, war kein akzeptabler Ersatz. Wenn sie irgendwohin wollte, dann nur mit ihrem eigenen Wagen.
Er parkte auf der Straße. Problem gelöst.
Keiner von beiden hatte je die Hebebühne benutzt, doch als die Polizei ihren Wagen zurückgab, verfrachtete er ihn nach oben. Laurens perlweißes Infiniti-Coupé hatte dort fast zwei Jahre unberührt gestanden. Nun drehte er den Schlüssel um, der die Hydraulik bediente. Das System brummte und ächzte und senkte den Wagen langsam ab wie Sargträger, wenn sie die Holzkiste ins Grab herunterließen. Die Reifen waren platt und die Batterie leer. Er benutzte einen tragbaren Generator, um die Reifen aufzupumpen, und fuhr seinen Jeep in die Garage, damit er Starthilfe geben konnte. Dann setzte er sich hinter das Steuer, schloss die Tür und wartete darauf, dass die Erinnerungen ihn erfassten.
Er wollte Lauren riechen, sie spüren und schmecken. Er verband mit diesem Auto unzählige Erinnerungen, und sie kam in allen darin vor. Der Wagen sollte wenigstens ein paar davon bewahrt haben. Doch stattdessen roch er nur den warmen Staub und spürte die Hitze, die aus der Lüftung wehte. Sie war an einem warmen Tag gestorben, im Gegensatz zu dem, an dem er das Auto zurückbekommen und auf die Hebebühne gefahren hatte.
Nachdem er dem schnurrenden Geräusch des Motors ein paar Sekunden lang zugehört hatte, fuhr er den Wagen rückwärts aus der Garage und machte sich auf den Weg nach Cassadaga.
Mark hatte nie jemanden kennengelernt, der so entschieden gegen die Todesstrafe war wie seine Frau. Er hatte über viele Jahre hinweg, in denen sie zusammen gelebt und gearbeitet hatten, ihre Ansichten geteilt. Er hatte diese Ansichten gepredigt und praktiziert. Als Lauren ermordet wurde, behielt er sie bei – für die Öffentlichkeit.
Er war sich nicht sicher, wann genau er sich im Innern davon abgewandt hatte.
Vielleicht auf ihrer Beerdigung. Vielleicht beim Anblick der Tatortfotos. Vielleicht in dem Augenblick, als der stellvertretende Sheriff eintraf und ihm die Nachricht überbrachte.
Es war schwer, sich überhaupt einer Sache sicher zu sein.
Und wessen war er sich jetzt sicher? Dass das Spiel aus war. Es hatte sich mit Garland Webbs Abschiedsworten erledigt. Außerdem war es an der Zeit, ehrlich zu sein. Er hatte nie wirklich daran geglaubt, dass die Todesstrafe falsch war, so wie Lauren. Er hatte es glauben wollen und es sich wohl selbst eingeredet, da es die Auffassung der Frau war, die er liebte. Er hatte ihr oft seine Weltanschauung beteuert: Kein Mensch sollte einen anderen Menschen töten, egal aus welchem Grund. Das hatte er damals wirklich so gemeint, und er fand, dass es ein wichtiger Punkt war.
Zum damaligen Zeitpunkt hatte er eine Frau, die er zutiefst liebte, einen Job, der ihn erfüllte, und keinen Grund, irgendjemandem den Tod zu wünschen.
Dinge ändern sich.
Seit Mark vor drei Monaten bei Innocence Incorporated ausgeschieden war, einem Unternehmen, das sich auf die Verteidigung von Todeskandidaten spezialisiert hatte und in dem er als Ermittler und Lauren als Anwältin tätig gewesen war, hatte er sich auf zwei Dinge konzentriert. Zunächst auf das Wiedererlangen seiner Gesundheit, nachdem er während einiger Ermittlungen in Indiana schwer verletzt worden war, und dann auf das Beibringen knallharter Beweise und dem Ersetzen von Gerüchten im Zusammenhang mit Garland Webb.
Die erste Aufgabe hatte er um ein Vielfaches besser bewältigt als die zweite. Mark fühlte sich körperlich so gut wie schon seit Langem nicht mehr. In Bezug auf Webbs Schuld hatte er es bisher jedoch nur geschafft, Material zusammenzutragen, das möglicherweise darauf deutete, dass dieser an dem Tag, an dem Lauren umgebracht wurde, in Cassadaga, Florida, gewesen sein könnte.
Es war schwer gewesen, überhaupt Beweise zu Laurens Ermordung zusammenzutragen. Sie hatte an einem Fall gearbeitet, der oberflächlich betrachtet für niemanden im allerweitesten Umkreis von Cassadaga als Bedrohung hätte erscheinen müssen, und ihre letzten Anmerkungen bestätigten das. Es gab keine neuen Informationen oder Namen, nichts Unerklärliches außer diesem aus drei Worten bestehenden Satz, den sie in ihr Notizbuch gekritzelt und auf dem Beifahrersitz ihres Autos liegen gelassen hatte. Diese Worte, erhebe dich Dunkelheit, hatten die Kriminalbeamten anfangs interessiert, aber niemand, einschließlich Mark, hatte sich je einen Reim darauf machen können. Für Mark war Webb, der angeblich behauptet hatte, sie umgebracht zu haben, der einzig mögliche Kandidat. Er hatte bisher jedoch noch keinen Beweis gefunden, dass Webb dort gewesen war, als Lauren auf einer einsamen Landstraße rechts rangefahren, ausgestiegen und über einen mit großen Eichen und dichten Bambusstauden gesäumten Weg gegangen war. Irgendwann kurz danach war ihr zweimal in den Kopf geschossen worden. Die Person, die sie entdeckte, konnte lediglich aussagen, dass die Motorhaube noch warm gewesen war. So wie auch Laurens Körper, laut dem Gerichtsmediziner. Tot, aber noch warm.
Was immer passiert war, war schnell passiert.
Keiner wusste, warum sie aus dem Auto gestiegen war. Vielleicht eine Gefahr. Womöglich Gutgläubigkeit. Dichter kam die Polizei an die Hintergründe zu ihrem Mord nicht heran: irgendwo zwischen Gutgläubigkeit und Gefahr.
Die letzte unbestreitbare Tatsache, die es in Laurens Leben gab, war der Ort, an dem es endete.
Mark hatte sich eine lange Zeit von ihm ferngehalten. Zu lange.
5
Mark hatte sich nie zugemutet, die tatsächliche Stelle zu untersuchen, an der sie umgebracht worden war, sondern seine Analyse des Tatorts auf Fotografien und Karten beschränkt, da er glaubte, die direkte Auseinandersetzung damit wäre zu überwältigend und niederschmetternd für ihn. Er hatte das Gefühl, als würde er den Ort in- und auswendig kennen. Als könnte er sogar eine Führung durch diese eigenartige kleine Stadt geben, die er noch nie gesehen hatte.
Wenn Sie Ihre Köpfe nach rechts wenden, meine Damen und Herren, haben Sie den Colby Memorial Temple vor sich. 1888 behauptete ein Spiritist namens George Colby in New York, dass ein geistiger Führer namens Seneca ihm eine Weisung erteilt habe: Colby solle nach Süden ziehen und seine eigene Spiritistenkolonie gründen. So lautete die Verfügung, und Colby zog um. Er ließ sich im Volusia County in Florida nieder, und die Kolonie blieb bestehen. Über einhundert Jahre später halten die Anwohner des Camps in Cassadaga den spiritistischen Glauben aufrecht, und die meisten sind eingetragene Medien …
An jenem Punkt würde er beginnen, mit sich zu ringen, da dieser Ort all das repräsentierte, was er hasste. Seine Mutter war eine Trickbetrügerin im Westen gewesen und hatte den Menschen vorgetäuscht, Zugang zu den Toten zu haben, was ihr stets ein paar Dollar mehr einbrachte. Die Vorstellung, dass es eine ganze Gruppe gab, die eine solche Handlungsweise guthieß, und eine Stadt voller »eingetragener« Medien, Seher in die Vergangenheit und die Zukunft, widerte ihn an.
Er parkte vor dem Cassadaga Hotel, einem spanisch aussehenden Steinbau, wo man Termine vereinbaren konnte mit den vielen in der Umgebung lebenden Medien, unter anderem auch mit der Frau, die Lauren nachweislich zuletzt lebend gesehen und die ein Zimmer an einen Mann namens Garland Webb vermietet hatte.
Das Hotel diente als eine Art zentrale Anlaufstelle für die Medien. Einige arbeiteten dort und standen schichtweise zur Verfügung, während andere ihre Kunden zu Hause empfingen. Die Hellseherin, wegen der Lauren gekommen war, hieß Dixie Witte. Seine Frau war zuerst zu dem Hotel gefahren, und Mark folgte ihrer Vorgehensweise.
Er trug eine Waffe unter seiner Softshelljacke. Normalerweise hatte er immer eine Neunmillimeterpistole dabei, doch heute war es ein .38er Revolver. Das war das Kaliber, mit dem Lauren umgebracht worden war, und Mark wollte sich mit der gleichen Waffe revanchieren. In der einen Jackentasche steckte ein digitales Aufnahmegerät, in der anderen eine taktische Taschenlampe.
Doch als er das Hotel betrat, erschien die Vorstellung lachhaft, irgendetwas davon brauchen zu müssen. Es war ein einladender Ort, der mit einer Weinbar und einem Café Charme versprühte. Ein Schild wies darauf hin, Termine mit Medien würden im Geschenkeladen vereinbart, um den sich eine Frau mittleren Alters kümmerte, die ein wallendes, fließendes, hell gemustertes Gewand trug. Sie erklärte ihm gut gelaunt, dass sie selbstverständlich einen Termin mit Dixie arrangieren könnte. Ihr linkes Handgelenk schmückten Armbänder mit schweren Steinen, und als sie die Nummer wählte, bemerkte Mark, dass sie an jedem Finger einen Ring hatte. Der kleine Geschenkeladen verkaufte jene Art billigen Schmucks, der das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit dieser Kolonie nicht unbedingt förderte und es eher wie eine Touristenfalle wirken ließ und nicht wie einen Ort, an dem Kommunikation auf einer höheren Ebene betrieben wurde. Er lauschte ihrem Teil der Unterhaltung. Dann legte sie den Hörer auf die Brust. »Gibt es besondere Themen, die Sie besprechen möchten?«, fragte sie. »Sie wird etwas Zeit damit verbringen, die richtige Energie zu kanalisieren, wenn sie weiß, wofür sie offen sein soll.«
Mark nickte, als wäre das für ihn völlig nachvollziehbar, und dachte einen Moment nach. »Mieter«, antwortete er dann.
Die gut gelaunte Frau runzelte die Stirn: »Mieter?«
»Ja. Ich habe ein paar Fragen zu Mietern.«
»Können Sie den emotionalen Bezug auf die Frage zu Mietern präzisieren?«
»Wut.«
Sie kniff die Augen zusammen und schien ihn noch etwas fragen zu wollen, hielt sich aber doch zurück und hob das Telefon wieder zum Ohr. »Mr. Novak hat Fragen zu … äh, Mietern, und er hat außerdem ein Problem mit Wut.« Sie horchte ein paar Sekunden. »Gut«, sagte sie dann und legte auf.
»Dixie erwartet Sie heute Abend um sieben Uhr.«
»Großartig.«
Sie nahm einen Plan heraus und zeichnete einen Kreis und ein Viereck ein. »Wir sind das Viereck, und Sie wollen zum Kreis. Es ist einfach zu finden, doch auf dem Grundstück gibt es zwei Häuser. Sie müssen zu Nummer 49 A, nicht 49 B.«
Garland Webb hatte 49 B gemietet. Dixie Witte hielt nicht viel von schriftlichen Aufzeichnungen, sie erledigte ihre Geschäfte lieber in bar, was für Garland günstig war. Sie hatte sich nie daran erinnern können, ob er an dem fraglichen Tag überhaupt da gewesen war. Auch hatte sie erst gesagt, dass er ein Mieter von ihr war, als der Informant im Gefängnis mit seiner Geschichte auftauchte.
»Ich bin mir sicher, dass ich das richtige Haus finden werde«, sagte Mark. »Die Nachbarn verfügen bestimmt alle über einen unheimlichen Orientierungssinn.«
Es war sein erster verbaler Ausrutscher, und der Sarkasmus kam bereits deutlich zum Vorschein. Dabei hatte er sich doch eingeschärft, ihn im Zaum zu halten und die Leute ernst zu nehmen, so wie Lauren es gemacht hatte. Fünf Minuten in der Stadt – und schon verlor er die Fassung.
»Das hier ist ein Ort des Heilens, Mr. Novak«, klärte die Frau ihn auf. »Es ist nicht der Ort, für den Sie ihn halten. Das kann ich an Ihren Augen ablesen. Sie empfinden viel Verachtung für uns. Das geht in Ordnung, aber es wird Ihnen nicht weiterhelfen. Wenn Sie sich den Möglichkeiten dieses Ortes öffnen, werden Sie belohnt.«
»Einige dieser Belohnungen habe ich bereits gesehen«, erwiderte Mark.
»Würde das stimmen, wären Sie nicht so skeptisch. Die Sitzung wird Ihnen helfen, egal ob Sie sich öffnen oder nicht. Ein Skeptiker wird eine Sitzung verlassen und noch immer Zweifel in sich tragen, aber auch Echos.«
»Das merke ich mir«, verabschiedete er sich und verließ den Geschenkeladen. Er spazierte durch die Hotelhalle hinaus in die feuchtwarme Luft des Tages, froh, von diesem Ort wegzukommen. Draußen wehte mittlerweile kein Lüftchen mehr, und der Himmel war mattgrau. Als ein Lastwagen vorbeifuhr, fiel der aufgewirbelte Staub schnell zurück auf den Boden.
Die Frau in dem Hotel hatte sich zu vertraut für ihn angefühlt und alte Aggressionen in ihm ausgelöst. Sie gehörte zu jenen Menschen, die Binsenwahrheiten von sich gaben, die andere für sich und ihre eigene Situation passend machen konnten. Das Miese daran war, fand Mark, dass sie glaubten, ihnen sei Erkenntnis und nicht ein Glückskeks zuteilgeworden. Marks Mutter hatte das ziemlich gut beherrscht. Sie war am liebsten in die Rolle von Snow Creek Maiden vom Stamm der Nez Percè geschlüpft, gab sich als amerikanische Ureinwohnerin aus, da viele Weiße glaubten, die Indianer würden mit der spirituellen Welt eher im Einklang stehen, ohne den Rassismus wahrzunehmen, der sich dahinter verbarg. Sie färbte sich das Haar und die Haut und trug traditionelle Gewänder. Die Touristen blickten in ihre Augen, die eigentlich blau, durch Kontaktlinsen aber dunkel waren, und nickten erstaunt bei jedem dahergesagten allgemeinen Spruch, weil der auf etwas in ihrer Vergangenheit passte. Die Verbindungen, die sie selbst herstellten, schrieben sie ihr zu. Und zahlten auch noch für den Betrug.
Diese Erfahrung hatte in Mark Verachtung für die Menschen hervorgerufen, die ihre Spielchen an einem Ort wie diesem trieben. Und genau wegen seiner Verachtung hatte seine Frau den Auftrag angenommen und ihn als ihren ausgegeben, obwohl das Gespräch mit Dixie Witte eigentlich Marks Aufgabe gewesen war. Doch Lauren hielt ihn nicht für fähig, diese Unterredung ernsthaft anzugehen, und fand, dass er gegenüber jedem, der behauptete, übernatürliche Kräfte zu besitzen, voreingenommen war. Und so hatte sie eingegriffen und war selbst nach Cassadaga gefahren.
Und hatte es nie verlassen.
Langer, lauter Donner jagte Mark hinterher, als er sich von dem Hotel entfernte und durch das Camp ging. In der Luft lag Feuchtigkeit, sie roch nach Jasmin und Geißblatt. Es gab nur eine gepflasterte Straße, die durch das Zentrum des Camps verlief. Die restlichen Häuser waren an schmalen Wegen gebaut, die aus Schotter und festgetretener Erde bestanden und von hohen, mit Louisianamoos überzogenen Eichen gesäumt waren.
Ein eigenartiger kleiner Ort. Einige der Häuser waren sauber und gepflegt, in einigen Fällen sogar vor Kurzem restauriert worden. Andere sahen aus, als hätte jemand mit zwei linken Händen sie gebaut. Mark spazierte an einem Mann vorbei, der mitten in seinem Vorgarten an einer Langhantel mit zwei Zwanzig-Kilo-Gewichten trainierte. Sein Oberkörper war nackt, Brust und Bauch waren mit dichtem, schwarzem Haar überzogen. Die Haut glänzte vor Schweiß, und er zählte ächzend die Wiederholungen, während er die Gewichte stemmte. Wer braucht schon ein Fitnessstudio, wenn man einen Vorgarten hat? Oder ein Hemd, wenn man ein Fell besitzt? Drei Meter von ihm entfernt liefen Hühner gackernd und scharrend um einen Hühnerstall herum. Der örtliche Kraftsportler schien nach dem Motto zu leben, spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
Auf sämtlichen Straßenschildern stand die Notrufnummer in fetten weißen Zahlen in einem grünen Kreis geschrieben. So etwas hatte Mark noch nie zuvor gesehen. Der Gedanke dahinter hatte wahrscheinlich etwas damit zu tun, den Notdiensten sofort eine feste Adresse angeben zu können bei Straßen, die vorher keine Kennzeichnung oder Namen besessen hatten. Die Wirkung war jedoch beunruhigend. So als würde am Ende eines jeden sich schlängelnden Weges eine Katastrophe warten.
Mr. Novak? Ich muss Ihnen leider eine schlimme Nachricht überbringen. Es geht um Ihre Frau.
Der stellvertretende Sheriff, der ihn in dieser Nacht im Strandhaus auf Siesta Key vorgefunden hatte, wo er und Lauren hingefahren waren, um ein romantisches Wochenende zu verleben, hatte noch nie zuvor von Cassadaga gehört. Genau wie Mark, der an jenem Tag ebenfalls zum ersten Mal von diesem Ort durch seine Frau erfahren hatte.
Seitdem hatte er viel Zeit in dieser Stadt verbracht, in Gedanken, nicht körperlich.
Mr. Novak? Ich muss Ihnen leider eine schlimme Nachricht überbringen. Es geht um Ihre Frau.
Einen Tag nach ihrer Verlobung hatte Laurens Vater Mark auf ein Bier eingeladen, nur sie beide. Mark erwartete die typische »Ab-jetzt-wirst-du-auf-mein-kleines-Mädchen-aufpassen«-Rede, die tatsächlich in abgewandelter Form gehalten wurde, aber auf den tiefen Schmerz in den Augen des Mannes war er nicht vorbereitet. Zum ersten Mal hatte er die Angst verstanden, die zu Eltern gehörte wie der eigene Herzschlag. Zumindest zu guten Eltern.
»Ein Kind zu haben ist, als würde man sein Leben damit verbringen, unter Haien zu schwimmen«, hatte Laurens Vater erklärt. »Du denkst, ich mache Witze, aber das ist nur, weil du es noch nicht erlebt hast. Du hast noch kein Kind groß werden und in die Welt hinausspazieren sehen, denn wenn, dann denkt man pausenlos daran, was alles da draußen warten könnte. Man denkt auf eine Weise an Autounfälle, Krebs, Entführung und all die anderen Schrecken, wie man es vor einem Kind noch nie getan hat. Man wusste ja immer, dass es sie gab, aber man hat sich nicht in gleicher Weise gesorgt. Dann hat man eine Tochter, und … na ja, man sieht die Haie. Sie beginnen bei einem im Kopf zu kreisen und gehen nie weg. Man betet einfach nur, dass sie immer kreisen werden. Verstehst du, was ich meine?«
»Ich bin kein Hai«, hatte Mark geantwortet und dann gelächelt, denn er hatte keine Kinder und verstand deshalb nicht, worum es ging. Laurens Vater hatte das Lächeln nicht erwidert, sondern eine lange Zeit suchend in Marks Augen geblickt, bis er schließlich genickt hatte. Sie tranken ihre Biere und sprachen über American Football, Boote und Filme. Alles unbeschwert und locker, doch Mark hatte sich den Rest des Abends unbehaglich gefühlt, weil er das, was er in den Augen des anderen Mannes gesehen hatte, nie selbst erfahren hatte. Es waren schon viele Jahre vergangen, dass er sich das letzte Mal gefragt hatte, wer sein eigener Vater war. Bis zu jenem Abend. Da stellte er sich die Frage erneut und grübelte, ob dieser Mann je an Haie gedacht hatte. Auch nur ein einziges Mal.
Es donnerte noch mehr. Am westlichen Rand der Stadt herrschte Stille, als ob die Bäume sich bedeckt hielten und versuchten, nicht die Aufmerksamkeit der bedrohlichen Wolken auf sich zu ziehen.
Obwohl Mark noch nie zuvor in der Stadt gewesen war, wusste er genau, wo Dixie Wittes Haus lag. Er hatte viel Zeit damit verbracht, es auf Landkarten zu betrachten. Das zweite Stockwerk stand schief, wie ein Betrunkener, der auf einem Bein zu stehen versuchte. Die Fenster der vorderen Veranda hatten Risse oder waren dort, wo Glas sein sollte, mit Plastik abgeklebt. Die hohen Farne im Garten reichten fast bis zum Dach eines verrosteten Ford Taurus. Das Gestrüpp war dicht, sodass Mark sich nicht sicher sein konnte, doch hätte er einen Dollar darauf gewettet, dass der Wagen keine Reifen mehr hatte. Vielleicht nicht mal einen Motor. Neben dem Haus befand sich ein Schuppen mit eingestürztem Dach. Eine Plastikplane war über das Loch gezogen worden, in der sich Regenwasser gesammelt hatte, sie beulte sich nach unten aus. Beim Anblick des Hauses kam einem unwillkürlich der Gedanke, man könnte sich möglicherweise eine Virusinfektion einfangen, wenn man in dessen Windschatten stand.
Mark hatte während seiner Kindheit in vielen solcher Dreckslöcher gelebt, eine Zeit lang sogar mal in einem Pick-up, doch selbst seine Mutter hätte nicht erwogen, in dieses Haus zu ziehen.
Garland Webb hatte dort zwei Monate gewohnt, bevor er nach Daytona Beach weitergezogen und schließlich wegen sexueller Nötigung verhaftet worden war.
In der Einfahrt stand ein Pick-up. Ein roter Dodge, durch nachträglich angebrachte Federungen höhergelegt, mit grobstolligen Geländereifen, die wahrscheinlich so viel wert waren wie das Haus. Der Pick-up war frisch gewaschen, der rote Lack glänzte sogar in der Dämmerung. Mark hatte ein paar Leute kennengelernt, deren Fürsorge mehr ihren Autos als ihren Häusern galt. Normalerweise deutete das auf nichts Gutes hin. Er spazierte um das Haupthaus und erblickte ein Gästehaus am Ende des Grundstücks. Ein kleines, aber gepflegtes Heim, blau gestrichen mit einem sauberen weißen Sockel. Eine Paarung, die nicht zusammenpasste: das große Haus herunterkommen, das kleine Haus liebevoll in Schuss gehalten. Die blühenden Sträucher um es herum waren ordentlich geschnitten, und eine Leiter lehnte an einen Orangenbaum vor dem Haus. Ein barfüßiger blonder Junge in einer Latzhose, ohne Hemd, pflückte Orangen. Er konnte nicht älter als sieben Jahre sein, und er schwankte gefährlich, als er nach einer Orange griff.
»Vorsicht!«, rief Mark und trat neben die Leiter, um sie festzuhalten.
Der Junge pflückte die Orange, legte sie in einen Korb, der auf der obersten Stufe stand, und wandte sich zu Mark. Er war für Florida unglaublich blass und hatte hellblaue Augen.
»Hallo.«
»Hallo. Verlier mal nicht dein Gleichgewicht da oben.«
»Verlieren Sie mal nicht Ihr Gleichgewicht da unten.«
Mark grinste. »Okay. Ist Dixie da?«
Der Junge zuckte mit den Achseln. »Sie hat mich noch nicht bezahlt. Das macht sie, wenn ich fertig bin. Fünfzig Cent für den ganzen Baum.«
»Du musst die Inflation ausgleichen, mein Junge. Du wirst ausgenutzt.«
Noch ein Achselzucken.
»Du kennst die meisten Leute hier in der Stadt, oder?«, sagte Mark.
»Ich kenne jeden.«
»Genau so wirkst du, wie ein Mann mit Beziehungen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Garland gehört?«
»Nee.«
»Von einem Mr. Webb vielleicht? Sagt dir das was?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Sie kommen und sie gehen.«
»Wer?«
»Leute in dem großen Haus.« Der Junge zeigte auf den heruntergekommenen Bau hinter Mark. »Sie bleiben nicht lange und reden nicht viel.«
»Was sind das für Leute, würdest du sagen?«
»Leute wie Sie.«
»Wie ich? Was heißt das denn?«
»Wütende Leute«, antwortete der Junge, und Marks Grinsen erstarb. Die Wolken zogen schnell vorbei. Mark stand jetzt im Schatten, doch der Junge war im Sonnenlicht, und seine weiße Haut leuchtete hell unter der schmutzigen Latzhose. Nur seine nackten, staubbedeckten Füße waren matt.
»Ich bin nicht wütend«, entgegnete Mark.
Ein weiteres Achselzucken. »Ist mir egal.«
»Okay. Aber ich bin nicht wütend, und du musst dir wegen mir keine Sorgen machen.«
»Ich mach mir wegen Ihnen überhaupt keine Sorgen. Wenn Sie ein schlechter Mensch wären, würde Walter mir das schon sagen.«
Mark zog eine Augenbraue hoch. »Walter?«
»Ihm hat mal dieses Haus gehört.«
Jetzt war Marks Interesse wirklich geweckt, denn soweit er wusste, gehörte das Haus seit Generationen der Familie von Dixie Witte, und wenn jemand mit Garland Webb zu tun gehabt hatte, dann sie.
»Das hat mal jemand anderem gehört? Diesem Mann, diesem Walter? Er hat es an Dixie verkauft?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Nee. Walter ist seit Ewigkeiten tot. Er hat das Haus damals gebaut, während der großen Depression. Aber dann wurde er umgebracht. Hab gehört, ihm wurden die Hände abgehackt und in eine Zigarrenschachtel gesteckt. Haben Sie das schon mal erlebt?«
Mark wurde schlecht. Wer zum Teufel erzog dieses Kind und erzählte ihm so was? Was war mit den Leuten in dieser Stadt nur los?
»Hör nicht auf solche Geschichten«, sagte er. »Kinder sollten von Dingen wie diesen nichts wissen.«
»So ist es nun mal passiert«, entgegnete der Junge gleichgültig. »Aber Walter mag Sie. Er begleitet Sie, seit Sie durch das Tor gekommen sind. Und Walter verlässt selten die Veranda.«