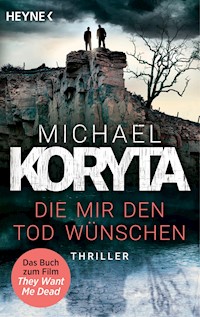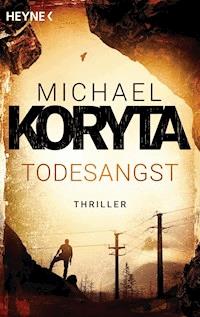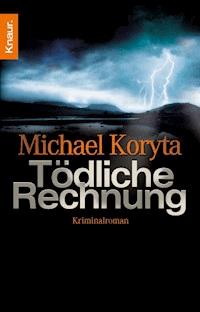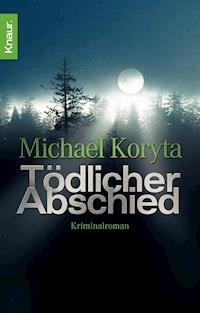
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
In Cleveland wird der Privatermittler Wayne Weston tot in seinem Haus gefunden. Seine Frau und seine sechsjährige Tochter sind spurlos verschwunden. Die Polizei glaubt, dass Weston erst seine Familie und dann sich selbst getötet hat. Westons Vater hält das für Unfug. Er setzt die beiden Privatdetektive Lincoln Perry und Joe Pritchard auf den Fall an. Bei ihren Nachforschungen geraten sie in ein undurchsichtiges Geflecht aus falschen Identitäten, zwielichtigen Geschäften, windigen Freunden und tödlichen Verstrickungen. Aber Westons Tod geht nicht auf dieses Konto …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Ähnliche
Michael Koryta
Tödlicher Abschied
Roman
Aus dem Amerikanischen vonThomas Bertram
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Bob Hammel
Seiner Unterweisung, Anleitung, Ermutigung und Freundschaft bin ich zu tiefem Dank verpflichtet.
1
Es war an einem eiskalten Nachmittag in der ersten Märzwoche, als John Weston seinen Sohn zum letzten Mal lebend sah. Johns Enkeltochter baute gerade einen Schneemann, während die beiden Männer in der Einfahrt standen und sich unterhielten. Bevor er ging, gab John seinem Sohn einen väterlichen Klaps auf die Schulter und versprach, ihn bald wieder zu besuchen. Er besuchte ihn bald wieder. Weniger als achtundvierzig Stunden später, in einem Leichenschauhaus, wo sein Sohn ausgestreckt dalag, gestorben an einer kleinkalibrigen Schusswunde im Kopf. Das Grauen, seine Enkelin im gleichen Zustand zu sehen, blieb John erspart, aber der Grund dafür war ein schwacher Trost: Die fünfjährige Betsy Weston und ihre Mutter waren verschwunden.
All das erzählte John Weston mir, als wir fünf Tage später in seinem Haus in North Olmsted, einem Vorort in Clevelands West Side, saßen. Westons Wohnzimmer war tadellos und stilvoll eingerichtet, aber dunkel. Die Jalousien waren heruntergelassen, und es roch stark nach Zigarettenqualm. Während er sprach, starrte der alte Mann mich mit einem missmutigen Gesichtsausdruck an, der keine Spur von Trauer, dafür jede Menge Entschlossenheit verriet.
»Hören Sie, Mr. Perry«, sagte er, während er eine Wolke aus Zigarettenrauch in meine Richtung blies, »ich kenne meinen Sohn. Er hat sich nicht umgebracht, und er hat ganz sicher seiner Familie kein Haar gekrümmt. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Verstehen Sie, was diese Dreckskerle behaupten? Sie behaupten, mein Sohn hätte seine eigene Frau und seine kleine Tochter getötet und sich dann selbst umgebracht.« Er schlug so fest mit der Hand auf den Couchtisch, dass ein paar Tropfen meines Kaffees über den Rand des Bechers spritzten. »Ich werde das nicht hinnehmen. Ich will wissen, was passiert ist, und ich will, dass Sie und Ihr Partner mir helfen.«
Weston thronte mir gegenüber auf einer gewaltigen Ledercouch, und ich saß in einem bizarren Sessel mit einem geschwungenen hölzernen Gestell und einem großen geriffelten Plastikpolster. Wenn ich mich darin zurücklehnte, rutschte ich nach unten, bis mein Kopf auf Höhe der Armlehnen war. Da ich mir in dieser Position ziemlich lächerlich vorgekommen war, hatte ich alle möglichen anderen Stellungen ausprobiert, bevor ich angesichts der Schwerkraft und des rutschigen Polsters kapitulierte, mich nach vorne lehnte und auf die Sesselkante hockte. Zwar wirkte ich mit meinen auf den Knien ruhenden Ellenbogen jetzt angespannter, als ich es tatsächlich war, aber es war die beste Alternative.
»Ich hab die Fernsehberichte gesehen«, sagte ich. »Aber die Polizei hat nicht behauptet, dass es Gründe für die Mord-/Selbstmord-Theorie gibt, Mr. Weston. Das redet bloß irgendein hohler Schwätzer in einer Nachrichtenredaktion daher, der versucht, die Zuschauer mit Sensationsmache bei der Stange zu halten.«
Weston blickte weiter mürrisch drein. Er war Ende siebzig, aber noch immer eine stattliche Erscheinung. In jüngeren Jahren musste er massig gewesen sein. Doch jetzt waren seine Beine dünn, und sein Bauch war schlaff, aber die breite Brust und die breiten Schultern zeugten von seiner früheren Statur. Noch immer hatte er fast volles, graues Haar, dazu eine Nase, die zu klein für sein Gesicht zu sein schien, und berechnende, wache Augen, die alles aufnahmen, als suchte ihr Besitzer nach einem Vorwand, um loszubrüllen. Der kleine Finger seiner rechten Hand fehlte, und der Ringfinger endete in einem Stummel direkt über dem mittleren Fingerglied. Während ich an meinem Kaffee nippte, drehte Weston sich um und zeigte auf zwei gerahmte Gemälde an der Wand hinter ihm.
»Sehen Sie diese Bilder da?«, sagte er.
Es schienen militärische Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein, und sie waren handwerklich gut ausgeführt. Nichts Ausgefallenes, einfach die genaue Wiedergabe dessen, was ein talentierter junger Künstler gesehen hatte. Malerei genau nach meinem Geschmack – Bilder, die man ohne einen Magister in Kunst verstehen konnte.
»Hat ein Kumpel von mir gemalt«, sagte Weston und hustete dann laut. Es war ein feuchter, krächzender Husten, der stoßweise kam, so als kratzte man mit einer Schaufel Schnee von einem rauen Gehweg.
»Ziemlich gut, nicht wahr?«
»Sehr schön.« Ich trank meinen Kaffee aus und stellte den Becher auf den Couchtisch neben die Visitenkarte, die ich Weston überreicht hatte. PERRY & PRITCHARD ERMITTLUNGEN stand darauf. Ich war Lincoln Perry, und Joe Pritchard war mein Partner. Wir waren jetzt erst sechs Monate in dem Geschäft, hatten es aber schon geschafft, einen ziemlichen Berg Schulden anzuhäufen. Allerdings versuchten wir, uns dieser Leistung nicht allzu oft zu rühmen, vor allem nicht gegenüber Klienten. Vor unserem Einstieg ins private Ermittlungsgeschäft waren Joe und ich Partner im Rauschgiftdezernat des Cleveland Police Department gewesen. Ich war gezwungen worden, zu kündigen, und Joe war ungefähr ein Jahr später in Pension gegangen. Irgendwie hatte er mich dazu gebracht, mich mit John Weston allein zu treffen, während er vermutlich ein reines Routinegespräch abwickelte. Jetzt bedauerte ich diese Abmachung.
»Was Sie da auf den Bildern sehen, sind ein CG-4A-Lastensegler und ein Schleppflugzeug«, sagte Weston mit einem neuerlichen Blick auf die Bilder. »Ich habe die Lastensegler geflogen.«
»Ich nehme an, das war eine einzigartige Erfahrung.«
»Das können Sie laut sagen. So etwas hat es weder davor noch danach jemals wieder gegeben. Als dann Vietnam kam, hatten sie Helikopter, um diesen Job zu erledigen. Aber in meinem Krieg waren es Segelflugzeuge.«
Ich stellte mir das Erlebnis vor, ohne einen Motor als Antrieb still und leise auf ein Schlachtfeld hinabzuschweben.
»Was war das für ein Gefühl, so ein Ding zu fliegen?«
Er lächelte. »Als wenn man auf der vorderen Veranda sitzt und das Haus fliegt. Ich habe zwei Kampfeinsätze und eine Hand voll Nachschubmissionen geflogen. Hatte beim zweiten Kampfeinsatz ’ne unsanfte Landung und verlor ein paar Finger, aber trotzdem musste ich noch die ganze Nacht am Boden kämpfen. Wir bekamen dieselbe Ausbildung an der Waffe wie die Soldaten von den Kommandotrupps, und wir Seglerpiloten hatten den Auftrag, jedes Terrain zu halten, auf dem wir landeten. Ich habe die ganze Nacht gegen die Nazis gekämpft, ohne irgendwelche Medikamente gegen die Schmerzen in meiner Hand. Aber es hätte schlimmer kommen können. Einige andere Segler gingen völlig zu Bruch bei der Landung, und ein paar wurden abgeschossen. Teufel noch eins, ich hatte sogar Einschusslöcher in der Bespannung.«
»Knapp davongekommen, was?« Ich wusste nicht, worauf er mit dieser Unterhaltung hinauswollte, aber ich war willens, sie durchzustehen.
»Knapp genug. Doch am knappsten überhaupt bin ich bei einem Einsatz davongekommen, den ich nicht geflogen bin. Ich war eingeteilt, praktisch mitten in eine deutsche Festung in Frankreich zu fliegen, und die Wahrscheinlichkeit, zu überleben, war so gering, dass das Ganze einer Kamikaze-Aktion verdammt nahe kam. Wir waren alle fest entschlossen, hinzufliegen, und sagten der Welt Lebewohl, na ja, weil wir ziemlich überzeugt davon waren, dass das eine Reise ohne Rückfahrkarte war. Kurz vor dem Start wurde uns dann mitgeteilt, dass der Einsatz abgeblasen worden sei, weil Patton die Nazi-Festung erobert habe.« Er zündete sich mit einem stählernen Zippo eine weitere Zigarette an und inhalierte tief. »Die Leute ziehen in letzter Zeit ständig über Patton her, aber eines will ich Ihnen sagen: Dieser Mistkerl ist mein Freund, solange ich lebe.«
Ich bin selber immer ein ziemlicher Patton-Fan gewesen, zumindest was den Respekt vor dem Feldherrngenie und der Tüchtigkeit des Mannes betraf, aber da ich vermutete, dass Weston derartige Respektsbekundungen von seiten eines Mannes, der nie gedient hatte, verschmähen würde, hielt ich den Mund. Er rauchte eine Minute lang schweigend und starrte in Erinnerungen versunken über seine Schulter hinweg auf die Bilder. Dann wandte er sich wieder mir zu und kniff die Augen in einer Weise zusammen, die Konzentration und Entschlossenheit verriet.
»Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich mit mir treffen«, sagte er. »Nach unserem ersten Gespräch am Telefon dachte ich, Sie würden mich abblitzen lassen.«
»Ich bin hier«, erwiderte ich, »aber das heißt nicht, dass ich den Auftrag übernehme, Mr. Weston. An diesem Fall arbeiten ein paar der besten Cops in der Stadt, und nach dem, was ich so höre, hilft sogar das FBI mit.«
»Hilft mit, herumzutändeln und Zeit zu vergeuden!«, brüllte er.
»Ich glaube nicht, dass die Polizei irgendwelche Zeit vergeudet, Sir.«
»Nein? Wo, zum Teufel, bleiben dann die Ergebnisse? Diese Scheißbullen kommen jeden verflixten Tag vorbei und erzählen mir, was sie herausgefunden haben. Und wissen Sie, was sie herausgefunden haben? Einen Dreck, Mann. In fünf Tagen haben sie nichts zuwege gebracht.« Er schob die Unterlippe vor und stieß kraftvoll eine Rauchwolke aus, die sein Gesicht einhüllte.
»Es braucht eine gewisse Zeit, um bei einer Untersuchung von dieser Größenordnung voranzukommen, Sir.«
»Hören Sie«, sagte er, wobei er versuchte, seine Wut zu zügeln, »wir reden hier über meinen Sohn. Meinen Sohn und seine Familie. Ich muss etwas unternehmen, aber ich bin clever genug, um einzusehen, dass ich allein nichts ausrichten kann. Ich brauche jemanden, der für mich arbeitet. Jemanden, der das Zeug hat, diese Sache mit der nötigen Energie voranzutreiben.«
Ich seufzte. John Weston war überzeugt davon, dass sein Sohn ermordet worden war, obwohl keiner der Polizeiermittler seine Ansicht zu teilen schien. Nach der – dank einer »ungenannten polizeilichen Quelle« – in den Medien vorherrschenden Theorie hatte Wayne Weston seine Familie getötet, bevor er sich selbst ins Jenseits beförderte. Man hatte keine Leichen gefunden, und es gab kaum Anhaltspunkte, die das Verschwinden von Ehefrau und Tochter erklärten. Im Haus selbst hatten sich keinerlei Hinweise auf gewaltsame Eindringlinge gefunden; abgesehen von Wayne Westons Leiche hatte alles einen ganz normalen Eindruck gemacht.
»Warum wir, Mr. Weston?«, fragte ich. »Wieso glauben Sie, dass wir eingeschaltet werden müssen, wo Sie doch schon die Polizei haben, die alles tut, was in ihrer Macht steht?«
»Weil Sie meinen Sohn kannten.«
Ich hob warnend die Hand. »Ich bin Ihrem Sohn einmal begegnet.«
»Wie auch immer. Sie kannten ihn, und er kannte und respektierte Sie. Als Sie mit Ihrer Firma anfingen, sagte er mir, dass er glaube, Sie und Ihr Partner würden Ihre Sache sehr gut machen.«
Ich hatte Wayne Weston vor zwei Monaten auf einer Tagung für Privatdetektive in Dayton getroffen. Es war eine dieser zweitägigen Veranstaltungen gewesen, die tagsüber aus Seminaren zu verschiedenen brancheninternen Themen und abends aus Besprechungen im Hotelrestaurant mit zu viel Essen, Trinken und lautem Gelächter bestehen. Joe hatte entschieden, wir müssten hinfahren, weil sich die Möglichkeit böte, Kontakte zu anderen Ermittlern zu knüpfen und vielleicht den einen oder anderen Auftrag an Land zu ziehen.
Wayne Weston hatte an einem Abend beim Essen am selben Tisch gesessen wie ich. Er war ein großspuriger Bursche, der teure Anzüge trug und einen schicken Wagen fuhr, aber er war freundlich und besaß eine gewisse Ausstrahlung. Und nach allem, was ich gehört hatte, war er ein verdammt guter Ermittler. Er war einige Jahre bei der Pinkerton-Agentur gewesen, bevor er nach Cleveland zurückkehrte, um seine eigene Firma aufzumachen. Und anscheinend verdiente er gutes Geld damit. Mein persönliches Gespräch mit ihm hatte sich auf einen Austausch der Namen beschränkt, und ich war überrascht, jetzt zu erfahren, dass er irgendetwas über Joe und mich zu seinem Vater gesagt hatte.
»Mein Sohn hat sich weder umgebracht noch seiner Familie Gewalt angetan«, sagte Weston. »Das ist der absurdeste und unverschämteste Blödsinn, den ich je gehört habe. Sie kamen gestern in den Nachrichten darauf zu sprechen, und ich wäre wahrhaftig beinahe da runtergefahren und hätte einen Mordskrach geschlagen. Ich will wissen, was meiner Schwiegertochter und meiner Enkelin tatsächlich zugestoßen ist, damit ich aufhören kann, mir diese verflixten Sorgen zu machen, und damit diese Fernsehleute die Klappe halten müssen.«
Während er sprach, funkelten seine Augen vor Wut, und er versuchte, sie mit einem mächtigen Zug an seiner Zigarette zu ersticken. Einen Moment lang dachte ich, er würde die ganze Kippe mit diesem einen heftigen Zug aufrauchen.
»Was genau sollen Joe und ich Ihrer Meinung nach tun?«, fragte ich. »Herausfinden, ob Ihr Sohn ermordet wurde oder seine Frau und seine Tochter finden?«
»Beides«, erwiderte er, wobei er eine Rauchwolke ausstieß, von der mir die Augen brannten. »Ich habe den Eindruck, dass das eine ziemlich stark mit dem anderen verknüpft ist.«
Das war ein berechtigter Hinweis. Doch die Sache gefiel mir trotzdem nicht. Die Bullen würden sich über unsere Anwesenheit ärgern, und ich hatte nicht die geringste Lust, in das Medienspektakel verwickelt zu werden.
»Hören Sie, ich habe genug Geld«, sagte Weston. »Ich habe eine gute Altersversorgung, und ich habe ein Sparkonto. Ich kann es mir leisten, jede Summe zu zahlen, die Sie wollen.«
»Es geht nicht um Geld, Mr. Weston«, sagte ich.
»Nein? Worum, zum Teufel, geht es dann?«
»Die Polizei hat einen Haufen Ermittlungsbeamte auf den Fall angesetzt«, erwiderte ich. »Die haben Mittel und Wege, über die wir nicht verfügen, und außerdem haben sie eine Woche Vorsprung in der Sache. Ich würde Ihnen raten, erst einmal abzuwarten, was die Polizei herausfindet. Wenn die Cops in ein paar Wochen keinerlei Fortschritte erzielt haben, rufen Sie uns wieder an, und vielleicht überlegen wir es uns noch einmal.« Ich hatte nicht die Absicht, es mir anders zu überlegen, aber ich hoffte, das Angebot würde den alten Mann besänftigen.
»Sie wissen, warum ich Ihnen diese Gemälde gezeigt habe?«, fragte er. »Warum ich Ihnen erzählt habe, was mit meiner Hand passiert ist?«
»Nein, Sir.«
Er drückte seine Zigarette in einem Aschenbecher auf dem Tisch aus und starrte mich verächtlich an. Dann schüttelte er den Kopf.
»Wayne war einer von Ihnen«, sagte er. »Dieselbe Stadt, dieselbe Branche, und es ist eine Branche, die zahlenmäßig recht überschaubar ist. Das hat den Leuten früher etwas bedeutet. Als ich im Krieg war, kämpften wir für die Männer an unserer Seite. Vor dem Kampf, bei der Vorbereitung, ging es nur um Patriotismus und darum, die Welt zu retten und die Freiheit unserer Familien daheim zu schützen. Aber wissen Sie was? Letzten Endes, im Feuergefecht, hat man darauf keinen Gedanken mehr verschwendet. Man kämpfte für die Männer neben einem, kämpfte für die eigenen Kameraden, schützte sich selbst.« Er blickte mich traurig an. »Vielleicht war meine Generation die Letzte, die diese Art von Loyalität, diese Art von Kameradschaft besaß.«
Das war eine verdammt gute Masche. Ich antwortete nicht gleich, aber seine Worte fanden Widerhall bei mir, ganz so, wie er gehofft hatte. Ich hatte Wayne Weston nicht gut gekannt, und wir waren in derselben Branche, nicht im selben Krieg, aber als ich jetzt diesem Mann mit seinen Weltkriegsgemälden, der verstümmelten Hand, dem toten Sohn und den verschwundenen Familienangehörigen gegenübersaß, erschien mir diese Argumentation irgendwie nicht sehr überzeugend.
»Warum machen Sie es?«, wollte er wissen. »Warum sind Sie überhaupt in diesem Geschäft? Wollen Sie reich werden, indem Sie untreuen Ehemännern nachjagen? Glauben Sie, es macht Eindruck auf Frauen, wenn Sie sagen, Sie sind Privatschnüffler? Na?«
Ich blickte zu Boden und bemühte mich, ihn nicht anzuschnauzen. »Nein«, gab ich in ruhigem Ton zurück. »Nichts davon, Sir.«
»Tatsächlich? Warum, zum Teufel, machen Sie es dann?«
Ich schwieg.
»Und?«, hakte er nach. »Kriege ich eine Antwort, mein Junge?«
Ich hob den Kopf und sah ihn an. »Ich mache es«, sagte ich, »weil ich unheimlich gut darin bin.«
»Sie glauben also wirklich, Sie sind unheimlich gut?«
»Ich glaube es nicht, Sir, ich bin es. Und mein Partner ebenfalls.«
Er lächelte, weder belustigt noch vergnügt. »Dann beweisen Sie es!«
Ich begegnete seinem Blick und hielt ihm eine Weile stand. Dann nickte ich kurz.
»In Ordnung«, sagte ich. »Das werden wir.«
2
Also, das war das letzte Mal, dass ich dich unbeaufsichtigt einen potenziellen Klienten treffen lasse«, sagte Joe Pritchard. »Ich dachte, wir wären uns einig gewesen, uns in diesen Schlamassel nicht hineinziehen zu lassen.«
Es war am nächsten Vormittag, und wir saßen im Büro. Joe kam gerade von seinem Fünf-Meilen-Lauf zurück, war schweißgebadet und atmete noch immer schwer. Ich fand, das war der günstigste Zeitpunkt, ihm die Neuigkeit zu eröffnen, in der Hoffnung, dass er zu müde war, sich etwas daraus zu machen. Schön wär’s. Um Joe zu erschöpfen, brauchte es weit mehr als einen Fünf-Meilen-Lauf in der Kälte.
»Warum es nicht mal versuchen, Joe? Wir verdienen sowieso nicht viel, warum also die Angebote ablehnen, die wir bekommen?«
»Weil das Geld den Aufwand nicht lohnt.« Er stöhnte und wischte sich mit einem Handtuch übers Gesicht. Er trug Laufschuhe, Jogginghose und eine Nylonjacke, und hätte man zehn Leute aufgefordert, sein Alter zu schätzen, hätten sich alle um ein Jahrzehnt vertan. »Mir gefällt einfach die Vorstellung nicht, hinter dem Cleveland Police Department herzutrotten, Lincoln.«
Dafür hatte ich Verständnis. Joe war erst vor sechs Monaten in Pension gegangen, und ich wusste, dass es ihm sonderbar vorkäme, sich von außen in eine laufende polizeiliche Ermittlung einzuschalten. Doch jetzt war es zu spät. Ich hatte die Vereinbarung mit Weston getroffen, und in meiner Tasche steckte ein Zweitausend-Dollar-Scheck als Vorschuss, um den Deal zu besiegeln.
»Ach, komm schon«, sagte ich. »Du weißt, dass dich der Fall interessiert, und wir haben nicht gerade alle Hände voll zu tun mit anderen Projekten.«
Er grunzte, erwiderte aber nichts, sondern sah sich im Büro um, als suchte er Unterstützung bei den Möbeln. Unser kleines Büro liegt in der West Side, im ersten Stock eines alten steinernen Bankgebäudes. Es verfügt über Hartholzböden, die dringend einer Politur bedürfen, zwei Schreibtische, ein kleines Badezimmer, das gleichzeitig als Ausweichbüro fungiert, und frisch gestrichene Wände, die in dem alten Gebäude erschreckend hell wirken. Mein Beitrag zur Büroeinrichtung steht gegenüber von unseren Schreibtischen: vier hölzerne Sitze aus dem alten Cleveland Stadium. Das Stadion war Anfang der Neunziger abgerissen worden, und man hatte einige der Sitze als Souvenirs versteigert. Ich hatte die Stühle erstanden, sie wieder herrichten lassen, und ich fand, sie sahen ganz passabel aus, auch wenn sie ein wenig fehl am Platz wirkten. Joe belegte die Sitze mit verschiedenen Vulgärausdrücken und weigerte sich, sich darauf zu setzen. Es war kaum zu glauben, dass er Indians-Fan war. Kein Sinn für Nostalgie.
»Tja, ich hab Weston gesagt, wir wären jetzt dabei«, sagte ich, »also lass uns nicht darüber streiten, ob wir den Fall hätten übernehmen sollen. Lass uns überlegen, wie wir am besten anfangen.«
»Wir könnten anfangen, indem wir uns ein Sandwich schnappen«, sagte Joe. »Ich bin am Verhungern.«
Joe isst mit unbändigem Appetit, aber er trinkt auch fast nichts außer Wasser und läuft jeden Tag mehrere Meilen, so dass er selbst als Fünfzigjähriger noch gut in Schuss ist.
»Ich hab den Fall nicht so genau verfolgt«, sagte ich und ignorierte ihn. »Deshalb sollten wir wahrscheinlich die Zeitungsartikel durchsehen, bevor wir das CPD mit irgendwelchen Anrufen bombardieren. Ich hasse es nämlich, uninformiert zu wirken.«
»Du suchst nach einem Vorwand, um Lois Lane, unsere Superman-Kollegin, in die Sache hineinzuziehen«, sagte er mit einem Seufzer. »Gerade wo ich dachte, schlimmer könnte es nicht mehr kommen.«
Ich grinste. »Ich bin mir sicher, dass Amy gern auf jede erdenkliche Art behilflich sein wird.«
»Fabelhaft«, erwiderte er. »Ich sag dir was: Wie wär’s, wenn du die Hintergrundinformationen beschaffst, und ich hole uns was zu essen? Wenn ich dann zurückkomme, kannst du mich präzise ins Bild setzen, und ich bin in der Lage, mich zu konzentrieren, ohne ständig von meinem knurrenden Magen abgelenkt zu werden.« Er stieß sich vom Schreibtisch ab.
»In Ordnung«, erwiderte ich, während er die Tür öffnete, um zu gehen. »Ich nehme an, dass ich hier die meiste Arbeit machen muss. Ihr alten Knacker seid einfach nicht zäh genug, um da mitzuhalten.«
Amy Ambrose war einverstanden, in ihrer Mittagspause mit allen einschlägigen Artikeln vorbeizukommen. Gegen zwölf schritt sie naserümpfend durch die Tür.
»Euer Treppenhaus stinkt. Habt ihr da wieder die Wermutbrüder schlafen lassen?«
»Dir auch Hallo.«
»Ja, ja.« Sie warf ihren Mantel ab und ließ sich auf einen der Stadionsitze fallen. Sie sah gut aus, wie immer. Ihr Haar war ein bisschen länger als im Sommer, als wir uns zum ersten Mal begegnet waren, aber es war dasselbe Dunkelblond, und es waren dieselben weich fallenden Locken. Amy war Reporterin für Clevelands Daily Journal und hatte im Sommer den Auftrag bekommen, über eine Morduntersuchung zu berichten. Das Mordopfer war ein Stammkunde in meinem Fitness-Studio gewesen, und Amy kreuzte auf der Suche nach Informationen bei mir auf. Mit meinem üblichen Charme sagte ich ihr, sie solle sich zum Teufel scheren. Einen Tag später war sie wieder da, mit mehr Informationen über den Fall und über mich, als die meisten Reporter über Nacht herauskriegen konnten. Sie hatte sich meinen Respekt, meine Hilfe und bald auch meine Freundschaft verdient. Amy war freimütig, frech und großspurig, aber sie ging auch konsequent ihren eigenen Weg, und sie war ehrlich. Genau deswegen kamen wir einander näher – zwei selbstbewusste Einzelgänger, die, wenn sie unter Druck standen, einzig und allein ihrem eigenen Urteil und Können vertrauten. Außer Joe gab es niemanden, mit dem ich so eng befreundet war, und obwohl ich den Leuten erzählte, dass Amy für mich wie eine Schwester sei, erkannte ein kleiner Teil meines Verstandes, dass mir beim Anblick meiner echten Schwester nicht so der Atem stockte, wie es passieren konnte, wenn ich Amy sah.
»Sieh an, du und Pritchard, ihr beide glaubt also, ihr kriegt das fertig, wozu Dutzende von Cops und ein paar FBI-Agenten bislang nicht imstande waren?«, sagte Amy.
»So anmaßend sind wir nicht«, entgegnete ich. »Ich schätze, zwei Tage werden wir schon brauchen, vielleicht auch drei.«
Sie lächelte. »Klar. Also gut, es sieht so aus, als hättet ihr alle Hände voll zu tun. Ich hab das meiste von dem Zeug überflogen, bevor ich herkam, und falls die Cops irgendwelche lohnenden Hinweise haben, dann weihen sie die Medien nicht ein, so viel ist sicher.«
»Du arbeitest nicht an der Story?«
»Nein, sie haben einen anderen Reporter darauf angesetzt, einen Burschen namens Steve. Er ist ein guter Schreiber, aber ich weiß nicht, ob er den richtigen Riecher für Ermittlungsarbeit hat.« Sie entdeckte eine winzige Knitterfalte in ihrer Hose, betrachtete sie missbilligend und versuchte dann, sie mit der Handfläche zu glätten. Es sind solche kleinen Dinge, die Amy stören. Dass die Rückbank ihres Autos auffallende Ähnlichkeit mit einer Müllkippe hat, ist ihr gleichgültig, aber Knitterfalten kann sie nicht ausstehen.
»Hast du mir ein paar Hintergrundinformationen besorgt?«, fragte ich.
»Hier ist alles, was Steve über den Fall geschrieben hat«, sagte sie und reichte mir einen Packen Computerausdrucke. »Mehr konnte ich nicht kriegen.«
Ich überflog sie rasch. Eine Menge Artikel für gerade mal fünf Tage, aber in keinem stand viel mehr, als ich bereits wusste. Westons Leiche sei am Mittwochmorgen von seiner Putzfrau entdeckt worden. Er sei an einer einzigen Schusswunde an der rechten Schläfe gestorben, eine Verletzung, die er sich nach polizeilicher Feststellung selbst zugefügt hatte. Die Waffe, eine .38er Smith & Wesson, habe sich noch in Westons rechter Hand befunden, als die Leiche entdeckt wurde. Sie sei auf seinen Namen registriert gewesen. Man habe die Polizei gerufen, die den Rest des Tages erfolglos versucht habe, Westons Frau und Tochter ausfindig zu machen. Am Mittwochabend habe die Polizei dann eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte, die auf eine Entführung hindeuteten, was die Sache zu einem Fall für das FBI gemacht hätte, aber ein paar Agenten vom FBI-Büro in Cleveland würden dem CPD »helfen«. Der Artikel verriet, dass einige Nachbarn und Bekannte argwöhnten, das Geschehen habe etwas mit einem Fall zu tun, an dem Weston gearbeitet habe, aber diese Theorie sei von der Polizei nicht erhärtet worden. Dahinter stecke wahrscheinlich nichts weiter als Neugier und der Umstand, dass man bei der Tätigkeit eines Privatdetektivs sofort an finstere Machenschaften denke. Die Polizei habe Westons Büro und Wohnung durchsucht und »geht intensiv Hinweisen nach«, aber der mit dem Fall betraute Detective, Rick Swanders, meinte, es gebe keinen berechtigten Verdacht, dass irgendjemand, über den Weston gerade Ermittlungen angestellt habe, es auf die Ehefrau und die Tochter abgesehen hatte.
»Tja«, sagte ich, als ich fertig war, »noch habe ich den Fall nicht geknackt. Ich vermute, ich werde tatsächlich ein oder zwei Leute befragen müssen.«
»Ich hatte erwartet, dass du dir die fehlenden Informationen aus den Artikeln holst«, sagte Amy in gespieltem Frust. »Das ist eine echte Enttäuschung.«
»Kennt dein Spezi Steve möglicherweise Einzelheiten, die er seinen Lesern vorenthält?«
»Vielleicht, aber ich würde nicht allzu viel Hoffnung darauf setzen. Du weißt, wie zugeknöpft Cops am Anfang einer solchen Untersuchung sind. Falls Steve nicht eine großartige Quelle aufgetan hat, bezweifle ich, dass er viel mehr erfahren hat als das, was du gerade gelesen hast.«
Ich nickte. Es war eine Weile her, seit ich die Truppe verlassen hatte, aber nicht so lange, dass ich das wohlbegründete Misstrauen vergessen hätte, das die meisten Cops gegenüber den Medien hegten.
»Wo geht ihr also von hier aus hin?«, fragte Amy.
»Wenn Joe zurückkommt, fahren wir rüber zu Westons Vater. Wir werden ihn nach Einzelheiten über seinen Sohn befragen und versuchen, uns einen Eindruck von seinen letzten Lebensmonaten zu verschaffen. Dann werden wir mit der Polizei reden und schauen, wie viel Zusammenarbeit wir von dieser Seite erwarten können. Sobald wir uns darum gekümmert haben, denke ich, werden wir uns auf Westons Arbeit konzentrieren, so viel wie möglich über seine jüngsten Fälle in Erfahrung bringen und feststellen, ob es irgendjemanden gibt, dem er tatsächlich auf die Füße getreten ist.«
Amy nickte. »Glaubst du, er wurde ermordet?«
»Nein, nach allem, was ich gehört oder gelesen habe, glaube ich nicht, dass er ermordet wurde. Ich denke, er hat sich umgebracht. Aber der Vater will, dass wir das Gegenteil beweisen, also werde ich den Fall unter der Prämisse angehen müssen, dass sein Sohn nicht Selbstmord verübt hat. Außerdem, falls seine Familie noch am Leben sein sollte, ist es viel wahrscheinlicher, dass er ermordet wurde. Bis also jemand beweisen kann, dass seine Frau und seine Tochter tot sind, werde ich behaupten, dass die Polizei in der falschen Richtung sucht.«
»Du klingst nicht allzu begeistert.«
»Bin ich auch nicht. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir das Geld des Vater einstreichen, damit wir unsere Nasen in dieses Durcheinander stecken können, und in ein oder zwei Wochen halten die Cops dann eine Pressekonferenz ab und verkünden, dass sie die Leichen von Ehefrau und Tochter genau dort gefunden haben, wo Weston sie entsorgt hat. Ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber es ist schwierig, nicht daran zu denken.«
»Warum den Fall dann übernehmen?«
»Wenn jemand so sehr wie dieser alte Mann darauf besteht, dass ich in einer Sache ermittle«, sagte ich, »dann werde ich immer einen Versuch wagen.«
Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen und runzelte die Stirn. »Ich muss selber ständig darüber nachdenken, einfach wegen seines Berufs. Durch die Art der Branche erscheint die ganze Sache noch ein bisschen schäbiger, findest du nicht?«
»Ein wenig.« Ich lehnte mich zurück und legte die Füße auf den Schreibtisch.
»Und«, sagte sie, das Thema wechselnd, »wie geht’s Angela?«
»Warum betonst du ihren Namen so?«, fragte ich. »Als würdest du mich auslachen?«
Sie zog die Augenbrauen hoch und versuchte unschuldig dreinzuschauen. »Dich auslachen? Ganz und gar nicht. Sei nicht abwehrend. Also, was ist los mit euch beiden?«
»Angela und ich gehen jetzt getrennte Wege.«
»Wirklich? Tut mir leid«, erwiderte sie, aber ich konnte sehen, dass es ihr keineswegs leidtat. »Darf ich fragen, wieso?«
»Wir sind einfach zu verschieden«, murmelte ich. »Sie war, ach, eine ziemlich …«
»… dumme Gans«, warf Amy ein.
Ich runzelte die Stirn. »Das wollte ich nicht sagen.«
»Hoppla.« Sie grinste. »Meine Schuld.«
»Sie war keine dumme Gans«, sagte ich. »Und du bist ihr nur einmal begegnet, also kannst du dir kaum ein Urteil erlauben.«
»Einmal hat gereicht, Lincoln.«
»Und wie steht’s mit deinem Liebesleben? Dein heißer Nachrichtenmoderator-Freund, Mr. Jacob Terry?«, sagte ich und senkte meine Stimme zu einem tiefen Bariton.
»Uns geht’s gut.«
Ich lächelte. »Was findest du eigentlich am attraktivsten an ihm? Den romantischen Moschusduft seines Rasierwassers oder die Unmengen Haargel, mit denen er sich diese umwerfende Mähne für eine windige Live-Reportage an den Kopf klebt?«
»Du bist ja nur eifersüchtig«, sagte sie.
»Ich kann mich kaum beherrschen«, sagte ich mit einem Nicken. »Ich hab fast schon schlaflose Nächte.«
»Mach dich ruhig lustig, Lincoln, aber ich kenne den wahren Grund, warum du und Angela euch nicht verstanden habt. Du kannst nicht aufhören, an mich zu denken.«
Ich zeigte auf die Tür. »Zieh Leine, Goldstück. Ich hab zu arbeiten.«
Sie lächelte und erhob sich. »Ich auch. Aber ich erwarte in den nächsten paar Tagen einen Anruf, damit ihr mir Bescheid gebt, was ihr herausgefunden habt.«
»Ich werde anrufen.«
Eine halbe Stunde später kam Joe zurück, und wir gingen John Weston einen Besuch abstatten. Während Joe fuhr, informierte ich ihn über das, was ich aus den Artikeln erfahren hatte. Es war praktisch nichts.
»Ich hoffe, dieser alte Mann ist nicht so laut und hitzig, wie du behauptest«, sagte er zu mir. »Mit solchen Typen komme ich nicht so gut klar.«
»Du meinst deine Altersgenossen?«
»Schnauze, Mann.«
Weston begrüßte uns an der Tür in einer Wolke aus Zigarettenrauch. Er schüttelte Joe die Hand, als ich die beiden miteinander bekannt machte.
»Ich hoffe wirklich stark, Sie lassen sich nicht so viel Zeit wie Ihr Partner«, sagte Weston zu ihm. Mich mochte er schon.
»Keiner von uns wird sich bei irgendetwas Zeit lassen, sobald wir zugesagt haben, den Fall zu übernehmen«, erwiderte Joe. »Aber er war derjenige, der mich überreden musste, Sir. Nicht umgekehrt.«
»Das kümmert mich jetzt nicht mehr. Fangen Sie einfach an.«
Er führte uns ins Wohnzimmer. Ich steuerte rasch auf den Lehnstuhl an der gegenüberliegenden Wand zu und überließ es Joe, sich mit dem Foltersessel herumzuquälen.
Weston kehrte zu seinem Platz auf der Couch zurück und hielt ein Notizbuch in die Höhe. »Ich habe daran gearbeitet, seit Sie gestern weg sind«, sagte er und nickte mir zu. »Ich habe alles über Wayne aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Ich habe natürlich versucht, mich auf die Sachen aus jüngster Zeit zu beschränken, aber Sie finden auch ein paar Hintergrundinformationen. Ich dachte mir, das könnte alles ganz nützlich sein.«
Ich schaute Joe an und konnte erkennen, dass er sah, was ich bereits wusste. Möglich, dass John Weston trauerte, möglich, dass er launisch war, aber das Wichtigste war für ihn, diese Ermittlung zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. In vielen Situationen ist es schwierig, die Familie des Opfers zu bewegen, ihre Gefühle lange genug auszuschalten, bis man die nötigen Informationen hat. Hier würde das kein Problem sein.
»Los, werfen Sie einen Blick rein und schauen Sie nach, ob ich irgendetwas ausgelassen habe«, sagte Weston und winkte mir mit dem Notizbuch.
Ich nahm es, und ich war beeindruckt. Er hatte fast zwanzig Seiten säuberlich mit pedantischer Druckschrift gefüllt, lauter Großbuchstaben. Jede Gruppe von Informationen trug eine Überschrift, beispielsweise »geschäftlicher Werdegang«, »Bekanntschaften« und so weiter. Auf einige Seiten hatte er sogar Fotos geklebt, samt Bildunterschriften, die die Abgebildeten identifizierten. Es war genau die Art von Bericht, die Joe und ich gehofft hatten, nach dieser Unterredung selber zusammenstellen zu können.
»Das ist sehr gründlich«, sagte ich. »Wir wissen das zu schätzen, Mr. Weston. Das sind genau die Informationen, die wir zur Verfügung haben müssen, wenn wir in dem Fall schnell vorankommen wollen.«
Weston zündete sich eine neue Zigarette an. »Das dachte ich mir. Nach den meisten Punkten haben die Cops mich schon gefragt, so dass ich wusste, wonach Sie wahrscheinlich suchen würden. Ich dachte, ich würde etwas Zeit sparen, wenn ich sie für Sie zusammenstelle.«
Als mein Blick auf ein Foto von Wayne Weston in Uniform fiel, hielt ich im Blättern inne.
»Ihr Sohn war beim Militär?«
»Das stimmt. Acht Jahre bei den Marines. Er gehörte zur Force Recon«, verkündete Weston stolz. Ich kannte den Grund für diesen Stolz. Die Force Recon (Reconnaissance) war die Spezialeinheit des Marine Corps für Aufklärungseinsätze. Die Truppe war für die Marines das, was die Green Berets für die Army und die SEALs für die Navy waren.
»Wie alt war er, als das Corps ihn entließ?«
»Achtundzwanzig. Er kam von den Marines, kehrte hierher zurück und heuerte dann bei der Pinkerton-Truppe an. Er fand, Ermittlungsbranche klinge interessant, und einen Recon-Veteranen würde man dort nicht ablehnen, so viel sei hundertprozentig sicher«, sagte Weston. »Er blieb ein paar Jahre dabei. Dann lernte er Julie kennen und heiratete. Für die Pinkerton-Leute hatte er ziemlich viel herumreisen müssen, so dass er von sich aus beschloss auszuscheiden.«
»Wie lange hat er selbständig gearbeitet?«, fragte ich.
»Neun Jahre«, erwiderte Weston, ohne eine Sekunde zu überlegen. »Und er hat verdammt gut davon gelebt. Schönes Haus, schicke Autos für ihn und für Julie, der ganze Krempel.« Westons braune Augen schauten melancholisch durch den Schleier aus Zigarettenrauch.
»Sie sagten mir, Ihnen sei nichts von irgendwelchen Schwierigkeiten bekannt gewesen«, sagte ich. »Keine Familienstreitigkeiten, keine finanziellen Probleme, nichts in dieser Art.«
»Das stimmt. Ich habe mindestens einmal die Woche mit ihm gesprochen, und alles schien in Ordnung zu sein. Na ja, fast in Ordnung. In den letzten paar Monaten wirkte er ein wenig ernster, wissen Sie, nicht mehr ganz so schnell mit einem Witz bei der Hand.« Er paffte seine Zigarette und zuckte dann mit den Schultern. »Doch vielleicht war es nur der Winter, der ihn fertig machte. Sie wissen selbst, wie mürbe einen diese verfluchten Winter in Cleveland machen können.«
»Hat er jemals irgendwelche geschäftlichen Sorgen erwähnt?«, fragte Joe. »Einen hartnäckigen Fall, einen schwierigen Klienten, irgendetwas in der Art?«
»Nein. Rein gar nichts.« Er sagte es unsicher – nicht, als würde er lügen, aber so, als beunruhigte es ihn, dass er nichts hatte, worauf er alles schieben konnte.
»Hat er allein gearbeitet?«
»Ja.« Weston hielt einen Finger hoch und bekam einen Hustenanfall, der klang wie ein stotternder Dieselmotor. Er bekam ihn unter Kontrolle, fluchte, zog kräftig an seiner Zigarette und nahm den Gesprächsfaden wieder auf. »Er hatte ziemlich bald schon einen Partner, aber dieser Typ zog dann nach Sandusky, und Wayne kehrte wieder zu seinem Einzelkämpferdasein zurück. Er hatte wohl einen – tja, wie würden Sie so was nennen – Ermittlungsassistenten, nehme ich an? Irgendein Student in den höheren Fachsemestern, den er gebeten hatte, ihm gelegentlich bei Nachforschungen zu helfen, wenn er wirklich überlastet war.«
»Wissen Sie seinen Namen?«, fragte Joe.
»Ihren Namen«, sagte Weston. »Sie heißt April Sortigan. Der Name steht in dem Notizbuch.«
Ich hörte auf, die Notizen durchzublättern, und starrte auf die Fotografien seiner Schwiegertochter Julie und seiner Enkelin Elizabeth, die er beigefügt hatte. Ich hatte Bilder der beiden in den Nachrichten und in den Zeitungen gesehen, aber das waren Porträtaufnahmen gewesen, und John Weston hatte Schnappschüsse der beiden bei verschiedenen familiären Aktivitäten eingeklebt. Julie Weston war eine schöne Frau mit dunklen, italienischen Zügen, einem Körper, von dem Männer träumen, und einem Lächeln, das so strahlend und natürlich war, dass ich den Wunsch verspürte, von dem Bild wegzuschauen.
Elizabeth Weston war eine Miniaturausgabe ihrer Mutter. Sie hatte dieselbe dunkle Haut, dieselben dunklen Haare und Augen, und ihr Lächeln war, wenn überhaupt, noch strahlender. Auf einem der Bilder trug sie ein hellblaues Kleid, hielt einen Blumenstrauß und schien über irgendetwas zu lachen, was der Fotograf gesagt hatte. Laut John Westons Bildunterschrift war die Aufnahme letztes Jahr an Ostern gemacht worden. Auf einem anderen Bild trug Elizabeth einen Partyhut, hielt einen Hotdog in der Hand, und neben dem besagten Lächeln saß ein kleiner Ketchupfleck. »Fünfter Geburtstag, August« hatte John Weston unter das Foto geschrieben. Ich klappte das Notizbuch zu und wünschte, er hätte uns weniger persönliche Bilder gegeben, etwas, das den kalten, ernsten Fahndungsfotos näher kam, deren Anblick Cops gewohnt sind.
Wir löcherten Weston noch eine Weile, aber für präzise Fragen stand der Fall noch zu sehr am Anfang, und die allgemeinen Hintergrundinformationen erwarteten uns in dem Notizbuch.
»Wir werden uns alle paar Tage mit Ihnen in Verbindung setzen«, versprach Joe, als wir gingen. »Sobald wir Hinweise erhalten, kommen wir mit weiteren Fragen wieder.«
»In Ordnung«, sagte Weston, der in der Tür stand. »Sie tun alles, was nötig ist. Über Geld zerbreche ich mir nicht den Kopf. Ich will beweisen, dass mein Sohn ermordet wurde, und ich will meine Enkelin und ihre Mutter finden.«
Joes Unterkiefer mahlte leicht hin und her, und er blickte weg, hinaus zu dem Flaggenmast in der Mitte des Rasens.
»Sir«, sagte er, »wir werden unser Möglichstes tun, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Aber Sie sollten wissen, dass wir Ihnen, falls es nach den ersten Ermittlungen so aussieht, als habe Ihr Sohn tatsächlich Selbstmord verübt, nichts vormachen und keine Spielchen mit Ihnen treiben werden. Wir werden Ihnen sagen, dass dies allem Anschein nach die Wahrheit ist, und dann werden wir unsere Ermittlungen einstellen.«
Weston spannte eine Hand um den Türgriff. »Ich schätze Leute, die nicht dazu neigen, einem irgendwelchen Blödsinn zu erzählen«, sagte er. »Aber ich bin viele Jahre in der Welt herumgekommen, mein Freund, und ich bin kein Vollidiot. Wenn Sie beide irgendetwas taugen, dann werden Sie herausfinden, dass mein Sohn ermordet wurde. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.«
Als ich ihm daraufhin in die Augen sah, dachte ich, vielleicht hatte er es schon getan.
3
Joe lehnte sich zurück, dass der alte Schreibtischstuhl knarrte, und warf in hohem Bogen ein Papierknäuel über seine Füße, die auf dem Schreibtisch ruhten. Das Knäuel fiel in den Papierkorb und vergrößerte einen bereits recht ansehnlichen Haufen.
»Der größte Augenblick in der Baseball-Geschichte«, sagte er. »Du zuerst.«
Ich feuerte ein Knäuel in den Papierkorb und überlegte. »Bill Mazeroski, wie er im siebten Finalspiel der World Series diesen Homerun zum Sieg über die Yankees erzielt. Aber wenn es um wahre Eleganz und publikumswirksames Auftreten geht, da ist Ruth nicht zu toppen, wie er bei der World Series 1932 gegen die Chicago Cubs seinen Homerun ankündigt und ihn dann schlägt.«
»Nee«, sagte Joe. »Der größte Augenblick gebührt unbedingt Kirk Gibson, wie er zum Schlagmal humpelt und Eckersley den entscheidenden Punkt zum Spielgewinn wegschnappt. Und wenn wir schon von wahrer Eleganz und publikumswirksamem Auftreten reden, wie du es nennst, dann ist es Fisk, der mitten auf dem Weg zur ersten Base schon den Homerun anzeigte.«
»Wieso ist das publikumswirksames Auftreten? Das ist höchstens kindliche Begeisterung. Auch nicht annähernd so gut wie Ruth mit seinem angekündigten Homerun. Und hör mir auf mit Gibson; dieser Homerun entschied damals lediglich ein Spiel, nicht die Meisterschaft.«
»Was soll’s.« Joe zerknüllte ein weiteres Blatt Papier und warf es in Richtung Papierkorb. Es traf den Rand des Behälters und prallte ab. Mehr hatten wir in der letzten halben Stunde nicht zustande gebracht. Wir betrachteten es als Brainstorming.
Ich wollte Joe gerade zu den Sternstunden in der Basketball-Geschichte befragen, als die Bürotür aufging und zwei Männer eintraten.
»Wir müssen wirklich eine Türklingel anbringen«, sagte ich. »Die Leute scheinen nicht mehr zu wissen, wie man anklopft.«
»Hallo, Rick«, sagte Joe zu einem der Besucher. Rick Swanders, der für den Fall Weston zuständige Detective, war ein kleiner, dicker Mann mit Hängebacken und gerötetem Gesicht. Sein Partner war größer und dünner, hatte einen vorstehenden Adamsapfel und rotblonde Haare. Er trug Jeans und einen Parka der Cleveland Indians. Swanders steckte in einem zerknitterten Winteranzug.
»Hi, Pritchard.« Swanders sah mich an. »Perry.«
»Hi, Rick.«
Swanders wies mit dem Daumen auf seinen Begleiter. »Das ist Jim Kraus. Er ist bei der Polizei von Brecksville. Man hat uns heute Morgen informiert, dass John Weston euch angeheuert hat, und wir dachten, es wär ’ne gute Idee, mal auf einen Plausch vorbeizuschauen.« Er musterte die Berge von Papierknäueln im Papierkorb und auf dem Fußboden. »Ich hoffe, wir stören nicht bei irgendwas allzu Wichtigem.«
»Setzt euch«, sagte Joe.
Swanders zog sich einen der Klientenstühle heran, während Kraus sich auf einem Stadionsitz niederließ. Er war mir auf Anhieb sympathisch.
»Also, was genau habt ihr beide vor?«, fragte Swanders. »Die alten Knaben unten im Department bloßstellen, ein paar Schlagzeilen machen, in den Sonnenuntergang davonreiten?«
»Den Sonnenuntergang muss ich nicht haben«, sagte ich. Ich kannte Swanders flüchtig aus meiner Zeit bei der Truppe, aber mit Kraus hatte ich nie zu tun gehabt. Brecksville war ein kleiner, exklusiver Vorort, und die dortige Polizei war nicht dafür ausgerüstet, einen größeren Fall wie diesen zu bearbeiten, so dass das CPD sich eingeschaltet hatte, um zu helfen. Allerdings machte Kraus nicht den Eindruck, als glaubte er, tief im Schlamassel zu stecken; wenn überhaupt, schien er gelassener zu sein als Swanders.
Swanders starrte mich an und kaute auf seiner Lippe. »Sucht ihr nach der Frau und der Tochter, oder versucht ihr zu beweisen, dass es kein Selbstmord war?«
»Wir versuchen herauszufinden, was passiert ist«, antwortete ich. »Das beinhaltet, glaube ich, beide Aspekte.«
»Ihr werdet bezahlt, ob ihr den Fall löst oder nicht, stimmt’s?«
»Klar. Sie aber auch.«
»Schon, aber es ist nicht die Familie des Opfers, die mir meinen Scheck ausstellt.«
Ich wollte schon erwidern, dass das ja wohl nicht ganz stimme, da auch John Weston Steuerzahler sei, aber es war eine kleinliche, alberne Entgegnung, und ich konnte sie mir gerade noch rechtzeitig verkneifen.
»Gibt’s außer Nörgeln noch einen anderen Grund, hierher zu kommen, Rick?«, sagte Joe. »Wir sind nicht darauf aus, euch schlecht aussehen zu lassen, euch zu bedrängen, im Nacken zu sitzen oder sonst irgendwas. Wir sind im Ermittlungsgeschäft. John Weston möchte, dass wir in dieser Sache ermitteln, und das werden wir tun.«
Joe war derjenige, der sie von unserer Harmlosigkeit überzeugen konnte, nicht ich. Mit meinen raschen Beförderungen hatte ich mich seinerzeit bei einigen der älteren Cops nicht gerade beliebt gemacht, aber Joes Unterstützung hatte mir damals geholfen, diese Feindseligkeit zu überwinden.
Joe war ein waschechter Cop und Angehöriger des CPD in der vierten Generation. Solange irgendjemand denken konnte, hatte es in Clevelands Westside Pritchards in Uniform gegeben. Joes Vater war Detective bei der Mordkommission gewesen, und sein Onkel war im Dienst getötet worden. Es gab nicht einen Cop bei der Truppe, der die Pritchards nicht kannte, und in der Familie selbst war es anscheinend undenkbar, dass ein männliches Familienmitglied einen anderen Beruf ergriff. Joe war der letzte Vertreter seines Geschlechts. Er hatte mit dreißig eine fast zwanzig Jahre ältere Frau geheiratet und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sohn in seine Fußstapfen trat, ziemlich eingeschränkt. Für Joes Vater, dem das polizeiliche Vermächtnis eine Menge bedeutete, war das niederschmetternd gewesen. Aber Joe und Ruth waren glücklich gewesen, das glücklichste verheiratete Paar, das ich je gesehen hatte. Als Ruth vor ein paar Jahren gestorben war, hatte sie einen Teil von Joe mitgenommen. Die Arbeit, die für Joe immer wichtig gewesen war, wurde danach alles für ihn, und statt sich auf seiner Pension auszuruhen, hatte er beschlossen, Privatdetektiv zu werden. Es war das Einzige, worin er Erfüllung fand.
Swanders und Kraus tauschten einen Blick aus, keineswegs erfreut über Joes Worte, aber Swanders erwies ihm mit einem Nicken den Respekt, den Joe sich in den letzten paar Jahrzehnten verdient hatte.
»Schön, Pritchard. Ich war nicht gerade begeistert, als ich hörte, dass ihr beide dabei seid, weil dieser Fall an sich schon unangenehm genug ist. Aber wenn ihr anständig zu uns seid, werden wir anständig zu euch sein.« Er seufzte und kratzte sich seine einen Tag alten Bartstoppeln. »Bei dem ganzen verfluchten Medienrummel, den dieser Fall auslöst, ist die Sache kein Spaziergang. Ihr solltet lieber hoffen, dass diese Reporter sich nicht auch an eure Fersen heften.«
»Wie, so schlimm?«, fragte ich.
»Das können Sie laut sagen.« Swanders beugte sich vor und stützte seine Unterarme auf die Knie. Sein Ärmel rollte sich dabei hoch und enthüllte eine goldene Armbanduhr, die zu klein für sein Handgelenk war und zu beiden Seiten Fettfalten hervorquellen ließ. »Da wir nun also alle zusammen weitermachen werden, wie wär’s, wenn ihr uns verratet, was ihr bisher gemacht habt?«
Joe deutete auf die Berge von zusammengeknülltem Papier. »Das da.«
Kraus grinste. »Schon mit eurem Latein am Ende, was?«
»He«, sagte Joe, »wir sind erst einen Vormittag an der Sache dran.«
»Nur der Ordnung halber möchte ich darauf hinweisen, dass die meisten Papierbälle auf dem Boden von Joe stammen«, warf ich ein. »Meine sind im Korb gelandet.«
»Ihr glaubt, Weston war ein Selbstmörder?«, fragte Joe.
»Ja«, sagte Kraus, und Swanders nickte. »Die Beweise am Tatort lassen schwerlich eine andere Bezeichnung zu.«
»Wie sieht’s mit dem psychologischen Profil aus?«, erkundigte ich mich. »Irgendwelche Anzeichen für ein Problem, einen Hinweis, dass Weston ein bisschen labil war?«
Kraus blinzelte und runzelte die Stirn, und Swanders bedeutete ihm mit einem Blick, zu sprechen.
»Ja und nein«, sagte Kraus. »Ein paar Bekannte haben uns erzählt, dass er angespannt, mürrisch, was auch immer gewesen sei. Aber ich gebe nie viel auf solche Geschichten, weil jedesmal, wenn die Zeitung einen Burschen zum Selbstmörder erklärt, jeder, der ihn gekannt hat, anfängt, sich diese Dinge auszumalen, und versucht, sich, na ja, seinen eigenen Reim darauf zu machen.«
»Aber Sie konnten keinen Grund finden, warum er sich selbst, geschweige denn die Familie um die Ecke gebracht haben sollte?«, sagte ich. »Die Ehefrau hat ihn nicht betrogen, er war kein Alkoholiker oder Kokser, nichts dergleichen?«
Kraus und Swanders tauschten einen weiteren Blick aus und berieten stumm, was sie uns anbieten sollten.
»Er war ein Spieler«, sagte Kraus schließlich, nachdem Swanders ihm in einer Art von Osmose seine Zustimmung signalisiert hatte. »Scheint außerdem das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen zu haben; häufige Abstecher rauf nach Windsor, und jede Menge Sportwetten.«
In Windsor, direkt gegenüber von Detroit, auf der anderen Seite des Flusses, stand das größte Spielcasino Kanadas. Die Äußerung überraschte mich nicht unbedingt; sie passte einfach gut zu meinem Bild von Weston.
»’ne Menge Leute haben Spaß am Spielen«, meinte Joe. »Heißt nicht, dass sie selbstmordgefährdet sind. Bloß dumm.«
»Seine Bankkonten wurden leergeräumt«, sagte Swanders. »Vermutlich werden wir feststellen, dass er ziemlich hohe Schulden hatte.«
»Irgendeine Idee, bei wem er in der Kreide gestanden haben könnte?«
Er schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Genau daran arbeiten wir.«
»Wenn das die Wahrheit ist, würde das, glaube ich, ein paar andere Theorien eröffnen«, sagte Joe. »Ich meine, ich kann mir die Spielschulden als Selbstmordmotiv vorstellen, aber was ist mit seiner Familie? Ist es möglich, dass die Leute, die er bei den Schulden prellte, sich die Ehefrau und die Tochter geschnappt und ihn vielleicht sogar ermordet haben?«
Swanders und Kraus runzelten gemeinsam die Stirn. »Möglich schon«, entgegnete Swanders. »Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist wirklich fast alles möglich. Es gibt in diesem Haus nicht den kleinsten äußeren Anhaltspunkt, der auf einen Einbruch oder irgendeine Art von Gewaltanwendung hindeutet. Die Nachbarn behaupten, sowohl Mrs. Weston als auch die Tochter seien Dienstagabend zu Hause gewesen, aber am Mittwochmorgen sind beide kein einziges Mal irgendwo aufgetaucht. Der Zeitpunkt von Westons Tod liegt laut Gerichtsmedizinern irgendwo zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens. Das heißt, dass alles, was passiert ist, Dienstagnacht passiert sein muss, und die Nachbarn haben nichts Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Das macht ein Einbrecherszenario weniger wahrscheinlich, es sei denn, sie wurden von der verdammten Delta Force oder so was Ähnlichem herausgeholt.«
»Was ist mit dem Schuss?«, fragte Joe.
»Niemand hat behauptet, einen gehört zu haben, aber das ist nicht weiter überraschend«, sagte Swanders. »Drei Uhr morgens, ein einzelner Schuss aus einer Handfeuerwaffe? So was ist leichter zu verschlafen, als man meinen sollte. Außerdem sind wir hier in Brecksville. Die Leute dort draußen hören, wie eine Handfeuerwaffe abgefeuert wird, und halten den Knall wahrscheinlich für eine Fehlzündung am Laubgebläse des Gärtners.«
»Könnten wir vielleicht einen Blick in den Polizeibericht vom Tatort werfen?«, fragte Joe.
Swanders zuckte mit den Schultern. »Bloß um ein Schwein zu sein, würde ich sagen, nein, aber dieser Bericht wird euch sowieso nicht groß weiterhelfen, also was soll’s. Habt ihr ein Faxgerät?«, fragte er und ließ einen skeptischen Blick durch das Büro schweifen, als sei er sich nicht sicher, ob wir überhaupt ein Telefon hätten.
»Ja«, sagte Joe und gab ihm die Nummer.
»In Ordnung.« Swanders erhob sich. »Wir bleiben mit euch in Verbindung, und von euch erwarte ich dasselbe.«
»Machen wir«, gab Joe zurück.
»He«, rief ich den beiden hinterher, als sie auf die Tür zusteuerten. »Haben Sie mit April Sortigan gesprochen? Irgend ’ne Studentin, die bei Weston gearbeitet hat, glaube ich?«
Kraus winkte ab. »Ja, mit der muss man sich nicht abgeben. Bloß so ’ne Kleine, die durch ein Seminarprojekt Westons Bekanntschaft machte. Er mochte sie und ließ sie hin und wieder in irgendwelchen blödsinnigen Gerichtsakten recherchieren, damit sie ihren Lebenslauf aufpeppen konnte. Ich hab am Telefon mit ihr gesprochen, und es war reine Zeitverschwendung.«
Sie gingen, und Joe und ich saßen da und starrten auf die geschlossene Tür. »Tja«, sagte Joe, »ich glaube, wir sollten uns an die Arbeit machen.«
»Wahrscheinlich.«
»Dieser Glücksspielaspekt klingt interessant«, sagte er. »Je nachdem, bei wem Weston Schulden hatte und wem er auf die Füße getreten ist.«
»Mir gefällt das nicht. Zu clever und einfach.«
»Perfekt«, entgegnete Joe. »Ich bin clever, und du bist eher einfach gestrickt. Genau der Fall für uns.«
»Kennst du jemanden in Windsor?«
»Noch nicht, aber gib mir ein oder zwei Stunden am Telefon, und ich habe ein paar Freunde.«
»Klingt gut. Ich muss in einer halben Stunde diese April besuchen, also können wir uns heute am Spätnachmittag treffen, falls du dann noch wach bist.«
Er täuschte ein mächtiges Gähnen vor. »Du willst mit ihr sprechen, obwohl Kraus meinte, es sei Zeitverschwendung?«
»Zwei Dinge über Cops«, sagte ich. »Erstens haben sie bekanntlich früher schon Hinweise übersehen, und zweitens haben sie lästige Privatschnüffler wie uns bekanntlich immer schon belogen. Deshalb, ja, werde ich ihr einen Besuch abstatten.«
April Sortigan wohnte in einem vollgestopften Apartment etwa zehn Minuten von unserem Gebäude entfernt. Sie hatte keinen Mitbewohner, dafür aber sieben Katzen. Sie schienen in dem winzigen Wohnzimmer aus den Wänden zu kommen. Anfangs vermutete ich, es müssten mindestens drei Dutzend sein. Sortigan war ein hochgewachsenes, schlankes Mädchen mit rabenschwarzem Haar, einer schmalen, leichten Hakennase, auf der eine eckige, schwarze Hornbrille saß. Ihr Körper war gertenschlank und kräftig, nicht unattraktiv, aber nichts, was auf der Straße bewundernde Pfiffe hervorriefe. Sie saß mit übereinander geschlagenen Beinen da und trommelte, während wir uns unterhielten, mit den Fingern auf die Lehne der Couch.
Nachdem ich sie ein paar Minuten ausgefragt hatte, war ich von ihrer generellen Unwissenheit, was das Leben und die Angelegenheiten von Weston betraf, überzeugt. Vielleicht hatte Kraus recht gehabt. Sie schien eine Sackgasse zu sein – und, leider, eine recht geschwätzige Sackgasse. Dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen, aber der Mittelpunkt ihrer Geschwätzigkeit war sie selbst, nicht Weston. Ich versuchte aufzupassen, während ich die Ringe an ihren Fingern zählte. Ich war bei neun und noch nicht fertig, als sie verstummte.
»Sie haben Wayne Weston während Ihrer Studienzeit kennen gelernt?«, fragte ich und versuchte, sie zu dem Punkt zurückzuführen, bevor sie angefangen hatte, ihre persönlichen Referenzen und außerlehrplanmäßigen Aktivitäten aufzulisten.
»Das stimmt. Ich arbeitete an einem Projekt über Bauunfälle und erfuhr, dass er in einem Haftungsprozess einen dieser Unfälle untersucht hatte. Ich stellte ihm ein paar Fragen, und weil die Arbeit mich interessierte, blieb ich in Verbindung. Er bot an, mir ein wenig Erfahrung in staatlichen Archiven zu verschaffen, bevor ich mit dem Jurastudium anfing.«
Eine große tigergestreifte Katze sprang in die Mitte des Zimmers und attackierte eine auf dem Boden liegende Zeitung. Anscheinend glaubte die Katze, die Zeitung sei auf dem Sprung zu einer Attacke gewesen. April Sortigan beachtete sie nicht weiter.
»Wie viel Arbeit haben Sie für ihn erledigt?«, fragte ich.
»Ach, nicht allzu viel. Er zeigte mir, wie es läuft; Sie wissen schon, Bezirksamt und Rechnungsprüfungsamt und so weiter. Ich habe jeden Monat ein paar Überprüfungen für ihn erledigt. Bloß kleinere Nachforschungen.«
»Irgendwas in jüngster Zeit?«
»Doch, ja. Vor etwa zwei Wochen schickte er mir eine Liste mit drei Namen und bat mich um eine einfache Abfrage bei einigen Computer-Datenbanken und im Bezirksamt. Er sagte, er könne es nicht selbst machen, weil er verreisen müsse und nicht in der Stadt sei, und bat mich, ihm einen Bericht zuzufaxen.«
»Wissen Sie, wo er hinfuhr?«
»Nein, aber ich hab noch die Fax-Nummer.«
»Kann ich sie mal sehen?«
»Sicher.«
Eine fette, graue Katze kam hinter meinem Stuhl hervor und hievte sich mit der gewaltigen Anstrengung, die nötig ist, einen so massigen Körper zu bewegen, laut miauend neben Sortigan auf die Couch. Eigentlich war es kein Miauen, es klang eher wie eine Luftschutzsirene. Sortigan flüsterte leise mit ihr und kraulte sie unter dem Kinn.
Ich räusperte mich, um ihre Aufmerksamkeit wiederzuerlangen. »Haben Sie diese Namen noch?«
»Sicher. Ich habe sogar noch alle Informationen, die ich zusammengetragen habe. Irgendwie zwielichtige Typen, wenn ich ehrlich sein soll.«
»Haben die Cops Sie danach gefragt?«
»Ja. Aber, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hinter dem Fall steckte. Und es ist nicht so, als hätten viele der Leute, die wir überprüfen, keine Vorstrafen, wissen Sie. Es war nicht ungewöhnlich.«
»Klar. Dürfte ich einen Blick auf diese Namen und die Fax-Nummer werfen?«
»Sicher. Moment, ich geh die Mappe holen.« Sie setzte die fette Katze auf den Boden, die einen Protestschrei ausstieß und prompt entschied, dass dieser Platz ebenso bequem wäre wie jeder andere, und einschlief. Das Leben als Katze.
Kurz darauf kam Sortigan mit einem braunen Schnellhefter zurück. Er enthielt drei Sätze Computerausdrucke mit den detaillierten Strafregistern, die sie zu drei Männern gefunden hatte. Es war die Art routinemäßiger Nachforschungen, wie Joe und ich sie jetzt regelmäßig anstellten, und Sortigan schien ziemlich gründliche Arbeit geleistet zu haben. Alle drei Ehrenmänner waren Sowjetbürger, und alle drei waren vorbestraft. Vielleicht hatte es eine gewisse Verwirrung hinsichtlich der Sitten und Gebräuche ihrer neuen Heimat gegeben.
»Kann ich mir Kopien davon machen?«, fragte ich.
»Sie können die Originale behalten. Ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Tote Chefs zahlen nicht.«
4
Wladimir Rakic, Iwan Malaknik, Alexej Kraschakow«, las ich vor. »Alle Mitte dreißig, alle in der Sowjetunion geboren, alle vorbestraft. Und alle von dem verstorbenen Wayne Weston in den Wochen vor seiner Ermordung überprüft.«
Joe runzelte die Stirn. »Ermordung? Das wissen wir jetzt?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Es klang dramatischer.«
»Wie lauten die strafrechtlichen Anschuldigungen?«
»Meistens Bagatellsachen. Mehrere Anklagen wegen Körperverletzung, zweimal tätliche Bedrohung, eine Anklage wegen Raubüberfalls gegen alle drei, die fallen gelassen wurde, mehrere Fälle von öffentlicher Trunkenheit, eine Tätlichkeit gegen einen Polizeibeamten und eine Anklage wegen Nötigung.«
»Ach!«, sagte Joe. »Klingt, als seien es brave Jungs. Bloß missverstanden.«
Ich nickte. »Diesen primitiven Polizeibeamten in Cleveland fehlt natürlich jeglicher Sinn für die feinen Unterschiede in Kultur und Werten, die unsere sowjetischen Besucher bei den amerikanischen Behörden vorzufinden hofften.«
»Natürlich«, pflichtete Joe mir bei. »Wie willst du mit ihnen verfahren?«
»An die Tür klopfen und ihnen sagen, dass ich nach einer verschwundenen Mutter und ihrer Tochter suche?«
»Das ist vielleicht ein bisschen zu direkt.«
»Ach so«, sagte ich. »Tja, in diesem Fall habe ich auch keine Idee.«
»In dieser Hinsicht keine Überraschung«, entgegnete Joe. »Zum Glück war ich eine ganze Ecke produktiver als du. Ich habe ein paar Anrufe nach Windsor getätigt, und ich muss zugeben, ich hatte wenig Glück. Aber stets unverzagt, änderte ich meine Taktik und rief John Weston an. Ich sagte ihm, er solle seinen Anwalt veranlassen, bei der Bank seines Sohnes anzurufen und so lange zu insistieren, bis sie uns ein paar Auskünfte gäben. Was sie ziemlich schnell taten. Swanders und Kraus hatten Recht; Wayne Weston war im Grunde blank. Zwei Riesen auf dem Girokonto und etwa fünfhundert Dollar an Ersparnissen. Er hatte Rentenfondanteile und offene Investmentfonds gegen bar verkauft.«
»Macht das Glücksspielproblem vielleicht etwas glaubwürdiger.«
»Hm. Ich habe auch um nähere Angaben zu den letzten Schecks gebeten, die auf Westons Geschäftskonto gutgeschrieben wurden. Fünf Schecks in den vergangenen zwei Monaten, von fünf Firmen.«
Er blickte kurz auf einen Notizblock vor ihm.
»Zwei Immobilienmakler, zwei Baufirmen und eine Anwaltskanzlei.«
Ich runzelte die Stirn. »Die Anwaltskanzlei ergibt Sinn, aber ich frage mich, was er für die Immobilienmakler und die Baufirmen gemacht hat.«
»Vielleicht ein paar Nachforschungen nach Wanzen angestellt oder elektronisches Überwachungsgerät installiert«, meinte Joe. »Es gibt ein paar Firmen, die machen solche Sachen.«
»Vielleicht, aber warum sollte das Immobilienbüro darum ersuchen und nicht der Hausbesitzer? Mir kommt das seltsam vor.«
Er winkte ungerührt ab. »Jede Privatperson und jedes Unternehmen kann einen Privatdetektiv engagieren.«
»Schön. Trotzdem sollten wir wahrscheinlich die Aufträge unter die Lupe nehmen und sehen, was wir in Erfahrung bringen können. Auf den Verdacht hin, dass Weston mit seiner Arbeit in irgendein Wespennest trat, wäre es sinnvoll, zuerst die jüngsten Aufträge zu überprüfen.«
»Na gut.« Joe klang nicht begeistert.
»Hast du ’ne bessere Idee?«
Er schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht. Los, sehen wir uns diese Aufträge an und fühlen den Russen auf den Zahn.«
»Was denkst du?«
»Dass dieser Kerl sich nicht umgebracht hat«, sagte er. »Wenn es bloß Wayne Weston wäre, würde ich sagen, vergiss es, dieser Fall lohnt den Aufwand nicht. Aber die Familie lässt mir keine Ruhe. Es gehört einiges dazu, ein paar Spielschulden zu machen und sich dann als leichtesten Ausweg die Kugel zu geben. Aber es gehört etwas ganz anderes dazu, seine eigene Familie zu ermorden. Und falls er sie ermordet hat, wie hat er es getan? Wann hat er es getan? Wo sind die Leichen? Bei den meisten Mord-Selbstmord-Fällen, von denen ich gehört habe, werden nämlich beide Taten normalerweise in recht großer Nähe zueinander verübt.«
»Klar.«
»Und«, fuhr er mit neuem Schwung in seiner Beweisführung fort, »falls er sie ermordet hat, gab er sich offensichtlich große Mühe, die Leichen verschwinden zu lassen, was nicht zum Denken eines Burschen passt, der vorhatte, Selbstmord zu begehen. Warum sich die Mühe machen, die Leichen verschwinden zu lassen, wenn man nicht mehr da sein wird, um sich deswegen Gedanken zu machen?«
»Also glaubst du, wir sollten uns an die Annahme halten, dass er ermordet wurde?«
Er lächelte mich müde an. »Ich weiß nicht. Aber wie auch immer, über Weston zerbreche ich mir gar nicht so sehr den Kopf. Er hat sich selbst umgebracht, oder jemand hat ihn umgebracht. Schön. Die Leiche haben wir nämlich da liegen. Aber was, zum Teufel, ist mit dieser Frau und dem kleinen Mädchen passiert?«
»Das ist es, was wir herausfinden sollen, Alter.«
»Ich weiß.« Er winkte mir mit einem Bündel Papiere. »Swanders hat Wort gehalten und den Bericht vom Tatort rübergefaxt.«
»Und?«
»Und die äußeren Anzeichen lassen es wie Selbstmord aussehen. Sie haben das Haus nach allen Regeln der Kunst auf den Kopf gestellt und ebenfalls keinerlei Anhaltspunkte für einen Eindringling oder irgendeinen Kampf gefunden. Weston wurde mit seinem eigenen Revolver erschossen, der aus nächster Nähe auf seine Schläfe abgefeuert wurde.«
»Könnte nicht vielleicht jemand anders ihn erschossen, die Fingerabdrücke von der Waffe abgewischt und sie in seiner Hand zurückgelassen haben?«
Er zuckte mit den Schultern. »Nun ja, es gab keine Schmauchspuren an seiner Hand, keinen wirklich überzeugenden Beweis, dass er selbst den Schuss abfeuerte. Aber bei einem Selbstmord gibt es den auch nicht immer. Was du sagst, ist also möglich, aber unwahrscheinlich. Ich meine, der Bursche war Profi, klar? Ein Veteran der Force Recon und professioneller Ermittler. Es ist schwer, sich ein Szenario vorstellen, bei dem jemand Weston die eigene Waffe wegnimmt und ihn aus nächster Nähe so einfach erschießt, sich anschließend die Familie vornimmt, und das alles, ohne genug Lärm zu veranstalten, um die Aufmerksamkeit der Nachbarn zu erregen. Glaubst du nicht, dass die Mutter und das kleine Mädchen nicht wenigstens einen Schrei ausstoßen würden?«
»Vielleicht hat der Kerl sie zuerst getötet.«
»Während Weston herumsitzt und an den Fingernägeln kaut? Willst du mich auf den Arm nehmen?«
Ich seufzte und kratzte mich am Kopf.
»Wann wurden die Mutter und das Mädchen zum letzten Mal gesehen?«
»Nachbarn behaupteten, sie seien an dem Abend um sieben Uhr im Garten hinter dem Haus gewesen.«
»Sie verlassen also das Haus, stoßen auf irgendwelche Schwierigkeiten, und dann gehen der oder die Kerle zum Haus zurück und erledigen Weston.«
»Weston wurde nicht vor Mitternacht getötet. Vermutlich eher gegen drei oder vier als gegen Mitternacht. Obwohl seine Frau und sein Kind so spät draußen verschwunden sind, sitzt er im Haus herum und entspannt sich?«
»Vielleicht hat er geschlafen und gar nicht gemerkt, dass sie nicht nach Hause gekommen waren.«
»Der Kerl schläft in Hemd und Krawatte?«
Mir gingen allmählich die Vielleicht’s aus. »Wir werden wegen dieser Sache wohl das Büro verlassen müssen.«