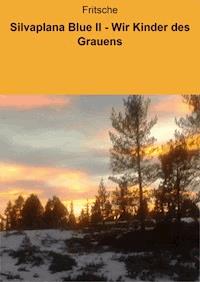Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Berlin war total zerstört. Es wurde von den Engländern Ruinen gelegt, von den Russen ausgeplündert und von aller Welt verraten und vergessen. Wir träumen immer nur von Berlins Glanz und Gloria. Aber Berlins Gloria liegt in seinen Toten. Jetzt senkt sich der Staub darüber. Die Handlung spielt in Berlin in den Jahren 1960 bis 1963. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Ereignisse am 13. August 1961 in Berlin. Diese Ereignisse sind mit den Schicksalen von vier Mädchen verbunden. Diese Mädchen sind Irene, Susanne, Lilly und Rita verbunden. Sie wurden in den Jahren von 1941 bis 1945 geboren wurden. Sie repräsentieren die Nachkriegsgeneration. "Die Schandmauer" ist die Geschichte Berlins und Deutschlands. "Die Schandmauer" ist aber auch die Geschichte dieser Kriegs- und Nachkriegsgeneration.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Schandmauer
Berliner Geschichten
von
Fritsche
Dieses E-Book wurde erstellt für Heide Marie Herstad ([email protected])
am 11.12.2014 um 17:30 Uhr, IP: 80.212.67.4
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die fünfziger Jahre
Irene, Lilly, Susanne und Rita
Der Flüchtling
Die Leiche
Im Polizeipräsidium
In der Reichenberger Straße
Die Nachforschung
Die Piano-Bar
Lilly
Die Schlägerei in der Piano-Bar
Der Abort
Die Sünden der Väter
Das Polizeiprotokoll
Die Fahndung nach der verschwundenen Leiche
Das gestohlene Jackett
Die verlorene Brieftasche
S-Bahnhof Bülowstraße
Organisierte Fluchtrouten
Das Findelkind
Susanne
Der Pass
Deutsch-deutsche Probleme
Das Studium in der DDR
Eine Karriere in der DDR
Grenzgänger
Ewald Schwitters stirbt
Stacheldraht
Lilly am 13. August 1961
Woltersdorf
Am 13. August nachts in Ostberlin
Die Bar an der Potsdamer Straße
Am S-Bahnhof Savignyplatz
Irene am 13. August 1961
Susanne am 13. August 1961
Rita am 13. August 1961
Die Flucht von Familie Witte
Die Flucht von Alfred Weichelt
Die Flucht von Uschi
Die Verhaftung von Susanne und Joachim
Die Leichenträger
Panik am Brandenburger Tor
Die Beerdigung
Die verlorene Adresse
Der Ausweis
Am Alexander Platz
Die Verhaftung von Rechtsanwalt Pfitzner
Die Verlobung von Alfred Weichelt
Bautzen
Die Hochzeit von Alfred und Adele
Das Pulverfass Berlin
Der jüdische Friedhof in Essen
Russische Panzer am Ehrenmal
Flak-Helferin
Zurück nach Berlin
Epilog
Impressum
Die fünfziger Jahre
Anfang der sechziger Jahre war der Kalte Krieg auf dem kältesten Tiefpunkt angelangt. In Berlin war der Kalte Krieg noch kälter, er lag unterm Gefrierpunkt. Berlin unterlag dem Viermächteabkommen. Diese Viermächte waren die Russen, die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen. Laut Abkommen bestimmten ein Kontrollrat dieser vier Mächte, was man in Berlin tun durfte und was nicht. Aber so einfach war das nun auch nicht, denn die Russen glaubten, sie hätten prinzipiell mehr zu sagen als die Amerikaner, die Engländer und Franzosen zusammen. Die Amerikaner scherten sich einen Teufel darum, was die Russen meinten. Die Engländer richteten sich nach dem, was die Amerikaner ihnen sagten. Die Franzosen existierten nur, wenn man ihre Unterschrift für ein Memorandum brauchte.
Deutschland gab es zu dieser Zeit nicht mehr. Dafür hatte man eine Ostzone und eine Westzone erfunden. Die Ostzone war die Sowjetzone. Sie wurde auch die Deutsche Demokratische Republik genannt. Was hier „Deutsch“ war, was „demokratisch“ genannt wurde und wie eine „Republik“ aussah, bestimmte Moskau. In dieser von den Russen okkupierten Zone war der Krieg noch lange nicht zu Ende, denn noch immer diktierten Lebensmittelknappheit, Materialknappheit, Stromausfall und Zensur den Alltag der Menschen. Statt Gestapo herrschte jetzt in der Ostzone der Staatssicherheitsdienst. Im Volksmund wurde er Stasi genannt.
Aus den okkupierten Gebieten der Amerikaner, Engländer und Franzosen entwickelte sich langsam eine Bundesrepublik. Das wurde der Westen genannt. Der Westen war Wirtschaftswunder, Neonreklame und Wohlstandsspeck. Der Osten war grau und verarmt und von den Russen total ausgeplündert.
Diese Koexistenz der stärksten Militärmächte der Welt, die auf den Raum einer Großstadt zusammen gepresst waren, musste notgedrungen zu Konfrontationen führen. Diese Konfrontationen wurden verbal ausgetragen. Darum nannte man diese Kriegsführung den „Kalten Krieg“. Im Kalten Krieg operierte man mit verbalen Kanonaden und Schlagwörtern. Ost wurde gegen West ausgespielt. Die Welt zerfiel in Nord und Süd und in Arm und Reich. Schuld daran war der Kommunismus, schrie die eine Seite. Schuld daran war der Kapitalismus, schrie die andere Seite. Propaganda, Desinformationen und Diplomatie wurden auf dem tiefsten intellektuellen Niveau geführt. Man griff den Gegnern mit diplomatischen Witzen und Kalauern an.
Ansonsten gehrte es überall auf der Welt. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende, da begannen schon unzählige neue Kriege. Erst wurde Korea rot. Das musste verhindert werden. Dann ließen sich die Vereinten Staaten auf das Vietnam-Abenteuer ein, weil auch hier der Virus des Kommunismus die Gehirne zerfraß. Lateinamerika, Kuba und China revoltierten und revolutionierten aus dem gleichen Grund. Afrika versank in Korruption und Terrorismus. Daran ist der Westen Schuld, sagte Russland. Daran ist die Sowjetunion Schuld, sagte der Westen. Je kälter der Krieg in Berlin wurde, umso heißer wurde er in der restlichen Welt geführt.
Neben dem Radio tauchte der Fernseher in der guten Stube auf. Krieg, Mord, Totschlag und alle Katastrophen der Welt wurden ein Teil des täglichen Lebens. Man goutierte das beim Mittagsessen und als Beruhigungspille vorm Schlafengehen. Alltag war das, was man jeden Tag vor der Nase hatte. Was man jeden Tag vor der Nase hatte, waren Lügen, dumme Witze, idiotische Anschuldigungen, Korruptionen und die Kriege der Großen. Das war die Normalität des Normalen. Das war die Beste aller Welten. Die Beste aller Welten wurde zum Supermarkt, wo jeder lernte, selektiv zu leben. Man fischte sich das aus dem Angebot heraus, was einem am besten schmeckte, was einem gerade in den Kram passte und was vom Geldbeutel akzeptiert wurde. So wurschtelte sich jeder durch.
Besonders die Berliner entwickelten einen eigenen Pragmatismus. Man lebte den Umständen entsprechend. Man nahm die Dinge wie sie kamen. Die Berliner hatten zwei Weltkriege erlebt. Sie waren Zeugen der Morde, Überfälle und Kämpfe der Weimarer Republik. Sie ließen zwölf Jahre Hitlerdiktatur über sich ergehen. Die totale Zerstörung von Berlin von dem englischen Flächenbomberdement wurde phlegmatisch hingenommen. Berlin wurde von den Russen zur Plünderung freigegeben. In der Geschichte der Neuzeit gibt es kein Beispiel über ein derartiges barbarisches und viehisches Verbrechen an einer Großstadt. Damit prahlen die Russen. Die Frauen wurden zu Tode vergewaltigt. Keine Frau bekam dafür den Friedens-Nobelpreis. Die gesamte männliche Bevölkerung Berlins wurde nach Sibirien verschleppt. Niemand spricht darüber.
Diese Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts haben in Berlin Spuren hinterlassen. Sie kreierten den speziellen Berliner Charakter. Man ließ die Großen die Großen sein. Hinter ihren großen Worten kam auch nur der kleine Schmutz zum Vorschein, wie sie Habgier und Größenwahn hervorbringen. Der kleine Mann auf den Straßen von Berlin war in seiner Gelassenheit immer noch grösser als alle großen Worte der Großen dieser Welt.
Irene, Lilly, Susanne und Rita
Es war Samstag, der 6. April 1960. In der Wohnung bei Schwitters in der Reichenberger Straße in Berlin waren vier Mädchen und zehn Jungen versammelt. Sie tranken, randalierten, sangen, diskutierten, lärmten und aßen, alles durcheinander und ohne Zusammenhang. Jeder sprach mit jedem. Alle sprachen gleichzeitig. Niemand hörte zu.
„Scotsch-Whisky! Ich nem Scotsch-Whisky. Wie habt ihr nich? Wieso habt ihr nich? Gibt’s doch gar nicht. Na hör mal.“
„Scotsch-Whisky? Nix für mich. Mir hat der Arzt alles verboten. Ich darf keine Wurst essen, keine Butter und keinen Zucker. Ich darf keinen Wein trinken. Aber Wodka, davon hat er nicht gesprochen. Wie? Ihr habt auch keinen Wodka? Ist doch die Höhe!“
„Mensch treib Sport.“Walter boxt seinem Nachbarn in die Seite: „Warum treibst du keinen Sport?“
Irene war auf die Idee gekommen, auf der Straße ein paar Jungen anzureden und einzuladen, einfach so. Man musste die Feste feiern, wie sie fallen. Die Eltern waren unterwegs, mal wieder, wie jedes Wochenende. Die Mädchen konnten tun und lassen, was sie wollten. Irene nahm Rita mit. Rita war Irenes Stiefschwester.
Auf der Straße sprachen sie wildfremde Männer an. Irene konnte das ganz locker, so nebenbei, kühl und überlegen. Sie machte auf intellektuell. Das zog immer. Rita bewunderte Irene. Sie wollte gerne wie sie sein, konnte aber nicht. Sie hatte nicht den Schmiss, nicht das Aussehen und nicht dieses gewisse Etwas wie Irene. Die Männer flogen auf Irene. An einem Abend zehn fremde Männer einzuladen, war für Irene ein Kinderspiel.
Rita wurde auf der Flucht geboren. Im Januar 1945 floh die Familie vor den Russen aus Schlesien. Die Familie hatte seit undenklichen Zeiten in Schlesien gewohnt. Früher war man einmal österreichisch gewesen. Seit dreihundert Jahren war man preußisch. Aber das spielte keine Rolle, ob man Österreicher oder Preuße war, das Leben ging weiter. Als jedoch die Russen kamen veränderte sich dieses „Laissez-faire“. Alles, was deutsch war, wurde umgebracht. Das geschah methodisch. Das war in Teheran, Jalta und Potsdam geplant worden. Wer sein Leben retten wollte, musste fliehen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Ritas Mutter starb nach der Geburt. Rita überlebte. Das Dorf hatte sich geschlossen auf die Flucht gemacht. Alle haben sich gegenseitig geholfen. Eine Nachbarin von Ritas Mutter hatte auch ein neugeborenes Kind. Sie konnte Rita die Brust geben. So überlebte Rita.
Aber Rita wurde während der Flucht auf der Landstraße geboren. Es gab keinen Arzt und keine Hebamme, der bei der Geburt hätte helfen können. Es gab keine Desinfektionsmittel. Auf den hartgefrorenen Wegen vom Januar, Februar und März 1945 gab es auch keine Waschgelegenheit. Durch die primitiven Umstände ihrer Geburt wurde Rita das Rückgrat deformiert.
Rita wollte gerne so extrovertiert agierend wie Irene sein, konnte aber nicht. Ihre körperlichen Probleme belasten sie und behinderten sie überall. Sie war fleißig und liebenswürdig und konnte keiner Fliege was zuleide tun. Aber ihre Zeugnisse lagen unter dem Klassendurchschnitt. Ist die Intelligenz genetisch bedingt oder wird sie durch die Umstände gefördert? Darüber streiten sich die Gelehrten. Aber die Entwicklung von Irene, Lilly, Susanne und Rita sprach eine eindeutige Sprache. Alle vier waren von Krieg, Nachkriegszeit und psychotischen Eltern beschädigt und belastet. Keines der Mädchen war vom Schicksal besonders privilegiert behandelt worden. Aber ihre Lebenswege waren sehr verschieden.
Rita hatte niemals eine große Kariere gemacht. Sie war nach der Volksschule bei Karstadt am Hermannplatz als Lehrling eingestellt worden. Seit einem Jahr arbeitete sie hier im Verkauf.
Ritas richtige Schwester war Susanne. Susanne war zwei Jahre älter als Rita. Sie wuchs in ihren ersten beiden Lebensjahren in Schlesien in glücklichen Familienverhältnissen auf. Von Natur aus war sie introvertiert. Sie sprach selten, sehr selten und dann auch nur, wenn sie ausdrücklich dazu aufgefordert wurde. Sie war immer im Hintergrund, schweigend. Susanne war eine graue Unscheinbarkeit. Trotzdem hatte sie mehr Glück als Rita. Beruflich ging es ihr glänzend und auch auf Männer wirkte sie anziehend, obwohl sie so schüchtern war.
Susanne arbeitete seit drei Jahren als Friseurlehrling. Seitdem sie im Friseursalon arbeitete, färbte sie sich jede Woche ihre Haare in einer anderen Neonfarbe. Das gehörte zu ihrem Berufsimage. Außerdem behandelten sich die Friseusen gegenseitig gratis. Das war eine gute Reklame fürs Geschäft, ohne Zweifel. Gleichzeitig waren diese Friseusen auch Versuchskaninchen für alle chemischen Produkte und Farbstoffe, die im Wirtschaftswunderland tagtägliche neu auf den Markt geschmissen wurden. Darüber dachte niemand nach. Die Friseusen waren jung, unbeschwert und naiv. Sie bewunderten sich selbst mit immer neuen Farben in den großen Spiegeln der Salons. Sie waren die Welt von Morgen nach der verlorenen Generation der Kriegszeit. Sie repräsentierten die neue Zeit nach den grauen Mäusen der Arbeitsmaiden und Ruinenfrauen. Sie wollten genießen, in großen Zügen. Sie hatten aber nicht gelernt, dass alles einen Preis hat, auch der Luxus der neuen Welt.
Ohne Zweifel machten diese lackierten, selbstleuchtenden Frisuren Susanne bunter. Mehr sichtbar wurde sie dadurch nicht. Aber ihre Kunden liebten sie. Tagein, tagaus hörte Susanne sich geduldig jedes Gewäsch und jeden Klatsch ihrer Kundinnen an. Sie störte nie mit unnützen Fragen. Sie kommentierte nichts. Sie gab keine Informationen weiter. Aller Kummer der Kundinnen, ihre kleinen und großen Geheimnisse, aller Klatsch und Tratsch, alle Informationen, Lügen und Desinformationen kamen nie über die Türschwelle des Friseursalons hinaus. Das wussten die Kundinnen zu schätzen. Susannes Wortkargheit verwandelte sich hier in reines Gold. Sie kassierte astronomische Trinkgelder.
Als die Herrengesellschaft, die Irene und Rita auf der Straße aufgelesen hatte, in der Reichenberger Straße angeströmt kam, kroch Susanne in sich selber zusammen wie in einem Schneckenhaus. Mit den Frauen im Friseursalon konnte sie großartig auskommen. Sie lächelte, arbeitete fleißig, ließ die Frauen reden und alle waren ihr dankbar. Wie aber sollte sie sich gegenüber diesen Männern verhalten? Susanne setzte sich geduldig in eine Ecke. Sie wagte gar nichts anderes. Sie war fügsam und geduldig und wartete ab, was geschah. Ansonsten schwieg sie wie gewöhnlich. Sie neigte den Kopf nach unten. Wenn sie angesprochen wurde, stierte sie auf den Fußboden. Wenn sie jemand etwas fragte, schüttelte sie den Kopf oder sie nickte. Ansonsten brachte sie kein Wort hervor.
Irene hatte eine Halbschwester. Sie hieß Lilly. Auch Lilly war an diesem Abend stumm. Auch sie sagte kein Wort, als zehn wildfremde Männer in der Reichenberger Straße anmarschiert kamen. Aber im Gegensatz zu Susanne war Lilly niemals fügsam und geduldig. Gleichgültig, in welche Situationen sie kam, so wartete sie ab, beobachtete, registrierte, was gesagt und gemacht wurde und dann handelte sie konsequent.
Lilly war der Prügelknabe ihrer Mutter, Irene war ihr Liebling. Irene durfte die Realschule besuchen. Lilly musste arbeiten gehen. Das Geld, das sie verdiente, musste sie zu Hause abgeben. Sie könne in der Reichenberger Straße nicht gratis wohnen und essen, hatte ihre Mutter gesagt. Da war Lilly vierzehn Jahre alt.
„Lilly hat keinen Verstand.“,sagte ihre Mutter.„Gymnasium? Ha, ha, ha! Das ich nicht lache! Ich schmeiße mein Geld nicht vor die Schweine. Die geht in die Fabrik. Die kann sich ihren Lebensunterhalt alleine verdienen.Das ist das einzig vernünftige, was sie zustande bringt. Bei mir hängt sie nicht herum. Ich unterstütze keine Faulenzer. Zu etwas anderem taugt dieses Flittchen ohnehin nicht.“
Seitdem Lilly vierzehn Jahre alt war, musste sie arbeiten. Zuerst war Lilly Saisonarbeiterin. Sie half beim Verkauf in Geschäften aus. Sie sprang überall ein, wo jemand gebraucht wurde. Im Haushalt helfen? Putzen? Kein Problem! Lilly sagte ja, immer und überall. Jeder Pfennig war willkommen. Alles, was sie nicht bei ihrer Mutter ablieferte, investierte sie in Kursen. Sie besuchte Stenografie-, Schreibmaschine- und Mathematikkurse, Englisch- und Französischkurse. Sie war jeden Abend unterwegs. Morgens um sieben Uhr ging Lilly aus dem Haus. Sie kam nachts um elf Uhr in die Reichenberger Straße zurück, legte sich ins Bett, schlief und verschwand früh morgens wieder, bevor die anderen aufstanden. Sie kommentierte nichts. Sie gab ihrer Mutter keine Informationen, wo sie war und was sie machte. Sie antwortete ihrer Mutter nicht, wenn sie angesprochen wurde. Sie drehte sie sich um und ging weg. Deswegen nannte ihre Mutter sie eine Herumtreiberin, ein Flittchen und eine Hure.
Nach einem Jahr, als Lilly das Schreibmaschinen- und Stenografie Examen bestanden hatte, bekam sie eine Anstellung als Schreibkraft in einem Büro. Jetzt verdiente sie regelmäßig und gut. Auch davon sprach sie mit niemanden. Ihre Mutter hätte dann noch mehr Geld von ihr verlangt und noch mehr an ihr herum gestänkert. Wie, wo und wann sie arbeitete, war ihre Angelegenheit. Das ging niemanden etwas an.
Damals gab es noch eine achtundvierzig Stunden Woche in Deutschland. Auch samstags wurde gearbeitet. Aber jeden Tag von acht Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags im Büro zu sitzen, genügte Lilly nicht. Abends besuchte sie weiterhin Mathematik- und Sprachkurse. Ihre Kolleginnen glauben, sie wollte Kariere machen. Sie wollte zur Privatsekretärin avancieren oder sich für die Korrespondenz in der Auslandsabteilung bewerben. Lilly war jung. Die ganze Welt stand ihr offen.
Lilly äußerte sich nicht dazu. Wenn ihr jemand einen besseren Job angeboten hätte, hätte sie nie nein gesagt. Aber des Lebens letzter Zweck war dies nicht für sie. Lilly lernte, um des Lernens willen. Sie las alles, was sie auftreiben, erstehen oder ausleihen konnte. Im Lernen und Lesen öffneten sich für Lilly ganz andere Welten. Lilly lebte mit und in ihren Büchern. Hier verwischten sich die Grenzen zwischen Wirklichkeit, Traum, Phantasie, Utopie und Wunschbilder. Es öffneten sich immer neue Möglichkeiten. Jetzt hatte sie ein privates Gymnasium gefunden, wo sie ihr Abitur nachmachen konnte. Allerdings musste sie hier tagsüber zur Schule gehen. Darum hatte sie im Büro gekündigt und suchte einen Job, wo sie abends oder nachts arbeiten konnte.
Auch in dieser Nacht in der Reichenberger Straße war Lilly in einem Buch versunken. Dann kam diese lärmende Kompanie und machte jegliche Konzentration unmöglich. Die Kakophonie von Stimmen, Lachen, Singen und Schreien schlug wie eine Sintflut über ihr zusammen. Politik, Klatsch und Banalität wurden wie Kraut und Rüben durcheinander geschmissen. Wer sagte was? Worum ging es? Lilly konnte nicht folgen.
„Erzähle mal, wie war das mit diesem Skandal?“
„Skandal? Dem wollt ich mal eins auswischen, wollt ich. Und da hab ich jesacht, ‚Wat hab’n Se eben jesacht?‘, und da hat er jesacht: ‚Kommen Se mir nich mit so wat.‘“
„Unmöglich!“
„Sach ich doch, sach ich doch.“
Alle redeten gleichzeitig, keiner hörte zu. Jeder hatte eine Meinung, die niemanden interessierte.
„Das Volk weiß nicht, was es will und die Abgeordneten sind zu faul, zu müde und zu beschäftigt.“
„Man sollte diese aufgeblähten Beamtenkörper abschaffen.“
„In Bonn produzieren diese Typen tausend Narrheiten und Albernheiten. Hier fischt jeder im Trüben.“
„Meinst’e?“
„Deutschland müsste amtlich organisiert werden und nicht von wildgewordenen Spießbürgern, sach ich.“
„Amtlich organisiert? Mit all die irrsinnigen Vorschriften? Glaubst’e das interessiert mich. Das interessiert mich überhaupt nicht.“
Susanne gähnte. Sie hatte Lust ins Bett zu gehen. Sie traute sich aber nicht, einfach aufzustehen und alle Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Rita war in der Küche, um ein paar Stullen zu schmieren. Die Herren hatten Schrippen und Aufschnitt mitgebracht. Das wurde ein richtiges Fest.
„Nächstes Jahr? Tunis? An jeder Straßenecke ein Harem. Wa?“
„Woher hasse das?“
„Na hör mal, ich lese, klar, lesen muss man können.“
„Harem? Hab ich richtig jehört? Sowat jehört bei uns unters Jugendschutzgesetz. Anstößige Wörter müssen vermieden werden.“
„Man darf auch nicht ‚das leibliche und sinnliche Leben’ verherrlichen oder gar bordellartige Gespräche im Schoß der Familie führen.“Das war Irene. Sie machte auf intellektuell wie immer. Rita kam mit den Brötchen. Irene holte Bier.
Familienleben! Dachte Lilly verächtlich, Familienleben war geheuchelte Ehrbarkeit, die öffentlich ausgestellt wurde, die aber niemals stimmte und die keiner glaubte. Familie war ein Markenartikel. Das war die Grundlage des deutschen Staates. Die Familie war ein Warenhaus von gängigen Werten wie triefende Würde, hölzerne Anständigkeit und ausgekochte Sauberkeit. Die Familie wurde sakral gehütet und nach kaufmännischen Prinzipien auskalkuliert und immer an die jeweilige politische Lage angepasst. So war es jetzt auch wieder in der Ostzone. Familie? Natürlich! Selbstverständlich! Aber die Kinder gehörten dem Staat. Die Kinder mussten der jeweiligen politischen Ideologie entsprechend ausgerichtet und dressiert werden und zwar von der Wiege bis zum Grab. Dafür sorgte die Partei. Familie? Was war das? Das war das, was der Staat diktiert und was in die politischen Landschaften hineinpasste.
Rita sprach auf Klaus und Robert ein:„Irenes Großvater starb vor zwei Jahren. Er hinterließ eine größere Summe Geld. Lilly und Irene erbten das Geld. Ihre Mutter wurde von ihrem Vater enterbt. Sie hatte eine höhere Ausbildung bekommen. Das wurde ihr Pflichtanteil genannt. Lilly und Irene sollten sich alleine durchwurschteln, darum sollten sie das Erbe bekommen.“
„Meine Mutter führte einen langen Prozess”,mischte sich Irene hier ein, „sie verlor eine Instanz nach der anderen. Lilly und ich, wir sind beide noch minderjährig. Meine Mutter hat das Erziehungsrecht. Sie beanspruchte die Kontrolle über das Geld, um unsere Erziehung sicherzustellen. Als sie sich abgesichert hatte, kaufte sie sich einen Mercedes. Seitdem fährt sie an jedem Wochenende nach Westdeutschland. Darum sind wir an jedem Wochenende alleine in der Wohnung.“
Jürgen, Norbert und Günther hingen neben und hinter Lilly am Klavier, pickten auf den Tasten herum und sangen, jeder nach einer eigenen Melodie, jeder mit einem anderen Text. Aus dem Fernseher tönte die Stimme des Nachrichtensprechers: „Die Sowjetunion protestierte gegen die Übermittlung einer Medaille an einen Sowjetbürger durch die deutsche Botschaft. Arbeitskollegen von Iwan Goppe, wohnhaft in der Siedlung Kaliez im Rayon Solikamsk hätten ausgesagt, dass ein Postbote ein Paket von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau an besagten Iwan Goppe abgegeben hätte …“
„Mit Politik tu ich mir nicht befassen, det jeht mir jar nischt an“,sagte Helmut. Helmut und Rainer verschwanden im Schlafzimmer von Schwitters. Sie durchwühlten den Kleiderschrank und kostümierten sich. Helmut zog das schöne Geblümte von Frau Schwitters an und Rainer den guten Gestreiften von Herrn Schwitters. Die Kleider hingen wie Säcke an ihnen herunter. Sie wurden mit Unterhosen und Strümpfen ausgestopft. Helmut fand den Lippenstift von Frau Schwitters.
„Breeennend hei-hei-heißer Wüstensand“, grölte Jürgen und Norbert und hämmerten aufs Klavier. Helmut und Rainer tanzten eng umschlungen. Klaus und Robert waren mit Irene beschäftigt: „Seid ihr alle vier Geschwister?“
„Nein, Susanne und Rita sind Schwestern, und Lilly und ich, wir sind Halbschwestern, wir haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter.“
„Ja so jet dat, Männer kann’ste nehmen, brauchen und wegschmeißen.“
Martin hatte den Kasten mit den Sicherungen gefunden. Das war spannend. Er zog eine Sicherung raus, setze eine andere rein und wieder umgekehrt, hin und her. Das Radio klickte aus und an, der Fernseher wurde schwarz und explodierte in Blitzlichtern. Der Plattenspieler leierte, hackte und verstummte. Jürgen und Norbert hämmerten weiterhin auf dem Klavier herum. Sie schwebten in seliger Bierstimmung.
Rita wusste nicht genau, ob sie mit Robert oder mit Klaus anbändeln sollte. Irene war immer noch mit ihren eigenen Familienproblemen beschäftigt: „Jedes Wochenende sind meine Eltern unterwegs. Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Aber meine Mutter nimmt uns alles Geld ab. Alle Essenswaren werden eingeschlossen.“
Rolf hörte entmutigt auf, am stummen Radio zu kurbeln. Er setzte sich bei Susanne auf den Schoss. Susanne protestierte. Rolf kitzelte sie.
„Nein... nicht... mir wird übel...“, Susanne wollte aus dem Wohnzimmer weglaufen, konnte aber nicht.
Helmut und Rainer tanzten im Dunkeln weiter, ohne Musik. Am Klavier wurde getrunken und gegrölt: „Schwarzer Kater Stanislaus …“
Die ganze Wohnung lag im Dunkeln. Lilly schob sich an der Wand entlang.
„Huh... Huh!“Martin fühlte sich witzig. Er tastete sich vorwärts, stolperte über Lilly und fiel. Mit dem Kopf schlug er gegen die Tischkante. Ein Zahn wurde beschädigt: „Verdammte Scheiße!“Er wischte sich das Blut mit dem Taschentuch ab. Im Dunkeln flammten Streichhölzer und Feuerzeuge auf.
Lilly erreichte den Korridor, tastete sich bis zu ihrer Zimmertür und verschwand in ihrem Zimmer. Sie schloss die Tür hinter sich ab, legte sich auf ihr Bett und schlief ein. Der Lärm in der Wohnung mischte sich mit ihren verworrenen Träumen. Sie hörte einen Wasserfall und Räderrollen. Dann wurde der Lärm konkreter. Türen knallten. Jemand schrie. Die Stimme kannte Lilly. War das ein Alptraum? Lilly war mit einem Male hellwach. Sie blieb regungslos liegen und lauschte. Ihre Mutter war zurückgekommen. Wie spät war es? Fünf Uhr morgens? Wieso kamen die mitten in der Nacht wieder nach Zuhause zurück? Was war passiert? Reifenpanne? Unfall? Oder war der Schwitters wieder stinkbesoffen? Wahrscheinlich! Das war nicht das erste Mal. Was sollte sie jetzt machen? Sie stand auf und zog sich an, leise, bloß keinen Lärm machen. Lilly wartete.
Im Korridor hörte sie das Kreischen ihrer Mutter:„Pornographisch ... bis ins Mark vergiftet... anstößig... verlotterte Bande... bringe ich in die Erziehungsanstalt … “
Dazwischen konnte sie laute Proteste von Männerstimmen ausmachen: „Wie? Wat hab’n Se eben jesacht?“
„Ich hole die Polizei. Raus! Rauuuus ….!“Das hallte im Treppenhaus. Offensichtlich schrie sie jetzt im Treppenhaus die Nachbarn zusammen. Sie wollte Zeugen haben.
„Das verbitte ich mir aber. Was erlauben Sie sich für einen Ton?“ War das Norbert?
„Skandal is das …“
„Sie … kommen Sie mir bloß nicht mit Skandal!“
„Sie können mir mal!“
„Das is ja jrossartig! Ich soll Sie? Sie können mir!“
„Wenn Sie nicht sofort…“
Lilly hörte einen Knall. Was war passiert? Draußen wurde es hell. Offensichtlich wurden jetzt die Jungen nach draußen befördert. Sie hörte Poltern und einen undefinierbaren Lärm. Etwas flog gegen ihre Tür, Porzellan klirrte, Schritte jagten vorbei. Dazwischen hörte sie Proteste: „Unglaublich!“
Irgendjemand drohte:„Komm’Se, komm’Se doch!“
„Wat’n! Wat’n …“
„Vaflucht!“
Jemand trampelten über den Korridor:„Sie … Sie …“
Im Treppenhaus schrie ein Mann:„Herrjott, wat sind Sie for ene!“
Die Wohnungstür wurde zugeschlagen. Einen Augenblick lang war es stille, dann legte Lieselotte Schwitters gegen Rita los:
„Flittchen. So was will ich nicht im Hause haben...raus, habe ich gesagt, raus …“.Schon wieder krachte etwas. Lilly hielt den Atem an. Wurde ihre Mutter jetzt gegen Rita und Susanne handgreiflich? Dann war auch sie in höchster Gefahr. Vorsichtig packte sie ein paar Kleidungsstücke und ihre Bücher in einen alten Pappkoffer.
„Wenn Rita rausgeschmissen wird, gehe ich auch“, sagte Susanne. Normalerweise war Susanne zu schüchtern, um zu sprechen, aber wenn Rita angriffen wurde, dann verlor sie ihre Hemmungen. Mit Rita war sie zusammen durch die Hölle gegangen. Rita war alles, was sie noch hatte.
„Rauuuus ...“
Von Irene war kein Piep zu hören. Lillys Zimmertür war noch immer verschlossen. Lilly wagte kaum, sich zu bewegen. Sie wollte nicht die Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf ihre Person lenken. Aber ihr Schweigen half ihr auch diesmal nichts. Susanne und Rita nahmen ihre wichtigsten Sachen und verließen das Haus. Frau Schwitters kontrollierte jeden Gegenstand, den sie einpackten. Dann erinnerte sie sich an Lilly: „Wo ist Lilly? Wo ist diese Hure? Auch noch immer draußen auf dem Strich?“
Frau Schwitters rüttelte an Lillys Zimmertür: „Aufmachen! Wird’s bald! Ich schlage die Tür ein. Ich hole die Polizei. Ich schlage dich in Stücke, wenn ich dich erwische.“
Lilly schmiss den Pappkoffer mit den Büchern und Kleidern aus dem Fenster, dann stieg sie hinterher. Ihre Sachen konnte sie am Bahnhof Zoo einschließen. Vielleicht konnte sie bei einer Freundin unterkommen. Das Leben ging weiter, auch ohne Familie.
Der Flüchtling
Es war Samstag, der 13. April 1960. Alfred Weichelt ging von Tür zu Tür. Irgendwo musste sich eine Unterkunft für ihn finden, gleichgültig was und wenn es nur eine Schlafstelle war. Vorläufig war er im Flüchtlingsauffanglager in Marienfelde. Das war für ihn die Hölle: Als eingefleischter Junggeselle war er nicht gewohnt, Kinderlärm um sich herum zu haben. Jetzt war er diesem hektischen Betrieb ausgesetzt. Die Völker strömten herbei, jeden Tag. Das war das Resultat der Zwangskollektivierung des Bauernstandes in der Ostzone.
„Begreifen Sie doch: Ich bin kein Bauer. Mich mit Hunderten von Bauern einzupferchen, bringt mich in die Klapsmühle.“
„Berlin ist überlaufen. Wir werden Sie nach Westdeutschland rüber fliegen.“
Weichelt wollte aber nicht nach Westdeutschland fliegen. Er wollte überhaupt nicht fliegen. Er wollte ein kleines Zimmer haben, irgendwo in Berlin, mehr verlangte er nicht. Er telefonierte von Zeitungsannonce zu Zeitungsannonce. Er ging von einer Empfehlung zur anderen, bis er in der Reichenberger Straße ankam. Hier klingelte er zuerst bei Frau Elster. Frau Elster war sehr zurückhaltend:„Bei mir kommt kein Mann in die Wohnung. Ich war einmal verheiratet, das reicht.“
Mitleid hatte sie trotzdem: „Aber eine Tasse Kaffee und eine Stulle können Sie bekommen... Also, Flüchtling sind Sie? Warum sind Sie geflohen?“
„Zwangskollektivierung.“
„Sie doch kein Bauer nicht.“
„Alle reißen sich den Mund wund über die Zwangskollektivierung des Bauernstandes, aber an den kleinen Mann mit Privatbetrieb denkt keiner. Ich hatte eine kleine Druckerei, Reklame, Laufzettel, Krimskrams, Traueranzeigen, Gratulationen, was sich gerade bot, nicht viel, Einmannbetrieb, aber ich war mein eigener Herr. Jetzt sollte ich in einem staatseigenen Betrieb jeden Quatsch der Partei drucken. Das war alles zensurierter Blödsinn, Propaganda, Blablabla, politische Schulung, Gehirnwäsche... Nee, wissen Sie, ich bin zu alt für so was.“
Weichelt war deprimiert: „Die Ostzone erklärt die Zwangskollektivierung als eine Welle der freien Einsicht der Bauern und des Mittelstandes. Die Zwangskollektivierung ist aber nichts anderes als Terror gegen die Bevölkerung.“
Frau Elster schmolz das Herz. Sie konnte diesen armen Menschen nicht einfach wegschicken: „Versuchen Sie einmal nebenan bei Schwitters ihr Glück. Ich will nicht klatschen, aber da war letzte Woche ein Krawall. Die Alte hat die jungen Mädchen rausgeschmissen. Da sind bestimmt ein paar Zimmer leer.“
Die Leiche
Zwei alte Damen kamen am Sonntagmorgen, dem 4. Mai 1960, zur Polizeiwache. Sie wollten eine Aussage machen. Der diensthabende Beamte notierte. Die Damen berichteten:Als wir, das heißt, meine Schwester und ich, aus der Kirche kamen, lag eine Leiche vor unserer Haustür.“
„Ganz bestimmt eine Leiche“,echote ihre Schwester.
„Die war nackend, hatte überall blaue Flecken und war blutverschmiert.“
„Können Sie mir eine nähere Beschreibung geben?“fragte der Beamte.
„Das war ein Mann, also… hm…“Die alte Dame errötete leicht. Ihr war das sichtlich unbehaglich, das detailliert beschreiben zu müssen. „Der war nackend, ganz … also, wissen Se … da kann man doch nicht hingucken. … Is doch unanständig.“
„Ja“, konterte ihre Schwester.
„Alter?“, fragte der Polizeibeamte sachlich. Er war müde. Es war Sonntagmorgen und er hatte keine Lust, sich diesen Blödsinn von zwei senilen Frauen anzuhören.
„Mechthild, was würdest du sagen? So zwischen dreißig und sechzig meine ich, so ungefähr.“
„Ja, genau.“
„Haarfarbe?“
„Tja, die Haare waren dünn, soweit ich sehen konnte. Was glaubst du, Mechthild, waren die dunkel oder waren die nicht dunkel?“
„So ungefähr, ja.“
„Augenfarbe?“
„Der hatte die Augen geschlossen. Wie soll ich das wissen.“
„Größe?“
„Welche Größe?“
„Die Körpergröße natürlich. Was glauben Sie denn?“
Das ältliche Fräulein errötete zart.
„Der liegt da, quer vor der Haustür. Er versperrte den ganzen Eingang. Wir konnten nicht in unser Haus kommen. Größe? Ja? Die Tür ist ein Meter fünfzig breit. Die Treppe ist zwei Meter breit. Also, zwischen ein Meter fünfzig und zwei Meter würde ich sagen. Was meinst du, Mechthild?“
„Genau.“
„War der Mann dünn, dick, kräftig, schmächtig?“
„Was soll man dazu sagen? Wie er da so lag … also … dick? Nee! Dünn war er auch nicht. Die Beine waren dünn wie dünne Streichhölzer. Der Bauch war schwabbelig. Aber sonst war nicht viel an ihm dran. Meinst du nicht auch, Mechthild?“
„Du hast ganz Recht.“
„Wie war Ihr Name?“
„Wir wohnen im selben Haus, wo diese Leiche liegt, in der Reichenberger Straße in der dritten Etage, gleich die erste Tür links, wenn Sie die Treppe raufkommen.“
„Ihre Namen, bitte.“
„Macher, Clara und Mechthild Macher.“
Der diensthabende Beamte wandte sich an einen Kollegen vom Außendienst:
„Kurt, würdest du die beiden Damen zur Reichenberger Straße fahren und die Fundstelle sicherstellen? Ich werde die Mordkommission benachrichtigen.“
Im Polizeipräsidium
Am Montag, dem 5. Mai 1960 herrschte der gewohnte Betrieb im Polizeipräsidium. Das lief von links nach rechts und von rechts nach links. Man trabte treppab und treppauf. Es wurde gearbeitet, telefoniert, diskutiert und konferiert. Tür auf und Tür zu. Man hatte Aktenmappen unterm Arm, Aktenmappen lagen auf dem Tisch, Aktenmappen kamen in die Schränke hinein und aus den Schränken heraus. Das elektronische Zeitalter war noch nicht in die Dienststuben eingezogen. Hier lag noch der Staub von tausenden von Akten.
Die Ereignisse vom Wochenende wurden registriert und besprochen. Zwei Vergewaltigungen, dreizehn Schlägereien und eine Leiche in der Reichenberger Straße. Am Montagmorgen um neun Uhr war eine Leiche aus dem Landwehrkanal gefischt worden.
„Könnte die Leiche im Landwehrkanal mit der Leiche in der Reichenberger Straße identisch sein?“
„Man muss alle Möglichkeiten offen halten.“
„Unmöglich. In der Reichenberger Straße soll ein dreißig bis sechzig Jahre alter Mann gelegen haben. Aus dem Landwehrkanal wurde ein Schuljunge von sechzehn Jahren herausgeholt. Seine Mitschüler sind draußen. Sie sprechen von unglücklicher Liebe, Einzelgänger, Opfer von Spott und schäbigen Späßen. Scheint mehr ein Disziplinarfall für die Schule zu sein.“
Kriminalkommissar Herbert Hegmann übernahm die Leiche in der Reichenberger Straße. Er diskutierte die Situation mit seinen Kollegen. Die Schwestern Macher hatten die Leiche zwischen elf und zwölf Uhr am Sonntagmorgen vor ihrer Haustür gesehen. Die Polizei hatte die beiden Damen gegen dreizehn Uhr in die Reichenberger Straße zurückgefahren. Als die Polizei zur Stelle kam, war die Leiche verschwunden. Man hat die „angebliche“ Fundstelle gründlich untersucht und Blutspuren gefunden. Die Blutbefunde waren zur technischen Untersuchung sichergestellt worden. Ein alter Schuh wurde neben der Treppe gefunden. Es war unsicher, woher der stammte. Ansonsten fehlte jeder weitere Befund. Eine Leiche wurde nicht gefunden. Die diensthabenden Polizeibeamten waren im Haus von Tür zu Tür gegangen. Der Aussage nach hatte niemand was gesehen. Die Glaubwürdigkeit einiger Personen wurde aber angezweifelt. Herbert wollte der Sache noch einmal nachgehen.
„Man muss die Ergebnisse aus der Reichenberger Straße mit äußerster Vorsicht behandeln.“
„Eine Meldung fürs Presseamt?“
„Wird sich nicht vermeiden lassen. Die Leute klatschen so oder so.“
„Wenn die Presse misstrauisch wird, kommt sie mit unbehaglichen Kommentaren.“
„Ha, ha, ha Presse! Die Ostpresse ist nicht nur zensuriert, die Artikel werden eigenhändig vom Politbüro geschrieben.“
„In einem Artikel der Iswestija wird der Bundeskanzler Adenauer beschuldigt, mit zwei Hakenkreuzen im Gästebuch der Nationalgalerie der Künste in Washington signiert zu haben.“
„