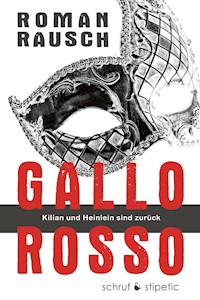6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Kilian ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Die Partei, die das Land seit Jahrzehnten regiert, hat eine schockierende Wahlniederlage erlitten. Ein Parteitag in Würzburg soll darum die Weichen neu stellen. Da verschwindet eine Praktikantin. Tage später wird ihre skelettierte Leiche in einer Hütte im Wald gefunden. Sofort werden Gerüchte laut, tauchen belastende Fotos auf: Die junge Frau hatte offenbar ein Verhältnis mit dem Generalsekretär. Doch je tiefer Kommissar Kilian in die Schattenwelt der Politik eindringt, desto deutlicher wird ihm: Das war kein Mord aus Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Ähnliche
Roman Rausch
Die Seilschaft
Kommissar Kilians siebter Fall
Dieser Roman ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären zufällig und sind nicht beabsichtigt. Die verwendeten Ortsnamen, Werke, Gruppierungen und alle sonstigen Bezeichnungen stehen in keinem tatsächlichen Zusammenhang mit dem Roman.
Die Partei hat uns alles gegeben,
Sonne und Wind, und sie geizte nie.
Wo sie war, war das Leben,
Was wir sind, sind wir durch sie.
Sie hat uns niemals verlassen,
Fror auch die Welt, uns war warm.
Uns schützt die Mutter der Massen,
Uns trägt ihr mächtiger Arm.
LOUIS FÜRNBERG, LIED DER PARTEI
Es herrscht eine Atmosphäre «der Angst, der Unterdrückung
und der Drohungen» in der Partei.
KURT TAUBMANN
Ich habe einen typischen Frauenfehler gemacht.
UTE VOGT
Prolog
Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechts dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfassung.
PRÄAMBEL DER BAYERISCHEN VERFASSUNG
1
«Gelobt sei Jesus Christus», sprach der Priester und schlug das Kreuzzeichen.
«Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen», antwortete die Frau. Sie bekreuzigte sich ebenfalls.
Es war dunkel und stickig in diesem engen Beichtstuhl aus dem vierzehnten Jahrhundert. Könige und Bettler hatten hier ihre Sünden einem barmherzigen Gott gebeichtet, lange bevor die Partei von ihrem gottesfürchtigen Weg abkam und die Hoffnungen ihrer Wähler dem Eigennutz opferte.
Der Knieschemel war hart und ungepolstert. Der bußfertige Sünder sollte spüren, dass Schmerz einer Lossprechung vorausging.
Die Frau ließ ihr Gesicht nicht erkennen. Wie es die Frauen – oder um im Sprachgebrauch des Volkes und des Glaubens zu bleiben–, wie es die Weiber seit jeher taten, hatte sie ihr Haupt mit einem Tuch bedeckt. Es schützte sie vor den neugierigen Blicken der Kirchgänger wie auch des Beichtvaters, sofern er doch einmal in das Gesicht einer Mörderin, Betrügerin oder Ehebrecherin sehen wollte.
Auf den sonst üblichen Bibelvers oder das einleitende Gebet verzichtete er an diesem Tag. Er musste sich ranhalten, es ging auf die Mittagszeit zu, und er hatte seit dem Frühstück nichts mehr zu sich genommen.
«Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit.» Er räusperte sich. «Was führt dich zu mir?»
Die Frau wusste um den vorgeschriebenen Ablauf. Sie hielt ihr Haupt gesenkt und ihre Hände gefaltet – äußere Zeichen der wahrhaften Bereitschaft zur Besserung.
«Ich möchte in Demut und Reue meine Sünden bekennen.»
Der Priester nickte zustimmend. Er rückte mit seinem Kopf näher an das kleine Gitter heran, das den Beichtenden vom Beichtvater trennte.
«Welche Sünden hast du begangen?»
«Ich habe die Unwahrheit gesprochen», flüsterte die Frau. «Ich habe geflucht und damit den Namen unseres Herrn beschmutzt.»
Sie hielt inne.
«Waren das alle deine Sünden?», fragte der Priester.
«Ich hatte auch unkeusche Gedanken.»
Wieder stockte sie.
«Sprich weiter. Noch etwas?», forderte er.
«Ich… ich bin sehr zornig gewesen», antwortete sie mit zitternder Stimme. Ihr bisher demütiger Blick ins Dunkel des Beichtstuhls hob sich und überwand das kleine Gitter. «So zornig wie noch nie in meinem Leben zuvor.»
Der Priester bedeutete ihr, leiser zu sprechen.
«Was war der Grund deines Zorns?»
«Diese gottlose Brut», zischte sie, «sie haben den Namen des Herrn entehrt.»
Er schien zu wissen, wer damit gemeint war, und seufzte.
«Was haben sie denn nun wieder getan?»
«Sie geben seinen Namen für den ihren aus und besudeln ihn damit.»
«Werde deutlicher. Was meinst du genau damit?»
Die Frau atmete tief ein, als gelte es, eine lange Liste von Verfehlungen vorzutragen.
«Da ist einer, er hat zu Hause Frau und Kind, und dennoch legt er sich zu einer anderen ins Bett. Jeder weiß davon, aber keiner unternimmt etwas dagegen. Statt ihn aus dem Amt zu jagen, preisen sie ihn als ihren neuen Anführer.»
«Ich habe davon gehört.»
«Ein anderer lügt, betrügt und stiehlt, als gäbe es keine Strafe für ihn. Und tatsächlich: Der Richter lässt ihn ungeschoren davonkommen. Er sagt, die Beweise reichten nicht aus, um ihn zu verurteilen. Dabei liegen sie offen auf der Hand.»
«Ich verstehe gut, was du meinst.»
Sie seufzte. «Diese Welt ist aus den Fugen geraten. Ich erkenne sie nicht wieder, und ich weiß nicht, wie ich mich darin noch zurechtfinden kann. Ehrwürdiger Vater, ich bin ein Kind unseres allmächtigen Herrn, und ich bemühe mich stets, seinen Geboten zu folgen, aber diese Scheinheiligkeit und Dreistigkeit, mit der sie sündigen, ist nicht länger zu ertragen. Ich fürchte, ich werde noch verrückt darüber, wenn ihnen nicht bald Einhalt geboten wird.»
Der Priester nickte. «Der Zorn ist eine große Sünde. Er lässt uns Menschen schreckliche Dinge tun.»
Er hielt kurz inne, besann sich dann eines Besseren.
«Sorge dich nicht länger, denn es gibt da noch einen anderen Zorn. Einen, den der Herr nicht als Sünde sieht. Es ist ein gerechter Zorn, der durch begangenes Unrecht erzeugt worden ist. In den Schriften heißt es dazu, dass man dem Bösen nicht freien Lauf lassen darf. Das Böse zu bekämpfen ist die Aufgabe jedes guten Christenmenschen. Dein gerechter Zorn ist gar ein heiliger, wenn du dich gegen die Missachtung der Gebote unseres Herrn stellst, so wie es Jesus getan hat, als er die Händler aus dem Tempel seines Vaters vertrieben und sich gegen die verlogenen Pharisäer gestellt hat.»
«Aber das war Christus. Wie kann ich mich mit ihm vergleichen?»
«Er ist unser aller Vorbild. Wahres Christsein bedeutet nicht Schwäche oder Tatenlosigkeit, sondern Kraft, sich gegen das Böse und die Sündiger zur Wehr zu setzen.»
Ein zufriedenes Seufzen, Zeichen ihrer Erleichterung.
«Ich danke Euch. Ihr habt eine große Last von mir genommen.»
Er nickte. «Hast du noch etwas zu beichten?»
«Nein, Vater. Das war alles.»
«Willst du nun bereuen?»
«Ja, Vater. Ich bereue, dass ich Böses getan und Gutes unterlassen habe. Erbarme dich meiner, o Herr.»
Der Priester nahm ihre Bitte als Zeichen der Reue entgegen und sprach sie von allen begangenen Sünden los.
«Nun geh hin in Frieden und sei ein starker Christenmensch. Bete zehn Gegrüßest seist du, Maria zu unserer heiligen Mutter Maria als Buße für deine Sünden.»
Er schlug das Kreuzzeichen.
Sie erwiderte es, blieb aber auf dem harten Betschemel knien.
«Ist noch etwas?», fragte er.
Sie blickte auf. «Ja, Bruder Vinzenz. Was gibt es Neues?»
2
«Herrschaftszeiten!»
Werner Schwerdt beugte sich über die Zeitung. Die Rede des Kreisvorsitzenden interessierte ihn in diesem Moment keinen Deut mehr.
Es war nicht zu fassen: Woher hatte dieser Schmierfink nur das Foto? Es zeigte ihn mit zerzaustem Haar, übernächtigt und verkatert beim Verlassen der Wohnung, von der eigentlich niemand wissen durfte. Sein Büroleiter hatte sie auf den Namen einer entfernten Cousine gemietet – einer unwiderstehlich süßen Studentin der Kunstgeschichte. Somit konnte niemand eine Verbindung zu ihm herstellen.
Schon bei der Schlüsselübergabe hatte es ihn in den Fingern gejuckt. Der Körper dieses jungen Dings machte jeden noch so guten Vorsatz zunichte. Aber nein, hatte er sich gesagt, die Verwandtschaft von Mitarbeitern bleibt tabu. Daran gab es nichts zu deuteln.
Nach einer Weile fragte er sich dann doch: Zu welchem Zweck sollte der Herr so wunderbare Früchte erschaffen, als dass man sie nicht pflücken dürfte? Reinste Verschwendung.
Eine reife Pflaume wollte vom Ast genommen werden. Das war schließlich ein Naturgesetz, von Gott gegeben.
Und bei allen guten Geistern, die Kleine war reif.
Anfänglich etwas spröde – das musste in der Familie liegen–, aber bei der Aussicht, was er noch für sie tun könnte und welche Möglichkeiten er ihr eröffnen würde, ließ sie alle Bedenken fahren und gab sich ihm hin.
Genau so liebte er sie. Weigerung und Hingabe. Er kannte die Menschen, und vor allem die Frauen, gut. Sie waren zu allem bereit, wenn die Belohnung stimmte. Ein weiteres Naturgesetz, das mit Eva, der Schlange und dem Apfel Eingang in die menschliche Existenz gefunden hatte.
Nicht umsonst war er zum Generalsekretär der Partei ernannt worden. Er wusste, wie die Dinge funktionierten. Gibst du mir, gebe ich dir. Das war das schlichte Geheimnis von dreißigtausend Jahren Menschheitsgeschichte. Mit ihm wurden Königreiche erschaffen und wieder niedergerissen. Es gab keinen Grund, etwas daran zu ändern. Der Handel lag den Menschen im Blut, er machte sie zu dem, was sie in seinen Augen eigentlich waren: rückgratlose Opportunisten, die für den eigenen Vorteil ihre Mutter verkauften, sofern – und das war das Entscheidende – der Preis stimmte. Die Kunst dabei war, den Preis so gering wie möglich zu halten und den Partner an sich zu binden. In dieser Disziplin war er Meister geworden. Vorschriften und Regeln interessierten ihn nicht. Das war etwas für Erbsenzähler und Idealisten.
Er hingegen stand darüber, er machte die Gesetze.
Doch dieses Foto hier war eindeutig zu viel. Es verstieß auf beleidigende Art und Weise gegen den Ehrenkodex, den er und seine Parteifreunde mit der Presse geschlossen hatten.
Keine kompromittierenden Fotos im Wahlkampf.
Sein Blick schweifte zur Bildunterzeile. Der Fotograf war nicht namentlich genannt. Offenbar wieder einer dieser schmierigen Paparazzi, die nichts anderes zu tun hatten, als ehrbaren Bürgern nachzustellen. Wenn er nur einen dieser Halunken zu fassen bekäme, am besten nachts auf einer Brücke oder in einer dunklen Seitengasse. Er würde keinen Augenblick zögern.
Der Autor des Artikels war eine Frau. Sonja Lindström. Er hatte noch nie von ihr gehört.
«Kennst du die?», fragte er seinen Wahlkampfmanager, der neben ihm im großen Rund des Kaisersaals der Residenz zu Würzburg saß.
Der verneinte. «Muss eine Neue sein.»
«Überprüf sie. Ich will wissen, wer sie ist, und vor allem, wie sie zu dem Foto gekommen ist.»
Ein flüchtiges Grinsen huschte über die Lippen des Wahlkampfmanagers. Dem Generalsekretär entging es nicht.
«Du bist der Letzte», zischte er ihn an, «der hier etwas zu grinsen hat. Wie kommt das Foto überhaupt in die Zeitung? Noch so ein Mist, und du kannst wieder Wahlplakate kleben.»
«Das ist das Blatt der anderen», wehrte er sich. «Wir haben kein Druckmittel, um es zu verhindern.»
«Dann streng den letzten Rest deines kümmerlichen Hirns an. Werbeanzeigen zurückziehen kann jeder Anfänger. Finde die Schwachstelle und nutze sie.»
Am liebsten hätte er ihm das Schmierblatt um die Ohren gehauen. Wie sollte man mit solchen Stümpern einen Wahlkampf gewinnen?
Dieses eine Foto konnte ihm alles kosten. Es traf ihn an seiner einzig verwundbaren Stelle – seinem Privatleben. Wieso ließen sie ihn nicht sein Leben führen, wie er es sich vorstellte? Schrieb er es denn anderen vor?
Sicher nicht. Nun, bis auf ein paar Kleinigkeiten vielleicht, die in das Verständnis der Partei von Familie, Ordnung und Moral passten. Ansonsten konnte jeder tun und lassen, was er wollte. Und jetzt diese Machtlosigkeit – mit ansehen zu müssen, wie jeder x-beliebige Praktikant seine heimtückischen Fotos in Zeitungen veröffentlichen durfte.
Es war die gleiche Machtlosigkeit, die er alle vier Jahre verspürte, wenn er sich jedem dahergelaufenen Schnösel anbiedern musste, damit er ihm seine Stimme gab. Sosehr er auch die Idee von Demokratie liebte, das Volk war ein verdammter Unsicherheitsfaktor. Seine Macht zu begrenzen war für einen Politiker die einzig sinnvolle Schlussfolgerung.
Dieses Foto. Im Hintergrund war ein Schatten am Fenster zu sehen. Es war der von Charlotte.
Er hatte sie bei der alljährlichen Starkbierprobe auf dem Nockherberg mit anschließendem Politiker-Derblecken kennengelernt. Charlotte, die liebenswerte Gattin des Gegenkandidaten, war eine harte Nuss gewesen. Eifrig und züchtig stand sie ihrem Gatten zur Seite, und selbst die derbste Spitze gegen ihren politisch nicht immer glücklich agierenden Mann nahm sie mit offensichtlicher Heiterkeit.
Erst im Bett hatte sie ihm gestanden, dass sie vor Scham am liebsten in den Boden versunken wäre. Er sei ein aufgeblasener Wichtigtuer, der, außer dumm daherzureden, nichts auf die Reihe brachte. Sie hasste ihn mit jeder Faser ihres Körpers, genauso, wie sie ihn nun mit aller Leidenschaft betrog.
Das war der leichte Teil der Verführung gewesen.
Der schwere war, die vielen kleinen, aber auch großen Geheimnisse über den politischen Gegner zu erfahren. Es gelang ihm mit dem Versprechen, sie zu heiraten, sobald die Wahl entschieden war. So lange sollte sie für den Ehemann lächeln und für den Liebhaber die Ohren offenhalten. Um alles Weitere würde er sich kümmern.
Der Plan war so weit aufgegangen.
Und nun das. Wenn die Medien erführen, wer sich hinter dem Vorhang verborgen gehalten hatte, dann würde die Stimmung kippen. Er wäre dann nicht länger der Wahrer von Recht und Moral im Freistaat, sondern nur noch ein schändlicher Hurenbock, der nicht die Finger von anständigen Frauen lassen konnte. Sein Gegenkandidat wäre damit der bedauernswerte, gehörnte Ehemann, dem man nun mit dem Wahlzettel über die erlittene Schmach hinweghelfen musste.
Das war eine gefährliche und beängstigende Situation.
Eine Frau konnte alles zerstören.
Sowohl die Reporterin Sonja Lindström als auch die von den Medien bloßgestellte Ehebrecherin Charlotte, die als reumütige Sünderin letztlich alles gestehen und an die Seite ihres betrogenen Ehemanns zurückkehren würde.
Und sofern er nicht den letzten Rest politischen Kalküls in Selbstmitleid und Alkohol ertränkt hatte, würde er sie – wenn auch gekränkt – schließlich doch wieder in die Familie aufnehmen.
Die Vergebung war eine zutiefst christliche Tugend im Freistaat, und sie würde dem eigentlichen Verlierer den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg bringen.
Welch eine Schmierenkomödie. Es wurde ihm ganz schlecht bei dem Gedanken.
Er brauchte unbedingt etwas zu trinken. Auf dem Tisch standen Wasserflaschen, Säfte, Kaffee und Tee. Nein, nicht dieses fade Zeug. Die Würzburger rühmten sich doch für ihren Frankenwein. Er zitierte einen Kellner herbei und flüsterte ihm die Bestellung ins Ohr. Es sollte ein heller Wein in einem unauffälligen Glas sein, der sich farblich kaum von Wasser unterschied.
Als er sich jedoch in der Runde umblickte, fragte er sich, ob diese Vorsichtsmaßnahme nötig war.
Diese feisten Gesichter auf den dicken Hälsen achteten nicht auf ihn. Sie waren ganz mit sich und ihren leeren Reden beschäftigt.
Eine klare Wertordnung, Heimat für alle Bevölkerungsschichten und Kraft der Zukunft, so ging es von Mund zu Mund.
Glaubt ihr das wirklich?
Nein, das tut ihr nicht. Genauso wenig wie ich daran glaube oder jeder andere Mensch, der halbwegs seinen Verstand beisammen hat. Aber wir wissen alle, dass die Wähler eher eine schöne Lüge hören wollen als die unbequeme Wahrheit.
Auch das war ein Naturgesetz, und damit schloss sich der Kreis.
«…wie Werner schon bei seiner Rede in Vilshofen gesagt hat.»
Mit Werner war er gemeint – Shootingstar Werner Schwerdt. Hoffnungsträger der Partei, die sich nach einer Reihe von Skandalen, galoppierendem Vertrauensverlust und Abstrafung durch das Wahlvolk am Rande des politischen Ruins befand. Die Mehrheit war seit den letzten Wahlen dahin und die Zwangsjacke Koalition eine Zumutung.
Werner Schwerdt sollte nun den Karren aus dem Dreck ziehen. Er war der Mann der Umfragen. Sie bescheinigten ihm, das neue Gesicht der Partei zu sein – jung, zeitgemäß und begeisternd. Ein Spiegel der neuen Wähler- und Bevölkerungsschichten.
Bei der Nennung seines Namens nickte er zustimmend, heuchelte Begeisterung und lächelte selbst der Frauenfront auffordernd zu, die ihm direkt gegenübersaß.
Politik von Frauen, für Frauen und vor allem mit Frauen.
Um Himmels willen, wenn das der Alte hören müsste, er würde sich im Grab angewidert umdrehen. Diese Frauen hatten ihren naturgegebenen Platz verlassen.
Schwerdt seufzte. Wo blieb der Wein, den er bestellt hatte? Er schaute sich um. Weit und breit war niemand in Sicht außer dieser unerhört attraktiven jungen Frau, die mit kurzem Rock und sündhaft langen Beinen gerade den Kaisersaal betrat. Sie trug ein silbernes Tablett mit einem Glas darauf in den Händen und hielt genau auf ihn zu.
Durst war nicht das erste Gefühl, das ihn dabei überkam.
«Ihr Wasser, Herr Schwerdt», flüsterte sie und beugte sich zu ihm herab.
Sein Blick fiel auf ihre Bluse. Es war alles da, wofür sich das Risiko lohnen würde.
«Wie ist dein Name, schönes Kind?», fragte er.
Er liebte es, den Erwachsenen zu spielen, den reifen und erfahrenen Mann. Wenn sie darauf einging, war der Handel perfekt.
«Petra», antwortete sie. «Ich bin in der Ortsgruppe aktiv.»
Das war perfekt, nein, es war mehr als das, das war phänomenal. Sie war eine Nachwuchspolitikerin aus den eigenen Reihen, die in ihm den Macher, den Befehlshaber aller Parteisoldaten sah.
Er musste unweigerlich schmunzeln.
Wieso war es nicht immer so einfach…
«Lass uns in der Pause reden», sagte er. «Ich möchte noch etwas mit dir besprechen.»
Petra nickte. «Gerne, Herr Generalsekretär.» Dann zog sie sich zurück, leise und graziös.
Als sie den Saal verlassen hatte, wusste Schwerdt, dass dieses fade Wochenende doch noch einen versöhnlichen Abschluss finden würde.
Von gegenüber beobachtete ihn eine Frau. In ihrem Blick waren Abscheu und Hass vereint, sie hatte sich in Schwerdt nicht getäuscht. Er war genau das, was man ihm nachsagte. Ein verdammter Hurenbock. Sie versuchte den Widerwillen zu verdrängen und besann sich wieder auf ihre Professionalität.
Schwerdt war so leicht berechenbar.
Wenn es doch immer so einfach wäre.
3
Kriminalhauptkommissar Johannes Kilian erbrach sich am Rand eines Trimm-dich-Pfads im Gramschatzer Wald.
Die Anfälle von Übelkeit mit darauffolgendem Erbrechen kamen zwar nicht mehr so häufig wie in den vergangenen Wochen, nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, aber sie waren noch immer Bestandteil eines gewöhnlichen Tags.
«Das Magnesium schleicht sich nur langsam aus dem Körper», hatte ihm der Oberarzt verkündet. «Viel frische Luft und moderate Bewegung sollten Ihnen bald wieder ein halbwegs normales Leben ermöglichen. Ob Sie aber wieder der werden, der sie vor dem Unfall waren, kann ich Ihnen nicht versprechen. Dafür hat Ihr Körper zu viel einstecken müssen.»
Wie recht der Quacksalber hatte, dachte Kilian. Ein neuer Schwall kündigte sich an.
Nie im Leben zuvor hatte er sich so elend gefühlt. Manchmal dachte er, er wäre lieber gestorben, als dieses Martyrium noch einen Tag länger ertragen zu müssen.
«Es ist ohnehin ein Wunder, dass Sie das Feuer überlebt haben. Das Magnesium hat sich wie Säure durch Kleidung, Haut und Fleisch gefressen. Eigentlich habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir Sie noch retten können. Zwischen das Magnesium und Ihre Leber passte kein Blatt Papier mehr. Danken Sie Ihrem Schutzengel.»
Dann hatte er Kilian aufmunternd auf die Schulter geklopft, als rede er mit einem Halbwüchsigen.
«Lassen Sie es in der nächsten Zeit etwas langsamer angehen, und denken Sie daran: Nichts übertreiben. Der Erfolg kommt in kleinen Schritten. Also bis zum nächsten Mal.»
Kilian wischte sich den Speichel vom Mund. Von wegen, sagte er sich, so schnell wirst du mich nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Drei Monate andauernder Schmerz hatten eine überraschende Allergie gegen Menschen in weißen Kitteln ausgelöst. Wenn er seine Medikamente in der Apotheke abholte, erzeugte der Weißkittel vor ihm ein Unwohlsein, zuweilen ein leichtes Zittern. Es schien ihm unvorstellbar, je wieder ein Krankenhaus zu betreten.
Kilian richtete sich auf. Im Moment hatten er ein anderes Problem. Wo zum Teufel war er? Die Bäume sahen alle gleich aus. Nirgends ein Hinweisschild. Er hatte nicht den blassesten Schimmer, in welche Richtung er musste. Das Magnesium steckte in seinem Körper und sorgte dafür, dass er stellenweise hilflos wie ein Kind war.
So lief er einfach los. Die Wunde an seiner Leber schmerzte bei jedem Schritt. Sie war passabel verheilt, das Hautimplantat hielt zusammen, was es konnte, aber für richtigen Sport war es noch zu früh.
Kilian hielt sich die Wunde und trabte weiter. Langsam, und vor allem nicht hinfallen, hieß die Devise. Das hätte alles zunichtegemacht.
Gerade jetzt konnte er sich einen weiteren Krankenhausaufenthalt nicht erlauben. Seine Freundin Pia war im neunten Monat schwanger, der Geburtstermin in wenigen Tagen. Bis dahin durfte nichts mehr passieren. Wenn Pia niederkam, wollte er an ihrer Seite sein und den Neuankömmling in die Arme schließen. Das war das Ziel, auf das er hinarbeitete.
Drei Anhöhen und zwei Zwangspausen weiter meinte er, Polizeifahrzeuge zwischen den Bäumen zu erkennen.
Was machen die denn hier draußen?, fragte er sich. Außer Hasen und Rehen, gab es in diesem dichten Wald nichts zu entdecken beziehungsweise zu verfolgen. Er seufzte erleichtert. Sie würden ihn zumindest in die Zivilisation zurückbringen.
Als er sich den Einsatzfahrzeugen näherte, sah er eine Waldhütte. Wusste man nicht, dass es sie an dieser Stelle gab, niemand würde sie finden.
Auf den letzten Metern musste er dichtes Unterholz überwinden. Absperrband und Einsatzfahrzeuge wären nicht nötig gewesen, hier gab es keine Neugierigen.
«Was macht ihr denn hier draußen?», fragte Kilian den erstbesten Kollegen.
«Kilian?», antwortete er. «Gute Frage. Was machst du hier?»
«Hab mich verlaufen. Ein Glück, dass ich euch gefunden habe.» Er hielt sich die Seite. Den Weg durchs Unterholz hätte er sich besser erspart.
«Ist was mit dir?» Er wollte ihm zu Hilfe kommen, doch Kilian wehrte ab.
«Schon okay. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe.»
«Kein Wunder, bei dem, was du erlebt hast. Ich war damals am Einsatzort dabei, und ehrlich, ich dachte nicht, dass ihr da lebend wieder rauskommt. Ihr müsst einen guten Schutzengel haben.»
Mit ihr meinte er ihn und seinen Kollegen Schorsch Heinlein. Der hatte mehr Glück gehabt als Kilian, da er dem sich rasant entzündenden Magnesium nicht zu nahe gekommen war. Das gleißende Licht hatte ihn zwar für ein paar Tage geblendet, aber ansonsten war er heil aus der Sache rausgekommen.
Tag für Tag, Woche um Woche war Heinlein an sein Krankenbett gekommen, hatte stundenlang dort gesessen und mit ihm die Schmerzen ertragen. Manchmal war es ihm vorgekommen, als hätte Heinlein geweint – leise, bitter und vorwurfsvoll. So hatte er ihn noch nie erlebt. Was war nur mit ihm geschehen? Er hatte ihn nie danach gefragt.
«Was ist passiert?», fragte Kilian und deutete auf die Hütte.
Schuler winkte angewidert ab. «Irgend so ein Psychomist. Die Leiche ist völlig skelettiert. Muss wohl schon länger hier liegen. War ein Festmahl für die Ratten und das Geziefer. Kein Stück Haut haben sie übrig gelassen.»
«Wer ist an dem Fall dran?»
«Der Schorsch natürlich.»
Kilian wandte sich ab, um die Hütte zu betreten. Schuler hielt ihn zurück.
«Warte, Kilian.» Er seufzte. «Sei vorsichtig, was du sagst. Der Schorsch ist nicht gut drauf.»
«Was meinst du?»
Statt einer Antwort, erhielt er ein eindeutiges Zeichen.
Irgendwie plemplem.
Er würde damit klarkommen, versicherte er und öffnete die Tür. Auf den ersten Blick war alles so wie immer. Ein ganz normaler Tatort – viel zu viele Menschen in einem winzigen Raum, die alle nach den Tatumständen forschten und dabei Spuren verwischten.
Die Kollegen vom Erkennungsdienst in ihren weißen Overalls lösten einen ersten Schub Unwohlsein aus. Er mied den Kontakt mit ihnen. Drüben auf der Eckbank befragte der Kollege Schneider vermutlich den Besitzer der Hütte.
Aus dem Durchgang zu einem hinteren Zimmer hörte er eine vertraute Stimme. War das etwa Pia, seine hochschwangere Freundin? Wenn sie es in ihrem Zustand erneut gewagt hatte, einen Tatort aufzusuchen, dann gab es Ärger.
Über eine Badewanne gebeugt fand er sie vor. Ihr dicker Bauch hielt sie davon ab, der Leiche noch näher zu kommen.
Welche Leiche?, fragte er sich im selben Augenblick. Er sah nur eine bis zum Rand gefüllte Badewanne, die einen seltsam seifigen Geruch verströmte.
Neben Pia stand Heinlein, die Hände über der Brust verschränkt und sichtbar verstimmt.
«Das darf doch nicht wahr sein», polterte Kilian, als er den kleinen Raum betrat. «Hatten wir nicht vereinbart, dass du bis auf weiteres Tatorten fernbleibst?»
Pia reagierte nicht darauf. Heinlein hingegen zeigte sich von Kilians unerwartetem Erscheinen überrascht. Er pflichtete ihm dennoch bei. «Ich hab’s ihr gesagt. Aber sie will einfach nicht auf mich hören.»
«Stellt euch nicht so an», antwortete Pia, die ahnte, dass sie jetzt Ärger erwartete. «Frauen wissen, wann es so weit ist. Aber was machst du überhaupt hier?»
Kilian ging nicht darauf ein. «Wieso hat Karl das nicht übernommen?»
«Karl ist im Urlaub», erwiderte Heinlein.
«Dann holt euch Verstärkung aus Nürnberg. Das darf doch nicht wahr sein. Eine hochschwangere Frau quer durch den Wald schleppen und sie an einer mit Ungeziefer verseuchten Leiche arbeiten lassen.»
Von einer Leiche konnte jedoch nicht die Rede sein. Die Badewanne war bis zum Rand mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt. Was sich darin befand, entzog sich dem Auge.
Pia erhob sich. «Haltet mal beide die Luft an!»
Sie stützte die Hände in die Seite und streckte den Rücken, sodass ihr Bauch nun richtig hervorquoll.
«Kinderkriegen ist und bleibt Frauensache. Ihr Kerle könnt so lange auf ein Bier gehen, so wie ihr es immer macht, wenn Arbeit ansteht. Habt ihr das nun verstanden?»
Heinlein schien die uneinsichtige Haltung von seiner Frau Claudia gewohnt zu sein. «Wenn du es so willst. Es ist dein Kind.»
«Und meines», widersprach Kilian. Er machte einen Schritt auf Pia zu, wollte sie vom Tatort wegführen.
«Lass mich», setzte sich Pia zur Wehr.
«Komm jetzt her!» Abermals befreite sich Pia aus seinem Griff.
«Wenn hier einer nichts zu suchen hat, dann bist es wohl du», antwortete sie. «Du solltest im Bett liegen und dich erholen.»
Heinlein stimmte zu. «Da hat sie recht. Der Arzt…»
«Du hältst dich da raus», schnitt Kilian ihm das Wort ab. «Das ist ’ne Sache zwischen uns beiden.»
Heinlein hob beschwichtigend die Hände. «Wenn du meinst.»
Schneider, der sich wohlweislich im Durchgang zurückgehalten hatte, meinte mit seiner Frage den passenden Augenblick gewählt zu haben.
«Der Besitzer der Hütte will…»
«Raus hier!», blaffte Heinlein ihn unvermittelt an.
Schneider, selten um ein Wort verlegen, verdrückte sich stillschweigend.
Kilian und Pia schauten sich fragend an. Wieso reagierte Heinlein so barsch? Das war überhaupt nicht seine Art.
«Schorsch», fragte Kilian, «wo liegt das Problem?»
Als lebten zwei Seelen in Heinleins Brust, antwortete er ruhig. «Können wir nun endlich weitermachen?» Er wedelte sich Luft zu. «Es ist verdammt heiß hier drin. Findet ihr nicht auch?»
«Das hat auch einen Grund», sagte Pia.
Auf Kilians Arm gestützt, ging sie auf die Knie und zeigte auf einen Heizstrahler, der unter der Badewanne angebracht war. «Eine ungewöhnliche, aber dennoch effektive Methode, um das Badewasser warm zu halten.»
«Für meinen Geschmack etwas zu warm», erwiderte Heinlein. «Das muss doch ein Vermögen an Strom kosten.»
«Das dürfte den Mörder nicht interessiert haben. Es ging ihm allein darum, die Wassertemperatur dauerhaft konstant zu halten.»
«Wieso das?», fragte Kilian.
«Wenn es das ist, wonach es aussieht», antwortete Pia und erhob sich, «dann habt ihr es hier mit einem wirklich kreativen Mörder zu tun.»
Sie nahm einen Kugelschreiber zur Hand, führte ihn unter die Wasseroberfläche und zog ihn langsam wieder heraus. Mit ihm kam ein völlig skelettierter Schädel zum Vorschein.
«Der Rest schaut genauso aus», sagte Pia. «Fein säuberlich von allem Gewebe befreit, genau so, wie wir es in der Gerichtsmedizin machen, wenn wir Exponate erstellen.»
Kilian konnte ihr nicht folgen. «Warte, nicht so schnell. Was macht ihr in der Gerichtsmedizin mit Leichenteilen?»
«Wir legen sie in handelsübliches Waschpulver, geben Wasser hinzu und sorgen dafür, dass die Wassertemperatur konstant bei etwa sechzig Grad bleibt. Nach gut einer Woche ist der Knochen komplett und vor allem sauber von dem ihn umgebenden Gewebe befreit.»
«Das ist doch nicht dein Ernst?»
«Nichts löst Fleisch und Sehnen besser vom Knochen als Waschpulver. Übrig bleibt ein Seife-Gewebe-Gemisch, das du getrost die Toilette hinunterspülen kannst. Was glaubst du denn, wieso die Hersteller von Waschmitteln damit werben, dass sie selbst Blut aus den Klamotten herausbekommen? Es sind die zugesetzten Enzyme, die das Gewebe auflösen. Nebenbei bemerkt, es sind die gleichen, die sich in deinem Verdauungssystem befinden. Ansonsten könntest du keine Nahrung verwerten und würdest mit vollem Bauch verhungern.»
«Und wieso muss das gerade bei sechzig Grad geschehen?», fragte Heinlein.
Pia schaute ihn ungläubig an. «Bei dir zu Hause ist wohl Claudia für die Wäsche zuständig?»
Heinlein nickte. «Ja, wieso nicht?»
«Wenn ihr Kerle euch nur einmal an der Hausarbeit beteiligen würdet, dann wüsstet ihr, dass bestimmte chemische Prozesse nur bei einer gewissen Temperatur ablaufen. So zum Beispiel beim Wäschewaschen. Das Wasser muss warm bis heiß sein, damit die Enzyme ihre Arbeit leisten können. Bei sechzig Grad fühlen sie sich pudelwohl. Deine Claudia weiß das.»
«Dann sollte ich sie vielleicht in die Ermittlung mit einbeziehen?», giftete Heinlein.
«Könnte nicht schaden, Einstein.»
«Beruhigt euch wieder», ging Kilian dazwischen. Was war nur mit den beiden los? Bei Pia hatte er ja ein Einsehen, ihre Nerven schlugen in der Schwangerschaft Purzelbäume, aber was war mit Heinlein geschehen? Er wirkte gereizt.
«Wer weiß von dieser Methode, Gewebe vom Knochen zu lösen?»
«Rechtsmediziner, Ärzte, Chemiker, Biologen… eigentlich jeder, der ein wenig Ahnung von biochemischen Vorgängen hat. Wie gesagt, es steht ja groß und breit auf jeder Waschmittelverpackung.»
«Es ist dennoch eine ungewöhnliche Art, eine Leiche verschwinden zu lassen», sagte Heinlein. «Kannst du etwas zum Todeszeitpunkt sagen?»
«Ich weiß ja noch nicht einmal, woran sie gestorben ist.»
«Es handelt sich also um eine Frau?»
«Ja, und wie ich auf den ersten Blick vermute, um eine junge. Nicht älter als dreißig. Sofern sie gleich nach dem Tod in die Waschlauge gelegt worden ist, könnte eigentlich alles in Frage kommen. Gift, Erwürgen oder ein Messer. Gewaltanwendung, die sich auf die Knochen ausgewirkt hat, scheidet aus. Das Projektil einer möglichen Schusswaffe müsste demnach alle Knochen verfehlt haben. Sie ist makellos. Ein optimales Exponat.»
«Gibt es irgendwelche Hinweise, wer sie ist?»
«Da fragst du besser die Jungs vom Erkennungsdienst. Ich habe nichts gefunden.»
«Keine Kleidungsstücke, Ausweispapiere, Schlüssel… irgendetwas Persönliches?»
Pia verneinte. «Ich werde den Gebissstatus aufnehmen, und dann sehen wir weiter.»
«Gut», sagte Heinlein, «dann wollen wir mal hören, was der Besitzer der Hütte zu sagen hat.»
Er wandte sich ab, in der Erwartung, Kilian würde ihm folgen. Doch der war mit Pia noch nicht fertig.
«Geh schon mal vor.»
«Lass mich in Ruhe arbeiten», widersprach Pia. «Alles Weitere heute Abend.»
«Ich will aber jetzt mit dir sprechen.»
Heinlein zog ihn mit sich. «Frauen haben ihren eigenen Kopf. Das wirst du noch lernen müssen.»
In der Wohnstube trafen sie auf Schneider. Er hatte die Befragung des Besitzers der Hütte abgeschlossen.
«Nun, Schneider, was hat der Zeuge ausgesagt?», fragte Heinlein, als sei nichts gewesen.
«Dass er das letzte Mal vor drei Wochen in der Hütte war», antwortete er. «In der Zwischenzeit sei die Hütte nicht vermietet gewesen.»
«Er vermietet sie?» Heinlein fuhr sich nachdenklich durch die Haare. «Das erweitert den Kreis der Personen, die Zugang zur Hütte hatten. Andererseits dürfte es nicht schwer sein, sie zu ermitteln. Was denkst du, Kilian?»
Der war mit seinen Gedanken noch bei Pia.
«Ja, sicher. Ein guter Ansatz. Irgendwelche Einbruchsspuren?»
Schneider verneinte.
«Dann legt mal los.»
Heinlein und Schneider machten sich auf den Weg. Kilian war unschlüssig, ob er noch auf Pia warten sollte.
Heinlein erriet, was ihn beschäftigte.
«Komm, ich nehm dich in die Stadt mit.»
«Nicht nötig. Ich…»
«Keine Widerrede. Du bist Privatier und hast an einem Tatort nichts verloren. Außerdem solltest du einer Schwangeren nicht widersprechen. Völlig sinnlos. Hormonell bedingt. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche.»
Der Weg zurück in die Stadt verlief durch den dunklen Gramschatzer Wald mit seinen vielen Wegen und Abzweigungen. Jetzt erst wurde Kilian klar, dass er große Probleme gehabt hätte, allein zurückzufinden.
«Was machst du eigentlich hier draußen?», wollte Heinlein wissen.
«Zerstreuung und Ablenkung. Ein bisschen Bewegung kann auch nicht schaden.»
«Solltest du es laut deinem Arzt nicht ein wenig langsamer angehen? Ich meine, was ist gegen eine gepflegte Partie Schach im Park einzuwenden?»
«Dafür ist Zeit, wenn ich pensioniert bin.»
«Das kommt schneller, als man denkt.»
«Was meinst du damit?»
Heinlein ließ die Frage unbeantwortet, und Kilian dachte, dass ein guter Zeitpunkt gekommen wäre, ihn nach seiner auffälligen Reizbarkeit zu fragen. «Wie läuft’s bei dir so?»
«Gut. Und bei dir?»
«Lass uns mal einen Moment bei dir bleiben. Alles okay zu Hause?»
«Sicher. Was sollte sein?»
«Ich habe den Eindruck, dass dich etwas beschäftigt.»
«Wie kommst du darauf?»
«So wie du Schneider zusammengestaucht hast. Das kenne ich gar nicht von dir.»
«Falscher Zeitpunkt. Nichts weiter.»
Die Autobahnzufahrt tauchte vor ihnen auf, und Heinlein drückte aufs Gas. Er blinkte nicht, schaute weder in den Rückspiegel noch zur Seite. Ein heranrauschender Zwanzigtonner musste abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Er machte seinem Ärger mit allen Hupen und Lichtern Luft, die er besaß.
Kilian glaubte, sein Herz würde stehenbleiben, so knapp waren sie einem Zusammenstoß entkommen.
«Was war das denn gerade?!»
Heinlein, unbeeindruckt und seelenruhig, zog auf die Überholspur.
«Viel Lärm um nichts. Da war genug Platz für uns beide.»
«Blödsinn. Du hättest uns fast umgebracht.»
Heinlein lächelte, aber seine Hände zitterten.
4
Die Vorstellung, dass der Stress der Arbeit und des Lebens bis ins Rentenalter andauern sollte, befremdete Hilde Michalik. Irgendwann musste doch einmal Schluss sein, und das würde am Tag der Wahl sein. Dann wäre alles vorbei, und sie könnte getrost den Schreibtisch für ihre Nachfolgerin räumen. Nach einem ausgedehnten Urlaub auf Mallorca, dem Besuch der Freunde in der alten Heimat in Schlesien würde sie endlich den Jakobsweg beschreiten können. Darauf freute sie sich. Zeit hatte sie ja dann genug.
Über vierzig Jahre hatte sie sich in den Dienst der Partei gestellt, war mit den großen und kleinen Führern auf Du und Du gestanden und hatte für jedes Problem ein Ohr. Das hatte ihr den Beinamen Tante Hilde eingebracht. Tante Hilde war die Seele der Partei. Wer sie nicht kannte, war weit vom Herzen der Partei entfernt. In ihrem Büro liefen viele der unsichtbaren Fäden zusammen, die von den Orts- und Kreisgruppen über München bis nach Berlin gespannt waren. Niemand zog an einem dieser Fäden, ohne dass sie davon Wind bekam.
Das war wohl auch der Grund, wieso die frühere Staatsministerin Ute Mayer nicht auf ihre Dienste verzichten wollte. Sie waren beide ein weites Stück zusammen gegangen, bis vor drei Jahren Ute Mayers überraschende Entlassung die Würzburger Gruppe ins Hintertreffen brachte.
Die altbayerischen Parteifreunde zogen die Demarkationslinie neu, so wie sie bereits zu Zeiten der alten Parteibonzen Gültigkeit besessen hatte.
Kein fränkischer Minister und schon gar nicht eine Ministerin sollten je wieder am Kabinettstisch der Staatskanzlei sitzen.
«Ich bin dann so weit», sagte Ute Mayer.
Sie stand abreisebereit vor dem Schreibtisch von Tante Hilde und wartete auf letzte Instruktionen.
«Zwanzig Uhr Essen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Biogas AG im Aquarello», antwortete Hilde mit Blick auf den Terminkalender. «Anschließend musst du dir den Gesetzentwurf noch einmal genauer ansehen, bevor du ihn morgen an Schwerdt weiterleitest. Sein Assistent macht Druck.»
Ute Mayer nickte. «Ist klar. Wann treffe ich Hofmeister vom Haushaltsausschuss?»
Hilde blätterte einen Tag weiter. «Um neun Uhr dreißig, und vergiss nicht: Seine Tochter hat das Abi im dritten Anlauf nun doch noch geschafft. Er ist stolz wie Oskar.»
«Stimmt», antwortete Ute Mayer ärgerlich, «das habe ich ganz vergessen. Was schlägst du vor?»
«Ich habe ein wenig rumtelefoniert und einen Platz im Austauschprogramm der Universität von Florida ergattert. Die Kleine soll ganz wild auf den Spring Break sein, oder wie sie dieses Saufgelage bezeichnen. Ich denke, sie wird dich dafür für immer ins Herz schließen. Nicht zu vergessen der Papa. Damit hat er seinen missratenen Sprössling endlich aus der Schusslinie gebracht.»
Ute Mayer seufzte erleichtert. «Perfekt. Was würde ich nur ohne dich machen?»
Hilde blickte auf und lächelte. «Gewöhn dich schon mal dran. Bald wirst du allein beweisen müssen, was für ein Kerl in dir steckt.»
«Der Himmel bewahre mich davor.»
Sie nahm den Aktenkoffer in die Hand. «Dann bis übermorgen. Wenn was ist…»
«Ich weiß, wo und wie ich dich erreichen kann. Und jetzt los. Das Taxi wartet.»
Ute Mayer gut präpariert auf die Reise zu schicken, zählte heute zum letzten Aufgabenpunkt. Dann war ihr Tagwerk vollbracht. Hilde würde eine Stunde früher Schluss machen und nach dem Grab schauen, ob alles in Ordnung war.
Sie gab den Pflanzen Wasser, schaltete den Computer aus und ließ das ungeliebte Handy in die Handtasche gleiten. Jeder musste heutzutage jederzeit erreichbar sein. Vernetzt, nannten sie es. So ein Unsinn. Als wäre die Welt deswegen eine andere.
Der Bus ließ nicht lange auf sich warten und setzte sie mit einer Handvoll Grauköpfe am Hauptfriedhof ab. Eine weiße Lilie mit etwas Zierwerk war im nahen Blumenladen schnell erstanden.
Dada hatte weiße Lilien geliebt. Einmal im Monat wünschte er sich eine frische Lilie auf sein Grab. Das war seine einzige Bitte in der Stunde des Todes gewesen. Hildes Mutter war der Bitte bis zu ihrem Tod gefolgt. Seit dreiundzwanzig Jahren war nun sie die Blumenbotin und Grabpflegerin, und mit ihr würde das Ritual sterben, sofern sie nicht eine würdige Nachfolgerin fand.
Das Grab war in gutem Zustand. Hilde musste außer ein paar verdorrten Blumen nichts richten. Sie wechselte das Wasser, steckte die Lilie hinein und gedachte für ein paar Minuten der Zeit, die sie mit Dada hatte verbringen dürfen.
Im Frühjahr 1945 war sie mit ihren Eltern ins bombenzerstörte Würzburg gekommen. Nach ihrer überstürzten Flucht aus dem schlesischen Hermsdorf, das die Polen nach der Vertreibung der verhassten Deutschen wieder in Sobięcin umbenannt hatten, war der Traum von einer guten Zukunft in einer sicheren Heimat endgültig vorbei.
Mittellos und ausgehungert saßen sie wie alle Würzburger in den Trümmern eines wahnsinnigen Kriegs fest.