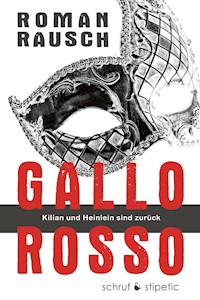7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Im Verborgenen blüht die Rache. Im Morast eines Kanals findet die Hamburger Polizei eine menschliche Hand. Wie sich herausstellt, gehört sie einem Mann, der grausam zu Tode geprügelt wurde. Die Tatwaffe: kurze, biegsame Stöcke. Wenig später taucht eine weitere Leiche mit den gleichen Folterspuren auf. Profiler Balthasar Levy entwickelt ein erschreckendes Szenario: Hier war kein gewöhnlicher Mörder am Werk, sondern ein selbsternannter Richter. Und dieser Richter kennt nur ein Urteil – die Todesstrafe. «Levy hat alle Voraussetzungen zur Kultfigur.» (Nürnberger Nachrichten)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Ähnliche
Roman Rausch
Weiß wie der Tod
Thriller
Das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren,
und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus,
die in ihnen waren; und sie wurden gerichtet,
ein jeder nach seinen Werken.
Offenbarung 20,13
Prolog
Wie lautet das Passwort?»
Der Mann, der zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte lediglich als Holger M. bekannt war, kniete in einem Gemisch aus Blut und Urin. Er hustete und spuckte zähe Speichelfäden auf den blanken Betonboden. Ein Tritt gegen den Kopf ließ ihn zur Seite kippen. Selbst in dieser ausweglosen Lage wollte er einen letzten Rest Dominanz bewahren und setzte auf Häme. «Mehr hast du nicht von mir gelernt?»
Sein bemühtes Grinsen wirkte bizarr. Er blickte auf, blinzelte gegen das grelle Licht der Deckenbeleuchtung an. Sein Peiniger saß am Tisch. Vor ihm der Computer. Der Cursor blinkte vor dem weißen Hintergrund des Monitors. Dahinter verbarg sich das versteckte Laufwerk.
Er würde sein Geheimnis mit ins Grab nehmen, dessen war er sich sicher.
***
«Das Passwort!»
An Händen und Füßen zusammengezurrt, kauerte Holger M. in einer dunklen Ecke des Kellers. Er weigerte sich noch immer, das Passwort zu nennen. Dann wäre sein Leben nichts mehr wert. Aus dem Licht kam eine Hand auf ihn zu. Er zuckte zusammen, suchte Schutz vor der nächsten Attacke.
Die kleine Gewürzflasche entließ nur einen Tropfen, der auf seine nackte Schulter fiel. Holger M. drückte sich noch weiter in die Ecke, zitternd vor Furcht, was passieren würde, wenn der Tropfen eine der klaffenden Wunden auf seinem Rücken erreichte.
Ein gellender Schrei. Die Flüssigkeit war ins offene Fleisch gelangt.
***
«Passwort!»
Halb besinnungslos stöhnte Holger M. am Boden. Sein Kopf lag auf dem Metallgitter, das inmitten des Raums in den Beton eingelassen war. Durch das angeschwollene Auge konnte er schemenhaft die Gestalt erkennen, die mit einer Bohrmaschine auf ihn zukam. Der Bohrer heulte auf.
Ein Fuß stemmte sich auf seinen Hals und drückte ihn für die bevorstehende Operation fest nach unten.
«Warte», flehte er angesichts des rotierenden Bohrers über seinem Gesicht.
Die Bohrmaschine verharrte in ihrer Position.
«Valerie… 9… x… 5768.»
***
Der Ordner Kontakte öffnete sich. Ein Klick auf die erste Datei. Der aufgezeichnete Messenger-Dialog füllte den Bildschirm.
Sweet16: Wie siehst du aus? ;-)
Loverboy: Ist das wichtig?
Sweet16: Wär ’n Anfang.
Loverboy: Wie hättest du mich denn gern?
Sweet16: Jetzt sag schon.
Loverboy: Du wirst es mir nicht glauben.
Sweet16: Bitte…
Loverboy: OK, du hast es so gewollt ;-)) Stell dir Brad Pitt in Rendezvous mit Joe Black vor.
Sweet16: Ha-ha.
Loverboy: Niemand glaubt mir, solange er mich nicht gesehen hat ;-) Im Ernst, eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen.
Sweet16: Schick mir ein Bild von dir.
Loverboy: Was würde das beweisen?
Sweet16: Stimmt auch wieder.
Loverboy: Finde es doch heraus.
Sweet16: Was?
Loverboy: Wie ich aussehe.
Sweet16: Ich weiß nicht… und wenn du ein durchgeknallter Psycho bist?
Loverboy: Dann gehst du einfach wieder.
Sweet16: Hm, lass mich nachdenken.
Loverboy: Lass dir Zeit. Ich träum so lange von dir.
Sweet16: Du weißt doch auch nicht, wie ich aussehe.
Loverboy: Ich fühle dich. Das reicht.
Sweet16: Ein Poet? Schwärm.
Loverboy: Don’t be so quick to walk away. Dance with me. I wanna rock your body.
Sweet16: Du magst Justin? Schmelz.
Loverboy: Ich habe 2Karten fürs Konzert am 12.
Sweet16: Seit Wochen ausverkauft. Du lügst.
Loverboy: Hier in meiner Hand. Ich schwör’s.
Sweet16: Verkaufst du eine? Zahle jeden Preis.
Loverboy: Was sagen deine Eltern dazu?
Sweet16: Die müssen nicht alles wissen.
Loverboy: Bist du alt genug? Es gibt Kontrollen am Eingang.
Sweet16: Ich leih mir den Perso von meiner Schwester. Und du kannst Daddy spielen.
Loverboy: CU morgen, 3Uhr, vorm Siouxsie’s.
Noch bevor die nächste Datei geöffnet wurde, meldete der Messenger eine eingehende Nachricht.
LordofLust: Ist der Job erledigt?
Zögern. Dann ein Klick auf Antwort. Der Cursor blinkte für die Eingabe.
Darkman: OK.
LordofLust: Gut. Ich habe ein neues Ziel im Auge.
1
Ein Jahr später. Hamburg, Strafjustizgebäude.
Antje drohte ein gemeines Miststück zu werden.
Hinterlistiger und verheerender, als es Katrina in New Orleans gewesen war. So fürchteten es zumindest die Meteorologen. Gemächlich wie ein fettes, bösartiges altes Weib hielt Antje auf die deutsche Nordseeküste zu. Ihre Ausläufer hatten die Nacht zuvor die Shetland-Inseln gestreift und gewaltige Sturmfluten an die zerrissenen Küsten geworfen. Das genaue Ausmaß der Schäden war in den frühen Morgenstunden noch nicht absehbar, da alle Nachrichtenkanäle auf den Inseln zusammengebrochen waren. Sicher stand bis zu diesem Zeitpunkt lediglich fest, dass eine Fähre, von Tórshavn auf den Färöer-Inseln kommend, nicht mehr über Radar und GPS zu orten war. Auch der Zielhafen Lerwick sendete keine Antwort mehr.
Antjes ältere, aber kleinere Schwestern Almuth und Amelie hatten in den Tagen zuvor der Norddeutschen Tiefebene viel Regen und Überschwemmungen beschert. Zusammen mit den Schmelzwassern der Elbe und ihren zahlreichen Zuflüssen drohte Hamburg nun Gefahr von zwei Seiten. Die südöstlich der Hansestadt gelegene Staustufe Geesthacht war die letzte Bastion gegen die vordringenden Wassermassen.
Während der Katastrophenschutz alle Kräfte mobilisierte, blickte Balthasar Levy teilnahmslos aus dem Fenster des Strafjustizgebäudes am Sievekingplatz. Der Regen hämmerte wütend gegen die Scheiben und ließ vor Levys geistigem Auge ein Zerrbild vergangener Ereignisse Revue passieren.
Seitdem sein Bruder Frank de Meer vor fünf Monaten aus dem Koma erwacht war, hatten sich die Dämonen wieder in Levys Kopf ausgebreitet. Die Schreie seiner Eltern hallten in seinen Ohren wider, er hatte ihre panischen Gesichter vor Augen, als sie von der Feuerwalze zerfressen wurden. Der beißende Gestank von Benzin und schmorendem Fleisch schien in seiner Nase für immer festzusitzen.
Frank, der für den Tod der Eltern verantwortlich war und in den letzten Jahren weitere unschuldige Menschen grauenvoll ermordet hatte, stand nun vor Gericht. Der Prozess war auf wenige Verhandlungstage angelegt, und das Urteil konnte auf nichts anderes als eine lebenslange Freiheitsstrafe lauten.
Doch das genügte Levy nicht. Er wusste, dass er sich niemals dem Einfluss seines Bruders würde entziehen können, solange dieser noch am Leben war. Nur dieses eine Mal wünschte er sich die Todesstrafe. Sie sollte beenden, was niemals hätte sein dürfen.
«Herr Levy!», drang es barsch an sein Ohr. «Hören Sie denn nicht?»
Levy drehte sich um. «Wie bitte?»
«Ich habe Sie bereits mehrfach aufgerufen», antwortete der Gerichtsdiener.
«Entschuldigen Sie. Ich war in Gedanken.»
«Der Richter wartet. Kommen Sie endlich.»
Levy nickte und folgte dem hastig zur Tür eilenden Mann.
Das Schwurgericht stand unter Vorsitz von Richter Jens Windhoek, einem distinguierten Endsechziger, dem Levy in einer anderen Verhandlung zu einer Mordserie bereits begegnet war. An seiner Seite die beiden Beisitzer und die zwei Schöffen, im hinteren Teil des Saales vollbesetzte Reihen mit Angehörigen und Neugierigen.
«Setzen Sie sich», wies Windhoek Levy an.
Levy ging die wenigen Schritte auf den ihm vertrauten Zeugenplatz zu – nur dieses Mal nicht in der Rolle des Gutachters, sondern als Zeuge im Prozess gegen seinen Bruder. Er schenkte Frank, der zu seiner Linken auf der Anklagebank saß, keinerlei Aufmerksamkeit. Dennoch spürte er dessen Anwesenheit – aufdringlich, verletzend, mächtig.
Windhoek stöberte in den Akten, bis er die entsprechende Seite gefunden hatte. «Auch wenn Sie dem Gericht bekannt sind, in einem meiner Verfahren sogar als Gutachter, so machen es die Umstände erforderlich, noch einmal Ihre Personalien aufzunehmen. Sie sind nach vorliegender Aktenlage als Ruben de Meer 1962 in Emmen, Holland, geboren. Nach dem Tod Ihrer Eltern erfolgte die Einweisung ins Waisenhaus und die spätere Adoption durch die Familie Levy…»
Ein blecherner, zerrissener Ton schnitt Windhoek das Wort ab. Er schaute von seiner Akte auf und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Frank wollte sich zu den Ausführungen des Richters äußern. Er tat dies mit Hilfe eines Gerätes, das an seinem Kehlkopf angebracht war. Der Schuss, der Levy damals das Leben gerettet hatte, war Frank am Hals eingedrungen und hatte seine Stimmbänder verletzt.
Da war er wieder, sein Bruder. Frank blickte ihm geradewegs in die Augen, und Levy spürte eine beunruhigende Furcht in sich aufsteigen.
2
Es war nicht leicht gewesen, das Nikolaifleet über die Schleuse an der Hohen Brücke trockenzulegen. Das Wasser im Zollkanal, wie in der gesamten Speicherstadt, stand mehrere Meter über Normalnull, Tendenz steigend. Doch die Suche nach der kleinen Leonie ließ keine andere Entscheidung zu, zumal ein Augenzeuge sie zuletzt in einem Fleetgang in der Deichstraße gesehen haben wollte. Polizisten und Feuerwehrleute waren knietief durch den modrigen braunen Schlamm gestapft, um die kleine Ausreißerin zu finden. Wie sich zeigte, ergebnislos.
Nicht ganz, denn einen unerwarteten Fund konnten sie verbuchen. Was anfänglich nach einem knorrigen Ast ausgesehen hatte, der sich aus dem Morast erhob, wusch der Regen zu einer menschlichen Hand frei. Nicht die von Leonie, sondern die eines noch unbekannten Mannes, dessen restlicher Leib im Morast verschwunden blieb.
Ringsum in den schmalen und hohen Fleetfronten der Außendeichhäuser standen die Menschen an den Fenstern, um die Polizei bei ihrer Arbeit zu beobachten. Der Regen prasselte auf das weiße Zeltdach, das um die Fundstelle aufgebaut war. Darunter befreite der Rechtsmediziner Dragan Milanovic den Toten vom Schlamm. Er musste vorsichtig vorgehen, da sich die Oberhaut an der Leiche bereits gelöst hatte.
Zum Vorschein kam ein nackter, aufgedunsener männlicher Körper, der beträchtliche Verletzungen aufwies. Auffällig waren die sichelförmigen und scharfkantigen Einschnitte im Fleisch. Daneben und über den ganzen Oberkörper verteilt Schlagverletzungen, genauer: zahlreiche parallel verlaufende, streifenförmige Blutungslinien, die durch einen schmalen Streifen unbeschädigter Haut getrennt waren. An einigen Stellen war die Haut aufgeplatzt. Darunter die ergraute Fettschicht.
An Milanovic’ Seite verfolgten Kriminalhauptkommissarin Hortensia Michaelis und Kriminalobermeisterin Naima Hassiri den Vorgang mit gespannter Ungeduld. Wie befürchtet, zeigte auch dieses Opfer die bekannten Spuren.
«Was meinst du?», fragte Michaelis Milanovic.
«Einen Moment noch.»
An Füßen und Händen zeigte sich Waschhaut – eine runzlige Aufquellung der Haut infolge der Wassereinlagerung im Gewebe. Die Totenstarre war bereits gelöst. Totenflecken waren an den Unterarmen und Unterschenkeln nur spärlich ausgeprägt, ein Zeichen dafür, dass die Leiche in Bauchlage getrieben haben musste. Die Hornhaut der Augen war trüb, eine Feststellung der Augenfarbe war nicht mehr möglich.
«Also», begann Milanovic, «der Körper lag vermutlich nicht länger als zehn bis zwölf Tage im Wasser. Der Mann war bereits tot, als er ins Wasser gelangte. Anzeichen des Ertrinkens sind nicht feststellbar. Die Hämatome an den Schlagverletzungen sehen alle gleich aus. Es ist wenig wahrscheinlich, dass sie postmortal zugefügt wurden.»
«Und was ist mit den großen Fleischwunden?», fragte Naima Hassiri.
«Sieht nach einer Schiffsschraube aus.»
«Das heißt», ergänzte Michaelis, «dass der Körper an der Wasseroberfläche geschwommen sein muss.»
Milanovic bestätigte. «Ja, aber nicht länger als drei bis vier Tage. Bei der Wassertemperatur hat sich die Bildung von Fäulnisgasen im Körper verlangsamt. Ich sehe keine Spuren einer Fixierung. Folglich trieb der Körper am siebten oder achten Tag vom Grund zur Oberfläche und hat dann Bekanntschaft mit einer Schiffsschraube gemacht.»
«Das Nikolaifleet scheidet folglich als Ablageort aus», folgerte Naima.
«Ist anzunehmen, wenngleich nicht ausgeschlossen. Der Körper kann bei der aktuellen Hochwasserlage und den Strömungsverhältnissen quasi im ganzen Hamburger Wassergebiet unterwegs gewesen sein, bevor er hier im Schlamm versunken ist.»
«Hast du einen Hinweis auf die Todesursache?», fragte Michaelis.
«Diese Art von Schlägen kann, wenn sie mit großer Wucht ausgeführt wird, schwere innere Verletzungen hervorrufen. Ansonsten vermag ich nichts zu erkennen, was auf eine andere Tötungsart hinweist.»
«Dann haben wir es wieder mit unserem Totschläger zu tun?», fragte Naima.
Milanovic zuckte die Schultern. «Das Verletzungsmuster ist bis auf die Verletzungen durch die Schiffsschraube ähnlich.»
«Danke», sagte Michaelis und beendete damit das Gespräch. Sie spannte den Regenschirm auf und verließ mit Naima das schützende Zelt. Über den schmalen Steg in der Deichstraße angekommen, gingen sie zum Parkplatz und stiegen ins Auto.
«Was schlägst du vor?», fragte Naima.
«Zwei Leichen mit gleichem Verletzungsmuster und eine Leiche in Einzelteilen», antwortete Michaelis. «Ich glaube, es ist Zeit für unseren Spezialisten.»
3
Auf den ersten Blick hätte Lili Waan eine ganz normale Sechzehnjährige aus der elften Klasse der Gesamtschule Wilhelmsburg sein können – ein feingliedriger Körper in schmal geschnittenen Jeans, enges T-Shirt, das ihre kleinen Brüste unterstrich, hennafarbene, lange Haare und ein Markenhandy in glitzerndem Pink am Ohr.
Der Teint ihrer Haut hingegen harmonierte nicht so recht mit den Schönheitsidealen von Sechzehnjährigen. Lili war auffallend hellhäutig, was durch die Sommersprossen noch akzentuiert wurde, die sich links und rechts der kleinen Nase allen Schminkversuchen zum Trotz behaupteten. Auf Lippenstift und Schmuck verzichtete sie gänzlich und betonte ihr zart wirkendes Gesicht lediglich dadurch, dass sie ihre Haarpracht zu einem Pferdeschwanz bündelte.
Und noch etwas passte nicht ins Bild eines Mädchens aus der elften Klasse: Lili sprach nicht über Jungs, Klamotten und Musik, sondern über den Förderunterricht, den sie in den Nachmittagsstunden mit den Achtklässern durchführen wollte. Dazu benötigte sie einen frischen Satz an Ölfarben, Pinsel, Malpapier und die Erlaubnis der Rektorin, den Raum der zehnten Klasse zu benutzen, von wo aus die Schüler einen ungehinderten Blick auf den Park hatten.
Lili Waan war eine der beiden Sozialpädagoginnen, die sich die Schule zur Stärkung der Sozialkompetenz ihrer Schüler leistete.
«Müssen es denn unbedingt diese teuren Ölfarben sein?», hörte Lili am Telefon die Rektorin seufzen, «Wachsmalkreiden tun es doch auch, und die sind wesentlich billiger.»
Lili kannte Einwände dieser Art. Bei der Vorstellung ihres Konzepts Malen wie die Meister war die Rektorin noch begeistert gewesen, doch als es an die Finanzierung der benötigten Utensilien ging, wurde aus der Gönnerin eine Buchhalterin.
Sie lächelte ins Telefon. «Van Goghs würden heute keine zwanzig Millionen wert sein, wenn sie mit Wachsmalstiften gemalt wären.»
«Es reicht, wenn Ihre Schüler ein halbwegs stimmiges Bild zustande bringen, das es wert ist, im Klassenraum aufgehängt zu werden.»
«Ich dachte mehr an die Aula. Das Motiv: Schule und Familie. Damit hätten wir wunderbares Anschauungsmaterial für die nächste Sitzung des Elternbeirats.»
Die Rektorin rang mit sich. Schließlich gab sie nach: «Nun gut, wenn es unbedingt sein muss… Passen Sie aber auf, dass alle Pinsel und Farbtuben am Ende der Stunde vollzählig sind, damit wir sie wiederverwenden können.»
Lili versprach es.
Im Klassenraum wurde sie von drei Jungen und sechs Mädchen empfangen. Erwartungsvoll schauten sie auf die Tasche, die Lili mitgebracht hatte. Pinsel, Farben und Malpapier, das sie bereits vor dem Gespräch mit der Rektorin gekauft hatte, schauten heraus. Sie ließ die Tasche herumgehen, und jeder nahm ein vorbereitetes Set an sich.
«Nachdem wir in der letzten Stunde das Zeichnen eines Entwurfs mit Kohlestiften geübt haben», begann Lili, «schreiten wir heute zur Königsdisziplin – dem Malen mit richtiger Profiausrüstung. Geht vorsichtig mit den Farben um. Sie sind sehr kräftig.»
Die Schüler öffneten die Sets in erwartungsvoller Vorfreude. «Ich möchte, dass ihr mit den Farben experimentiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr anstatt des Pinsels auch eure Finger verwenden. Spürt das Material, wie es sich anfühlt, mischt eine Farbe mit einer anderen zusammen und führt dann den Finger über das Papier.»
«Was sollen wir malen?», fragte ein Junge.
«Ihr könnt eure Entwürfe nehmen, oder lasst einfach eurer Phantasie freien Lauf. Schaut zum Fenster hinaus. Seht das Grauschwarz der Wolken, die kurz davor sind, sich zu entladen. Beobachtet den Wind, wie er die Bäume unter seiner Kraft bewegt. Die Natur ist ein dankbares Motiv, gerade jetzt, wenn es scheint, als käme die nächste Sintflut auf uns zu.»
«So wie bei Noah und der Arche?»
«Ja, oder wie bei Turner oder Friedrich. Spürt die Natur in euch und was euch damit verbindet. Los jetzt, nicht zu lange nachgedacht. Euer Gefühl ist gefragt.»
Einige der Schüler legten sofort los, andere folgten Lilis Rat und beobachteten das Treiben jenseits der schützenden Glasscheibe.
Lili nahm an einem der Tische Platz und ließ die Schüler arbeiten. Sie griff nach ihrem Handy und überprüfte es auf neue Nachrichten, so wie es auch ihre Schüler gern und oft taten.
Eine Viertelstunde verstrich, als ihr Nicole auffiel, eine frühreife Vierzehnjährige. Sie saß nah am Fenster in der Ecke, drei Tische von den anderen entfernt. Hin und wieder glaubte Lili ein Schniefen von ihr zu hören. So auch jetzt, als Nicole sich mit dem Arm über die Nase fuhr.
Lili stand auf und ging zu ihr hin. Ihre Finger waren ganz in Schwarz getaucht, dazwischen ein Finger mit roter Farbe. Auf dem Malpapier erkannte Lili einen Körper am Boden liegen. Er schien verletzt zu sein, schien zu schreien, darüber ein Gewitter, aus dem Pfeile schossen. Für eine Vierzehnjährige war das eine ziemlich finstere Phantasie. Was Lili jedoch wirklich erschreckte, war ein einziger roter Punkt in diesem Schwarz aus grollendem Himmel und leidender Kreatur.
«Darf ich?», fragte Lili leise und nahm das Papier zur Hand.
Der rote Punkt lag zwischen den Beinen der Figur.
«Hast du dieses Motiv schon mal gesehen?»
Nicole schüttelte den Kopf, den Blick vor sich auf den leeren Tisch gerichtet.
«Woher hast du es dann?»
Nicole antwortete nicht.
«Hast du…?»
«Nein», schnitt ihr Nicole das Wort ab.
Lili gab ihr das Blatt zurück. «Komm bitte nach der Stunde in mein Zimmer.»
4
Drei Absolut?», fragte der Mann hinter dem Tresen.
Levy nickte und zückte einen Fünfziger.
«Vier plus eins. Angebot der Woche», sagte der Mann.
Levy dachte nicht lange nach.
Vorbei an den Nutten vom Kiez und an torkelnden Touristen, die selbst im Regen ihre St.-Pauli-Erkundungen nicht aufgeben wollten, hielt er schnurstracks über die Davidstraße auf seine Wohnung zu. Als sich die Tür des Aufzugs hinter ihm schloss, öffnete er die Flasche und setzte sie an. Nicht denken, nicht fühlen.
Der Computer meldete fünf Nachrichten im Posteingang. Levy kümmerten sie nicht. Bis auf die Haut durchnässt und mit der Flasche in der Hand ließ er sich aufs Bett fallen. Die Wärme strömte wohltuend in seinen Magen.
5
Stephan Voss war bestens gelaunt. Eine Fondsbeteiligung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung hatte er heute an die Frau gebracht.
Die Kleine war eine Schnepfe aus dem Badischen gewesen, die ihre erste Stelle bei einer Softwarefirma angetreten hatte. Eine geschlagene Stunde hatte er sich den Unsinn über Examensstress, verstaubte Professoren und die Karriere, die nun auf sie wartete, anhören müssen. Damit ihr auf diesem Weg nichts mehr in die Quere kam, wollte sie auf Nummer sicher gehen und vorsorgen.
Wie immer in den Abschlussgesprächen hatte er alle Informationen parat – Vermögensaufstellung, familiärer Hintergrund, Lebensplan–, um die geeignete Absicherung für die Widrigkeiten des Lebens zusammenzustellen. Er schmunzelte. Als könnte man das Leben versichern.
Der Erstkontakt hatte vor vier Wochen stattgefunden. Einer seiner Kunden hatte ihn weiterempfohlen. Sie waren über ganz Deutschland verteilt, und deshalb war er viel unterwegs. Doch wann immer er es einrichten konnte, verließ er seine Wohnung in St.Georg nicht. Er lebte in zwei Zimmern mit Küche und Bad. Nichts Besonderes. Außer dass er die alleinige Verfügungsgewalt über einen Kellerraum hatte, den nur er betreten konnte. Er lag abgelegen im hinteren Teil des Hauses tief unter der Erde. In den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs hatte er vielen Hamburgern das Leben gerettet. Heute war das anders.
Die Vermieterin, eine alleinstehende Frau in ihren Achtzigern, hatte den Keller bei einem Beratungsgespräch erwähnt. Sie plapperte über ihre Kinder und Enkel, die nach Süddeutschland gezogen waren und für die sie nach der Zeit ihres Ablebens vorsorgen wollte. Voss hörte nur mit einem Ohr zu, seine Gedanken kreisten um den Keller. Er musste aus seiner alten Wohnung raus und suchte dringend etwas Neues. Da kam ihm die Alte mit ihrer Wohnung und dem Keller gerade recht. Er berichtete von der schlechten Nachbarschaft und seinem Hobby, dem Schlagzeugspielen, das ihm durch die Beschwerden der Anwohner vergällt worden war. Wenn sie ihm diese Wohnung und den Keller vermietete, dann würde er ihr ein besonderes Paket für die lieben Kleinen zusammenstellen, das sonst niemand bekäme. Das Stundenhotel gleich nebenan störe ihn nicht.
Die Alte empfand das als gutes Geschäft und willigte ein. So waren beide zufrieden – sie in ihrer Illusion und er mit einem neuen Hobbyraum.
Stephan Voss schälte sich aus dem Anzug und hängte ihn sorgsam auf den Bügel. Das Affenkostüm würde er diese Woche nicht mehr benötigen. Während er den Overall überstreifte, dachte er an das Flittchen vom Nachmittag. Er würde ihr vier Wochen Zeit geben. Dann wollte er sie wie zufällig vor ihrer Haustür abpassen, um noch eine Frage zur getätigten Finanzanlage zu klären. Die Unterlagen habe er dabei, und man könne es gleich in seinem Wagen besprechen. Argwohn hatte er bei dieser Vorgehensweise noch nie erlebt. Das Geschäft beruhte auf Vertrauen.
Er packte die Reinigungsmittel in einen Eimer, zog die Gummistiefel an und verließ die Wohnung. Im Treppenhaus war es ruhig. Ebenso im Untergeschoss. Er schloss die schwere Feuerschutztür auf, die zu seinem Keller führte, und verriegelte sie gleich nach seinem Eintreten wieder. Hier unten im Gang gab es kein Licht. Er hatte eigens die Leitung gekappt. Die Taschenlampe wies ihm den Weg. Es war still und roch nach Schimmel, der in der Nase kitzelte.
Vor seinem Kellerraum angekommen, schob er die beiden Riegel zurück und schloss auf. Die Tür war nach innen mit reichlich Styropor abgedichtet, sodass niemand diesseits der Tür fürchten musste, durch den Lärm belästigt zu werden.
Er knipste die Lampe an, stellte den Eimer zu Boden und verstaute das Notebook. Dann schob er die Bahre zur Seite und machte sich an die Arbeit. Erst einmal Musik. Er drehte den Ghettoblaster auf. Sunshine of Your Love, die bläserdominierte Version von Ginger Baker’s Air Force aus dem Jahr 1970, erklang. Diese wild und dämonisch klingende Fassung des Cream-Gassenhauers war ultraselten, und als sie 1998 auf einer Ginger-Baker-Kompilation endlich offiziell als CD erschien, hatte er trotz des stolzen Preises sofort zugegriffen.
1998 war auch das Jahr, in dem sie ihn fast erwischt hätten. Damals war er jung und vor allem dumm gewesen. Er hatte sich von seinen Gefühlen leiten lassen, die ihn geradewegs ins Verderben geführt hätten, wenn er sich nicht rechtzeitig am Riemen gerissen hätte. Seitdem ging er klarer, überlegter und geduldiger vor. Früher oder später landeten sie alle bei ihm.
I’m with you my love, the lights shining through on you.
Er drehte den Wasserhahn auf und spritzte mit dem Schlauch die Ecke aus. Aus dem Halbdunkel wurden die Reste herangespült, die er gestern nicht mehr hatte entsorgen können. Sie sollten kein Problem darstellen. Es passte alles in die Abfalltüte. Nur der Arm nicht.
6
Levy, wach auf!», schrie Michaelis gegen das Heulen des Sturms an. Sie rüttelte ihn, doch er schien wie tot. Am Boden lagen zwei leere Flaschen Absolut-Wodka. Sie kickte sie energisch unters Bett. Dann schloss sie das Fenster.
Levy drehte sich zur Seite, hielt die Augen geschlossen und rollte sich wie ein Embryo zusammen. «Was ist?»
«Wieso hast du das Fenster offen?»
«Ist doch egal.»
«Willst du dir den Tod holen? Du bist völlig durchnässt.»
«Wie kommst du hier rein?»
Michaelis fuchtelte mit dem Schlüssel vor seinen Augen herum. «Der Zweitschlüssel. Schon vergessen?»
«War ’n Fehler. Leg ihn auf den Tisch und verschwinde.»
«Das würde dir so passen.»
«Ja, verdammt. Und jetzt lass mich in Ruhe.»
Sie setzte sich auf die Bettkante und drehte sein Gesicht zu sich hin. «Mein Gott, Levy, was ist nur aus dir geworden?»
Verkatert öffnete er die Augen. «Liebe deinen Bruder wie dich selbst.»
«War es so schlimm?»
«Wieso hat Naima nicht besser zielen können? Ein paar Zentimeter höher, und ich hätte meine Ruhe.»
Frank war wieder in sein Leben getreten, und zwar schlimmer, als sie es befürchtet hatte. Sie hatte ihn bei ihrer gestrigen Zeugenaussage das erste Mal seit Naimas Rettungsschuss wiedergesehen. Er war eine beängstigende Erscheinung. In seinen Augen spiegelte sich ihre Furcht vor dem, was er ihr angetan hatte, und dem, wozu er noch über die Gefängniszelle hinaus fähig war, anzurichten. Er war kein Tier, die handelten nach ihren Instinkten, er war ein gefühlskalter, berechnender Psychopath, der sich am Leid anderer Menschen ergötzte.
«Komm», sagte Michaelis und griff Levy unter die Arme. «Ich lass dir ein Bad ein.»
«Das hilft auch nicht mehr.»
Michaelis zog Levy hoch und bugsierte ihn ins Badezimmer.
Während das Wasser einlief, half sie ihm, sich auszuziehen. Von der gesunden Körperverfassung von vor einem halben Jahr war nichts mehr zu erkennen. Levy hatte Gewicht verloren und war kreidebleich. Immerhin, die Hautimplantate waren gut verheilt. Man erkannte nur noch die Wundnarben, die wie eine schwache Naht auf der Haut verliefen. Sie erschrak bei diesem Anblick, sagte aber nichts.
«Dreh dich um. Ich will nicht, dass du mich so siehst», bat Levy.
Normalerweise hätte sie gelacht und gesagt, dass er nicht der erste Mann sei, den sie nackt sehe, doch dieser Fall lag anders. Sie schüttete Badezusatz ins Wasser, und Levy stieg hinter ihrem Rücken in die Wanne.
«Ich mach uns einen Kaffee», sagte sie und ging in die Küche.
Das warme Wasser prickelte auf Levys Haut, wie bei einem eingeschlafenen Bein, wenn es wieder erwacht. Es schien ihm fast angenehm zu sein.
«Was willst du eigentlich?», rief Levy zur Seite.
In der Küche röchelte die Kaffeemaschine.
«Es gibt Arbeit.»
«Ich bin krankgeschrieben.»
Michaelis tauchte in der Tür auf. «Seit wann?»
«Seit heute.»
Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und strich ihm über den Kopf. «Es tut mir leid für dich. Ich weiß…»
«Nichts weißt du.»
«Ich kann es mir vorstellen, okay?»
Die Antwort erstickte sie mit dem Finger auf seinen Lippen. «Es muss fürchterlich sein, wieder mit Frank konfrontiert zu werden. Aber ich verspreche dir, dass es das letzte Mal in deinem Leben sein wird.»
«Du meinst, es geht mir besser, wenn er hinter Gittern sitzt?»
«Er wird nie wieder herauskommen.»
«So lange er lebt, wird er nicht mehr gutmachen können, was er uns angetan hat.»
Michaelis schwieg, denn Levy hatte recht. Auch sie war Franks Opfer gewesen und war nur knapp dem Tod entronnen. Sie hatte im Krankenhaus viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Doch diese Erfahrung ließ sich nicht mit dem Verstand verarbeiten. Frank de Meer hatte ihr die Selbstsicherheit geraubt, sie im tiefsten Inneren erschüttert, verunsichert und verletzt. Seitdem sah sie die Welt mit anderen Augen. Eine Körperverletzung oder ein Mord war nicht mehr bloßer Tatbestand aus dem Strafgesetzbuch, sondern gelebte Erfahrung. Das war eine ganz andere Qualität.
Sie kam zum Thema. «Wir haben eine neue Leiche.»
«Quelle surprise», antwortete Levy lakonisch.
«Es handelt sich um einen Mann, den wir heute im Nikolaifleet gefunden haben.»
«Wenn du alle Fleete trockenlegen würdest, fändest du noch mehr.»
«Er weist dasselbe Verletzungsmuster auf wie der von letzter Woche.»
«Dann ist die Sache einfach. Ihr sucht denselben Täter.»
«Wir haben noch ein anderes Opfer. Von ihr gibt es nur Einzelteile.»
«Gut, dann sucht ihr eben zwei Täter.»
«Hör mit deinem Sarkasmus auf. Ich möchte, dass du mir hilfst.»
Levy lachte bemüht. «Es ist das erste Mal, dass ich Sven recht gebe. Ich bin ein Wrack und tauge nicht für eure Arbeit.»
Michaelis riss sich zusammen. «Auch wenn es dir kein Trost ist: Gerade weil du ein Wrack bist, gibt es keinen Besseren als dich für diesen Job.»
7
Willytown. Was geht ab, Digga?
Der Weg von der S-Bahn zum Wohnblock, in dem Nicole lebte, war erfreulich menschenleer. Die Homeys stemmten um diese Zeit Gewichte oder übten hinter kahlen Kellermauern für eine Karriere als Gangsta-Rapper. Wind peitschte Regen in Lili Waans Gesicht. Die Lichter der Wilhelmsburger Wohnsiedlungen dienten ihr als einzige Orientierung. Obwohl Nicole nichts von einem Gespräch zwischen Lili und ihren Eltern hatte wissen wollen, ließ sich Lili nicht beirren. Sie musste das klären. Dass eine Vierzehnjährige offensichtlich regelmäßig Geschlechtsverkehr mit jemandem aus ihrem nahen Umfeld hatte, war nicht akzeptabel. Nicole hatte nicht verraten, um wen es sich dabei handelte.
Der Wohnblock endete irgendwo im schwarzen Nichts. Lili suchte vergebens nach dem Namen. Von den rund fünfzig Klingelschildern war die Mehrzahl eingedrückt, der Rest verbarg sich unter einer Schicht Sprühfarbe. Kurzerhand drückte sie die oberste Reihe durch. Keine Antwort. Dann die zweite Reihe.
«Zu wem willst du?», fragte eine Stimme neben ihr.
Lili drehte sich um und sah ein Mädchen, vielleicht zwölf oder dreizehn, aus dem Dunkel des Dachvorsprungs treten. Es nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette.
«Nicole Stevens», antwortete Lili.
«Hat sie was ausgefressen?»
«Nein, ich will mit ihren Eltern sprechen.»
«Bist du vom Jugendamt?»
«Ich bin ihre Lehrerin. Aber was machst du um diese Zeit hier draußen? Und außerdem: Bist du nicht noch etwas zu jung fürs Rauchen?»
«Meine Alten haben Stress. Wenn der Werbeblock vorbei ist, kehrt wieder Frieden ein. Und du? Bist ganz schön mutig. Alleine nachts in dieser Gegend.» Es schnippte die Kippe in den Regen.
«Wo kann ich Nicole finden?»
«Klingeln bringt nichts. Da macht niemand auf. Komm mit, ich zeig’s dir.»
Das Mädchen schloss die Tür auf und ging die Stufen hoch. Lili folgte ihm. «Den Aufzug kannste vergessen. Letzte Woche haben sie das Ding einfach abgefackelt.»
«Wie heißt du?»
«Lotte. Und du?»
«Lili.»
Sie traten in den ersten Stock. Aus einer der Türen klang der Gesang einer Frau aus dem Fernsehen.
«In den unteren Stockwerken wohnen nur Türken», sagte Lotte. «Die Deutschen findest du weiter oben, auch ein paar Jugos und Albaner.»
Als sie endlich den neunten Stock erreicht hatten, wies Lotte in den Gang. «Dritte Tür links.»
«Danke», erwiderte Lili, «und überleg dir das nochmal mit dem Rauchen.»
Lotte lächelte. «Viel Glück.»
Sie sperrte Lottes Wohnungstür auf. Dahinter erkannte Lili einen Mann im ausgeleierten Jogginganzug, eine Flasche Bier in der Hand. Er blickte ihr geradewegs in die Augen, als er zum Trinken ansetzte.
Lili ging weiter. Der Geruch von abgestandenem Frittierfett drang ihr in die Nase. Der Linoleumboden klebte. Von den Wänden grinsten sie die Schmierereien pubertierender Jugendlicher an.
Im fahlen Neonlicht erkannte sie verblichenes Gekritzel auf dem Namensschild. Sie klingelte und wartete. Keine Reaktion. Sie klopfte.
Das Geräusch kleiner trampelnder Füße, dann öffnete sich die Tür. Ein Junge, acht oder neun Jahre alt, blickte sie misstrauisch an.
«Ich möchte mit deinen Eltern sprechen», sagte Lili freundlich.
Der Kleine drehte sich wortlos um und lief zurück. In den Gang fiel das blassblaue Licht eines Fernsehers. Dahinter eine Tür, einen Spalt offen. Ein Gesicht lugte hervor. Es wurde verdeckt von der Gestalt einer Frau im rosafarbenen Bademantel, Haare hochgesteckt. Sie begrüßte Lili argwöhnisch. «Was gibt’s?»
«Mein Name ist Lili Waan, ich bin eine Lehrerin von Nicole…»
«Hat sie wieder was ausgefressen?», unterbrach sie die Frau.
«Nein, nein. Ich bin wegen etwas anderem hier.» Lili wartete darauf, in die Wohnung gebeten zu werden. Vergebens. Sie holte die Zeichnung hervor und hielt sie der Mutter hin. «Das hat Nicole heute Nachmittag in meiner Stunde gemalt.»
Die Frau warf einen flüchtigen Blick darauf. «Na und?»
«Erkennen Sie den roten Punkt, den sie zwischen den Beinen gemalt hat?»
Sie schaute genauer hin. «Deswegen kommen Sie mitten in der Nacht hierher?»
«Ja, und außerdem habe ich mich mit ihr darüber unterhalten.»
«Machen Sie’s nicht so spannend.»
«Sie sagt, dass sie von jemandem aus der Familie sexuell bedrängt wird.»
Die Frau erschrak. «Wie bitte?!» Dann wandte sie sich um. «Nikki, komm her!»
Aus dem Spalt trat Nicole hervor. Sie hatte die Unterhaltung belauscht. Den Kopf gesenkt, trat sie neben ihre Mutter. Durch die Stimmen im Gang aufgeschreckt, kam ein Mann aus dem Wohnzimmer hinzu. «Was ist hier los?», blaffte er.
«Deine Tochter behauptet, dass du sie fickst.»
«Das habe ich nicht gesagt», widersprach Lili.
«Was dann?», wollte er wissen.
«Fragen wir sie doch am besten selbst», schlug Lili vor. «Hab keine Angst, Nicole. Ich bin hier, um dir zu helfen.»
«Einen Scheiß werden Sie», fuhr die Mutter sie an. Dann zu ihrer Tochter: «Was verbreitest du wieder für Lügen über uns?»
Nicole brachte keinen Ton heraus.
«Hab keine Angst», beruhigte sie Lili, «du musst nur sagen, was du mir heute erzählt hast.»
«Jetzt mach deinen Mund auf», keifte die Mutter.
«Nichts hab ich erzählt», sagte sie kleinlaut.
«Na, also», bekräftigte der Vater.
«Nicole», versuchte Lili es noch einmal, «bitte.»
«Nichts hab ich erzählt», wiederholte Nicole. «Gehen Sie weg.»
«Ab in dein Zimmer», ordnete die Mutter an. «Wir sprechen uns noch.»
Doch so schnell wollte sich Lili nicht geschlagen geben. «Interessiert es Sie überhaupt nicht, was Ihre Tochter…»
«Hören Sie», schnitt die Mutter ihr das Wort ab, «nehmen Sie das Gekritzel wieder mit und kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Ich weiß, was meine Tochter tut und was nicht. Wenn ihr hier jemand ans Höschen geht, dann bin ich die Erste, die das erfährt. Und lassen Sie meinen Mann aus dem Spiel.»
Die Tür flog Lili vor der Nase zu. «Ich werde das nicht auf sich beruhen lassen», rief sie gegen die Ignoranz an.
Wütend trat Lili den Rückweg an. Sie ärgerte sich, dass sie sich so einfach hatte abwimmeln lassen. Sie hätte gleich mit dem Jugendamt anrücken sollen. Verdammtes Pack. Wieso erkennen sie die Zeichen nicht?
Als Lili im Erdgeschoss angelangt war, hörte sie Rap-Musik. Eine Tür stand offen. Ein junger Mann mit nacktem Oberkörper lehnte lässig am Türstock. Kurzhaarschnitt, sonnenbankgebräunt, Tätowierungen über der Brust, Adidas-Schuhe, lässige Jeans. Kanakenstyle.
«Hey, Pussy, was geht?»
Er spannte die Muskeln. Lili ließ ihn stehen.
Er griff sich in den Schritt und rappte: «Komm, wir machen Party… mit Wodka und Bacardi… Shake… shake dein Arsch.»
8
Das Team war versammelt.
Der dunkelhäutige Luansi Benguela, Michaelis’ Stellvertreter, der Computerfachmann Alexej Naumov, Falk Gudman, der Verhörspezialist, Naima Hassiri, die Chefermittlerin, und Dragan Milanovic, der Rechtsmediziner. Auf den zahlreichen Monitoren waren Bilder von Leichen und Fundorten zu sehen, Landkarten und Berichte.
Michaelis betrat gemeinsam mit Levy den Raum. Obwohl sie Levy seit dem Fall um die Terroranschläge in Hamburg, Frankfurt und Mannheim nicht mehr gesehen hatten, hielt sich die Wiedersehensfreude in Grenzen. Es wurde lediglich registriert, dass ihn Michaelis zum Fall hinzugezogen hatte – anscheinend nicht zur allgemeinen Begeisterung.
«’n Abend», sagte Levy und nahm an einem der Schreibtische Platz. «Schön, dass ihr mich vermisst habt.»
Levy, unrasiert und im verknautschten Halbmantel, wartete auf eine Reaktion. Ein Blick zur Begrüßung musste genügen. «Gibt’s auch was zu trinken?»
«Kaffee steht auf dem Tisch», erwiderte Michaelis. «Ansonsten, gedulde dich.»
Falk Gudman erhob sich, grinste abfällig. «Ich hab noch ein paar Mon Chéri im Schrank. Wenn dir die als Begrüßungsdrink reichen?»
Michaelis duldete keinen Widerspruch. «Ich werde meine Entscheidung nicht diskutieren. Levy ist wieder im Team. Und damit basta.»
«Meinst du, er wird auch nur eine Stunde ohne Stoff überstehen?»
«Falk, setz dich.»
Levy schaute sich in der Runde um. Alexej und Luansi schienen ihm wohlgesinnt, Naima neutral, Dragan besorgt.
«Dann fehlt ja nur noch Sven zu meinem Glück», erwiderte Levy.
«Sven und seine Leute sind mit dem Bosporus-Fall beschäftigt», entgegnete Michaelis.
Sven Demandt, sein ehemaliger Mentor und Ausbilder in der Abteilung Operative Fallanalyse beim BKA, war mit seiner Mannschaft hinter dem oder den Tätern her, die in den letzten sieben Jahren neun Dönerbudenbesitzer ermordet hatten. Er erinnerte sich. Es hatte dazu bereits eine Anfrage im Bundestag gegeben. Die Nerven lagen blank, wenn sich die Politik einschaltete.
Levy grinste. «Na, dann habt ihr ja mit mir den Jackpot geknackt. Gratuliere.»
«Levy», schnitt ihm Michaelis das Wort ab, «spar dir die Stichelei. Wir brauchen dich, Punkt.»
«Ich fühle mich geehrt.»
Michaelis ließ es unkommentiert. «Dann lasst uns anfangen. Dragan, was hat die Obduktion ergeben?»
«Bei dem Opfer im Nikolaifleet handelt es sich um einen Mann weißer Hautfarbe, etwa dreißig Jahre alt», begann Milanovic. «Keine Narben, keine Tätowierungen, keine Erkrankungen oder Operationen, die auf seine Identität schließen lassen könnten. Der Mann war vollkommen gesund, gut genährt, kein Raucher, kein Trinker, kein Pillenschlucker – beste Voraussetzungen für ein langes Leben. Das Gebissschema und die DNA habe ich zur Abklärung in die nationalen Datenbanken gegeben, bisher ohne Ergebnis. Den Todeszeitpunkt lege ich auf eine Spanne von zwölf bis vierzehn Tagen. Er gelangte erst nach seinem Tod ins Wasser. Kurz danach, würde ich sagen. Todesursache: ein gebrochener Kehlkopf, der zum Ersticken führte.»
«Wie wurde ihm die Verletzung beigebracht?», fragte Naima.
«Ein Tritt oder ein Schlag. Keine Strangulation. Er ist an der aufkommenden Schwellung erstickt.»
«Ist er verprügelt worden?», wollte Luansi Benguela wissen.
«Das auch. Sein Körper weist zahlreiche Hämatome auf. Ich schätze, sein Martyrium hat sich über Stunden hingezogen. Womit wir bei dem auffälligen, uns bereits bekannten Verletzungsmuster sind.»
Milanovic bat Alexej Naumov, die Aufnahmen auf dem großen Monitor zu zeigen. Sie offenbarten einen Teil des Rückens, auf dem man deutlich die Verletzungen durch die Schiffsschraube und die Schlagabdrücke erkennen konnte.
«Wie in unserem Fall von letzter Woche sehen wir auch hier die typischen Muster eines Schlagstocks.» Milanovic deutete auf die roten, parallel verlaufenden Blutlinien, in der Mitte ein weißer Streifen, etwa einen Zentimeter breit.
«Es ist also definitiv keine Peitsche», stellte Naima fest.
«Ich tippe auf einen Rohrstock.»
«Welcher Art?», wollte Michaelis wissen.
«Kein Bambus. Bei der Wucht, mit der der Täter zugeschlagen haben muss, wäre er wahrscheinlich gesplittert. Ich tippe auf Rattan. Das ist biegsamer.»
«Wie oft hat der Täter zugeschlagen?», fragte Gudman.
«Ich habe vierundneunzig Hiebe gezählt. Einige waren so stark, dass sie das Gewebe zum Platzen gebracht haben. Der Unterarmknochen und das Nasenbein sind dadurch gebrochen.»
«Also ein Mann mit viel Kraft und Ausdauer.»
«Ja, aber ob Mann oder Frau, kann ich nicht bestimmen. Rechtshänder. Die Hiebe verlaufen von oben links nach rechts unten.»
Alexej Naumov schaltete sich ein. «Hat er lange leiden müssen?»
«Kommt auf seine Schmerztoleranz an. Drei bis fünf Stunden. Dann trat Bewusstlosigkeit ein.»
«Ist er fixiert gewesen?», fragte Naima.
«Ich habe keine Anzeichen dafür gefunden.»
«Das heißt, er hat es freiwillig über sich ergehen lassen?»
«Oder er war kampfunfähig», fügte Luansi Benguela hinzu.
«Die chemischen und feinstofflichen Untersuchungen laufen noch. Bisher habe ich aber keine Spuren von einem Betäubungsmittel feststellen können.»
«Wer macht so was?», fragte Naumov. «Das ist doch krank.»
Naima lächelte. «Was glaubst du, was ich in den letzten Tagen alles gesehen habe.»
«Gute Frage», sagte Michaelis. «Was machen deine Ermittlungen bei den Dominas?»
«Bisher will keine der Damen den Mann erkannt haben. Vielleicht haben wir mit dem Neuen mehr Glück.»
«Muss es sich denn unbedingt um einen sexuellen Hintergrund handeln?», warf Gudman skeptisch ein.
«Levy, was meinst du dazu?», fragte Michaelis.
Doch Levy antwortete nicht. Er war eingenickt.
9
Der Scheibenwischer lief im Intervall. Stephan Voss blickte hinauf in den vierten Stock, wo noch immer die Bürobeleuchtung brannte. Jennifer hatte ihm im letzten Gespräch vor einigen Wochen geklagt, dass sie lange im neuen Job arbeiten müsse. Doch nun ging es bereits auf 21Uhr zu. Seinen Standardspruch Ich war ohnehin in der Gegend konnte er nun nicht mehr anbringen. Dabei war die Gelegenheit günstiger denn je. Regen und Wind zwangen die Bewohner der Stadt in die eigenen vier Wände. Es war niemand auf der Straße oder an den Fenstern der umliegenden Häuser zu sehen.
Jennifer war gerade erst zwanzig Jahre alt und hatte bereits Verantwortung zu tragen. Ihre Angst zu scheitern hatte sie schon öfter zur Sprache gebracht. Stephan zeigte sich verständnisvoll, teilte ihre Besorgnis und machte ihr Mut, dass sie die Kraft und das notwendige Durchsetzungsvermögen mitbringe, um den Anforderungen gerecht zu werden. Er habe eine gute Menschenkenntnis und sei sich sicher, dass sie zu den wenigen gehöre, die es schaffen würden.
Es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre an jenen Abenden in ihrem Bett gelandet – wenn er es gewollt hätte. Die anfänglich spröde, doch mit der Zeit schnell auftauende Jenny aus Chemnitz war allein in dieser Stadt. Sie suchte nach Freundschaft und Nähe, die sie in Stephan glaubte gefunden zu haben. Dabei verachtete er sie, sie alle, die sich auf seine Aufmerksamkeit etwas einbildeten.
Aufmerksamkeit. Das war das Schlüsselwort in seinem Leben gewesen. Damals hatte sie sich einen Dreck darum geschert – Tanja, seine langjährige Freundin und Fast-Ehefrau. Er hatte sie auf einer Party kennengelernt. Da war er gerade achtzehn und sie einundzwanzig. Sie war ihm sofort aufgefallen. Selbstbewusst, überlegen, laut. Sie war in Begleitung ihres Freundes gekommen, eines älteren Abteilungsleiters mit BMW und in Armani. Der glaubte, bestimmen zu können, mit wem sie quatscht, mit wem sie tanzt, mit wem sie fickt. Sie machte ihm schnell klar, wer das Sagen hatte. Zuerst auf der Tanzfläche, dann in der Küche und zum Schluss auf der Toilette. Nachdem sie ihr sexuelles Bedürfnis befriedigt hatte, ging sie geradewegs auf Stephan zu, griff nach seiner Hand und führte ihn hinaus in die kühle Nacht. Ausgerechnet ihn, der sich nie im Leben getraut hätte, sie anzusprechen, geschweige denn, von so einer Superfrau angesprochen zu werden.