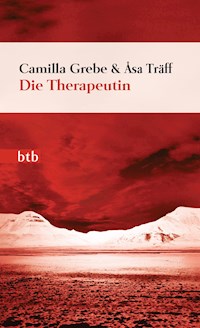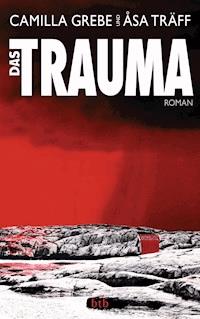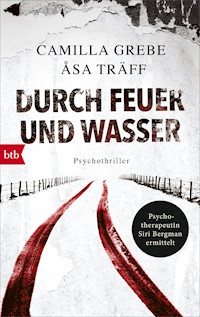Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
August
September
Oktober
November
Dezember
Epilog
Danksagung
Für unsere Eltern
Hab keine Angst vor der Finsternis, das Licht, es ruht darin so sehr. Wir sähen keine Sterne, wenn nicht das Dunkel wär. Der helle Irisring birgt selbst die finstere Pupill, denn finster ist doch alles, zu dem das Licht gern streben will. Hab keine Angst vor der Finsternis, das Licht, es ruht darin so sehr, hab keine Angst vor der Finsternis, das Herz des Lichts, und noch viel mehr.
Es hätte ein Idyll sein können.
Ein trügerisch ruhiger, taufeuchter Morgen. Sonnenstrahlen, die langsam, aber beharrlich die verputzte Jugendstilfassade in Besitz nehmen.
Sie umarmen sie siegesgewiss mit ihrer gleichgültigen Wärme, schenken die Leuchtkraft, die von der Nacht zurückgehalten wurde.
Als wäre nichts geschehen.
Als bereitete dieser Sommermorgen einen Tag wie alle anderen vor: voller Leben, verschwitzte Körper auf Fahrrädern, unterdrücktes Kichern vor dem Eisstand am Hafen, hitzige, sonnenverbrannte Schultern, ungelenker Sommersex, wo das hellblaue Zwielicht nahtlos in die Morgendämmerung übergeht, eine miefige Mischung aus Weißwein und Limonade am nadelgespickten Waldrand oberhalb der Pizzeria, das kalte Wasser des Sees auf mageren Kinderkörpern mit Rippen, die hervorstechen und sich durch die weiche, papierdünne, milchweiße Haut zu bohren scheinen.
Herumalbernde Teenager, die um die Wette zur Insel und wieder zurück schwimmen, die sich gegen die blaubraune, satte Dunkelheit des Wassers wie bleiche Froschmänner, Amphibienfahrzeuge, absetzen. Das Johlen derjenigen, die sich vom Badefelsen hinunterstürzen. Der Duft gegrillten Fleisches. Das Geräusch weit entfernter Motorboote.
Mücken. Wespen. Insekten ohne Namen: im Haar, im Mund, auf den Leibern, den juckenden, verschwitzten, warmen Leibern.
Schwedischer als schwedisch.
Sommer ohne Ende.
Als wenn nichts passiert wäre.
Auch das Haus erscheint gleichgültig. Schwer und gelangweilt brütet es im üppigen Garten, eingebettet in ein dichtbelaubtes, taufeuchtes Grün. Sein dreistöckiger, massiver Körper streckt sich dem hintergründigen Blau des heller werdenden Sommerhimmels entgegen. Nirgends ist Putz abgeblättert. Die graugrüne Farbe, die Fensterrahmen und Türen bedeckt, ist frisch aufgetragen und glänzt immer noch wie neu. In den bleigefassten, getönten Fensterscheiben mit ihrem verschlungenen, organischen Blumenmuster sind weder Risse noch Staub zu sehen. Auf dem Dach ruht ein schönes altes, grünspanfarbenes Kupferblech von der Sorte, die heute nicht mehr verlegt wird.
Es hätte ein Idyll sein können.
Doch da ist etwas, das nicht stimmt.
Auf dem kleinen Parkplatz mit dem sorgfältig geharkten Kies steht ein schwarzer Geländewagen, auch er blitzeblank und ohne einen Kratzer. Im Lack des Wagens spiegelt sich eine Clematis mit großen, reinweißen Blüten wider, die sich einen alten, knorrigen Apfelbaum hinaufrankt, und dort, unter dem lodernden Stamm des Baumes und seinen krummen Zweigen, da liegt sie.
Die junge Frau, das Mädchen.
Zusammengekauert wie ein Vogel liegt sie im Gras, das rote Haar genau wie das Gras von einer dünnen Tauschicht bedeckt. Die schmalen, blassen Arme des Vögelchens liegen zur Seite ausgestreckt, die Handflächen in einer resignierten Geste nach oben gedreht. Das Blut, das aus ihrem Körper floss, ist zu rotbraunen Flecken auf der Jeans und im Gras geronnen. Die Augen sind offen und scheinen die Krone des Apfelbaums zu betrachten.
Dort, an den Zweigen, hängen die kleinen grünen Fruchtansätze. Es sind viele, der Baum wird in ein paar Monaten reichlich Früchte tragen. Über der Krone des Apfelbaums fliegen unbeeindruckt Turmschwalben und Möwen – was interessiert sie ein toter Mensch?
Unter dem Körper, außerhalb des Blickfeldes von Vögeln und Menschen, haben die winzigsten Einwohner des Gartens vor langer Zeit das entdeckt, was bis jetzt noch kein Mensch gesehen hat. Ein kleiner schwarzer Käfer krabbelt zwischen Hosenbund und kalter, blasser Haut auf der Jagd nach etwas Essbarem herum, zarte Fliegen haben sich im dichten roten Wald des Haars eingerichtet, und mikroskopisch kleine Würmer bewegen sich langsam, aber zielstrebig immer tiefer in die Windungen der Ohren hinein.
Bald werden diejenigen, die im Haus wohnen, aufwachen und nach der jungen Frau, dem Mädchen suchen. Weil sie sie im Haus nicht finden, werden sie auch im Garten suchen, wo sie sie im Gras unter dem Baum finden werden, die Augen dem Himmel zugewandt.
Sie werden sie schütteln, als versuchten sie, sie aus einem tiefen Schlaf zu wecken, und da das vergeblich ist, wird einer von ihnen ihr hart auf die Wange schlagen, so dass sich ihr Gesicht von dem noch nicht geronnenen Blut auf seinen Händen rot verfärben wird.
Sie werden sie in den Arm nehmen und behutsam hin und her wiegen, einer von ihnen wird ihr etwas ins Ohr flüstern, während die anderen ihre Gesichter in ihrem Haar begraben werden.
Später werden Männer kommen, die sie noch nie gesehen haben und ihren Namen nicht kennen, um sie abzuholen. Sie packen ihre schmalen, steifen Hände mit ihren groben, drehen und heben sie ohne viel Federlesens auf eine kalte Bahre, bedecken sie mit Plastik und entfernen sich mit ihr weit, weit weg von ihrem Zuhause.
Sie wird auf einen Metalltisch gelegt werden, neben die chirurgischen Instrumente, die sie öffnen sollen und – hoffentlich – das Rätsel lösen, das Unerklärliche erklären, das Gleichgewicht wiederherstellen können. Klarheit in das bringen, was niemand versteht.
Einen Abschluss schaffen und vielleicht auch Frieden.
Eine Art von Frieden.
August
Datum: 14. August Uhrzeit: 15.00 Ort: grünes Zimmer, Praxis Patientin: Sara Matteus
»Na, wie war der Sommer?«
»Ist es okay, wenn ich rauche?«
»Klar.«
Sara wühlt in der camouflagefarbenen Stofftasche und zieht ein Päckchen rote Prince und ein Feuerzeug heraus. Mit rauen, zitternden Fingern zündet sie sich eine Zigarette an und zieht zweimal tief, bevor sie wieder ihren Blick auf mich richtet. Sie mustert mich eine Weile schweigend und bläst eine Rauchwolke zwischen uns – ein krebserregender Nebelvorhang -, die einen Moment lang ihre schwarz umrandeten Augen verbirgt. Ihre Geste hat etwas Demonstratives an sich, etwas gleichzeitig Spielerisches und Provokantes, weshalb ich beschließe, den Augenkontakt aufrecht zu halten.
»Also was?«, fragt Sara affektiert.
»Der Sommer?«
»Ach ja. Der Sommer. War gut. Ich habe in dieser Kneipe in Gamla Stan gearbeitet, wissen Sie, am Järntorget.«
»Ich weiß. Und wie ist es Ihnen gegangen, was meinen Sie?«
»Gut, wirklich gut. Absolut. No problems.«
Sara verstummt und schaut mich mit unergründlichem Blick an. Sie ist fünfundzwanzig, sieht aber keinen Tag älter als siebzehn aus. Blondiertes Haar, mit verschiedenen Abtönungen von Weiß bis Buttergelb, ringelt sich über die schmalen Schultern und bildet dabei verworrene, verfilzte Zöpfe. Haarwürste. Sie dreht sie sich um die Finger, wenn sie sich langweilt. Die Würste schiebt sie sich dann rein in den Mund und wieder raus, wobei sie mal drauf beißt, mal drauf saugt. Wenn sie nicht auf ihrem Haar kaut, dann raucht sie. Sie scheint immer eine Zigarette in den rauen Fingern bereitzuhalten.
»Keine Angstattacken?«
»Ne. Doch, vielleicht ein bisschen … ab und zu. Ich meine zur Mittsommernacht und solchem Scheiß. Kriegen dann nicht alle Angst? Wer hat keine Angst an Mittsommer?«
Schweigend schaut sie mich eine Weile prüfend an. Ein Lächeln spielt um ihre Mundwinkel.
»Verflucht, da können Sie einen drauf lassen, dass ich da Angst hatte.«
»Und was haben Sie daraufhin gemacht?«
»Nichts«, sagt Sara und sieht mich durch den Rauch mit leerem Blick an. Sie scheint ungewöhnlich gleichgültig zu sein, was ihre Gefühle der Angst und des Ausgegrenztseins angeht, die von der Mittsommernachtsfeier ausgelöst wurden, wie sie behauptet.
»Sie haben sich nicht geritzt?«
»Nee … doch, ja. Aber nur ein bisschen, an den Armen. Nur an den Armen. Ich musste es tun, sonst hätte ich diesen ganzen Mittsommernachtskram nicht ertragen. Aber nicht viel. Ich hab Ihnen ja versprochen, mich nicht mehr zu ritzen. Und ich halte immer, was ich verspreche, wirklich. Ganz besonders, wenn ich es Ihnen versprochen habe.«
Ich kann sehen, dass Sara ihre Unterarme in einer wahrscheinlich unbewussten Geste zu verbergen versucht.
»Wie oft haben Sie sich geritzt?«
»Wieso, meinen Sie, wie viele Ritze?«
»Nein, wie oft haben Sie es gemacht?«
»Oh, ein paar Mal. Zwei, vielleicht drei Mal den Sommer über. Ich weiß nicht mehr so genau …«
Saras Stimme erstirbt, und sie drückt ihre Zigarette in der blauen Blumenvase aus, die auf dem Couchtisch steht als ein Versuch, das Zimmer etwas einladender zu gestalten. Ich bin wahrscheinlich die einzige Therapeutin in ganz Schweden, die es zulässt, dass ein Patient raucht, aber Sara wird sonst so unruhig, dass ein Gespräch mit ihr kaum möglich ist.
»Sara, das ist wichtig. Ich möchte, dass Sie zu der Situation zurückgehen, in der Sie sich geritzt haben. Versuchen Sie sich daran zu erinnern, was vorher passiert ist. Was die Gefühle ausgelöst hat, die Sie dazu gebracht haben, sich zu ritzen.«
»Äh …«
»Fangen Sie mit dem ersten Mal an. Nehmen Sie sich Zeit. Wann war es? Fangen Sie damit an!«
»Es muss am Mitsommerabend gewesen sein. Also bei der Mittsommerfeier. Hab ich doch schon gesagt!«
»Und was haben Sie da gemacht? Ich meine, bevor es dazu kam?«
»Meine Mutter besucht. Da waren nur wir beide. Sie hat Essen gekocht und so. Und Wein eingekauft.«
»Dann waren Sie also nicht auf einer Mittsommerfeier?«
»Nee, es war eher so eine, wie heißt das … eine Metapher. Eine Metapher dafür, wie schrecklich diese Mittsommernacht ist. Alle sind so fröhlich. Man muss sich mit der Familie treffen und fröhlich sein. Es ist… irgendwie so gezwungen.«
»Dann waren Sie beide nicht fröhlich?«
Sara bleibt eine ganze Weile unbeweglich sitzen, ohne etwas zu sagen, und ausnahmsweise hält sie sogar ihre Hände ruhig auf den Knien, während sie nachdenkt. Im Zimmer ist nur das Surren der Videokamera zu hören, die unser Gespräch aufzeichnet. Sara seufzt schwer, und als sie wieder anfängt zu reden, kann ich trotz des ruhigen, beherrschten Tonfalls ihre Wut spüren.
»Ne, das können Sie sich doch denken. Ich weiß wirklich nicht, was das hier bringen soll. Ich habe doch schon mindestens tausend Mal über meine Mutter geredet. Sie wissen, dass sie eine Säuferin ist. Hallo, muss ich Ihnen das noch aufschreiben? Es war wie immer. Alles sollte so schön sein … aber dann … hat sie nur gesoffen, und dann hat sie angefangen zu jammern. Sie wissen, so wird sie ja, wenn sie säuft. Traurig und… irgendwie … irgendwie bereut sie dann alles. Sie scheint dann wirklich alles zu bereuen. Als sollte ich ihr verzeihen, dass sie keine gute Mutter war. Finden Sie, dass ich das sollte?«
»Was finden Sie?«
»Ne, ich finde das nicht. Ich finde, es ist nicht zu verzeihen, was sie mir angetan hat.«
»Und was haben Sie also gemacht?«
Sara zuckt mit den Schultern, und ich kann ihrer Körperhaltung entnehmen, dass sie keine Lust hat, weiterzureden, weder über ihre Mutter noch über sich selbst. Ihre Stimme ist schrill geworden, und am Hals zeichnen sich hektische rote Flecken ab, als wäre Wein auf einer Leinendecke verschüttet worden.
»Ich bin abgehauen. Kann’s nicht ausstehen, wenn sie heult.«
»Und dann?«
Sara windet sich und zündet sich eine weitere Zigarette an.
»Nach Hause. Ich bin nach Hause gefahren.«
»Und?«
»Mensch, Sie WISSEN doch, was dann passiert ist. Daran ist nur die Alte schuld. Ich kann irgendwie nicht… ich kann nicht mehr atmen, wenn ich dort gewesen bin.«
Jetzt ist Sara wütend. Das ist gut, ich werde versuchen, das Gefühl am Leben zu halten. Meistens dringen eine Menge Wahrheiten durch, wenn Sara wütend ist. Der Schutzwall der Selbstmanipulation verschwindet und wird von einer rohen Ehrlichkeit ersetzt, wie man es bei Personen kennt, die nichts zu verlieren haben, die es nicht interessiert, was man von ihnen hält.
»Sie haben sich geritzt?«
»Na logisch hab ich mich geritzt.«
»Erzählen Sie!«, fordere ich sie auf.
»Also, nun mal ehrlich, Sie wissen doch, was passiert ist.«
»Es ist wichtig, Sara.«
»Ich habe mich am Arm geritzt. Zufrieden jetzt?«
»Sara … hören Sie mir zu! Das, was Sie beschreiben, das, was Sie fühlen, das ist doch vollkommen verständlich. Es ist Mittsommernacht, Sie besuchen Ihre Mutter, sie ist betrunken und bittet Sie um Verzeihung, das wühlt jede Menge an Gefühlen auf. Können Sie das sehen?«
Sara schaut auf ihre Finger. Studiert sorgsam jeden Nagel. Sie nickt, als wollte sie bestätigen, dass auch sie findet, dass ihre Gefühle und Reaktionen möglicherweise verständlich sind.
»Das Problem ist nur, dass Sie sich selbst Schaden zufügen, wenn die Angst kommt, und das ist keine gute Lösung, schon gar nicht auf lange Sicht.«
Wieder nickt Sara. Sie weiß, dass das Trinken, das sich selbst Verletzen oder die impulsiven sexuellen Beziehungen nur für eine gewisse Zeit Linderung bringen und dass die Selbstverachtung und der Schmerz danach doppelt so stark zurückkehren. Ihr verzweifelter Versuch, die Angst im Griff zu behalten, verstärkt diese nur noch.
»Haben Sie es mit dem versucht, worüber wir schon einmal gesprochen haben? Sie wissen, zu versuchen, die Angst zu ertragen. Sie wissen doch, wodurch sie ausgelöst wurde. Die Angst an sich ist nie gefährlich. Sie fühlt sich nur so an. Sie müssen daran arbeiten, dieses Gefühl zu ertragen. Nur für eine Weile, denn dann geht sie vorbei.«
»Ich weiß.«
»Und die anderen Male?«
»Welche anderen Male?«
»Als Sie sich geritzt haben.«
Sie seufzt und schaut demonstrativ aus dem Fenster. Die Wut in ihrer Stimme ist zum Teil durch Müdigkeit ersetzt worden.
»Also, einmal war ich besoffen, das zählt wohl nicht richtig. Dann bin ich nicht ich selbst. Es war auf einer Party in Haninge, bei einem Typen vom Job.«
»Ist etwas Spezielles auf der Party passiert, was diese Gefühle ausgelöst hat?«
Sara zuckt mit den Schultern und lässt eine weitere Zigarettenkippe in die Vase mit meinen bereits nikotinvergifteten Schnittblumen fallen.
»Versuchen Sie es. Sara, es ist wichtig. Sie müssen sich selbst helfen. Ich weiß, dass das schwerfällt.«
»Da war ein Typ …«
»Ja, und?«
»Ja, und der war Göran irgendwie ziemlich ähnlich.«
»Ihrem Pflegevater?«
»Ja«, nickt Sara, »er hat mich wie Göran angefasst. Plötzlich … Sie wissen ja, ich will nicht mehr an all das denken, aber als er dastand und mich betatscht hat, mich mit seinen ekligen Händen begrabbelt hat, da ist alles wieder hochgekommen. Ich hab ihn ganz fest weggestoßen, direkt gegen einen Tisch. Er war ziemlich besoffen, deshalb ist er gestolpert und eine Augenbraue ist aufgeplatzt.«
»Und was ist dann passiert?«
»Tja, er war stinksauer. Fing an, rumzuschreien, und ist hinter mir hergerannt.«
Sara sieht plötzlich müde und sonderbar klein aus.
»Wissen Sie, eigentlich war es gar nicht so gefährlich, wie es jetzt klingt. Er war besoffen, hab ich das schon gesagt? Er hat mich nicht zu fassen gekriegt. Und ich bin nach Hause gefahren.«
»Und?«
»Und dann habe ich es gemacht, okay? Können wir jetzt über etwas anderes reden?«
»Versuchen Sie zu beschreiben, wie Sie sich gefühlt haben, direkt bevor Sie sich geritzt haben.«
»Wie ich mich gefühlt habe? HALLO, das WISSEN Sie doch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe. Als würde ich kaputt gehen. Ich habe an diesen ekligen Kerl gedacht und an sein widerliches Getatsche und an Göran, und dann hatte ich das Gefühl, ich würde einfach keine Luft mehr kriegen. Und dann habe ich es gemacht, und dann habe ich mich besser gefühlt. Irgendwie sauberer. Und ruhig. Ich konnte schlafen. Okay? Können wir jetzt über etwas anderes reden? Außerdem muss ich bald los. Ich habe ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum. Können wir nicht lieber nächstes Mal darüber reden?«
»Ich möchte, dass Sie bis zum nächsten Mal die Hausaufgabe machen, über die wir gesprochen haben, Sara.«
»Ja, klar. Dann kann ich jetzt gehen?«
»Tun Sie das. Wir sehen uns nächste Woche.«
Ich stelle die Videokamera ab und falle wieder zurück auf den Stuhl. Wie immer nach meinen Sitzungen mit Sara bin ich wie leergepumpt, bar jeder Energie. Das liegt nicht nur an all den anstrengenden Dingen, die sie erzählt, sondern auch daran, dass ich die ganze Zeit auf der Hut sein muss. Saras Therapeutin zu sein ist ein Balanceakt.
Ihr Hintergrund ist leider nicht besonders ungewöhnlich. Sie ist in einem scheinbar ganz normalen Mittelklassehaushalt in Vällingby aufgewachsen, als jüngste von drei Geschwistern. Das einzig Anormale an der Familiensituation war die Mutter mit ihren Alkoholproblemen, auch wenn sie in gesellschaftlicher Hinsicht funktionierte. Sara erklärt gern, dass dies ab und zu sogar ein Vorteil war. So schwieg die Mutter beispielsweise auf Elternabenden, sich sehr wohl bewusst, dass sie sich in dem Moment, in dem sie den Mund öffnete, als hoffnungslose Alkoholikerin entlarven würde. Und sie schlief auch immer schon, wenn Sara nach Hause kam, fragte nie nach, wo Sara gewesen war oder warum sie erst mitten in der Nacht erschien oder woher sie immer wieder neue Kleider hatte. Kleider, die sie nicht von ihren Eltern bekommen hatte.
Sara hatte beträchtliche Konzentrationsprobleme und Schwierigkeiten in der Schule. In der dritten Klasse zündete sie die Gardinen in der Turnhalle mit einem Feuerzeug an, das sie der Turnlehrerin geklaut hatte (die immer heimlich im Umkleideraum rauchte, während die Schüler gezwungen waren, im Herbstregen eine Runde nach der anderen auf dem Schulhof zu drehen). In der Mittelstufe durfte sie zum ersten Mal im Streifenwagen mitfahren, nachdem sie im Konsum geklaut hatte. Sie fing an, ältere Jungs zu treffen, tat sich mit Steffe zusammen, der achtzehn war, als sie selbst erst dreizehn war. Wurde schwanger und ließ abtreiben.
Die Eltern stellten währenddessen fest, dass sie vollkommen die Kontrolle verloren hatten, und suchten deshalb soziale Einrichtungen auf, um sich Hilfe zu holen, woraufhin vom zuständigen Sozialamt eine Untersuchung in die Wege geleitet wurde, die darin resultierte, dass Sara eine Betreuerin zugeteilt und sie gezwungen wurde, regelmäßig Urinproben abzuliefern. Derartige Maßnahmen sind meist ziemlich folgenlos, und das waren sie auch in diesem Fall. Saras Betreuerin legte ihr Mandat bald nieder, nachdem Sara sie eine »Scheißsozialarbeiterfotze« und eine »verdammte Sozialarbeitervettel« genannt und auf ihren Schreibtisch gerotzt hatte. Die Betreuerin behauptete außerdem, sich von Sara bedroht zu fühlen, wobei sie Sara wohl in Wahrheit eher leid war, weil sie so anstrengend und arbeitsintensiv war.
Aggressiv? Auf jeden Fall. Aber ich habe nie erlebt, dass Sara jemand anderem als sich selbst geschadet hat. Man kann es wohl am besten so umschreiben, dass sie eine untrügliche, fast schlafwandlerische Fähigkeit besitzt, sich immer genau für die Alternative zu entscheiden, die die schlechteste ist, und immer für den Weg, der ihr den maximalen Schmerz bereiten wird. Sie scheint eine Art eingebauten, unzerstörbaren Via-Dolorosa-Kompass im Schädel zu haben.
Nach dem Bruch mit der »Scheißsozialarbeitervettel« folgte die Einweisung in eine Pflegefamilie. Als Sara fünfzehn war, vergewaltigte ihr Pflegevater sie wiederholte Male. Sara tat das aus ihrem Gesichtspunkt einzig Logische und versuchte wegzulaufen. Tatsache ist, dass es ihr mehrere Male gelang, sie aber immer wieder aufgegriffen und von den peniblen lokalen Ordnungsmächten zurück in die Pflegefamilie gebracht wurde. Und hier manifestierte sich ihr destruktives, selbstschädigendes und sexuell ausagierendes Verhalten erst richtig.
Als Sara achtzehn Jahre alt war, bekam sie zum ersten Mal eine echte psychiatrische Diagnose: Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie üblich nützte es nichts, dass es der Psychiatrie gelang, das in Worte zu kleiden, was ihr fehlte. Es ging ihr immer schlechter. Kurz danach wurde sie für zwei Monate in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen wegen ihres vermutlich durch Drogen verursachten psychoseähnlichen Zustands. Sara selbst redet von der Psychiatrie als »die Hölle«, und ich nehme an, dass sie bei ihrem Abstieg dorthin mehr oder minder alle Ambitionen aufgegeben hat, jemals ein normales Leben führen zu können, ein »Mustermann-Leben«, wie sie es selbst immer nennt. In Saras Fall folgte der Zeit in der psychiatrischen Institution eine Periode immer intensiveren Drogenmissbrauchs, und ein halbes Jahr nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie wurde Sara zwangsweise in die staatliche Entzugsanstalt in Norrtälje eingewiesen, um ihren Missbrauch von Drogen, die zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich aus Amphetaminen und synthetischen Halluzinogenen bestanden, in den Griff zu bekommen.
Dann geschah etwas. Unklar, was. Nicht einmal Sara kann es anders erklären als mit den Worten, sie habe einfach beschlossen zu leben. Und nicht zu sterben.
Und heute? Drogenfrei seit zwei Jahren, eine eigene Wohnung im Stockholmer Midsommerkransen-Viertel. Arbeitslos. Viele Freundinnen und noch mehr Freunde.
Sara ist wirklich ein Veteran, was die Psychiatrie angeht. Sie ist nach allen Regeln der Kunst analysiert worden. In der Kinderpsychiatrie, in ambulanten psychiatrischen Einrichtungen und den geschlossenen Anstalten. Sie hat mehr Sozialarbeiter, Betreuer, Psychologen und Psychiater gesehen, als ich je Patienten hatte. Das verpflichtet. Manchmal habe ich das Gefühl, als wäge sie meine Kommentare ab, kategorisiere mich und sortiere mich gedanklich in eine Rangordnung von Hirnverdrehern ein. Sie kann Kommentare von sich geben, die zweifellos von meinen Vorgängern stammen: »Ja, sicher, aber haben Sie auch die wachsende Konkurrenz unter den Geschwistern bedacht, die ein Resultat der frühen Trennung meiner Eltern war?« oder »Ich gebe ja zu, dass das schrecklich ödipal klingt, aber manchmal habe ich wirklich geglaubt, dass Göran mich auf seine Art geliebt hat.«
Ich denke an Saras dünne, vernarbte Beine und Arme. Sie sehen aus wie ein Bahnhof, auf dem sich die Gleise mal kreuzen, mal parallel nebeneinander verlaufen. Man nennt sie auch »Ritzer«. Mädchen, die sich selbst verletzen, um ihre Angst zu dämpfen.
Aber natürlich ist Sara viel mehr als eine psychiatrische Diagnose: Sie ist intelligent, Expertin im Manipulieren und tatsächlich ziemlich unterhaltsam, wenn sie in der richtigen Laune ist. Jetzt soll sie wieder rehabilitiert werden. An das normale Leben angepasst werden, das sie niemals hatte und sicher niemals bekommen wird.
Angepasst werden. Sich anpassen.
Ich lege die Hand auf ihre Akte – dick wie eine Bibel ist sie -, mit den Berichten der Sozialämter, den Aktenauszügen von der ambulanten psychiatrischen Betreuung und der geschlossenen Anstalt. Gedankenverloren lasse ich die Finger über die Seiten gleiten. Mein Blick bleibt bei den Aufzeichnungen aus dem St.-Görans-Krankenhaus hängen, aus der Zeit, als Sara in die Psychiatrie aufgenommen wurde.
Patientin: Sara Matteus, Personenidentifikationsnummer: 821123 – 0424
Kontaktaufnahme: Pat. kommt akut in die Psych. 18.37 Uhr auf Veranlass. der Polizei Norrmalm, nachdem sie wegen Ladendiebstahls bei Twilfit im Einkaufszentrum festgenommen wurde. Da Pat. sich verwirrt und aggressiv verhielt, wurde sie von Polizei zur Aufnahme in die Psych. gebracht.
Aktuell: Pat. ist eine 18-jährige Frau mit Drogenproblemen und Angststörungen. Sie war schon früher in Kontakt sowohl mit der Jugendpsych. als auch der psych. Ambulanz (Vällingby, ambulante psychiatrische Klinik). Momentan hat Pat. keinen psych. Kontakt und auch keine Medikation. Pat. erklärt selbst, dass es ihr sehr schlecht geht und sie Hilfe braucht. Sie ist zeitweise klar ansprechbar und klagt dann über große Ängste und kann berichten, dass sie Drogen genommen hat, kann sich aber nicht erinnern, welche. Ansonsten aggressiv, zeigt Zeichen paranoider Zwangsvorstellungen dahingehend, dass sie von Sozialarbeitern und Polizei verfolgt wird. Pat. weist Zeichen von Eigenverletzungen auf (Narben und Wunden an den Unterarmen und an der Schenkelinnenseite).
Ich lasse seufzend die dicke Patientenakte los, so dass sie mit einem dumpfen Knall zu Boden fällt. Ich habe meine Dosis an Sara Matteus für heute gehabt. Es ist Zeit zu lüften und mich auf Ilja vorzubereiten, die russische Mutter eines Säuglings, die ihren schwedischen Mann via Internet kennen gelernt hat. Die so tüchtig und angepasst ist und als OP-SCHWESTER im privaten Sophia-Krankenhaus arbeitet, aber unter dem ununterdrückbaren Zwang leidet, im Gartenschuppen der Familie alle Messer und Scheren zu verstecken, aus Angst, sie könnte ihr Baby mit einem scharfen Gegenstand verletzen.
Es könnte ein Idyll sein.
Mein Haus ist klein und liegt nur einen Steinwurf vom Strand entfernt. Große Terrassenfenster nehmen die ganze Breitseite zum Wasser ein. Es ist ein helles Haus. Der Boden ist mit alten, dicken, abgetretenen Kieferbohlen bedeckt, zwischen denen tiefe Spalten laufen, angefüllt mit dem Staub mehrerer Jahrzehnte.
In der Küche muss sich die Originaleinrichtung aus den Fünfzigerjahren mit abgeschmirgelten Schiebetüren aus vormals blau gestrichenen Sperrholzbrettern mit neuen Küchengeräten arrangieren. Das Schlafzimmer zeigt auf die Klippen der einen Buchtseite, und durch das große Fenster kann man das Meer sehen, selbst wenn man im Bett liegt, das viel zu breit für mich ist.
Badezimmer und Toilette liegen in einem separaten Gebäude; dem kleinen Häuschen, das einmal der Holzschuppen war. Um dorthin zu gelangen, muss ich durch die Tür an der Frontseite nach draußen und zwischen den Rabatten mit den Buschrosen entlang.
Vor den Häusern breitet sich eine kleine Grasfläche aus. Unkraut und Gestrüpp machen alle traditionellen Rasenbemühungen unmöglich. Stattdessen habe ich zwei kleine Trampelpfade durch die wild wuchernde Vegetation gelegt; einen zu dem schiefen alten Anleger und einen zu den Klippen.
Am Strand wachsen Fetthenne, Heide und Grauer Thymian wild durcheinander. Kleine, windgepeitschte Zwergkiefern klammern sich an die hohen Klippen, hinter denen der Wald und die Wildnis beginnen. Obwohl ich nicht einmal eine Stunde von Stockholm entfernt wohne, liegt das nächste Haus fast einen Kilometer entfernt.
Es war Stefans Idee, hier zu wohnen, spartanisch und nahe der Natur, nahe den Tauchmöglichkeiten. Es klang wie ein guter Vorschlag. Damals. Kein Traum war zu naiv, keine Idee zu verwegen für mich. Jetzt kann ich das nicht mehr sagen. Mit der Einsamkeit ist auch eine sonderbare Passivität über mich gekommen; eine Glühbirne zu wechseln scheint mir wie eine große Sache, und den Holzfußboden zu streichen wie ein nicht durchführbares Projekt – unmöglich in einzelne Arbeitsschritte einzuteilen. Umziehen geht schon gar nicht. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte.
Meine Freunde betrachten mich mit einer Mischung aus Mitleid und Besorgnis, wenn sie mich besuchen. Sie sind der Meinung, ich sollte Stefans Sachen wegräumen: den Rasierapparat aus dem Badezimmer, die Tauchutensilien aus dem Abstellraum, die Kleider aus dem Schrank, die Armbanduhr vom Nachttisch, die ich nachts umklammere, wenn die Sehnsucht zu groß wird.
»Du kannst doch nicht in einem Mausoleum leben«, pflegt Aina zu sagen und mir dabei vorsichtig übers kurze Haar zu fahren.
Natürlich hat sie Recht. Ich sollte Stefans Sachen wegschaffen. Ich sollte Stefan wegschaffen.
»Du arbeitest zu viel«, sagt sie dann mit einem Seufzer. »Besuch mich doch mal ein Wochenende.«
Ich lehne immer dankend ab. Es gibt ja so viel zu tun am Haus, und da sind so viele Protokolle, die geschrieben werden müssen. Papiere, die geordnet werden müssen. Dann lächelt Aina jedes Mal, als wüsste sie, dass ich lüge, was ich natürlich auch tue.
Manchmal wohnt Aina bei mir, statt die Wochenenden in Södermalms lärmenden Kneipen in Gesellschaft von Männern zu verbringen, deren Namen sie bald wieder vergessen wird. Dann essen wir Muscheln in Wein, trinken Unmengen an billigem Weißwein dazu und reden über unsere Patienten oder Ainas Typen. Oder über nichts Besonderes. Wir springen nackt von den Klippen und hören viel zu laut David Bowie, so dass die Tiere des Waldes erschreckt aufblicken.
Danach erscheint das Haus jedes Mal noch leerer als vorher, die Fenster starren wie große leere Löcher aufs Meer, und die Stille ist ohrenbetäubend. In der Regel habe ich einen Kater, und da ich zu träge bin, zum Einkaufen zu fahren, esse ich Vanilleeis zu Mittag und Nudeln mit Ketchup abends. Dazu ein paar Gläser Wein. Ich achte penibel darauf, alle Lampen einzuschalten, wenn der Abend kommt, denn ich mag die Dunkelheit nicht. Es ist, als verwischte die Abwesenheit des Lichts die Grenzen zwischen mir und meiner Umgebung. Das erschreckt mich mehr, als ich zugeben will, und ruft das Gefühl hervor, das ich am besten kenne: Angst.
Ich habe mich jetzt seit mehreren Jahren mit der Angst beschäftigt und kann ohne Übertreibung sagen, dass ich ihr nahestehe, so nahe, dass ich inzwischen nicht mehr registriere, wenn sie sich in der Dämmerung nähert. Stattdessen heiße ich sie resigniert willkommen wie einen alten, wenn auch nicht gerade gern gesehenen Gast.
Das ist auch der Grund, warum ich bei eingeschalteten Lampen schlafe.
Ich bin also Therapeutin. Approbierte Psychologin. Staatlich anerkannte Psychologin. An der Praxistür steht es klar und deutlich auf dem glänzenden Messingschild: Södermalms Psychotherapiepraxis. Doktor der Psychologie. Doktor der Psychotherapie. Siri Bergman.
Ab und zu frage ich mich, wie meine Patienten wohl reagieren würden, wenn sie wüssten, dass diese scheinbar so ruhige, kompetente Frau, an die sie sich mit all ihren Geheimnissen und Ängsten wenden, nicht allein in einem dunklen Raum schlafen kann. Was würden sie von meiner Unfähigkeit halten, mich mit meinen eigenen schwarzen Löchern zu konfrontieren, während ich fordere, dass sie sich den ihren nähern? Bei diesen Gedanken kommt die Scham; ich bin eine schlechte Therapeutin, ich bin gescheitert, ich sollte darüber hinweggekommen sein.
Sollte weiter sein.
Aina lacht mich dann immer aus und weist auf mein Kontrollbedürfnis hin und meinen Perfektionismus. »Du bist nicht gleichzusetzen mit deinem Beruf«, sagt sie. »Therapeutin zu sein, das ist doch keine blöde Berufung. Du kommst her, hast pro Tag deine vier Patienten, und dann gehst du nach Hause und bist Siri. Gescheitert, depressiv, passiv und phobisch zu sein, das sollte dich sogar zu einer besseren Therapeutin machen. Solange du es nicht im Beisein deiner Patienten bist. Das solltest du übrigens schon in der ersten Stunde deiner psychologischen Ausbildung gelernt haben.«
Und Aina muss es wissen, denn ihr Name steht unter meinem auf dem glänzenden Messingschild: Aina Davidsson. Doktor der Psychologie. Doktor der Psychotherapie.
Aina und Siri. Ein Begriff seit den ersten nervösen Wochen an der Stockholmer Universität. Das Merkwürdige ist nicht, dass wir immer noch Freundinnen sind. Das Merkwürdige ist, dass wir unseren Traum von einer eigenen Praxis verwirklicht haben.
Wir haben noch einen weiteren Kollegen. Sven Widelius, einen alten Fuchs, der seit mehr als zwanzig Jahren als Therapeut arbeitet. Im Prinzip teilen wir uns die Räume, den Empfang und die Kaffeeküche. Unsere Zusammenarbeit beschränkt sich genau darauf. Die Praxis liegt am Medborgarplatz, im selben Gebäude wie die futuristischen Verkaufsräume der Söderhallarna, einer modernen Einkaufsmeile, nur ein paar Stockwerke höher.
Jeden Werktag stehe ich vor unserer Tür und schnappe nach Luft, nachdem ich die Treppen hinaufgelaufen bin. Ich schaue das polierte Schild an, überlege, zögere und stecke schließlich den Schlüssel ins Schloss.
So auch an diesem Tag. Es ist Mitte August. Der Sommer ist so intensiv schön auf eine gefährliche, fast ein wenig erotische Art. Die Düfte und Ausdünstungen der Natur sind schwer und süßlich und verursachen ein mulmiges Gefühl, verstärkt noch durch die drückende Hitze. In der Stadt vermischt sich der metallische Gestank von Abgasen und der Luftverschmutzung mit den Essensgerüchen der Restaurants und Würstchenbuden. Und mitten in dieser Geruchskakophonie gibt es ihn, den nicht zu ignorierenden Geruch nach Verwesung.
Das Grün vibriert vor Intensität, und in der Stadt wie auch daheim bei meinem Häuschen ist die Luft erfüllt von Tausenden von Fliegen und Insekten. Wenn ich zwischen Bushaltestelle und meinem Häuschen unterwegs bin, kann ich das Geräusch kriechenden, sich schlängelnden, primitiven Lebens hören. Ich kann sehen, wie das Grün des Waldbodens von Millionen von Insekten vibriert, und fühlen, wie jeder Schritt unzählige winziger Organismen zerquetscht und neue Biotope von heruntergetrampeltem Moos, zerdrückten Ameisen und Käfern schafft. Für mich stellt die fleischige Sinnlichkeit des Sommers den Höhepunkt des Jahres dar.
Aber der Sommer stellt auch seine Anforderungen. Der Sommer fordert Freude und Leben, gesellige Zusammenkünfte und Ferien. Mein Sommer in diesem Jahr hat in einem erzwungenen Besuch im Ferienhaus meiner Eltern in den Wäldern von Sörmland bestanden. Eine Woche musste ich bleiben und die Besorgnis meiner Eltern und Geschwister ertragen, bevor sie mich endlich wieder gehen ließen. Ich konnte die Furcht direkt hinter dem Lächeln meiner Mutter sehen und in der Art, wie meine Schwestern mich behandelten, als wäre ich aus zerbrechlichem Porzellan. Und im Versuch meines Vaters, sich mit mir zu unterhalten, war die Panik direkt unter der Oberfläche zu spüren. Ich zweifle daran, dass irgendeiner von ihnen mich vermisst hat, nachdem ich abgefahren war.
Den restlichen Sommer habe ich im Garten gesessen und übers Meer geschaut. Ich habe überlegt, ob ich wieder anfangen sollte zu tauchen. Die Ausrüstung ist ja da. Ich habe Erfahrung. Mir fehlt das Gefühl, mich in einer anderen Welt zu bewegen, die vielleicht besser ist. Tauchen macht mir keine Angst, trotz allem, was passiert ist, aber ich kann nicht das Engagement aufbringen, das nötig wäre. Und ich möchte meine ehemaligen Freunde nicht wiedersehen.
Stattdessen tue ich so, als würde ich mich um die Beete kümmern, und trinke Wein, spiele mit dem fetten Bauernkater Ziggy, der seit ein paar Jahren mein Haus zu seinem Heim erklärt hat, und ertrage den endlosen Zeitabschnitt, der Sommer genannt wird.
Bis jetzt.
Es ist mein vierter Arbeitstag. Tag vier. Mit vier Klienten.
Am Empfang steht Marianne. Eine Halbtagssekretärin ist ein unnötiger Luxus, weil wir sie eigentlich nicht brauchen, den wir uns aber dennoch leisten.
Marianne. Wie würden wir nur ohne sie zurechtkommen? Ihr kurzes blondes Haar kräuselt sich auf der Stirn, und sie strahlt, als ich hereinkomme.
»Siri! Dann sind wir auch heute komplett! Du hast um zehn Uhr eine Absage.«
Sie schaut mich bedauernd an, als wäre es ihre Schuld, dass Siv Malmstedt nicht kommt. Siv hat höchstwahrscheinlich abgesagt, um die zweistündige Metrofahrt und die damit verbundene Exposition zu umgehen. Marianne, die schon seit langem mit den Routinen vertraut ist, teilt mir mit, dass die Rechnung bereits losgeschickt ist und Siv dennoch ihren normalen Termin am nächsten Donnerstag haben möchte.
Die Praxis ist klein, aber gemütlich. Wir haben drei Sprechzimmer, einen Empfang und eine kleine Pantry, in der wir Kaffee trinken. Ganz hinten befinden sich eine Toilette und eine Dusche. Mein Zimmer wird salopp das grüne Zimmer genannt, da die Wände in einem sanften Lindgrün gehalten sind, ein Versuch, eine irgendwie besänftigende Stimmung hervorzurufen. Ansonsten sieht es aus wie in jedem Sprechzimmer: zwei Stühle, die im rechten Winkel zueinander stehen, ein kleiner Tisch mit einer Blumenvase aus handgeblasenem blauem Glas und eine Packung Taschentücher, die signalisieren, dass man sich hier gehen lassen darf, dass man hier seine Gefühle zeigen und weinen darf.
An einer Wand, die ansonsten mit neutralen Lithographien passender Künstler geschmückt ist, hängt eine Magnettafel. Das, was mein Zimmer möglicherweise von den meisten anderen Therapieräumen unterscheidet, ist wohl die häufig genutzte Videokamera, die auf ihrem Stativ thront. Ich nehme die meisten meiner Gespräche auf. Manchmal, damit die Patienten die Sitzung zu Hause rekapitulieren können, manchmal für mich selbst.
Die Bänder sind Aktenmaterial und werden in dem schweren, grün gestrichenen, feuersicheren Archivschrank verwahrt, der sich in der Rezeption befindet. Aina behauptet, meine Bänder seien nur ein weiterer Beweis für mein Kontrollbedürfnis, und beschwert sich, dass der Platz im Aktenschrank immer knapper wird. Ich erwidere, dass das wohl kaum ein Problem für sie darstellen könne, da sie ja doch nie mehr als zwei Zeilen notiert.
So lässt sie mich weitermachen.
Ich musste sie dazu bringen, zu begreifen. So fing es an. Ich musste ihr klarmachen, was sie mir angetan hat. Aber wie sollte ich es erklären? Dass der Schmerz nachts wie tausend Messer in meinem Inneren sticht, Messer, die in Magen und Brust arbeiten. Wie ein wollüstiges Raubtier, das mich langsam von innen heraus auffrisst, ein gewaltiger Parasit mit rasierklingenscharfen Zähnen und kalten, glatten, blitzschnellen Gliedern, aus denen sich zu befreien unmöglich ist.
Würde ich die Leere und die Sehnsucht beschreiben können? Dass jeder Sonnenaufgang verkündete, dass wieder ein sinnloser Tag herannahte. Sinnlose Stunden, erfüllt von ebenso sinnlosen Aktivitäten, in Erwartung von irgendetwas. Und mit jedem Tag wuchs der Abstand. Der Abstand zu ihr.
Würde ich erklären können, dass die Träume so intensiv und wirklich erschienen, dass ich vor Enttäuschung weinte, wenn ich aufwachte, in Schweiß gebadet wie ein Fieberkranker?
Kann man überhaupt jemand anderen dazu bringen, so etwas zu verstehen? Und selbst wenn es mir gelänge, was würde es nützen?
Letztendlich?
Datum: 16. August Uhrzeit: 13.00 Uhr Ort: grünes Zimmer, Praxis Patientin: Charlotte Mimer
»Charlotte, ich dachte, wir fangen am besten damit an, wie Sie den Sommer über klargekommen sind. Schließlich war das eine lange Zeit.«
»Ich denke, der Sommer ist gut gelaufen. Ich möchte Ihnen meine Aufzeichnungen zeigen.«
Charlotte Mimer beugt sich zu ihrer Aktentasche und zieht eine Mappe heraus, in der die Unterlagen sauber geordnet liegen. Ich registriere, dass sie wie üblich alle Aufzeichnungen mit demselben Stift und der gleichen schönen, ordentlichen Handschrift gemacht hat. Charlotte überreicht mir die Mappe, während sie sich gleichzeitig das sorgfältig geschnittene braune Haar hinters Ohr streicht. Ich erkenne, dass sie erwartungsvoll und stolz ist, und ich freue mich für sie.
»Dann lassen Sie uns bei den Eintragungen für den Juni anfangen.«
Die Eintragungen, die Charlotte den Sommer über machen sollte, bestehen in Aufzeichnungen über jede Mahlzeit. Was sie gegessen hat, wie viel, wo sie sich jeweils befunden hat. Nach jeder fertigen Mahlzeit sollten Unbehagen und Angst bewertet werden. Denn eine Person mit einer ernsthaften Essstörung zeigt häufig starke Angst nach den Mahlzeiten, Essen wird mit Fett verknüpft. Um diese Angst loszuwerden, werden dann Verhaltensmuster benutzt, die sich in jahrelangem Training eingeschlichen haben. Hunger, Erbrechen und übertriebenes sportliches Training. Was wiederum zu neuen Heißhungerattacken führt, ohne dass einem dies bewusst sein mag, denn die Angst ist in diesem Moment so stark und quälend, dass alles andere keine Rolle spielt. Es ist ein Teufelskreis.
Ich nehme Charlottes sorgfältig geführtes Essenstagebuch in die Hand und schaue mir die Liste für den Juni an. Regelmäßige Mahlzeiten, keine größeren Angstattacken nach beendeter Mahlzeit, keine Fressorgien, kein Erbrechen.
»Möchten Sie erzählen?«, frage ich.
»Ich weiß nicht … es hat einfach gut geklappt. Plötzlich war es … ganz einfach.«
Charlotte ist fast vierzig, erfolgreich im Beruf, sie arbeitet als Vertriebsleiterin in einer großen, multinationalen Firma. Fast fünfundzwanzig Jahre lang hat sie in aller Stille mit Essstörungen gekämpft. Erst als ihr Zahnarzt sie mit den Knirschschäden an ihren Zähnen konfrontierte, hat sie Hilfe gesucht. Seit Ende April ist sie in Behandlung und so etwas wie eine Musterpatientin. Genau wie sie eine perfekte Vertriebsleiterin ist, ist sie auch die perfekte Psychotherapiepatientin. Ihr großes Problem sind vielleicht gerade diese unerhört großen Erwartungen, die sie an sich selbst stellt. Charlotte hat eine Todesangst, zu versagen. Bis jetzt haben wir das nur peripher berührt und stattdessen an ihren Heißhungerattacken und dem Erbrechen gearbeitet. Im Unterschied zu Sara Matteus ist Charlotte eine Patientin, die Energie verströmt. Ihre Furcht, inkompetent zu sein und nicht zu genügen, lässt mich selbst tüchtig und fähig erscheinen.
Wir betrachten weiter Charlottes Aufzeichnungen. Juli, August: wenig Angst, kein Erbrechen. Wir finden uns in einem gemeinsamen Lächeln, und Charlotte bekommt das Lob, das sie so gern haben möchte, sich aber auch verdient hat.
»Da ist noch etwas anderes.«
Charlotte zögert. Sie windet sich auf ihrem Stuhl, und wie immer, wenn sie nervös ist, fängt sie an, mit einem Fuß zu wippen, der heute in Slipper mit Noppen auf der Gummisohle gekleidet ist. Ich ahne, dass dies der Typ von Schuhen ist, den zu kaufen ich mir nie werde leisten können.
»Erzählen Sie!«
»Ich weiß nicht …«
Charlotte sieht plötzlich aus, als berge sie ein Geheimnis in sich. Ein Geheimnis, das sie mir gleich verraten wird. Denn so funktioniert das hier, sie verraten mir alle ihre Geheimnisse in diesem kleinen grünen Zimmer.
»Ich weiß nicht, ob das überhaupt etwas mit der Therapie zu tun hat. Wissen Sie, ich habe über das Leben nachgedacht.«
Charlotte bricht ab, und rote Flecken breiten sich auf ihrem Hals aus, es sieht aus, als hätten kleine Finger fest zugedrückt und dann plötzlich losgelassen. Mir ist klar, dass es viel Mut von ihr erfordert, das anzupacken, was sie jetzt sagen will.
»Ich habe … wie viele Jahre sind es eigentlich schon – mein Gott, fünfundzwanzig vielleicht? -, die habe ich damit verbracht, die ganze Zeit ans Essen zu denken. Und an meinen Körper. Und an meinen Bauch. Und an meine Schenkel. Und damit, zum Sport zu gehen. Wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe, dann habe ich gearbeitet. Job. Körper. Essen. Ich bin die jüngste und erfolgreichste Vertriebsleiterin im ganzen Konzern, aber ich habe kein Leben. Kein richtiges Leben. Keine Freunde. Zumindest keine NAHEN Freunde. Keinen Mann. Keine Kinder. Ich war so damit beschäftigt, perfekt zu werden, dass ich vergessen habe, wozu ich eigentlich perfekt sein will. Ich wollte … geliebt … werden. Ich will geliebt werden. Und jetzt ist es zu spät.«
Charlotte bricht in Tränen aus, die wie kleine Bächlein über ihre glühenden Wangen rinnen. Sie schluchzt und nimmt gleich mehrere Taschentücher aus der Packung. Putzt sich die Nase, wischt sich die Tränen ab, weint. Ich schiebe ihr die Packung über den Tisch hin zu und streichle leicht mit der Hand ihren Arm.
»Charlotte«, ich fange ihren Blick ein, »es ist nicht ungewöhnlich, dass man so empfindet wie Sie, wenn man das durchmacht, was Sie gerade durchmachen … Sie waren gehandicapt, sind von einer schweren Krankheit gebremst worden, und jetzt werden Sie langsam wieder gesund. Damit kommt die Einsicht über all die verlorenen Jahre. Das ist kein Wunder. Das ist gut so. Was ich wissen möchte: Warum sagen Sie, dass es zu spät ist?«
Sie bleibt eine Weile schweigend sitzen und betrachtet die Wand über meinem Kopf, bevor sie mit spröder Stimme antwortet.
»Alt, ich werde alt. Und es scheint, als könnte ich es nicht begreifen, es nicht akzeptieren. Ich laufe irgendwie einfach herum und warte darauf… wieder jung zu werden.«
»Wieder jung zu werden?«
»Nun ja, vielleicht im Frühling?«, sagt sie lächelnd, doch es ist ein schiefes, wehmütiges Lächeln voller Schmerz.
Ich erwidere ihr Lächeln. Das Gefühl wirkt vertraut, als wäre die Zeit ein Kanal, auf dem es möglich ist, in kontrollierten Bahnen in beide Richtungen zu schwimmen, und nicht ein Wasserfall. Sie zuckt leicht mit den Schultern und fixiert mich mit resigniertem Blick.
»Wer will mich denn jetzt noch… ich bin … ich kann ja wahrscheinlich nicht einmal mehr ein Kind kriegen.«
Charlottes Sorgen. Charlottes Angst. Meinen so ähnlich. Kein Kind. Zu spät. Kein Mann. Keine Chance. Nie wieder.
Ich versuche Charlottes Gedanken zu bündeln und daraus etwas Sinnvolles zu machen. Sie dazu zu bringen, sich von außen zu betrachten. Objektiv. Den Wahrheitsgehalt ihrer Behauptungen zu überprüfen. Wir kommen darin überein, dass Charlottes Hausaufgabe darin bestehen soll, genau damit zu arbeiten, und dann sind ihre fünfundvierzig Minuten verstrichen, und Charlotte holt eine Haarbürste heraus, fährt sich damit über ihren Pagenkopf, und irgendwie gelingt es ihr, sich zu sammeln. Als sie mir zum Abschied die Hand gibt, existiert das schluchzende kleine Mädchen Charlotte Mimer nicht mehr. Aus dem Zimmer geht die Vertriebsleiterin Charlotte Mimer, und zurück bleibt die Psychotherapeutin Siri Bergman, und das bin ich.
Ich trete ans Fenster und schaue hinunter auf die Straße. Weit unten, auf dem Pflaster des Medborgarplatzes, geht eine Gruppe Kindergartenkinder. Die Augustsonne strahlt, als wüsste sie nicht, was sie sonst tun sollte. Kein Geräusch dringt in mein Zimmer, doch als ich die Augen schließe, kann ich mir vorstellen, wie die Kinderstimmen da unten klingen. Ein leises Gefühl, das ich nicht identifizieren kann, erfüllt meine Brust. Vielleicht ist es Trauer, vielleicht ist es nur Ruhe und Leere.
Abend.
Es gibt ein Ritual, das jeden Abend durchgeführt werden muss. Wenn ich die Arbeit beendet habe, die ich fast ohne Ausnahme täglich mit nach Hause bringe, nehme ich ein Bad im Meer. Jetzt im Sommer versuche ich darauf zu achten, ein wenig zu schwimmen. Anschließend koche ich mir das Essen.
Essen für eine Person.
Das ist nie etwas besonders Aufwendiges oder Nahrhaftes: Spaghetti mit fertiger Tomatensoße, gekaufte Pfannkuchen, Käseauflauf, gegrilltes Hähnchen vom ICA in Gustavsberg. Ich besitze nicht einmal ein Kochbuch. Zum Essen trinke ich Wein, wasche sorgfältig nach der Mahlzeit ab und gehe dann aus dem Haus, lege die kurze Strecke zwischen den Rosenbüschen zum Badezimmer im Nebenhäuschen zurück, ich will nicht riskieren, nach Einbruch der Dunkelheit auf die Toilette zu müssen. Ich rufe Ziggy herein. Manchmal klappt das. In anderen Nächten will er seine eigenen Wege gehen, statt mein Bett zu wärmen. Wenn ich zurück im Haus bin, gehe ich durch alle Zimmer und schalte die Lampen ein. Alle Lampen: Deckenleuchten, die Nachttischlampe, die Schreibtischlampe. Sogar die Lampe in der Dunstabzugshaube in der Küche. Ich kontrolliere, dass die große Taschenlampe strategisch günstig unterhalb meines Nachttischs liegt. Ein Stromausfall ist dort, wo ich wohne, keine Seltenheit. Dann schaue ich durch die großen Fenster hinaus in die Dunkelheit, zu dieser Tageszeit ähneln sie leeren, schwarzen Löchern.
Mit Hilfe von noch etwas mehr Wein schlafe ich, tief und traumlos.
Eine meine frühesten Erinnerungen ist, dass meine Schwester mich in den Schrank in ihrem Zimmer eingesperrt hat, weil ich die Haare ihrer Cindypuppe mit Nutella eingeschmiert hatte. Ich wollte Cindys Haarpracht nicht in einen kackbraunen Kuchen voller schmieriger, ranziger Schokocreme verwandeln. Geplant war gewesen, Cindy schöner zu machen. Schließlich benutzten ja sowohl meine Schwester als auch meine Mutter Gesichtsmasken und Haarpackungen, wenn sie besonders schön sein wollten.
Ich erinnere mich noch genau, wie ich sie anflehte und bettelte, mich doch wieder raus zu lassen, nachdem sie mich fest und unerbittlich in ihren Schrank geschubst hatte. »Du Rotzgöre, verdammte Rotzgöre! Du Miststück! Ich bring dich um, wenn du meine Cindy noch einmal anrührst.«
Im Schrank war es dunkel und stickig, als wäre die Luft selbst ganz schwer und würde sich auf mein Gesicht und meinen mageren Körper legen, mich gegen meinen Willen noch weiter hinein zwingen. Ich erinnere mich an einen leichten Geruch nach Wolle, Staub und etwas, das Gummi ähnelte.
Zögernd bewegte ich mich in der Dunkelheit, die Hände vor mir ausgestreckt. Kleider, die für den Sommer weggehängt worden waren, streiften meine Wangen, und die Stahlkanten alter Slalomskier stießen gegen meine Schulter.
Mein Herz schlug immer schneller, und plötzlich wuchs ein sonderbarer Druck auf meiner Brust. Mein erster Gedanke war eher Verblüffung als Angst; es war, als wäre mein Körper ängstlich geworden, während mein Intellekt begriff, was passierte, als könnte ich deutlich alle physiologischen Zeichen der Angst spüren und registrieren, bevor ich tatsächlich begriff , dass ich Angst hatte. Ich hörte die Bügel gegen die Kleiderstange reiben und fing instinktiv an, mit den Armen zu rudern. Daunenjacken, Mäntel und alte Skianzüge donnerten mit dumpfem Lärm um mich herum zu Boden, und ich hörte zu meiner eigenen Verwunderung, wie sich ein merkwürdig schriller Ton aus meiner Kehle schraubte. Es klang genau wie die Schweine, die wir gesehen hatten, als wir mit der Klasse auf dem Bauernhof in Flen auf Schulausflug gewesen waren.
»Aaaauaaa!«, schrie ich.
Dann fiel ich zwischen gemusterten Fausthandschuhen, Trainingsanzügen und sorgfältig gestapelten Bündeln von »Meine Wahre Geschichte« in Ohnmacht.
Datum: 21. August Uhrzeit: 15.00 Uhr Ort: grünes Zimmer, Praxis Patientin: Sara Matteus
»Ich muss Ihnen was erzählen!«
Sara kratzt aufgeregt mit einem langen, grün angemalten Fingernagel den Schorf auf ihrem Unterarm auf. Kratzt, zupft, zieht den Schorf ab, bis endlich die Wundflüssigkeit heraussickert.
»Ja, gern«, erkläre ich aufmunternd und studiere Sara das erste Mal während unseres Gesprächs eingehend. Sie erscheint aufgekratzt und energisch. Manisch. Das Feuerzeug trommelt immer schneller auf der Zigarettenpackung, und Sara reißt die Augen auf. Es fällt ihr offensichtlich schwer, still zu sitzen. Angeturnt, durchfährt es mein zynisches Gehirn, aber ich weiß, dass es nicht stimmt. Sara ist clean.
»Ich habe einen Mann kennen gelernt!«
Diskret schaue ich auf meinen Notizblock, damit mein Blick nicht verrät, was ich denke, doch Sara hat mich bereits durchschaut.
»Ich weiß, was Sie denken, aber dieses Mal ist es anders! Und ich weiß, dass Sie jetzt denken, dass ich das jedes Mal sage, aber dieses Mal stimmt es. Echt! Er ist viel älter als ich. Er hat einen richtigen Job, ist verdammt tüchtig. Verdient scheiß viel Geld. Auch wenn das nicht so wichtig ist«, fügt sie noch hinzu, um die Tatsache herunterzuspielen, dass der Mann, den sie kennen gelernt hat, rein äußerlich über die richtigen Eigenschaften verfügt.
Sie senkt ihre Stimme und flüstert theatralisch:
»Er sieht mich und versteht mich wie noch nie jemand vorher. Verstehen Sie es nicht falsch, aber ich kann mit ihm über Dinge reden, die ich niemandem sonst sagen kann, nicht einmal Ihnen. Er hört mir stundenlang zu. Hört sich meine Litaneien an, wissen Sie.«
Sara lächelt, zündet sich eine Zigarette an und schüttelt langsam den Kopf, was ihre blonden Haarwürste über die Schultern tanzen lässt.
»Er will, dass ich bei ihm einziehe.«
Das sagt sie langsam und in einem nachdenklichen Tonfall, aber in der Art, wie sie den Satz ausspricht, liegt auch etwas Triumphierendes.
Ich ordne meine Papiere und versuche, nicht auf ihre geröteten Wangen und ihren trotzigen Gesichtsausdruck zu starren.
»Ich freue mich für Sie, Sara. Wirklich. Wie lange kennen Sie diesen … Mann schon?«
Sara schaut zu Boden, lässt den Oberkörper auf den Knien ruhen und wiegt den Kopf langsam hin und her.
»Nun ja, ein paar Wochen. Aber wir treffen uns wahnsinnig oft. Die Tasche habe ich von ihm gekriegt«, ergänzt sie dann, und wie um die Legitimation ihrer Beziehung zu beweisen, hält sie die überdimensionierte, mit dem entsprechenden Monogramm gemusterte Guccitasche hoch.
»Er lädt mich zum Essen ein.«
Ich sage nichts.
»Er ist lieb zu mir.«
Sara zuckt mit den Schultern und sieht mich fragend an, als warte sie auf meine Zustimmung.
»Sara, Sie sind erwachsen und brauchen meine Zustimmung nicht, wenn Sie eine Beziehung eingehen«, erkläre ich, aber mein Tonfall verrät, dass ich mir Sorgen mache.
Es hört sich nicht richtig an. Ein erfolgreicher Mann mittleren Alters umwirbt ein junges Mädchen mit knallgrünem Nagellack, eine charmante Borderline-Persönlichkeit, deren Arme und Beine aufgrund all der Narben von Rasierklingen und Messern ein Zebramuster aufweisen. Zu meiner Verwunderung fürchte ich, er könnte Sara ausnutzen.
Nachdem Sara gegangen ist, bleibe ich noch eine Weile in meinem grünen Zimmer sitzen und schaue aus dem Fenster. Saras Freunde haben sich die Klinke in die Hand gegeben, seit ich ihre Therapeutin bin. Meistens waren sie in ihrem Alter, nicht selten mit Problemen, die ihren eigenen ähnelten. Unstete, heruntergekommene junge Typen mit Narben von Nadeln und Gott weiß was noch. Und anderen, viel schlimmeren Narben, eingeritzt in die Seele selbst. Jedes Mal war Sara gleich enthusiastisch, gleich hingerissen vor Verliebtheit, und jedes Mal endete es gleich: in bodenloser, finsterster Verzweiflung.
Ich wünschte, ich könnte verhindern, dass es wieder passiert.
Ich habe Stefan vor sieben Jahren bei einem Scheunenfest in der Nähe von Eslöv in Skåne kennen gelernt. Es war an einem schönen, aber ziemlich kalten Hochsommerabend. Ich erinnere mich daran, dass er warme Hände hatte und mir großzügig sein Jackett lieh, als wir durch den Raps spazieren gingen. Er faszinierte mich, was zumindest teilweise daran lag, wie mir später klar wurde, dass wir so unterschiedlich waren. Stefan war groß und blond – ich klein, zartgliedrig mit schwarzem, kurzgeschnittenem Haar und einem jungenhaften Körper. Er war immer fröhlich, nie schwermütig, hatte Unmengen von Freunden und immer etwas vor. Ich glaube, ich hoffte, dass ein wenig von seiner Lebensfreude auf mich abfärben würde. Und das tat es auch.
Es ist so merkwürdig, dass es Stefan nicht mehr gibt. Aber ich glaube, ich habe Stefans Tod akzeptiert. Diese absolute Lähmung und dieses panikartige Gefühl der Einsamkeit sind schon lange fort und haben stattdessen einer weichen, wehmütigen Trauer und einer fast greifbaren Leere Platz gemacht: mein Körper, der sich immer noch daran erinnert, wie weich seine Haut sich anfühlte, meine Hände, die das Gefühl vermissen, sein festes blondes Haar zu berühren, meine Zunge, die sich nach dem Salz auf der Haut in seinem Nacken sehnt.
Ich bin also Witwe. Wie kann man Witwe sein, wenn man vierunddreißig Jahre alt ist? Denen, die mich nicht kennen, sage ich immer, ich sei Single. Ich möchte nicht in irgendwelche Diskussionen über den Tauchunfall verwickelt werden oder zu hören bekommen, dass sie ganz genau wissen, was für ein Gefühl das ist, da sie vor hundert Jahren einmal ganz genau das Gleiche erlebt haben, oder dass es gut für mich wäre, häufiger raus zu kommen, oder etwas anderes, was mich nur wütend macht.
Meinen Freunden, die bereits alles wissen, brauche ich nichts zu erklären. Sie lassen mich sein, wie ich bin, und haben nicht das Bedürfnis, die Stille mit sinnlosem Geplapper anzufüllen. Sie lassen mich in meinem Häuschen sitzen und Wein schlürfen, statt mich in irgendwelche Kneipen zu zwingen.
Für meine Patienten bin ich die Therapeutin, und niemand fragt jemals nach meinem Privatleben, was eine Erleichterung ist.
Ich bin ein professioneller Seelenklempner ohne Vergangenheit.
Das gefällt mir.
Stefan absolvierte seine Assistentenzeit im Krankenhaus von Kristianstad, und ich arbeitete in Stockholm. Die dauernde Hin- und Herfahrerei war belastend. Wenn Stefan in Stockholm war, wurde er in meiner kleinen Ein-Zimmer-Wohnung in der Luntmakargatan einquartiert. Dann entwickelte sich ein Muster, dem wir im folgenden Jahr folgten: Die Woche über waren Arbeit und Freunde dran, am Wochenende genossen wir die Abgeschiedenheit in meiner Wohnung. Wir verbrachten die Zeit von unserer Sehnsucht getrieben vollkommen aufeinander fixiert in meinem schmalen, unbequemen Bett.
Alle meine Freunde waren der Ansicht, dass Stefan gut für mich war. Er ließ mich aufblühen und dämpfte meine finsteren, grüblerischen Seiten. Er hatte ein unkompliziertes Verhältnis zu den großen Lebensfragen und begegnete meinen Grübeleien nicht selten mit Erklärungen wie: »Wenn du dich mehr bewegen würdest, dann würdest du dich anders fühlen.« oder: »Hör auf, daran zu denken, und hilf mir lieber mit dem Brett hier.« Seine handfeste Art, behutsam meine Gedanken aus den finsteren Gewölben zu vertreiben, funktionierte gut, und ich vermisste meine tiefe, schwermütige Seite nie. Ich hatte immer schon ein gespaltenes Verhältnis zu meiner Tendenz gehabt, Gefühle und Probleme ständig zu hinterfragen, und nahm deshalb seine direkte, einfache Art voller Freude an.
Dann begann Stefan seine Facharztausbildung im Söderkrankenhaus. Keiner wunderte sich, dass er sich für die Orthopädie entschied. Das war ganz Stefan. Wenn etwas kaputt war, dann wollte er es auf der Stelle reparieren, nicht irgendwelche Untersuchungen durchführen oder sich in tiefschürfende Diskussionen stürzen, warum es nicht funktionierte.
Als Jenny Andersson, eine meiner Patientinnen, Selbstmord beging, war Stefan eine große Stütze. Ich selbst verlor mich in Zweifeln und Selbstanklagen, stellte sowohl meine Berufswahl in Frage als auch meine Fähigkeiten als Mensch. Stefan ließ mich einsehen, dass ich nicht die Verantwortung trug. Auf seine handfeste, analytische Art erklärte er mir, dass weder ich noch irgendjemand sonst es verhindern könnte, wenn jemand sich wirklich das Leben nehmen wollte. Ich erinnere mich immer noch an unsere damalige abendliche Diskussion, nachdem Stefan mich mit der Patchworkdecke zugedeckt hatte, die seine Großmutter in den Sechzigerjahren aus alten Taschentüchern zusammengenäht hatte.
Ich meinte zu Stefan, dass ich der Meinung sei, ich hätte sehen müssen, dass so etwas passieren würde.
»Wieso?«, fragte er und zuckte mit den Schultern.
Wenn irgendjemand es hätte ahnen müssen, dann ich.
»Bist du der Meinung, jetzt im Rückblick, dass es irgendwelche Zeichen gab?«
Ich zögerte eine Weile und versuchte mir meine letzten Treffen mit Jenny ins Gedächtnis zu rufen. Sie hatte fröhlicher und etwas ruhiger gewirkt als sonst. Vielleicht hatte sie da bereits den Entschluss gefasst gehabt? War es wie eine Erleichterung für sie – ein Gewicht, das ihr von der Brust genommen worden war, die Einsicht, welche Entscheidung sie getroffen hatte und welche Konsequenzen diese haben würde? Frieden?
»Nein, eigentlich nicht. Überhaupt nicht«, erklärte ich und schüttelte den Kopf. »Es gab keine Zeichen. Ich meine, es ist klar, dass es Zeichen gab, Jenny hatte Angst, sie war deprimiert, aber auf meine dementsprechenden Fragen erklärte sie mir, dass sie nicht darüber nachdächte, sich das Leben zu nehmen. Ich hatte sie danach gefragt, hatte die Standardfragen gestellt: ob sie Gedanken an den Tod habe, Gedanken, sich umzubringen, Pläne … Jenny hat nur gelacht. Mir gesagt, dass Selbstmord etwas für die Schwachen sei. Die Verlierer. Ich habe nicht gefragt, ob sie sich selbst als eine Verliererin sah.«
»Würdest du ihrer Familie oder ihren Freunden vorwerfen, dass sie nicht gesehen haben, was sie vorhatte?«
»Nein, auf keinen Fall.«
»Also, warum wirfst du es dir dann selbst vor?«
»Aber es ist doch mein Job, so etwas zu sehen.«
»Siri, geliebte Siri«, sagte Stefan und nahm meine Hände in seine, wie er es immer tat, wenn er meine volle Aufmerksamkeit haben wollte.
»Du weißt so gut wie ich, dass man keine Gedanken lesen kann, nur weil man eine ausgebildete Psychologin ist, dass man auch dann nicht in die Zukunft eines Menschen sehen, ihn nicht daran hindern kann, eine falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt keine Blutprobe, die man nehmen kann, Siri, man kann seine Patienten nicht ins Labor schicken und am nächsten Tag die Ergebnisse erhalten. Du hast die Fragen gestellt, du hast eine Antwort bekommen. Mehr konntest du nicht tun.«
Eigentlich wusste ich ja, dass Stefan Recht hatte, aber dieses hoffnungslose, erstickende, quälende Schuldgefühl wollte mich trotzdem nicht aus seinen Klauen lassen. Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, dass ich nicht zu Jennys Tod beigetragen hatte.
»Siri, vergiss Jenny jetzt.«
Aber ich hörte nicht mehr zu.
Sanft half er mir vom Sofa aufzustehen und führte mich in die Küche, als wäre ich ein Kind.
»Siri, ich brauche Hilfe bei den Kartoffeln.«
Ich schaute ihn verständnislos an, unfähig zu reden.
»Hier.« Er drückte mir den Schäler in die Hand und kippte ein paar Kilo Kartoffeln ins Spülbecken. Langsam, fast mechanisch, fing ich an, Kartoffeln zu schälen. Es muss mindestens eine Stunde gedauert haben, und noch bevor ich die letzte geschält hatte, hatte ich mich tatsächlich so weit gefasst, dass wir über etwas anderes als nur über Jennys Tod sprechen konnten.
Noch eines von Stefans Talenten: mir auf eine wortlose Art und Weise entgegenzukommen und mich zu heilen. Ich selbst war davon überzeugt, dass alles im Gespräch geklärt, geordnet und gelöst werden konnte. Manchmal hatte ich das Gefühl, das wäre überhaupt alles, was ich tat: reden, reden, reden. In der Praxis, mit meinen Freunden, mit Stefan.
»Menschen sind das, was sie tun«, pflegte Stefan immer zu sagen. »Es sind die Handlungen, die uns zu dem machen, was wir sind.« Und was haben sie dann aus mir gemacht?
Es begann als Zeitvertreib.
Zeit: Ich hatte ein Meer davon, das es zu vertreiben galt, warum also nicht untersuchen, was sie tat, wenn sie nicht arbeitete? Was sie tagsüber tat, wusste ich ja bereits.
Ich ging immer öfter in die Kneipen um den Medborgarplatz, weil ich annahm, dass sie dort nach der Arbeit häufiger einkehrte. Ich hatte keinen Plan, wusste nicht, was ich tun sollte, wenn ich sie entdeckte. Es war eher wie ein Zwang, der unbezwingbare Wunsch, sie zu sehen.
Wie ein Juckreiz.
Dann plötzlich, eines Tages stand sie direkt vor mir, als ich auf der Treppe zur Forsgrénska saß und rauchte. Das heißt, sie stand zehn Meter vor mir und schaute ziellos über den Marktplatz. Ich erschrak darüber, wie hässlich sie war. Klein und knochig, mit kurz geschnittenem braunem Haar. Soweit ich sehen konnte, war sie vollkommen ungeschminkt und betrachtete die Menschenmenge abwartend aus grauen, ausdruckslosen, toten Augen. Sie kniff den Mund zusammen, was ihn wie eine kleine rosa Larve aussehen ließ. Ihre Arme und Beine waren mager und braungebrannt, mit hervortretenden, knöchernen Kniescheiben und Ellbogen. Die Kleidung war typisch für intellektuelle Södermalm-Bewohner: ein kurzer, unförmiger Khakirock, flache Sandalen, eine schwarze, locker sitzende Baumwollbluse (ich konnte nicht einmal den Ansatz einer Brust erkennen) und ein bauschiges Tuch, das sie mehrere Male um den Hals gewickelt hatte. Um das Handgelenk trug sie ein Armband mit bunten Perlen, was sie unglaublich kindisch aussehen ließ. Wie die unschuldige Kindergärtnerin, die sie nun WIRKLICH nicht war. Ich drückte meine Zigarette in der Handfläche aus und begrüßte den scharfen Schmerz, da er die anderen Gefühle im Zaume hielt.
Es ist ein außergewöhnlich schöner Abend, auch wenn die Luft bereits eine Kühle zeigt, die verrät, dass der Herbst sich unweigerlich nähert. Die Straßencafés auf dem Medborgarplatz sind voll besetzt. Als wüssten alle, dass der Sommer bald vorbei sein wird, und deshalb diesen Abend nutzen. Über dem Platz schwebt eine einsame Möwe auf der Jagd nach Essensresten.
Aina und ich, wir schlendern durch Södermalm. Wir gehen am Björn-Park vorbei, in dem sich ein paar Teenager auf der Skateboardrampe vergnügen, während ein paar Stammgäste aus unidentifizierbaren Flaschen trinken und ein enthusiastisches Publikum bilden. Wir gehen weiter hinauf zum Mosebacke-Markt und durch das Portal zum Mosebacke-Etablissement.
Das Straßencafé ist voll besetzt. Eine Mischung aus jüngeren Leuten aus dem Stadtteil, japanischen Touristen und älteren Paaren drängt sich um die Tische. Aina späht in die Menschenmenge.
»Guck mal. Wir haben Glück!«
An einem Tisch sitzt unser Kollege Sven Widelius mit einem Bier und einer Zeitung. Sein welliges, graumeliertes Haar fällt wie eine Gardine über die faltige, sonnengebräunte Stirn. Wenn ich ihn nicht kennen würde, nicht seine Kollegin wäre, ich würde ihn als attraktiven Mann ansehen. Obwohl er zwanzig Jahre älter ist als ich.
Die Art, wie er sein Haar aus dem Gesicht streicht, hat etwas an sich, genau wie die hageren, markanten Wangenknochen, die schweren Augenlider und die Intensität seiner grauen Augen. Etwas ist an seiner Art, den Raum mit seiner selbstverständlichen Anwesenheit zu füllen, und an seiner nervösen Energie – er ist ständig in Bewegung. Und er ist körperbetont: ein leichtes Streicheln über die Schulter, wenn er vorbei geht, ein Huschen über die Hand, wenn er mich mit dem Blick fixiert und mir seine gesamte Aufmerksamkeit schenkt. Und dann sein Lachen. Nicht immer freundlich; oft zynisch, ironisch. Es kommt vor, dass ich unsicher werde, wenn er mich ansieht, dass ich mich jünger fühle, nackt.
Ungezogen.
So ist sein Blick. Und er nimmt sich Zeit. Lässt die grauen Augen auf mir ruhen, ohne dass es ihm peinlich ist oder er unsicher wird. Als hätten wir eine heimliche Abmachung.