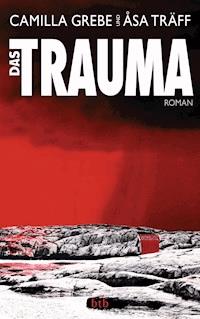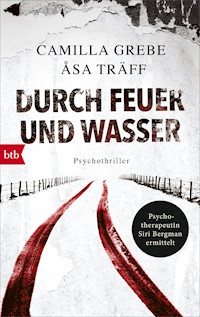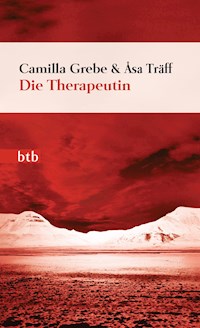9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Profilerin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Eine Tote, mitten im Wald. Getötet an dem Ort, wo vor Jahren das Skelett eines kleinen Mädchens lag. Ein cold case, der nie gelöst wurde. Wer sind die Toten? Was hat der spurlos verschwundene Kommissar mit ihnen zu tun? Und warum erinnert Profilerin Hanne sich an keine Ermittlungsergebnisse? Die Einwohner des kleinen trostlosen Omberg, das mitten zwischen dunklen Kiefernwäldern liegt, halten sich bedeckt. Doch niemand, nicht einmal die Polizei, kann der Wahrheit entkommen, die sich nach jahrelangem Schweigen bahnbricht…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Ähnliche
Zum Buch
Eine Tote mitten im Wald. Getötet an dem Ort, wo vor Jahren das Skelett eines kleinen Mädchens lag. Ein Cold Case, der nie gelöst wurde. Wer sind die Toten? Was hat der spurlos verschwundene Kommissar mit ihnen zu tun? Und warum erinnert Profilerin Hanne sich trotz ihres akribisch genau geführten Tagebuchs an keine Ermittlungsergebnisse? Die Einwohner des kleinen trostlosen Ormberg, das mitten zwischen dunklen Kiefernwäldern liegt, halten sich bedeckt. Doch niemand, nicht einmal die Polizei, kann der Wahrheit entkommen, die sich nach jahrelangem Schweigen bahnbricht …
Zur Autorin
CAMILLA GREBE, geboren 1968 in Älvsjö in der Nähe von Stockholm. Sie studierte an der Stockholm School of Economics, hat den Hörbuchverlag »StorySide« gegründet und betreibt ein Beratungsunternehmen. Gemeinsam mit ihrer Schwester schrieb sie die erfolgreiche Krimi-Reihe um die Stockholmer Psychotherapeutin Siri Bergman. »Wenn das Eis bricht« war ihr erster eigener Roman, der für seine einzigartige Stimme in der Presse hochgelobt wurde. »Tagebuch meines Verschwindens« wurde mit dem Skandinavischen Krimipreis ausgezeichnet. Camilla Grebe lebt mit ihrer Familie in Stockholm.
Camilla Grebe
Tagebuch meines Verschwindens
Psychothriller
Aus dem Schwedischen von Gabriele Haefs
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Husdjuret« bei Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Oktober 2019
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Camilla Grebe
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Semper Smile nach einem Entwurf von Miroslav Šokčić
Covermotiv: © Miroslav Šokčić
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19619-6V002www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Åsa und Mats, weil ihr bewiesen habt, dass selbst aus der schwärzesten Finsternis ein Weg hinausführt.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.Bosnisches Sprichwort
Ormberg Oktober 2009
Malin
Ich hielt Kennys Hand ganz fest, als wir durch den dunklen Wald gingen. Nicht, weil ich an Gespenster geglaubt hätte, natürlich nicht. Das taten nur Idioten. Solche wie Kennys Mutter, stundenlang saß sie vor diesen blödsinnigen Fernsehsendungen, in denen ein sogenanntes Medium alte Häuser nach Geistern durchsuchte, die gar nicht vorhanden waren.
Aber trotzdem.
Tatsache war, dass fast alle, die ich kannte, bei der Geröllhalde das weinende Baby gehört hatten – eine Art gedehntes, verzweifeltes Wimmern. Es wurde das Spukkind genannt, und obwohl ich nicht an Geister und anderen Unsinn glaubte, wollte ich auch nichts riskieren, deshalb ging ich nie allein hierher, wenn es dunkel war.
Ich schaute zu den spitzen Wipfeln der Kiefern hinauf. Die Bäume waren so hoch, dass sie den Himmel und den kugelrunden milchweißen Mond fast versteckten.
Kenny zog an meiner Hand. Die Bierflaschen in der Plastiktüte klirrten, und ich merkte, wie der Rauchgeruch seiner Zigarette sich mit dem von feuchter Erde und verfaulendem Laub vermischte. Einige Meter hinter uns schlurfte Anders durch die Blaubeersträucher, er pfiff ein Lied, das ich aus dem Radio kannte.
»Aber verdammt, Malin!«
Kenny zerrte an meiner Hand.
»Was denn?«
»Du gehst ja langsamer als meine Mutter. Bist du jetzt schon besoffen, oder was?«
Dieser Vergleich war ungerecht – Kennys Mutter wog sicher zweihundert Kilo, und ich hatte sie nie weiter gehen sehen als vom Fernsehsofa zur Toilette. Und bisweilen geriet sie sogar da außer Atem.
»Fresse«, sagte ich und hoffte, Kenny werde meinem Tonfall anhören, dass ich Witze machte. Dass er begriff, dass dieses Wort eine Art liebevollen Respekt enthielt.
Wir waren erst seit zwei Wochen zusammen. Abgesehen von dem üblichen ungeschickten Herumgeknutsche auf seinem nach Hund stinkenden Bett hatten wir die Zeit mit dem Versuch verbracht, unsere Rollen festzulegen. Er: dominant, witzig (ab und zu auf meine Kosten) und bisweilen überwältigt von einer frühreifen, egozentrischen Schwermut. Ich: bewundernd, fügsam (zumeist auf meine Kosten) und verständnisvoll und hilfreich, wenn er wieder schlecht drauf war.
Meine Liebe zu Kenny war so intensiv, unreflektiert und körperlich, dass sie mich manchmal total erschöpfte. Dennoch wollte ich nicht eine einzige Sekunde von ihm getrennt sein, als ob ich Angst hätte, er könnte sich als Traum erweisen, als wunderschöne Fantasie, die sich mein ausschweifendes Teenagergehirn zusammenfabuliert hatte.
Die Kiefern um uns herum sahen uralt aus. Weiche Mooskissen hatten sich um die Wurzeln herum ausgebreitet, und graue Flechtenbärte wuchsen an den dicken Ästen kurz über dem Boden.
Irgendwo war das Geräusch eines zerbrechenden Astes zu hören.
»Was war das?«, fragte ich, und meine Stimme klang vielleicht ein bisschen zu schrill.
»Das war das Spukkind«, sagte Anders mit theatralischer Stimme hinter mir. »Das will dich jetzt hoooooooolen!«
Er heulte.
»Verdammt, mach ihr doch keine Angst!«, fauchte Kenny, den offenbar ein plötzlicher und unerwarteter Beschützerinstinkt gepackt hatte.
Ich kicherte, stolperte über eine Wurzel und hätte fast das Gleichgewicht verloren, aber in der Dunkelheit war Kennys warme Hand zur Stelle. Die Flaschen in der Tüte klirrten dumpf, als er sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte, um mich zu stützen.
Diese Geste ließ mein Inneres richtig warm werden.
Dann lichtete sich der Wald, als ob die Kiefern zur Seite weichen und Platz machen würden für eine kleine Lichtung, wo sich vor uns die Geröllhalde ausbreitete. Der Steinhaufen sah im Mondschein aus wie ein riesiger gestrandeter Wal – überwuchert von dickem Moos und kleinen Farnbüscheln, die sich im schwachen Wind träge bewegten.
Jenseits der Lichtung zeichnete sich Ormbergs dunkle Silhouette vor dem Nachthimmel ab.
»Also«, sagte ich. »Hätten wir nicht einfach zu irgendwem nach Hause fahren und da das Bier trinken können? Müssen wir hier im Wald sitzen? Das ist doch saukalt.«
»Ich wärme dich«, sagte Kenny und grinste.
Er zog mich so eng an sich, dass ich aus seinem Atem den Geruch von Bier und Tabak herausriechen konnte. Ein Teil von mir wollte das Gesicht abwenden, aber ich zwang mich dazu, stillzustehen und seinen Blick zu erwidern, weil das eben von mir erwartet wurde.
Anders pfiff nur, ließ sich auf einen der großen runden Steine fallen und streckte die Hand nach einem Bier aus. Dann steckte er sich eine Zigarette an und sagte:
»Ich hatte gedacht, du wolltest das Spukkind hören.«
»Es gibt keinen Spuk«, sagte ich und setzte mich auf einen kleineren Stein. »An so was glauben nur Idioten.«
»Halb Ormberg glaubt an das Spukkind«, widersprach Anders, öffnete ein Bier und trank einen Schluck.
»Eben«, sagte ich.
Anders lachte über meinen Kommentar, Kenny dagegen schien ihn nicht gehört zu haben. Er hörte mir eigentlich nur selten zu, nie richtig. Stattdessen setzte er sich dicht neben mich und fuhr mir mit der Hand über den Hintern. Schob einen eiskalten Daumen unter meinen Hosenbund. Dann hielt er mir seine Zigarette an den Mund. Brav nahm ich einen tiefen Zug, legte den Kopf in den Nacken und schaute den Vollmond an, während ich den Rauch ausblies.
In der Stille wurden alle Geräusche des Waldes deutlich: das Rauschen des schwachen Windes, der durch die Farnwedel strich, dumpfes Knacken und Pochen, als ob tausend unsichtbare Finger am Boden entlangtasten würden, und ein Vogel, der in einiger Entfernung einen gespenstischen Schrei ausstieß.
Kenny reichte mir ein Bier.
Ich trank einen Schluck von dem kalten, bitteren Getränk und spähte in die Dunkelheit zwischen den Bäumen. Wenn sich dort jemand versteckte, sich an einen Baumstamm presste, würden wir ihn niemals entdecken. Es wäre so unvorstellbar leicht, sich hier auf der Lichtung an uns anzuschleichen, wie Rehe in einem Gehege abzuschießen oder Goldfische aus einem Aquarium zu nehmen.
Aber warum sollte jemand das tun, in Ormberg?
Hier passierte niemals etwas. Deshalb mussten sich die Leute wohl Gespenstergeschichten ausdenken – um nicht vor Langeweile einzugehen.
Kenny rülpste träge und öffnete ein weiteres Bier. Dann drehte er sich zu mir um und küsste mich. Seine Zunge war kalt und schmeckte nach Bier.
»Get a room!«, sagte Anders und rülpste ebenfalls. Laut, als sei das Rülpsen eine Frage, auf die er von uns eine Antwort erwartete.
Dieser Kommentar schien Kenny aufzureizen, denn er schob energisch seine Hand in meine Jackenöffnung, suchte sich den Weg unter meinen Pullover und presste meine Brust ganz fest zusammen.
Ich setzte mich anders hin, um es ihm leichter zu machen, und ließ meine Zunge über die spitzen Zähne gleiten.
Anders erhob sich. Ich schob Kenny vorsichtig weg und fragte: »Was?«
»Ich hab was gehört. Es klang wie … als ob jemand weinte oder wimmerte oder so.«
Anders stieß ein klagendes Geräusch aus und lachte dann so sehr, dass ihm das Bier aus dem Mund spritzte.
»Du bist doch gestört, Mann«, sagte ich. »Ich muss pissen. Ihr könnt ja so lange hier nach dem Spuk Ausschau halten.«
Ich stand auf, lief um die Geröllhalde herum und ging dann noch einige Meter weiter. Drehte mich um und überzeugte mich davon, dass Kenny und Anders mich nicht sehen konnten, dann knöpfte ich meine Jeans auf und ging in die Hocke.
Irgendetwas, vielleicht Moos oder ein Gewächs, kitzelte mich am Oberschenkel, als ich pinkelte. Die Kälte strich über mein Bein und unter meine Windjacke.
Ich schauderte zusammen.
Wirklich tolle Idee hierherzukommen, um Bier zu trinken. Echt! Warum hatte ich nichts gesagt, als Kenny diesen Vorschlag gemacht hatte?
Warum widersprach ich nie, wenn Kenny irgendetwas vorschlug?
Die Dunkelheit war kompakt, und ich zog das Feuerzeug aus der Jackentasche. Streifte das Rädchen mit dem Daumen und ließ den Schein der Flamme über den Boden leuchten: herbstbraunes Laub, samtweiches Moos und dann die großen grauen Steine. Und dort, in einer Spalte zwischen zwei Steinen, dicht in meiner Nähe, ahnte ich etwas Glattes, Weißes, wie den Hut eines großen Champignons.
Kenny und Anders redeten noch immer über den Spuk, sie klangen ausgelassen und nuschelten schon vom Bier. Ihre Worte folgten dicht aufeinander, stolperten und wurden zwischendurch von Lachen unterbrochen.
Vielleicht war es Neugier, vielleicht hatte ich einfach keine große Lust, jetzt gleich zu ihnen zurückzukehren, aber etwas brachte mich dazu, mir diesen Champignon ein bisschen genauer anzusehen.
Gab es um diese Zeit so große Champignons, mitten im Wald? Die einzigen Pilze, die ich hier je gepflückt hatte, waren Pfifferlinge gewesen.
Ich hielt das Feuerzeug an den Spalt zwischen den Steinen, sodass das schwache Licht den Gegenstand deutlicher zeigte. Ich schob ein wenig Laub zur Seite und riss ein kleines Farnbüschel mit der Wurzel aus.
Doch, da lag einwandfrei etwas. Etwas, das …
Noch immer in der Hocke, mit heruntergelassenen Jeans, schob ich die freie Hand hinein und berührte vorsichtig mit dem Finger dieses Weiße, Glatte. Es fühlte sich hart an, wie Stein oder Porzellan. Vielleicht eine alte Schüssel? Jedenfalls einwandfrei kein Pilz.
Ich streckte mich ein wenig und rollte den Stein weg, der über der Schüssel lag. Er war kleiner als die anderen und nicht besonders schwer, aber er landete trotzdem mit einem dumpfen Knall neben mir im Moos.
Und da lag sie, die Schale, oder was immer es nun war. Sie war so groß wie eine Grapefruit, auf der einen Seite gesprungen und durchwachsen von einer Art fadenreichem, braunem Moos.
Ich streckte die Hand aus und berührte die dünnen dunklen Fäden. Rieb sie einige Sekunden zwischen Daumen und Zeigefinger, ehe mein Gehirn die Teile des Puzzles zusammenfügte, und ich begriff, was es war.
Ich ließ das Feuerzeug fallen, richtete mich auf, machte einige stolpernde Schritte in die Dunkelheit hinaus und schrie. Es war ein Schrei, der tief aus mir herauskam und niemals ein Ende zu nehmen schien. Als ob das Entsetzen jedes Sauerstoffatom, das sich in meinem Körper befand, durch die Lunge hinauspresste.
Als Kenny und Anders mir zu Hilfe kamen, hing meine Hose mir noch immer um die Knöchel, und meine Lunge hatte dem Schrei neues Leben gegeben.
Die Schale war keine Schale.
Das Moos war kein Moos.
Es war ein Schädel mit langen dunklen Haaren.
Ormberg Acht Jahre später – 2017
Jake
Ich heiße Jake. Das soll ausgesprochen werden wie auf Englisch – Dschäjk, weil meine Eltern mich nach Jake Gyllenhaal so genannt haben – das ist einer der besten Schauspieler auf der Welt. Die meisten in der Schule sprechen meinen Namen ganz bewusst falsch aus, sie sagen Jak-ke, aber so, dass es sich auf Hacke oder Zacke reimt, oder schlimmer noch, Kacke. Ich wünschte, ich hätte einen anderen Namen, aber ich kann ja nicht viel daran ändern. Ich bin der, der ich bin. Und ich heiße so, wie ich heiße. Mama wollte so furchtbar gern, dass ich einfach Jake heißen sollte, und Papa machte immer, was Mama wollte, vielleicht, weil er sie über alles auf der Welt liebte.
Sogar jetzt, wo Mama tot ist, ist sie irgendwie noch immer bei uns. Ab und zu deckt Papa aus Versehen für sie mit, und wenn ich eine Frage stelle, zögert er lange mit der Antwort, als ob er sich überlegen müsste, was Mama wohl sagen würde. Dann kommt die Antwort: »Sicher, du kannst einen Hunderter leihen« oder »na gut, du kannst zu Saga fahren und dir einen Film ansehen, aber um sieben musst du wieder zu Hause sein«.
Papa sagt fast nie Nein, auch wenn er ein bisschen strenger geworden ist, seit TrikotKönig, die alte Textilfabrik, wieder als Flüchtlingsheim genutzt wird.
Ich möchte gern glauben, dass es daran liegt, dass er lieb ist, aber Melinda, meine große Schwester, sagt, dass er einfach zu faul ist, um zu widersprechen. Dabei schielt sie dann vielsagend zu den leeren Bierdosen hinüber, die auf dem Küchenboden aufgetürmt sind, grinst und macht perfekte Rauchringe, die langsam zur Decke hochsteigen.
Ich finde Melinda undankbar. Ich meine, sie darf zu Hause ja sogar rauchen, das hätte Mama niemals zugelassen, aber statt sich zu freuen, sagt sie so was. Es ist undankbar, ungerecht und vor allem kein bisschen lieb.
Als Oma noch lebte, hat sie manchmal gesagt, Papa sei vielleicht nicht das »schärfste Messer in der Schublade«, aber ich wohnte im schönsten Haus von Ormberg, und das sei ja auch nicht das Schlechteste. Ich glaube nicht, dass ihr klar war, dass ich genau wusste, was sie mit dem »schärfsten Messer« meinte, aber das wusste ich. Egal, es war jedenfalls völlig in Ordnung, ein stumpfes Messer zu sein, solange man ein schönes Haus hatte.
Das schönste Haus von Ormberg liegt fünfhundert Meter von der Autobahn entfernt, gleich am Waldrand, an dem Bach, der bis nach Vingåker weiterfließt. Es gibt zwei Gründe dafür, dass das Haus etwas Besonderes ist: Erstens ist Papa Zimmermann, und zweitens hat er selten Arbeit. Das ist ein Glück, denn deshalb kann er fast immer am Haus herumbasteln.
Um das Haus hat Papa das Gestrüpp entfernt und eine riesige Terrasse gebaut. Die ist so groß, dass man darauf Basketball spielen oder Rad fahren könnte. Wenn man wirklich Anlauf nähme und kein Geländer vorhanden wäre, dann könnte man noch dazu von der Querseite aus in den Bach springen. Ein Erwachsener würde das allerdings nicht wollen – das Wasser ist eiskalt, sogar mitten im Sommer, und der Boden ist voller Schlamm und Wassergewächse und ekliger schleimiger Würmer. Im Sommer blasen Melinda und ich ab und zu die alten Luftmatratzen auf und lassen uns von der Strömung bis zu der alten Mühle tragen. Die Baumwipfel bilden ein grünes Dach, das an die von Oma gestickten Spitzendeckchen mit den Lochmustern erinnert. Das Einzige, was zu hören ist, sind die Vögel, das gummiharte Knacken der Luftmatratzen, wenn wir uns bewegen, und das Rauschen des kleinen Wasserfalls beim Weiher vor dem alten Sägewerk.
Wenn wir den Wasserfall erreicht haben, müssen wir aufstehen, die Luftmatratzen hochheben und durch das seichte, reißende Wasser zum Weiher hinunterwaten, der voller Seerosen und Seegras ist.
Als Opa, den ich nicht mehr kennengelernt habe, jung war, hat er in der Sägemühle gearbeitet, aber die wurde schon lange vor Papas Geburt stillgelegt. Die verfallenen Gebäude wurden von Skinheads aus Katrineholm abgefackelt, als Papa so alt war wie ich jetzt – vierzehn –, die verkohlten Ruinen sind aber noch vorhanden. Aus der Ferne sehen sie aus wie Hauer, die aus dem Gestrüpp aufragen.
Papa sagt immer, dass früher alle in Ormberg Arbeit hatten, entweder in der Landwirtschaft, in der Säge, in Brogrens Mechanischer Werkstatt oder bei TrikotKönig.
Jetzt haben nur noch die Bauern Arbeit, denn alle Industriebetriebe sind stillgelegt worden, und die Arbeitsplätze befinden sich in China. Brogrens Mechanische Werkstatt steht stumm und verlassen da, ein Skelett aus verrostetem Blech in der Ebene, und das schlossartige Klinkergebäude von TrikotKönig hat sich also in ein Flüchtlingsheim verwandelt.
Dahin dürfen weder ich noch Melinda gehen, obwohl Papa uns sonst fast alles erlaubt. Und er scheint nicht einmal nachdenken zu müssen, was Mama wohl sagen würde, denn die Antwort kommt blitzschnell, wenn wir fragen. Er sagt, es sei zu unserer eigenen Sicherheit. Es ist unklar, wovor genau er sich fürchtet, aber Melinda verdreht immer die Augen, wenn er dieses Thema aufgreift, und dann wird er wütend und fängt an, sich über Kalifat, Burkas und Vergewaltigungen zu verbreiten.
Ich weiß, was Burka und Vergewaltigung sind, aber Kalifat weiß ich nicht, ich habe es aufgeschrieben, damit ich es googeln kann – das mache ich immer mit Wörtern, die ich nicht kenne, Wörter finde ich nämlich toll, vor allem schwierige Wörter.
Ich sammele die sozusagen.
Noch ein Geheimnis, das ich niemandem erzählen kann. Man kriegt in Ormberg schon aus geringeren Anlässen Prügel, wenn man zum Beispiel die falsche Musik gut findet oder Bücher liest. Und einige – wie ich – beziehen mehr Prügel als andere.
Ich gehe hinaus auf die Terrasse, beuge mich über das Geländer und schaue auf den Bach. Die Gewitterwolken lösen sich jetzt auf und lassen einen schmalen Streifen blauen Himmel und eine intensiv orange Sonne gleich über dem Horizont sehen. Der Frost, der die Bodenbretter weich und wollig aussehen lässt, glitzert in den letzten Sonnenstrahlen, und das Wasser im Bach fließt dunkel und träge unter mir vorbei.
Der Bach gefriert nie – das liegt daran, dass er immer in Bewegung ist. Man könnte eigentlich den ganzen Winter hindurch darin baden, aber das tut natürlich niemand.
Die Bodenbretter sind voller Zweige, die der Sturm über Nacht von den Bäumen geholt hat. Ich müsste sie vielleicht aufsammeln und sie auf den Kompost werfen, aber ich bin wie hypnotisiert von der Sonne, die wie eine Apfelsine unter der Wolkendecke hängt.
»Jake, komm rein, verdammt noch mal«, ruft Papa aus dem Wohnzimmer. »Du frierst dir doch den Arsch ab!«
Ich lasse das Geländer los, sehe mir die perfekt geformten nassen Abdrücke an der Stelle an, wo meine Hände gelegen haben, und gehe rückwärts ins Haus.
»Mach die Tür zu«, sagt Papa auf seinem Platz im Massagesessel vor dem riesigen Flachbildschirm.
Papa dreht die Lautstärke mit der Fernbedienung herunter und sieht mich an. Zwischen seinen buschigen Augenbrauen zeigt sich eine Furche. Er streicht sich mit seiner sommersprossigen Hand die Haare über den Schädel. Dann greift er gewohnheitsmäßig nach den nicht mehr funktionierenden Kontrollknöpfen des Massagesessels.
»Was hast du da draußen gemacht?«
»Den Bach angesehen.«
»Den Bach angesehen?«
Die Furche zwischen Papas Augenbrauen wird immer tiefer, als ob ich eins der schwierigen Wörter benutzt hätte, die er nicht versteht, aber dann scheint er zu beschließen, das hier sei nicht der Rede wert.
»Ich fahre nachher zu Olle«, sagt er und knöpft seine Jeans auf, um für seinen Bauch Platz zu schaffen. »Melinda hat etwas zu essen gemacht. Steht im Kühlschrank. Wartet nicht auf mich.«
»Okay.«
»Sie hat versprochen, um zehn wieder zu Hause zu sein.«
Ich nicke und gehe in die Küche, hole mir eine Cola, gehe auf mein Zimmer und spüre das Prickeln im Bauch.
Ich werde mindestens zwei Stunden für mich haben.
Es ist dunkel, als Papa geht. Die Tür fällt so hart ins Schloss, dass meine Fensterscheibe klirrt, und bald darauf wird der Motor angelassen, und der Wagen fährt los. Ich warte einige Minuten, um sicher sein zu können, dass Papa nicht zurückkommt, dann gehe ich ins Zimmer meiner Eltern.
Das Doppelbett ist auf Papas Seite nicht gemacht. Auf Mamas Seite ist die Decke ordentlich über das Bett gebreitet, und die Kissen lehnen an der Wand. Auf dem Nachttisch liegt das Buch, in dem sie vor ihrem Tod gelesen hat, dieses Buch über die junge Frau, die sich mit einem reichen Kerl namens Grey einlässt. Der ist Sadist und kann nicht lieben, aber die Frau liebt ihn trotzdem, denn Mädchen finden es toll, wenn es wehtut. Das sagt Vincent jedenfalls. Ich kann das eigentlich nicht glauben, ich meine, wer kriegt denn gern Prügel? Ich jedenfalls nicht. Ich glaube eher, die Frau mag Greys Geld, denn alle lieben Geld, und die meisten würden alles tun, um reich zu werden.
Die Prügel einstecken oder einem fiesen Sadisten einen blasen, zum Beispiel.
Ich gehe zu Mamas Kleiderschrank und öffne die Spiegeltür. Die klemmt ein bisschen, und ich muss ihr einen Stoß versetzen, ehe sie aufgeht. Dann fahre ich mit der Hand über die Kleidungsstücke: glatte Seide, Paillettenkleider, weicher Samt, raue Jeans und knittrige, ungebügelte Baumwolle.
Ich schließe die Augen und schlucke.
Es ist so schön, so perfekt. Wenn ich reich wäre, so reich wie dieser Grey, würde ich mir eine betretbare Garderobe zulegen, oder wie das nun heißt. Ich würde mir für alle Anlässe und Jahreszeiten die passende Handtasche besorgen, und meine Schuhe würden in einem eigenen Schrank mit Beleuchtung stehen.
Mir ist natürlich klar, dass das alles unmöglich ist. Nicht nur, weil es einen Haufen Geld kostet, sondern auch, weil ich ein Junge bin. Es wäre total gestört, sich einen Schrank mit Mädchenkleidern anzuschaffen. Wenn ich das machte, dann wäre endgültig bewiesen, dass ich eine Missgeburt bin. Dass ich noch viel kränker bin als dieser verdammte Grey – denn es ist offensichtlich in Ordnung, Frauen zu fesseln und zu schlagen, aber nicht, sich wie sie anzuziehen.
Jedenfalls nicht in Ormberg.
Ich nehme das goldene Paillettenkleid heraus, das mit den schmalen Trägern und dem blanken, ein bisschen glatten Futter. Mama hat es zu Silvester getragen und als sie mit ihren Freundinnen auf eine Kreuzfahrt nach Finnland gefahren ist.
Ich halte es vor mich und mache einige Schritte rückwärts, damit ich mich im Spiegel sehen kann. Ich bin mager, und meine dunklen Haare machen mein Gesicht noch blasser. Vorsichtig lege ich das Kleid auf den Tisch und gehe zur Kommode. Ziehe die oberste Schublade heraus und nehme einen schwarzen BH mit Spitzen hervor. Dann streife ich Jeans und Kapuzenpulli ab und ziehe den BH an.
Es sieht natürlich ein bisschen blödsinnig aus. Es gibt ja nichts da, wo die Brüste sein müssten, nur einen platten milchweißen Brustkorb mit kleinen, albernen Brustwarzen. Ich stopfe in jedes Körbchen einen aufgerollten Strumpf und lasse mir dann das Kleid über den Kopf gleiten. Wie immer, wenn ich das Paillettenkleid anprobiere, staune ich darüber, wie schwer es ist – schwer und gleichsam kalt auf der Haut.
Ich mustere mein Spiegelbild und bin plötzlich verlegen, ich würde lieber andere Kleider anziehen als ausgerechnet Mamas, aber ich habe natürlich selbst keine Mädchenkleider, und Melinda trägt meistens Jeans und Pullover, nie im Leben würde sie sich etwas so Schönes aussuchen wie das hier.
Ich überlege, welche Schuhe am besten zu dem Kleid passen. Vielleicht die schwarzen mit den rosa Steinen? Oder die Sandalen mit den blauroten Riemen? Ich entscheide mich für die schwarzen Schuhe – ich nehme fast immer dieses Paar – denn ich liebe diese funkelnden rosa Steine. Sie erinnern mich an kostbaren Schmuck, wie den von den Mädchen in diesem YouTube-Film, den Melinda sich oft ansieht.
Ich trete wieder zurück und mustere mein Spiegelbild. Wenn meine Haare nur ein bisschen länger wären, würde ich wirklich aussehen wie ein Mädchen. Vielleicht sollte ich sie ein bisschen wachsen lassen, damit ich sie hochstecken kann?
Was für eine aufregende Vorstellung.
Als ich zu Melindas Zimmer gehe, hinterlasse ich Abdrücke in dem dicken Teppichboden. Papa hat in allen Zimmern Teppichboden gelegt, nur nicht in der Küche, weil es so angenehm ist darüberzulaufen. Ich liebe dieses Gefühl des Weichen unter den hochhackigen Schuhen, es ist fast, wie durch Gras zu gehen, wenn ich im Freien bin.
Melindas Schminktasche ist groß und chaotisch. Ich schaue kurz auf die Uhr und beschließe, mich zu beeilen. Ziehe mir dicke Kajalstriche um die Augen, wie diese Sängerin Adele, und fahre mit dem weinroten Lippenstift über die Lippen. Mir wird innerlich ganz warm, wenn ich in den Spiegel schaue.
Ich bin richtig schön.
Ich bin Jake und doch nicht, denn ich bin hübscher und perfekter und sozusagen mehr ich selbst als vorher.
In der Diele ziehe ich eine von Melindas Jacken an – draußen ist es null Grad, und so gern ich das auch möchte, kann ich nicht nur im Kleid losgehen. Die schwarze Wolljacke kratzt und hat nicht mehr alle Knöpfe, deshalb kann ich sie nicht zumachen. Die Kälte beißt mir in die Beine, als ich die Haustür abschließe, den Schlüssel unter den leeren, gesprungenen Blumentopf lege und auf die Straße zugehe. Der Kies knirscht unter meinem Gewicht, und ich muss mich darauf konzentrieren, in den hochhackigen Schuhen das Gleichgewicht zu halten.
Die Nacht ist dunkel und farblos und riecht nach nasser Erde.
Jetzt fällt ein leichter Schneeregen. Das Kleid macht leise Geräusche, als ich gehe, es knistert gewissermaßen. Die Kiefern stehen stumm am Wegrand, und ich frage mich, ob sie mich sehen und was sie dann denken. Aber ich glaube nicht, dass die Kiefern etwas gegen mein Kleid haben. Sie sind einfach nur Kiefern.
Ich biege auf den schmalen Weg ab.
Ungefähr hundert Meter vor mir liegt die Landstraße. Ich kann bis dorthin gehen, aber nicht weiter, denn dann könnte mich jemand sehen, und etwas Schlimmeres könnte gar nicht passieren. Es wäre sozusagen schlimmer als der Tod.
Ich gehe so gern allein durch den Wald. Vor allem in Mamas Kleidern. Ich stelle mir dann immer vor, ich wäre in Katrineholm, auf dem Weg zu einer Bar oder einem Restaurant.
Aber das wird natürlich niemals passieren.
Zwei Meter vor der Straße bleibe ich stehen. Kneife die Augen zusammen und versuche, alles so sehr zu genießen, wie es nur geht, denn ich weiß, dass ich gleich zurückgehen muss. Zurück zum schönsten Haus von Ormberg, zu Flachbildschirm und Massagesesseln und meinem Zimmer mit den vielen Filmplakaten. Zurück zu dem Kühlschrank, der mit Fastfood gefüllt ist und eine Eismaschine hat, die funktioniert, wenn man einige Male hart mit der Faust dagegenhaut.
Zurück zu Jake, der kein Kleid und keinen BH und keine hochhackigen Schuhe hat.
Kalte Regentropfen fallen mir auf den Kopf, laufen mir über den Nacken und zwischen die Schulterblätter.
Ich fröstele, aber eigentlich ist das Wetter nicht so schlimm. Jedenfalls im Vergleich zu gestern – da hat es so arg geweht, dass ich schon glaubte, das Dach würde vom Haus gerissen.
Irgendwo ist ein Aufprall zu hören, vielleicht von einem Reh – es gibt hier viel Wild. Einmal hat Papa ein ganzes Reh mitgebracht, das Olle geschossen hatte, und er hat es mehrere Tage in der Garage hängen lassen, ehe er es abgehäutet und zerlegt hat.
Noch mehr Geräusche.
Zweige brechen, und ich höre noch etwas anderes, ein ersticktes Stöhnen, wie von einem verletzten Tier. Ich erstarre und spähe in die Dunkelheit.
Etwas bewegt sich zwischen den Bäumen, kriecht im Gestrüpp auf mich zu.
Ein Wolf?
Dieser Gedanke kommt von irgendwoher, obwohl ich weiß, dass es hier keine Wölfe gibt. Nur Elche, Füchse und Hasen. Das gefährlichste Tier in Ormberg ist der Mensch, das hat sogar Papa schon gesagt.
Ich drehe mich um, um zurück zum Haus zu rennen, aber ich bleibe mit dem einen Absatz irgendwo hängen und kippe rückwärts auf den Boden. Ein spitzer Stein bohrt sich in meine Handfläche, und ich spüre einen scharfen Schmerz im Steißbein.
Eine Sekunde später sehe ich, wie eine Frau aus dem Wald kriecht. Auf einmal ist sie da, aufgetaucht aus dem Nirgendwo.
Sie ist alt. Die Haare hängen in feuchten Strähnen um ihr Gesicht, und ihre dünne Bluse und ihre Jeans sind nass und zerrissen. Sie hat keine Jacke und keine Schuhe an, und ihre Arme sind blutig und verschmutzt.
»Hilf mir«, sagt sie, als sie mich sieht. Sie hat eine so schwachen Stimme, dass ich kaum ein Wort verstehen kann.
Ich rutsche rückwärts über den Boden, um ihr zu entgehen, habe plötzlich eine Todesangst, denn sie sieht genauso aus wie die Hexen oder wahnsinnigen Mörderinnen in den Horrorfilmen, die Saga und ich uns immer ansehen.
Es regnet jetzt heftiger, und um mich herum hat sich eine große Pfütze gebildet. Ich komme in die Hocke, streife die Schuhe ab und nehme sie in die Hand.
»Hilf mir«, murmelt sie wieder und kommt gleichzeitig auf die Beine.
Mir ist natürlich klar, dass sie keine Hexe ist, aber vielleicht ist sie wahnsinnig. Und gefährlich. Vor einigen Jahren hat die Polizei in Ormberg einen geisteskranken Typen erwischt. Er war aus der Klinik Karsudden in Katrineholm ausgebrochen und hatte sich fast einen Monat lang in leer stehenden Ferienhütten versteckt.
»Wer bist du?«, frage ich, weiche zurück und spüre, wie meine Hacken im weichen Moos versinken.
Die Frau erstarrt. Sie macht ein verwirrtes Gesicht, weiß wohl nicht, wie sie diese Frage beantworten soll. Dann sieht sie ihre Arme an, schiebt mit der Hand einen Zweig weg, und ich sehe, dass sie etwas in der Hand hält, ein Buch oder vielleicht einen Notizblock.
»Ich heiße Hanne«, sagt sie nach einigen Sekunden.
Ihre Stimme klingt jetzt fester, und als sie meinen Blick erwidert, sieht es aus, als versuchte sie, sich ein Lächeln abzuringen.
Sie fügt hinzu:
»Du brauchst keine Angst zu haben. Ich tu dir doch nichts.«
Der Regen peitscht meine Wange, als ich ihren Blick erwidere.
Sie sieht jetzt anders aus, weniger wie eine Hexe und mehr wie eine Oma. Eine harmlose Oma, die sich die Kleider zerrissen hat und im Wald gestürzt ist. Vielleicht hat sie sich verirrt und findet nicht nach Hause.
»Was ist passiert?«, frage ich.
Die Oma, die Hanne heißt, mustert ihre zerfetzte Kleidung und schaut dann mich an. Ich ahne Verzweiflung und Angst in ihren Augen.
»Ich weiß es nicht mehr«, murmelt sie.
In diesem Moment ist in der Ferne ein näher kommendes Auto zu hören. Die Oma hört es offenbar auch, denn sie macht einige Schritte auf die Straße zu und schwenkt die Arme. Ich folge ihr an den Straßenrand und schaue in der Dunkelheit dem Fahrzeug entgegen. Im Scheinwerferlicht sehe ich, dass Hannes nackte Füße von Blut bedeckt sind, als ob sie sich an scharfen Steinen und Zweigen aufgescheuert hätte.
Aber ich sehe noch etwas anderes, ich sehe, wie die Pailletten an meinem Kleid im Licht funkeln wie Sterne am Himmel in einer klaren Nacht.
In dem Auto, das immer näher kommt, kann einfach jeder sitzen – es kann ein Nachbar sein oder der große Bruder eines Kumpels oder der alte Irre von hinter der Kirche –, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand ist, den ich kenne, ist groß.
Die Angst breitet sich in mir aus, dreht meine Eingeweide um und quetscht mein Herz zusammen.
Es gibt nur eins, das schlimmer ist als Hexen und Irre und wahnsinnige Mörderinnen – nämlich, entlarvt zu werden. Dass jemand mich in Paillettenkleid und aufgerollten Strümpfen in Mamas altem BH sieht. Wenn das in Ormberg bekannt würde, könnte ich mir auch gleich die Kugel geben.
Ich weiche in den Wald zurück und hocke mich ins Gebüsch.
Der Fahrer muss mich gesehen haben, aber vielleicht hat er mich nicht erkannt. Es ist dunkel und gießt jetzt, und ich bin schließlich verkleidet.
Der Wagen hält und die Fensterscheibe gleitet mit einem summenden Geräusch hinunter. Musik strömt in die Nacht hinaus. Ich höre, wie die Oma mit der Fahrerin spricht, aber ich erkenne weder sie noch das Auto. Nach ungefähr einer Minute öffnet die Oma die hintere Tür und steigt ein. Dann verschwindet der Wagen in der Nacht.
Ich richte mich auf und gehe zur Straße, die sich wie eine dunkle blaue Schlange durch den Wald windet. Nur der Regen ist noch zu hören.
Die Oma, die Hanne heißt, ist verschwunden, aber auf dem Boden liegt etwas – ein braunes Buch.
Malin
Ich zittere im kalten Wind, schaue den schwarz glänzenden Asphalt an und denke an die Frage, die Mama, kurz bevor der Anruf kam, gestellt hat.
Warum bist du eigentlich zur Polizei gegangen, Malin?
Wenn mir diese Frage gestellt wird, dann lache ich meistens und verdrehe die Augen. Dann sage ich so ungefähr, dass es jedenfalls nicht wegen des Gehalts, des Dienstwagens oder der fantastischen Arbeitszeiten war. Aber es geht darum: Ich tue es mit einem Scherz ab. Ich will diese Frage nicht ernst nehmen, will nicht mich selbst und meine Motive hinterfragen. Wenn ich doch einen Versuch machen wollte, dann wäre der Grund wohl, dass ich Menschen helfen will, dass ein Teil von mir wirklich glaubt, ich könnte dazu beitragen, eine bessere Gesellschaft entstehen zu lassen. Vielleicht besitze ich auch eine Art Trieb, Ordnung zu schaffen und Dinge zurechtzurücken, so, wie man zu Hause Ordnung schafft oder im Garten Unkraut entfernt.
Die Ausbildung an der Polizeihochschule in Sörentorp, im Norden von Stockholm, war zudem für mich eine angenehme Möglichkeit, von zu Hause wegzukommen. Eine Gratisreise von Ormberg fort und ein hervorragender Vorwand, um am Wochenende keine Besuche machen zu müssen.
Und das Skelett, das Kenny, Anders und ich vor acht Jahren im Wald gefunden hatten – hat das zu meiner Berufswahl beigetragen?
Ich weiß es eigentlich nicht.
Damals fand ich es jedenfalls spannend, bei einer aufsehenerregenden Ermittlung im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Auch wenn das Opfer, ein kleines Mädchen, damals nicht identifiziert werden konnte und der Täter nicht gefasst wurde.
Ich hätte wohl nie gedacht, dass ich einmal gerade an diesem Fall arbeiten würde.
Ein kalter Wind bringt eine leere Plastiktüte und etwas Laub mit, trägt sie zu dem niedrigen braunen Krankenhausgebäude hinüber. Ein Mann kommt aus der Rezeption, stellt sich mit dem Rücken zum Wind und zündet sich eine Zigarette an.
Manfred Olsson, mein zufälliger Kollege, hat vor weniger als einer Stunde angerufen.
Ich denke an Mamas überraschtes Gesicht, als der Anruf kam. An ihren Blick, der zwischen mir und der Uhr hin- und herirrte, als ihr aufging, dass etwas Schwerwiegendes passiert war und dass ich losmusste, obwohl es der erste Advent war und der Sonntagsbraten auf dem Herd stand.
Manfred schien außer Atem zu sein, als ich mich meldete, als ob er eben die Drei-Kilometer-Strecke bei der Kirche gelaufen wäre. Aber andererseits keucht er fast immer, vermutlich, weil er ein Übergewicht von an die fünfzig Kilo mit sich herumschleppt. Jedenfalls war ich total unvorbereitet darauf, was er dann sagte: dass Hanne Lagerlind-Schön gestern im Wald aufgegriffen worden sei, allein, unterkühlt und verwirrt. Ob ich mit ins Krankenhaus kommen könnte, um mit ihr zu sprechen.
Die lokale Polizei hatte offenbar fast einen ganzen Tag gebraucht, um sie zu identifizieren und Manfred zu informieren. Vielleicht kein Wunder – in Ormberg gibt es ja keine Wache. Die nächste liegt in Vingåker, und wir haben nicht besonders viel Kontakt zu den Kollegen dort. Hanne konnte sich zudem nicht erinnern, was sie im Wald gemacht hatte und dass sie überhaupt in Ormberg gewesen war.
Von allen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, ist Hanne wohl die Letzte, von der ich erwartet hätte, dass ihr etwas zustoßen könnte. Die freundliche, schweigsame und pedantische Profilerin von ungefähr sechzig aus Stockholm, die nie zu spät zu einer Besprechung kommt und wirklich alles in ihr kleines braunes Buch schreibt.
Wie ist so etwas möglich? Wie kann man vergessen, wo man sich befindet und welche Kollegen man bei sich hat?
Und wo zum Teufel steckt Peter Lindgren? Er geht doch kaum einen Meter ohne Hanne.
Hanne und Peter gehören zu einer fünfköpfigen Gruppe, die noch einmal im Mordfall des Mädchens in der Geröllhalde ermittelt. Seit der neue Chef der Zentralen Polizeibehörde seine Stelle angetreten hat, sind innerhalb der Polizei zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet worden: Gegen Verbrechen soll härter durchgegriffen werden, der Aufklärungsprozentsatz für schwere Gewaltverbrechen soll steigen. Besondere Teams sollen sich auf die Bandenkriminalität in den gefährdeten Vororten konzentrieren. Zudem werden Cold Cases, bei denen es um tödliche Gewalt ging, noch einmal aufgerollt, denn seit 2010 die Verjährungsfrist für Mord abgeschafft wurde, sind überall im Land die Stapel mit den Unterlagen über ungelöste Mordfälle gewachsen.
Der Mord an dem kleinen Mädchen in Ormberg ist so ein Cold Case, der aus der Vergessenheit hervorgeholt wurde und nun abermals untersucht wird. Wir arbeiten seit einer guten Woche an dieser Ermittlung. Hanne und Peter kommen von der NOA, der Nationalen Operativen Abteilung der Polizei. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie auch privat ein Paar – ein sehr ungleiches Paar, denn Hanne ist mindestens zehn Jahre älter als Peter. Auch Manfred kommt von der NOA und arbeitet schon lange mit Peter zusammen. Außerdem gehört noch Andreas Borg zu dieser Gruppe – ein etwa dreißig Jahre alter Polizist, der normalerweise in Örebro arbeitet.
Und dann ich, Malin.
Dass ich an der Aufklärung des Mordes an dem Mädchen im Geröll arbeiten würde, ist gelinde gesagt unerhört – nicht nur, weil ich sie an jenem Herbstabend vor acht Jahren gefunden habe, sondern auch, weil ich nach meinem Examen an der Polizeihochschule bei der Ordnungspolizei in Katrineholm eingesetzt war. Aber das Ganze hat doch eine gewisse Logik – ich wurde nach Ormberg geschickt, weil ich hier aufgewachsen bin und Ortskenntnisse beisteuern soll. Ich glaube eigentlich, dass ich die einzige Polizistin in Sörmland bin, die ausgerechnet aus Ormberg kommt.
Dass ich dabei war, als der Leichnam gefunden wurde, hat bei der Entscheidung meiner Vorgesetzten offenbar keine Rolle gespielt. Sie wollten einfach jemanden vor Ort haben, der sich in den großen Wäldern, die das Dorf umgeben, auskennt und mit den alten Kerlen und den Omas in den Waldhäusern reden kann.
Und da haben sie nicht unrecht.
Ormberg ist Fremden gegenüber nicht gerade entgegenkommend, und ich kenne den Ort in- und auswendig und auch alle, die dort wohnen. Die, die noch übrig sind, genauer gesagt. Denn seit TrikotKönig und Brogrens Mechanische dichtgemacht haben, sind die meisten weggezogen. Übrig geblieben sind nur Ferienidioten, Alte und arbeitslose Umzugsverweigerer.
Und dann die Flüchtlinge natürlich.
Ich frage mich, wer auf die geniale Idee gekommen ist, hundert Flüchtlinge in einem entvölkerten Dorf mitten in Sörmland unterzubringen. Es ist auch nicht das erste Mal; schon als zu Beginn der Neunzigerjahre die Flüchtlinge vom Balkan eintrafen, musste TrikotKönig als Flüchtlingsunterkunft dienen.
Ich sehe Manfreds großen deutschen SUV auf den Parkplatz einbiegen und gehe ihm entgegen.
Der Wagen hält an, und Manfreds kräftige Gestalt nähert sich, schlurfend und vorgebeugt. Der Wind fängt seine rotblonden Haare ein und weht sie nach oben, nach hinten, so sehen sie aus wie ein Heiligenschein.
Er ist wie immer elegant gekleidet, in einen teuren Mantel und einen roten Schal aus dünner, ein wenig zerknitterter Wolle, den er sich mehrmals bewusst lässig um den Hals gewunden hat. Er hat sich die Aktentasche aus cognacfarbenem Leder unter den linken Arm geklemmt und beschleunigt jetzt seine Schritte.
»Hallo«, sage ich und laufe los, um mit ihm Schritt halten zu können.
»Kommt Andreas auch?«, frage ich.
»Nein«, sagt Manfred und presst die Hand auf seine rotblonden Haare, um sie zum Liegen zu bringen. »Der ist bei seiner Mutter in Örebro. Wir müssen ihn dann morgen informieren.«
»Und Peter, irgendwas gehört?«
Manfred antwortet nicht sofort.
»Nein. Sein Handy ist wohl ausgeschaltet. Und Hanne kann sich an nichts erinnern. Ich habe ihn zur Fahndung ausschreiben lassen. Polizei und Militär werden morgen früh den Wald durchsuchen.«
Ich weiß nicht, wie nah sich Peter und Manfred stehen, aber sie arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Sie scheinen jedenfalls fast immer einer Meinung zu sein, und sie brauchen offenbar nicht viele Worte, um zu kommunizieren. Ein Blick oder ein kurzes Nicken, das scheint zu reichen.
Manfred macht sich bestimmt große Sorgen.
Seit vorgestern hat niemand von Peter gehört, seit er und Hanne gegen halb fünf unser provisorisches Büro in Ormberg verlassen haben.
Soviel wir wissen, habe ich sie als Letzte gesehen.
Als sie gingen, wirkten sie irgendwie aufgekratzt, als hätten sie etwas Lustiges vor. Ich habe gefragt, wo sie hinwollten, und sie sagten, sie wollten zum Essen nach Katrineholm fahren, sie hätten die pappige Imbisskost jetzt satt. Ja, so ungefähr haben sie das gesagt.
Danach hörten wir nichts mehr von Hanne oder Peter – was wir an sich auch nicht erwartet hatten, es war doch Wochenende, und wir alle wollten uns zwei Tage freinehmen.
Wir betreten das Krankenhaus und lassen uns an der Rezeption den Weg zur Station erklären. Die grelle Krankenhausbeleuchtung spiegelt sich in dem blanken Linoleumboden im Gang wider. Manfred sieht müde aus, seine Augen sind gerötet und seine Lippen blass und rissig. Aber er sieht oft müde aus. Ich nehme an, dass die Vollzeitarbeit und das Leben als fünfzig Jahre alter Vater eines kleinen Kindes ihren Tribut fordern.
Hanne sitzt auf der Bettkante, als wir das Zimmer betreten. Sie trägt Krankenhauskleidung und hat sich die orange Klinikdecke über die Schultern gelegt wie ein Cape. Ihre Haare hängen ihr in feuchten Strähnen auf die Schultern, als ob sie eben geduscht hätte. Ihre Hände sind zerschrammt, ihre Füße verbunden. Neben ihr steht ein Gestell mit einem Tropf, und eine Kanüle steckt in ihrer Hand. Ihr Blick ist glasig und ausdruckslos.
Manfred geht zu ihr und umarmt sie unbeholfen.
»Manfred«, murmelt sie mit kratziger Stimme.
Dann schaut sie mich an, legt den Kopf ein wenig schräg und macht ein verständnisloses Gesicht.
Ich begreife erst nach einigen Sekunden, dass sie mich wirklich nicht erkennt, obwohl wir seit über einer Woche gemeinsam an unserem kalten Mordfall arbeiten.
Bei dieser Erkenntnis wird mein Magen eiskalt.
»Hallo, Hanne«, sage ich und berühre ganz leicht ihren Arm, in der plötzlichen Angst, sie könnte bei meiner Berührung zerfallen wie eine Papierpuppe, denn sie sieht so grauenhaft zerbrechlich aus.
»Ich bin’s, Malin, deine Kollegin«, füge ich hinzu und versuche, meine Stimme fest klingen zu lassen. »Erinnerst du dich an mich?«
Hanne blinzelt mehrere Male und erwidert meinen Blick. Ihre Augen sind wässrig und gerötet.
»Doch, natürlich«, sagt sie, aber ich bin sicher, dass sie lügt, denn ihre Miene wirkt gequält, als versuchte sie, eine schwierige Gleichung zu lösen.
Ich hole einen Hocker und setze mich ihr gegenüber. Manfred lässt sich auf das Bett sinken und legt ihr den Arm um die schmalen Schultern.
Hanne sieht neben ihm so seltsam klein und dünn aus, fast wie ein Kind.
Manfred räuspert sich.
»Kannst du dich erinnern, was im Wald passiert ist, Hanne?«
Hanne verzieht das Gesicht. Sie runzelt die Stirn und schüttelt langsam den Kopf.
»Ich kann mich nicht erinnern«, sagt sie und schlägt die Hände vors Gesicht.
Einen Moment lang glaube ich, dass sie sich schämt, denn es sieht aus, als wollte sie die ganze Situation aussperren.
Manfred erwidert meinen Blick.
»Das macht nichts«, sagt er, drückt Hannes Schulter und fügt dann mit fester Stimme hinzu:
»Du warst im Wald, im Süden von Ormberg, gestern Abend.«
Hanne nickt, setzt sich gerade und legt die Hände auf die Knie.
»Kannst du dich daran erinnern?«, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf und kratzt zerstreut an dem Klebestreifen, mit dem die Kanüle befestigt ist. Ihre Nägel sind eingerissen und haben schwarze Trauerränder.
»Du bist von einer Autofahrerin gefunden worden«, sagt Manfred. »Offenbar warst du mit einer jungen Frau zusammen. Die trug eine Strickjacke und eine Art glitzerndes Kleid. Weißt du das noch?«
»Nein, entschuldige. Es tut mir so leid, aber …«
Hannes Stimme versagt, und die Tränen laufen ihr über die Wangen.
»Macht doch nichts«, sagt Manfred. »Macht nichts, Hanne. Wir kriegen schon noch raus, was passiert ist. Weißt du noch, ob Peter mit dir im Wald war?«
Hanne schlägt wieder die Hände vors Gesicht.
»Nein. Entschuldige!«
Manfred sieht traurig aus. Schaut mich flehend an.
»Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst?«
Erst glaube ich, dass sie nicht antworten wird. Ihre Schultern heben sich immer wieder, und sie atmet mühsam, als sei ihr jeder Atemzug zuwider.
»Ilulissat«, sagt sie endlich, das Gesicht noch immer in den Händen vergraben.
Manfred fängt meinen Blick auf und formt mit den Lippen das Wort »Grönland«.
Hanne und Peter sind direkt von Grönland aus zu uns gestoßen. Sie kamen von einer zwei Monate langen Traumreise, die sie endlich angetreten hatten, nachdem sie lange an einem komplizierten Mordfall gearbeitet hatten.
»Na gut«, sage ich. »Und dann seid ihr nach Ormberg gekommen, um an den Ermittlungen zu dem Skelett in der Geröllhalde zu arbeiten. Weißt du das noch?«
Hanne schüttelt heftig den Kopf und schluchzt.
»Weißt du noch irgendetwas aus Ormberg?«, fragt Manfred mit leiser Stimme.
»Nichts«, sagt Hanne. »Ich weiß nichts mehr.«
Manfred nimmt ihre dünne Hand in seine und denkt offenbar nach. Dann erstarrt er, dreht ihre Handfläche nach oben und mustert sie mit großem Interesse.
Zuerst begreife ich nicht, was er tut, aber dann sehe ich, dass auf Hannes Hand etwas steht. Zittrige Ziffern in Schwarz, durchbrochen von kleinen Wunden, sind auf die blasse Haut geschrieben. Ich kann »363« lesen, aber dann verläuft die Schrift und ist nicht zu entziffern, so, als ob sie zusammen mit dem Schmutz aus dem Wald weggeschrubbt worden sei.
»Was ist das hier?«, fragt Manfred. »Was bedeuten diese Ziffern?«
Hanne starrt ihre Hand verständnislos an, als ob sie sie noch nie gesehen hätte. Wie ein seltsames Tier, das sich ins Krankenhaus geschlichen und es sich auf ihrem Knie gemütlich gemacht hat.
»Ich weiß nicht«, sagt sie. »Ich habe keine Ahnung.«
Wir sitzen mit der Ärztin, die Maja heißt und in meinem Alter zu sein scheint, in der Küche. Ihre langen blonden Haare fallen in weichen Wellen über ihren schwarzen Kittel. Sie erinnert mich vage an die vielen Mädchen, denen ich so gern ähneln wollte, als ich jünger war, klein, kurvenreich und zuckersüß – mit anderen Worten, alles, was ich nicht war. Sie trägt Jeans, und unter dem Kittel lugt ein rosa T-Shirt hervor. Auf der Brust hat sie ein blaues Schild mit der Aufschrift »Ärztin«, und in ihrer Brusttasche stecken einige Kugelschreiber.
Der Raum ist klein und eingerichtet mit zwei Kühlschränken, einer Spülmaschine und einem runden Tisch mit vier Hockern aus Birkenfurnier. Mitten auf dem Tisch steht ein Christstern in einem Plastiktopf. Eine Dankeskarte mit zittriger Handschrift steckt zwischen den Blättern.
Zwei Krankenschwestern kommen herein, holen etwas aus dem Kühlschrank und verschwinden dann mit lautlosen Schritten wieder auf dem Gang.
»Sie war arg unterkühlt und ausgetrocknet, als sie hergebracht wurde«, sagt Maja und gießt sich einen Schuss Milch in ihre Kaffeetasse. »Ja, sie trug ja offenbar nur eine dünne Bluse und eine Hose, als sie gefunden worden ist, obwohl draußen null Grad war.«
»Keine Jacke?«, fragt Manfred.
Maja schüttelt den Kopf.
»Keine Jacke, keine Schuhe.«
»Konnte sie etwas darüber sagen, was geschehen war?«, frage ich.
Maja sammelt ihre langen blonden Haare und steckt sie im Nacken zu einem Knoten zusammen. Schiebt die perfekt geformten Lippen zusammen, seufzt und schüttelt den Kopf.
»Sie konnte sich an fast nichts erinnern. Anterograde Amnesie nennen wir das. Ja, das ist, wenn man sich ab einem gewissen Zeitpunkt an nichts mehr erinnern kann. Zuerst glaubten wir, es liege daran, dass sie sich irgendeine Art von Schädeltrauma zugezogen hatte. Aber wir haben nichts gefunden, was darauf hinweist. Sie hat keine äußeren Verletzungen am Kopf, und die Röntgenuntersuchung hat keine Blutungen oder Schwellungen gezeigt. Aber natürlich können wir etwas übersehen haben. Man muss innerhalb von sechs Stunden nach dem Schädeltrauma röntgen, um mögliche Blutungen auf jeden Fall sehen zu können. Und wir wissen ja nicht, wie lange sie im Wald unterwegs war.«
»Ist es möglich, dass ihr etwas einen solchen Schock versetzt hat, dass sie es verdrängt hat?«
Maja zuckt kurz mit den Schultern und nippt an ihrem Kaffee. Zieht dann eine Grimasse und knallt die Kaffeetasse auf den Tisch.
»Entschuldigung. Der Kaffee hier schmeckt wie der letzte Dreck. Sie meinen, ob sie einem psychischen Trauma ausgesetzt gewesen sein kann und als Folge davon das Gedächtnis verloren hat? Vielleicht. Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Aber wir glauben so langsam, dass sie an irgendeiner Form von Demenzkrankheit leidet. Vielleicht hat sich ihr Zustand dessentwegen, was sie erlebt hat, nun verschlechtert. Ihr Kurzzeitgedächtnis ist kräftig reduziert, aber an alles, was bis vor einem Monat passiert ist, scheint sie sich ziemlich genau zu erinnern.«
»Kann man das nicht in ihrem Krankenbericht nachsehen?«, frage ich.
»Sie meinen, in dem von ihrem Hausarzt?«, fragt Maja zurück. »Wir dürfen den ohne ihr Einverständnis nicht kommen lassen, so steht es im Gesetz. An sich ist Hanne auch einverstanden. Aber wir müssten wissen, wo sie in Behandlung war, und das weiß sie nicht mehr. Ja, die Krankenberichte befinden sich ja oft bei unterschiedlichen Pflegeinstanzen.«
Manfred räuspert sich und scheint zu zögern. Fährt sich mit der Hand über den Bart.
»Hanne hatte wirklich Gedächtnisprobleme«, sagt er leise.
»Was?«, frage ich. »Das hast du aber nicht erwähnt.«
Manfred windet sich und sieht verlegen aus.
»Ich hatte es nicht für so ernst gehalten. Peter hat es einmal erwähnt, aber ich hatte den Eindruck, sie sei vor allem ein bisschen schusselig, nicht, dass es sich um … Ja, also, dass sie dement ist, in klinischer Bedeutung.«
Er verstummt und spielt an seiner teuren Schweizer Armbanduhr herum.
Sein Geständnis verwirrt mich. Meint er allen Ernstes, dass Hanne an einer Mordermittlung teilnehmen durfte, obwohl sie krank ist? Dass einer dementen Person Fragen anvertraut worden sind, die sich um Leben und Tod drehen?
»Wir wissen ja noch nicht, warum ihr Kurzzeitgedächtnis so schlecht ist«, schaltet sich Maja diplomatisch ein. »Dahinter kann zwar eine Demenzproblematik liegen, aber sie könnte auch an einem Trauma leiden, sei es nun psychisch oder physisch.«
»Was passiert jetzt mit ihr?«, fragt Manfred.
»Das wissen wir noch nicht«, sagt Maja. »Der Sozialdienst versucht, eine vorläufige Unterkunft für sie zu finden, da die Geriatrie voll belegt ist. Außerdem ist sie nicht krank genug, um im Krankenhaus zu bleiben. Sie hat Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, sonst ist sie aber funktionsfähig.«
»Kann sie ihre Erinnerung wiederfinden?«, frage ich. »Falls es nur ein Zufall ist, meine ich.«
Maja lächelt traurig und legt den Kopf schräg. Spielt an ihrer Kaffeetasse herum, legt die schmalen Hände auf den Tisch und faltet sie.
»Wer weiß. Es sind schon seltsamere Dinge vorgekommen.«
Jake
Auf der Heimfahrt sitze ich im Schulbus neben Saga. Niemand sonst will neben ihr sitzen, aber ich tu es gern.
Ich mag Saga.
Sie sieht anders aus und ist auch anders, von innen, meine ich. Als ob sie aus einem ganz anderen Material wäre als die anderen. Einem, das härter und weicher zugleich ist.
»Hallo«, sagt sie und streicht sich eine Strähne ihrer rosa Haare aus dem Gesicht. Der Ring in ihrer Nase funkelt in dem trüben Dämmerlicht.
Draußen sind nur Felder zu sehen. Kilometer um Kilometer von schwarzen gepflügten Äckern. Und hier und da ein bisschen Wald. Bald werden wir die Tankstelle an der Ausfahrt zur Autobahn passieren, und danach wird der Wald immer dichter werden, je näher wir Ormberg kommen.
Ormberg ist gleichbedeutend mit Wald. Und dann haben wir noch den Berg Ormberg, mit seinen Überresten aus der Steinzeit. Wir waren mit der Schule da, aber viel zu sehen gab es nicht, nur ein paar große Steine in einem Kreis, auf einem Bergabsatz ziemlich weit oben. Ich weiß noch, dass ich enttäuscht war, ich hatte mit Runeninschriften oder Bronzeschmuck oder so was gerechnet.
Sara nimmt mein Handgelenk. Bei dieser Berührung geht ein Stoß durch meinen Leib und meine Wangen werden heiß.
»Lass mal sehen«, sagt sie, dreht meine Handfläche nach oben und sieht sich die Wörter an, die dort mit Tinte geschrieben stehen.
Proposition
Soßenfond
Konjunktion
Ich habe sie heute in Gesellschaftskunde, Hauswirtschaft und Schwedisch gesammelt.
»Die will ich nachher googeln«, erkläre ich.
»Sweet«, sagt Saga und schließt die Augen, wie um sich weit wegzuträumen.
Dabei sehe ich, dass sie glitzernden rosa Lidschatten hat. Es sieht aus, als wären Edelsteine zermahlen und vorsichtig auf ihre Lider aufgepinselt worden. Ich würde gern etwas sagen, ihren Lidschatten kommentieren. Oder vielleicht mit dem Finger darüberstreichen.
Aber das tue ich natürlich nicht.
Stattdessen verschlägt es mir den Atem, als Vincent Hahn sich auf mein Knie schiebt. Der Geruch von Zigarettenrauch und Kaugummi schlägt mir entgegen. Sein Gesicht ist so nah, ich sehe die spärlichen Barthaare, die Pickel mit ihren gelben Eiterköpfen und den flaumigen Schnurrbart. Sein Adamsapfel ragt aus dem Hals vor, es sieht aus, als ob er soeben ein Ei verschluckt hätte. Sein Blick ist voller Hass – Hass, von dem ich nicht einmal weiß, woher er kommt.
Ich habe ihm nie etwas getan, aber er liebt es, mich zu hassen. Ich glaube, dass es zu seinen Lieblingsbeschäftigungen im Leben gehört.
Ich bin sein Lieblingshassobjekt.
Vincent hat meine Hand mit eisernem Griff gepackt.
»Ja, Scheiße, kuckt mal, was sich der Schwule in die Hand geschrieben hat!«, schreit er. »Konjunk … Konjunktion. Was zum Teufel soll das denn heißen? Ist das so was wie ein Arschfick?«
Vincent macht Wichsbewegungen und grinst. Hinten im Bus ist Lachen zu hören. Ich sage nichts, denn das ist die beste Strategie. Früher oder später hört er wieder auf.
Vincent lässt mein Handgelenk los und stellt sich neben mich, packt meinen Nacken und schlägt meinen Kopf gegen den Sitz vor mir.
Dunk. Dunk. Dunk.
Es tut weh an der Stirn, und die Haut in meinem Nacken brennt unter seinem Griff.
Jetzt gibt es zwei vorstellbare Alternativen: Entweder wird er die Sache sattkriegen und zu seinen Kumpels hinten im Bus zurückkehren, oder alles wird noch schlimmer. Viel schlimmer.
»Lass ihn in Ruhe, du Freak«, sagt Saga.
Vincent erstarrt.
»Hast du was gesagt, Hure?«
Seine Stimme ist scharf und gemein, aber sein Griff um meinen Nacken lockert sich, und er lässt meinen Kopf in Ruhe.
»Ich habe gesagt, dass du ihn in Ruhe lassen sollst. Hörst du schlecht? Es ist so verdammt gemein, sich an Kleineren zu vergreifen.«
Vincent lässt mich los und schielt zu Saga hinüber, während ich mit gesenktem Kopf dasitze. Sie und ich wissen, dass sie mich bewusst kleiner macht, damit er aufhört.
Das ist schon in Ordnung.
Ich mache mich selbst auch immer kleiner. Werde so klein und uninteressant und fügsam, dass es keinen Spaß mehr macht, mich zu verspotten, zu schlagen oder anzupöbeln.
Das kann ich verdammt gut.
Einige Sekunden darauf verliert Vincent das Interesse und kehrt an seinen Platz weiter hinten im Bus zurück. Die Haut in meinem Nacken brennt, als ob jemand eine Flamme darangehalten hätte.
»Scheiß auf den Kerl«, sagt Saga. »Der ist doch fucking scheißgestört. Ist alles in Ordnung bei dir?«
Ich streiche mir mit der Hand über die Haut im Nacken, versuche, den Schmerz wegzumassieren.
»Das war saumäßig scheußlich.«
Sara reißt die Augen auf und beugt sich zu mir vor.
»Wenn er so was macht, dann musst du dir vorstellen, dass er auf dem Klo sitzt und kackt.«
»Was?«
Saga kichert und sieht zufrieden aus.
»Das sagt meine Mutter immer. Wenn sich jemand blöd aufführt oder sich einfach wahnsinnig wichtig nimmt, dann soll man sich solche Leute beim Kacken vorstellen. Denn dann kann man einfach keine Angst mehr vor ihnen haben.«
Ich überlege eine Weile.
»Du hast recht«, sage ich dann. »Das klappt wirklich.«
Sara lächelt, und das Prickeln in meinem Magen ist wieder da.
»Bis heute Abend?«, fragt sie. »Ich hab ein paar neue Horrorfilme runtergeladen.«
»Vielleicht«, sage ich. »Muss vorher noch was erledigen.«
Es ist still, als ich nach Hause komme. Nur die Geräusche des Waldes sind zu hören: das schwache Rauschen der Baumkronen und das leise Knistern und Knuspern unsichtbarer Tiere, die in der Dunkelheit auf der Lauer liegen. Die Luft ist gesättigt von Gerüchen: Kiefern, verfaulendes Laub und die feuchte Kohle im Grill vor dem Haus.
Papas alter dunkelblauer Volvo steht quer in der Auffahrt, als ob Papa es eilig gehabt hätte, als er nach Hause kam.
Ich schließe auf und gehe hinein. Lasse die Schultasche unter die Garderobe fallen und ziehe mich aus.
Im Wohnzimmer flackert Licht: Der Fernseher läuft, aber ohne Ton. Papa liegt auf dem Sofa und schläft. Er schnarcht laut und hat einen Fuß auf dem Boden stehen, als sei er mitten im Aufstehen eingeschlafen. Auf dem Couchtisch stehen einige leere Bierdosen.
Vorsichtig hebe ich seinen Fuß auf das Sofa und lege die alte karierte Decke über ihn. Er grunzt und dreht sich auf die Seite, mit dem Gesicht zum Sofarücken.
Ich schalte den Fernseher aus und gehe hinaus in die Diele. Schleiche die Treppe hoch, gehe in mein Zimmer und ziehe vorsichtig die Tür zu. Dann gehe ich zum Bett, hebe die Matratze hoch und ziehe das braune Buch hervor. Setze mich mit dem Rücken zum Bett auf den Boden.
Ich weiß, wer sie ist – die Frau, die mir im Wald begegnet ist, die, die Hanne heißt. Ich habe in der Lokalzeitung im Internet über sie gelesen. Der Artikel sagt, dass sie an Gedächtnisverlust leidet und mit einer jungen Frau zusammen war, als eine Autofahrerin sie gefunden hat. Die Polizei würde gern mit dieser jungen Frau sprechen, heißt es dort. Es war sogar eine Telefonnummer angegeben, die man anrufen soll. Sie schrieben, dass alle Hinweise weiterhelfen könnten und dass ein Kollege dieser Frau, ein Polizist aus Stockholm namens Peter, verschwunden sei. Dann stand da noch, wie dieser Peter aussah und dass er zuletzt ein rot kariertes Flanellhemd und eine blaue Jacke der Marke Sail Racing trug.
Beim Lesen habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, diese Nummer anzurufen. Aber wenn ich das mache, kapieren sie doch sofort, dass ich da gestanden habe, in BH, Kleid und hochhackigen Schuhen. Und das geht doch nicht. Das ist einfach total verdammt unmöglich. Ich habe auch überlegt, ob ich das Buch bei der Polizei abliefern soll, aber die Wache liegt in Vingåker und ist auch nur an einem Tag pro Woche besetzt.
Außerdem: Wie sollte ich erklären, dass ich das Buch habe?
Ich habe viel über das alles nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich am besten diese mit spitzer Schrift zu Papier gebrachten Aufzeichnungen lese und nachsehe, ob da etwas Wichtiges steht, etwas, das diesem verschwundenen Polizisten helfen kann.
Also mache ich das. Ich öffne das Buch, das sich vor Feuchtigkeit wellt. Auf der ersten Seite steht in altmodischer Schrägschrift Tagebuch. Und dann, gleich darunter: morgens und abends lesen.
Seltsam.
Hat Hanne an sich selbst geschrieben?
Warum schreibt man ein Tagebuch, das morgens und abends gelesen werden soll, als wäre es eine Medizin zum Einnehmen? Außerdem: Ein Tagebuch wird doch wohl nur von dem Menschen gelesen, der es geschrieben hat.
Hat Hanne an sich selbst geschrieben?
Morgens und abends lesen.
Das klingt doch total gestört.
Ich blättere rasch an zwei leeren Blättern vorbei und finde etwas, das aussieht wie eine lange alphabetische Liste. Die zieht sich über zwei ganze Seiten hin. Nach jedem Wort oder Namen stehen Zahlen.
Ich fahre mit dem Finger über den Text, halte beim Buchstaben M inne und lese:
M
Malin Brundin, Polizei: 5, 6, 8, 12, 20
Modus: 12, 23, 25
Metallplatte, im Skelett: 12, 23
Mir geht erst nach einer Weile auf, dass es sich um eine Art Inhaltsverzeichnis mit Seitenverweisen handeln muss.
Ich schlage eine Seite weiter hinten auf, dann noch eine. Auf jeder Seite hat Hanne unten rechts in der Ecke die Seitenzahl notiert.
Aber warum?
Es ist doch ein Tagebuch, kein verdammtes Kochbuch.
Ich finde keine Antwort auf diese Frage, deshalb blättere ich an dem Inhaltsverzeichnis vorbei und fange an zu lesen.
Ilulissat, 19. November
Darf man so glücklich sein?
Ich bin genau an dem Ort, an dem ich am liebsten sein möchte. Und ich bin hier zusammen mit dem Mann, den ich liebe.
Als ich heute Morgen aufgewacht war, brachte P mir das Frühstück ans Bett. Er war schon im Ort gewesen und hatte so ein Brot mit Körnern gekauft, das ich so gern esse. Es ist ja nichts Großes, ein Brot kaufen zu gehen. Aber bei so viel Fürsorge wurde mir innerlich ganz warm.
Wir blieben lange im Bett liegen. Liebten uns. Ließen uns mehr Kaffee aufs Zimmer bringen.
Dann: ein langer Spaziergang und Mittagessen in der Sonne, bis gegen zwei Uhr die Dämmerung einsetzte.
Das Wetter ist noch immer schön, aber um einiges kühler als vor zwei Wochen. Die Tage sind jetzt kurz, nicht viel mehr als drei Stunden.
In zehn Tagen wird es rund um die Uhr dunkel sein. Dann dauert es bis Januar, bis die Sonne zurückkehrt.
P findet es »creepy«, aber ich wünschte, wir könnten hierbleiben.
Ich vermisse hier gar nichts! Zum ersten Mal in meinem Leben kommt mir alles perfekt vor. Obwohl mein Gedächtnis immer schlechter wird, habe ich das Gefühl, dass mir in meiner vollkommenen grönländischen Blase nichts passieren kann.