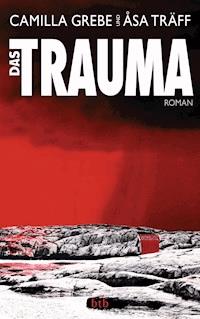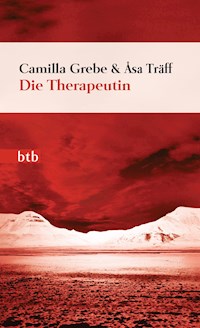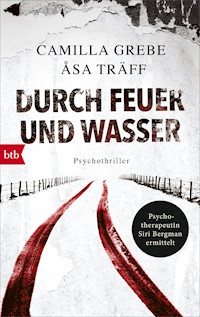
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychotherapeutin Siri Bergmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Zwei Geschwister verschwinden kurz nacheinander von ihren Pflegeeltern. Wenig später taucht ein Bild von den beiden im Internet auf, zusammen mit einer fremden Frau. Als diese einige Tage später tot aufgefunden wird, muss das Ermittlerteam schnell handeln. Was ist mit der Frau passiert? Und warum ist sie auf einem Bild mit den zwei vermissten Kindern zu sehen? Was hatte sie mit ihnen zu tun? Psychotherapeutin Siri Bergman und ihrem Team bei der Stockholmer Polizei bleibt nicht viel Zeit, um dem mysteriösen Fall auf den Grund zu gehen und den Täter zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Zum Buch
Zwei Geschwister verschwinden kurz nacheinander von ihren Pflegeeltern. Wenig später taucht ein Bild von den beiden im Internet auf, zusammen mit einer fremden Frau. Als diese einige Tage später tot aufgefunden wird, muss das Ermittlerteam schnell handeln. Was ist mit der Frau passiert? Und warum ist sie auf einem Bild mit den zwei vermissten Kindern zu sehen? Was hatte sie mit ihnen zu tun? Psychotherapeutin Siri Bergman und ihrem Team bei der Stockholmer Polizei bleibt nicht viel Zeit, um dem mysteriösen Fall auf den Grund zu gehen und den Täter zu finden.
Zu den Autoren
CAMILLA GREBE UND ÅSA TRÄFFsind Schwestern, aufgewachsen in Älvsjö in der Nähe von Stockholm. Der Roman »Die Therapeutin« war ihr erstes Gemeinschaftsprojekt, fast zwangsläufig entstanden aus ihrer Liebe zur Kriminalliteratur. Camilla, geboren 1968, lebt in Stockholm mit ihrem Mann, zwei Kindern und einem Dalmatiner. Sie ist studierte Betriebswirtin, hat den Hörbuchverlag »StorySide« gegründet und betreibt ein Beratungsunternehmen. Åsa, geboren 1970, lebt in Gnesta mit ihrem Mann und zwei Kindern. Sie arbeitet als Psychologin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie und betreibt in Stockholm mit drei Kollegen eine Gemeinschaftspraxis, die sich auf Angststörungen und neuropsychologische Störungen spezialisiert hat.
Camilla Grebe und Åsa Träff bei btb:
Die Therapeutin. RomanDas Trauma. RomanBevor du stirbst. RomanMann ohne Herz. Psychothriller
CAMILLA GREBE · ÅSA TRÄFF
Durch Feuer und Wasser
Psychothriller
Aus dem Schwedischen von Gabriele Haefs
Für Mikael und Andreas
Aber
werd’ ich sagen
Hüte dich vor dem Feuer
und dem tiefen Wasser
Lauf niemals, niemals weg von mir
in die schwarze Nacht
Barbro Lindgren
Nacka, im Osten von Stockholm, 1985
Er setzt sich im Bett auf. Lauscht unruhig auf Geräusche, hat Angst, seine Eltern könnten das Klingeln hören. Er hat mit dem Wecker im Bett geschlafen. Wie eine harte Kugel lag der unter dem weichen Kissen. Wie ein Geheimnis, von dem nur er wusste.
Das einzige Licht im Zimmer stammt von einem orangefarbenen Weihnachtsstern aus Pappe, der sein Licht im Kinderzimmer verbreitet. Das schmale Bett, das Bücherregal aus Fichtenholz und die bunten, bis an den Rand mit Spielzeug gefüllten Plastikkisten werden davon brandgelb gefärbt. Auf dem kleinen Schreibtisch neben der Tür steht ein Flamingo aus rosa Glas, den seine kleine Schwester ihm zu Weihnachten geschenkt hat. Daneben sitzt Onkel Dagobert mit düsterer Miene auf der Spardose, die wie eine Truhe aussieht, und bewacht das Geld. Der Junge weiß genau, wie viel er in der Spardose hat. Neunzehn Kronen und fünfzig Öre. Der Junge denkt, dass er ein so guter Slalomläufer werden will wie Ingemar. Auch er wird die steilsten Hänge hinuntersausen und die größten Rennen gewinnen. Sein Papa hat ihm versprochen, dass er dieses Jahr in die Skischule darf. Er ist doch jetzt sieben, also groß genug. Nach Weihnachten wird die Familie nach Sälen fahren, und da kann er dann endlich seine neuen Skier ausprobieren.
Der Junge steht auf. Schleicht vorsichtig zum Fenster. Stellt sich dicht vor die Scheibe. Legt die Hand an das kalte, glatte Glas. Draußen ist der Himmel schwarz, und er kann Tausende funkelnder Sterne sehen. Sie kommen ihm vor wie spitze Glasscherben, die jemand über ein schwarzes Tuch verstreut hat.
Den Jungen schaudert es. Er mag es nicht, wenn der Nachthimmel das Haus in Finsternis hüllt. Er hat Angst vor Dunkelheit und Leere, vor allem vor dem, was sich dort draußen versteckt und nicht zu sehen ist. Er richtet lieber den Blick nach unten auf das Grundstück. Der Schnee liegt unberührt da und die Straßenlaterne wirft ihr kaltes Licht auf den weißen daunenweichen Teppich.
Überall Schnee. Der breitet sich wie eine dicke Decke über den Garten. Der Junge ahnt die Umrisse von Büschen und Beeten und von Papas altem Fahrrad vor der Garage. Mama hat in einen der knorrigen Apfelbäume Laternen gehängt. Es sieht so schön aus, wenn die Laternen durch den Schnee leuchten. Wirklich wie Weihnachten.
Es ist halb fünf Uhr morgens. Bald wird Mama aufstehen. Sie muss immer früh raus, um rechtzeitig bei ihrer Arbeit im Krankenhaus zu sein.
Mama arbeitet bei kranken Kindern, und ab und zu weint sie, wenn sie nach Hause kommt. Dann ist tagsüber etwas passiert. Der Junge hat heimlich zugehört, als Mama und Papa geredet haben, und er weiß, dass bei Mamas Arbeit schlimme Dinge geschehen. Es kommt vor, dass Kinder sterben. Dass sie so krank sind, dass sie nicht mehr leben können. Er bekommt Angst, wenn er Mamas Geschichten hört. Auch er ist schließlich schon krank gewesen. Was, wenn es auch bei ihm so schlimm wird, dass er stirbt? Oder vielleicht Mama oder Papa oder Elsemarie? Wenn der Junge über solche Dinge nachdenkt, bekommt er Bauchschmerzen und muss an etwas anderes denken. Wie Autos. Oder Tablettenschachteln.
Er flüstert alle Namen von Tablettenschachteln, die er kennt, wieder und wieder.
Nach einer Weile geht es ihm besser.
Vorsichtig drückt er auf die Klinke und schleicht hinaus auf den schmalen Gang. Elsemaries Zimmertür steht offen, und er kann ihr erleuchtetes Aquarium sehen, das einen eigenen Tisch hat. Die weiße Tür der Eltern ist geschlossen, und er weiß, dass die beiden dahinter tief schlafen. Der Junge spürt den Teppichboden an seinen nackten Fußsohlen kitzeln. Es fühlt sich schön an, wie Samt. Wenn man den Fuß darüberzieht, bleibt eine Spur in dem dicken Teppich. Das sieht witzig aus. Der ganze Teppich sieht witzig aus.
So ein Teppichboden ist auch auf der Treppe verlegt. Papa sagt, das sei gut, dann ist die Treppe nicht so glatt und man braucht keine Angst zu haben, dass man ausrutscht und sich wehtut. Papa findet solche Dinge wichtig. Dass die Treppe nicht glatt ist. Dass auf dem Weg von der Straße zum Haus ordentlich gestreut ist. Dass alle gefährlichen Flaschen mit Reinigungsmitteln in der Garage weggesperrt sind. Der Junge findet, dass der Vater übertreibt. Er ist doch jetzt sieben. Geht zur Schule. Ist alt genug, um zu wissen, dass man nichts trinken darf, was man nicht kennt. Aber er sagt nichts, denn er weiß ja, dass Papa es beruhigend findet, wenn alles seine Ordnung hat.
In der Küche brennt der elektrische Leuchter. Es riecht nach Tee und Apfelsinen und etwas anderem, das er nicht kennt, das ihm aber vertraut vorkommt. Es riecht nach zu Hause. Der Junge geht in die Hocke, öffnet einen Schrank und zieht ein großes rotes, mit Weihnachtswichteln dekoriertes Blechtablett heraus. Er stößt dabei gegen einen Plastikbehälter, und in der Küche ist ein dumpfer Laut zu hören. Dann wird es wieder still. Er wartet. Wartet auf die Stimme seiner Mutter und ihre Frage, was denn los sei, aber alles bleibt still.
Der Junge stellt das Tablett auf den Tisch und nimmt sich einen Teller. Es ist ein brauner Steingutteller, und er findet, der sehe aus wie ein echter Wichtelteller. Dann hockt er sich vor den Küchenschrank. Im Schrank haben die Eltern ihre großen Kessel und Kochtöpfe stehen, die Papa benutzt, wenn er Saft kocht. Der Junge hebt den Deckel von dem größten Kessel und greift hinein. Tastet mit eifrigen Händen, bis er die Papiertüte streift. Triumphierend zieht er sie heraus und fängt an, die schön verzierten Pfefferkuchenherzen auszupacken. Grüner und rosa Zuckerguss. »Schönen Luziatag«, steht in feiner Schnörkelschrift darauf. Es sind insgesamt vier. Eins für jedes Familienmitglied. Mama, Papa, Elsemarie und ihn selbst. Er legt die Herzen auf den grünen Steingutteller. Versucht, sie besonders schön aussehen zu lassen, indem er sie anordnet wie ein vierblättriges Kleeblatt.
Der Junge hat Geld aus seiner Spardose genommen und die Herzen in der kleinen Konditorei in der Innenstadt gekauft, an der er jeden Tag auf dem Schulweg vorbeigeht. Er hat lange gebraucht, um sich zwischen den unterschiedlichen Pfefferkuchen hinter dem Tresen zu entscheiden, er wollte ja alles ganz richtig machen. Als er sich am Ende entschieden hatte, gab er das Geld der grauhaarigen Tante, die immer hinter dem Tresen in der Konditorei steht. Sie heißt Hilma, und ihr Mann, der Konditor, heißt Erik, und er bäckt alle Kuchen und Brötchen, die es in der Konditorei gibt. Hilma lachte über den Jungen, als sie seine Ein-Kronen-Stücke sah, aber es war ein liebes Lachen.
»Willst du deine Eltern überraschen?«
Sie lachte noch immer, und dabei war ihre Zahnlücke im Oberkiefer zu sehen. Er nickte eifrig.
»Ja, zu Luzia. Mama und Papa und Elsemarie.«
»Was du nicht sagst. Das wird ja ein schönes Fest werden!«
Hilma griff zu einer silbernen Zange, nahm vorsichtig einen Pfefferkuchen nach dem anderen und legte sie in die Tüte.
»Aber dann brauchst du doch auch eine Überraschung.«
Sie bückte sich unter den Tresen und zog eine Tüte mit Lutschern heraus. Der Junge nahm sich einen orange gestreiften und bedankte sich artig, dann legte er die Tüte vorsichtig in seine Schultasche und machte sich auf den Heimweg, während er an seinem Lutscher leckte.
Er arbeitet weiter an dem Tablett. Mama und Papa trinken morgens Kaffee, aber er weiß nicht, wie man Kaffee kocht. Stattdessen nimmt er zwei Flaschen Weihnachtsmalzbier aus der Speisekammer. Die fühlen sich kühl an. Mama hat erklärt, dass es in der Speisekammer eine Luke gibt, die kalte Luft hereinlässt. Je kälter es draußen wird, umso kälter ist es auch in der Speisekammer. Und jetzt ist es draußen schweinekalt. So kalt, dass schon jede Menge Schnee gefallen ist.
Er hat sich so nach Schnee gesehnt.
Danach gesehnt, mit dem Schlitten den steilen Hang im Wald hinunterzusausen, im Garten liegend Schnee-Engel zu machen und Elsemarie mit Schneebällen zu bewerfen. An das Letzte denkt er fast zaghaft, wie aus Angst, dass jemand seine Gedanken hören könnte. Er will Elsemarie nicht wehtun, aber manchmal macht es Spaß, sie aufzuziehen. Er liebt seine kleine Schwester, und wenn irgendwer gemein zu ihr wäre, würde derjenige es mit ihm zu tun bekommen. So ist das.
Er stellt vier kleine Gläser auf das Tablett und betrachtet dann sein Werk. Ein Teller mit vier Pfefferkuchen. Zwei Flaschen Malzbier. Vier kleine Gläser. Es sieht schön aus, aber doch noch nicht so schön, wie wenn seine Eltern für ein Festmahl decken. Er überlegt, was fehlt, und dann geht er zu einer Schublade, sucht darin und findet schließlich eine Packung Servietten. Die sind nicht sonderlich weihnachtlich, mit ihren Bildern von Walderdbeeren, aber er findet sie trotzdem schön. Er faltet sie zusammen, wie Mama das macht, und legt sie dann auf das Tablett.
Jetzt sieht es noch schöner aus, aber noch immer fehlt etwas.
Er schaut sich in der Küche um und entdeckt dann den Adventsleuchter, der auf dem Tisch aus Kiefernholz steht. Zwei Kerzen sind unberührt, die darf man noch nicht anzünden. Man muss bis zum dritten und vierten Advent warten. Der Junge stellt den Adventsleuchter auf das Tablett. Drückt ihn zwischen Servietten und Teller, wo er gerade genug Platz hat. Kuchen, Getränke, Servietten, Kerzen. Das sieht wirklich schön aus, und so lecker, dass er gern einen Pfefferkuchen probieren würde, wie ein richtiges Baby.
Aber das wird er natürlich nie im Leben tun.
Jetzt muss er noch Streichhölzer holen. Er weiß genau, wo Papa die aufbewahrt, aber er kommt nur mit Mühe an das oberste Schrankfach. Er klettert auf die Küchenbank und versucht, sich zum obersten Fach in dem kleinen Seitenschrank zu recken. Es riecht nach Stearin und Gewürzen und ein bisschen muffig, und eigentlich würde er sich gern die Nase zuhalten, da der Geruch so stark und aufdringlich ist. Er kann nicht bis so hoch oben sehen, deshalb lässt er vorsichtig seine Finger über die unterschiedlichen Gegenstände wandern. Findet den großen Aschenbecher aus Glas, der nur hervorgeholt wird, wenn sie Besuch von jemandem haben, der raucht. Daneben liegen die schönen Serviettenringe aus Messing, die an Feiertagen benutzt werden. Er sucht weiter, findet schließlich eine kleine Pappschachtel, schließt die Finger darum und klettert von der Küchenbank. Die Schachtel ist blau, und darauf ist ein Bild eines kleinen Kindes, das zielstrebig auf eine leuchtende Sonne zumarschiert. Es sieht fast aus, als sei das Kind auf dem Weg mitten in die Sonne.
Es ist schwer, die Kerze anzuzünden. Er hat zwar schon einmal Streichhölzer benutzt, aber da waren immer Erwachsene dabei. Jetzt muss er es allein schaffen. Natürlich weiß er, dass man mit Feuer ungeheuer vorsichtig umgehen muss. Er ist vorsichtig. Er konzentriert sich, und am Ende brennt die erste Kerze. Bei der zweiten geht es leichter, denn er kann das Streichholz gleich an der ersten Flamme anzünden. Und dann ist das Tablett fertig: Pfefferkuchen, Malzbier, Servietten und Kerzen.
Es sieht schön aus. Er ist stolz und aufgeregt. Stellt sich vor, was Mama und Papa wohl sagen werden. Und Elsemarie! Die werden ja so überrascht sein!
Er hebt das Tablett vorsichtig hoch. Es ist schwer. Schwerer, als er erwartet hat. Er muss sich anstrengen, um es gerade zu halten, damit nichts herunterfällt. Mit langsamen Schritten steigt er die Treppe hoch und findet es plötzlich schön, dass Papa auch dort Teppichboden verlegt hat, denn dadurch ist es weniger glatt, genau wie Papa gesagt hat.
Als er in den kleinen Gang im ersten Stock kommt, stellt er das Tablett auf den Tisch vor dem Fenster. Dann geht er in sein Zimmer und holt seine Sternsingerkleider hervor: ein weißes Hemd, einen Sternenhut und einen goldenen Pappstern, der an einem Blumenstöckchen befestigt ist.
Diese Kleider kommen ihm auf irgendeine Weise magisch vor. Er wird zu einem anderen Jungen. Einem Jungen in weißen Kleidern, der Weihnachten ankündigt.
Als er wieder in den Gang hinauskommt, will er anfangen zu singen, aber dann schaut er aus dem Fenster.
Draußen auf der Straße kommt ein seltsamer Mensch gegangen, der einen Wagen vor sich herschiebt. Zuerst begreift der Junge nicht, was er dort sieht, er ahnt nur die Umrisse dieses seltsamen Gefährts. Er rennt die Treppe hinunter in die Diele und zu dem Fenster neben der Haustür. Kann das ein Dieb sein, der da draußen mit einem Wagen unterwegs ist? Denn so früh am Morgen ist es ja wohl keine Mama mit einem Kinderwagen. Oder ist es vielleicht der Weihnachtsmann?
Der Junge glaubt eigentlich nicht mehr an den Weihnachtsmann. Stefan aus seiner Klasse sagt, dass nur Pipibabys an den Weihnachtsmann glauben und dass die Geschenke von den Eltern besorgt werden.
Aber vielleicht trotzdem?
Er beugt sich zur Fensterscheibe vor und sieht sich die Gestalt genauer an, und die bewegt sich jetzt auf der verschneiten Straße auf das Haus zu. Er begreift nicht so ganz, was er sieht, wer sich hinter den Winterkleidern verbirgt. Aber dann bückt sich die Gestalt plötzlich über den Wagen, nimmt etwas heraus und steckt es in ihren Briefkasten.
Der Junge begreift, dass er einen Zeitungsboten vor sich hat. Er hat so einen noch nie gesehen, weil die immer so früh am Morgen kommen, aber Papa hat ihm erklärt, dass ein Zeitungsbote die Morgenzeitungen austrägt, so, wie ein Briefträger das mit der Post macht. Der Mann tut ihm leid, da er so früh aufstehen und bei dem vielen Schnee Zeitungen austragen muss, aber zugleich freut sich der Junge, denn er weiß, dass Mama und Papa morgens gern die Zeitung lesen.
Er zieht seine Allwetterstiefel an, die innen lockiges weißes Fell haben und außen Plastik. Man kann sie bei jedem Wetter anziehen, wie der Name ja schon sagt. Die Stiefel sind schön, und das Fell fühlt sich an seinen nackten Füßen warm und weich an.
Der Junge betrachtet sich im Spiegel. Ein Sternsinger mit einem funkelnden goldenen Stern und Allwetterstiefeln. Vorsichtig legt er den Stern auf den Boden. Den braucht er ja wohl nicht, wenn er nur die Zeitung holen will.
Es ist nicht schwer, die Tür aufzumachen. Man dreht nur an dem Türknauf, bis es Klick macht. Der Junge tritt hinaus auf die Treppe, dann bleibt er stehen und schaut sich verwundert um.
Überall weiß. Überall Schnee.
Es riecht kalt und feucht und nach Winter.
Vorsichtig zieht er die Haustür zu, wie er das von seinem Papa gelernt hat, und läuft dann zum Briefkasten. Er bleibt stehen und bückt sich, lässt die Hände einige Handvoll Schnee fangen und macht daraus einen harten Ball. Er zielt auf die große Birke, die in ihrem Garten wächst, verfehlt den weißgefleckten Stamm aber um einige Zentimeter. Er macht sofort noch einen Schneeball, zielt und trifft wieder daneben. Er versucht es noch einmal und noch einmal, schafft es aber nie.
Plötzlich merkt er, wie steif und kalt seine Finger sind. Er hat ja keine Handschuhe an. Nur einen Schlafanzug und darüber ein Luziahemd und einen Sternsingerhut aus Pappe. Und die warmen Stiefel. Langsam geht er auf den Briefkasten zu. Der Schnee reicht ihm fast bis über den Stiefelrand und ein bisschen rutscht hinein. Er versucht, sich zu beeilen. Hebt den Deckel des alten grünen Plastikbriefkastens und fischt Dagens Nyheter heraus. Auf der Vorderseite ist eine Luzia abgebildet.
Als er zur Haustür zurückgeht, schaut er am Haus nach oben. Im Fenster im ersten Stock sieht er einen seltsamen Lichtschein. Er begreift nicht, was das sein kann. Vielleicht sind Mama und Papa aufgewacht, oder Elsemarie ist schon aufgestanden?
Das Licht bewegt sich oben hinter dem Fenster, wechselt zwischen Weiß, Gelb und Orange.
Der Junge rüttelt an der Haustür, aber nichts passiert. Er rüttelt wieder. Zieht so fest er nur kann am Türknauf. Er friert, und seine Füße sind nass, und er will ins Haus, aber er bekommt die Tür nicht auf. Er versucht es noch einmal, aber noch immer passiert nichts. Die Tür ist weiterhin verschlossen und nichts bewegt sich.
Und dann fällt es dem Jungen wieder ein.
Man muss das Schloss aufsperren, sonst kann man die Tür nicht öffnen. Und das hat er vergessen.
Für einen Moment steht er bewegungslos da. Weiß nicht, was er machen soll. Dann fängt er an, mit der schwarzen Türklappe zu schlagen. Er schlägt und schlägt, aber niemand kommt.
Dann schreit er. Ruft nach Mama und Papa.
Aber noch immer kommt niemand, um aufzumachen. Und im ersten Stock bewegt sich das Licht jetzt immer schneller. Weiß, Gelb und Orange.
Das Licht, das ein Feuer ist.
Restaurant Blå Porten, Djurgården, Stockholmer Innenstadt
Aina ist sehr blass. Ihre langen Haare sind einer lockigen Pagenfrisur gewichen. Ihre Züge sind markanter, treten in dem mageren Gesicht deutlicher hervor. Aber die Augen, die zwischen grau und grün changieren, funkeln wie immer.
Der Schmerz über ihren Anblick verschlägt mir fast den Atem. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass es ein Schock sein würde. Habe mich gefragt, ob mein Zorn noch vorhanden sein würde, wie ein eigenes Wesen irgendwo tief in meinem Körper. Aber ich verspüre nur Trauer, es tut mir weh, ihre Veränderung zu sehen. Ich werde von meinem Mitgefühl für Aina überwältigt. Aina, meine beste Freundin.
Meine ehemals beste Freundin.
»Ich weiß. Ich sehe einfach schrecklich aus.«
Sie fährt sich mit der Hand durch die dünnen Haare und kehrt ihr Gesicht der bleichen Herbstsonne zu. Sie nippt an einem Glas Wein und weicht meinem Blick dadurch aus, dass sie zwei kleine Kinder beobachtet, die sich gegenseitig durch den geschützten Innenhof jagen. Wir sitzen vor dem Blå Porten, wie früher so oft. Die Sommerwärme macht noch einen letzten Besuch, wie um uns zu bitten, durchzuhalten und nicht zu vergessen, dass nach der tiefen Finsternis, die auf uns wartet, ein neuer Frühling kommen wird. Um uns herum sitzt eine Mischung aus frischgebackenen Eltern, die Latte trinken, während ihre Kinder in ihren Bugaboo Wagen sitzen, und aus Frauen um die Sechzig, die irgendeine kulturelle Veranstaltung auf Waldemarsudde oder bei Liljevalchs besucht haben. Alles genau wie immer. Und doch ist alles anders. Ich merke, dass ich Angst davor habe, zu fragen, wie es aussieht. Wie es war.
»Willst du erzählen?«
Für einen kurzen Augenblick begegnen sich unsere Blicke, halten einander fest, ehe sie wieder in verschiedene Richtungen auseinanderhuschen. Aina holt tief Luft und blinzelt.
»Du meinst den Krebs. Ich bin jetzt gesund. Das hat man mir jedenfalls gesagt.«
Sie dreht plötzlich den Kopf und schaut mir direkt ins Gesicht.
»Es war viel schlimmer, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Viel schlimmer, aber zugleich absolut nicht so, wie man denkt. Wie ich es mir vorgestellt hatte. Hast du dir je überlegt, wie es wäre, lebensgefährlich krank zu sein?«
Ich überlege. Lasse die Frage einsinken. Natürlich habe ich mir das schon vorgestellt. Mich gefragt, was aus Erik und Markus werden sollte, wenn ich nicht mehr da wäre. Ob Erik sich an mich erinnern würde. Mich vermissen. Als Stefan, mein erster Mann, gestorben war, habe ich mich nach dem Tod gesehnt. Ich dachte daran wie an einen Befreier, der mich retten würde, damit ich nicht weiter in einem Dasein existieren müsste, das nur aus Leere und Schmerz bestand. Ich nicke Aina bestätigend zu. Ich habe mir Krankheit und Tod vorgestellt.
»Ich auch. Vorher habe ich das getan. Und ich hatte eine ganz deutliche Vorstellung davon, wie ich sein würde, wenn ich krank wäre. Dass ich stark und mutig sein, dass ich um mein Leben kämpfen würde. Dass ich die Krankheit mit purer Willenskraft besiegen würde. Doch als es dann so weit war, war alles anders, ich war anders. Ich war klein und ängstlich und feige. Und mir ging auf, dass man Krebs nicht besiegen kann, indem man Fischölkapseln schluckt oder zum Yoga geht. Man kann nur still alles aushalten, was geschieht, und die Gefühle auf sich zukommen lassen. Sie da sein lassen. Sie erforschen. Sie ertragen.«
Sie fährt sich noch einmal mit der Hand durch die Haare, wickelt eine Strähne um einen Finger, wie sie das immer schon getan hat.
»Zellgifte. Du hast keine Ahnung, was die mit uns anstellen. Ich wusste, dass es schwer sein würde, aber wie schwer … Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen …«
Plötzlich verstummt sie und richtet den Blick auf mich.
»Entschuldige. Ich plappere einfach drauflos. Ich wollte mich nicht mit dir treffen, um zu jammern, wirklich nicht. Aber ich will, dass du weißt, wie es war. Und warum es so gekommen ist, wie es eben gekommen ist, mit Stefan.«
Ein Windstoß packt meine Serviette, und sie fliegt über den Kiesweg und landet dann unter einem blattlosen Busch. Ich weiß, dass ich hinterherlaufen und sie aufheben müsste, aber ich bleibe sitzen. Ich habe so lange darauf gewartet, mit Aina sprechen zu können, aber zugleich bin ich ihr ausgewichen. Ich wollte reden und wollte es auch wieder nicht. Meine beste Freundin und mein verstorbener Mann hatten vor langer Zeit einmal hinter meinem Rücken ein Verhältnis. Als ich das erfuhr, war Stefan bereits tot, und ich konnte nur noch Aina bestrafen. Wir haben uns seit mehreren Jahren nicht gesehen, obwohl Aina sich bei mir gemeldet hat, als sie krank wurde. Ich löschte ihre Mails und leerte den Papierkorb, ehe ich es mir anders überlegen konnte. Dann passierte etwas, das mich dazu brachte, meine Meinung zu ändern.
»Und warum ist es so gekommen?«
Meine Stimme ist ausdruckslos. Ich denke daran, was geschehen ist. An einen Zorn, der so stark war, dass ich gern geschlagen, verletzt hätte. Ein Gefühl, von dem ich nicht gewusst hatte, dass es existierte, ehe ich von Ainas Verrat erfuhr. Aber jetzt gibt es nur noch Leere. Alles Böse, das ich Aina gewünscht habe, hat sie bereits getroffen, aber ich finde darin keine Befriedigung. Stattdessen tut sich in mir ein Abgrund an Sehnsucht auf, der unbedingt gefüllt werden will.
Ich blinzele und spüre die Sonnenwärme im Gesicht, höre das erregte Gespräch am Nachbartisch, über fehlende Vorschulplätze in Hägersten, und ich denke, es muss schön sein, sich über etwas so Klares und Abgegrenztes empören zu können, ein Thema, bei dem es so selbstverständlich wirkt, was richtig ist und was falsch.
»Es ist so gekommen, weil sehr viel passiert ist. Sehr viele unglückliche Umstände. Ich will mich nicht rausreden, Siri, was geschehen ist, war falsch, aber es ist möglich, zu verstehen, wodurch etwas ausgelöst wird.«
Ich nicke, zeige, dass ich zuhöre. Mein Herz hämmert und mir ist schlecht, aber ich bleibe sitzen. Ich weiß, dass ich zuhören muss, wenn es für Aina und mich eine Zukunft geben soll.
»Nachdem du … das Kind verloren hattest, warst du fast nicht ansprechbar.«
Aina sieht aus, als wollte sie um Entschuldigung bitten, als sie das sagt, als wollte sie deutlich machen, dass sie mir keinerlei Verantwortung für das Geschehene zuschreibt. Ich denke an das Kind, das Eriks Schwester oder Bruder war. An das Kind, das so schwer behindert war, dass es nicht leben konnte.
»Das ist so schwer mit dir, Siri, wenn es dir nicht gut geht. Du ziehst dich dann zurück und lässt dir von niemandem helfen. Und da fing Stefan an, stattdessen mit mir zu reden. Es war seltsam, ich wurde zu seiner Vertrauten. Er hat immer über dich gesprochen. Wie sehr er dich liebte. Wie schrecklich du ihm fehltest. Aber dennoch konnte er dich nicht erreichen. Er fühlte sich abgewiesen.«
»Stefan war also einsam und unglücklich, weil ich nicht da war. Schön. Aber welchen Grund hattest du?«
Ich höre, dass ich noch immer gleichgültig klinge.
»Keinen Grund, der mein Verhalten entschuldigt.« Sie schüttelt den Kopf, und die schlaffen Locken bewegen sich im Wind.
»Ich glaube, es war die Nähe. Wir kamen uns zu nahe. Trafen uns zu oft. Wir haben Intimität mit etwas anderem verwechselt, mit Begehren.«
Ich sehe Jimmy vor mir. Den Polizisten, mit dem ich zusammenarbeite. Ich denke daran, wie wir ungeplant in einer warmen Sommernacht bei ihm zu Hause gelandet sind. Das seltsame Gefühl, einem anderen als Markus so nah zu sein. Mein eigener Verrat. Ich weiß jetzt, wie leicht das passieren kann.
»Hast du ihn geliebt?«
Aina erwidert meinen Blick und schüttelt den Kopf.
»Ich hatte Stefan sehr gern. Aber nie auf diese Weise. Es war klar, dass es eine zufällige Affäre war. Mehr nicht.«
»Und Stefan? Hat er dich geliebt?«
Das ist die Frage, vor der ich mich am meisten gefürchtet habe. Wollte er mich verlassen?
»Es gab nur dich. Manchmal glaube ich, er hat sich nur mit mir getroffen, um Distanz zu dir zu bekommen. Das hat seine Selbstverachtung gesteigert und es ihm erleichtert, das zu tun, was er dann getan hat. Es hat seinen Entschluss gerechtfertigt, sich das Leben zu nehmen.«
Ich will Aina verstehen, aber zugleich ist es unbegreiflich. Es ist wie ein Rätsel, für das es keine Lösung gibt. Jede neue Erkenntnis gebiert neue Fragen.
»Aber du hattest doch immer eine Menge Männer, hättest jeden haben können. Warum Stefan? Warum meinen Mann?« Ich merke, wie mir Tränen in die Augen treten, und ich weiß nicht, was mich mehr empört, dass mein Mann mit Aina fremdgegangen ist oder dass meine beste Freundin mich betrogen hat.
»Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht«, sagt Aina und wirkt plötzlich gequält. »Ich wünschte, ich könnte dir eine einfache Antwort geben. Sagen, dass ich ihn geliebt und dass ich gehofft habe, wir könnten zusammen sein, er und ich, auf Dauer. Aber so war es nicht. Ich war nicht in Stefan verliebt, und das macht alles vielleicht noch schlimmer.«
Sie seufzt und bückt sich nach ihrer Tasche, sucht, und zieht eine Packung Zigaretten heraus. Sie nimmt eine, steckt sie an und macht einen langen Zug.
»Solltest du wirklich rauchen? Ich meine …«
Die Frage hängt zwischen uns in der Luft, und Aina fängt plötzlich an zu lachen.
»Nö. Sollte ich wohl nicht. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, dass es auch egal sein kann. Allerdings nur ab und zu.«
Sie hält mir die Packung hin, und ich nehme mir zögernd eine Zigarette, die sie für mich anzündet. Es ist ein seltsames Gefühl, wir haben es früher Hunderte Male so gemacht, und jetzt machen wir es wieder. Unsere Bewegungen haben etwas Feierliches. Wie ein Eingeständnis, dass sich jetzt etwas verändert.
»Ich finde jedenfalls, du solltest nicht rauchen. Ich möchte dich gern behalten.«
Wir wissen beide, dass wir nicht über ihre Gesundheit reden. Ich will Aina in meinem Leben behalten, will ihre Freundin sein. Sie hat mir so gefehlt.
Aina wird still. Ihr Blick begegnet meinem, und ich ahne Erstaunen in ihrem Gesicht. Diese unverhohlene Verletzlichkeit. Eine einzelne Träne läuft über ihre Wange. Dann wendet sie sich von mir ab, zieht wieder an ihrer Zigarette.
»Verdammt, Siri. Es tut mir so furchtbar leid. Es gibt nicht viel in meinem Leben, was ich bereue, aber ich würde alles tun, um das ungeschehen zu machen. Wenn man glaubt, dass man sterben muss, begreift man, was im Leben wichtig ist. Ich weiß, das klingt wie ein Klischee, aber mir ist es so gegangen. Ich habe an dich gedacht. An meine Mutter, mit der ich seit zwanzig Jahren kaum noch geredet hatte. Ich dachte an alle Sommer, daran, wie oft wir bei deinem Haus auf den Felsen gelegen und uns gesonnt haben. Das alles würde ich verlieren. Aber jetzt werde ich vielleicht leben, und ich will nicht, dass das hier zwischen uns steht. Ich will dich nicht verlieren.«
Sie sieht verzweifelt aus, und ich strecke langsam die Hand aus, berühre ihren Arm.
»Ist schon gut. Oder … nicht gut, aber ich kann damit leben.«
Ich schließe die Augen. Lausche Kinderlärm und Möwengeschrei. Die Eltern mit den kleinen Kindern haben den Nebentisch verlassen, und nun sitzen dort zwei ältere Frauen. Die eine hat eine Tüte mit dem Emblem von Liljevalchs. Ich höre, wie sie über eine gewisse Ulla tuscheln, die offenbar die Intelligenz nicht gerade mit Löffeln gefressen hat. Sie kichern wie zwei junge Mädchen, und ich frage mich, ob Aina und ich irgendwann in einer fernen Zukunft hier sitzen werden, vielleicht eine einzelne Zigarette rauchen, ein Rotweinglas in der Hand halten. Ich will nicht mehr auf dem herumreiten, was geschehen ist, ich will frei sein.
»Hast du gehört, dass Sven wieder arbeiten will? Er hat offenbar Sehnsucht nach uns.«
Aina grinst, und trotz des mageren Gesichtes und der dünnen Haare ist sie plötzlich die Alte.
»Im Ernst? Hast du mit ihm gesprochen?«
Ich staune. Aina, Sven und ich hatten einmal eine gemeinsame psychotherapeutische Praxis. Aina und ich waren die Jungen, die Unerfahrenen, und Sven der Senior, der seit fast dreißig Jahren als Psychotherapeut gearbeitet hatte. Das war eine Dynamik, die funktionierte. Sven fühlte sich wohl in seiner Expertenrolle, und wir hatten alle Hände voll damit zu tun, uns im Beruf zu etablieren. Wenn ich daran zurückdenke, kommt die Praxis mir vor wie ein Traum. Fast in Reichweite und doch so weit weg.
»Ich habe regelmäßig mit ihm gesprochen. Während der Chemo hat er mich immer wieder besucht. Hat meine Hand gehalten und mir versprochen, dass alles gut wird. Seine Mutter ist wohl an Brustkrebs gestorben.«
»Es fällt mir schwer, ihn mir sanft und tröstend vorzustellen. Er war immer so sachlich, niemals gefühlsbetont.«
Ich schüttele den Kopf und Aina lächelt.
»Es hat doch einen Grund gegeben, warum die Klienten ihn geliebt haben. Aber sicher. Ich war auch überrascht. Vielleicht hat das Leben als Vater kleiner Kinder ihn weich gemacht.«
»Und wie geht es ihm mit Windelwechseln und Fläschchengeben? Er ist ja nicht gerade ein Papatyp«, sage ich.
»Er ist phantastisch. Er ist noch immer mit Sanna verheiratet, und Hjalmar ist jetzt drei.«
Ich sehe Sanna vor mir. Fast dreißig Jahre jünger als Sven, stark und selbstständig und absolut integer. Nicht so viel anders als seine Exgattin, Birgitta. Wenn man vom Altersunterschied absieht.
»Aber warum will er wieder arbeiten? Er scheint doch seinen Traum zu leben.«
»Mit seinem Buch kommt er wohl nicht so richtig weiter. Und vielleicht fehlt ihm die intellektuelle Herausforderung. Dreijährige sind zwar wunderbar, aber vielleicht nicht so … tiefsinnig.«
Wir lachen gemeinsam. Behutsam und unsicher.
»Und was hat er vor? Wieder als Psychotherapeut zu arbeiten?«, frage ich.
»Er will eine neue Praxis aufmachen, mit dir und mir.«
Ich erstarre. Nichts hätte mich mehr überraschen können. Eine neue Praxis. Ich denke an meine Arbeit als Profilerin bei der Täterprofilgruppe der Polizei. Sie ist spannend und herausfordernd, aber auch abstoßend und schwer. Ich hatte früher nie an das Böse als Konzept geglaubt. Immer gedacht, dass es für alles eine rationale Erklärung gibt, dass man begreifen kann, warum Menschen tun, was sie eben tun. Das habe ich in meinem Beruf als Psychologin gelernt: das Unbegreifliche begreiflich machen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Bei manchen Menschen gibt es etwas, das offenbar nur leer und abgrundtief ist, das sich nicht erklären oder verstehen lässt. Und diese Leere macht mir Angst. Ich will sie nicht betreten, denn ich habe das Gefühl, dass sie mich vernichten könnte. Svens Vorschlag kommt mir plötzlich vor wie ein Rettungsring. Etwas, das mich vor dem retten kann, was vielleicht das Böse ist. Zugleich zweifele ich, denn ich weiß nicht, ob sich die Zeit zurückdrehen lässt.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das kommt so plötzlich.«
»Ich weiß. Und es hat sich ja vieles geändert, seit wir zuletzt zusammengearbeitet haben. Ich habe ihm gesagt, dass es nicht infrage kommt, dass die Lage anders ist, aber er will trotzdem, dass ich mit dir rede, Siri. Aber, äh …. Scheiß drauf. Soll er sich lieber wieder an sein Buch setzen.«
Ich sehe ihr an, dass sie mit meinem Zögern gerechnet hat und dass es sie nicht verletzt.
»Wir könnten uns vielleicht mit ihm treffen. Nur um zu reden.«
Ich bin von meinen eigenen Worten fast überrascht. Will ich das wirklich? Aber Reden ist ja noch keine Verpflichtung.
»Könntest du dir das vorstellen?« Aina runzelt die Stirn, als ob sie versucht, meinen Worten einen Sinn zu entlocken – ihr Gesicht erinnert mich an jemanden, der versucht, ein ganz besonders vertracktes Möbelstück von Ikea zusammenzubauen.
»Ja. Ein unverbindliches Treffen. Nennt man das nicht so?«
»Ich rede mit ihm. So schnell wie möglich. Ehe du es dir anders überlegst.«
Wir lachen wieder. Diesmal ein wenig natürlicher. Mit mehr Überzeugung und weniger Angst.
Älvsjö, im Süden von Stockholm
Olga erinnert sich an sie alle.
Die Gesichter tauchen vor ihrem inneren Auge auf:
Paul, der bei einem Unfall den Fuß verlor und darum kämpfte, wieder Fußball spielen zu können. Der kleine Hamid, der sechs Monate in ihrem Bett schlief, eng, ganz eng an sie geschmiegt, bis er es wagte, allein im Zimmer zum Wald hin zu schlafen. Und dann Erkki, der so ungeschickt war, dass er fast ihr gesamtes Porzellan zerschlug. Später stellte sich heraus, dass er an einer motorischen Entwicklungsstörung litt, aber auch dieses Problem hatte sich im Laufe der Zeit offenbar gelöst.
Ja, weckt mich mitten in der Nacht, und ich kann alle Namen laut aufsagen, sie alle vor mir sehen, ihre Gesichter und ihre kleinen Körper herbeirufen, denkt sie. Ich kann mich an ihre Stimmen erinnern und den Geruch schmutziger Kinderhaut wahrnehmen, das Gefühl, wenn der Kamm verfilzte Haarsträhnen auskämmt, und den lauten Protest, wenn spitze Nägel geschnitten werden sollen.
Es erfüllt sie mit einer tiefen Zufriedenheit, dass sie für diese vielen Kinder wirklich etwas ändern konnte. Dass sie da war und ihnen ein Zuhause anbieten konnte, wenn ihr Leben zu Bruch gegangen war und niemand sonst half.
Helfen ist eine Pflicht, aber auch ein Privileg – ein Geschenk, für das wir dankbar sein sollten.
Wir haben ihnen allen geholfen, denkt sie. Da bin ich mir sicher.
Bis jetzt jedenfalls.
Denn bei Nova-Li ist das anders. Sie scheint aus einem ganz anderen Holz geschnitzt zu sein als die anderen Kinder. Aus einem härteren, stummeren Material, mit dem Olga sich nicht auskennt. Sie denkt immer, dass sie einfach nur Zeit braucht – die Zeit wird das Harte, Verschlossene aufweichen und das Mädchen auf irgendeine Weise empfänglich machen für die Liebe, die sie doch anbieten.
Aber vielleicht irrt sie sich. Vielleicht gibt es Kinder, die einfach zu viel Elend durchgemacht haben. Die sich dermaßen verschlossen haben, dass der Panzer undurchdringlich geworden ist.
Vielleicht ist Nova-Li so ein Kind.
Sten setzt sich an den Esstisch, lehnt die Krücke an die Wand und nimmt die Kaffeetasse, die Olga ihm hinhält. Vor dem Fenster ist der Spielplatz zu sehen. Im schwachen Licht der Dämmerung sieht alles grau aus. Sogar das Herbstlaub, das am Kantstein zusammengeweht worden ist, ähnelt grauen, zerrissenen Papierstreifen. Die Rutsche und die Schaukeln zeichnen sich vor der Straßenlaterne bei der Garage als schwarze Silhouetten ab.
Olga gießt Milch in ihre Kaffeetasse, rührt vorsichtig mit einem Löffel um und setzt sich Sten gegenüber.
»Ich habe meine Brille im Schlafzimmer vergessen«, beginnt sie.
»Soll ich sie holen?«
»Nein, Unsinn. Mit deinem Fuß? Aber ich sehe sie nicht.«
Sten schlürft seinen Kaffee und späht ins Zwielicht hinaus.
»Sie sitzt auf der Schaukel.«
»Immer noch?«
»Ja.«
Olga seufzt tief und rückt die Kette mit dem Kreuz gerade, die Kette hat sie zur Konfirmation bekommen und trägt sie noch immer jeden Tag, auch jetzt, fünfzig Jahre später. Nicht nur, weil sie damit Zeugnis für ihren Glauben ablegt, sondern auch, weil die Kette auf irgendeine Weise eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart darstellt. Zwischen ihrer Kindheit in einer Pastorenfamilie in Tierp im Norden von Uppsala – über die Zeit als Schwesternschülerin in Stockholm und die Arbeit im Sachsska-Kinderkrankenhaus – bis zu der Begegnung mit Sten an jenem Abend auf der Fähre nach Gotland und zu der Familie, die sie zusammen gegründet haben.
Das Kreuz ist ein Symbol für den Glauben und hat sie durch alle Lebenssituationen getragen. Das Kreuz ist Hoffnung und Trost, aber es hat sie auch – jedenfalls in jüngeren Jahren – ein wenig verängstigt. Denn Gott ist nicht nur gut, da ist sie sich ziemlich sicher. Gott kann dem Menschen in einem Augenblick alles nehmen, was er ihm vorher gegeben hat. Alles sorgsam Aufgebaute dem Erdboden gleichmachen.
Es gilt, nicht hochmütig zu werden. Niemals zu vergessen, für die Geschenke des Lebens dankbar zu sein.
»Was machen die anderen Kinder denn?«
»Die von Olssons klettern wie immer auf dem Baum herum«, sagt Sten und räuspert sich. »Ich muss mal mit ihnen darüber reden. Die Äste sind zu schwach, um darauf zu klettern. Eines Tages wird das ein böses Ende nehmen.«
Das Geräusch der Küchenuhr zerhackt die Stille und bohrt kleine, deutliche Löcher in die behutsame Ruhe der Küche.
»Weißt du«, sagt Olga. »Ich glaube, aus diesem Kind werde ich niemals schlau. Es spielt gar keine Rolle, was man tut, es ist irgendwie unmöglich, ihr … nahezukommen.«
Sten nickt und schlürft wieder seinen Kaffee.
»Sie ist unser zwanzigstes Pflegekind«, sagt er leise. »Man kann nicht …«
»Alle retten? Nein, das kann man vielleicht nicht. Aber keins von den anderen war so … in sich verschlossen, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Lass ihr ein bisschen Zeit.«
»Das geht jetzt schon seit vier Monaten so.«
Sten gibt keine Antwort, sondern beugt sich vor, wie um besser zu sehen.
»Jetzt geht sie zu den anderen Kindern.«
Olga nickt.
»Gestern habe ich wieder Essen in ihrem Zimmer gefunden.«
»Essen?«
»Ja, weißt du nicht mehr, dass ich dir vorige Woche davon erzählt habe? Sie versteckt Essen in ihrem Zimmer.«
»Was denn für Essen?« Sten sieht sie an. Sein freundliches, rundes Gesicht strahlt Verwirrung aus. Die weißen Wimpern flattern um seine blassen Augen und erinnern sie an Insektenflügel.
»Gekochte Kartoffeln. Sie hatte sie unter das Bett gelegt. Hat wohl gedacht, ich würde sie da nicht finden.«
Sten schüttelt den Kopf. »Kartoffeln? Arme Kleine. Sie hat sicher gedacht, sonst würde sie nichts zu essen bekommen.«
»Bei uns ist ja wohl noch jedes Kind satt geworden.«
»Es geht hier nicht um uns. Das musst du doch begreifen?«
Olga nickt und starrt in ihre Kaffeetasse, wo nur noch ein brauner Rest den Boden bedeckt.
»Spielt sie jetzt mit den Kindern von Olssons?«
Sten schaut aus dem Fenster. Einzelne Blätter tanzen im Wind, und schwerer Regen fällt.
»Nein. Ich glaube, sie ist hinter dem Klettergerüst. Warst du übrigens böse auf sie, als du das Essen gefunden hast?«
Olga seufzt.
»Nein. Natürlich war ich nicht böse. Ich war nur … überrascht, wie immer bei Nova-Li. Ich begreife dieses Kind nicht. Und sie macht es einem ja auch nicht leichter, wenn sie die ganze Zeit so verschlossen ist. Aber ich habe ihr erklärt, dass es hier bei uns immer genug zu essen geben wird, und dass sie nichts mit in ihr Zimmer zu nehmen braucht, das schon.«
»Und was hat sie da gesagt?«
»Nichts natürlich.«
Olga verstummt und schüttelt langsam den Kopf. Eine Geste, die Resignation ausdrückt, aber auch eine gewisse Unzufriedenheit.
»Sollen wir sie vielleicht hereinrufen?«, fügt sie dann hinzu. »Es regnet.«
»Das wäre vielleicht das Beste«, sagt Sten und fährt sich mit der Hand durch die schütteren weißen Haare.
Olga erhebt sich und stellt die Kaffeetasse ins Spülbecken, das dabei ein blechernes Geräusch macht. Sie geht hinaus in die Diele und zieht Gummistiefel und Regenjacke an, dann öffnet sie die Haustür und lässt alle Herbstgerüche nach fauligem Laub und feuchter Erde herein.
Der Wind fährt in die Jacke, und Olga zieht den Reißverschluss hoch und streift die Kapuze über. Die Stiefel schwappen im Schlamm, und sie reißt schwarze Wunden in die Erde, als sie den kurzen Weg zum Spielplatz geht.
Auch in diesem Jahr haben sie den Rasen nicht in Ordnung bringen können – er sieht aus wie ein frischgepflügter Acker, mit einzelnen vertrockneten Unkrautbüscheln hier und da. Vielleicht wäre es besser, aufzugeben und die kleine rechteckige Fläche vor dem Reihenhaus mit Platten zu belegen, aber sie findet die Vorstellung, Erde mit Stein zu bedecken, entsetzlich – die Wachstumskraft der Erde einzusperren und das Grüne durch Zementscheiben zu ersetzen.
Die Kinder von Olssons sitzen gefährlich weit draußen auf den schwachen Ästen des Baumes, genau wie Sten gesagt hat. Sie hebt die Hand und geht weiter zum Klettergerüst. Der Sand macht die Schritte schwer. Sie verspürt einen Stich der Irritation, weil Nova-Li nicht begreift, dass sie ins Haus gehen muss, wenn es dunkel wird und anfängt zu regnen.
Olga biegt um die kleine Holzkonstruktion, die oben mit einem Netz aus orangen Stricken bedeckt ist, so dass die Kinder dort liegen und zum Himmel hochblicken oder sich durch die Maschen winden können wie kleine Würmer.
Nova-Li ist nicht dort.
»Nova!«, ruft sie, aber Wind und Regen schlucken ihre Stimme.
Sie geht zurück zu dem Baum und wendet sich an die drei Jungen, die oben auf dem Ast hocken.
»Habt ihr Nova gesehen?«
Oscar, der Älteste, der immer so gemein zu Perssons Katze ist, schüttelt langsam den Kopf.
»Nö. Ist sie nicht im Haus?«
»Wie meinst du das? Ist sie von hier weggegangen?«
»Keine Ahnung.«
Oscar schaut seine jüngeren Brüder an, die in einer einzigen synchronen Bewegung den Kopf schütteln.
»Aber habt ihr nicht gesehen, wohin sie gegangen ist? Sie kann doch nicht einfach verschwunden sein …«
»Wir haben hier gesessen …«
»Ich weiß schon, dass ihr die ganze Zeit auf dem Baum gesessen habt. Aber ihr müsst doch gesehen haben, wohin sie gegangen ist.«
Die Jungen geben keine Antwort, und Oscar sieht sich um.
»Vielleicht ist sie zum Parkplatz«, schlägt er vor.
»Zum Parkplatz. Was kann sie denn da gewollt haben?«
Oscar zuckt mit den Schultern.
»Da geht sie manchmal hin.«
Olga dreht sich um und läuft zum Parkplatz. Es ist noch dunkler geworden, und sie kann Steine und Senken auf dem Weg kaum erkennen. Der Regen stiehlt sich unter ihren Kragen und läuft am Hals entlang in den Pullover.
Eine Sekunde lang spürt sie, wie Zorn in ihr auflodert. Keine Unruhe, sondern Zorn. Sie ist böse auf Nova-Li. Böse, weil das Mädchen niemals dankbar ist, ihr nie in die Augen schaut, weil es unmöglich ist, mit ihr zu reden oder sich auf sie zu verlassen.
Böse, weil sie das zwanzigste Kind ist.
Das Kind, das sie nicht retten können.
Zweige knacken, als sie durch das Wäldchen eilt. Feuchte Blätter schlagen ihr ins Gesicht. Sie stolpert über einen Stein, aber in letzter Sekunde kann sie noch einen Baumstamm packen und den Sturz vermeiden. Ihr Handgelenk tut weh, und sie bleibt stehen und massiert sich die Hand. Zupft sich die scharfen kleinen Rindenstücke von der Haut. Irgendwo hört sie, dass ein Auto den Motor anlässt und losfährt.
Wo zum Kuckuck treibt sie sich herum? Ein Kind kann doch nicht einfach so verschwinden, von einer Sekunde auf die andere? Denn sie haben sie doch fast die ganze Zeit gesehen. Haben von der Küche aus ihre Bewegungen im Auge behalten.
In dem Moment, in dem Olga den Parkplatz erreicht, sieht sie den ersten Blitz. Der blanke schwarze Asphalt spiegelt den grellen Lichtschein. Schickt kleine spitze Lichtpfeile los, die sie blenden.
Als sich ihre Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt haben, hält sie auf dem kleinen Parkplatz Ausschau. Der ist leer. Sie sieht nur den alten Lada von Familie Persson, dem die Hinterreifen fehlen und der mit einigen alten Ziegelsteinen gestützt wird.
Nova-Li ist verschwunden.
Polizeigebäude, Kungsholmen, Stockholmer Innenstadt
Jimmy ist der Erste, den ich sehe, als ich den Besprechungsraum betrete. Er sitzt zurückgelehnt in einem der schlichten Sessel aus Birkenholz, die Hände im Nacken verschränkt. Seine ganze Gestalt hat etwas Lässiges – der glattrasierte Schädel, die Tätowierung, die sich seinen Hals hochschlängelt, die entspannte Haltung – etwas, das auszudrücken scheint, dass ihm die Regeln und Konventionen, die im Polizeigebäude herrschen, ziemlich egal sind.
Aber vielleicht irre ich mich. Vielleicht bin ich nur beeinflusst von allem, was ich schon über ihn weiß. Und wenn ich ehrlich sein soll, ist das eigentlich zu viel. Ich weiß, wie er denkt und argumentiert, wie seine Stimme klingt, wenn er aufgeregt oder irritiert ist. Wie der Rest der Tätowierung aussieht und wie er liegt, wenn er schläft: auf dem Bauch, die Hände unter dem Kissen. Und ich weiß, wie sich sein Gesichtsausdruck verändert, wenn er mich langsam auszieht, und wie sich seine Hände auf meiner Haut anfühlen.
Kurz gesagt, alles, was man über einen Kollegen nicht wissen dürfte. Vor allem nicht, wenn man schon einen Lebensgefährten und ein kleines Kind hat. Außerdem weiß ich, wie weh Untreue tut.
Ich rede mir ein, dass das, was zwischen uns passiert ist, ein Versehen war. Es wird niemals wieder vorkommen. Und es lässt sich wirklich nicht damit vergleichen, was Stefan mir angetan hat, als er die Affäre mit Aina hatte.
Aber trotzdem.
»Siri«, sagt Jimmy und macht ein überraschtes Gesicht.
Er steht auf, kommt mit zwei kurzen Schritten auf mich zu und umarmt mich heftig. Ich erwidere die Umarmung vorsichtig und atme seinen Duft ein.
»Hallo«, sage ich und trete einen ungeschickten Schritt zurück.
»Alles in Ordnung?«
»Klar doch. Und bei dir?«
Er fährt sich mit der Hand über den Schädel, so wie er das immer macht, wie um sich davon zu überzeugen, dass er beim Rasieren keinen Fleck ausgelassen hat.
»Alles bestens. Wie war es denn bei dir?«
Ich hatte zwei Wochen frei und habe meine Schwester in Schonen besucht. Das habe ich jedenfalls gesagt. Die Reise nach Schonen hat nur vier Tage gedauert. In der restlichen Zeit habe ich vor allem zu Hause im Wohnzimmer vor mich hin gebrütet.
»Sehr gut. Erik hat Radfahren gelernt.«
Ich weiß nicht so genau warum, aber aus irgendeinem Grund kommt es mir wichtig vor, Erik zu erwähnen. Sozusagen zu betonen, dass ich eine Familie habe, ein Kind. Und vor allem nicht zu verraten, dass Markus und ich uns die ganze Zeit gestritten haben.
Er nickt und lächelt. Sein Blick ist unergründlich.
In diesem Moment höre ich vom Gang her Stimmen, und gleich darauf kommt Carin hereingefahren. Ein Knall ist zu hören, als der Rollstuhl in der Tür stecken bleibt. Carin flucht leise.
»Verdammt.«
Örjans Gesicht taucht hinter ihr auf. Seine Haare sind weniger geworden, seit ich ihn zuletzt gesehen habe, aber die Pilotenbrille mit dem schmalen Goldgestell, die mich an irgendeinen Fernsehkrimi aus den Siebzigerjahren erinnert, ist noch dieselbe.
»Soll ich dir helfen?«, fragt Örjan und sieht Carin an.
Ich ahne rote Flecken an Carins Hals, und ihre Stimme klingt verbissen, als sie antwortet.
»Absolut nicht. Ich muss nur schnell …«
Sie fährt ein kleines Stück zurück, wendet und kommt dann hereingefahren.
»Siri«, sagt sie, und ihr Gesicht öffnet sich bei meinem Anblick zu einem strahlenden Lächeln. »Wie schön, dich wiederzusehen.«
Ich bücke mich und umarme sie. Ich habe Carin zuletzt gesehen, als ich sie im Krankenhaus besuchte und die Folgen ihrer Verletzung noch ungewiss waren. Alle hofften, dass sie die Herrschaft über ihre Beine zurückgewinnen würde, aber jetzt wissen wir, dass sie den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen wird. Ich frage mich, wie ihr zumute ist, wie sie alles schaffen will – das mit der Arbeit wird sicher gut gehen, wir sitzen ja doch meistens am Schreibtisch, aber sie ist Single und hat eine Tochter mit Down-Syndrom. Wie bewältigt sie das eigentlich?
»Wie geht denn alles?«, frage ich und nicke zum Rollstuhl hinüber.
»Naja. Geht schon. Wenn ich erst gelernt habe, mit diesem verflixten Ding umzugehen, dann …«