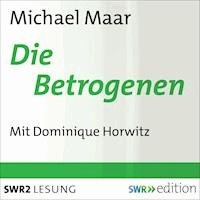14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
«Man liebt nicht weil, man liebt obwohl.» Nach seiner bewunderten Stilstudie «Die Schlange im Wolfspelz» legt Michael Maar eine schlanke und sehr private Sammlung von Notizen, Betrachtungen, Aphorismen, Anekdoten und kurzen Prosastücken vor über all das, was ihm im Lauf der Jahre buchenswert erschien. Maar handelt von Musik und Metaphysik, von prophetischen Träumen, vom in der Luft schwebenden Glas, von den blauen Häkchen bei WhatsApp und wie sie Proust gequält haben würden; von den Frauen bei Tschechow, vom Bahnhofs-Youporn unter Lenin, von Wolfgang Paulis tödlichem Problem mit der Zahl 137, von Joseph Roths Taschenuhr, von Stifters Unfruchtbarkeit, von Fichte, der bei Goethe lässig seinen Mantel abwirft, von Doctorows «Ragtime» als Kleist-Thriller, von den Rätseln der Kosmologie; von der süßen Angewohnheit zu leben, zu lesen, zu lieben, zu altern und nachzudenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 104
Ähnliche
Michael Maar
Fliegenpapier
Vermischte Notizen
Über dieses Buch
«Man liebt nicht weil, man liebt obwohl.» Nach seiner vielgerühmten Stilstudie Die Schlange im Wolfspelz legt Michael Maar eine schlanke und sehr private Sammlung von Notizen, Betrachtungen, Anekdoten und Kurzessays vor über all das, was ihm im Lauf der Jahre buchenswert erschien. Maar handelt von Musik und Metaphysik, von prophetischen Träumen und Quantenspuk, von den blauen Häkchen bei WhatsApp und wie sie Proust gequält haben würden; von Tschechows Einfluß auf Kafka, vom Bahnhofs-YouPorn unter Lenin, von Wolfgang Paulis tödlichem Problem mit der Zahl 137, von Stifters Unfruchtbarkeit, von Doctorows Ragtime als Kleist-Thriller, von den Rätseln der Kosmologie, von Fragen an die Dichter im Totenreich; von der süßen Angewohnheit zu leben, zu lesen, zu lieben, zu altern und zu sinnieren.
Vita
Michael Maar, geboren 1960, ist Germanist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Bekannt wurde er durch «Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem Zauberberg» (1995), für das er den Johann-Heinrich-Merck-Preis erhielt. 2002 wurde er in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen, 2008 in die Bayerische Akademie der Schönen Künste, 2010 bekam er den Heinrich-Mann-Preis verliehen, 2021 den Werner Bergengruen-Preis. Zuletzt sind von ihm erschienen: «Heute bedeckt und kühl. Große Tagebücher von Samuel Pepys bis Virginia Woolf» (2013) und «Tamburinis Buckel. Meister von heute» (2014). 2020 erschien sein Bestseller «Die Schlange im Wolfspelz». Er hat zwei Kinder und lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Adolph Menzel, Kupferstichkabinett, SMB/Wolfram Büttner/bpk
Fliegenpiktogramm Daniel Sauthoff
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01287-5
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Inhaltsübersicht
Für Antonia und ...
Vorwort
Vermischte Notizen
Quote zu «Die Schlange im Wolfspelz»
Für Antonia und Bruno
Vorwort
Bettina von Arnim machte es sich ein bißchen leicht. Ihrem Briefwechsel mit einem Kinde, der Korrespondenz mit Goethe, schickte sie die treuherzige Mahnung voraus: «Dies Buch ist für die Guten und nicht für die Bösen.»
Wir wollen die Leserschaft nicht so rigide in zwei Gruppen aufspalten. Auch schon die Widmung «Für meine Freunde» wäre anmaßend.
Ein Wort zur Genese dieser Sammlung scheint dennoch nicht überflüssig. Auch wenn man kein Tagebuch führt, wird man über die Jahre hinweg Gedankensplitter festhalten; Leseeindrücke, Alltagsbeobachtungen, Skizzen oder Gefühlsstimmungen notieren, gerade wenn man an einem anderen Hauptgeschäft sitzt. Warum sollte man dieses Halb-Private, Fragmentarische, dieses Streuobst auf der öffentlichen Wiese ausbreiten, ohne Kenntnis der Güte oder Bosheit des Publikums? Jeder Autor orientiert sich an Vorbildern, ohne daß er mit ihnen wetteifern wollte. Henning Ritters Notizhefte, Peter Sloterdijks Zeilen und Tage und Botho Strauß’ Der Fortführer waren drei solcher Vorbilder – hiermit der Dank für die selbstermächtigte Fortführung.
Das Folgende hat außer einer losen chronologischen keine andere Ordnung als die der Petersburger Hängung. Möge der Blick der geneigten Leser sich hier oder dort fixieren.
Vermischte Notizen
Zu einer Theorie des Erzählens. Jeder weiß: Je länger man voneinander getrennt war, desto weniger hat man sich beim Wiedersehen zu erzählen. Nach zwei Tagen Trennung sind die Details noch frisch. Nach zwei Wochen wird summarisch zusammengefaßt, und die Details verblassen. Nach mehreren Jahren Trennung, z.B. durch Kriegsgefangenschaft der Männer, wird überhaupt nichts mehr erzählt. Der Mahlstrom der Zeit hat die Details weggespült.
Zu erzählen wäre so, als hätte man sich vor zwei Tagen getrennt und sähe sich jetzt wieder. Vieles ist bekannt, nichts muß zusammengefaßt werden. Das Neue ist das Kleine, Farbige des Alltags. Und mehr gibt es im Leben nicht, von den seltenen Großereignissen abgesehen; und selbst bei denen ist der nachmittägliche Besuch der Schwimmschule bekanntlich wichtiger.
Im Tagesspiegel eine Rezension über ein Buch Paul Austers mit einem eindrücklichen Detail. Jemand rotzt einen Schleimbrocken auf des Helden Schulter, eine fette glibberige, nun ja, Auster. Morgentraum: Ein bis dahin sympathischer, mir unbekannter älterer Mann spuckt plötzlich einen großen Schleimpfropfen in ein vor ihm stehendes Glas. – Tagesrest? Der Traum war einen Tag vor dem Artikel. Ein Fall für den englischen Traumerklärer und zeitweisen Einstein-Konkurrenten John W. Dunne?
Man denkt, wenigstens bei der Wahl seiner Kleidung sei man einigermaßen individuell. Weit gefehlt: Die gewiefte Astrologin erkennt am Tragen der Weste das Typische des Sternzeichens Krebs; die Weste bräuchten sie als Panzer, um sich sicher zu fühlen. Beweis: Trägt Otto Schily nicht immer Dreiteiler mit Weste? Von Angela Merkels Kostümen ganz zu schweigen.
Großes Familiengrab, in dem bislang die Mutter und jetzt auch der Vater ruhen. Nach dessen Beerdigung bemerkt jemand zum darüber lachenden Sohn: «Da ist noch Luft nach unten!»
Hätte Gotthold Ephraim Lessing das gewußt! Marlene Dietrich gewinnt in der Nachbetrachtung stark bei der Schilderung ihres Rencontres mit John F. Kennedy. Sie war um 18 Uhr im Weißen Haus bei JFK eingeladen, um 19 Uhr erwarteten sie die Jewish War Veterans zu einem Ehrendinner, um sie für ihre Hilfe für jüdische Flüchtlinge zu würdigen. Ein Presseattaché empfängt sie und schenkt ihr gekühlten deutschen Weißwein ein. Der Präsident erscheint um 18 Uhr 15, nippt am Glas und sagt, sie sei doch hoffentlich nicht in Eile? Doch, um 7 pm erwarteten sie zweitausend Juden, um ihr eine plaque zu geben. «That doesn’t give us much time, does it?» Marlene: «No, Jack, I guess it doesn’t». Darauf geleitet er sie über den Flur in den presidential bedroom. Und nun, während er sich schon auskleidet, erinnert sie sich an seine Rückenprobleme und seine Kriegsverletzung. Kennedy windet sich aus langen Bandagen um seine Hüfte. Marlene denkt: Sie will gerne mit dem Präsidenten schlafen, sure, aber «I’ll be goddammed if I’m going to be on top!» Was dann nicht passiert, sie schafft es auch noch auf ihr Ehrendinner; der Präsident führt sie, nur mit einem Handtuch bekleidet, zum Fahrstuhl, nachdem sie ihn geweckt hat. Zum Abschied erkundigt er sich, ob sie je etwas mit seinem Vater gehabt habe, was sie wahrheitsgemäß verneint. Aber ihre Schilderung davor zeigt die Klasse: John F. Kennedy, der Rückenpatient, vor dem Akt: «He looked like Laocoön and that snake, you know?» Eine Dame mit Stil. (Nach dem New Yorker, August 2000.)
Ebent! Ein Süddeutscher in der Hauptstadt stößt täglich auf sprachliche Rätsel und Bizarrerien. In der phonetischen Entwicklung muß Berlin eine Insellage eingenommen haben; das «i» jedenfalls hat einen Bogen um die Stadt gemacht. Hier ißt man am Tüsch und geht in die Kürche und trinkt «Mülsch». Wenn die eingespeicherte Stimme des Anrufbeantworters meldet: «Ihre Nachricht wurde gölöscht», weiß man: Siemens rekrutiert Sprecherinnen aus Berlin. Die Ü- und Ö-Drift ist deshalb rätselhaft, weil sie ins Niedliche spielt, das dem Berliner sonst fremd ist. Der Zugezogene bemerkt im Gegenteil rasch, daß er der heimischen Schlagfertigkeit nie gewachsen sein wird. Wer zur falschen Jahreszeit im Gemüseladen nach Austernpilzen fragt, wird vom Inhaber belehrt: Wo die denn wachsen sollten, etwa unter seiner Matratze? Zu dieser Berliner Geistesart will die kindliche Verüung nicht recht passen. Besser zu ihr paßt der Glaube, das Wort «eben» sei ein Stümmelwort und heiße korrekt «ebent». Das zusätzliche «t» harmoniert mit der Härte, mit der dem Berliner jedes «ch» zu «k» wird. «Ich» und «Icke». Es steht allerdings im Widerspruch zu der Spartendenz, mit der er das «Tschüß» zu «Tschü» verkürzt. Großzügig ist er dafür in der Grammatik. Er wird Stein und Bein schwören, daß man Kohlen im Keller zu liegen und Bücher im Regal zu stehen hat. Selbst wenn er Regierender Bürgermeister geworden ist, den falschen Infinitiv kann er nicht ablegen, und wer ihm das «zu» zuviel abspenstig machen wollte, würde sehen, daß mit dem Berliner nicht gut Kürschen essen ist.
Kommt eh nicht das Rumpelstilzchen? Ad «Eh». Für E. – Die geläufige Eindeutschung des Wiener oder österreichischen «Eh» ist «ohnehin». Das habe ich eh gewußt – das habe ich ohnehin gewußt. Auch ein «sowieso» paßt oft. Das hatte ich eh vor – das hatte ich sowieso vor. Wir kommen eh zu spät – wir kommen sowieso zu spät. Das wird sich eh ausgehen – das wird am Ende dann sowieso klappen.
Diese Eindeutschung erfaßt aber nur den geringsten Teil des österreichischen «Eh»-Spektrums.
Das Wiener «Eh» ist ein Chamäleon-Wort, ein Proteus-Wort, ein mit Polyjuice Potion getränktes Wunderwort. Es kann praktisch alles ausdrücken und bestimmen, und es gibt kein deutsches Pendant dafür. Der Übersetzer ist machtlos, da ist das Finnische leichter als das «Eh», das versatil ist wie der Wiener selbst, geschmeidig, gefällig und tückisch, doppelsinnig und sackgrob.
«Was hat er gleich studiert? Eh Psychologie.» Das bedeutet ungefähr: Wie man es sich hätte denken können, hat er Psychologie studiert. Aber das trifft es noch nicht ganz, genauer schwingt mit: wie ich es eigentlich wußte oder weiß oder hätte wissen müssen, oder: wie es auf der Hand liegt, oder: wie der Zeitgeist und der Charakter des Betreffenden es nahelegen. Ein deutsches «ohnehin» kann diesen Nuancenreichtum nicht annähernd so weit auffächern. Am ehesten noch ginge ein: Na klar Psychologie. Oder auch: Natürlich Psychologie!
Wer fegt den Tennisplatz? Eh der Zdenko. Wer schrieb die Mutzenbacher? Eh der Salten. Willst nicht den Sessel zum Tisch rücken? Eh.
Das «Eh» genügt als Antwortsatz. Kommt’s Ihr heut abend zum Anzengruber? Eh. Magst eine Melange? Eh. Denkst bitte an den Radetzkymarsch? Eh.
Das Wiener Kind (es war Klaus Nüchtern) fürchtet sich vor einem bestimmten Märchen. Vor der Fernsehsendung fragt es bang die Mutter: «Kommt eh nicht das Rumpelstilzchen?» (Es kam dann doch.)
Am deliziösesten, wienerisch abgefeimtesten und unterteuftesten ist das «Eh» immer zum Satzbeginn.
«Eh der Kaindl!» «Eh die Mona!» «Eh Bad Ischl». «Eh im Plachutta». Die Fragen dazu kann man sich denken: Wer leitet die Wiener Buchmesse? Wer schneidet den nächsten Haneke-Film? Was wäre ein schöner Urlaubsort? Wo findet man das beste Saftgulasch-Rezept? Nur die Antworten sind unübersetzbar.
Das «Eh» kann heißen: Die Sache versteht sich von selbst, wer sonst außer der Mona sollte einen Haneke schneiden? Es kann auch heißen: Du hast ja recht, wir stimmen ganz überein und passen meinungsweise zusammen wie Deckel und Topf; so wie Du’s sagst, hab ich’s eh gedacht, Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Es steckt in dem «Eh» oft aber auch ein: Du mußt mir gar nichts erzählen. Du kannst mir gar nichts erzählen, ich weiß es eh schon lange, hab es längst erwogen, ist mir alles bekannt – nichts Neues unter der Sonne.
Die virtuosen und unermüdlichen «Eh»-Sager sind dabei nicht unbedingt Besserwisser. Sie sind Besser-Ahner. Sie hatten sich’s eh gedacht.
Das «Eh» dichtet die Welt ab gegen unerwünschte Neuigkeiten. Genauer: Es versichert und beruhigt den «Eh»-Sager darüber, daß draußen keine Drachen sind, jedenfalls nicht allzu viele. Die würde man eh kennen. Der Wiener weiß eh Bescheid. Und dieses Bescheidwissen hilft. Es tröstet über die Unbilden der Welt. Es tröstet über ihre bekannten finsteren Einrichtungen. Es tröstet sogar über den Tod.
Auch der Wiener muß sterben?
Eh.
Wie konnte man, außer Unvorhergesehenes trat ein, nur unpünktlich sein? Und viel von dem angeblich Unvorhersehbaren war es nicht, es gab immer etwas, was verzögerte und dazwischenkam, das rechnete der Pünktliche nur davor ein. Wie oft nicht hatte er, weiß vor Zorn, die Minuten gezählt, die sie schon wieder auf sich warten ließ, und immer mit den unsolidesten Begründungen. So wie sie nie ihre Schlüssel fand, fuhr sie immer erst so spät zu einer Verabredung los, daß der Kosmos in perfekter Synchronisation auf noch die kleinste Störung verzichten mußte, damit sie überhaupt nur eine Chance hätte, pünktlich zu sein. Wenn sich dann aber der Schal oder der Lippenstift nicht fand oder auch nur eine Ampel zuviel auf Rot schaltete oder der Parkplatz nicht direkt am Zielort frei wurde, dann – ja dann ging die Welt auch nicht unter, wie die Formel lautete; die Welt, die sie so unvorhersehbar am pünktlichen Eintreffen gehindert hatte.
Es war ein Elefantenschädel auf den Zyklopeninseln vor Catania, der den von Odysseus ausgetricksten Riesen Polyphem ins Leben rief. In dem übergroßen Schädel des Skeletts klaffte auf der Stirn an einer Stelle ein großes Loch: der Auslaß für den Rüssel. Die Inselbewohner zählten zwei und zwei zusammen und zogen den einzig logischen Schluß. Der einäugige Riese war geboren.
Auch Goethe hatte einen Elefantenschädel in seiner Weimarer Stube, den er vor seiner Haushälterin versteckt hielt.
Allenfalls Karl Schlögel wüßte es noch, was auf den russischen Bahnhöfen dem revolutionären Volk zur Ergötzung und sittlichen Entrüstung dargeboten wurde. Der Doderer-Leser erfährt es aus dessen letztem, unvollendetem Roman Der Grenzwald