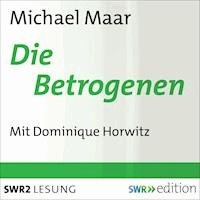9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Märchen erzählen von den Urdingen und Tabus, verstecken das Unaussprechliche in Geschichten. Dabei bewahren sie stets ihr Geheimnis – was sie unsterblich macht. Michael Maar geht diesen Geschichten auf den Grund: Wie in den «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm oft schon zu Beginn nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern auch die simpelsten Gesetze der Mathematik suspendiert werden; warum ihre demonstrative Grausamkeit nur vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges zu verstehen ist; dass «Rotkäppchen» von weiblicher Geschlechtsreife und «Hänsel und Gretel» auch von einem wichtigen Übergangsritus erzählt; warum Hans Christian Andersens «Die Kleine Meerjungfrau» nicht wie die Volksmärchen ein uraltes menschliches, sondern ein ganz privates Tabu verhandelt; und wo Scheherazades Erzählungen aus «Tausendundeiner Nacht» noch bei Marcel Proust nachklingen – all das erfahren wir in Maars Essay, der uns die vermeintlich vertrauten Erzählungen in ganz neuem Licht zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Ähnliche
Michael Maar
Hexengewisper
Über dieses Buch
Märchen erzählen von den Urdingen und Tabus, verstecken das Unaussprechliche in Geschichten. Dabei bewahren sie stets ihr Geheimnis – was sie unsterblich macht. Michael Maar geht diesen Geschichten auf den Grund: Wie in den «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm oft schon zu Beginn nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern auch die simpelsten Gesetze der Mathematik suspendiert werden; warum ihre demonstrative Grausamkeit nur vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges zu verstehen ist; dass «Rotkäppchen» von weiblicher Geschlechtsreife und «Hänsel und Gretel» auch von einem wichtigen Übergangsritus erzählt; warum Hans Christian Andersens «Die kleine Meerjungfrau» nicht wie die Volksmärchen ein uraltes menschliches, sondern ein ganz privates Tabu verhandelt; und wo Scheherazades Erzählungen aus «Tausendundeiner Nacht» noch bei Marcel Proust nachklingen – all das erfahren wir in Maars Essay, der uns die vermeintlich vertrauten Erzählungen in ganz neuem Licht zeigt.
Vita
Michael Maar, geboren 1960, ist Germanist, Schriftsteller und Literaturkritiker. Bekannt wurde er durch «Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem Zauberberg» (1995), für das er den Johann-Heinrich-Merck-Preis erhielt. 2002 wurde er in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen, 2008 in die Bayerische Akademie der Schönen Künste, 2010 bekam er den Heinrich-Mann-Preis verliehen. Zuletzt erschienen «Fliegenpapier. Vermischte Notizen» (2022) und «Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur», das lange auf der «Spiegel»-Bestsellerliste stand. Michael Maar hat zwei Kinder und lebt in Berlin.
Impressum
Neuausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Die Originalausgabe erschien 2012 im Berenberg Verlag, Berlin
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Affe, Kerze anzündender Knabe und Mann (Ausschnitt). Gemälde von El Greco, um 1577. Madrid, Museo del Prado (Erich Lessing/akg-images)
ISBN 978-3-644-01949-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Inhalt
I. Märchen als Meteoriten
Gilgamesch und Shrek
Von Indien nach Paris
Grimms Kinder- und Hausmärchen als Weltliteratur
Der fremde Blick
II. Dornröschens dumme Eltern
Falsche Briefe, ehrliche Diebe
Grausam naiv
Brauchen Kinder Bettelheim?
III. Rotkäppchen unterm Machandelbaum. Märchengrammatik
Fruchtbare Frösche
Die Schöne und das Tier
Zensierter Rapunzel
Märchen-Moleküle nach Propp
Der Höhlenmensch als Held der Quest
Der Machandelbaum und das petzende Horn
Schamanistische Priester
Böse Mütter, schwache Männer
IV. Hänsel und Gretel im Dreißigjährigen Krieg
Rotenburg
Der Hungerturm von Ugolino
Wer Hänsel in Wahrheit fressen will
Simplicissimus im Krieg
Der Räuberbräutigam
Kastanien im Feuer: Trauma und Tabu
V. Das Kunstmärchen als Trojanisches Pferd: Andersens Seejungfrau
Der verkaufte Schatten
Von Brentano zu Büchner
Feuerzeug und Zuckerferkel
Das neue Ferment: Ironie
Andersens Geheimnis
Die Schleier der Camouflage
Das rote Kreuzchen
VI. Scheherazade und Mädchen mit Flügeln. Ausblick vom Zauberberg
Der Weiber Lust
Perlen in der Gurke
Mädchen mit Flügeln
Die Schneekönigin im Schloß
Räuberweib mit Bart
Literatur (Auswahl)
Inhalt
I.
Märchen als Meteoriten
Seite 7
II.
Dornröschens dumme Eltern
Seite 17
III.
Rotkäppchen unterm Machandelbaum.
Märchengrammatik
Seite 27
IV.
Hänsel und Gretel im Dreißigjährigen Krieg
Seite 43
V.
Das Kunstmärchen als Trojanisches Pferd:
Andersens Seejungfrau
Seite 59
VI.
Scheherazade und Mädchen mit Flügeln.
Ausblick vom Zauberberg
Seite 75
Literatur
Seite 89
I. Märchen als Meteoriten
Einer der größten Romane des zwanzigsten Jahrhunderts birgt in seiner Mitte ein Geheimnis. Hans Castorp, Sanatoriumsbesucher in Davos, unternimmt einen Ausflug ins Gebirge und wird von einem Schneesturm überrascht. Dem Erfrierungstod nahe, hat er eine lange traumartige Vision. Diese Vision mündet in eine blutrünstige Szene, aus der er schaudernd hochschrickt, um glücklich seinen Weg zurück ins Sanatorium zu finden. Zwei graue Weiber sind es, die er in seinem Alptraum sieht, zwei Hexen, genauer gesagt, die in einem Tempel zwischen flackernden Feuerpfannen hantieren, und zwar aufs gräßlichste.
Über einem Becken zerrissen sie ein kleines Kind, zerrissen es in wilder Stille mit den Händen – Hans Castorp sah zartes blondes Haar mit Blut verschmiert – und verschlangen die Stücke, daß die spröden Knöchlein ihnen im Maule knackten und das Blut von ihren wüsten Lippen troff. Grausende Eiseskälte hielt Hans Castorp in Bann. Er wollte die Hände vor die Augen schlagen und konnte nicht. Er wollte fliehen und konnte nicht. Da hatten sie ihn schon gesehen bei ihrem greulichen Geschäft, sie schüttelten die blutigen Fäuste nach ihm und schimpften stimmlos, aber mit letzter Gemeinheit, unflätig, und zwar im Volksdialekt von Hans Castorps Heimat.
Träume rufen nach Entschlüsselung, jedenfalls wenn sie symbolträchtig in der Mitte großer Romane auftauchen. Mit der Entschlüsselung des berühmten Schneetraums im Zauberberg tut man sich bis heute schwer. Der Schauplatz ist ein griechischer Tempel. Es steht eine Doppelstatue von Mutter und Tochter davor, in denen man die Muttergöttin Demeter und ihre Tochter Persephone erkennen kann. Das ist der mythologische Hintergrund, man kann auch sagen: die mythologische Staffage. Hinter ihr, im Innern des Tempels, wird Hans Castorp Zeuge eines schaurigen Geschäfts: die Hexen zerreißen ein kleines Kind.
Ist das nun immer noch griechische Mythologie, oder speist sich die Szene eher aus der Erinnerung an etwas anderes, Simpleres? Oft ist es ja das Naheliegende, das man am leichtesten übersieht. Wir haben es mit einem Hans zu tun, der in die Nähe von menschenfressenden Hexen gerät. Was könnte wohl dafür das Vorbild sein? Thomas Mann erwähnt nicht von ungefähr die Knöchlein, die den Hexen im Maule knacken. Ein Knöchlein spielt auch eine wichtige Rolle in dem Urtext zu Castorps Traumszene, dessen Held in einem kleinen vergitterten Stall gefangengehalten wird.
Da ward nun alle Tage dem Hänsel das beste Essen gekocht, daß er fett werden sollte: Grethel aber bekam nichts als die Krebsschalen. Alle Tage kam die Alte und sagte: «Hänsel, streck deine Finger heraus, daß ich fühle ob du bald fett genug bist.» Hänsel streckte ihr aber immer statt des Fingers ein Knöchlein heraus: da verwunderte sie sich daß er so mager blieb, und gar nicht zunehmen wollte.
Wer hätte es gedacht: Thomas Mann ist sich nicht zu schade, ins Herz seines mit Mythologie schwer beladenen Romans ein kleines Märchenmotiv zu senken. Märchen haben etwas Robustes und Unverwüstliches an sich. Sie überleben jahrhundertelang, notfalls in den Wirtskörpern fremder Texte. Märchen sind uralt und bleiben dabei immer jung. Offenbar haben sie etwas, das sie unsterblich macht – ein Geheimnis, dessen Lösung noch niemandem gelungen ist. Was kein Grund sein soll, es nicht ein weiteres Mal zu versuchen.
Gilgamesch und Shrek
Wir alle kennen sie und haben sie noch aus Kinderzeiten im Ohr. Wir kennen die Geschichte von Hänsel und Gretel, die am Knusperhaus knabbern, die Geschichte vom Teufel mit den drei goldenen Haaren, der nicht geweckt werden darf, von Rapunzel, die ihren langen Zopf herabläßt, von Dornröschen, das sich an der Spindel sticht, von Rotkäppchen, das der Großmutter Wein und Kuchen bringt, vom Rumpelstilzchen, das frenetisch ums Feuer tanzt, seinen wahren Namen hört und sich vor Zorn mitten entzwei reißen muß. Wir kennen die Bremer Stadtmusikanten, die sieben Geißlein und den Froschkönig, wir kennen das Aschenputtel, das zur Ballnacht erblüht, wir kennen Schneewittchen, das in den vergifteten Apfel beißt, und den Hans im Glück, der seinen Goldklumpen erst gegen ein Pferd, dann eine Kuh, ein Schwein, eine Gans und einen Wetzstein eintauscht und sich schließlich freudig auch dieser letzten Last entlädt.
Wir alle kennen die Märchen, die wir als Kinder gehört haben. Das heißt nicht, daß wir sie alle präsent und abrufbereit hätten – im Gegenteil. Man kann Wetten damit gewinnen, wenn man im Freundeskreis fragt, wie eigentlich das Märchen Dornröschen beginnt. Kaum einer wird sich erinnern, daß die Handlung von einem verzauberten Frosch ausgelöst wird. Kaum einer hat die Handlungsverläufe der Märchen am Schnürchen, schon darum nicht, weil sie sich alle so ähnlich sind. Das gerade ist das Eigentümliche an den Märchen, die darin den Geschichten aus der Bibel gleichen: auch wenn man sie seit langem nicht mehr gelesen hat und Schwierigkeiten hätte beim korrekten Referat, sind sie latent wirksam und gegenwärtig. Sie schlummern jahrelang, aber können jederzeit geweckt werden.
Was Märchen eigentlich sind, weiß dabei keiner genau. Wie sind sie entstanden, und woher kommen sie? Die Herkunft der Märchen verliert sich im Frühnebel der Zeiten. Märchen-Motive finden sich schon im ältesten literarischen Dokument der Menschheit, dem babylonischen Epos um den König Gilgamesch. Es ist auf Tontafeln überliefert und soll aus dem zwölften Jahrhundert v. Chr. stammen. Heute, im einundzwanzigsten Jahrhundert, speist sich die halbe Hollywood-Industrie aus dem Motivschatz der Märchen. Welterfolge wie Star Wars oder Shrek wären ohne Märchen nicht möglich, ganz zu schweigen von Harry Potter, dem größten Erfolg in der Geschichte der Literatur.
Von Indien nach Paris
Auch in den drei Jahrtausenden dazwischen war das Märchen nie ausgestorben. Schon das Alte Testament, Heiliges Buch hin oder her, ist nicht frei davon. Man denke nur an das Buch Hiob. Die Geschichte der Tortur des braven Hiob fängt wie ein Märchen an und endet wie eines. Ein reicher Mann mit sieben Söhnen wird von Gott respektive Satan auf die Probe gestellt und verliert all sein Hab und Gut. Weil er nicht vom Glauben abfällt und die Prüfung besteht, bekommt er zum Schluß alles doppelt zurück – die Lösung, wie sie seit jeher zum Märchen gehört.
Aus dem sechsten Jahrhundert v. Chr. stammt die berühmte indische Märchensammlung Panchatantra. Tausend Jahre später wurden die «Fünf Gewebe», was Panchatantra bedeutet, von einem Arzt und Schachmeister aus dem Sanskrit ins Persische übersetzt. Die Sammlung blieb wirkmächtig bis ins siebzehnte Jahrhundert, als der französische Fabeldichter Jean de La Fontaine auf einem Spaziergang durch die Pariser Quais auf ein Exemplar der Fünf Bücher stieß.
Wie das Beispiel zeigt, ist das Märchen ein Nomade, der durch die Dünen der Jahrhunderte streift. Und er läßt keine Kultur dabei aus. Ein und dasselbe Motiv kann sich auf einem persischen Pergament finden, in mündlicher Form in den Pyrenäen, in einer Ballade der schottischen Highlands und einem Märchen der Karibik.
Es dauerte allerdings lange, bis es als Gattung ernstgenommen wurde. Im Mittelalter waren zwar die Ritterepen beliebt, große Märchen für Erwachsene – wobei das Märchen lange