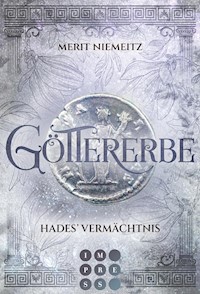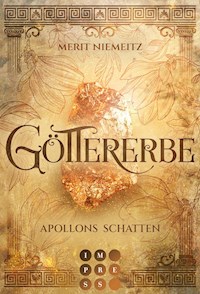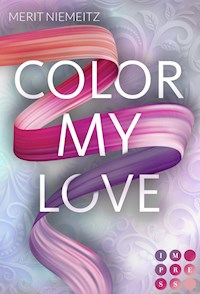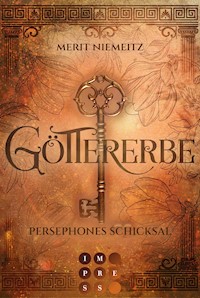
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
**Wenn die Vergangenheit dein engster Verbündeter wird** Um den jungen Göttererben Vesper zu retten, ist Lia einen gefährlichen Deal mit dem Gott der Unterwelt eingegangen und seitdem auf der Suche nach der sagenumwobenen Büchse der Pandora. Doch nicht nur Hades, sondern auch Zeus haben ihr das Versprechen abverlangt, ihnen den geheimnisvollen Inhalt zu bringen. Lia weiß nicht, wem der beiden Götter sie vertrauen kann. Die falsche Entscheidung könnte einen Krieg heraufbeschwören, der sogar die Erde in Gefahr bringt. Und auch ihre Liebe zu Vesper wird auf eine harte Probe gestellt, denn seit seiner Rückkehr hat er sich von Lia abgewandt … Für all die Göttinnen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. //Dies ist der dritte Band der magisch-göttlichen Buchreihe »Göttererbe«. Alle Bände der Fantasy-Liebesgeschichte bei Impress: -- Göttererbe 1: Apollons Schatten -- Göttererbe 2: Hades' Vermächtnis -- Göttererbe 3: Persephones Schicksal// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Merit Niemeitz
Göttererbe 3: Persephones Schicksal
**Wenn die Vergangenheit dein engster Verbündeter wird**
Um den jungen Göttererben Vesper zu retten, ist Lia einen gefährlichen Deal mit dem Gott der Unterwelt eingegangen und seitdem auf der Suche nach der sagenumwobenen Büchse der Pandora. Doch nicht nur Hades, sondern auch Zeus haben ihr das Versprechen abverlangt, ihnen den geheimnisvollen Inhalt zu bringen. Lia weiß nicht, wem der beiden Götter sie vertrauen kann. Die falsche Entscheidung könnte einen Krieg heraufbeschwören, der sogar die Erde in Gefahr bringt. Und auch ihre Liebe zu Vesper wird auf eine harte Probe gestellt, denn seit seiner Rückkehr hat er sich von Lia abgewandt …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Merit Niemeitz wurde 1995 in Berlin geboren und lebt noch immer dort, in einer Wohnung mit unzähligen Flohmarktschätzen, Pflanzen und Büchern. Seit ihrer Kindheit liebt sie Worte und schreibt ihre eigenen Geschichten. Während und nach ihrem Studium der Kulturwissenschaft arbeitet sie seit Jahren in der Buchbranche und möchte eigentlich auch nie etwas anderes tun.
Kapitel 1
Der Himmel war mit Watte überzogen – weiche Wolkenberge, die sich nicht bewegten. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein klares Blau gesehen hatte. Seit Wochen war da nur dieses Weiß-Grau, das jegliches bisschen Farbe unter sich begrub.
Ich atmete neblig aus und umklammerte meinen Oberkörper, während ich durch das frostbesetzte Gras stapfte. Es war Mitte Januar und seit Neujahr fiel gelegentlich Schnee. Nie so viel, dass er liegen blieb, aber immer genug, dass ich fast jeden Morgen mit feuchten Klamotten zurückkam. Das Wetter konnte sich nicht entscheiden und ich verstand das so gut. Zu gut.
Hätte ich gewusst, was ich tun wollte, wäre ich nicht täglich auf die Steilklippen geklettert. Hier oben umwehte mich der Wind von verschiedenen Seiten: vom Meer, das unten an die Steine schlug, und von den weitläufigen raugrasigen Hügeln, die die Klippen von oben umspielten. Die Luft war eiskalt und so frisch, dass ich es manchmal nicht schaffte zu atmen. Oder zu denken. Und genau deswegen waren diese Stunden die angenehmsten meines Tages.
Ich stellte mich dicht an den Abgrund, hinter dem es metertief bergab ging. Das Meer war zu dieser Uhrzeit schwarz-blau, zersetzt von weißen Schaumkronen und Algenfäden, die auf den unruhigen Wellen tanzten. In solchen Momenten sah es so wütend aus, dass ich Poseidons Anwesenheit im Wasser spüren konnte. Seine Anwesenheit und vor allem seinen Hass, den er stellvertretend für seinen Bruder Zeus auf mich richtete.
Immerhin war ich der Mensch auf diesem Planeten, den die olympischen Götter am meisten verachteten. Sie wollten mich tot sehen und früher oder später – da war ich mir sicher – würden sie auch versuchen dafür zu sorgen. Diese Duldung, die ich erfahren durfte, war nicht mehr als eine Schonfrist. Und sie hing mit einer ziemlich klaren Bedingung zusammen: Ich musste Zeus die Büchse der Pandora bringen. Jene Büchse, die auch Hades unbedingt haben wollte und die wiederum der Grund dafür gewesen war, dass ich sein Reich hatte verlassen können. Wozu die beiden verfeindeten Götter diese Büchse haben wollten, hatten sie mir nicht gesagt. Wo ich sie finden konnte, auch nicht. Angeblich war ich als Erbin von Hades dazu befähigt, das Ding aufzuspüren. Ich würde einfach wissen, wo sie sich befand, sobald Apollons Visionskraft vollständig verschwunden und nur noch mein göttliches Erbe zurückgeblieben war.
Tja. Es war einige Wochen her, dass wir Apollon beschworen hatten und ich seine Macht losgeworden war. Aber ich spürte keine Veränderungen in mir, die darauf hindeuteten, dass mit dem Wegfall des Schwindels etwas anderes zum Leben erwacht war. Wenn ich die Augen schloss, fühlte ich keine Superkräfte in mir. Und auch keine Kompassnadel, die sich nach der Büchse richtete und mich fortzog. Da war nur drückende Dunkelheit. Leere. Taubheit. Hilflosigkeit. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte.
Die anderen dachten, dass ich mich hierher zurückzog, um mich besser konzentrieren zu können. Um die Augen zu schließen, tief durchzuatmen und in mir nach dem Aufenthaltsort der Büchse zu suchen. Als wäre mein Inneres eine Schatzkarte und kein verdammter Schlachtplatz.
Ich ließ sie in dem Glauben. Solange sie das dachten, sagten sie nichts dagegen, dass ich stundenlang verschwand. Und diese Zeit war die einzige, in der ich mich traute meine Maske der Selbstbeherrschung und Gelassenheit ein wenig sinken zu lassen.
Wir hatten Zeos Insel vor etwas mehr als zwei Wochen verlassen. Ich war mir nicht sicher, wessen Entscheidung das gewesen war, aber ich hatte mich nicht beschwert. Abstand zu Zeo bedeutete Abstand zu Zeus und das war mir mehr als recht. Es reichte, dass ich an ihn denken musste, sobald ich in der Nähe des Wassers oder des freien Himmels war. Seine Morddrohung schwebte über mir, egal wohin ich ging. Und ich wusste, dass er das genau so beabsichtigt hatte. Ihm war klar, dass ich seine Warnung ernst nahm, und er zweifelte sicher nicht daran, dass ich ihm die Büchse vor Hades bringen würde. Und da er im Olymp festsaß, überließ er es seinen Anhängern, mich so lange im Auge zu behalten, bis ich seinem Befehl nachgekommen war.
Mein Blick glitt über die Kante der Klippe. In einigen Metern Entfernung setzte ein Sandstrand an. Ein weißer Streifen, der sich zwischen fast schwarzem Wasser und grünen Dünenhügeln entlangschlängelte. Weit und breit gab es nur ein einziges Gebäude, das die Unberührtheit dieser Natur durchbrach. Ein großes Haus, das dicht hinter den Dünen stand und seltsam fehlplatziert wirkte. Graue Fassade, schwarzes Dach, die Fenster eine Handvoll goldener Lichtflecken in der Morgendämmerung. Bei dem Gedanken, wer sich darin befand, zog sich alles in mir zusammen. Aus den verschiedensten Gründen.
Weder Zeo noch Dorion waren bereit gewesen mich allein gehen zu lassen. Lex war sowieso schon mit mir auf Zeos Insel gereist und kaum, dass wir diese verlassen hatten, hatte sich Caleb uns angeschlossen. Eine Tatsache, die Zeos Anhänger nicht wirklich begrüßten. Immerhin waren die Erben der Olympier seit Jahrhunderten mit denen der chthonischen Götter verfeindet und da nun klar war, dass Zeo und Dorion die Büchse der Pandora für die Zwecke ihres jeweiligen Gottes nutzen wollten, schloss sich eine Zusammenarbeit aus – mehr als je zuvor. Sadie und Chester waren nur schwer davon abzuhalten gewesen, bereits bei den Autos einen handfesten Streit anzufangen. Letztlich hatten Leander und Clio es geschafft, sie so weit zu beruhigen, dass sie bereit waren Lex und ihn zu dulden.
Vermutlich dachten beide Seiten, ich würde die Büchse der Pandora an ihren jeweiligen Gott überliefern. Bis auf Lex fragten sie mich nicht danach und ich sagte nichts dazu. Die meiste Zeit über sagte ich gar nichts. Dort unten in diesem Haus, das Zeo gehörte und das er seit etlichen Jahren nicht mehr gesehen hatte, traute ich mich kaum den Mund zu öffnen. Weil es so vieles gab, das ich nicht mehr sagen durfte. Nicht mehr denken durfte. Nicht mehr fühlen durfte.
Weil er dort war.
Ich stemmte mich gegen das brennende Gefühl in meinem Inneren, das mich immer durchströmte, wenn ich es wagte, an ihn zu denken. Mit aller Kraft grub ich die Finger in meine Arme, legte den Kopf in den Nacken und atmete tief durch. Bis der eisige Wind mir auch die letzten schmerzhaften Gedankenfetzen aus dem Kopf gepustet hatte und ich mich – zumindest für einen kurzen Moment – daran erinnerte, was Seelenfrieden war.
***
Es war nach neun, als ich die Klippen wieder hinabstieg. Mein schwarzes Haar klebte feucht an meinem Kopf, ebenso wie die Jeans und die Regenjacke an meinem Körper. Seit Tagen rechnete ich damit, mich zu erkälten, aber nichts geschah. Mittlerweile provozierte ich es, indem ich auf Handschuhe, Schal und Mütze verzichtete – trotzdem erholte sich mein Körper jedes Mal innerhalb von kürzester Zeit von dem feuchtkalten Wetter, dem ich ihn jeden Morgen mehrere Stunden lang aussetzte. Als wollte er nicht krank werden. Oder, und das war es eigentlich, wovor ich mich fürchtete, als könnte er es nicht mehr. Zumindest nicht mehr so schnell, wie es menschlich gewesen wäre, weil ich eben nicht mehr menschlich war. Nicht mehr richtig zumindest.
Ich sah Lex schon von Weitem. Ein dunkler Fleck, der reglos im wiegenden Dünenhaar verharrte. Unwillkürlich umklammerte ich meine Arme fester. Ich hatte große Lust, einen Umweg zum Haus zu gehen, um nicht an ihm vorbei zu müssen, aber das wäre sinnlos gewesen. Wir spielten dieses Spiel jeden Morgen. Normalerweise ließ er mich wenigstens vorher durch die Haustür ins Warme treten. Heute stand ihm die Ungeduld überdeutlich ins Gesicht geschrieben.
Ich verstand es sogar. Seit Tagen schlief er mit einer Handvoll Göttererben unter einem Dach, die ihn lieber getötet hätten, als mit ihm zu frühstücken. Nicht nur, dass Lex zu Dorions und somit zu Hades’ Gefolge gehörte, er hatte noch dazu einen ihrer Freunde umgebracht. Auch wenn Vesper mittlerweile wieder am Leben war: Göttererben hatten zwar ziemlich viele herausragende Eigenschaften, Verzeihen gehörte aber nicht dazu.
»Und?«, fragte er, sobald ich in Hörweite war.
»Was?« Ich stapfte an ihm vorbei, ohne ihn anzusehen.
Lex blieb dennoch dicht neben mir. Das Gras kratzte an meinen Beinen, sein Blick an meinem Profil. »Du weißt was.«
Ich tippte mir an die Schläfe. »Ach so, du meinst die Büchse. Klar, die lag da oben unter einem Stein. Wir können also sofort losgehen.«
Lex musterte mich schweigend, während wir die Düne hinabliefen. Das Haus wurde immer größer und dunkler. So wie die Gedanken in mir, denen ich täglich auf den Klippen aus dem Weg gehen wollte. Zurücklassen konnte ich sie nie.
»Du wirst von Tag zu Tag zynischer«, sagte er trocken, als wir die Terrasse erreicht hatten.
Eine Insel aus Holz mitten im Grün. Dieses Haus im schottischen Nirgendwo hatte etwas Idyllisches, fast Magisches an sich. Es hätte mir hier gefallen, wenn es mir gelungen wäre auszublenden, wer im Inneren auf uns wartete.
»Und du von Tag zu Tag nerviger«, murmelte ich und schob die Glastür zur Wohnküche auf.
Im Inneren roch es nach frisch gemahlenem Kaffee und aufgebackenen Brötchen. Clio gab sich jeden Morgen die größte Mühe, unserer Wohnsituation einen Funken Normalität und Gemütlichkeit zukommen zu lassen. Es blieb trotzdem mehr als schräg.
Am Wohnzimmertisch saßen Sadie und Chester hinter einem Laptop und versanken in ihrer Zwillingskommunikation, die aus unzusammenhängenden Halbsätzen und einvernehmlichem Brummen bestand. Sie wühlten sich seit Wochen durch das Internet und suchten nach Quellen, die etwas über den Aufenthaltsort der Büchse der Pandora hergaben. Bisher war nichts dabei gewesen, das ihnen so vielversprechend erschien, als dass wir aufgebrochen wären. Scheinbar gab es keinen verlässlichen Wikipedia-Artikel zu dem Aufenthaltsort einer mythischen Blechschatulle, die eine Frau aus Lehm vor Jahrhunderten auf die Erde gebracht hatte.
Wenn das überhaupt stimmte. Es fiel mir schwer, irgendetwas von dem zu glauben, was man über Pandora lesen konnte. Angeblich hatte Zeus bei Hephaistos das Erschaffen dieser Frau in Auftrag gegeben, um Prometheus’ Diebstahl des Feuers für die Menschen zu rächen. Etliche der anderen Götter halfen dabei, das Lehmgeschöpf so verführerisch und anziehend wie nur möglich werden zu lassen, indem sie ihm allerlei erstrebenswerte innere und äußere Attribute zukommen ließen. Anschließend überreichten sie der Frau eine Büchse, in die sie alle Übel der Welt – und die Hoffnung – sperrten, und schickten sie auf die Erde zu Prometheus’ Bruder Epimetheus. Obwohl dieser von seinem Bruder gewarnt worden war Geschenke des Göttervaters entgegenzunehmen, konnte er Pandora nicht widerstehen und heiratete sie. Sie öffnete die Büchse und damit entwichen all die Übel in die Welt. An dieser Stelle spaltete sich der Mythos in eine Version, in der die Büchse wieder geschlossen wurde, ehe die Hoffnung entfliehen konnte, und in eine, in der sie abermals geöffnet wurde, sodass sie doch noch entfloh – womöglich als Schlimmstes aller Übel.
Wenn ich Hades glaubte, war Pandora allerdings auch eine gute Freundin von ihm gewesen, die die Büchse für ihn auf der Erde vor seinen Brüdern versteckt hatte. Die Tatsache, dass sie immer noch leben sollte, musste bedeuten, dass sie auf irgendeine Art unsterblich war. Zeus hatte mir gegenüber angedeutet, dass er sie ewig auf der Erde gesucht und nicht gefunden habe. Wenn selbst der Göttervater ihren Aufenthaltsort nicht kannte, machte ich mir nicht allzu große Hoffnungen, dass ich mehr Erfolg haben würde. Generell war ich mir mit meinem derzeitigen Gemütszustand sicher, dass Pandora die Hoffnung in ihrer Schatulle behalten hatte.
In der Küchenzeile stand Clio am Herd und briet unter wenig melodiösem Summen Rührei in der Pfanne. Als ich neben sie trat, um mir einen Becher aus dem Schrank zu holen, schenkte sie mir ein betont fröhliches Lächeln. Meine Mundwinkel ziepten, als ich es erwiderte. Ich hatte Clio wirklich gern, aber ihre offensichtliche Bemühung, Optimismus und Zuversicht auszustrahlen, machte alles irgendwie noch schwieriger. Sie nervte mich zwar nicht wie Lex, aber in ihren Augen erkannte ich jeden Morgen dieselbe Frage: Gibt es etwas Neues?
Alle warteten darauf, dass ich irgendwann hier hereinplatzte und verkündete, dass ich etwas hatte, das uns weiterhelfen würde. Jede noch so kleine Spur, die es uns ermöglichen würde aufzubrechen, wäre ihnen extrem lieb. Aber ich hatte nichts. Ich war eine wandelnde Enttäuschung. Für uns alle. Ich schüttelte den Kopf und Clio zwickte mich sanft in die Seite. Ein stilles: Schon gut. Mach dir keinen Stress. Das wird schon.
Als ich gerade den Oberschrank noch einmal öffnen wollte, um Teller herauszuholen, stupste sie mich erneut an. »Könntest du vielleicht nach den Jungs sehen? Sie sind hinterm Haus. Ich würde es begrüßen, wenn sie noch duschen, bevor sie zum Frühstück kommen.« Sie senkte die Stimme und neigte sich zu mir. »Caleb ist momentan richtig gereizt. Ich befürchte, wenn er noch einmal eine Matschspur im Haus findet, versetzt er uns alle ins Koma.«
»Klar. Mach ich.« Ich rang mir ein Lächeln ab, obwohl mein Herz sofort beschleunigte. In diesem Haus befanden sich aktuell fünf junge Männer – nur zwei davon nannte Clio Jungs.
»Danke.« Clio ließ ihren Blick wachsam an mir hinabgleiten. »Und du selbst solltest auch noch mal unter die heiße Dusche springen. Du fängst dir da draußen noch was ein, wenn du so weitermachst.«
Schön wäre es, dachte ich grimmig, aber ich nickte nur, ehe ich mich an ihr vorbeischob.
Das Haus stand allein an diesem Küstenabschnitt, ringsherum gab es kilometerweit nur endlose Weite. Zu dieser Jahreszeit waren die Highlands farblos, die Grasdecke der Hügel braun und trocken. Das Haus grenzte an einer Seite an die Dünen, die es vom Meer abschirmten, auf der anderen wies es direkt auf eine Talebene. Das borstige Gras stach durch meine Hosenbeine, als ich durch die Vordertür getreten war und an der Hauswand entlangstapfte. Ich wusste genau, wo ich sie finden würde. Mehrmals am Tag musste ich dagegen ankämpfen, mich nicht an das Fenster am Ende des Flurs im Obergeschoss zu stellen und hinauszusehen. Von dort aus konnte man genau auf die gartenähnliche Freifläche blicken. Dorthin, wo Clios Jungs beinahe den gesamten Tag verbrachten.
Als ich sie entdeckte, hielt ich ruckartig inne. Leander stand mit dem Rücken zu mir. Er trug einen Pullover, eine lange Jogginghose und eine Sonnenbrille, obwohl der Himmel noch immer grau und wolkenbetupft war. Es lag nicht am Wetter, dass er seine Augen schützen musste. Es lag an ihm.
Vesper stand ein paar Meter von Leander entfernt, nur in Trainingshose und Sportschuhen. Sein nackter Oberkörper war feucht vom Schneeregen, aber ich wusste, dass er nicht einmal eine Gänsehaut hatte. Dafür bekam ich eine, während ich dabei zusah, wie er langsam die Hände in die Luft streckte. Er legte den Kopf mit geschlossenen Augen in den Nacken und bewegte lautlos seine Lippen.
Je länger er dort stand, desto heller wurde das Leuchten, das von ihm ausging. Nicht von seiner Haut oder seinen goldblonden Locken, das Licht kam direkt aus ihm. Die Luft, die ihm umgab, schwirrte. Seine Silhouette dahinter wurde weichgezeichnet, so, wie nur extreme Hitze es konnte. Leander wich ein paar Schritte zurück, sodass ich mitansehen konnte, dass das Gras rund um Vespers Füße zu schwarzer Asche zerfiel. Dünne Rauchfäden schlängelten sich an seinen Beinen empor, aber er bewegte sich nicht. Noch immer hatte er die Augen geschlossen und murmelte lautlos vor sich hin. Dabei konnte ihm unmöglich entgehen, dass die Hitze gerade den Boden um ihn herum zerfraß.
»Verdammt«, rutschte es mir heraus.
Vesper hielt inne und öffnete die Augen. Innerhalb weniger Sekunden ebbte das Hitzefeld ab. Vespers Silhouette schärfte sich. Leider galt das auch für die Art, wie er mich ansah.
Meine Mundwinkel hoben sich zu einem zaghaften Lächeln. Ein peinlicher Reflex, den ich mir nicht abgewöhnen konnte. Ich schämte mich jedes Mal dafür, sobald er darauf reagierte. Weil er das jedes Mal auf dieselbe Weise tat: Mit einem verächtlichen, wütenden Blick, der sich unter meine Haut grub. Er brannte. Auf eine schrecklich unangenehme Weise.
Vesper war so hell, aber die Art, wie er mich ansah, war nur dunkel. So, so dunkel.
Ich schluckte und blieb neben Leander stehen, der sich die Sonnenbrille in die Haare geschoben hatte und mich halbherzig anlächelte. »Guten Morgen, Lia.«
»Hey. Was …?« Ich schüttelte den Kopf und betrachtete die Brandflecken auf dem Rasen. »Das ist neu«, brachte ich schließlich hervor. Seit wir hier waren, verbrachte Vesper jeden Tag Stunden damit, seine Kräfte zu trainieren. Ich wusste nicht genau, was bisher dabei herausgekommen war, aber hiervon hatte ich noch nichts gehört. Es hatte ausgesehen, als wäre Vesper ein wandelndes Hitzefeld. Eine kleine Sonne, jetzt noch mehr, als ich es schon immer gedacht hatte. Besorgt musterte ich seinen Oberkörper, auch wenn der Anblick mir unangebrachte Wärme in die Wangen trieb. »Tat das gar nicht weh?«
»Was willst du?«, fragte er barsch zurück.
Ich zuckte leicht zusammen. Es war absurd, dass der in jeder Hinsicht wärmste Mensch, den ich kannte, nur ein paar Worte brauchte, um mich frieren zu lassen. Weitaus mehr, als es der schottische Winter schaffte. Ich senkte den Blick auf das verbrannte Gras. »Clio meinte, ich solle euch holen. Damit ihr euch frisch machen könnt, bevor das Frühstück fertig ist. Sie …«
Weiter kam ich nicht. Vesper lief ohne ein weiteres Wort los. Als er an mir vorbeigehen wollte, machte ich reflexartig einen Schritt zur Seite. Ich wusste nicht wieso – ob ich ihm Platz machen oder mich ihm in den Weg stellen wollte. Mein Verstand wusste, dass ich ihn meiden sollte, aber mein Körper suchte ständig seine Nähe. Vielleicht brauchte ich die permanente Zurückweisung, um mich daran zu erinnern, dass das hier jetzt unsere Realität war.
Er hielt inne. So wie sein Atem, als würde er die Luft anhalten, weil er mir so nah war. Ich hätte nur die Finger ausstrecken müssen, um ihn zu berühren. Ich wollte es so sehr. Immer noch und mehr als alles andere.
Vespers Kiefermuskulatur zuckte, ebenso wie seine Finger, als er sie zu Fäusten ballte. Ich wusste, was in ihm vorging: Er musste dagegen ankämpfen, sie erneut um meinen Hals zu schließen – so, wie in jenem Moment auf Zeos Insel, in dem er nach seinem Vergessen aufs Neue erfahren hatte, wer ich war. »Geh mir aus dem Weg!«
Hastig wich ich einen Schritt zur Seite. »Entschuldige.« Meine Stimme klang heiser, unangenehm zerbrechlich. »Ich …«
Ich gab mir keine Mühe, den Satz zu beenden. Vesper lief, ohne mich eines Blickes zu würdigen, an mir vorbei und verschwand in Richtung Vordertür.
Leander küsste mich im Vorbeigehen auf den Scheitel, ehe er ihm folgte. Er versuchte nicht mich zu trösten. Vielleicht weil er wusste, dass es für manche Dinge keinen Trost gab.
Ich blieb reglos stehen und bemühte mich – wie jeden Tag – Vespers Reaktionen und meine Gefühle für ihn in Einklang zu bringen. Das war Vesper und gleichzeitig war er es nicht. Ein Mensch war sehr viel mehr als nur ein Gebilde aus Zellen oder einer Ansammlung von Charakterzügen. Er wurde vor allem dadurch definiert, was er erlebt, gefühlt und gedacht hatte. Erinnerungen machten so viel aus, wahrscheinlich waren sie das Prägendste für einen jeden Menschen. Und ich hatte ihm so viel davon genommen.
Vesper erinnerte sich nicht mehr daran, dass er im Tartaros gewesen war. Genauso wenig, wie er sich an mich erinnerte. Oder daran, dass wir einander gesagt hatten, dass wir uns liebten. Oder daran, dass … Ich schloss die Augen und drängte den Gedanken beiseite. Das führte zu nichts. Was auch immer Vesper und ich gehabt hatten: Es war vorbei.
Was Vesper anging, hatte es nicht einmal existiert. Wenn er mich ansah, sah er weder eine eigenbrötlerische Prophetin noch eine verfluchte, aber vielleicht doch liebenswerte Frau. Er sah einfach nur die Erbin des Gottes der Unterwelt, die laut irgendeiner uralten Legende dazu bestimmt war, das ultimative Chaos bei den Göttern und den Menschen auszulösen. Und ich konnte noch nicht einmal behaupten, dass das nicht stimmte. Weil ich keine Ahnung hatte, was überhaupt noch wahr war. Seit wir Apollon beschworen hatten, war der Schwindel auch ohne Vespers Nähe fort, die Visionen kein Teil mehr von mir – und doch fühlte sich nichts mehr real an.
Ich rieb mir über die Augen und drehte mich um, nur um Lex gegenüberzustehen, der an der Hauswand lehnte. Etwas an seinem Blick ließ mich ahnen, dass er bereits weit länger dort stand, als mir lieb war.
Er runzelte die Stirn. »Ist ja echt traurig, das mit anzusehen. Soll ich anfangen dich mit einem Waschlappen abzuwerfen, wenn du dich lächerlich machst?«
Hitze stieg in meine Wangen und ich wandte mich ab. »Halt den Mund, Lex. Das ist alles deine Schuld.«
»Ich war es nicht, der ihn aus dem Fluss des Vergessens hat trinken lassen«, erinnerte er mich.
Wütend funkelte ich zu ihm hinüber. Als müsste er mich daran erinnern, was ich getan hatte. Es war meine Entscheidung gewesen, Vesper etwas von Lethes Wasser zu geben, das ich in der Unterwelt gesammelt hatte. Ich hatte mir eingeredet keine Wahl zu haben: Die Erinnerungen an den Tartaros hatten Vesper gequält und Hekate hatte mir zu verstehen gegeben, dass das auch so bleiben würde. Ich hatte ihn vor sich selbst retten wollen und das war der einzige Weg dafür gewesen. Die möglichen Risiken, die mit dem unkontrollierten Vergessen einhergingen, hatte ich einfach so hingenommen. Genauso wie ich es akzeptiert hatte, ihn aus der Unterwelt zu retten, ohne mir im Klaren darüber gewesen zu sein, was das für Folgen für Vesper haben würde.
Mit dem Ergebnis, dass er jetzt nicht nur die vergangenen Monate seines Lebens vergessen hatte, sondern auch kein Mensch mehr war. Als Göttererbe war er nie normal gewesen, aber er hatte ein halbwegs gewöhnliches Leben führen können. Das war vorbei: Durch seine Rückkehr von den Toten war Vesper unsterblich geworden. Er war ein irdischer Gott. Und da er wusste, dass ich es gewesen war, die ihn aus dem Hades zurückgeholt hatte, hasste er mich dafür.
Mein Hals zog sich zusammen – wie immer, wenn sich die Erkenntnis in mir breitmachte, was ich ihm angetan hatte. Was ich niemals wiedergutmachen konnte. Denn egal, was ich mir einreden wollte, ich hatte eine Wahl gehabt. Die hatte man immer. Ich hatte nur einfach das getan, was ich selbst am besten ertrug. Ich hatte für Vesper entschieden, was in meinen Augen das kleinere Übel war, und ich verstand, dass er mir das niemals verzeihen würde. Dass Vesper dieses Leben führen musste, war meine Schuld. Und die von Lex. Hätte er Vesper nicht umgebracht, um mich in den Hades zu locken, wäre nichts davon passiert.
Ich schob ihn grob beiseite, um die Tür zu öffnen. »Du warst es, der mich dazu gezwungen hat.«
Er seufzte hinter mir. »Rede dir das ein, wenn es dir dann besser geht. Das ändert nichts daran, dass du das endlich abhaken solltest. Wir haben weitaus Wichtigeres zu tun.«
Ich kniff die Lippen aufeinander und ging auf ich die Treppe zum Obergeschoss zu. Bevor ich die erste Stufe nehmen konnte, hielt Lex mich am Arm zurück. Sein Gesichtsausdruck wirkte angespannt und genervt. »Ernsthaft, Lia. Du musst dich endlich auf das Wesentliche konzentrieren. Und du kannst mir nicht immer ausweichen, wenn ich dich frage, was du vorhast!«
Als ob ich das selbst wüsste. Ohne etwas zu erwidern, riss ich mich von ihm los und stapfte die Treppe hinauf. Ich atmete erleichtert durch, als ich merkte, dass er mir nicht folgte. Es gab nichts zu sagen. Ich wusste natürlich, dass er recht hatte. Wir mussten die Büchse der Pandora finden, bevor Zeus oder Hades die Geduld mit mir verloren. Und dann sollte ich schnellstmöglich herausfinden, wie ich es schaffte, beide zufriedenzustellen. Was, meinem jetzigen Kenntnisstand nach, absolut unmöglich war. Ich hatte so viele Fragen darüber, was sich in der Büchse befand und vor allem, wozu die beiden göttlichen Brüder sie nutzen wollten. Ich wusste nicht, was sie vorhatten. Ich wusste nicht, was meine Rolle dabei war. Ich wusste nicht einmal, wie ich das Ding finden sollte. Ich wusste gar nichts.
Es stimmte: Wir hatten weitaus Wichtigeres zu tun, als dem nachzutrauern, was ich nie wiederbekommen würde. Das war mir klar. Das Problem war nur, dass es mir allein um Vesper ging.
Frustriert zerrte ich mir die feuchte Jacke von den Schultern und warf sie achtlos über das Geländer. Während sich im Erdgeschoss nur der Essbereich und das große Wohnzimmer befanden, bot das Obergeschoss mit fünf Schlafzimmern genug Platz für eine Familie. Oder für eine unfreiwillig zusammengewürfelte Gruppe von Göttererben.
Mein Zimmer lag am Ende des Flurs. Es war das kleinste, ausgestattet mit nur einem schmalen Holzbett und einem Kleiderschrank, aber ich hatte es mir selbst ausgesucht. Es lag am weitesten von allen anderen Zimmern entfernt und außerdem war es zu klein für ein zweites Bett, sodass ich im Gegensatz zu den meisten der anderen allein schlafen durfte. Da ich tagsüber schon permanent unter Beobachtung stand, war mir das mehr als recht.
Man merkte dem Haus an, dass es seit einiger Zeit leer gestanden hatte. Auf dem Boden lag eine dünne Decke aus Staub und zwischen den Bilderrahmen an den dunkel gestrichenen Wänden hingen Spinnweben. Wir hatten nach unserer Ankunft den gröbsten Schmutz beseitigt, aber da wir nicht wussten, wie lang wir hierblieben, hatten wir uns nicht vor Mühe überschlagen. Die anderen hatten mir erzählt, dass dieses Haus einmal als Ferienhaus von Zeos Familie genutzt worden war, aber offensichtlich war seit Jahren niemand mehr hier gewesen.
Als ich an Calebs Zimmer vorbeiging, hörte ich ihn hinter der Tür leise reden. Ich musste nicht hinhorchen, um zu wissen mit wem. Ich wusste, dass er jeden Tag mit Dorion telefonierte, so wie Vesper jeden Tag mit Zeo sprach. Manchmal kam es mir so vor, als würde sich eine unsichtbare Linie durch das Haus ziehen und die Erben voneinander trennen. Dass sie alle hier waren und es seit Wochen schafften, nebeneinander zu existieren, grenzte an ein Wunder. Allen war bewusst, dass dieser Waffenstillstand mehr als fragil war: Er würde genau so lang anhalten, bis wir die Büchse der Pandora gefunden hatten. Was sich – Stand jetzt – nur noch um eine Ewigkeit handeln konnte.
Ich war bereits so müde von diesem Tag, dass ich mich am liebsten ins Bett verkrochen hätte. Nur Clio zuliebe zwang ich mich dazu, mir ein paar saubere Sachen aus meiner Reisetasche zu ziehen und in Richtung Bad zu gehen. Ich hatte den Flur gerade zur Hälfte durchquert, als sich urplötzlich jemand aus einem der Zimmer schob und ich geradewegs gegen einen Rücken prallte.
Vesper war schon immer leise gewesen, aber seit er mehr als ein paar göttliche Gene hatte, hörte ich ihn niemals kommen.
Hastig wich ich zurück und spürte, wie die Farbe aus meinem Gesicht sickerte, als er sich zu mir umdrehte. Seine hellen Locken waren noch feucht und er trug mittlerweile Jeans und einen olivgrünen Pullover, der die Farbe seiner Augen betonte. Gott, er war so schön.
Einige Sekunden lang starrte ich ihn an, dann schaffte ich es, den Blick zu senken. »Entschuldige. Schon wieder.« Ich biss mir auf die Zunge, um nicht noch mehr zu sagen. Mit heißen Wangen wandte ich mich ab und ging auf das Bad zu.
Bevor ich die Tür öffnen konnte, ertönte seine Stimme. »Warte!«
Sofort hielt ich inne. Nicht nur in der Bewegung, auch innerlich. Mein Atem stockte und ich drehte mich langsam um. Vesper stand noch immer vor seiner Zimmertür und musterte mich mit leicht gerunzelter Stirn. Es sah aus, als würde es ihm körperlich wehtun, mit mir zu reden. Was vermutlich der Grund dafür war, dass er es so gut wie nie tat. In meiner Nähe schien seine ganze Energie dafür draufzugehen, mich nicht umbringen zu wollen.
»Wir müssen reden«, teilte er mir knapp mit, ehe er sich abwandte und mir mit einer Handbewegung zu verstehen gab, dass ich ihm in sein Zimmer folgen sollte.
Mit mulmigem Gefühl legte ich meine sauberen Sachen vor die Badtür und folgte ihm. Seit wir hier waren, hatte ich sein Schlafzimmer nie betreten. Ein paar Mal hatte ich unsicher davorgestanden und darüber nachgedacht zu klopfen, aber ich hatte es jedes Mal nicht über mich gebracht. Vesper hatte mir mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass er so wenig wie möglich mit mir zu tun haben wollte. Und ich versuchte wirklich das zu respektieren, selbst wenn ich mich permanent davon abhalten musste, seine Nähe zu suchen.
Mit verschränkten Armen sah ich mich um. Ebenso wie ich hatte Vesper ein Einzelzimmer bekommen. Ich wusste nicht, wie viel er wirklich hier schlief. Jedes Mal, wenn ich nachts auf die Toilette ging, war da ein schmaler Lichtstreifen, der unter seiner Türschwelle hervortrat. Vielleicht musste ein Gott nicht schlafen. Ich traute mich nicht ihn danach zu fragen.
Das Fenster war weit geöffnet, sodass die winterkalte Luft über die Bodendielen kroch. Vesper würde davon sicher nichts bemerken. Als Nachfahre von Apollon war Sonnenwärme etwas, das in ihm lebte. Er fror so gut wie nie. Vermutlich jetzt noch weniger als damals. Vesper blieb neben dem Schreibtisch am Fenster stehen und wartete, bis ich in der Mitte des Zimmers angekommen war. Direkt neben seinem Bett. Ich vermied es krampfhaft, auf die unordentlich beiseitegeschobene Decke zu sehen oder daran zu denken, dass wir mehr als einmal gemeinsam in einem Bett gelegen hatten.
Das musste aufhören. Ich musste mich damit abfinden, dass es den Vesper, der sich in mich verliebt hatte, nicht mehr gab. Das war nur so verdammt schwer, während er direkt vor mir stand. Ich atmete tief durch und bemühte mich um einen sachlichen Tonfall. »Was gibt’s?«
Vesper stützte sich mit den Händen hinter sich auf der Tischplatte ab. »Du veränderst dich nicht.«
Ich runzelte die Stirn. »Was soll das heißen?«
Er griff nach dem Rucksack, der auf dem Tisch lag. »Es soll heißen, dass mit dir etwas nicht stimmt.«
»Freut mich, dass es dir aufgefallen ist«, erwiderte ich schroff. Womöglich hatte Lex recht und ich wurde tatsächlich immer zynischer. Vielleicht war das ja meine göttliche Superkraft.
Vesper ignorierte mich. Als er sich zu mir umdrehte, hielt er ein Etui in den Händen. Es kam mir unangenehm bekannt vor. Entweder er wollte mich wie damals in York betäuben oder … Er klappte es auf und mein Blick fiel auf die Ampullen, die darin befestigt waren. Zwölf Stück, zwei davon schon geleert, die anderen mit einer goldgelben Flüssigkeit gefüllt. Meine Zunge begann zu kribbeln und ich machte automatisch einen Schritt auf ihn zu.
»Das ist …«, begann er, aber ich schnitt ihm das Wort ab.
»Nektar.« Mit zwei weiteren Schritten war ich bei ihm und betrachtete die kleinen Fläschchen. Der Anblick löste eine solche Sehnsucht in mir aus, dass ich mich davon abhalten musste, ihm das Etui aus den Händen zu reißen. »Ich habe es schon einmal getrunken.«
Als würde er mein Verlangen spüren, zog Vesper das Etui etwas zurück. »Wer hat dir so was gegeben?«
»Du. Wir waren angegriffen worden, Ezra hatte mich verletzt, ich stand am Rande eines Nervenzusammenbruchs und du … hast dir Sorgen gemacht.« Ich stockte und rieb mir über die Schläfe, um ihn nicht ansehen zu müssen. »Es hat gewirkt«, fügte ich heiser hinzu und presste anschließend die Lippen fest aufeinander.
Das hier war gefährlich. Ich musste aufpassen nichts zu sagen, was zu viel verriet. Über uns. Denn da war dieses winzige Detail bezüglich seines Vergessens, das ich immer wieder verdrängte. Dabei war auch das meine Entscheidung gewesen. Nachdem uns klar geworden war, dass Vesper sich nicht an mich erinnerte, hatte ich sämtliche Erben dazu gebracht, mir ein Versprechen zu geben. Wir würden Vesper alles erzählen, was passiert war, aber ein Detail weglassen: was genau das zwischen uns gewesen war. Ich hatte behauptet, es würde alles nur verkomplizieren und die Dinge für ihn noch schwerer machen, aber im Grunde war es reiner Selbstschutz gewesen. Es war eine Sache, mit Vespers unverhohlener Abneigung umzugehen. Eine andere wäre es, ertragen zu müssen, dass er sich allein bei dem Gedanken, mich zu küssen, ekelte.
Wie hätte ich ihm erklären sollen, was er angeblich für mich empfunden hatte? Ihn jetzt, nachdem ich ihn verloren hatte, davon überzeugen zu müssen, dass wir einander einmal auf eine ganz andere Art gefunden hatten, das wäre … zu viel. Ich war nicht stark genug, um das zu ertragen.
Also hatten Clio und Leander ihm lediglich gesagt, dass wir nach anfänglichem Misstrauen Freunde geworden waren. Allein diese Beschreibung hatte bei Vesper Unglauben und Ablehnung hervorgerufen.
Ich wollte mir nicht vorstellen, was in ihm vorgehen würde, wenn er wüsste, dass er einmal geschworen hatte mich zu lieben. Mich zu beschützen. Mich nie wieder gehen zu lassen. Das Einzige, was er jetzt wollte, war, mich so weit wie möglich fortzustoßen. Vermutlich am liebsten wieder in den Hades. Diesmal ohne Rückfahrtschein.
»Dann hätte ich wissen müssen, dass du eine Erbin bist«, stellte er stirnrunzelnd fest.
Ich wich seinem bohrenden Blick aus und schob eine umgeklappte Teppichecke mit dem Fuß zurecht. »Dir waren andere Sachen wichtiger, schätze ich.«
»Jetzt nicht mehr, also sorgen wir endlich dafür, dass du dich auch wie eine Erbin benehmen kannst.«
Wortlos beobachtete ich ihn dabei, wie er eine Ampulle herauslöste und mir hinhielt.
»Trink!«
Unsicher sah ich von seinem angespannten Gesicht hin zu der verlockend funkelnden Flüssigkeit. Ich wollte den Nektar haben, gleichzeitig widerstrebte es mir. Der Drang verdeutlichte nur, wie süchtig das göttliche Getränk machen konnte. »Ich bin nicht verletzt«, sagte ich konzentriert.
»Deine Kräfte lagen zwanzig Jahre lang verschüttet. Wir müssen ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn wir hier nicht ewig festsitzen wollen.« Ungeduldig griff er nach meiner Hand und drückte die Ampulle hinein.
Allein diese alles andere als liebevolle Berührung jagte einen Hitzeschauer meine Wirbelsäule hinab. Ich versteifte mich und wagte es erst auszuatmen, als Vesper wieder einen Schritt zurückgemacht hatte.
Unschlüssig drehte ich die Ampulle zwischen den Fingern. Es behagte mir zwar nicht, aber vielleicht hatte Vesper recht. Wir warteten jetzt seit Wochen und ich nahm keinerlei Veränderung wahr. Ein bisschen göttlicher Nektar könnte womöglich dabei helfen, das, was sich in mir verbarg, zu wecken. Und auch wenn mir das Angst machte: Wenn ich wollte, dass sich diese furchtbare Situation in diesem Haus auflöste, musste ich alles dafür tun voranzukommen.
Ohne noch weiter zu zögern, öffnete ich die Ampulle, legte den Kopf in den Nacken und trank den Inhalt. Innerhalb von Sekunden benetzte der Nektar alles in mir. Ein samtenes Gefühl durchfloss mich und ließ mich leise aufseufzen. Es stimmte, körperlich war ich nicht verletzt, aber in diesem Moment spürte ich dennoch, dass etwas in mir heilte. Meine Muskeln entkrampften sich, meine Lunge weitete sich und meine Gedankenwolken wurden auseinandergezogen. Für ein paar Sekunden war da nur Stille und Frieden in mir. Dann öffnete ich die Augen und sah direkt in Vespers wachsames Gesicht. Und der Schmerz war zurück.
Mit zittrigen Fingern drehte ich die Ampulle wieder zu und reichte sie ihm. Er schob sie zurück zu den anderen, ohne mich aus dem Blick zu lassen. Als erwartete er, dass sich sofort irgendetwas an mir veränderte. »Komm jetzt jeden Morgen zu mir, klar? Ich will das Zeug nicht unten rumliegen lassen.«
»Okay.« Ich tastete mit dem Finger über meine pochende Unterlippe. »Wieso hast du eigentlich so viel Nektar bei dir? Ich dachte, das ist nur für Notfälle.«
Ein harter Zug zuckte um seinen Mund. »Das war, bevor ich so geworden bin.« Eine vage Geste, die seinen Körper umfasste.
Ich verstand sofort, was er meinte, und spürte die brennende Schuld wieder aufflackern. Natürlich: Nektar war neben Ambrosia eines der Hauptnahrungsmittel der Götter. Nachdem wir erfahren hatten, dass Vesper unsterblich war, hatten sich die anderen gefragt, wieso seine Verwandlung so lang unentdeckt geblieben war. Erst seit wir hier waren, schien sich sein Körper seinem neuen Erbe anzupassen. Es waren nicht nur seine Fähigkeiten, die sich verstärkt hatten. Es war alles an ihm. Seine Haut war noch reiner, sein Haar noch leuchtender, seine Bewegungen waren noch fließender. Vesper war immer schön gewesen, jetzt konnte man ihn kaum ansehen. Gleichzeitig war es fast unmöglich, sich seinem Anblick zu entziehen. In allem, was er tat, war er so unfassbar … anziehend. Ich hätte ihn stundenlang nur ansehen können, wenn mir nicht alles daran – an ihm – das Herz zerfetzt hätte.
Ich hatte nicht gewusst, dass er seine Veränderungen beeinflusst hatte, indem er angefangen hatte Nektar zu trinken. Wie Zeo, dachte ich bitter. Doch während der Anführer der Erben, die Zeus unterstanden, das Getränk konsumierte, um besser in Kontakt zum Göttervater treten zu können, blieb Vesper keine Wahl. Weil – und da wären wir wieder – ich sie ihm genommen hatte.
»Es tut mir so leid, Ves«, wisperte ich. Es war nicht das erste Mal, dass ich das sagte, aber so wie jedes Mal zuvor wusste ich auch jetzt, dass es vergebens war.
»Nenn mich nicht so!« Er verzog den Mund zu einem geraden Strich – unendlich bitter. »Wir sind keine Freunde, klar? Du hast mir das angetan.«
Jede Silbe purer Hass. Meine Augen prickelten, ich spürte die Tränen aufsteigen. »Ich wollte dir das Leben retten.«
Er lächelte verächtlich. »Das ist kein Leben. Ich werde jeden, den ich liebe oder auch nur kenne, sterben sehen. Ich bin weder ein richtiger Mensch noch ein richtiger Gott. Ich bin etwas, das es nicht geben sollte. Und ich werde damit allein sein. Für immer.« Seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter, bis sie abrupt abbrach. Ruckartig drehte er sich um und ging zurück zum Schreibtisch.
Der Schmerz, die Wut und diese endlostiefe Verzweiflung, die seine Worte ausdrückten, krochen innerhalb von Sekunden auch durch mich hindurch. Jede Spur der Nektarwirkung verblasste. Mein Inneres war eine einzige Wunde. Einzelne Tränen liefen über meine Wangen, aber ich gab kein Geräusch von mir. Es stand mir nicht zu trauern. Es stand mir nicht zu, auch nur den Bruchteil seines Leids zu empfinden. Es war einzig und allein Vesper, der diese Last tragen musste.
»Danke für den Nektar«, sagte ich leise, obwohl ich wusste, dass es das nur schlimmer für ihn machte. Ausgerechnet mir helfen zu müssen würde kaum erträglich sein. Selbst für jemanden, der so warmherzig war wie Vesper. Oder zumindest wie er es gewesen war. Noch immer wusste ich nicht, was seine Verwandlung in seinem Inneren verändert hatte. Und womöglich wollte ich das auch nicht. Dass ich ihm die Chance auf ein gewöhnliches Leben genommen hatte, war eine Sache … dass ich womöglich auch seine Persönlichkeit völlig verändert hatte, eine andere.
Vesper regte sich nicht. Er verharrte am Schreibtisch, das Gesicht zum Fenster gewandt, die Schultern angezogen und steif.
Mein Inneres brannte lichterloh, als ich sein Zimmer verließ und die Tür hinter mir ins Schloss zog. Ich wusste, dass ich ihn schon lange verloren hatte, aber es fühlte sich jedes Mal aufs Neue wie ein schwerer Verlust an, wenn ich ihn zurückließ.
Kapitel 2
Das hier war kein Schneeregen, es war ein Wintersturm. Ich stand erneut auf der Klippe, nur ein paar Meter vom Abgrund entfernt, und reckte das Gesicht nach oben. Die Welt verschwamm in weißem Nebel. Schneeflocken benetzten mein Gesicht, meine nackten Arme, mein offenes, umhertanzendes Haar.
Seit Vesper mir jeden Morgen Nektar gab, spürte ich, wie ich fitter wurde. Ich war viel langsamer außer Atem, wenn ich jeden Morgen die Hügelformation neben dem Haus hinaufstieg, ich wurde später müde und früher wach, und meine Sinne schärften sich. Ich roch den Kaffee, noch bevor ich die Veranda betreten hatte, ebenso wie Sadies aufdringliches Jasminparfum und Calebs Aftershave, von dem er immer zu viel nahm. Ich schmeckte es, wenn die Milch kurz davor war zu kippen. Und ich bemerkte die Blicke, die die anderen austauschten, wenn sie dachten, ich sähe nicht hin. Und vor allem hörte ich sie. Immer. Ich hörte Clio mit Caspar telefonieren, Sadie und Chester im Erdgeschoss miteinander streiten, Caleb und Lex im Nachbarzimmer gelangweilt Karten spielen und Vesper unruhig auf- und ablaufen. Ich hätte mir am liebsten die Ohren zugehalten. Das Haus wurde mit jedem Tag lauter und das, was die anderen nicht sagten, auch. Seit fast vier Wochen waren wir hier, seit zwölf Tagen trank ich Nektar und ich wusste noch immer nicht, was wir tun sollten. Sie hatten sich alle geirrt. Hades, Dorion, Zeus, Zeo – ich würde diese verdammte Büchse niemals finden. Wie viel Zeit blieb mir noch, bis ihnen das auffiel? Wie viele Tage, bis Hades mich zu sich rief oder Zeus mich auf irgendeine naturgewaltige Art bestrafen würde? Wie lange noch, bis ich den Preis für etwas zahlte, das ich nie gewollt und trotzdem verschuldet hatte?
Ich wusste längst nicht mehr, ob ich Angst davor hatte oder mich danach sehnte. Sollten diese arroganten Götter doch kommen und mich holen. Ich hatte schlechte Laune und ich hatte große Lust, sie an ihnen auszulassen.
Vielleicht blieb ich deswegen immer länger auf der ungeschützten Bergspitze. Wenn Zeus mich mit seinen Blitzen abwerfen wollte, sollte er es gern versuchen.
Trotz des pfeifenden Windes nahm ich ihn wahr, kaum dass er die Klippe erreicht hatte. Seit ich den Nektar trank, war Vespers Nähe noch intensiver spürbar. Seine Wärme kitzelte an meinem Nacken, obwohl er bestimmt noch zehn Meter von mir entfernt war. Ich konnte ihn sogar riechen, unter der beißenden Schneekälte lag diese vertraute Spur aus Moos, Sonnenwärme und Geborgenheit. Am liebsten wäre ich geradewegs über die Klippe gesprungen.
»Was soll das?« Seine Stimme wurde vom Wind auseinandergenommen, aber ich hörte sie trotzdem überdeutlich. So wie seine Schritte, die knirschend über die weiße Ebene auf mich zukamen.
»Was soll was?«, fragte ich zurück, ohne mich auch nur zu bewegen. Auf meinem Gesicht und meinen Armen hatte sich eine dünne Schneeschicht gebildet. Meine Jacke hatte ich noch auf der Veranda ausgezogen und achtlos in die Dünen geworfen.
»Du bist seit Stunden hier oben. Du warst nicht mal beim Frühstück.« Er kam näher.
Mein Körper spannte sich an, ich presste die Augen fest zu. »Na und? Was habe ich verpasst? Habt ihr euch darüber gestritten, wen ich dabei bin zu verraten? Habt ihr darüber abgestimmt, was ich tun soll? Was ich sagen und machen und wer zur Hölle ich sein soll, damit es euch und euren arroganten Götter-Chefs in den Kram passt?« Mit einem Ruck riss ich die Augen auf und fuhr zu ihm herum.
Vesper stand nur zwei Meter hinter mir. Der Schnee tanzte weiß um seine Silhouette herum – doch kaum dass er ihn berührte, schmolz er. Feine Wasserspuren, die über seine Haut liefen und die ich so unerträglich drängend wegwischen wollte. Das Grünbraun der Highlands in der Ferne zerlief hinter ihm zu einem unfertigen Aquarellgemälde. Es war so absurd und grausam: Die Welt verschwamm noch immer unter dem Schnee, aber Vesper blieb scharf gezeichnet. Meine Sinne fokussierten ihn und zersetzten ihn gleichzeitig in all jene Details, die ich seit Wochen zu vergessen versuchte. Es tat so weh, dass ich am liebsten geschrien hätte.
Stattdessen ballte ich die Hände zu Fäusten und konzentrierte mich auf das andere Gefühl in mir. Auf andere Weise schmerzhaft. Auf eine, mit der ich umgehen konnte. Wut. »Ich hab es so satt. Ich hab es satt, dass ihr mich alle als ein Mittel zum Zweck betrachtet. Als einen willenlosen Spürhund, der euch nützlich sein kann, wenn ihr mich auf die richtige Fährte setzt. Das war schon damals mit diesem bescheuerten Stein und dieser Prophezeiung anstrengend, aber jetzt ist es einfach nur beschissen. Ich bin nicht das, was ihr in mir seht, okay? Ich hab absolut keine Ahnung, wer ich überhaupt bin, aber ganz bestimmt bin ich kein verfluchter Kompass. Und mir reicht es jetzt, dass ihr mich alle permanent beobachtet und jeden meiner Schritte verfolgt. Ich habe das Gefühl, in diesem Haus zu ersticken. Ich bekomme keine Luft mehr. Ihr. Macht. Mich. Krank!« Die letzten Worte stieß ich nur noch heiser hervor.
Vesper betrachtete mich mit einer Seelenruhe, die das Kribbeln in mir nur verstärkte.
»Du bist wütend«, stellte er sachlich fest. Sein Atem schwebte in Wolken zwischen uns, so viel sichtbarer als meiner.
»Und du bist eine richtige Intelligenzbestie, seit du unsterblich bist. Bist du jetzt der neue Gott der Erkenntnis?« Ich lachte rau auf. Ein Ton, der über meine Kehle schabte, so heftig, dass ich glaubte Blut zu schmecken. Vielleicht lag das aber auch nur daran, wie oft ich mir in den letzten Tagen in die Wange gebissen hatte, um nicht vor Frust zu schreien.
Ungerührt kam er weiter auf mich zu. »Es ist gut, dass du wütend bist.«
»Findest du?«, schoss ich bissig zurück.
»Ja. Deine Kräfte …«
Ich stöhnte auf und drehte mich einmal im Kreis, ehe ich die Hände an die pochenden Schläfen presste und vor ihm zurückwich. Ich wusste, dass das überzogen war, alles irgendwie zu viel, aber genau das war ja der Punkt: Es war alles verdammt nochmal zu viel. »Gott, fang jetzt nicht wieder damit an. Es tut mir leid, dass mir keine Blitze aus den Augen schießen oder ich Menschen in Stein verwandeln kann, okay? Es tut mir echt leid, dass ich so eine verdammte Enttäuschung bin. Aber …«
»Bleib sofort stehen!«, fiel Vesper mir barsch ins Wort.
Eine weitere Hitzewelle flutete meine Muskeln. Meine Fingerknöchel knackten, als ich die Hände erneut zu Fäusten ballte. Mit noch größeren Schritten wich ich zurück. »Hör auf mir zu sagen, was ich …« Meine Stimme brach ab, als mein linker Fuß plötzlich in der Luft schwebte. Ich registrierte vage, dass ich das Ende der Klippe erreicht haben musste, aber da war es schon zu spät. Der Abgrund griff mit windgeschmückter Hand nach mir und zerrte mich zu sich. Ich wankte und gerade, als ich das Gefühl hatte zu fallen, spürte ich Vespers Hände auf mir.
Er packte mich an den Unterarmen und zog mich bestimmt nach vorn, direkt an seine Brust. Seine Nähe löschte alles andere aus. Auf einen Schlag war die unangenehme Hitze verblasst und eine weiche Wärme kroch über mein aufgerautes Inneres. Vesper zog mich mit sich zurück auf die Klippen, bis wir ein paar Meter entfernt vom Abgrund standen. Und auch dann ließ er mich nicht los. Die Finger in meine nackten Arme gegraben, sein Atem an meiner Stirn, sein Herzschlag auf meiner Haut, ein bisschen schneller und kräftiger als üblich. So viel Wärme, die stärker wehtat als die Kälte um mich herum.
»Beruhige dich, Lia«, sagte er leise, aber bestimmt.
Ich zuckte zusammen, weil es so ungewohnt war, meinen Namen aus seinem Mund zu hören. Beim letzten Mal, als er mich so genannt hatte, hatte der Name noch eine Bedeutung für ihn gehabt. Und zwar eine, die nicht mit Hass zusammenhing, sondern mit Liebe. Beim letzten Mal hingegen, als er mich so bewusst berührt hatte, war er kurz davor gewesen, mich umzubringen. Ich konnte nicht einmal sagen, welche der Erinnerungen grausamer war.
Hastig versuchte ich mich von ihm zu lösen, doch er festigte seinen Griff. »Ich werde dich erst loslassen, wenn ich mir sicher bin, dass du nicht über die Klippe springst«, raunte er mir zu. »Du wirst jetzt die Augen schließen und bis fünfzig zählen, verstanden? Und dann siehst du mich an und sagst mir, dass du deine Gefühle im Griff hast – und nicht sie dich.«
Ich biss die Zähne aufeinander, aber ich gehorchte. Versuchte Vespers schmerzhaft vertraute Nähe auszublenden und auf die Reste des Brennens in mir zu horchen. Sicherheitshalber zählte ich gleich bis siebzig, bis ich es wagte, die Augen zu öffnen.
Vespers Blick lag fokussiert auf mir, sein Gesicht nur zwei Fingerbreit von mir entfernt. Zu nah. Und doch viel zu weit weg.
»Okay«, flüsterte ich und senkte die flatternden Lider. »Ich habe es im Griff. Du kannst mich loslassen.«
Vesper sah mich noch einige Sekunden lang intensiv an, dann nahm er seine Hände langsam von mir. Sofort spürte ich die Kälte des Winters, die sich bereitwillig über mich hermachte. Mein Inneres fühlte sich vereist an, sodass ich es schaffte, halbwegs rational zu denken.
Ich presste die Handballen auf die Augäpfel. »Tut mir leid. Ich weiß nicht, was gerade los war, ich war nur so …«
»Wütend«, wiederholte er. »Ich weiß. Ich merke seit Tagen, wie es in dir brodelt. Ich hab mich schon gefragt, wann es ausbricht.«
Verzweifelt löste ich die Hände vom Gesicht und sah zu ihm auf. »Was ist los mit mir? Ich hab das Gefühl, ich stehe unter Strom. Ich bin so gereizt, dass ich für nichts garantieren kann, wenn ich mir nur noch ein einziges Mal anhören muss, wie Sadie einen Apfel isst.«
Vespers Mundwinkel zuckten schwach. »Sie kaut wirklich laut.«
Dieser winzige Versuch von Freundlichkeit machte es nur schlimmer. Tränen stiegen in meine Augen und verschleierten meine Sicht. »Was stimmt nicht mit mir, Vesper?«
Sofort wurde sein Gesichtsausdruck wieder ernst. »Deine Kräfte wachen auf. Du fühlst jetzt alles ein bisschen intensiver als vorher. Das ist ganz normal.«
»Es fühlt sich aber nicht normal an.« Wenn das hier das Dasein als Göttererbin war, dann wollte ich es sicher nicht haben. Lieber wollte ich meinen Schwindel zurück, meine Decke der Taubheit, die die Hälfte meiner Empfindungen verschluckt hatte. Das hier war zu intensiv. Zu anstrengend. Zu viel. Das war kein Leben, es war ein ständiges Aufpassen, um nicht auszurasten und die Einrichtung zu demolieren.
»Durch Apollons Macht waren deine Kräfte dein ganzes Leben lang blockiert. Das, was du als normal betrachtet hast, war eine verschleierte Version deines wahren Ichs. Du bist eine Erbin der Götter. Du musst dich nur erst daran gewöhnen, was das bedeutet.«
»Ich will gar nicht wissen, was das bedeutet.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust und umklammerte meine Ellbogen. Sie waren längst blau angelaufen und fühlten sich taub an. Ich wusste nicht, wie lange ich schon hier stand. Wenn ich das Frühstück verpasst hatte, musste es nach zehn Uhr sein. Ich war gegen sechs aus dem Haus gegangen. Jeder normale Mensch wäre sicher längst hier oben festgefroren. Gott, ich wünschte mir so, ich wäre normal.
»Und genau das ist das Problem«, erklärte Vesper weiter.
»Wie meinst du das?«
»Du wehrst dich dagegen. Gegen dich selbst. Aber du darfst keine Angst davor haben.«
Er berührte ganz leicht meine verkrampften Finger. Ertappt zuckte ich zusammen und erwiderte seinen aufmerksamen Blick.
»Welche Kräfte auch immer du in dir trägst, sie sind ein Teil von dir. Du kannst dich nicht vor ihnen verstecken und du solltest es erst gar nicht probieren. Wenn du versuchst sie zu unterdrücken, werden sie immer die Macht dazu haben, dich zu überwältigen. Wenn du dich ihnen stellst, kannst du lernen sie zu kontrollieren.«
Ich schluckte schwer. »Und was, wenn ich das nicht schaffe? Was, wenn das, was ich von … Hades geerbt habe, mächtiger ist als ich?«
»Dann sind wir hier, um dich aufzuhalten.« Es hätte eine Drohung sein können, aber seine Stimme und sein ganzer Gesichtsausdruck ließen es anders wirken. Das Stirnrunzeln war fort, dafür hatte sich ein sanftes Verständnis in seine Augen geschlichen. Etwas, das mich gefährlich an den alten Vesper erinnerte. Ich wich vorsichtshalber einen Schritt zurück. Vespers Nähe war verhängnisvoller als jeder Nektar.
Sekundenlang sahen wir einander nur an. Der Schneesturm hatte sich beruhigt und die Flocken fielen jetzt gemächlich in weichen Flocken auf die Erde. Für einen winzigen Moment war ich davon überzeugt, dass meine Unruhe den Sturm bewirkt hatte. Aber ich war keine Erbin des Windes, ich war die der Unterwelt. Wenn ich wirklich verborgene Fähigkeiten hätte, die gerade ausgebrochen wären, würde es jetzt vermutlich tote Vögel regnen. Allein bei dem Gedanken wurde mir so flau zumute, dass ich am liebsten auf die Knie gesunken wäre. Ich wollte so lange hier liegen bleiben, bis der Schnee mich unter sich begraben hatte. Doch ich wusste auch, dass das keine Option war. Vesper hatte recht: So ging es nicht weiter. Ich musste mich dem stellen, was ich war.
Beherrscht strich ich mir die Schneereste aus dem Gesicht und musterte Vesper. Die Winterluft hatte seine Wangen lediglich sacht gerötet, meine Nase hingegen lag als violett-roter Farbschemen in meinem Augenwinkel. Sein Shirt klebte feucht an seinem Körper, da er seine Jacke offen trug und sie sowieso zu dünn für diese Jahreszeit war. Der alte Vesper hätte sie mir trotzdem längst angeboten. Er wusste zwar besser als jeder andere, dass es mehr brauchte als eine Unterkühlung, damit sich eine Göttererbin erkältete, aber ihm war mit Sicherheit auch bewusst, dass die Kälte trotzdem schmerzhaft war. Dass er mich dennoch so schutzlos hier stehen ließ, tat weh und war in diesem Moment doch wichtiger als alles andere. Denn es machte mir deutlich, dass er genau derjenige war, den ich um das Folgende bitten konnte.
Ich machte einen Schritt auf ihn zu und hob das Kinn, um ihm direkt in die Augen zu sehen. »Dann versprich es mir!«, forderte ich. »Wenn ich etwas tue, das böse ist. Wenn ich zu einer Gefahr werde für euch oder die Menschheit an sich. Versprich mir, dass du mich aufhalten wirst. Ganz egal, was du dafür tun musst.«
Er blinzelte mehrmals. Da waren winzige Schneeflocken in seinen Wimpern, die dabei schmolzen. »Wieso bittest du ausgerechnet mich darum?«
Weil es dir egal ist, wenn ich friere. Und weil das bedeutet, dass ich dir egal bin. Weil du bereits einmal bereit warst mich umzubringen. Und weil ich weiß, dass du es nur zu gern wieder versuchen wirst, sobald ich den Zweck für deinen Gott erfüllt habe.
All das dachte ich, aber ich sagte nur: »Weil ich weiß, dass du zu deinem Wort stehst. Und weil ich weiß, dass dir die Sicherheit der Welt weitaus wichtiger ist als meine.«
»Richtig.« Er runzelte die Stirn und nickte dann langsam. »Ich verspreche es dir. Aber dann fang du endlich damit an, deine Bestimmung anzunehmen. Wenn du dich so davor verschließt, verurteilst du diese Mission von vorneherein zum Scheitern. Und damit bringst du uns alle in weitaus größere Gefahr, als du ahnst. Götter sind nicht geduldig. Nicht einmal mit denen, die auf ihrer Seite stehen. Gib dein Bestes, um uns zu helfen, dann gebe ich mein Bestes, dich dabei zu unterstützen. Und sobald du vom Weg abkommst, verspreche ich dir, dass ich dich aufhalte. Egal wie.«
Das war es, was ich hatte hören wollen, trotzdem raubte es mir kurz die Sprache. Das hier war derselbe Mensch, der vor wenigen Monaten geschworen hatte mir das Leben zu retten. Selbst als er erfahren hatte, wer ich war, hatte es für ihn keine Rolle gespielt. Er war für mich gestorben. Jetzt versprach er mir mich umzubringen, sobald ich zur Gefahr wurde. Und beide Male glaubte ich ihm. Wenn Vesper etwas versprach, dann weil er hundertprozentig dahinterstand. Ganz gleich, wie sehr wir beide uns verändert hatten – dessen war ich mir absolut sicher.
»Gut. Dann haben wir einen Deal«, erwiderte ich knapp.
Ehe er etwas erwidern konnte, wandte ich mich ab und ging an ihm vorbei, damit er nicht sehen konnte, dass sich in meinen Augen erneut Tränen sammelten. Er würde wissen, dass das kein Schnee war. Denn auch wenn er mich nicht mehr so ansah wie damals, sah er trotzdem noch so viel mehr von mir, als mir lieb war.
Vor einem Gott konnte man sich nicht verstecken. Schon gar nicht vor einem, der auf der Erde lebte.
***
Ich nahm die Anwesenheit der anderen im Haus wahr, als wir die Terrasse erreichten. Caleb war hinter dem Haus am Telefon, der Rest lungerte im Wohnbereich herum. Ich konnte ihre Gespräche nicht verstehen, aber ich spürte das angespannte Schwingen der Atmosphäre.
Mit flauem Gefühl folgte ich Vesper durch die Verandatür ins Innere. Leander und Clio lehnten an dem Tresen, der die Küchenzeile vom Esstisch abtrennte. Sadie und Chester standen an dessen Ende, Lex saß mit verschränkten Armen als einziger am Tisch, auf dem noch die Reste vom Frühstück standen. Sie alle verstummten, als Vesper und ich hineinkamen. Als dieser einen kurzen Blick mit Sadie tauschte und knapp nickte, verspannte ich mich noch mehr.
Ich konnte mich einfach nicht daran gewöhnen, dass die beiden neuerdings ständig einer Meinung waren. Seit Vesper wieder völlig auf Kurs mit Zeos Anweisungen stand, war Sadie auffällig oft in seiner Nähe. Ich hasste alles daran. Vor allem dieses winzige, grimmige Lächeln, das ihre Lippen durchzuckte, ehe sie sich an mich wandte. Dort angekommen wurde ihre Miene wieder von Kühle überschwemmt. »Wir müssen reden.«
Clio stieß sich vom Tresen ab und machte zwei Schritte auf mich zu. Ihr Blick glitt sorgenvoll an mir herab. »Kann das nicht warten? Sie ist total unterkühlt. Sie sollte duschen und sich umziehen und etwas essen und dann …«
Sadie schnitt ihr unwirsch das Wort ab. »Wenn sie da draußen stundenlang Eisprinzessin spielen will, ist das nicht mein Problem. Ihr Hang zum Drama geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf die Nerven.«
Ein feiner Schmerz schoss durch meinen Kiefer, als ich ihn fest aufeinanderpresste. Ich spürte Vespers Blick auf mir und als ich ihn erwiderte, neigte er leicht den Kopf. Die Botschaft war unmissverständlich: Bleib ruhig!
Beherrscht atmete ich aus und griff nach der Lehne des nächsten Stuhls. »Schon gut. Ich befürchte, dass ich an dem bisschen Schnee nicht sterben werde.« Ich setzte mich und lehnte mich provozierend gelassen zurück. »Dann beglücke mich mit deiner Weisheit. Ich bin sicher, was du zu sagen hast, kann nicht warten.«
Sie stützte die Hände auf der Tischplatte ab und neigte sich zu mir vor. »Das kann es wirklich nicht. Immerhin warten wir seit verdammten vier Wochen darauf, dass du irgendetwas hinbekommst. Aber alles, was du tust, ist es, finster in die Gegend zu starren und dich wie ein Fischstäbchen auf diese bescheuerten Klippen zu stellen.«