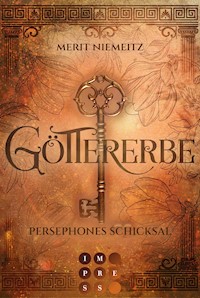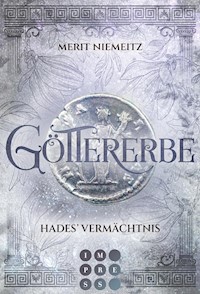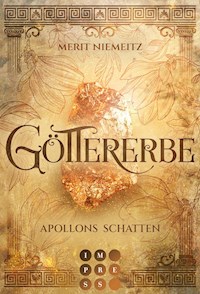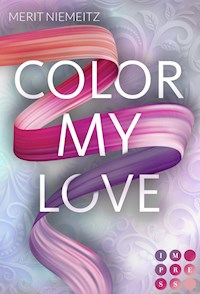9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mulberry Mansion
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Sie sind beste Freunde und Mitbewohner - oder doch mehr?
Willow und Maxton könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die lebensfrohe Willow auf jede Party geht, verbringt der ruhige Maxton lieber Zeit im Garten der Mulberry Mansion. Und doch verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Für Willow ist es daher selbstverständlich, dass sie Maxton dabei hilft, als er versucht, in die berüchtigte Studentenverbindung der Windsbury University aufgenommen zu werden. Dafür muss er sechs Prüfungen bestehen. Sechs Aufgaben in sechs Nächten, in denen Willow ganz neue Seiten an ihrem besten Freund entdeckt, die ihr Herz unerwartet schneller schlagen lassen. Doch auch Willow hat ein Geheimnis, von dem Maxton auf keinen Fall erfahren soll, und genau aus diesem Grund können sie niemals mehr als Freunde sein ...
»Tiefgründig, einfühlsam und so wahnsinnig echt ̶ die Geschichte von Willow und Maxton ist eine Erinnerung daran, dass nicht alle, die sich verloren fühlen, auch verloren bleiben.« CHARLIE_BOOKS
Band 3 der New-Adult-Reihe von Merit Niemeitz, der großen Entdeckung beim LYX-Pitch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Merit Niemeitz bei LYX
Impressum
MERIT NIEMEITZ
No Longer Alone
MULBERRY MANSION
Roman
Zu diesem Buch
Willow und Maxton. Maxton und Willow. In der Mulberry Mansion sind sie fast immer zusammen anzutreffen. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die lebensfrohe Willow ihr Collegeleben in vollen Zügen genießt und keine Party auslässt, verbringt der ruhige Landschaftsgestaltungsstudent seine Zeit lieber im Garten der Villa. Deshalb kann Willow nicht verstehen, warum Maxton auf einmal versucht, in die Silent Storms Society aufgenommen zu werden – hat die berühmt-berüchtigt Studentenverbindung der Windsbury University doch einen eher zweifelhaften Ruf. Dennoch ist es für sie selbstverständlich, dass sie ihren besten Freund unterstützt. In sechs Nächten soll Maxton dafür sechs waghalsige Prüfungen bestehen, bei denen Willow ihn plötzlich von einer ganz anderen Seite kennenlernt, die ihr Herz unerwartet schneller schlagen lässt. Bals muss sie sich die Frage stellen, ob das zwischen ihnen nicht schon immer über reine Freundschaft hinausging. Doch auch Willow hat ein Geheimnis, das sie vor Maxton verbirgt. Und genau aus diesem Grund können die beiden nie mehr als Freunde sein …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Merit und euer LYX-Verlag
Für Theresa.
Für diese eine Februarnacht, ohne die es dieses Buch nicht geben würde. Und für unser allerbestes Manchmal.
Playlist
Curls – Bibio
Me And I, Hand In Hand – Benjamin Amaru
Dark Four Door – Billy Raffoul
Nothing To Me – AVEC
I’m with You – Vance Joy
The Walls Are Way Too Thin – Holly Humberstone
Thought It’d Be Easy – Emanuel
that way – Tate McRae, Jeremy Zucker
The Girl With No Eyes – LOKI
Next to You – John Vincent III
Would That I – Hozier
I’ll Still Have Me – Cyn
tonight – LIE NING
Habits – Genevieve Stokes
Mess It Up – Gracie Abrams
Close Behind – Noah Kahan
Fire – MAVICA
i miss myself – renforshort
TV – Billie Eilish
Weird Goodbyes – The National, Bon Iver
this is me trying – Taylor Swift
Caves – Gregory Alan Isakov
Smiling All The Way Back Home – Tom Odell
It’s Been a Year – Tom Rosenthal
Petrichor – Keaton Henson, Ren Ford
Du wurdest auserwählt für eine Chance auf die Ewigkeit
Dir wird hiermit die Ehre zuteil, an den diesjährigen Herausforderungen der Silent Storms Society teilzunehmen, um ein Mitglied unserer Studentenverbindung zu werden.
Wer wir waren:
In der griechischen Mythologie gibt es eine Ära, die der der Götter vorhergeht. Eine Ära, die wir heute als Goldenes Zeitalter beschreiben, da sie nie wieder in ihrer Herrlichkeit übertroffen wurde. Sie wurde regiert von den zwölf Titanen: sechs männlichen und sechs weiblichen Gottheiten, die noch mächtiger waren als jene, die ihnen folgten. Heute symbolisieren diese sechs männlichen Titanen für uns jene Anführer, die dafür auserkoren waren, sich dem gewöhnlichen Leben zu entziehen und etwas Größeres – etwas Ewiges – zu erleben. Ein Dasein ohne Angst, ohne Schwäche, ohne Probleme, ohne Irrelevanz, ohne Vergehen.
Wer wir sind:
Die Silent Storms Society wurde 1819 von unseren sechs Gründerbrüdern ins Leben gerufen, um in die Fußstapfen jener Titanen zu treten. Sie bildeten eine Einheit, die seither das Beste der Windsbury University vereinigt und weit über den Universitätsabschluss hinaus zusammenhält. Insgesamt verbindet die Society mehrere Hundert ehemalige Mitglieder, welche in allen bedeutenden Bereichen der britischen Gesellschaft wirken und einander durch unerschütterliche Brüderlichkeit ein Leben voller Chancen ermöglichen.
Wer du sein könntest:
Du wurdest auserkoren, an den diesjährigen Herausforderungen teilzunehmen, da wir in dir das Potenzial sehen, einer von uns zu werden. Um dies zu beweisen, werden wir dich im kommenden Semester vor sechs Prüfungen stellen, durch die du gesellschaftliche und persönliche Grenzen überwinden musst. Das Meistern dieser qualifiziert dich für eine Mitgliedschaft – letztlich entscheiden jedoch wir, ob du geeignet bist, in unseren Kreis einzutreten.
Sechs Titanen, sechs Anwärter, sechs Prüfungen und eine Chance, einer von uns zu werden.
Δείξε μου τους φίλους σου και θα σου πω ποιός είσαι.
Zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist.
Zeig uns, wer du bist: Erweist du dich im Jetzt als würdig genug für eine Ewigkeit mit uns?
Silent Storms Society
Windsbury University
1. Kapitel
WILLOW
Ich fing an, Nächte zu lieben, als ich das erste Mal von der Wolfsstunde hörte.
Mein Vater war derjenige, der das Wort damals mir gegenüber benutzt hatte. Ich war vierzehn, als ich mir nachts gegen halb vier ein Glas Wasser aus der Küche holen wollte und ihn am Küchentisch sitzen sah. Mit einer Tasse Tee vor sich, dessen Dampffäden den schwermütigen Ausdruck auf seinem Gesicht halbwegs verschleierten. Als ich ihn fragte, warum er noch wach war, lächelte er auf diese gebrochene Weise und sagte: »Das ist die Wolfsstunde. Vielleicht bin ich jetzt ein einsamer Wolf.«
Ich hatte es gehasst, ihn so traurig zu sehen, aber dieses Wort, das hatte ich auf Anhieb geliebt. Denn anders als Dad dachte ich bei Wölfen nicht an Einsamkeit. Ich dachte an den vollen weißen Mond, der eine Sonne für die war, die nicht auf die Wärme anderer angewiesen waren, und ich dachte an die Art von Rennen, bei der man so schnell war, dass man sich selbst zurückließ.
Ich dachte an Freiheit.
Der Begriff »Wolfsstunde« bezeichnet die Zeitspanne von drei bis vier Uhr nachts, in der viele Menschen aufwachen und Probleme damit haben, wieder einzuschlafen. Die Ursache dieser Schlafstörung liegt im Hormonspiegel, der um diese Uhrzeit so durcheinandergerät, dass negative Gedanken hartnäckiger an die Oberfläche kommen und sich dort festbeißen können. Der Name wiederum, den Forschende ihr gegeben haben, beruht darauf, dass man früher davon ausgegangen war, dass zu dieser Uhrzeit mehr Wölfe als Menschen auf den Straßen unterwegs waren.
Die letzten Jahre hatten mich gelehrt, dass das auf schräge Weise stimmte. Menschen benahmen sich anders bei Nacht. Ungefilterter, roher, ehrlicher. Als hätten sie keine Angst davor, sich nackt zu zeigen, weil es sowieso dunkel war. Manchmal war das gut, manchmal eher weniger.
Ich schlüpfte durch das Tor, das die Mulberry Mansion von der Straße abgrenzte, und rieb mir genervt über den Hals. Die Stelle über meiner Schlagader wummerte. Ich brauchte keinen Spiegel, um zu wissen, dass sich die Haut bereits verfärbte. Ein fransiges Mal aus Rot und Blau und Falsch, Falsch, Falsch. Knutschfleck sagten manche dazu, Liebesfleck andere, Brandmarkung ich.
Ich hasste es, wenn Männer dachten, bedeutungsloser Sex würde ihnen erlauben, Abdrücke auf mir hinterlassen zu dürfen. Als wollten sie unbedingt dafür sorgen, dass etwas von ihnen an mir haften blieb, wenn ich schon klarmachte, dass alles andere eine einmalige, flüchtige Sache war. Hätte dieser Vollidiot mir vorher zugehört, als ich gesagt hatte, dass ich solche Spielchen nicht mochte, hätte ich mich nicht dazu gezwungen gesehen, unseren Abend vorzeitig zu beenden.
Es war so komisch: Die meisten Typen fühlten sich offenbar herausgefordert, wenn man von vornherein klare Regeln aufstellte. Ich sagte Sachen wie: »Ich will nicht über persönliche Dinge sprechen, ich will nicht darüber diskutieren, ob ein Kondom nötig ist, wenn ich eh die Pille nehme, ich will nicht unten sein, ich will nicht, dass du mich so grob anfasst, dass ich morgen noch irgendwas davon sehe, ich will nicht, dass du nach meiner Nummer fragst, ich will nicht, dass du mich hiernach wochenlang in der Uni anstarrst mit diesem trägen Schlafzimmerlächeln, das einfach nur peinlich aussieht. Ich. Will. Nicht.«
Die Kerle hörten zu, nickten, antworteten: »Ja, klar, kein Problem, alles, was du willst.« Und insgeheim dachten sich vier von fünf: »Haha, ich wette, du überlegst dir das noch anders.«
Anders konnte ich mir nicht erklären, dass Aron es gerade für nötig gehalten hatte, sich so heftig an meinem Hals festzusaugen, dass ich mir die nächsten Tage keinen Zopf würde machen können. Sein Pech. Denn wenn jemand ignorierte, was ich wollte, war meine Antwort jedes Mal dieselbe: »Haha, ich wette, du siehst mich nie wieder.«
Missmutig stapfte ich auf das Gebäude zu, das sich wie der buckelige Körper einer alten Frau hinter den Maulbeerbäumen erhob. Das Mondlicht wurde schwach in den Scheiben reflektiert, ansonsten war die Fassade dunkel.
Der Anblick ließ meine Wut abklingen. Nachts löste er immer ein seltsam intensives Gefühl von Zuneigung in mir aus, vielleicht, weil ich die Villa so zum ersten Mal gesehen hatte. An dem Abend, nachdem die Universität die Zusagen für das Wohnprojekt rund um die Mulberry Mansion verschickt hatte, waren Maxton und ich zusammen hergekommen. Wir hatten eine Ewigkeit schweigend auf dem Kiesplatz vor der Haustür gestanden und dieses riesige und trotzdem gemütlich wirkende Gebäude betrachtet, das bald unser neues Zuhause werden sollte. Es war so bemerkenswert gewesen. Ein bisschen heruntergekommen, angeknackst und verwahrlost – aber durch und durch einzigartig und charakterstark. Und genau das hatte ich von Anfang an gemocht.
Das war über ein Jahr her, und obwohl wir viel an der Mulberry Mansion gearbeitet hatten, hatte sie sich ihren Charakter erhalten – zum Glück. Unsere Villa war eine unperfekte Schönheit, und ich liebte jede Macke an ihr mehr als jeden gerade sitzenden Stein. Ich liebte die undichten Fenster, durch die es ab und zu reinregnete, die zugigen Flure, in denen das Holz ächzte, als wäre jeder unserer Schritte eine Zumutung, die dunklen, rissigen Tapeten, die Ornamente an den Decken, deren Farbe verblasste, die Samtmöbel, deren Polster längst aufgeraut waren. Sie war absolut makelhaft, sie war genau richtig.
Je näher ich der Mulberry Mansion kam, desto mehr zerfransten ihre Umrisse im Himmel, als hätte jemand sie mit Tinte auf Pergament gezeichnet. Aber womöglich lag das auch nur an den Drinks, die ich im Cinematic getrunken hatte, bevor ich mit Aron zu ihm gegangen war. An der Haustür zögerte ich. Es war halb vier, mitten in der Wolfsstunde, und ich wusste, dass die meisten meiner Mitbewohnenden schon schliefen. Mit einer Ausnahme vielleicht.
Kurz entschlossen stieg ich die Stufen vor der Tür wieder hinab und lief am Haus vorbei in den Garten. Die Nacht verschluckte seine warmen Farben, die er sich auf dem Weg zum Herbst hin angeeignet hatte, doch man konnte sie noch riechen: das Rot der Dahlien, das Gelb der Rudbeckien, das Lila der Astern. Und natürlich das Grün, das einen umschlang, kaum dass man ein paar Schritte ins weiche Gras getan hatte. Es war Mitte September, und der Sommer schleppte sich mit trägen Schritten durch Windsbury, kurz davor, stehen zu bleiben und sich in einen goldgelben Frühherbst zu verwandeln. Selbst nachts waren es noch fast zehn Grad, dennoch fröstelte ich. Mein Top war feucht vom Tanzen, und meine dünne Jacke bot keinen Schutz gegen den Wind, der durch die Zweige der Bäume hindurchwehte.
Ich machte diesen Abstecher so gut wie immer, wenn ich nachts nach Hause kam. Nicht, weil ich mich dem Garten so verbunden fühlte, sondern weil ich in den meisten Fällen nicht die einzige nächtliche Besucherin war. Bei den wenigen Ausnahmen, in denen ich ihn hier nicht finden konnte, machte ich einen zweiten Abstecher in das Zimmer, das an meines grenzte. Ich war nicht sicher, wann oder warum das angefangen hatte, ich wusste nur, dass ich schlecht schlief, wenn ich es nicht tat.
Ich schob die Zweige eines Apfelbaums auseinander, hinter denen sich der Pavillon aus einem Nest aus Gras und mehreren Haselnusssträuchern erhob. In einiger Entfernung standen die Kalkstatuen: weiße reglose Schemen, von denen ich mich jedes Mal beobachtet fühlte, wenn ich an ihnen vorbeilief. Mit zusammengekniffenen Augen fokussierte ich mich auf den Pavillon. Letztes Jahr hatten wir mehrere der Säulen ersetzen müssen, weswegen sie sich in Farbe und Material minimal unterschieden. Im Nachtschwarz waren die Umrisse verschieden hell, jedoch allesamt leuchtender als der der Person, die auf den Stufen saß.
Ein erleichtertes Grinsen schob sich auf meinen Mund. »Na, Dracula?«
Maxton drehte den Kopf zu mir, nicht im Geringsten überrascht wirkend. Wir redeten nie darüber, dass wir uns so oft hier draußen trafen, wenn ich heimkam, aber manchmal fragte ich mich, ob er auch darauf wartete. Auf mich.
»Du bist heute früh dran«, stellte er fest, als ich mich mit etwas Abstand neben ihn setzte. Seine Stimme klang heiser, vermutlich war er seit Stunden hier, ohne einen Ton von sich gegeben zu haben.
Maxton konnte so still und in sich ruhend sein, dass die Zeit schlichtweg vergaß, ihn mitzunehmen. Sie perlte an ihm ab, als wäre er kein Teil von ihrem Einflussgebiet. Er kam regelmäßig zu spät zu Verabredungen, weil er über seinen Zeichnungen saß, er verpasste seine Haltestellen, weil er im Bus in einem seiner komischen Botanik-Bücher versank, und wenn wir alle zusammen essen wollten, musste ich ihn ständig im Garten aufsammeln. Einmal war ich mit ihm in einem Pflanzencenter und letztlich kurz davor gewesen, ihn ausrufen zu lassen, weil er zur verabredeten Zeit weder bei den Kassen aufgetaucht noch ans Handy gegangen war. Schließlich hatte ich ihn zwischen meterhohen Baumsetzlingen gefunden, wo er mit hoch konzentrierter Miene Blätter gestreichelt hatte.
»Wie kommt’s?«, hakte er jetzt nach, als ich nicht auf seine Bemerkung einging. Aus gutem Grund. Ich machte keinen Hehl daraus, wo oder wie ich meine Nächte verbrachte, aber ausführlich darüber reden musste ich auch nicht. Zumindest nicht vor Maxton. Er war nicht der Typ für diese Art von Detailbericht.
Ich seufzte theatralisch. »Die Party war lahm. Nicht genügend Intellekt, um mich unterhalten zu können. Das kommt davon, wenn du mich nie begleitest.«
»Verstehe.« Trotz des schalen Mondlichts sah ich, wie sein Blick über mein Gesicht strich und an meinem Hals innehielt. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, und ich wusste, dass er es wirklich verstand.
Maxton war einer dieser Menschen, die Details wahrnahmen, die anderen verborgen blieben. Ich fragte mich manchmal, ob das daran lag, dass er seine Freizeit größtenteils mit Pflanzen verbrachte. Das ganze Grünzeug, mit dem er sich umgab, teilte seine Bedürfnisse auf ziemlich stille Art mit, aber Maxton verstand es, als würde es ihn in einer Geheimsprache anschreien. Er konnte völlig gleich aussehende Samen anhand ihrer Schale auseinanderhalten, winzige Schädlinge auf den ersten Blick bestimmen und einzelne Blätter komplizierten lateinische Begriffen zuordnen. Wenn Maxton Pflanzen beobachtete, dann lag in seinen Augen wirklich diese greifbare Achtung – in doppelter Hinsicht: Vorsicht und Wertschätzung in Reinform. Er nahm Dinge wachsamer und genauer wahr als andere. Er sah viel mehr als andere. Etwas, das ich mochte und oft irgendwie auch hasste. Denn manchmal sah er zu viel.
Beiläufig strich ich mir die Locken über die Schultern, sodass sie meinen Hals bedeckten, doch da wandte Maxton sich schon wieder ab und blickte hinaus in den Garten. Ich rutschte mit dem Rücken gegen die Säule und verschränkte die Arme vor der Brust, damit er nicht bemerkte, dass ich eine Gänsehaut hatte. Er würde mir seine Sweatjacke anbieten, ich ablehnen, er es nicht kommentieren, aber kurz zögern, worin ich einen Gedanken erahnen konnte, was mich dazu bringen würde, irgendwas Albernes zu sagen, damit er ihn nicht vertiefen konnte.
So war das mit Maxton und mir. Wir waren seit über zwei Jahren befreundet, und es gab niemanden, mit dem ich so viel sprach wie mit ihm, aber viel bedeutete nicht immer, und es bedeutete nicht über alles. Manche Dinge machte ich nicht mal mit mir selbst aus – dann ganz sicher nicht mit einem anderen Menschen. Unsere Freundschaft war ein hell beleuchtetes Zimmer mit stockfinsteren Ecken, und das war auch gut so.
Vielleicht waren Nächte deswegen unser Ding. Weil das mit den Schatten etwas war, das uns beiden lag. Wolfsstunden waren das, was wir teilten, und das, was unsere Unterschiede am meisten hervorhob. Weil ich jemand war, dem die Straßen um diese Uhrzeit gehörten und der sich nirgends so wohlfühlte wie in diesen dunklen Momenten, und er jemand, der eigentlich nichts mehr hier draußen verloren hatte und im Grunde auch nicht hier sein wollte.
Maxton war kein Wolf. Er war ein Mensch, dessen Körper das mit dem Biorhythmus irgendwie nicht ganz hinbekam. Seit ich ihn kannte, schlief er beschissen. Seit ich Wand an Wand mit ihm wohnte, wusste ich, wie beschissen. Es gab kaum eine Nacht, in der er vor mir ins Bett ging, und das, obwohl ich selten vor zwei das Licht ausmachte. Oft lag ich wach und konnte dabei zuhören, wie er in seinem Zimmer herumlief, und in den meisten Nächten öffnete sich seine Tür irgendwann. Ich war ihm nie gefolgt, doch manchmal ging ich auf den Balkon unseres Badezimmers und beobachtete ihn dabei, wie er das Haus über die Veranda verließ und im schwarzblauen Dickicht verschwand.
»Bist du immer noch wach oder schon wieder?«
Er zog die Füße eine Stufe höher. »Immer noch.«
Ich fragte nicht nach. Ein paarmal hatte ich das getan, ganz am Anfang, aber mittlerweile wusste ich, dass Maxton nicht darüber reden wollte, und das konnte mir nur recht sein.
Ich hatte meine dunklen Ecken, er seine. Und ein wichtiger Bestandteil unserer Freundschaft war: Wir richteten keine Taschenlampen dorthin, wo der andere bewusst kein Licht aufgestellt hatte.
»Du solltest aufhören, so viel Kaffee zu trinken, und stattdessen endlich den Baldrian nehmen, das ich dir besorgt habe«, meinte ich stattdessen, wissend, dass die Packung ungeöffnet auf seinem Schreibtisch lag, wo ich sie vor drei Wochen platziert hatte.
Maxton verdrehte die Augen. »Sag das nicht so, als wäre das eine Droge, die du für mich beschafft hast. Die Wirkung von Baldrian ist nicht mal wissenschaftlich nachgewiesen, genauso gut könnte ich mir Tic Tacs einwerfen.«
»Nur zu, vielleicht hilft es ja. Ist doch egal, ob Placebo-Effekt oder nicht.« Er sah mich unbeeindruckt an. Ich seufzte. »Meine Güte. Du bist manchmal so ein …«
»Realist?«, kam er mir trocken zur Hilfe.
»Griesgram«, korrigierte ich und musterte ihn erneut.
Neben seinem Schoß lag ein Notizbuch – Fake-Leder, dunkelgrün, rissiger Einband. Maxton schleppte ständig so eins mit sich herum, meistens, um zu zeichnen. Diesmal konnte ich keinen Stift entdecken, dafür ragte eine Papierecke mittendrin hervor. Ich kniff die Augen zusammen, gerade so, dass ich die feinen Ornamente darauf erkennen konnte. Ein Briefumschlag, ein ziemlich edler noch dazu.
»Was ist das?«
Auch ohne meinem Blick zu folgen, schien er zu spüren, was ich meinte. Mit einer Bewegung schob er die Ecke tiefer ins Buch. »Nichts Wichtiges.«
Ich verzog spöttisch den Mund. »Echt jetzt?«
Er kannte mich zu gut, um zu denken, dass ich darauf reinfiel. Maxton machte die Dinge gern mit sich aus, aber ich konnte ihm in der Regel anmerken, wenn ihn etwas belastete. In den meisten Fällen musste ich ihm nur ein bisschen auf die Nerven gehen, bevor er einknickte und es mir erzählte. Doch diesmal wusste ich noch bevor er antwortete, dass ich keine Chance hatte. Da war etwas in seinem Blick, das anders war als sonst. Eine leichte Gereiztheit, die nicht zu ihm passte.
»Echt jetzt«, erwiderte er ungerührt, ohne auch nur in meine Richtung zu sehen. Seine Finger hatten sich um die Ecke des Buchs geschlossen, als würde er damit rechnen, dass ich versuchte, es ihm wegzunehmen. Was ich zwar am liebsten getan hätte, aber nicht tun würde. Ich testete gern die Grenzen anderer aus, aber ich respektierte sie, wenn ich erkannte, dass sie standfest waren.
Mühsam schluckte ich alle Widerworte herunter. Auch wenn das etwas war, das mir wirklich nicht lag. Dunkle Ecken, beschwor ich mich und ließ den Kopf gegen die Säule sinken.
Eine Weile saßen wir still da, Maxton betrachtete den Garten aus Schattentönen, ich sein regloses Profil. Ein harter Zug bildete sich um seine Mundwinkel, die zwei Leberflecke im rechten waren in der Dunkelheit kaum auszumachen. Normalerweise verschwanden sie nur aus seinem Gesicht, wenn er lächelte. Normalerweise beruhigte es mich außerdem immer, mit Maxton zusammenzusitzen. Aber normalerweise strahlte er auch nicht diese unterschwellige Anspannung und gleichzeitig greifbare Verschlossenheit aus.
»Du bist irgendwie komisch in letzter Zeit«, stellte ich fest. »So … schweigsam.«
»Falls es dir in den letzten Jahren nicht aufgefallen ist: Du bist der kommunikativere Part von uns beiden.«
Ich schnaubte. »Trotzdem. Du wirkst abwesend seit ein paar Wochen. Vielleicht hängst du zu viel mit Eden rum. Grübeltum färbt bestimmt ab.«
»Grübeltum ist kein Wort.«
»Ablenkung aber schon.« Ich stieß ihm mit der Schuhspitze gegen den Fußknöchel. Er war wieder mal barfuß, und das, obwohl das Gras feucht war.
Sichtlich widerwillig wandte er mir das Gesicht zu. »Es ist alles gut. Bin nur gestresst wegen der Uni und allem.«
Ich nickte langsam. Die Uni hatte erst diese Woche wieder angefangen, aber sie beeilte sich jedes Semester mehr, die Ferienentspannung zu vernichten. Für Maxton brach die zweite Hälfte des Masters an. Obwohl er seine Kursverteilung über die Semester gestreckt hatte, um mehr Zeit für den Garten der Villa zu haben, blieben ihm nur noch anderthalb Jahre. Eine Tatsache, die ihn vielleicht mehr beschäftigte, als er bisher hatte durchscheinen lassen. Genauso gut konnte es aber auch sein, dass ihn irgendetwas ganz anderes belastete. Maxton gut zureden zu wollen war oft mit ziemlichem Herumstochern im Dunkeln verbunden.
»Wird schon alles«, meinte ich trotzdem betont positiv. »Bald bist du durch, kannst losziehen und bei Gartenwettbewerben in aller Welt abräumen.«
»Ja«, sagte er nur.
Ein paar Sekunden lang beobachtete ich ihn wachsam, dann gab ich mir einen Ruck und erhob mich. »Okay, gut. Ich merke, wenn ich unerwünscht bin. Dann lass ich dich jetzt mal allein mit deinen grünen Freunden und versuche, die Schmach zu überspielen, die ich empfinde, weil ich durchaus spüre, dass du sie lieber hast als mich.«
Ich war schon mit ein paar Schritten im Gras, da hielt mich seine Stimme zurück. »Catkin?«
Ich stöhnte, aber war zu müde, um mit ihm darüber zu diskutieren, dass ich verdammt noch mal nichts mit einem Weidenkätzchen gemein hatte, nur weil meine Eltern mich nach einem Baum benannt hatten. Maxton hatte mir diesen absolut dämlichen Spitznamen verpasst, als er mich das erste Mal in meiner flauschigen Samtjacke gesehen hatte, und trotz ziemlich kreativer Gewaltandrohung ließ er sich seitdem nicht davon abbringen, ihn zu benutzen.
»Was ist?« Mit hochgezogenen Augenbrauen drehte ich mich zu ihm um. Sein Blick lag nicht mehr auf dem Garten, sondern auf mir. Direkt auf meinem Hals. Und obwohl meine Locken eine schützende Schicht aus Goldblond zwischen seinen Augen und dem dumpf pochenden Bluterguss bildeten, glaubte ich trotzdem, sie darauf zu spüren.
»Passt du auf dich auf?«
Ich verzog keine Miene. »Hab immer Kondome dabei.«
»Du weißt, was ich meine.«
Wir sprachen nie über diese Dinge, doch mir war klar, dass Maxton wusste, was ich tat, wenn ich ausging und oft erst morgens heimkam. Es störte mich nicht, warum auch, aber ich mochte es trotzdem nicht, wenn er mich so ansah. So … nachdenklich. Dabei hatte meine Abendgestaltung in der Regel nichts mit Denken zu tun, nur mit Fühlen. Ich machte, was ich wollte, und ich wollte, was ich machte, und wenn ich etwas nicht wollte, brach ich es ab. So einfach war das mit mir und den Nächten, den Tagen, dem Leben.
Ich hätte ihm sagen können, dass es ihn nichts anging, dass ich allein klarkam. Bei jedem anderen hätte ich das getan, und auch nach zwei Jahren Freundschaft mit Maxton konnte ich dem Impuls ab und zu nicht widerstehen. Doch egal, wie ruppig und unfreundlich ich werden konnte, Maxton hörte nicht auf, diese Dinge zu fragen. Immer neutral, nie vorwurfsvoll oder angreifend, sehr subtil verpackte Sorge.
Also bemühte ich mich diesmal auch um Gelassenheit in Buchstabenform und sagte schlicht: »Ich lass mir nicht wehtun, Max. Von niemandem.«
»Ja«, sein Blick glitt an mir vorbei, »ich weiß.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und hob das Kinn. »Dir lass ich auch nicht wehtun, das weißt du ebenso, oder? Wenn Eden dich doch zu einem Schweigegelübde oder so gezwungen hat, sag mir Bescheid, und ich reiße seinen Lieblingsbüchern vor seinen Augen die Seiten raus, bis er dich daraus entlässt.«
Maxton seufzte. »Gute Nacht, Willow.« Da war ein sachtes Heben seiner Mundwinkel. Genug, um ein Grinsen auf meine Lippen zu schieben.
»Gute Nacht, Maxton.« Ich deutete eine Verbeugung an, ehe ich zwischen den Zweigen des Apfelbaums verschwand.
Es war seltsam: In Märchen und in der Mythologie galt der Wolf oftmals als Symbol der Grausamkeit. Aber nachdem ich eine seiner Stunden mit Maxton verbracht hatte, fühlte ich mich meistens so friedlich wie sonst nie.
2. Kapitel
WILLOW
Ein pastellvioletter Schleier hing über den abgeernteten Feldern, als ich aus dem Bus stieg. Mittlerweile hatte ich mich an die kleine Wanderung zwischen der Haltestelle und der Mulberry Mansion gewöhnt. Etwa nach der Hälfte der Strecke gabelte sich der Weg zu einem kiesigen Pfad, der an den Feldern entlang in Richtung Villa führte, und zu einem Gatter, hinter dem sich ein an den Wald angrenzendes, ungepflegtes Grundstück auftat, durch das man deutlich schneller zum Haus kam.
Ich warf einen prüfenden Blick über meine Schulter, dann stemmte ich mich mit beiden Händen am Gatter hoch, schwang die Beine über das Holz und landete auf der anderen Seite prompt in einer schlammigen Pfütze.
Immerhin vervollständigten die Spritzer auf meiner Jeans mein Outfit: Mein ehemals weißes T-Shirt war nämlich seit gut einer Stunde mit dem grünen Handabdruck eines Siebenjährigen verziert. Ein ganz gewöhnliches Mitbringsel von einem Nachmittag im Hort.
Ich hatte diesen Nebenjob schon lang genug, um zu wissen, dass es ein Fehler war, dafür saubere Sachen anzuziehen. Eigentlich war ich als Lernassistenz eingestellt worden, insbesondere für die Kinder mit Lernschwächen wie Dyskalkulie und Legasthenie. Laut Vertrag bestand meine Arbeit darin, mit ihnen Inhalte aus dem Unterricht zu wiederholen, für deren Verinnerlichung sie eine andere und intensivere Herangehensweise benötigten als andere. Trotzdem ließ ich mich von den Kindern am Ende meiner Schicht so gut wie jedes Mal dazu überreden, noch zum Spielen zu bleiben.
Ich liebte diese Arbeit. Kinder waren direkt, ehrlich und einfach sie selbst, weil die Welt noch nicht genug Zeit gehabt hatte, sie in eine Form zu pressen. Vielleicht spürte ich deswegen einen so ungebändigten Respekt für sie – weit mehr als für viele Erwachsene.
Um ehrlich zu sein, hatte ich mein Studium damals relativ willkürlich ausgesucht, als ich nach Windsbury gekommen war. Ich hatte keine Ahnung gehabt, was ich tun wollte, und mir deswegen die Studiengänge ohne schwierige Bewerbungsbedingungen angesehen. Mein Blick war sofort an Sonderpädagogik hängen geblieben – oder eher mein Herz. Kindern, die in irgendeiner Form der sogenannten Norm entfielen, wurde so oft von der Welt weisgemacht, sie wären zu kompliziert oder zu … viel. Die Aussicht, mit ihnen arbeiten und zeigen zu können, dass das ein Fehler der Welt war und nicht ihrer, gab mir zum ersten Mal seit Langem das Gefühl, etwas bewirken zu können. Ich war noch nicht sicher, was genau ich mit dem Abschluss machen wollte, aber je länger ich im Hort arbeitete, desto sicherer war ich, auf dem richtigen Weg zu sein.
Ich schloss die Cordjacke über der getrockneten Farbe und lief um die nächste Pfütze herum. Manchmal versuchte ich, die anderen von dieser Abkürzung zu überzeugen, doch meistens stieß ich dabei auf Widerstand. Helen und Avery wurden davon abgeschreckt, dass an dem Gatter »Privatweg« stand, May hatte Sorge, den Besitzern Umstände zu bereiten, wenn sie über ihr – wohlbemerkt völligunbewohntes – Grundstück lief, Beckett und Sienna würden es nicht zugeben, hatten aber definitiv zu viel Angst, in einem Sumpf stecken zu bleiben, und Eden … ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals allein mit ihm in einer solchen Situation gewesen zu sein. Obwohl ich ihn neben Maxton am längsten von allen meiner Mitbewohnenden kannte, hatte ich das Gefühl, ihn am wenigsten zu kennen. Zeit hatte nicht zwangsläufig etwas mit Intensität zu tun, und obwohl wir uns seit gut zweieinhalb Jahren gelegentlich sahen und seit über einem Jahr zusammenwohnten, hatten Eden und ich ein recht oberflächliches Verhältnis. Immerhin hatte er seine Kommunikation uns gegenüber in den letzten Monaten zunehmend über die Zwei-Wort-Grenze hinaus erweitert, doch selbst jetzt hatte ich nicht das Gefühl, unseren Buchjungen richtig zu verstehen. Am Anfang hatte mich das frustriert, mittlerweile hatte ich mich damit abgefunden.
Manchmal stellte ich mir vor, dass man mit jedem Menschen, den man traf, in ein eigenes Wasserbecken sprang. Es gab die, mit denen man auch nach Jahren der Bekanntschaft an der Oberfläche schwamm, in so weiten Kreisen umeinander herum, dass man nicht Gefahr lief, einander auch nur zu streifen. Diese Beziehungen waren unkomplizierter, aber auch unbedeutender. Sie hinterließen keine Spuren, wenn man das Becken wieder verließ. Die Erinnerungen an sie verblassten so schnell wie Wasserabdrücke auf Bikinistoff.
Ab und zu wünschte ich mir, es gäbe nur diese Art von Bekanntschaften. Aber die anderen Fälle waren trotzdem da: die, bei denen im Bruchteil eines Moments beide entschieden, unterzutauchen. Einfach so, ohne unsicheres umeinander Herumschwimmen, ohne tiefes Luftholen, ohne Schwimmflügel oder Sauerstoffmaske. Ohne Angst.
Mit manchen Menschen war Tauchen ein Instinkt. Dieses Gefühl war intensiv, fast berauschend und verdammt gefährlich. Ich wusste, was passieren konnte, wenn man ihm nachgab. Wie schmal der Grat zwischen Tauchen und Untergehen war. Was es einen kosten konnte, dieses Risiko einzugehen. Je tiefer man sank, desto schwieriger war es, sich an den Weg zur Oberfläche zu erinnern und mit ihr an die Möglichkeit, das Becken zu verlassen. Und das Schlimmste war: Wenn man erst einmal den Boden berührt hatte, ließ man einen Teil von sich dort, selbst dann, wenn man es zurück nach oben geschafft hatte. Genau deswegen hielt ich mich seit Jahren in den meisten meiner Becken am Rand fest – insbesondere in denen, worin ich den Drang zu tauchen am stärksten verspürte. Ich war eine Meisterin der Oberflächenfreundschaften geworden, indem ich gelernt hatte, für andere da zu sein, ohne mich selbst herzugeben. Nur in einem Becken hatte ich mich sinken lassen, nicht bis nach unten, aber deutlich tiefer als sonst. Es war keine bewusste Entscheidung gewesen. Mit Maxton waren die Dinge einfach von Anfang an so gewesen, wie sie eben waren. Anders.
Vielleicht hatte es mich deswegen nie überrascht, dass er der Einzige war, der immer einwilligte, diese Abkürzung zu nehmen. Jedes Mal hielt er am Zaun inne, um sich Schuhe und Socken auszuziehen, jedes Mal erklärte er mir auf dem Weg, welche Pflanzen um uns herum wuchsen, jedes Mal vergaß ich ihre Namen, bis wir durch das Tor auf der anderen Seite gegangen waren, aber nie, wie zufrieden er dabei aussah, wenn er die komplizierten Begriffe nannte. Ich sagte das nie laut, aber diese Male mit ihm, das waren die besten Male.
Sobald ich am Weiher vorbeikam, an dem einige meiner Namensvetterbäume standen, beschloss ich, Maxton zu schreiben. Als ich die App öffnete, wurden mir neue Nachrichten in drei Chats angezeigt. Eine von meiner Kommilitonin Lauren: Paul (du weißt schon: groß, blond, Gitarrist in einer Band, uuunverschämt heiß) hat mich nach deiner Nummer gefragt. Hab sie ihm gegeben, denke, das war in deinem Interesse? Eine von besagtem Paul, einem Freund von Lauren, den ich letztes Wochenende beim Feiern kennengelernt und mit dem ich maximal fünf Minuten geredet hatte, bestehend aus einem Hey und einem nichtssagenden Smiley.
Ich beschloss, es auf später zu verschieben, beiden zu antworten. Lauren, dass es egal war, wie heiß jemand war, sie mich dennoch fragen musste, bevor sie meine Nummer rausgab; Paul, dass er, was auch immer er gerade dachte, es vergessen konnte. Ich traf mich nicht mit Freunden von meinen Freunden. Das würde nämlich dazu führen, dass man sich weiterhin über den Weg laufen würde, nachdem die Dinge ihr unausweichliches Ende gefunden hatten.
Stattdessen öffnete ich die Nachricht von meinem Vater. Es war eine Antwort auf das Foto von dem Bild, das ich vorhin im Hort gemalt hatte, bevor ich mit Fingerfarbe attackiert worden war: eine sehr abstrakte Obstschüssel.
Ich speichere dich direkt als Willow Picasso Pierce ein.
Ich musste lachen und schickte ihm ein Herz zurück, ehe ich den Chat aufrief, der so gut wie immer ganz oben stand.
Bereit für eine neue Anekdote aus dem Hort? Kleiner Teaser: Was kommt heraus, wenn man Siebenjährige mit Fingerfarbe, ein weißes T-Shirt und mangelnde Autorität bei der Teamassistenz zusammenbringt?
Kaum dass ich die Nachricht abgeschickt hatte, kam Maxton online. Die Häkchen an meiner Nachricht färbten sich blau, und ich wartete auf die drei Punkte, die seine Antwort ankündigten. Stattdessen ging er einfach wieder offline.
Ich zog die Augenbrauen zusammen.
Sag nicht, dass dir dein Grünzeug wichtiger ist als diese nervenaufreibende Geschichte.
Diesmal kam er gar nicht mehr on, obwohl ich sicher war, dass er sein Handy vibrieren spürte. Maxton ignorierte mich nie bewusst. Er versuchte manchmal, mich mit halbherziger Genervtheit loszuwerden, aber er schickte mich nie wirklich weg. Ich hielt unter den Zweigen einer Buche inne, um eine weitere Nachricht zu tippen.
Okay, von mir aus. Brich mir ruhig das Herz. Ich werde mich mit einem wahnsinnig detaillierten Bericht heute Abend rächen, ich weiß nämlich, wo du wohnst, Craven!
Wenn ihm etwas eine Reaktion entlocken würde, dann das. Ebenso wenig wie ich seinen Spitznamen für mich, konnte Maxton meinen für ihn leiden. Seit ich eine Ausgabe von Der geheime Garten in seinem Zimmer gefunden hatte, neckte ich ihn manchmal mit dem Namen des Protagonisten Colin Craven. Dass craven außerdem feige bedeutete, war ein netter Bonus.
Ich war mir sicher, dass Maxton die Nachricht auf seinem Sperrbildschirm las, und konnte sein Augenverdrehen förmlich vor mir sehen, doch er blieb offline. Mit einem Schnauben drückte ich mir die Kopfhörer in die Ohren, wählte eine meiner Playlists aus, Sommerleichtigkeit, und machte mich auf den Weg zur Villa.
Es gab Gerüche, die man erst lieben lernte, wenn man sie mit Erinnerungen auflud. Früher hatte ich den Duft von Lavendel als kopfschmerzfördernd empfunden, aber seit ich in der Mulberry Mansion lebte, konnte ich an keinem Seifengeschäft mehr vorbeilaufen, ohne ein Gefühl von Behaglichkeit wahrzunehmen. Ich wusste, woran das lag: an den getrockneten Sträußchen, die May neben anderen Kräutern und Blumen überall im Haus verteilt hatte. Der Geruch, der durch die Flure schwebte, bestand aus so vielen Nuancen, dass ich sie kaum auseinanderhalten konnte. Zusammengesetzt ergaben sie eine einzigartige Mischung, die jedes Mal ein gleichermaßen flaues und weiches Gefühl in mir auslöste. Es roch so, wie sich ein Zuhause anfühlte.
Als ich die Villa heute betrat, wurde er allerdings überlagert von einem anderen Duft: dem von frisch gebackenem Kuchen. Mein Magen knurrte verräterisch, während ich meine Turnschuhe auszog und nachlässig auf den Haufen neben der Garderobe warf. Helen machte sich zwar ständig die Mühe, ein System hineinzubringen, doch meistens hielt das nur ein paar Tage an. Viel zu oft schlüpfte ich versehentlich in Averys abgetragene Sneakers oder Siennas Boots oder bemerkte erst an der Haustür, dass ich Becketts Jeansjacke trug, die denselben Farbton wie meine hatte.
Trotz sieben Mitbewohnenden wusste ich, noch bevor ich über die Schwelle der Küchentür trat, wen ich dort finden würde. Der Geruch von Kuchen war nach einem Jahr Zusammenwohnen unweigerlich an einen Namen geknüpft worden.
»Hab ich dir schon mal gesagt, wie unsagbar gern ich dich hab, May Little?«
May drehte sich zu mir um und lächelte. Ihr ovales Gesicht war von der Hitze des Ofens gerötet, der Kranz, zu dem sie ihr Deckhaar geflochten hatte, wirkte zerzaust. »Jedes Mal, wenn ich gebacken habe.«
»Ich bin eben einfach gestrickt.« Grinsend stellte ich meinen Beutel ab und lief zum Tresen.
Würde ich Menschen freiwillig zur Begrüßung umarmen, wäre May die Erste. Sie war die Sonne in unserem Villenkosmos. Ich kannte niemanden, dessen Ausstrahlung auf so pure Weise warm und hell war. May war mehr Herz als Mensch.
»Neues Shirt?«, fragte sie belustigt, ehe sie zum Küchenfenster ging, an dem der Zwetschgenbaum kratzte, und es öffnete. Vor ein paar Wochen hatten wir seine Früchte zu Blechkuchen und Marmelade verarbeitet. Wobei ich zugeben musste, dass ich mich eher für die darauffolgenden Aufgabenbereiche begeistern konnte. Ich war keine gute Köchin oder Bäckerin, allerdings eine hervorragende Esserin.
»Nein, nur gewohnt freche Kinder.« Umständlich zog ich mir Maxtons Cordjacke aus und hängte sie über einen der Hocker. Seine Sachen waren die einzigen, die ich mir bewusst auslieh. Ich mochte den Geruch nach Garten und das Gefühl, im weiten Stoff zu versinken. Zwar hatte ich ihn nie um Erlaubnis dafür gebeten, aber er hatte auch nie etwas dazu gesagt, wenn er mich darin sah. Vermutlich war es ihm egal. Maxton waren viele Dinge egal, weil er sich mit allem irgendwie arrangieren konnte.
»Verstehe. Du kommst jedenfalls genau richtig. Ich hab was Neues ausprobiert, Whisky-Schokoladen-Kuchen. Ich fürchte, er ist ein bisschen zu beschwipst geraten.«
Begeistert setzte ich mich. »Klingt perfekt.«
Es war schräg, doch manchmal dachte ich, dass May in meinem Leben das war, was einer Mutterfigur am nächsten kam. Seit meine eigene Dad und mich für ihren Chef verlassen hatte, als ich vierzehn gewesen war, hatten wir nur noch sporadisch Kontakt. Aber auch davor hatte sie sich nicht unbedingt durch Kuchengeruch, liebevolles Nachfragen und Verständnis ausgezeichnet, wie meine Mitbewohnerin es tat.
»Ich dachte mir, dass du das sagst.« Sie nahm einen geblümten Teller aus dem Schrank und griff nach einem Kuchenmesser. Auf ihren Wangen war ein Mehlstreifen zu sehen, darunter lugten bronzefarbene Sommersprossen als Überbleibsel der vergangenen Sonnenmonate hervor.
May hatte immer geleuchtet, aber seit sie mit Wesley Hastings zusammen war, strahlte sie. Ich hatte noch nie jemanden erlebt, dem man das Verliebtsein so sehr ansehen konnte wie ihr. Außer ihm natürlich. Wes hatte diese Art, May permanent anzustarren, als würde er sie zum ersten Mal treffen und sich völlig überfordert fragen, wie etwas so Schönes existieren konnte. Es war echt niedlich, aber, Gott, auch anstrengend. Die beiden waren fast schwerer zu ertragen als unser Hauspärchen, und das, obwohl Avery und Eden beide hier lebten und deswegen öfter vor unseren Augen aufeinander gluckten. Ich freute mich für sie alle und spürte trotzdem immer dieses Engegefühl in der Brust, wenn ich sie zusammen sah.
Ich seufzte genüsslich, als May mir den Teller vorsetzte, teilte ein Stück Kuchen mit den Fingern und schob es mir in den Mund. Der Teig war warm und süß, gleichzeitig schmeckte ich eine herbe Note Alkohol heraus.
»Perfekt«, urteilte ich. »Vor wem muss ich den verstecken, damit ihn mir niemand wegisst?«
May lächelte und wischte ein paar Krümel auf der Arbeitsplatte mit dem Geschirrtuch zusammen. »Du hast keine große Konkurrenz zu fürchten. Beckett ist im Wohnzimmer, aber er hat keinen Hunger. Er hat schlechte Laune, ich glaube, Audrey und er haben sich wieder gestritten.«
Sie warf einen bekümmerten Blick zur Tür, ich verdrehte nur die Augen. Es war nichts Neues, dass Beckett sich mit seiner Nenn-sie-nicht-meine-Freundin-wir-sind-nicht-zusammen-auch-wenn-wir-uns-fünfmal-die-Woche-sehen-und-ich-stündlich-ihr-Instagramprofil-stalke-Bekanntschaft in die Haare bekam. Beckett war einer dieser Menschen, die sich einredeten, ein unverbindliches Liebesleben haben zu wollen, obwohl sie gar nicht dafür gemacht waren. Unter seiner Fassade aus guter Laune und frechen Sprüchen befand sich ein ziemlich romantischer Kern. Das war einer der Gründe, warum ich von Anfang an nie darauf eingegangen war, wenn er mit mir flirtete. Ganz abgesehen davon, dass es – wie erwähnt – sowieso der größte Fehler war, etwas mit jemandem anzufangen, dem man nicht aus dem Weg gehen konnte.
»Und die anderen?«
»Sienna und Helen sind noch unterwegs, Avery und Eden sind oben und … beschäftigt.« Ein zarter Röteschleier legte sich über Mays Wangen, ich grinste.
»Dann bist du wieder aus deinem Zimmer geflüchtet, weil die Wände zu dünn sind, was?«
Avery und Eden hatten sich als Teenager kennengelernt, und seit sie wieder zusammen waren, hatte ich oft das Gefühl, dass sie erneut in diesen Zustand verfielen. Damit meinte ich nicht nur, dass sie sich ständig berühren mussten, sondern vor allem, dass es immer so wirkte, als wären sie sich ihrer gemeinsamen Zukunft unerschütterlich sicher. Dabei waren wir alle in unseren Zwanzigern und sollten mittlerweile wissen, dass Beziehungen nicht ewig hielten. Auch dann nicht, wenn Eden Avery Ever nannte, wenn er dachte, wir würden es nicht hören.
»Du könntest ihnen mal sagen, dass sie dir permanent eine Liveshow bieten«, schlug ich May mit vollem Mund vor.
Sie klopfte das Geschirrtuch über der Spüle aus. »Ich bringe Menschen aber nicht so gern in Verlegenheit wie du.«
»Soll ich es ihnen sagen?«
»Nein.« May sah mich streng an. »Wir sagen beide nichts und freuen uns einfach für sie, okay?«
»Von mir aus.« Ich zuckte mit den Schultern und drückte den Daumen auf die Krümelreste, um ihn anschließend abzulecken. »Wer wäre ich, wenn ich jemandem seinen täglichen Orgasmus nicht gönne?«
Noch mehr Farbe schoss in Mays Wangen, sie warf mir einen Blick zu, der irgendwo zwischen belustigt und peinlich berührt lag. »Willow, bitte.«
Ich lachte. May redete ungern über solche Dinge. Sie machte sie trotzdem, das wussten wir alle. Ich hätte ihr sagen können, dass Avery mir schon oft im B-Club Gesellschaft geleistet hatte, wenn Wes bei May zu Besuch war und Avery das Gefühl hatte, die beiden bei etwas zu intimen Dingen zu belauschen, aber ich ließ es sein. Ich wusste, dass alle glaubten, dass ich immer sagte, was ich dachte, ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer zu nehmen, aber das stimmte nicht. Ich war ehrlich und direkt, doch das bedeutete nicht, dass ich nie den Mund halten konnte. Zumindest gab ich mir Mühe.
»Schon gut«, meinte ich deshalb nur und winkte ab, so doll, dass ein paar Krümel auf den Boden flogen. Wenn mich nicht alles täuschte, war ich sowieso heute fürs Putzen der Gemeinschaftsräume eingeteilt. »Wo wir schon beim Thema sind, wo ist Hastings?«
»Ich hatte dich gebeten, ihn nicht so zu nennen.«
»Und das tue ich vor ihm auch nicht mehr. Aber er ist eben ein Hastings, auch wenn er das oft vergessen will.«
May seufzte, doch sie widersprach nicht. Wes war zwar ein sehr bodenständiger Millionärssohn, aber das änderte nichts daran, dass er einer war. Er hatte sich in seinem Leben nie Sorgen um die nächste Miete oder seine berufliche Zukunft machen müssen. Der Name seiner Familie war das Sicherheitsnetz, das sich mit seiner Geburt unter ihm aufgespannt hatte. Ich hätte ihn mehr dafür verachtet, wenn er May nicht so glücklich machen würde.
»Er unternimmt was mit Luke.« May deutete auf meinen Teller. »Noch eins?«
»Nicht für mich, aber ich würde Max eins in den Garten bringen.« Mein Blick wanderte zum Fenster, hinter dem die Lücken der Zwetschgenzweige grünes Dickicht offenbarten. »Wie ich ihn kenne, ist er seit Stunden da draußen, ohne was zu essen. Wenn wir nicht aufpassen, kippt er uns irgendwann um. Und, sind wir ehrlich, niemand außer Maxton selbst könnte sich in dem Gestrüpp so gut orientieren, als dass wir ihn wiederfinden würden.«
»Maxton ist nicht hier.«
Verwirrt blickte ich zu der Uhr über der Tür. Es war nach fünf, und Maxtons letztes Seminar war vor drei Stunden vorbei gewesen. Eigentlich kam er nach der Uni meist sofort zur Villa. Schon bevor wir uns für das Wohnprojekt beworben hatten, waren Eden und ich seine besten Freunde gewesen, und auch wenn er mittlerweile mit unseren anderen Mitbewohnenden eng befreundet war, hielt er mit dem Rest seiner Bekannten eher oberflächlichen Kontakt. »Sondern?«
May holte eine Karaffe mit Zitronenlimonade aus dem Kühlschrank und goss uns ein. »Keine Ahnung, aber er meinte, er isst heute nicht mit uns.«
Dankend nahm ich eins der Gläser entgegen, während mein Verstand versuchte, ihr zu folgen. Maxton hatte mir nicht gesagt, dass er heute etwas unternahm. Es war nicht so, als würden wir unsere Tagespläne absprechen, aber irgendwie wussten wir trotzdem immer, wo der andere gerade steckte. Er, weil ich ihm ständig schrieb, ich, weil er eben neunzig Prozent seiner Freizeit im Garten verbrachte. In den letzten Wochen war es öfter vorgekommen, dass er irgendwie … weg war. Ich suchte ihn draußen, um später zu erfahren, dass er noch gar nicht zu Hause war, ich klopfte an seine Tür, nur um das Zimmer verlassen vorzufinden, ich saß mit den anderen am Esstisch und starrte seinen leeren Platz an. Später sagte er meistens, er hätte etwas für die Uni erledigen müssen oder wäre unterwegs gewesen, in dieser typischen Stimmlage, die klarmachte, dass er keine Lust hatte, darüber zu reden. Und ich respektierte das so gut ich konnte, doch es stieß mir trotzdem unangenehm auf. Die Tatsache, dass er meine Nachrichten seit Stunden ignorierte, aber May erzählt hatte, dass er heute weg war, störte mich mehr, als ich erklären konnte.
»Und wo steckt er?«, fragte ich gepresst.
»Er ist dein bester Freund, oder? Wenn er es dir nicht gesagt hat, dann mir erst recht nicht.«
Ich schnaubte und wischte Zitronenfasern vom Glasrand. »Mein bester Freund, der sich in letzter Zeit echt rarmacht. Sonst muss ich ihn tagelang anbetteln, damit er mich außerhalb seiner vier grünen Wände begleitet, und jetzt ist er so oft unterwegs und … ja, was? Hängt in der Uni rum? Trifft sich mit Menschen, die er uns nicht vorstellen will?«
»Vielleicht solltest du ihm diese Fragen stellen, nicht mir.« Gott, ich hatte May echt gern, aber ihr sanfter, verständnisvoller Tonfall ließ mich nur gereizter werden.
»Als hätte ich das nicht schon getan. Du weißt doch, wie gesprächsfaul er sein kann.«
»Hm.« May rieb sich das Mehl von der Wange und zögerte. »Vielleicht ist faul nicht das richtige Wort. Vielleicht will er nicht darüber reden, weil er ahnt, wie du darauf reagieren würdest.« Mit einem Räuspern wandte sie sich ab und ging zur Spüle. Zu spät.
Ich hatte ein Gespür für Geheimnisse, für die Dinge, die jemand auf der Zunge hatte, aber lieber herunterschluckte als ausspuckte, für das Geflüsterte hinter Wänden und das Gedachte hinter Blicken. Ich verstand nicht immer, was da war, doch ich bemerkte, wenn da etwas war. Und hier war etwas. Etwas Großes, Grellrotes, Wichtiges. Es saß direkt da, hinter Mays leicht gerunzelter Stirn.
Mit Schwung stand ich auf und ging zu ihr. »Raus damit. Was weißt du?«
»Gar nichts.«
»May, du bist die schlechteste Lügnerin auf dem Planeten. Und ich bin die hartnäckigste Person in diesem Haus. Uns ist beiden klar, wie das hier ausgehen wird.«
Widerwillig drehte sie sich zu mir. »Ich weiß es aber wirklich nicht. Es ist nur … Wes hat etwas angedeutet.«
»Und was?« In meiner Brust bildete sich ein kleiner Knoten, ich spürte ihn ganz deutlich – ein Fadenknäuel aus Unruhe, Neugierde und Anspannung. Wes hing noch nicht lang mit uns allen rum – welche Information konnte er über Maxton haben, die uns nicht bekannt war?
»Sagt dir die Silent Storms Society was?«
Verwirrt starrte ich sie an. Dieses Stichwort lag so weit von allem entfernt, was ich mit Maxton verband, dass ich es schlichtweg nicht in einen Gedanken mit ihm bringen konnte.
»Diese lächerlichen Typen, die sich selbst als ›Elite der Universität‹ bezeichnen? Klar, die leben ja dafür, dass man von ihnen hört – nur um dann allen zu verbieten, über sie zu reden, weil sie angeblich eine Geheimgesellschaft sind.«
Zugegeben, ich wusste vermutlich mehr über diese Studentenverbindung als der Großteil am Campus, was daran lag, dass ich mich gern mit Menschen unterhielt. Und etwas, worüber man nicht reden durfte, war auf Partys das beliebteste Gesprächsthema überhaupt. Ich wusste nicht genau, wer in dieser Verbindung war, aber ich war mir sicher, dass ich mit keinem von ihnen Kontakt herstellen wollte. Es gab Menschen, die ihren kleinen Finger dafür gegeben hätten, in so eine elitäre Gruppe reinzukommen – und es gab Menschen, die ihr höchstens den Mittelfinger gezeigt hätten, wenn sie das Angebot dafür erhielten. Ich zählte mich zu Letzteren.
»Wes kennt ein paar Leute, die da Mitglied sind.«
»Wie überraschend.« Wenn es jemanden gab, den eine Studentenverbindung voller reicher Typen vermutlich gern in ihren Reihen willkommen geheißen hätte, dann Wesley Hastings. Im Grunde war es ihm anzurechnen, dass er offensichtlich kein Interesse daran gehabt hatte.
»Er ist selbst auch kein Fan von dem, was die so treiben, aber einige seiner alten Freunde sind dort eingetreten. Vor ein paar Wochen hat er einen von ihnen, Keenan Hall, auf dem Campus gesehen – und zwar mit Maxton.«
Ich wartete auf mehr, May sah mich allerdings nur abwartend an. Dabei verstand ich immer noch nicht, worauf sie hinauswollte. »Das bedeutet doch nichts. Ich meine, Maxton ist zwar kein Menschenmagnet, aber es kommt durchaus mal vor, dass er mit anderen redet.«
Sie zupfte an der zartgelben Schlaufe ihres Kleides herum. »Schon klar. Nur … Wes meint, dass Maxton komisch reagiert hätte, als er ihn auf Keen angesprochen hat. Und letztens, als Wes und ich aus Paris zurückgekommen sind, da kam Maxton gerade nach Hause. Und er war voller Tinte.«
»Was?« Mir war an diesem Tag nur aufgefallen, dass Maxton zu spät gekommen war. Ich hatte gedacht, er hätte im Garten die Zeit vergessen, aber nicht, dass … ja, was?
»Es sah aus, als hätte man ein Fass über ihm ausgeleert. Er ist nicht drauf eingegangen, als ich nachgefragt hab, aber Wes meinte später, dass er so was schon mal gesehen hätte. Die Silent Storms Society verkündet ihre Anwärter manchmal auf diese Weise.«
Ich verzog angewidert den Mund. »Indem sie ihnen Tinte über den Kopf kippen?«
May nickte nur und sah mich wieder an – als wartete sie darauf, dass ich endlich begriff, worauf sie hinauswollte. Ich tat es, langsam und widerwillig, weil sich alles in mir sträubte, diesen abwegigen Gedanken zuzulassen.
»Das ist völlig absurd«, schaffte ich es schließlich zu sagen. »Ich meine, wir reden hier von Max. Unserem Max. Dem Max, der seine Zeit lieber mit Pflanzen als mit Menschen verbringt. Dem Max, der mit Ohrstöpseln zeichnet, weil ihm das Haus zu laut ist. Dem Max, den ich seit über zwei Jahren nicht dazu überreden kann, mit mir in einen Club zu gehen. Dieser Typ würde niemals Interesse daran haben, einer Verbindung beizutreten, die ihn dazu verpflichtet, seine Freizeit in einer Herde elitärer Idioten zu verbringen.«
»Ich finde es auch schwer vorstellbar, und vielleicht ist ja gar nichts dran. Es war nur irgendwie komisch, das ist alles.« May winkte ab, doch da hing immer noch dieser Besorgnisschatten in ihren grünen Augen.
Das war an sich nichts Neues, May machte sich ständig Sorgen, aber diesmal spürte ich, wie etwas von dem Gefühl auf mich übersprang. Weil es um Maxton ging. Und weil Maxton eigentlich niemand war, um den man sich Sorgen machen musste – einfach, weil er sich so gut wie nie welche machte.
»Hast du ihn darauf angesprochen?«
»Nein. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er darüber reden möchte, und wollte ihm nicht zu nahe treten. Wenn er uns etwas dazu sagen will, wird er auf uns zukommen, oder?«
»Hm.« Ich zwirbelte eine meiner Locken und dachte daran, dass ich im ersten Jahr unserer Freundschaft nicht gewusst hatte, wann Maxton Geburtstag hatte. Hätte ich nicht zufällig einen Blick auf seinen Ausweis erhascht, wüsste ich es vermutlich bis heute nicht. Ich dachte auch daran, dass ich von seiner Weisheitszahn-OP letztes Jahr im Frühling nur erfahren hatte, weil ich nach zwei Tagen seltsam sporadischen Kontakts unangemeldet in seinem Wohnheim aufgetaucht war und ihn mit geschwollenem Gesicht aufgefunden hatte. Beide Male hatte ich ihn gefragt, warum er daraus so ein Geheimnis gemacht hatte, beide Male hatte er augenverdrehend gesagt: »Es war kein Geheimnis, es war nur unwichtig.«
Das war Maxton. Er hatte, auf sich selbst bezogen, das am weitesten gefasste Definitionsspektrum von »unwichtig«, das ich kannte. Er machte die Dinge gern mit sich aus, er tat sie lieber, als groß darüber zu reden, er fragte nur nach Hilfe, wenn er wusste, dass er sie wirklich brauchte. Maxtons innere Sicherheit war ein so starkes Grundgerüst, dass er niemanden sonst brauchte, um es aufrechtzuhalten.
Genau deswegen mischte ich mich bei ihm seltener ein und hakte weniger nach, als mir lieb war. Aber das hier, das war etwas anderes. Solang es auch nur den Hauch einer Chance gab, dass Maxton in irgendeiner Verbindung zu dieser abgehobenen Geheimgesellschaft stand, konnte ich das nicht ignorieren. Vielleicht hatte May recht und Maxton wollte tatsächlich nicht darüber reden. Unglücklicherweise hatte er sich dafür die falsche beste Freundin ausgesucht.
May beobachtete mich wachsam und seufzte dann leise. »Du wirst ihn darauf ansprechen, oder?«
Ich grinste nur und griff nach dem Messer, um mir ein weiteres Stück Kuchen abzuschneiden. Für den Verlauf dieses Abends würde ich dringend Nervennahrung brauchen.
3. Kapitel
MAXTON
Im Schach gab es etliche verschiedene Eröffnungszüge, trotzdem musste man sich zu Beginn der Partie im Grunde immer dieselbe Frage stellen: Was bin ich bereit zu opfern, um ans Ziel zu gelangen?
Ich musste seit anderthalb Stunden daran denken. An den Preis, den mich das hier kostete. Meine Zeit, meine Würde, meine Nerven und meine Selbstbeherrschung, weil ich konstant zwischen Gähnen, Lachen und Schnauben schwankte.
Je länger ich dem Typen vorn in dem aschgrauen Hemd zuhörte, desto absurder schien mir alles an dieser Situation. Mein Blick tastete von dem Stickemblem auf seiner Brusttasche – ein sechseckiges Wappen, in dessen Mitte ein geschwungenes S prangte – über die Lehnen seines Holzstuhls, hin zu der Säule, die sich neben ihm bis zur Raumdecke erstreckte. Sie war mit cremefarbenen Ornamenten verziert und erinnerte mich an die Decken der Mulberry Mansion.
Ich war nicht der Typ für Heimweh, aber in diesem Augenblick wäre ich am liebsten aufgestanden und gegangen. Ich hätte dieses Gebäude verlassen, das bis vor ein paar Wochen nur ein flüchtig wahrgenommenes Bild aus dunkelrotem Backstein, Wildem Wein und einer wuchtigen Eingangstür am Rand des Campus gewesen war. Ich wäre mit dem Bus bis zur Stadtgrenze gefahren und von dort in den Wald gelaufen, hätte mir die Schuhe ausgezogen und unter den Zehen gespürt, wie aus dem erdigen Weg ein Dickicht aus Moos, Blättern, Ästen und Bodenflechten wurde, bis ich schließlich das Anwesen der Villa und damit das satte Gras des Gartens erreicht hätte. Ich hätte mit den Fingern über die letzten blühenden Köpfe der Duftwicken gestrichen und die Handinnenfläche gegen die Rinde der Apfelbäume gedrückt, bis ihre Rauheit die meiner Gedanken verdrängt hätte.
Ich wäre nach Hause gegangen.
Stattdessen zwang ich mich dazu, den Blick auf dem Gesicht des Typens zu fixieren, der seit einer halben Stunde ununterbrochen auf uns einredete – auf mich und die sechs anderen jungen Männer, die um mich herum auf Stühlen saßen. Ihre Mienen schwankten zwischen Konzentration, Faszination und Angst, und ich fragte mich, warum ich nichts davon fühlte. Warum ich schon wieder irgendwie gar nichts fühlte.
Je feierlicher die Tonlage des Mannes wurde, desto stärker wurde der Drang in mir, die Augen zu schließen. Und die Ohren gleich mit. Normalerweise war ich gut darin, Menschen reden zu lassen. Es machte mir nichts aus, wenn Leute über Dinge sprachen, die mich nicht interessierten, oder wenn mir ihre Meinung nicht gefiel. Es war einfacher, das Zuhören zu beenden, als jemanden dazu bringen zu wollen, das Reden sein zu lassen. Das Problem war nur, dass ich mir hierbei nicht erlauben konnte, ganz abzudriften. Dazu war es zu wichtig. Oder zumindest sollte es das sein.
Mit aller Kraft lenkte ich meinen Fokus zurück auf den blonden Typen, der mittlerweile aufgestanden war und vor uns auf und ab lief: Sebastian »Bash« Allington, vierundzwanzig Jahre alt, Wirtschaftsingenieurwesen-Student im Master, jüngster Sohn der Familie, der eines der erfolgreichsten Bauunternehmen Englands gehörte. Ich wusste das, weil er und seine Brüder sich vorhin vorgestellt hatten, bevor sie sich gegenüber von mir und den anderen hingesetzt hatten. Eine Linie aus Grau und Geld, fünfzehn junge Männer in aschfarbenen Hemden und mit fast identischen Gesichtsausdrücken, die zwischen Langeweile und Feierlichkeit wechselten: die amtierenden Mitglieder der Silent Storms Society.
Bis zum letzten Semester war dieser Name für mich nur ein Wortschatten gewesen, den ich gelegentlich auf dem Campus vorbeihuschen gesehen hatte. Keiner, nach dem ich mich je umgedreht hätte, weil mich seine Konturen viel zu wenig interessiert hatten. Eine halbgeheime Studentenverbindung, die in den Erzählungen anderer so gut wie immer mit elitärem Verhalten und überzogenen Aufnahmeritualen zusammengebracht wurde – das klang nach Drama, Problemen und Lärm. Drei Dinge, die ich hasste. Hätte mir jemand vor sechs Monaten gesagt, dass ich eines Tages in ihrem Verbindungshaus sitzen und an einem ersten Aufnahmegespräch teilnehmen würde, hätte ich es nicht geglaubt. Eigentlich glaubte ich es immer noch nicht. Trotzdem war ich jetzt hier.
»Ich bezweifle, dass einer von euch sich mit der griechischen Mythologie auskennt?« Bash machte eine Pause und ließ den Blick über unsere Gesichter schweifen. Niemand blinzelte auch nur, als hätten sie Sorge, damit gegen eine unausgesprochene Regel zu verstoßen und rausgeschmissen zu werden. Dabei wussten wir alle dank des Briefs, den wir vor wenigen Wochen erhalten hatten, auf welchen abenteuerlichen Mythos diese Rede hinauslaufen würde.
»Das Dasein beginnt in der griechischen Mythologie mit dem Gott Chaos, der die ersten anderen Götter zum Leben erweckte. Eine davon war Gaia, die Erdgöttin, die Uranos, den Himmel, erschuf und mit ihm die zwölf Titanen bekam. Sechs männliche, sechs weibliche Gottheiten, die ihrem Vater ein Dorn im Auge wurden. Er versuchte, sie loszuwerden, wurde aber schließlich von seinem jüngsten Sohn, Kronos, entmachtet. Dieser übernahm mithilfe seiner Geschwister die Herrschaft über die Welt. Man spricht von dieser Epoche als dem Goldenen Zeitalter. Eine Ära des Glücks, die endete, als die Titanen von ihren eigenen Nachkommen besiegt wurden. Als unsere Gründerbrüder mit dem Gedanken spielten, diese Verbindung ins Leben zu rufen, fiel ihnen der Mythos in die Hände. Sie waren damals genau zu sechst, so wie die männlichen Titanen, und sie nahmen diesen Zufall als einen Anreiz. Einen Anreiz dafür, sich nicht mit dem gewöhnlichen Leben zufriedenzugeben. Einen Anreiz dafür, mehr zu wollen, mehr zu sein. Und sie hatten das Zeug dazu, denn so wie alle von uns waren sie Götter unter den Männern.« Noch eine künstliche, betont andächtige Pause.
Ich strich mir beiläufig über den Mund, weil meine Lippen zuckten. Unter anderen Bedingungen wäre ich davon ausgegangen, dass diese Metapher ein Witz war, aber ein Blick auf die Gesichter der Verbindungsbrüder und die der Anwärter machte mir klar: Sie meinten das ernst.
»Also, was unterscheidet einen Menschen von einem Gott?« Bash lehnte sich gegen die Säule schräg vor mir.
Von Keenan wusste ich, dass es das zweite Jahr war, in dem Bash den Vorsitz der Verbindung innehielt. Man konnte seiner monotonen Stimme anmerken, dass er diese Rede bereits öfter gehalten hatte.
»Ich könnte jetzt über Ruhm und Macht reden, über Stärke und Zusammenhalt. Aber wir lassen euch lieber selbst herausfinden, was es bedeutet, einer von uns zu sein. Die Herausforderungen, vor die wir euch stellen werden, werden euch dazu zwingen, euch über gesellschaftliche Konventionen und eure eigenen Ängste hinwegzusetzen. Sechs Herausforderungen, sechs Leitersprossen, die erklommen werden müssen, um am Ende vielleicht zu etwas Höherem aufzusteigen. Vorweggesagt: Das alte Selbst hinter sich zu lassen geht mit Schmerzen einher. Physischen, aber vor allem psychischen. Ihr müsst erkennen, dass euch euer altes Leben zu klein geworden ist, und bereit sein, euch aus dieser Hülle herauszuschälen.«
Ich nahm es zurück: Das konnte unmöglich ihr Ernst sein. Ich presste die Hand fester auf meinen Mund, während Bash die Metapher noch unnötiger und dramatischer aufbauschte. Gerade, als ich das Lachen in meiner Kehle kitzeln spürte, vibrierte mein Handy in der Hosentasche. Ich tastete danach und öffnete die App reflexartig, sobald mein Blick über Willows Namen stolperte. Sie schickte mir täglich etliche Nachrichten, und die meisten davon waren im Grunde sinnlos, aber sie waren trotzdem immer bedeutend.
Bereit für eine neue Anekdote aus dem Hort?
Meine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, und diesmal ließ ich es schutzlos zu. Bevor ich den Rest lesen konnte, ertönte ein Räuspern von links. Der Student auf dem Stuhl neben mir zog genervt die Augenbrauen zusammen, ohne mich eines Blickes zu würdigen.
So wie die fünfzehn Männer dort vorn gehörten auch diejenigen, die wie ich zum ersten Mal hier waren, zu irgendeiner Sparte der britischen Oberschicht oder stammten zumindest aus Verhältnissen, die man als wohlhabend bezeichnen könnte. Das war die Art Mensch, die erkannte, wenn man nicht zu ihr gehörte. Und das tat ich nicht, niemandem war das mehr bewusst als mir.