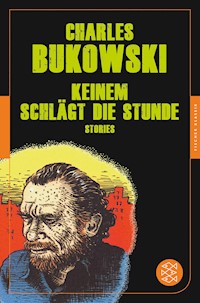8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
»Die Trauerfeier für meinen Vater lag mir im Magen wie eine kalte Bulette.« »Der Mensch ist der Abschaum des Universums«, heißt es gleich in der ersten Geschichte, und die restlichen 35 geben Gelegenheit, diese Theorie zu überprüfen. Frauen und Männer, Schriftsteller und Dichter, Außenseiter der Gesellschaft, die in billigen Hotels billige Befriedigung suchen – Bukowskis Charaktere haben viel gesehen und viel erlebt. Alkohol, Glücksspiel, Sex, das Altern und das Schreiben – die Storys umfassen die Themen, mit denen sich Bukowski Zeit seines Lebens befasst hat und die er in dieser minimalistischen Form prägnant, hart und ungeschönt auf den Punkt bringt. Ein Muss für alle Bukowski-Fans, gerade auch in der jüngeren Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Ähnliche
Charles Bukowski
Hot Water Music
Storys
Aus dem amerikanischen Englisch von Carl Weissner
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Charles Bukowski
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Für Michael Montfort
Die Heuschreckenplage
»Mir reichts«, sagte er. »Schluss für heute. Lass uns weggehn. Ich kann diese stinkenden Ölfarben nicht mehr riechen. Ich bins leid, ein großer Maler zu sein. Ich hab keine Lust, bloß auf den Tod zu warten. Komm, wir gehn.«
»Wohin denn?«, fragte sie.
»Egal. Was essen. Trinken. Was erleben.«
»Jorg«, sagte sie, »was mach ich, wenn du mal stirbst?«
»Na was wohl? Essen, schlafen, ficken, pissen, scheißen, dich anziehen, rumlaufen und nörgeln.«
»Ich brauch ne Sicherheit.«
»Brauchen wir alle.«
»Ich meine, wir sind nicht verheiratet. Ich komm nicht mal an das Geld von deiner Lebensversicherung ran.«
»Schon gut. Mach dir nicht so viele Gedanken. Außerdem hältst du von Heiraten sowieso nichts, Arlene.«
Arlene saß in dem rosaroten Sessel und las die Nachmittagszeitung. »Du sagst, fünftausend Frauen wollen mit dir ins Bett. Wo bleibe ich da?«
»Stellst dich eben hinten an.«
»Denkst du, ich kann keinen anderen Mann kriegen?«
»Nein, das ist für dich kein Problem. Du kannst in drei Minuten einen anderen haben.«
»Denkst du, ich brauche unbedingt einen großen Maler?«
»Nein, brauchst du nicht. Ein guter Klempner würde es auch tun.«
»Ja. Hauptsache, er liebt mich.«
»Natürlich. Zieh deinen Mantel an. Gehn wir.«
Sie verließen die Atelierwohnung unterm Dach und gingen im Treppenhaus die Stufen hinunter. Ringsum gab es spärlich möblierte Zimmer mit reichlich Kakerlaken, doch niemand schien zu hungern: Ständig kochten sie etwas in großen Töpfen und saßen herum, rauchten, putzten sich die Fingernägel, tranken Bier aus der Dose oder teilten sich eine große blaue Flasche Weißwein, schrien miteinander herum oder lachten, furzten, rülpsten, kratzten sich oder dösten vor dem Fernseher. Wie die meisten Menschen auf der Welt lebten auch sie nicht gerade im Überfluss, doch je weniger Geld sie hatten, desto besser kamen sie offenbar zurecht. Schlaf, ein sauberes Bettlaken, Essen, Trinken und Hämorrhoidensalbe, mehr brauchten sie nicht. Und immer ließen sie ihre Tür einen Spalt offen.
»Idioten«, sagte Jorg. »Sie verplempern ihr Leben, und mir drängen sie’s auf Schritt und Tritt auf.«
»Ach Jorg«, seufzte Arlene, »du kannst einfach keinen Menschen leiden, nicht?«
Er sah sie mit hochgezogener Augenbraue von der Seite an, sagte aber nichts. Ihre Reaktion auf seine Einstellung zur Menschheit blieb sich immer gleich. Als verrate die Tatsache, dass er die Menschen nicht mochte, einen unverzeihlichen Mangel an seelischer Größe. Aber im Bett war sie hervorragend, und es war angenehm, sie um sich zu haben – die meiste Zeit jedenfalls.
Sie kamen aus dem Gebäude und gingen den Boulevard hinunter. Jorg in seinem übel riechenden zerfledderten Mantel und mit seinem weißen Krückstock aus Elfenbein, seinem angegrauten roten Bart, den kaputten gelben Zähnen und dem schlechten Atem, violetten Ohren und verängstigten Augen. Wenn er sich richtig mies fühlte, ging es ihm immer am besten. »Scheiße«, sagte er. »Alles scheißt, bis es stirbt.«
Arlene ließ ihren Hintern schlingern, ohne ein Geheimnis daraus zu machen, und Jorg ließ seinen Krückstock aufs Pflaster knallen, und sogar die Sonne wurde stutzig und sagte: Oho. Schließlich erreichten sie das alte verwahrloste Hotel, in dem Serge wohnte. Jorg und Serge malten schon seit vielen Jahren, doch erst seit Kurzem erzielten ihre Bilder einen anständigen Preis. Sie hatten gemeinsam gehungert, und berühmt wurde jetzt jeder für sich. Jorg und Arlene durchquerten die Hotelhalle und stiegen die Treppe hoch. Aus den Korridoren drang der Geruch von Jod und brutzelndem Hühnerfett. Irgendwo wurde jemand gefickt und machte kein Geheimnis daraus. Vor dem Atelier in der obersten Etage blieben sie stehen, und Arlene klopfte an. Die Tür wurde aufgerissen, und Serge rief: »Kuckuck!« Dann wurde er rot. »Oh, Entschuldigung … kommt rein.«
»Mensch, was ist denn mit dir los?«, fragte Jorg.
»Setzt euch. Ich dachte, es ist Lila …«
»Spielst du mit Lila etwa Verstecken?«
»Lass nur. Ist nichts weiter.«
»Serge, du musst dich von diesem Girl trennen. Sie ruiniert dir den Verstand.«
»Sie spitzt mir die Bleistifte.«
»Serge, sie ist zu jung für dich.«
»Sie ist dreißig.«
»Und du bist sechzig. Das sind dreißig Jahre Unterschied.«
»Du meinst, dreißig Jahre sind zu viel?«
»Natürlich.«
»Und zwanzig?«, fragte Serge mit einem Seitenblick auf Arlene.
»Zwanzig geht noch. Dreißig ist obszön.«
»Warum sucht ihr euch nicht Frauen in eurem Alter?«, fragte Arlene.
Die beiden sahen sie an. »Sie macht gern so kleine Scherze«, sagte Jorg. »Ja«, sagte Serge, »sie ist witzig. Kommt, ich muss euch mal was zeigen …«
Sie folgten ihm ins Schlafzimmer. Er zog die Schuhe aus und legte sich aufs Bett. »Seht ihr? Einfach so. Bequem wie nur was.« Serge hatte seine Pinsel an langen Stecken und malte damit auf eine Leinwand, die an der Decke befestigt war. »Es ist wegen meinem Rücken. Kann keine zehn Minuten malen, ohne dass ich unterbrechen muss. Auf die Tour halte ich stundenlang durch.«
»Und wer mischt dir die Farben?«
»Lila. Ich sag ihr: ›Rühr Blau rein. Jetzt noch ein bisschen Grün.‹ Sie macht es ganz gut. Am Ende lass ich sie vielleicht auch die Pinsel bedienen und liege einfach rum und lese Illustrierte.«
Jetzt hörten sie Lila draußen die Treppe heraufkommen. Sie machte die Tür auf, ging durch den Wohnraum und kam ins Schlafzimmer. »Hey«, sagte sie, »ich sehe, der alte Scheißer ist am Malen.«
»Ja«, sagte Jorg, »er behauptet, du hast ihm die Bandscheiben verbogen.«
»Kein Wort hab ich davon gesagt.«
»Kommt, wir gehn essen«, sagte Arlene. Serge wälzte sich ächzend von seinem Bett und stand auf.
»Ich schwörs euch«, sagte Lila, »die meiste Zeit liegt er nur rum wie ein kranker Frosch.«
»Ich brauche was zu trinken«, sagte Serge, »dann komm ich wieder in Form.«
Sie gingen nach unten und machten sich auf den Weg zum »Sheep’s Tick«. Zwei junge Männer von Mitte zwanzig rannten auf sie zu. Beide trugen Rollkragenpullover. »Hey, ihr seid doch Jorg Swenson und Serge Maro, die beiden Maler!«
»Geht uns gefälligst aus dem Weg!«, sagte Serge.
Jorg holte mit seinem Krückstock aus und drosch ihn dem kleineren der beiden Burschen genau aufs Knie. »Scheiße«, sagte der junge Mann, »Sie haben mir das Bein gebrochen!«
»Das will ich hoffen«, sagte Jorg. »Vielleicht legst du dir jetzt bessere Umgangsformen zu.«
Sie gingen weiter. Als sie ins Restaurant kamen, steckten die Gäste die Köpfe zusammen und tuschelten. Der Oberkellner kam im Laufschritt an, verbeugte sich, wedelte mit Speisekarten und äußerte Nettigkeiten auf Französisch, Italienisch und Russisch.
»Sieh dir mal das lange schwarze Haar an, das ihm aus der Nase wächst«, sagte Serge. »Ist ja ekelhaft!«
»Ja«, sagte Jorg und schrie den Kellner an: »HALT DIR DIE HAND VOR DIE NASE!«
»Fünf Flaschen von eurem besten Wein!«, brüllte Serge, während sie sich an den besten Tisch setzten.
Der Oberkellner verschwand.
»Ihr zwei seid richtige Arschlöcher«, sagte Lila.
Jorg strich ihr mit der Hand am Bein hoch. »Zwei Unsterbliche können sich gewisse Taktlosigkeiten leisten.«
»Nimm deine Hand von meiner Muschi, Jorg.«
»Es ist nicht deine Muschi. Sie gehört Serge.«
»Dann nimm die Hand von der Muschi, die Serge gehört. Oder ich schreie.«
»Mein Geist ist aber nicht willig.«
Sie schrie. Jorg nahm die Hand weg. Der Oberkellner rollte den Sektkübel mit dem gekühlten Wein auf einem Wägelchen heran. Er machte eine Verbeugung und entkorkte eine Flasche. Er goss Jorg das Glas voll. Jorg trank es aus. »Scheißzeug, aber es geht. Mach die Flaschen auf!«
»Alle?«
»Ja alle, du Arschloch! Und ein bisschen dalli!«
»Er hat zwei linke Hände«, sagte Serge. »Sieh dir das an. Sollen wir essen?«
»Essen?«, sagte Arlene. »Ihr tut doch nichts als trinken. Ich glaube, ich hab noch nie erlebt, dass einer von euch mehr als ein gekochtes Ei isst.«
»Geh mir aus den Augen, du Schlappschwanz«, sagte Serge zu dem Kellner.
Der Oberkellner verschwand.
»Ihr solltet mit den Leuten nicht so umspringen«, sagte Lila.
»Wir haben es uns verdient«, sagte Serge.
»Ihr habt kein Recht dazu«, sagte Arlene.
»Schon möglich«, meinte Jorg, »aber es ist interessant.«
»Die Leute müssen sich so einen Scheiß nicht gefallen lassen«, sagte Lila.
»Was die Leute schlucken, das schlucken sie«, sagte Jorg. »Sie schlucken noch viel Schlimmeres.«
»Von euch wollen sie nur eure Bilder, das ist alles«, sagte Arlene.
»Wir sind unsere Bilder«, sagte Serge.
»Weiber sind einfach strohdumm«, sagte Jorg.
»Sieh dich vor«, sagte Serge. »Sie sind auch zu schauerlichen Racheakten fähig …«
Die nächsten zwei Stunden saßen sie schweigend da und tranken den Wein.
Schließlich sagte Jorg: »Der Mensch ist ne größere Plage als die Heuschrecke.«
»Der Mensch ist der Abschaum des Universums«, sagte Serge.
»Ihr zwei seid wirklich die letzten Arschlöcher«, sagte Lila.
»Weiß Gott«, sagte Arlene.
»Wie wärs, wenn wir heute Nacht Partnertausch machen«, sagte Jorg. »Ich fick deine Muschi und du meine.«
»Oh nein«, sagte Arlene. »Kommt nicht infrage.«
»Genau«, sagte Lila.
»Ich hätte jetzt Lust zu malen«, sagte Jorg. »Die Trinkerei langweilt mich.«
»Mir ist auch nach Malen«, sagte Serge.
»Lass uns hier verschwinden«, sagte Jorg.
»Moment mal«, sagte Lila, »ihr habt die Rechnung noch nicht bezahlt.«
»Die Rechnung?«, schrie Serge. »Glaubst du vielleicht, wir zahlen auch noch was für dieses Gesöff?«
»Gehn wir«, sagte Jorg.
Als sie aufstanden, kam der Oberkellner mit der Rechnung.
»Dieses Gesöff ist eine Zumutung!«, schrie Serge und trampelte vor Empörung. »Ich würde es nicht wagen, für so ein Zeug auch noch Geld zu verlangen! Ich werd dir zeigen, was diese Pisse wert ist!«
Serge griff sich eine halb volle Flasche, riss dem Kellner das Hemd auf und schüttete ihm den Wein auf die Brust. Jorg packte seinen Elfenbeinstock wie ein Schwert. Der Oberkellner sah völlig entgeistert drein. Er war ein ausnehmend schöner junger Mann mit langen Fingernägeln und einem teuren Apartment. Er studierte Chemie, und in einem Wettbewerb für Opernsänger hatte er einmal den zweiten Preis bekommen. Jorg schwang seinen Krückstock und verpasste dem Kellner einen harten Hieb genau unters linke Ohr. Der Kellner wurde sehr weiß im Gesicht und schwankte. Jorg schlug ihn noch dreimal auf dieselbe Stelle, und der junge Mann ging zu Boden.
Serge, Jorg, Lila und Arlene strebten gemeinsam dem Ausgang zu. Sie waren alle betrunken, aber sie hatten so etwas an sich, etwas Besonderes. Sie zwängten sich durch die Tür und gingen die Straße runter.
An einem Tisch in der Nähe des Eingangs saß ein junges Paar, das den ganzen Auftritt verfolgt hatte. Der Mann wirkte ganz intelligent, aber der gute Eindruck wurde verdorben von einem ziemlich großen Leberfleck, den er ausgerechnet auf der Nase hatte. Das Girl war eine liebenswerte Dicke in einem dunkelblauen Kleid. Sie hatte einmal Nonne werden wollen.
»Waren sie nicht sagenhaft?«, fragte der junge Mann.
»Das waren Arschlöcher«, sagte das Girl.
Der junge Mann winkte den Kellner heran und bestellte die dritte Flasche Wein. Es sah mal wieder nach einem anstrengenden Abend aus.
Zwei Gigolos
Als Gigolo kommt man sich sehr eigenartig vor. Besonders, wenn man Amateur ist.
Wir wohnten in einem zweistöckigen Haus. Comstock hatte sich bei Lynne im Obergeschoss einquartiert, ich bei Doreen im Erdgeschoss. Das Haus lag in wunderschöner Umgebung am Fuß der Hollywood Hills. Beide Ladys hatten hoch dotierte Jobs in der Industrie, und im Haus fehlte es nie an gutem Wein und gutem Essen. Es gab auch einen Hund mit einem zottigen Hinterteil. Und ein fülliges schwarzes Dienstmädchen namens Retha, das die meiste Zeit in der Küche verbrachte und die Bestände des Kühlschranks dezimierte.
Jeden Monat brachte der Postbote die Magazine und Illustrierten, die man in diesen Kreisen las. Comstock und ich lasen sie nicht. Wir hingen nur verkatert herum und warteten darauf, dass es Abend wurde und die Ladys uns mit Speis und Trank verwöhnten. Auf Spesen.
Laut Comstock war Lynne eine sehr erfolgreiche Produzentin bei einer großen Filmgesellschaft. Comstock trug immer eine Baskenmütze, einen Seidenschal und eine Türkiskette. Er hatte einen Bart, und sein Gang war so geschmeidig wie reine Seide. Ich war Schriftsteller und kam mit meinem zweiten Roman nicht voran. Ich hatte eine eigene Wohnung in einem abbruchreifen Mietshaus in East Hollywood, aber dort hielt ich mich nur selten auf.
Mein Transportmittel war ein Mercury Comet, Baujahr 62. Der jungen Dame im Haus gegenüber war mein altes Auto ein Dorn im Auge. Ich musste vor ihrem Haus parken, weil es eine der wenigen ebenen Stellen in der Gegend war und meine Karre nur ansprang, wenn sie waagerecht stand. Selbst so hatte ich noch meine Mühe und musste das Gaspedal pumpen und den Starter malträtieren, und der Qualm waberte unter dem Wagen heraus, und der Lärm war anhaltend und widerwärtig. Die Dame fing an zu schreien, als sei sie im Begriff, den Verstand zu verlieren. Es machte mir sonst nur selten etwas aus, dass ich ein armer Schlucker war, aber in solchen Augenblicken schämte ich mich dafür. Ich saß da und pumpte und betete darum, dass der 62er Comet endlich anspringen würde, während ich versuchte, die Wutschreie aus ihrem teuren Heim zu ignorieren. Ich pumpte und pumpte, und schließlich sprang der Wagen an, fuhr ein paar Meter und soff wieder ab.
»Schaffen Sie dieses stinkende Wrack vor meinem Haus weg, oder ich rufe die Polizei!« Dann wieder die langen irren Schreie. Es dauerte noch eine Weile, dann kam sie heraus, in einem Kimono – eine junge Blondine, wunderschön anzusehen, aber offenbar vollkommen kirre. Schreiend rannte sie außen herum zur Fahrertür, und jedes Mal fiel ihr der halbe Busen heraus. Sie stopfte die Titte wieder rein, und die andere fiel raus. Dann schob sich ein Schenkel aus ihrem geschlitzten Kimono. »Lady, ich bitte Sie«, sagte ich dann immer. »Ich versuch es ja.«
Endlich fuhr der Wagen an, und sie stand mitten auf der Straße, und der ganze Busen hing ihr raus, und sie schrie: »Parken Sie nie wieder vor meinem Haus! Nie, nie, nie wieder!« In solchen Augenblicken überlegte ich, ob es nicht besser wäre, wenn ich mir einen Job suchte.
Aber Doreen brauchte mich. Sie hatte Probleme mit dem Burschen, der im Supermarkt die Sachen in Tüten packte. Ich begleitete sie also und stellte mich neben sie und gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Wenn sie allein war, verlor sie die Beherrschung, und es endete damit, dass sie ihm eine Handvoll Trauben ins Gesicht warf oder sich beim Filialleiter beschwerte oder dem Besitzer des Supermarkts einen Sechs-Seiten-Brief schrieb. Ich nahm ihr den Burschen mit den Tüten ab und kam gut mit ihm zurecht. Ich mochte ihn sogar. Besonders gefiel mir, wie er mit einer einzigen eleganten Handbewegung eine große braune Tüte aufklappen konnte.
Mein erstes privates Gespräch mit Comstock war recht interessant. Bis dahin hatte es nur belanglose Unterhaltungen gegeben, wenn wir abends mit unseren Ladys etwas trinken gingen. Eines Morgens lief ich, nur mit einer Unterhose bekleidet, im Erdgeschoss herum. Doreen war zur Arbeit gefahren. Ich überlegte, ob ich mich anziehen sollte, um rüber in meine Wohnung zu fahren und nach der Post zu sehen. Retha, das Dienstmädchen, war daran gewöhnt, mich in Unterhosen zu sehen. »O Mann«, sagte sie immer, »deine Beine sind so weiß wie Hähnchenschlegel. Kommst du nie in die Sonne?«
Die Küche im Erdgeschoss war die einzige im Haus. Comstock hatte wohl Hunger, denn er ging gleichzeitig mit mir rein. Er trug ein altes weißes T-Shirt mit einem Weinfleck auf der Brust. Ich setzte Kaffee auf, und Retha bot an, uns Spiegeleier mit Schinken zu braten. Comstock setzte sich an den Tisch. »Na«, fragte ich ihn, »wie lange werden wir die beiden noch drankriegen können?«
»Sehr lange. Ich hab dringend Erholung nötig.«
»Ich denke, ich werde auch dranbleiben.«
»Ihr seid mir vielleicht zwei Schnorrer«, sagte Retha.
»Lass die Spiegeleier nicht anbrennen«, sagte Comstock.
Retha servierte uns Orangensaft, Toast, Schinken und Eier. Sie setzte sich zu uns und aß mit und blätterte die letzte Nummer von ›Playgirl‹ durch.
»Ich habe gerade eine richtig schlimme Ehe hinter mir«, sagte Comstock. »Ich brauche eine ausgiebige Ruhepause.«
»Hier ist Erdbeermarmelade für euren Toast«, sagte Retha. »Versucht sie mal.«
»Erzähl mal von deiner Ehe«, sagte ich zu Retha.
»Tja, ich hab mir einen elenden, nichtsnutzigen, stinkfaulen Typ geangelt, der dauernd Billard spielt …«
Sie erzählte uns alles von ihm, und als sie mit ihrem Frühstück fertig war, ging sie nach oben und warf den Staubsauger an. Dann erzählte mir Comstock von seiner Ehe.
»Vor unsrer Heirat war alles bestens. Sie zeigte sich von der besten Seite, aber die andere Hälfte der Karten ließ sie mich nie sehen. Eher mehr als die Hälfte, würde ich sagen.« Comstock trank einen Schluck Kaffee.
»Drei Tage nach der Trauung komme ich nach Hause, da hat sie sich einige Miniröcke gekauft – kürzer als alles, was Sie je gesehen haben. Und als ich reinkam, saß sie da und kürzte die Dinger. ›Was soll denn das?‹ fragte ich, und sie sagte: ›Die Scheißdinger sind zu lang. Ich will sie ohne Slip tragen, und ich steh drauf, wenn die Männer Stielaugen machen, weil sie meine Muschi sehen können, wenn ich von einem Barhocker runtersteige oder so was.‹«
»Das hat sie Ihnen einfach so hingeknallt, hm?«
»Na ja, eine leichte Vorwarnung hatte es eigentlich schon gegeben. Als ich sie ein paar Tage vor der Hochzeit meinen Eltern vorstellte. Sie hatte ein ganz normales Kleid an, und meine Eltern machten ihr ein Kompliment. ›Ach, mein Kleid gefällt Ihnen?‹, sagte sie. Und dann zog sie es hoch und zeigte ihr Höschen her.«
»Das fanden Sie wahrscheinlich noch charmant.«
»Irgendwie ja. Jedenfalls dann fing sie an, in ihren Miniröcken rumzulaufen – ohne was drunter. Sie waren so kurz, dass man ihr zwischen die Arschbacken reinsehen konnte, wenn sie sich nur mal ein bisschen gebückt hat.«
»Hat es den Boys gefallen?«
»Vermutlich, ja. Wenn wir irgendwo reinkamen, haben sie zuerst sie angesehen, dann mich. Sie saßen da und fragten sich, wie ein Kerl so etwas dulden kann.«
»Na ja, wir haben alle unsere Macken. Was solls. Muschi und Arschbacken bleiben sich immer gleich. Man kann nicht mehr daraus machen.«
»Das denken Sie nur so lange, bis es Ihnen mal passiert. Wenn wir aus einer Bar kamen, sagte sie zum Beispiel: ›Hey, hast du den Glatzkopf da in der Ecke gesehen? Der hat meine Muschi richtig verschlungen, als ich aufgestanden bin! Ich wette, der geht jetzt nach Hause und zittert sich einen runter.‹«
»Kann ich Ihnen noch Kaffee nachgießen?«
»Ja, und einen Schuss Scotch dazu. Wir können uns eigentlich duzen. Ich heiße Roger.«
»Okay, Roger.«
»Eines Abends komme ich von der Arbeit, und sie ist fort. Sie hat sämtliche Spiegel und Fenster in der Wohnung eingeschlagen. Und die Wände vollgekritzelt. ›Roger ist das Letzte!‹, ›Roger lutscht Ärsche!‹, ›Roger trinkt Pisse!‹ Lauter so Sachen. Und sie ist fort. Sie hat eine Nachricht hinterlassen. Sie fährt mit dem Bus nach Texas zu ihrer Mutter. Sie macht sich Sorgen. Ihre Mutter ist schon zehnmal im Irrenhaus gewesen. Ihre Mutter braucht sie. Das war die Nachricht.«
»Noch Kaffee, Roger?«
»Nur Scotch diesmal. Ich fuhr zum Busbahnhof, und da sitzt sie und zeigt ihre Muschi her, und achtzehn Kerle mit ausgebeulten Hosenlätzen schleichen um sie herum. Ich setzte mich zu ihr, und sie fing an zu schluchzen. ›Ein Schwarzer‹, erzählt sie mir, ›hat gesagt, ich kann pro Woche tausend Dollar verdienen, wenn ich tue, was er sagt. Roger, ich bin doch keine Hure!‹«
Retha kam wieder die Treppe herunter, griff sich Schokoladekuchen und Eiskrem aus dem Kühlschrank, ging ins Schlafzimmer, stellte den Fernseher an, legte sich aufs Bett und begann zu futtern. Sie war enorm schwergewichtig, aber ein angenehmer Mensch.
»Jedenfalls«, sagte Roger, »ich sagte ihr, dass ich sie liebe, und am Schalter nahm man ihr Ticket zurück und gab ihr das Geld wieder. Ich brachte sie nach Hause. Am nächsten Abend kommt ein Freund von mir zu Besuch, und sie schleicht sich von hinten an und schlägt ihm einen holzgeschnitzten Salatlöffel übern Kopf. Einfach so. Macht sich von hinten ran und bumm. Als er gegangen war, hat sie gesagt, ich müsste sie nur jeden Mittwochabend in den Keramikkurs gehen lassen, dann wär ihr geholfen. Na schön, sag ich. Aber es ist alles umsonst. Als Nächstes geht sie mit Messern auf mich los. Überall Blut. Meines. An den Wänden, auf den Teppichen. Sie ist sehr flink auf den Beinen, denn sie macht Ballett und Yoga, hat es mit Kräutern und Vitaminen, isst Sonnenblumenkerne und Nüsse und all solchen Scheiß. In ihrer Handtasche trägt sie ständig eine Bibel mit sich herum, und die Hälfte der Sprüche ist mit roter Tinte unterstrichen. Sie nimmt sich ihre ganzen Miniröcke und macht sie noch mal anderthalb Zentimeter kürzer. Eines Nachts werde ich gerade noch rechtzeitig wach: Da hechtet sie schreiend über das Fußende vom Bett und hat ein Schlachtermesser in der Hand. Ich wälze mich zur Seite, und die Klinge geht zwölf oder fünfzehn Zentimeter in die Matratze. Ich steh auf und lange ihr eine, dass sie an die Wand fliegt. Sie geht zu Boden und schreit: ›Du Feigling! Du elender Feigling! Du hast eine Frau geschlagen! Du bist ein feiges Aas!‹«
»Tja«, sagte ich. »War vielleicht nicht richtig, dass du sie geschlagen hast.«
»Na jedenfalls, ich zog aus und reichte die Scheidung ein. Aber damit war ich sie noch nicht los. Sie verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Einmal stand ich in einem Supermarkt in der Schlange vor der Kasse, da kam sie rein und schrie mich an: ›Du dreckiger Schwanzlutscher! Du Schwuchtel!‹ Ein andermal erwischte sie mich in einem Waschsalon. Ich nahm gerade meine Sachen aus der Waschmaschine und stopfte sie in den Trockner. Sie stand nur da und sah mich an, ohne ein Wort zu sagen. Ich ging raus, stieg in meinen Wagen und fuhr weg. Als ich wiederkam, war sie nicht mehr da. Ich schaute in den Trockner, und er war leer. Sie hatte alles mitgenommen. Meine Hemden, Hosen, Unterhosen, Handtücher, Leintücher, alles. Dann bekam ich Briefe, in roter Tinte geschrieben, in denen sie mir ihre Träume erzählte. Sie hatte einen Traum nach dem anderen. Sie schnitt Fotos aus Illustrierten aus und kritzelte sie voll. Ich konnte kein Wort entziffern. Abends, wenn ich in meinem Apartment saß, kam sie draußen vorbei, warf eine Handvoll Rollsplitt gegen die Fensterscheibe und brüllte: ›Roger Comstock ist schwul!‹ Man konnte es mehrere Blocks weit hören.«
»Hört sich alles sehr abwechslungsreich an.«
»Dann lernte ich Lynne kennen und zog hier oben ein. Aus meinem Apartment verdrückte ich mich in aller Herrgottsfrühe. Sie weiß nicht, wo ich bin. Ich gab auch meinen Job auf. Und jetzt bin ich hier. Ich denke, ich werde jetzt mal den Hund ausführen. Lynne hat das gern. Wenn sie von der Arbeit kommt, sage ich immer: ›Hey, Lynne, ich hab deinen Hund ausgeführt.‹ Dann lächelt sie. Sie mag das.«
»Okay«, sagte ich.
»Hey, Boner!«, brüllte Roger. »Auf gehts, Boner!« Die verblödete Kreatur kam mit schlabberndem Bauch und triefenden Lefzen herein. Sie zogen zusammen los.
Ich hielt mich noch drei Monate, dann war ich abgemeldet. Doreen lernte einen Burschen kennen, der Ägyptologe war und drei Sprachen beherrschte. Ich ging zurück in meine baufällige Bude in East Hollywood.
Ein knappes Jahr danach kam ich eines Tages in Glendale aus der Praxis meines Zahnarztes, da sah ich Doreen, die gerade in ihren Wagen stieg. Ich sagte ihr Guten Tag, und wir gingen einen Kaffee trinken.
»Was macht der Roman?«, fragte sie.
»Immer noch nicht weiter«, sagte ich. »Ich glaube, das Scheißding bring ich nie zu Ende.«
»Bist du jetzt solo?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.«
»Gut.«
»Gut ist es nicht, aber es geht.«
»Ist Roger noch mit Lynne zusammen?«
»Sie wollte ihn eigentlich abservieren«, erzählte Doreen. »Aber eines Tages ist er stockbesoffen vom Balkon gefallen und war von der Hüfte abwärts gelähmt. Er hat fünfzigtausend Dollar von der Versicherung kassiert. Mit der Zeit hat er sich erholt und konnte wieder gehen. Erst mit Krücken, dann mit einem Stock. Er kann Boner wieder ausführen. Vor Kurzem hat er ein paar ganz tolle Aufnahmen von der Olvera Street gemacht. Hör zu, ich muss wieder los. Ich fliege nächste Woche nach London. Ein Arbeitsurlaub. Alles auf Spesen! Wiedersehn.«
»Wiedersehn.«
Doreen sprang auf, lächelte mir zu, ging raus, bog um die Ecke und war verschwunden. Ich hob meine Kaffeetasse, trank einen kleinen Schluck und setzte sie wieder ab. Die Rechnung lag auf dem Tisch. 1,85 Dollar. Ich hatte noch zwei Dollar in der Tasche. Das kam gerade hin und reichte auch noch für Trinkgeld. Wie ich die verdammte Zahnarztrechnung bezahlen sollte, war ein Problem für sich.
Schrei, wenn du brennst
Henry goss sich einen Drink ein, stellte sich ans Fenster und sah hinaus auf die kahle heiße Straße in Hollywood. Herrgott noch mal, wie lange plagte er sich jetzt schon über die Runden. Und was hatte er? Nichts. Nur noch die Aussicht auf den Tod. Der war immer in der Nähe. Er hatte die Dummheit gemacht, sich eine Untergrundzeitung zu kaufen – sie glorifizierten immer noch Lenny Bruce. Da war wieder das Foto, das ihn tot auf den Fliesen zeigte, nach seinem goldenen Schuss. Gut, Lenny war manchmal ganz witzig gewesen. »Ich kann nicht kommen!« – Dieser Sketch war ein Meisterstück. Aber ganz so toll war er nun auch nicht gewesen. Sicher, sie hatten ihn schikaniert, bis er seelisch und körperlich am Ende war. Na und? Irgendwann musste jeder dran glauben. Das konnte man sich an den fünf Fingern abzählen. Das war nichts Neues. Rumsitzen und darauf warten müssen, das war das Problem.
Das Telefon schrillte. Seine Freundin war dran.
»Hör zu, du Drecksack, ich hab deine Trinkerei satt. Mein Vater hat mich damit schon genug genervt …«
»Ach komm, so schlimm ist es auch wieder nicht.«
»Doch. Und ich will es kein zweites Mal durchmachen.«
»Ich sag dir, du nimmst das viel zu wichtig.«
»Nein, ich hab genug davon. Ich sag dir, mir reichts. Als ich auf der Party gesehen habe, wie du jemand losgeschickt hast, damit er noch mehr Whisky holt, da bin ich gegangen. Ich bin bedient. Ich mach das nicht mehr mit …«
Sie legte auf. Er mixte sich in der Küche einen Scotch mit Wasser, ging ins Schlafzimmer, zog sich bis auf die Unterhose aus und legte sich mit seinem Drink aufs Bett. Es war kurz vor Mittag. Kein Ehrgeiz, kein Talent, keine Chance. Was ihn vor der Gosse bewahrte, war schieres Glück, und das Glück hielt nie lange vor. Das mit Lu war bedauerlich, aber Lu wollte eben einen Sieger. Er trank das Glas aus und machte es sich bequem. Er nahm einen Band Camus vom Nachttisch – ›Der Mensch in der Revolte‹ – und las ein paar Seiten. Camus redete von Angst und Verzweiflung und menschlichem Elend, aber in einer Sprache, die so ausgeruht und blumig war – man hatte den Eindruck, dass die Zustände weder ihn noch seine Schreibe irgendwie erreichten. Genauso gut hätte auf der Welt alles in bester Ordnung sein können. Camus schrieb wie ein Mann, der gerade ein ordentliches Steak mit Fritten und Salat verzehrt und eine Flasche guten französischen Wein dazu getrunken hat. Die Menschheit mochte vielleicht leiden, aber nicht er. Möglich, dass er ein kluger Kopf war, doch Henry las lieber etwas von einem, der schrie, wenn er brannte. Er schubste das Buch über den Bettrand und versuchte zu schlafen. Mit dem Schlafen hatte er seine Schwierigkeiten. Wenn er am Tag drei Stunden Schlaf fand, schätzte er sich schon glücklich. Na ja, dachte er, ich hab immer noch meine vier Wände um mich. Lass einem Mann seine vier Wände, und er hat noch eine Chance. Wenn man erst mal auf der Straße sitzt, ist nichts mehr zu machen.
Es läutete an der Tür. »Hank!«, schrie jemand. »Hey, Hank!«
Scheiße, dachte er. Was ist jetzt wieder?
»Yeah?«, rief er und sah an sich herunter.
»Hey! Was machst du gerade?«
»Augenblick noch …«
Er stand auf, griff sich Hose und Hemd und ging nach vorn ins Wohnzimmer.
»Was machst du?«
»Ich zieh mich an …«
»Du ziehst dich an?«
»Yeah.«
Es war zehn Minuten nach zwölf. Er machte die Tür auf. Draußen stand der Englischprofessor aus Pasadena. Er hatte eine junge Schönheit dabei und stellte sie ihm vor. Sie war Lektorin in einem großen Verlag in New York.
»Ach du reizendes Ding«, sagte er. Er stellte sich dicht vor sie hin und griff ihr an den rechten Schenkel. »Ich liebe dich.«
»Na Sie gehn aber ran«, sagte sie.
»Sie wissen ja – Autoren mussten den Verlegern schon immer den Arsch küssen.«
»Ich dachte immer, es sei umgekehrt.«
»Ist es nicht. Die Hungerleider sind immer die Autoren.«
»Sie interessiert sich für deinen Roman«, sagte der Prof.
»Ich hab nur noch ein gebundenes Exemplar. Das kann ich ihr nicht geben.«
»Na los, mach schon«, sagte der Prof. »Vielleicht kaufen sie die Rechte.«
Gemeint war sein Roman ›Albtraum‹. Er sagte sich, dass sie nur ein Exemplar abstauben wollte.
»Wir waren unterwegs nach Del Mar, aber Pat wollte dich unbedingt mal kennenlernen.«
»Wie nett.«
»Hank hat für meine Studenten eine Dichterlesung gemacht. Wir haben ihm fünfzig Dollar gezahlt. Er hatte solche Angst, dass ihm die Tränen nur so runterliefen. Ich musste ihn buchstäblich ans Mikrofon zerren.«
»Ich war empört. Ganze fünfzig Dollar. Auden kriegte immer zweitausend. Ich finde nicht, dass ich so viel schlechter bin als er. Ich denke eher …«
»Ja, wir wissen schon, was du denkst.«
Henry bückte sich und raffte die alten Rennformulare vor den Füßen der Lektorin zusammen.
»Ich habe elfhundert Dollar Außenstände und komm nicht ran. Die Zahlungsmoral bei den Sexmagazinen ist unsäglich geworden. Mit der Sekretärin von diesem einen Chefredakteur bin ich mittlerweile schon per Du. Eine gewisse Clara. Ich rufe sie an und sage: ›Hallo, Clara, hast du gut gefrühstückt?‹ ›O ja, Hank, und Du?‹ ›Klar‹, sag ich, ›zwei hart gekochte Eier.‹ ›Ich weiß, weshalb du anrufst‹, sagt sie. ›Ja freilich‹, sage ich zu ihr, ›es ist jedes Mal dasselbe.‹ ›Also ich habe deine Honoraranweisung Nummer 984765 für fünfundachtzig Dollar gerade auf dem Tisch.‹ ›Aha. Ich warte aber auch noch auf die Nummer 973895, Clara. Die fünfhundertsiebzig Dollar für die fünf Storys.‹ ›Ach ja. Na, ich werde mal sehn, dass mir Mister Masters die beiden unterschreibt.‹ ›Danke, Clara‹, sage ich. ›Oh, keine Ursache‹, sagt sie, ›ihr Jungs müsst ja zu eurem Geld kommen.‹ ›Eben‹, sage ich. Und dann sagt sie: ›Und wenn du dein Geld nicht bekommst, rufst du wieder an, nicht? Haha.‹ ›Ja, Clara‹, sag ich. ›Dann ruf ich wieder an.‹«
Der Professor und die Lektorin lachten.
»Verdammt, ich komm auf keinen grünen Zweig. Möchte jemand was trinken?«
Sie wollten nicht, also goss sich Henry selbst etwas ein.
»Ich hab es sogar schon mit Pferdewetten versucht. Es ließ sich gut an, aber dann hatte ich eine Pechsträhne und musste aufhören. Ich kann mirs nur leisten, solange ich gewinne.«
Der Professor fing an, sein System zu erläutern, mit dem man in Las Vegas beim Blackjack angeblich groß gewinnen konnte. Henry machte sich an die Lektorin heran.
»Gehn wir doch ins Bett«, schlug er vor.
»Sie sind ja lustig«, sagte sie.
»Ja. Wie Lenny Bruce. Nein, nicht ganz. Er ist tot. Ich bin erst kurz davor.«
»Sie sind trotzdem lustig.«
»Jaja, ich bin der Held. Der Mythos. Der reine Tor, der seine Seele noch keinem Teufel vermacht hat. An der Ostküste versteigern sie meine Briefe für zweihundertfünfzig Dollar das Stück, und ich kann mir nicht mal ’n Furz in ner Tüte kaufen.«
»Ihr Schriftsteller meint immer, ihr kommt zu kurz.«
»Wäre ja möglich, dass wir recht haben. Von seiner reinen Seele kann keiner leben. Man kann damit nicht die Miete bezahlen. Versuchen Sie’s mal.«
»Vielleicht sollte ich doch mit Ihnen ins Bett«, sagte sie.
Der Professor stand auf. »Kommen Sie, Pat«, sagte er, »wir müssen zum ersten Rennen in Del Mar sein.«
Sie gingen zur Tür.
»War nett, Sie kennenzulernen«, sagte sie.
»Hm«, sagte Henry.
»Sie werden es schaffen.«
»Klar«, sagte er. »Wiedersehn.«
Er ging zurück ins Schlafzimmer, zog sich aus und legte sich aufs Bett. Vielleicht würde er jetzt schlafen können. Schlafen war ein bisschen so, als wäre man tot.
Er schlief ein und träumte, er sei auf der Rennbahn. Der Mann am Wettschalter zahlte ihm seinen Gewinn aus, und er verstaute das Geld in der Brieftasche. Es war eine Menge Geld.
»Sie sollten sich eine neue Brieftasche leisten«, meinte der Mann. »Die hier ist ja ganz zerfleddert.«
»Nein«, sagte er. »Die Leute sollen nicht merken, dass ich reich bin.«
Die Türglocke weckte ihn. »Hank!«, schrie jemand. »Hey, Hank!«
»Ja doch … Moment mal …«
Er zog sich wieder an und ging zur Tür. Draußen stand Harry Stobbs. Ein Kollege. Henry kannte zu viele Schriftsteller.
Stobbs kam herein.
»Hast du Geld, Stobbs?«
»Gott, nee.«
»Na schön, kauf ich eben das Bier. Ich dachte immer, du bist reich.«
»Nein. Ich habe bei diesem Girl in Malibu gewohnt. Sie hat mich gut verköstigt und eingekleidet. Aber sie hat mich rausgeworfen. Jetzt hause ich in einer Duschkabine.«
»In einer Duschkabine?«
»Ja. Ist gar nicht schlecht. Sogar mit einer Schiebetür aus Glas.«
»Na gut. Gehn wir. Hast du ein Auto?«
»Nein.«
»Dann nehmen wir meins.«
Sie stiegen in seinen 62er Cornet und fuhren in Richtung Hollywood Boulevard und Normandy.
»Ich hab einen Artikel bei ›Time‹ untergebracht«, erzählte Stobbs. »Mann, ich dachte, jetzt rollt das große Geld. Heute kam der Scheck. Ich hab ihn noch nicht eingelöst. Rate mal, wie viel.«
»Achthundert?«
»Nee, hundertfünfundsechzig.«
»Was? Das ›Time‹-Magazin? Hundertfünfundsechzig Dollar?«
»Ganz recht.«
Sie parkten und gingen in einen kleinen Getränkeladen, um das Bier zu holen. »Meine hat mich auch abgehängt«, sagte Henry. »Sie behauptet, ich trinke zu viel. Eine glatte Lüge.« Er griff in die Kühltruhe und nahm zwei Sixpacks heraus. »Ich muss langsam tun. War letzte Nacht auf einer fürchterlichen Party. Nichts als hungernde Schriftsteller. Und Professoren, denen demnächst der Job flöten geht. Dieses ewige Tratschen und Fachsimpeln. Geht einem richtig an die Substanz.«
»Schriftsteller sind Nutten«, sagte Stobbs. »Sie sind die Nutten des Universums.«
»Den Nutten geht es in diesem Universum wesentlich besser als uns, Freund.«
Sie gingen zur Kasse.
»›Auf Flügeln des Gesangs‹«, sagte der Inhaber des Getränkeladens.
»›Auf Flügeln des Gesangs‹«, antwortete Henry.
Vor einem Jahr war in der ›L.A. Times‹ ein Artikel über Henry und seine Gedichte erschienen. Den Inhaber des Ladens hatte der Artikel sehr beeindruckt, und das Zitat daraus war zu einem Ritual geworden. Henry hatte es anfangs nicht ausstehen können, doch inzwischen fand er es amüsant. Auf Flügeln des Gesangs. Weiß Gott.
Sie stiegen wieder in den Wagen und fuhren zurück. Die Post war gekommen. Im Briefkasten lag ein einsamer Umschlag.
»Vielleicht ist ein Scheck drin«, sagte Henry.
Er nahm den Brief mit rein, machte zwei Flaschen Bier auf, öffnete den Brief und las ihn vor:
»Sehr geehrter Mister Chinaski, ich habe gerade Ihren Roman ›Albtraum‹ und Ihren Gedichtband ›Fotos aus der Hölle‹ gelesen, und ich finde, Sie sind ein großer Schriftsteller. Ich bin verheiratet, 52 Jahre alt, und meine Kinder sind erwachsen. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Hochachtungsvoll, Doris Anderson.«
Der Brief kam aus einer Kleinstadt in Maine.
»Gar nicht gewusst, dass in Maine noch welche leben«, sagte Henry.
»Leben tun sie bestimmt nicht«, meinte Stobbs.
»Doch. Jedenfalls die hier.«
Henry stopfte den Brief in den Müllsack. Das Bier tat gut. Die Krankenschwestern, die im Hochhaus auf der anderen Straßenseite wohnten, kamen von der Arbeit. Es wohnten ziemlich viele Krankenschwestern da drüben. Die meisten trugen eine dünne Kluft, die allerhand sehen ließ, und die tief stehende Sonne tat das Übrige. Henry und Stobbs sahen ihnen zu, wie sie aus ihren Autos stiegen und durch die Glastür ins Gebäude gingen. Um in ihren Apartments zu verschwinden und sich nach dem Duschen vor den Fernseher zu setzen.
»Sieh dir die da an«, sagte Stobbs.
»Hm.«
»Da kommt noch eine.«
»Herrje!«
Wir benehmen uns wie Fünfzehnjährige, dachte Henry. Wir verdienen es nicht, am Leben zu sein. Ich wette, Camus hat nie aus dem Fenster gelinst.
»Wie willst du über die Runden kommen, Stobbs?«
»Na ja, solang ich die Duschkabine habe, steh ich ganz gut da.«
»Warum suchst du dir nicht einen Job?«
»Einen Job? Ist dir nicht gut?«
»Ja, wahrscheinlich hast du recht.«
»Sieh dir die da an! Was die für einen Arsch hat!«
»Ja. Wahrhaftig.«
Sie setzten sich und nahmen sich das Bier vor.