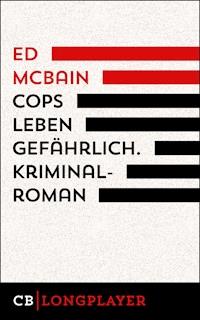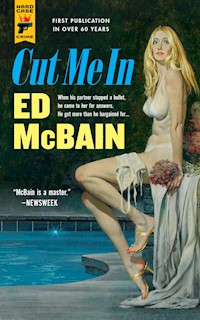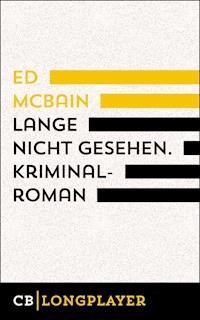
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In Vietnam verlor Jimmy Harris sein Augenlicht – in den Straßen des 87. Polizeireviers sein Leben. Der Mörder betäubt erst den Blindenhund mit Chloroform und schlitzt dann Jimmys Kehle auf. Detective Carella und seine Kollegen vernehmen als erste die Frau des Verstorbenen, die am Tage darauf aber ebenfalls ermordet wird. Jetzt haben die Detectives nur noch einen Anhaltspunkt auf der Suche nach dem Täter: den Alptraum, den Jimmy zehn Jahre vor seiner Ermordung einem Militärpsychologen erzählte. Und das ist ein Traum, der es in sich hat… »Einfach die besten Polizeigeschichten, die in den USA geschrieben werden« Washington Post
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Ähnliche
Über das Buch
In Vietnam verlor Jimmy Harris sein Augenlicht – in den Straßen des 87. Polizeireviers sein Leben. Der Mörder betäubt erst den Blindenhund mit Chloroform und schlitzt dann Jimmys Kehle auf. Detective Carella und seine Kollegen vernehmen als erste die Frau des Verstorbenen, die am Tage darauf aber ebenfalls ermordet wird.
Jetzt haben die Detectives nur noch einen Anhaltspunkt auf der Suche nach dem Täter: den Alptraum, den Jimmy zehn Jahre vor seiner Ermordung einem Militärpsychologen erzählte ...
»Einfach die besten Polizeigeschichten, die in den USA geschrieben werden« Washington Post
Über den Autor
Ed McBain
Lange nicht gesehen
Ein Kriminalroman aus dem 87. Polizeirevier
Ins Deutsche übertragen von Helmut Bittner
Impressum
Digitale Neuausgabe: © CulturBooks Verlag 2015
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten Deutsche Erstausgabe: 1966, Rowohlt Verlag Originalausgabe: Long Time No See, 1977 © Ed McBain © Copyright der deutschen Übersetzung: Uwe Anton
eBook-Cover: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 10.12.2015
ISBN: 978-3-944818-98-6
Dieses Buch ist Ronnie und Lucille King gewidmet.
Die hier geschilderte Stadt existiert nicht. Die Personen und Schauplätze sind frei erfunden. Die Darstellung der Polizeiarbeit allerdings basiert auf authentischen Ermittlungsmethoden.
1. KAPITEL
Er stellte sich die Stadt als eine Art Milchstraße vor. Wie einen Haufen Planeten, der sich um eine strahlende Sonne drehte. Asteroiden und Kometen strömten durch die Finsternis des Raums. Manchmal schienen hinter seinen Augen Farbfontänen emporzuschießen, Leuchtspurmunition zog Zickzackbahnen und verlosch, Himmelsraketen schwebten durch die ewige Nacht seiner Blindheit.
Er war blind, aber er kannte diese Stadt.
Manchmal wurde es hier im November schon bitter kalt. Für ihn war dieser Monat immer der schlimmste. Im November konnte er sich einfach nicht warm halten. Sogar der Hund schauderte im November vor Kälte. Der Hund war ein großer schwarzer Labrador mit der Ausbildung als Blindenführer. Der Hund hieß Stanley. Er musste immer lachen, wenn er sich den Hund vorstellte. Ein Schwarzer mit einem schwarzen Hund. Erst heute Vormittag hatte ihm jemand eine Münze in die Sammelbüchse geworfen, dem Klang nach einen Vierteldollar und dann gefragt: »Wie heißt der Hund, Mann?« Er hatte sogleich erkannt, dass ein Schwarzer mit ihm sprach. Er konnte allein an der Stimme erkennen, was für einen Menschen er vor sich hatte, auch seine Hautfarbe und Nationalität.
»Der Hund heißt Stanley«, war seine Antwort gewesen.
»Dann pass schön auf, Bruder Stanley«, sagte der Mann und ging weiter.
Bruder Stanley. Der Hund war schwarz, deshalb wurde er automatisch als Bruder angesehen. Stanley hatte den Schwätzer bestimmt angeschaut, als habe er einen Verrückten vor sich. Guter alter Hund. Ohne ihn wäre er verloren. »Brav, Stanley«, sagte er und tätschelte den Kopf des Tieres. Der Hund antwortete nicht. Er gab überhaupt nur selten mal Laut, der alte Stanley. Ein Glück nur, dass er den Hund hatte. Die Mitbewohner des Häuserblocks hatten das Geld für den Ankauf des Tieres aufgebracht, als er mit zerschossenen Augen aus dem Krieg heimgekehrt war. Stanley war kein deutscher Schäferhund, aber genauso ausgebildet. Sein Hund führte ihn in der Stadt überall hin. Er liebte diese Stadt. Er hatte sie schon gemocht, als er noch sehen konnte und liebte sie immer noch. Heute Abend, auf dem Weg zur Innenstadt, hatte ihm in der Untergrundbahn ein Mann seinen Platz angeboten. Der Stimme nach ein Italiener. »He, Kumpel, wollen Sie sitzen?« Dabei hatte er seinen Ellbogen sanft berührt. Der Fremde wusste offenbar über den Umgang mit Blinden Bescheid. Er packte nicht einfach zu, so dass man zu Tode erschrak. Ganz leicht hatte er ihn am Ellbogen berührt, mehr nicht. ›He, Kumpel, wollen Sie sitzen?‹ So wie er das sagte, musste er ganz bestimmt mit Blinden vertraut sein. Ganz sicher. In seiner Stimme klang nichts so, als spräche er zu einer alten Dame oder zu einem Krüppel. Nein, er sprach schlicht von Mann zu Mann. Wenn du meinen Sitzplatz willst, kannst du ihn haben. Sonst hätte er das Angebot zurückgewiesen. Dieser Mann aber spielte nicht den Mitleidigen. Er wollte es nur ein wenig leichter machen. Das war annehmbar.
Wenn man erblindet ...
Wenn man zwanzig Jahre alt ist und auf einmal erblindet, halten einen die Leute plötzlich für einen alten Mann. Vor zehn Jahren war er aus dem Krieg heimgekehrt, Augen weg, dunkle Brille auf, Mama und Chrissie hatten schrecklich geweint. Lasst es gut sein, lasst es gut sein, hatte er gesagt, das ist doch nichts weiter, das ist doch nichts. Scheiße, von wegen das ist nichts. Ich bin blind. Das ist es.
Aber dann lernt man, wie man wieder sehen kann. Wie man den alten Stanley dazu benutzt, sich überall hinführen zu lassen. Wie man Blindenschrift liest und mit Hilfe der Leittafel schreibt. Solche Sachen, wie die Schuhbänder zuschnüren, kann man sowieso – die meisten Leute schauen nicht mal hin, wenn sie ihre Schuhe zuschnüren. Wenn es um die Schnürsenkel geht, spielt es keine Rolle, ob man blind ist oder nicht. Und mit ein paar Münzen in der Sammelbüchse klappern ist leichte Arbeit. Man braucht sich nur ein selbstgemaltes Schild um den Hals zu hängen und schon ist man selbständiger Geschäftsmann. Sein eigener freier Unternehmer. ›Gott vergelt’s‹ hatte Chrissie für ihn auf ein Stück Karton gemalt. Die Schnur, an der er das Schild um den Hals trug, war links und rechts oben durch eingebohrte Löcher gezogen und befestigt. Das Schild, die blecherne Sammelbüchse und Stanley, der schwarze Labrador, so war er auf dem besten Weg, ein Vermögen zu verdienen. Immer und ewig sollte er dankbar sein für den Krieg. Wie sonst wäre er zu einem eigenen Unternehmen gekommen?
Das war vor zehn Jahren gewesen.
Volle Schwerversehrtenpension. Sammelbüchse. Rassel, rassel mit Münzen darin und lausche auf den Klang weiterer Geldstücke, die hineingeworfen werden. Zähl sie am Ende des Tages zusammen. Bring sie heim zu Isabel, wo ihr sie beide gemeinsam zählt. Setz dich an den Küchentisch, breite die Münzen auf der Wachstuchdecke aus. Ihre Hände, seine Hände betasten die Münzen, sortieren, tasten, tasten. Vor sechs Jahren hatte er Isabel in einer Bar am Stern kennengelernt. Er hatte sich damals schon zu einem recht erfolgreichen Bettler entwickelt. Er schlurfte hinter dem alten Stanley her, lauschte auf die summenden Geräusche der Stadt rings um ihn herum, pickte sich einzelne Laute heraus. Das war seine Unterhaltung, während er langsam den Gehweg entlangschritt, die klappernde Büchse in der Hand und ein Schild um den Hals – ein neues übrigens, das von einem Mann gemalt worden war, der an der South Twelfth einen Laden betrieb –, wobei seine rechte Hand Stanleys Führgeschirr hielt. Er hatte einen guten Tag gehabt. Deshalb kehrte er auf einen Drink in eine Bar ein. Es musste etwa vier Uhr nachmittags gewesen sein. Neben ihm saß eine Frau. Sie roch nach Parfüm und Whisky. Im Hintergrund spielte der Musikautomat.
»Was darf es sein, Jimmy?«, fragte der Barkeeper.
»Bourbon mit Wasser.«
»Wird gemacht.«
»Mein Daddy hat immer Bourbon mit Wasser getrunken«, sagte die Frau.
Der Stimme nach eine Weiße. Aus den Südstaaten.
»Wirklich?«
»Ja. Daheim hält man viel von Bourbon mit Quellwasser. Ich komme aus Tennessee.«
»Ja«, antwortete er.
»Bitte, das ist für dich, Jimmy.«
Das Geräusch des auf die Theke gestellten Glases. Seine Hand tastete forschend umher, bekam das Glas in die Finger. »Prost«, sagte er und trank.
»Prost«, sagte die Frau. »Ich heiße Isabel Cartwright.«
»Ich bin Jimmy Harris.«
»Freut mich.«
»Sind Sie weiß?«, fragte er.
»Sehen Sie das nicht?«
»Ich bin blind«, erklärte er.
Sie lachte leise. »Ich auch«, sagte sie.
Sechs Monate später heirateten sie. Blind wie die Fledermäuse, alle beide. Nahmen sich eine Wohnung an der Seventh in der Nähe von Mason, wollten nicht in dem verkommenen Stadtteil von Diamondback wohnen, nicht, weil er jetzt eine weiße Frau hatte, sondern nur, weil Diamondback weder für Weiße noch für Schwarze einen guten Ruf hatte. Den Namen hatte dieses Viertel von den Schwarzen erhalten, sollte wohl sarkastisch oder komisch klingen, war aber so spaßig wie eine Klapperschlange und auf jeden Fall genauso tödlich. Ihr Vater kam zur Hochzeit von Tennessee herauf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie sechs Monate zusammengelebt. Es hätte ihnen nichts ausgemacht, wenn der alte Mann geschimpft und getobt hätte, sie hätten ihn einfach nach Hause geschickt, wo er in seinem Bourbon mit Quellwasser ersaufen mochte. Aber er war ein netter, alter Knabe, sagte, er wüsste, dass seine Tochter gut aufgehoben wäre. Zwar musste sie durchaus einen Mann heiraten, der nicht die Hand vor seinem schwarzen Gesicht erkennen konnte, aber immerhin, er würde gut für sie sorgen.
Nun, das hatte er getan.
Manchmal tanzten sie zusammen.
Sie stellten das Radio an und tanzten danach. Vor dem Krieg war er ein guter Tänzer gewesen. Musik, er hörte innen drin immerzu Musik. Das war wie mit den zuckenden Lichtem hinter seinen blinden Augen. Früher hatte er immer gemeint, blind zu sein bedeute ständige Finsternis. Stimmte aber gar nicht. Lichter blitzten auf. Elektrische Impulse des Gehirns, Erinnerungsbilder oder sonst etwas. In seinem Kopf war immer etwas los. Vor den Augen konnte er nichts sehen, dafür sah er umso mehr hinter ihnen. Berührte ihr Gesicht. Ein schönes Gesicht. Blondes Haar, sagte sie. Der alte Jimmy Harris hatte sich da eine tolle Biene aufgerissen. Er liebte sie halb zu Tode. Für sie schüttelte er die verdammte Sammelbüchse und im Bett nahm er sie vor, dass ihre Knochen knackten.
Seiner Schätzung nach befand er sich zwei Häuserblocks von dem Gebäude der Seventh Street entfernt, in dem sie wohnten. Er war mit der Untergrundbahn bis zur Fourth gekommen und überquerte jetzt den Hannon Square, auf dem die Statue des Generals aus dem Ersten Weltkrieg auf einem Pferd sitzend ein kleines Rasenstück beherrschte, das von Walnussbäumen umgeben wurde. In seinem verdammten Krieg hatte es keine Pferde gegeben. Punji-Stöcke und Dorfüberfälle, umzingelt das Dorf, kämpft euch mitten hindurch – das war sein Krieg gewesen. Immer den Blick auf den Dschungelboden richten. Gut gemacht, Jimmy, den hast du erwischt. Seine M-16 war immer noch auf Automatik geschaltet. Er hatte die Büsche rechts vom Pfad, aus denen das plötzliche Maschinengewehrfeuer kam, mit einem Kugelregen bestrichen. Dann war es auf einmal still. Die Stimme des Sergeanten. Gut gemacht, Jimmy, den hast du erwischt.
Er wartete.
Er trug über dem baumwollenen Dschungelhemd eine Tarnjacke aus Kunststoff, dazu Feldhosen, mit Leder besohlte Dschungelstiefel aus Segeltuch mit Wasserabflusslöchern, schwarze Nylonsocken, einen Helm mit Tarnnetz und ein stählernes Feldkochgeschirr mit einem Tarnüberzug. An den Schulterriemen seines Gürtels baumelte ein Behälter für Erste Hilfe mit Notverbandpäckchen, Salztabletten und Fußpuder, ferner ein Munitionsbeutel mit Magazinen für sein automatisches Sturmgewehr, ein Claymore-Beutel mit sechs M-26-Sprenggranaten und zwei Rauchgranaten, ein Bajonett, eine Schutzmaske und zwei Flaschen mit Wasser. Er duckte sich ins Unterholz, wartete, lauschte. Er hörte den Zugführer über Funk die Schützengruppe Bravo zur Unterstützung anfordern.
Die Granate kam von irgendwoher weit rechts drüben. Der Warnruf von einem der Männer aus der Gruppe Alpha erreichte ihn zu spät. Er drehte sich um und sah gerade noch, wie die Granate durch die dumpfe Dschungelhitze heranzischte wie ein seltener Tropenvogel. Er wollte sich hinwerfen, weg von der Granate und flach in die Büsche hinter sich, als sie etwa einen Meter über seinem Kopf explodierte. Reines Glück, dass ihm dabei nicht der ganze Kopf weggeblasen wurde. Ihm wurde nur die Stirn aufgerissen und seine Augäpfel verwandelten sich in eine Art Rührei. Der Arzt im Frontlazarett meinte, er habe Glück gehabt, dass er überhaupt noch am Leben sei. Das geschah, nachdem Bravo ihnen zu Hilfe gekommen war. Seit jenem Tag hatte er nichts mehr gesehen. Am 14. Dezember war es passiert. Elf Tage vor Weihnachten, vor zehn Jahren. Seither war er blind.
Jetzt, im November, trugen die Nussbäume am Hannon Square keine Blätter. Er hörte den Wind in den nackten Zweigen seufzen. Er näherte sich der Statue – es gibt Dinge, die ein Blinder spüren kann, etwa von Objekten widerhallendes Echo, zurückgestrahlte Wärme, Bewegungen, die Veränderungen des Luftdruckes hervorrufen oder die man auf dem Gesicht spürt. Irgendwo oben an der Culver Avenue wurde knirschend an einem Bus die Gangschaltung eingerückt. Das hörte er genau. In der Luft hing der Geruch von Schnee. Er hoffte, es würde nicht schneien. Schnee erschwerte es ihm, zu ...
Stanley blieb plötzlich stehen.
Jimmy zog am Geschirr. Der Hund rührte sich nicht vom Fleck.
»Was hast du denn?«, fragte er.
Der Hund knurrte.
»Stanley?«, sagte der Blinde.
Stille ringsum, bis auf das Knurren des Hundes.
»Wer ist da?«, fragte er.
Er roch etwas, das er sofort erkannte. Den gleichen Geruch hatte er bei der Operation im Feldlazarett wahrgenommen. Der Novemberwind trug ihm den Gestank zu. Chloroform. Bis herauf in das Ledergeschirr in seiner Hand spürte er, wie der Hund sich spannte und verkrampfte. Dann begann das Tier plötzlich zu winseln. Der Chloroformgeruch wurde betäubend stark. Er drehte den Kopf weg und fühlte, wie das Gewicht des Hundes am Geschirr zog. Stanley fiel auf den Gehweg. Er versuchte, den Hund auf den Füßen zu halten. Mühte sich ab. Er beugte sich nach rechts, der Windseite zu. Der Hund lag jetzt auf dem Gehweg. Über sich hörte Jimmy das Rauschen und Knistern der Zweige des Walnussbaums. Er kam sich plötzlich verloren vor. Er wollte das Führgeschirr nicht loslassen, denn – völlig unvernünftigerweise – hatte er das Gefühl, erst richtig blind zu sein, wenn er den lederbezogenen Handgriff losließ. Der Hund war für ihn gleichbedeutend mit Augenlicht. Aber er wusste, dass Stanley bewusstlos war, wusste, dass man das Tier mit Chloroform betäubt hatte. Seine Hand öffnete sich. Er ließ das Geschirr los, als entglitte ihm eine lebensrettende Sicherheitsleine. Er trat von dem Tier zurück. Der Novemberwind rauschte in seinen Ohren. Keine Schritte.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
Schweigen. Nur der Wind.
»Wer sind Sie? Was wollen Sie?«
Plötzlich fühlte er sich von hinten gepackt. Irgendwer drückte ihm den Ellbogen unter das Kinn. Der Kopf wurde ihm nach hinten gerissen, das Kinn emporgehoben. Und dann Schmerz. Eine wie Feuer brennende Linie quer über die Kehle. Sein Hemdkragen wurde plötzlich nass. Warm. Die weit gespreizten Finger seiner linken Hand stießen zuckend in die leere Luft. Er keuchte erstickt, rang nach Atem. Im nächsten Augenblick sank er neben dem Hund auf den Gehweg. Blut strömte aus der aufgeschlitzten Kehle, rann in hellroten Bächen bis zum Fuß des Denkmals, floss darum herum, dann schräg über das Pflaster und verschwand in den Berberitzenbüschen.
Die Frau, die an jenem Donnerstag zehn Minuten vor acht Uhr die Leiche fand, stammte aus Puerto Rico und verstand kein Englisch. Sie schaute auf den Mann und den Hund hinunter, hielt beide zunächst für tot und entdeckte dann, dass das Tier noch atmete. Zunächst wollte sie einfach weitergehen und die ganze Sache vergessen. Es lohnte sich nie, sich in anderer Leute Angelegenheiten einzumischen, schon gar nicht, wenn ein Mann auf dem Gehweg lag, dem man in den Hals hineinsehen konnte. Da erst ging ihr auf, dass das Tier ein Blindenhund war und der Ermordete tat ihr auf einmal unendlich leid. Den Kopf schüttelnd und mit der Zunge schnalzend ging sie quer über die Straße zur Telefonzelle. Sie warf eine Münze in den Schlitz und wählte die 911. Sie wusste, wie man 911 zu wählen hat, denn alle Erläuterungen zu dieser Nummer waren in Englisch und Spanisch angeschlagen und in diesem Stadtteil war es nur von Vorteil, wenn man wusste, wie man im Notfall die Polizei erreichen konnte. Der Mann, der den Anruf entgegennahm, verstand Spanisch. Auch er war spanischer Herkunft. Seine Familie war während der großen Einwanderungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg von Mayagüez herübergekommen. Damals war er zwölf Jahre alt gewesen. Er sprach jetzt völlig akzentfreies Englisch, dafür war sein Spanisch inzwischen ziemlich fehlerhaft. Immerhin konnte er dem aufgeregten Geschnatter entnehmen, dass sie nahe dem Denkmal auf dem Hannon Square einen toten Blinden gefunden hatte. Als er nach ihrem Namen fragte, hängte die Frau den Hörer ein.
Dafür hatte er volles Verständnis. So war das nun mal in dieser Stadt.
Der Funkstreifenwagen war schräg an den Rinnstein herangefahren, als die Detectives Carella und Meyer am Tatort erschienen. Gleich dahinter stand eine schwarze Limousine, die wie ein Leichenwagen aussah. Carella nahm an, dass sie der Mordkommission gehörte.
»Sieh mal an«, sagte Monoghan, »wen wir da haben.«
»Ja, ja«, meinte Monroe.
Die beiden Detectives von der Mordkommission standen mit den Händen in den Taschen zu beiden Seiten des auf dem Pflaster zusammengekrümmten toten Mannes.
Die beiden Beamten waren fast gleich gekleidet. Beide trugen schwarze Mäntel und graue Fedorahüte sowie blaue Wollschals. Beide waren untersetzt, mit breiten Schultern, muskelbepackten Brustkörben und Schenkeln, gefurchten Gesichtern und darin Augen, die an Leichen gewöhnt waren, ganz gleich ob blinde oder nicht. Monoghan und Monroe sahen aus wie Killer der Mafia.
»Wir stehen hier schon seit zehn Minuten herum«, sagte Monoghan sofort.
»Zwölf«, verbesserte Monroe mit einem Blick auf die Uhr.
»Wir haben heute Abend ein paar Leute zu wenig«, sagte Carella.
»Wir haben schon per Funk einen Leichenwagen angefordert«, erklärte Monoghan.
»Und der Arzt ist auch schon unterwegs.«
»Die Leute vom Labor auch.«
»Dafür dürfen Sie sich bei uns bedanken«, meinte Monroe.
»Danke«, sagte Carella und schaute auf den Leichnam hinab.
»Der Kerl ist mausetot«, meinte Monoghan.
»Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten«, fügte Monroe hinzu.
»Sieh dir mal die Röhren im Hals an.«
»Man könnte das Kotzen kriegen.«
In der Stadt, wo diese Männer angestellt waren, ist es zwingend vorgeschrieben, dass Mitglieder der Mordkommission den Schauplatz eines Mordes aufsuchen, obwohl die nachfolgende Untersuchung von den Beamten des Reviers ausgeführt wird, das den Anruf entgegengenommen hat. In seltenen Ausnahmefällen steuern die Detectives der Mordkommission tatsächlich eine Idee oder das Bruchstück einer Information als Hilfe zur Lösung eines Falls bei, das aber nur in ihrer Eigenschaft als speziell ausgebildete Überwacher und Berater. Meistens standen sie nur im Weg herum. Monoghan und Monroe hatten den üblichen Ablauf bereits damit durcheinandergebracht, dass sie vor dem Eintreffen des Polizeiarztes nach einem Leichenwagen telefoniert hatten. Der Abend war kalt. Niemand hatte etwas dafür übrig, sich bei einer Temperatur nahe dem Gefrierpunkt warmzuzittern. Die Leute vom Krankenhaus durften den Leichnam erst nach der ärztlichen Untersuchung mitnehmen.
»Ich hasse Stichwunden«, sagte Monoghan.
»Das ist keine Stichwunde«, widersprach Monroe.
»Ach? Was denn sonst? Eine Vergiftung? Da liegt ein Mann mit aufgeschnittener Kehle. Ist er vielleicht aufgehängt worden?«
»Hier handelt es sich um eine Schnittwunde«, stellte Monroe fest. »Da besteht ein Unterschied. Ein Stich« – seine rechte Hand fuhr plötzlich aus der Manteltasche, seine Faust umklammerte einen imaginären Dolch. »Ein Stich ist, wenn man ruck, zuck macht«, dozierte er und stieß mit der Faust in die Luft. »Das ist ein Stich. Eine Schnittwunde entsteht, wenn man ›pffft‹ macht«, fuhr er fort, wobei er den imaginären Dolch quer durch die Luft führte.
»Wenn jemand mit dem Messer bearbeitet wird, ist das in meinen Augen eine Stichwunde«, sagte Monoghan.
»Für mich auch«, lenkte Monroe ein.
»Warum willst du also ...«
»Ich rede davon, was die Ärzte nach der Autopsie sagen werden. Die Autopsie wird ergeben, dass es sich um eine Schnittwunde handelt.«
»Ja, aber ich rede von dem, was ich meiner Frau morgen beim Frühstück erzählen werde. Soll ich ihr vielleicht erklären, wir hätten einen Mann gefunden, der totgeschnitten worden ist?«, fragte Monoghan und stieß ein lautes Lachen aus.
Auch Monroe begann zu lachen. Ihr Atem bildete weiße Nebel in der frostklaren Luft. Ihr fröhliches Wiehern hallte auf dem kleinen Platz wider, wo der Tote nahe dem Denkmal auf dem Rücken lag. Carella vernahm aus der Feme das Jaulen der Sirene eines herannahenden Krankenwagens. Dem Toten war die dunkle Brille von der Nase gefallen. Die Gläser lagen zersplittert neben ihm auf dem Pflaster. Carella betrachtete die vernarbten offenen Höhlen, wo sich einst seine Augen befunden hatten. Er wendete sich ab. Knapp anderthalb Meter von dem Toten entfernt lag der schwarze Labradorhund auf der Seite. Meyer kniete neben dem Tier nieder. Das Blut aus der aufgeschlitzten Kehle des Mannes war über den Gehweg geflossen und hatte das buschige, schwarze Haar an dem massigen Brustkorb des Hundes benetzt. Das Tier atmete noch. Meyer fragte sich, was man wohl mit dem Hund anfangen sollte. Einen Fall mit einem bewusstlosen Hund hatte er noch nie erlebt.
»Was machen wir mit dem Hund?«, wandte er sich an Carella.
»Darüber habe ich auch gerade nachgedacht.«
»Das ist ein Blindenhund«, mischte sich Monoghan ein.
»Sicher hat er gesehen, wer es getan hat. Vielleicht solltet ihr ihn mal fragen, wer es war.«
Darüber musste Monroe wieder laut lachen. Monoghan hielt sich als Erfinder dieses köstlichen Witzes bescheiden einen Moment lang zurück, ehe auch er in das Gelächter einstimmte. Gemeinsam lachten sie grölend in die Stille der Nacht hinein.
Als der Krankenwagen ankam, war der Hund noch immer bewusstlos. Inzwischen hatten sich vier Polizeiwagen mit rotierenden Warnlichtern eingefunden. Rings um den Platz wurden Absperrgitter aufgerichtet. Der Abend war kalt. Trotzdem begannen Neugierige herbeizuströmen und Streifenpolizisten mussten die Leute zum Weitergehen auffordern. Sie sollten sich besser um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. »Hier gibt’s nichts zu sehen, Leute, weitergehen, bitte!« Der Notarzt entstieg dem Krankenwagen und hielt sogleich nach jemandem mit einer Polizeimarke am Mantel Ausschau. Er ging dorthin, wo Carella und Meyer bei den beiden Männern von der Mordkommission standen. Er warf einen Blick auf den Leichnam.
»Können wir ihn mitnehmen?«, fragte er.
»Noch nicht«, erwiderte Carella. »Der Gerichtsmediziner hat ihn noch nicht untersucht.«
»Warum habt ihr uns dann jetzt schon angerufen?«, wollte der Arzt vom Krankenhaus wissen.
»Sie können ruhig ein paar Minuten warten«, sagte Monoghan. »Das wird Sie nicht gleich umbringen.« Der Arzt sah ihn an.
»Ja«, fügte Monoghan hinzu und nickte.
»Leiten Sie hier die Untersuchung?«, fragte ihn der Arzt.
»Ich habe den Krankenwagen kommen lassen.«
»Das hätte noch Zeit gehabt«, erklärte der Arzt sachlich.
Er machte auf dem Absatz kehrt und ging zu dem Krankenwagen am Rinnstein hinüber. Sein Assistent hatte bereits die hintere Tür geöffnet. Der Arzt ließ ihn sie wieder schließen.
Der stellvertretende Gerichtsmediziner traf zehn Minuten später ein. Inzwischen hatte der Doktor vom Krankenwagen viermal damit gedroht, wieder abzufahren. Jedes Mal beruhigte ihn Carella. Und jedes Mal wiederholte der Doktor: »Inzwischen sterben in der Stadt wer weiß wie viele Menschen.«
Der Gerichtsmediziner hieß Michael Horton. Er trug zum Anzug einen Querbinder, einen dunklen Mantel, keinen Hut, aber schwarze Lederhandschuhe. Er zog den rechten Handschuh aus, ehe er Carella begrüßte. Dann kniete er nieder, um den Leichnam zu untersuchen. Der Polizeifotograf trat zur Seite und begann, Bilder von dem Hund aufzunehmen.
»Klar, ganz klar«, sagte Horton. »Trachea, Karotiden und Halsschlagader durchtrennt. Da haben Sie gleich die Todesursache. Sonst keinerlei Verletzungen an dem Mann. Sehen Sie sich die Hände an. Keine Schnitte, wie sie bei der Abwehr entstehen. Nichts. Klar. Muss eine große Klinge gewesen sein. Nur ein Schnitt, sehr tief. Das bekommt niemand mit einem Taschenmesserchen hin. Das dürfen Sie mir glauben. Oh ja, ganz klar. Nichts deutet auf ein Zögern hin, ganz glatte Wundränder. Helfen Sie mir mal, ihn umzudrehen.« Carella kniete nieder. Gemeinsam rollten sie den Leichnam auf den Bauch. Horton betrachtete den Rücken. »Hier ist nichts. Keinerlei Spuren«, stellte er fest. Er zog den Mantelkragen des Toten hoch und untersuchte den Nacken. »Der Schnitt reicht beinahe bis zum Rückgrat. Okay, drehen wir ihn wieder zurück.« Zusammen mit Carella brachte er den Leichnam in die vorige Lage. »Ich möchte, dass seine Hände in Plastiktüten gesteckt werden. Vielleicht hat er den Angreifer gekratzt oder wir finden andere Spuren unter seinen Nägeln. Die Fingerabdrücke wollen Sie doch nicht gleich hier nehmen oder?«
»Wir wissen noch nicht, wer er ist.«, sagte Carella.
»Ich warte noch, bis ihr seine Taschen geleert habt«, entschied Horton. »Ohne der Autopsie vorzugreifen, würde ich als Todesursache eine Schnittwunde an der Kehle angeben.«
»Was habe ich gesagt!«, rief Monroe.
»Bitte, was?«, fragte Horton.
»Nichts«, sagte Monoghan und warf Monroe einen bösen Blick zu.
»Was wird mit dem Hund?«, fragte Carella.
»Welcher Hund?«
»Da drüben. Wollen Sie den Hund nicht auch untersuchen?«
»Hunde gehen mich nichts an«, lehnte Horton ab.
»Ich dachte ...«
»Ich bin doch kein Tierarzt. Hunde untersuche ich nicht.«
»Ja, aber wer ist dafür zuständig?«, erkundigte sich Carella.
»Keine Ahnung«, sagte Horton. »In allen meinen Jahren als Gerichtsmediziner musste ich noch nie einen toten Hund begutachten.«
»Der Hund ist noch am Leben«, sagte Carella.
»Warum soll ich ihn dann untersuchen?«
»Um festzustellen, was mit ihm los ist. «
»Woher soll ich wissen, was ihm fehlt? Ich bin kein Tierarzt.«
»Der Hund ist bewusstlos«, erklärte Carella. »Ich dachte, Sie würden ihn mal ansehen und uns sagen können, was ...«
»Nein, das gehört nicht zu meinen Aufgaben«, lehnte Horton ab. »Ich bin hier fertig. Geben Sie her, was ich zu unterschreiben habe. Ich warte, während Sie nach seinen Papieren suchen.«
»Ich weiß nicht, ob der Fotograf schon alle Bilder im Kasten hat«, sagte Carella.
»Na, dann stellen Sie das mal fest«, entgegnete Horton.
Der Arzt vom Krankenwagen kam herüber. Er blies sich in die Hände. »Kann ich ihn jetzt endlich mitnehmen?«, fragte er.
»Nun mal alle mit der Ruhe, okay?«, sagte Carella.
»Ich warte hier jetzt seit ...«
»Das ist mir vollkommen egal«, versetzte Carella. »Es handelt sich um einen Mordfall. Also immer alles der Reihe nach, okay?«
»Und inzwischen sterben in der Stadt soundso viele Leute«, sagte der Arzt.
Carella antwortete nicht. Er ging zu dem Polizeifotografen hinüber, der Blitzlichtaufnahmen von dem bewusstlosen Hund machte. »Sind Sie mit der Leiche fertig?«
»Davon habe ich erst ein paar Sofortbilder gemacht«, entgegnete der Fotograf.
»Gut, machen Sie, was Sie brauchen«, sagte Carella.
»Hier haben es alle Leute eilig.«
»Die Fingerabdrücke habe ich ihm auch noch nicht abgenommen.«
»Der Gerichtsmediziner hat angeordnet, dass seine Hände in Tüten gesteckt werden.«
Ein Techniker vom Labor zeichnete bereits mit Kreide die Umrisse der Leiche auf das Pflaster. Der Fotograf wartete, bis der Mann damit fertig war und machte dann die zusätzlichen Aufnahmen, die ihm notwendig erschienen. Blitzlichter flammten auf. Der Gerichtsmediziner blinzelte. Der Gehilfe hatte bereits erwartungsvoll wieder die hintere Tür des Krankenwagens aufgeklappt. Meyer zog Carella zur Seite. Als der Alarmruf kam, waren sie gerade im Begriff gewesen, sich in einem Warenhaus in den Hinterhalt zu legen. Beide trugen Parkas und wollene Mützen.
»Was machen wir mit dem Hund?«, fragte Meyer.
»Keine Ahnung«, entgegnete Carella.
»Wir können ihn doch nicht einfach hier liegenlassen oder?«
»Nein.«
»Also, was dann?«
»Einen Tierarzt anrufen, denke ich. Weiß wirklich nicht ...« Carella legte eine Pause ein und fuhr fort: »Hast du einen Hund?«
»Nein, Du?«
»Ich habe gerade überlegt – vielleicht sollten wir sofort einen Tierarzt hierherkommen lassen. Vielleicht ist der Hund vergiftet worden oder sonst was ...«
»Ja«, meinte Meyer und nickte. »Ich werde mal anrufen und zusehen, ob wir Murchison dazu bewegen können, uns jemanden zu schicken.«
»Vielleicht gibt es in der Innenstadt jemanden – du kennst doch die Abteilung mit den Spürhunden, die auf Rauschgift angesetzt werden?«
»Ja.«
»Meinst du nicht, dass die einen Tierarzt haben, der sich um die Hunde kümmert?«
»Könnte sein. Ich rufe an. Mal sehen, was sich da machen lässt.«
»Gut, los dann. Ich glaube, der Fotograf ist mit der Leiche fertig. Ich will endlich die Taschen durchsuchen.«
Meyer ging zum Streifenwagen, wechselte ein paar Worte mit dem Fahrer und stieg dann in den Wagen, um nach dem Handmikrophon zu greifen. Carella trat neben den Fotografen, der einen neuen Film in seine Kamera einlegte.
»Kann ich jetzt seine Taschen durchsuchen?«
»Er gehört Ihnen«, sagte-der Mann mit der Kamera.
In den Manteltaschen des Toten fand Carella nur ein Streichholzbriefchen und den Abriss einer U-Bahn-Karte. In der rechten Hosentasche stecke eine weitere Fahrkarte, ein Ring mit zwei Schlüsseln daran, ferner zwölf Dollar und vier Cents in kleinen Münzen. In der linken Tasche befand sich eine Brieftasche mit siebzehn Dollar, alles in Einernoten, und eine Cellophanhülle mit einem Ausweis der Blindenschule in 821 South Perry darin. Die eine Seite der Karte zeigte in Maschinenschrift die Zeilen:
DIES GILT ALS AUSWEIS FÜR JAMES R. HARRIS,
WOHNHAFT 3415 SOUTH SEVENTH STREET, ISOLA,
UND SEINEN FÜHRHUND STANLEY, SCHWARZER
LABRADOR-RETRIEVER (APPORTIERHUND).
Die Karte war unterschrieben vom Direktor der Blindenschule, einem gewissen Israel Schwartz. Rechts unten war der Stempel der Schule angebracht. Die Rückseite der Karte zeigte ein Bild von Harris und seinem Hund im Führgeschirr sowie den gedruckten Text:
GILT ALS AUSWEIS FÜR DIE BENUTZUNG
ÖFFENTLICHER TRANSPORTMITTEL UND IHRER
EINRICHTUNGEN FÜR BLINDENHUNDE IN
BEGLEITUNG IHRER EIGENTÜMER.
NICHT ÜBERTRAGBAR.
Der Block 3400 befand sich genau gegenüber der Mason Avenue. Als James Harris ermordet wurde, hatte er sich kaum zwei Häuserblocks von seiner Wohnung entfernt befunden. An der Innenseite der ledernen Brieftasche war ein Medaillon befestigt, das Carella für ein katholisches Emblem hielt. Am linken Handgelenk trug Harris eine Blindenuhr und am dritten Finger der linken Hand einen Trauring. An der rechten Hand trug er einen Hochschulring, wie ihn Studenten nach bestandenem Examen erhalten. Er stammte von der Emory-Hochschule in Diamondback. Das war alles.
Der Mann von der Spurensicherung kam hinzu. Er hockte sich neben Carella und begann damit, die Habseligkeiten des Toten in braune Papiertüten zu füllen, die er sorgsam verschloss und mit Anhängern versah.
»Was halten Sie davon?«, fragte Carella und zeigte ihn das Medaillon.
»Ich bin nicht religiös«, entgegnete der Techniker.
»Es stellt einen Heiligen dar, meinen Sie nicht auch?«
»Selbst wenn ich religiös wäre«, sagte der Mann, »gäb es in meiner Religion keine Heiligen.«
»Haben Sie alles?«, fragte Horton.
»Ja«, erwiderte Carella.
»Ich möchte, dass seine Hände in Tüten gesteckt werden«, wendete sich Horton an den Mann von der Spurensicherung.
»Okay«, nickte der Mann.
»Ich schicke gleich morgen früh jemanden ins Leichenschauhaus«, sagte Carella.
Horton nickte. »Gute Nacht denn«, sagte er und schritt davon.
Carella ging zu dem Fotografen hinüber, der Aufnahmen von der Umgebung des Tatortes machte. »Jemand von Ihrer Abteilung muss ihm morgen früh die Fingerabdrücke abnehmen. Ich schicke einen Mann hin, um die Abdrücke unterschriftlich zu bestätigen. Er soll sie dann gleich zum Erkennungsdienst bringen.«
»Um welche Zeit?«, fragte der Fotograf.
»Sagen wir um acht Uhr.«
»Gleich nach Mitternacht«, murrte der Mann.
»Was kann ich dafür?«, sagte Carella und deutete mit hilfloser Geste auf den Mann, der dem Toten bereits einen Plastikbeutel über die rechte Hand streifte.
Meyer kehrte vom Streifenwagen zurück. »Was gefunden?«, fragte er.
»Er heißt James Harris und wohnt an der South Seventh. Was ist mit dem Hund?«
»Murchison schickt sofort einen Tierarzt.«
»Gut. Wartest du hier, während ich die Anschrift eben mal überprüfe?«
»Hast du schon eine Tatortskizze angefertigt?«
»Noch nicht.«
Der Arzt trat gerade hinzu, als Meyer wegen der Skizze fragte. »Hören Sie«, sagte er, »wenn Sie vielleicht glauben, ich hänge weiter hier herum, während Sie eine gottverdammte Zeichnung ...«
»Das dauert nur ein paar Minuten«, sagte Meyer.
»Nächstes Mal rufen Sie gefälligst erst an, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind«, schimpfte der Notarzt. »Und wegen dem Hund ...«
»Was ist mit dem Hund?«
»Der Polizist da drüben sagt, wir müssen auch den Hund mitnehmen. Ich werde auf keinen Fall einen Hund im Krankenwagen transportieren. Das ist ...«
»Wer hat gesagt, Sie sollen ihn mitnehmen?«
»Der große Dicke da drüben, der mit dem schwarzen Mantel.«
»Monoghan? «
»Ich weiß nicht, wie er heißt.«
»Sie müssen den Hund nicht mitnehmen«, sagte Meyer.
»Aber ich kann Ihnen die Leiche nicht überlassen, bevor ich nicht eine Skizze vom Tatort gemacht habe. Okay? Ich verspreche, dass es kaum eine Minute dauern wird.«
Carella wusste, dass darüber eher fast eine halbe Stunde vergehen würde. »Meyer«, rief er, »ich komme gleich wieder.«
2. KAPITEL
In dem engen Hausflur brannte kein Licht. Carella zog die kleine Stablampe aus der Jackentasche und ließ den Lichtstrahl über die Reihe der Briefkästen wandern. Das Namensschild für die Wohnung 3C lautete ›J. Harris‹. Der Kriminalbeamte schaltete die Lampe aus und drückte auf die Klinke der inneren Flurtür. Sie war nicht abgeschlossen. Drinnen baumelte eine nackte Glühbirne über dem Treppenabsatz im ersten Stock. Ihr gelbliches Licht fiel auf die mit Linoleum bespannten Stufen. Er stieg die Treppe hoch. Der Geruch solcher Wohnhäuser war ihm vertraut. Während der Jahre seiner Arbeit beim 87. Revier hatte er sich daran gewöhnt.
Er nahm immer zwei Stufen auf einmal, nicht, weil er es sonderlich eilig gehabt hätte. Er nahm einfach immer zwei Stufen, wenn er eine Treppe hinaufging. Damit hatte er schon im Alter von zwölf Jahren angefangen, als er begann, schlaksig und langbeinig zu werden. Seine Mutter nannte ihn manchmal einen langen Lulatsch. Mit siebzehn Jahren hatte er aufgehört zu wachsen. Da maß er knapp ein Meter achtzig. Jetzt war er breitschultrig und schmalhüftig, ausgestattet mit der muskulösen Schlankheit und der flinken Gewandtheit eines Athleten. Sein Haar war braun, seine Augen waren ebenfalls braun. Sie standen ein wenig schräg und gaben seinem Gesicht ein auffallend orientalisches Aussehen.
Die Wohnhäuser in diesem Viertel waren immer entweder überheizt oder zu kalt. In diesem Haus war es zum Ersticken heiß, als habe sich die Wärme über Tage aufgestaut. Während er weiter hinaufstieg, nahm Carella die Wollmütze ab. Er stopfte sie in die Tasche seines Parkas und knöpfte den kurzen Mantel auf. Hinter geschlossenen Türen hörte er die Stimmen aus den Fernsehgeräten.
Irgendwo im Haus hatte jemand die Toilettenspülung betätigt. Schließlich erreichte er den Absatz des dritten Stockwerks. Hier gab es drei Wohnungen. Das Apartment 3C lag am Ende des Ganges, am weitesten von der Treppe entfernt. Er klopfte an die Tür.
»Jimmy?«, fragte eine Frauenstimme.
»Nein, Madam, Polizei.«
»Polizei? Sagten Sie Polizei?«
»Ja, Madam.«
Er wartete. Die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet.
Innen war eine Sicherheitskette vorgelegt. Die Wohnung dahinter war dunkel. Er konnte das Gesicht der Frau nicht erkennen.
»Halten Sie Ihre Marke in die Höhe«, verlangte sie.
Er hielt das Blechstück bereits in der Hand. Die Leute verlangten immer, es zu sehen. Die Marke war an der Innenklappe einer kleinen Ledertasche befestigt, die außerdem seine Kennkarte in einer Plastikhülle enthielt. Er zeigte sie ihr und wartete darauf, dass sie die Polizeimarke erkennen möge.
»Halten Sie Ihre Kennmarke hoch?«, fragte die Frau.
»Ja«, entgegnete er und runzelte verwundert die Stirn.
Ihre Hand erschien in dem schmalen Türspalt. »Lassen Sie mich die Marke befühlen«, sagte sie. Erst jetzt erkannte er, dass sie blind war. Er streckte ihr die Blechmarke hin und sah zu, wie ihre Finger das emaillierte Schild untersuchten. Das Muster zeigte goldene Berghänge im Sonnenglanz rund um das Stadtsiegel.
»Wie heißen Sie?«, forschte die Frau weiter.
»Detective Carella«, stellte er sich vor.
»Ich nehme an, dass alles seine Ordnung hat«, erklärte sie und zog die Hand zurück. Aber sie entfernte die Kette nicht. »Was wollen Sie?«, fragte die Frau.
»Wohnt hier ein James Harris?«
»Worum geht es, was ist mit ihm?«, fragte sie sofort.
»Mrs. Harris ...«, begann er und zögerte. Diesen Augenblick hasste er mehr als alles andere im Polizeidienst. Es gab keine Möglichkeit, den Leuten so etwas schonend beizubringen, nichts, das jetzt hätte trösten können. Nichts.
»Ihr Mann ist tot«, sagte er schließlich.
In dem offenen Türspalt herrschte Stille. Schweigen auch in der Finsternis dahinter.
»Was ... was ...?«
»Darf ich hineinkommen?«, fragte Carella.
»Ja«, sagte sie. »Ja, bitte ...«
Er hörte, wie die Sicherheitskette ausgehakt wurde. Die Tür öffnete sich weit. In dem vom Treppenflur hereindringenden Licht sah er, dass er eine Weiße vor sich hatte, blond, schlank. Sie trug einen langen blauen Mantel mit Gürtel und hatte eine riesengroße Sonnenbrille aufgesetzt, die ihre Augen und einen erheblichen Teil ihres Gesichts verbarg. Die Wohnung hinter ihr war dunkel. Er zögerte an der Tür. Sie spürte es sofort und erkannte die Ursache. »Ich mache Licht«, sagte sie, drehte sich um, schritt mit erstaunlicher Sicherheit zur Wand und dann daran entlang, wobei ihre linke Hand die Mauer kaum berührte. Sie fand den Lichtschalter und ließ ihn klicken. Eine Deckenlampe erhellte den Raum. Er trat ein und schloss die Tür hinter sich.
Sie befanden sich in der Küche. Das überraschte ihn nicht. Die Vordertüren der meisten Wohnungen in diesem Viertel führten direkt in die Wohnküche. Manche dieser Küchen waren makellos sauber, andere verdreckt. Diese hier war keins von beiden. Hätte er nicht gewusst, dass die Bewohner blind waren, hätte sein Urteil auf mangelhafte Haushaltsführung gelautet. Die Frau stand jetzt vor ihm, den Kopf in der für Blinde charakteristischen Art etwas zur Seite geneigt, das Kinn gesenkt. Sie wartete.
»Nehmen Sie bitte Platz«, sagte die Frau endlich und deutete genau zum Küchentisch. Er zog einen Stuhl heran und setzte sich. Sie kam quer durch die Küche. Ihre Hand ertastete den Küchenstuhl ihm gegenüber. Sofort ließ sie sich darauf nieder.
»Wir können ein andermal darüber reden, wenn es Ihnen lieber ist«, schlug Carella vor.
»Ist es nicht besser, jetzt gleich darüber zu sprechen?«
»Wenn Sie wollen, ja, es hilft uns vielleicht weiter.«
»Was wollen Sie denn wissen?«, fragte sie.
»Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen, Mrs. Harris?« Er verbesserte sich sofort: »Wann hat er sich von Ihnen verabschiedet?«
»Heute Morgen. Wir haben das Haus um zehn Uhr verlassen.«
»Wohin gingen Sie?«
»Ich habe eine Arbeitsstelle in der Innenstadt. Jimmy wollte zur Hall Avenue. Er arbeitet dort meistens zwischen Circle und Montgomery.« Sie hielt inne. »Er ist Bettler«, fügte sie hinzu.
»Und wo arbeiten Sie, Mrs. Harris?«
»Ich arbeite für ein Versandgeschäft. Ich stecke Kataloge in die Postumschläge.«
»Was für Kataloge?«
»Werbung für die Artikel, die die Firma verkauft. Die Kataloge werden zweimal im Monat verschickt. Mit mir zusammen arbeitet eine Frau, die die Versandlisten tippt und ich fülle die Umschläge. Wir verkaufen Souvenirs und Geschenkartikel wie Aschenbecher, Salz- und Pfefferstreuer, Glasuntersetzer, Rührstäbchen für Cocktails ... und solche Sachen.«
»Wie nennt sich die Firma?«
»Prestige Novelty. An Dutchman’s Row, im Geschäftsviertel.«
»Und Sie haben heute Vormittag zusammen mit Ihrem Mann das Haus verlassen?«
»Ja. Wir versuchen immer, den Hauptbetrieb in der U-Bahn zu vermeiden. Jimmy hat den Hund und so können wir ... « Sie unterbrach sich plötzlich. »Wo ist Stanley?«
»Man kümmert sich um ihn, Mrs. Harris.«
»Ist er in Ordnung?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht hat man ihn betäubt, vielleicht ist er auch ...« Carella ließ den Satz unvollendet.
»Was wollten Sie sagen? Vergiftet?«
»Ja, Madam.«
»Stanley nimmt von Fremden keinen Bissen an. Nur Jimmy füttert ihn. Der Hund ist so erzogen worden und darauf dressiert. Er nimmt nicht einmal von mir etwas, wenn ich ihm einen Happen anbiete. Es muss Jimmy sein, der ihn füttert.«
»Wir werden bald mehr wissen«, erklärte Carella. »Als ich fortging, war schon ein Veterinär unterwegs. Mrs. Harris, gingen Sie immer um zehn Uhr gemeinsam fort?«
»Von Montag bis Freitag.«
»Wann sind Sie zurückgekehrt?«
»Ich komme meistens gegen drei oder vier Uhr dreißig zurück. Jimmy wartet das Ende der Arbeitszeit ab – wenn die Leute nach Hause gehen, so zwischen fünf und sechs Uhr, nimmt er viel Geld ein. Dann wartet er noch eine halbe Stunde, geht auf einen Drink in ein Lokal, nur um sicher zu sein, nicht in den Hauptbetrieb zu geraten. Er nimmt meistens die U-Bahn gegen sechs Uhr dreißig oder Viertel vor sieben. Zu Hause ist er gewöhnlich um ...« Sie zögerte. Ihr war plötzlich aufgegangen, dass sie in der Gegenwartsform von einem Mann sprach, der tot war. Diese Erkenntnis war schmerzlich. Carella blickte ihr ins Gesicht und sah Tränen unter den übergroßen Gläsern hervorquellen und über ihre Wangen rinnen. Er wartete.
»Entschuldigung«, flüsterte sie.
»Wenn Sie lieber ...«
»Nein, nein«, schüttelte sie den Kopf. »Er ... er war für gewöhnlich spätestens um sieben Uhr dreißig daheim.« Sie erhob sich plötzlich und ging direkt, ohne sich den Weg ertasten zu müssen, zu der eingebauten Tischplatte neben der Spüle. Dort fanden ihre Finger den Behälter mit den Papiertüchern. Sie zog eins heraus und schnaubte sich die Nase. »Um sieben Uhr dreißig hatte ich meistens das Essen fertig. Sonst gingen wir draußen essen. Jimmy aß gern chinesisch, also gingen wir oft in solche Lokale. Der Hund führte uns ja überall hin.« Sie begann wieder zu weinen.
»Besitzen Sie nur diesen einen Hund?«
»Ja.« Das feuchte Papiertaschentuch vor den Mund pressend, murmelte sie nur diese eine Silbe. Sie zog ein zweites Tuch heraus und schnaubte abermals die Nase. »Blindenhunde sind teuer«, fuhr sie fort. »Ich brauchte keinen. Nur auf dem Weg zur Arbeit und zurück war ich ohne Jimmy. Ich habe den Blindenstock, ich ... ich ...« Jetzt setzte ein Schluchzen ein, das tief aus ihrer Kehle kam und ihr den Atem nahm.
Der Kriminalbeamte wartete. Sie schluchzte in das Tuch. Durch das Küchenfenster hinter ihr sah Carella, dass leichter Schneefall eingesetzt hatte. Er fragte sich, ob man inzwischen am Tatort fertig geworden war. Der Schnee erschwerte den Leuten vom Labor die Arbeit. Leise rieselte der Schnee. Sie konnte nicht wissen, dass es schneite. Das konnte sie weder sehen noch hören. Sie schluchzte weiter in das zerknüllte Tuch. Schließlich nahm sie die Schultern zurück, hob den Kopf und fragte: »Was möchten Sie sonst noch wissen?«
»Mrs. Harris, können Sie sich denken, wer das getan haben mag?«
»Nein.«
»Hatte Ihr Mann Feinde?«
»Nein. Er war blind«, entgegnete sie und abermals verstand er vollkommen ihren Gedankengang. Blinde haben keine Feinde. Blinden bringt man Mitleid oder Sympathie entgegen, aber niemals Hass.
»Sie haben nicht kürzlich Drohanrufe oder Briefe erhalten, aus denen ...«
»Nein.«
»Mrs. Harris, Sie lebten in einer Mischehe ...«
»Mischehe? «
»Ich meine ...«
»Oh, Sie meinen, weil ich eine Weiße bin.«
»Ja. Gab es unter den Nachbarn Leute ... oder jemanden in Ihrer Firma ... irgendwen ... die einer solchen Ehe strikt ablehnend gegenüberstanden?«
»Nein.«
»Erzählen Sie mir von Ihrem Mann.«
»Was wollen Sie wissen?«
»Wie alt war er?«
»Dreißig. Im August ist er dreißig Jahre alt geworden.«
»War er von Geburt an blind?«
»Nein. Es war eine Kriegsverletzung.«
»Wann?«
»Vor zehn Jahren. Im Dezember wären es zehn Jahre geworden. Am 14. Dezember.«
»Seit wann sind Sie verheiratet?«
»Fünf Jahre.«
»Wie heißen Sie mit Mädchennamen?«
»Isabel Cartwright.«
»Mrs. Harris ...«, begann er und zögerte. »Hatte Ihr Mann etwas mit anderen Frauen?«
»Nein.«
»Geben Sie sich mit einem anderen Mann ab?«
»Nein.«
»Wie haben Ihre Angehörigen diese Eheschließung aufgenommen?«
»Mein Vater mochte Jimmy. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Jimmy wachte in Tennessee an seinem Sterbelager.«
»Und Ihre Mutter?«
»Ich habe meine Mutter nie gekannt. Sie ist im Kindbett gestorben. «
»Wurden Sie blind geboren?«
»Ja.«
»Haben Sie Geschwister?«
»Nein.«
»Wie stand es mit Ihrem Mann?«
»Er hat eine Schwester. Chrissie, von Christine. Schreiben Sie das alles auf?«
»Ja, das tue ich. Stört es Sie? Ich kann gern damit aufhören, wenn ...«
»Nein, mir macht das nichts aus.«
»Leben seine Eltern noch?«
»Nur seine Mutter. Sophie Harris. Sie wohnt noch immer in Diamondback.«
»Kommen Sie gut mit ihr aus?«
»Ja.«
»Mrs. Harris, können Sie sich an irgendetwas, an irgendein Ereignis während der letzten Wochen erinnern, das irgendwen veranlasst haben könnte, wütend zu werden oder ...«
»Nein.«
»Wenn es auch noch so abwegig erschiene?«
»Ich wüsste nicht, woran ich da denken sollte.«
»Nun denn, vielen Dank.« Er klappte sein Notizbuch zu. Im Normalfall hätte er die Ehefrau eines Mordopfers aufgefordert, ihn ins Leichenschauhaus zu begleiten, um den Toten zu identifizieren. Er zögerte jetzt und fragte sich, was da zu tun sei. Isabel Harris konnte ohne Zweifel das Gesicht ihres Mannes abtasten und ihn dadurch mit der gleichen Sicherheit wie eine sehende Person identifizieren. Aber eine Leiche zu identifizieren war für jedermann ein schweres Erlebnis. Er konnte sich vorstellen, wie es um die Gefühle einer Blinden bestellt sein würde, die ja den Leichnam abtasten musste. Er überlegte sich, dass man an ihrer Stelle Jimmys Mutter holen konnte. Er wollte sie anrufen und sich mit ihr morgen früh am Leichenschauhaus verabreden. Sophie Harris in Diamondback, hatte er in seinem Buch notiert. Er wollte sie später anrufen. Dann aber ging ihm durch den Kopf, ob er nicht Isabel Harris eines Rechtes beraubte, das in erster Linie ausschließlich ihr zustand – und er machte es ihr nur deshalb streitig, weil sie blind war. Er beschloss, es auf dem geraden Weg zu versuchen. Im Laufe der Jahre war ihm klargeworden, dass der gerade Weg immer der beste war – und oft genug der einzige.
»Mrs. Harris«, begann er, »wenn ein Mordopfer verheiratet war, identifiziert gewöhnlich der andere Partner die Leiche.« Er zögerte wieder. »Ich weiß nicht, ob Sie es tun wollen oder nicht.«
»Ja, ich werde es tun«, versicherte die Frau. »Meinen Sie – jetzt gleich?«
»Morgen früh kommt es auch noch zurecht.«
»Gut, um zehn Uhr«, entgegnete sie und nickte.
Er ging zur Tür und drehte sich dort noch einmal um.
Hinter ihr rieselte unhörbar der Schnee.
»Mrs. Harris?«, begann er.
»Ja?«
»Kann ich irgendetwas für Sie tun? Werden Sie allein mit allem fertig?«
»Danke, ich brauche keine Hilfe.«
Sie lag schon im Bett, als das Pochen von der Tür her ertönte.
Sie klappte den Deckel ihrer Uhr auf und betastete das Zahlenrelief darauf. Es war zwanzig Minuten vor zwölf Uhr. Sofort war ihr klar, dass der Detective noch einmal zurückgekehrt war. Vermutlich hatte er gespürt, dass sie log. Er hatte wohl etwas in ihrer Stimme gehört oder ein Zucken in ihrem Gesicht beobachtet. Sie hatte ihn absichtlich belogen, als sie eine seiner Fragen mit einem glatten Nein beantwortete. Natürlich, jetzt kam er noch einmal, um zu fragen, warum sie ihn angelogen hatte. Ihr war es gleichgültig. Jimmy war tot. Sie hätte genauso gut gleich alles gestehen können. Also nahm sie sich vor, jetzt mit der Wahrheit herauszurücken.
Sie trug ein langes Nachthemd aus Barchent. Das machte sie während der Wintermonate immer so. Vom ersten Frühlingstag an aber schlief sie nackt. Jimmy pflegte immer zu sagen, dass es ihm Freude mache, ihre Brüste zu finden, ohne dass er sich erst durch einige Meter Hemdenstoff hindurchwühlen musste.
Eilig sprang sie aus dem Bett und setzte die Füße auf den kalten Holzfußboden. Die Heizung wurde immer um elf Uhr abgedreht. Ab Mitternacht war es in der Wohnung eiskalt. Sie warf einen Hausmantel über und ging zur Schlafzimmertür, wobei sie einem rechts stehenden Stuhl auswich. Ihre Hand war ausgestreckt. In der Wohnung brauchte sie keinen Stock. Sie gelangte durch die Tür ins Wohnzimmer. Die Türschwelle zwischen den beiden Räumen quietschte. Dann ging sie an dem Klavier entlang, auf dem Jimmy immer so gern gespielt hatte. Er spielte nach Gehör und bezeichnete sich selbst manchmal als den Art Tatum seiner Zeit, als wenn es so leicht wäre, ein großer Künstler zu sein. Merkwürdig, dass sie so sehr hatte weinen müssen. Sie hatte schon vor einem Jahr aufgehört, ihn zu lieben. Trotzdem waren ihre Tränen echt gewesen.
Schließlich erreichte sie die Küche. Wer auch immer draußen stehen mochte, er klopfte immer noch an die Tür. Bei ihrem ersten Wort verstummte das Geräusch.
»Wer ist da?«, fragte sie.
»Mrs. Harris?«
»Ja?«
»Polizei«, sagte die Stimme vor der Tür.
»Detective Carella?«
»Nein, Madam.«
»Wer denn sonst?«
»Sergeant Romney. Würden Sie bitte aufmachen. Wir glauben nämlich, den Mörder Ihres Mannes entdeckt zu haben.«
»Moment noch«, rief sie von drinnen und entfernte die Sicherheitskette.
Er betrat die Wohnung und schloss die Tür hinter sich.
Sie hörte, wie sich die Tür in den Rahmen fügte, wie der Schlüssel herumgedreht wurde und der Bolzen einrastete. Bewegung. Dielen knarrten. Jetzt stand er unmittelbar vor ihr.
»Wo ist es?«
Sie verstand ihn nicht.
»Wo es ist, will ich wissen! Wo hat er es versteckt?«
»Was versteckt? Wer ... wer sind Sie?«
»Sagen Sie mir, wo ich es finde«, drängte er, »dann passiert Ihnen nichts.«
»Ich weiß nicht, was Sie ... ich habe doch ...«
Sie wollte einen Schrei ausstoßen. Zitternd wich sie vor ihm zurück und prallte gegen die Wand hinter sich. Sie hörte das Geräusch von aneinanderreibendem Stahl, spürte, wie er plötzlich eine Bewegung auf sie zu machte und fühlte dann die Spitze von etwas Hartem und Scharfem am unteren Teil ihrer Kehle.
»Wagen Sie nicht, laut zu atmen«, flüsterte er. »Wo ist es?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen!«
» Wollen Sie, dass ich Sie umbringe?«
»Nein, bitte nicht, aber ich weiß wirklich nicht, was ...«
»Also, wo ist es?«, wiederholte er, lauter werdend.
»Bitte, ich ...«
»Wo?«, zischte er und schlug ihr die Hand mit plötzlicher Wildheit ins Gesicht, dass ihr die Sonnenbrille von der Nase flog. »Wo?«, sagte er und schlug sie abermals. »Wo?«, rief er. »Wo?«
3. KAPITEL
»Man kann niemandem erklären, wie sich das mit den Jahreszeiten verhält«, sagte Meyer. »Nehmen wir doch mal den Durchschnittsbürger von Florida oder Kalifornien. Der hat keine Ahnung von Jahreszeiten. Er glaubt doch, das Wetter müsse so sein – nämlich schön tagaus, tagein.«
Er sah nicht gerade wie ein Philosoph aus, wie er neben Carella kräftig ausschritt, während sie sich der Wohnung von James Harris näherten. Stattdessen sah er aus wie das, was er war: ein Polizist im Dienst. Groß, stämmig, mit porzellanblauen Augen in einem Gesicht, das runder wirkte, als es tatsächlich war. Das lag vielleicht an dem absoluten Kahlkopf, den er schon seit seinem dreißigsten Lebensjahr hatte.