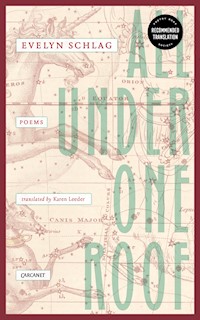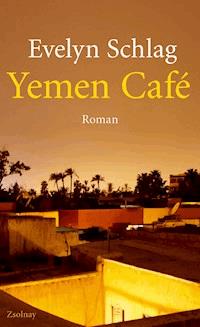Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HOLLITZER Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
New York 1957. Eine Frau hat sich entschieden: Für ihren Mann und gegen ihr Kind, zumindest für zehn Monate. Doch dann verliebt sie sich in einen anderen. "May I take a picture of you, John", fragte sie. "Sure." Sie stellte gar nicht viel ein. Das wird der Mann sein, mit dem sie ... die ganze Zeit lachte!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Please Come Flying
Evelyn Schlag
Please Come Flying
Roman
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung
Evelyn Schlag: Please Come Flying
Roman
Hollitzer Verlag, Wien 2023
Umschlaggestaltung und Satz: Daniela Seiler
Coverfoto: „Swinging City“, New York, ca. 1956; von Ernst Haas (Getty Images)
Hergestellt in der EU
Alle Rechte vorbehalten
© HOLLITZER Verlag, Wien
www.hollitzer.at
ISBN Druckausgabe: 978-3-99094-047-1
ISBN ePub: 978-3-99094-048-8
1
Die Maasdam verließ den Hafen von Rotterdam. Ein paar letzte Blicke auf die zwei Türme des Hauptgebäudes der Holland-Amerika-Linie. Ehe sie auf offene See kamen, fiel Nebel ein. Dann stoppte das Schiff die Weiterfahrt. Es dauerte eine Weile, bis die Passagiere den Grund für die Verzögerung erfuhren. Die Maasdam hatte ein Fischerboot gerammt, die drei holländischen Fischer hatten Glück im Unglück. Lisa war damit beschäftigt, ihren Koffer in die Kajüte zu bringen, ein paar Sachen auszupacken. Ihre Rolleiflex-Kamera hatte keinen Schaden genommen. Sie spürte die Unruhe in ihrem Magen, wollte aufs Deck hinaus.
Das Schiff zog eine lange Kurve – dort um die Ecke liegt New York, dachte sie. Ein paar nicht verankerte Stühle liefen an die Reling. Ein alter Sonderling in seinem ockergelben Mantel mit einem schwarzen Persianerfellkragen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Erst als ein paar Passagiere auf ihn zustolperten, sprang er auf und hob seinen Stock zum Fluchen. Warum sie nicht in ihren kleinen Häusern in Europa sitzengeblieben seien? Norddeutsch oder schon Holländisch, sie verstand nicht alles. Lisa konnte sich mit Mühe an einem Stuhl festhalten, der im nächsten Augenblick zu schlittern begann. Der Atlantik hielt viel Wasser bereit.
Im Speisesaal saß sie mit einer Wienerin und ihren zwei Kindern am Tisch, die zum Familienvater nach Vancouver fuhren. Sie waren richtige Auswanderer, ihre Habe war in zwei großen Kisten verpackt. Diese Leute hatten keine Zukunft für sich in Österreich gesehen. Der kleine Junge freute sich auf die Prärie, seine ältere Schwester hatte Angst vor den Indianern.
Es wird euch gefallen, sagte Lisa.
Ein Mann aus Rotterdam setzte sich zu ihnen. Lisa nahm die Speisekarte. Auf dem Deckblatt schwammen drei Fische friedlich in einem grünen Tang im durchsichtigen Meer. Friday, September 6th, 1957. Für sie kam nur etwas Leichtes in Frage. Vegetable Soup, danach eine Omelette mit Schnittlauch. Lisa dachte an ihre kleine Tochter daheim in Österreich, die vielleicht auch eine Eierspeise essen würde. Zum Glück mochte Kathi die Küche ihrer Oma, wo die Katze Muina auf dem Schrank saß. Was gäbe sie darum, jetzt bei ihnen zu sein.
Der Holländer sprach ein sympathisches Deutsch, in dem alles einen spielerischen Ton erhielt. Selbst als er von dem Unglück bei der Ausfahrt erzählte, klang das nicht nach einer Katastrophe, sondern nach etwas, mit dem man immer rechnen musste. Seine Landsleute lebten mit den Gefahren der See und der großen Passagierschiffe, auf die sie sehr stolz seien. Er hob besonders die neue Statendam IV hervor, durchgehend mit air condition ausgestattet und, wie auch die Maasdam, mit den modernen stabilizers. Die fingen die Rollbewegungen bei allzu großem Wellengang ab. So oder so ähnlich. Julian war vor drei Monaten mit der Statendam nach New York gereist.
Sie lächelte den Holländer an. Blaue Augen hatte sie immer gemocht. In seinem Blick lag Mitleid, er griff nach ihrer Hand, das war eine schöne Geste.
In Le Havre lichtete sich der Nebel. Vom Halt in Southampton bekam sie schon nichts mehr mit, weil es Nacht geworden war und sie erschöpft, aber hellwach auf ihrem Bett lag. Sie war so überdreht von dem langen Tag, dass sie nicht einschlafen konnte. Mehrere Male während der Zugfahrt nach Rotterdam hatte sie sich eingeredet, sie könne bei einem dieser deutschen Bahnhöfe aussteigen und den Zug zurück nehmen. Wenn ein Schaffner durch den Wagen ging und sie fragend anschaute, fehlte nicht viel. Er könnte einen besonderen Blick haben für Menschen wie sie, die lange mit einer Entscheidung gerungen hatten. Die Wahrheit war, dass es zwei Wahrheiten gab. Julian wollte die einjährige Ausbildung zum Anästhesisten am renommierten New York Hospital absolvieren. Wenn sie Julian nicht verlieren wollte, musste Lisa ihrem Mann nach New York folgen und Kathi über Monate hinweg bei den Großeltern zurücklassen. Nur einen Stock tiefer. In bester Obhut.
In dieser ersten Nacht tauchten Bilder von torpedierten Kriegsschiffen auf, eine Holzkiste krachte auf das Deck, Koffer rumpelten vorbei, Sturm und Gewitter, hoher Wellengang, Lärm, Schreie, dann wieder Stille und der nicht aufhörende Zugriff in ihrem Magen. Tee. Julian hatte nichts von seiner Überfahrt berichtet.
Am nächsten Morgen saß sie mit der Familie aus Wien beim Frühstück, alle hatten bleiche Gesichter. Lisa ließ sich von dem Kampfgeist der Frau anstecken. Am Nebentisch unterhielten sich die Engländer, die in Southampton an Bord gegangen waren. Zum Glück erholte sich ihr Magen und sie wanderte auf dem Schiff herum, sog die salzige Luft ein, lehnte sich an Türen, wenn der Horizont kippte, und fragte sich, wo der nette Holländer geblieben war.
Es gab ein Lese- und Schreibzimmer mit einer Bibliothek. Viele Namen, die ihr nichts sagten, aber von Pearl S. Buck ein neuer Roman, Letter from Peking. Sie hatte Ostwind-Westwind und Die gute Erde gelesen. Ein Kinderbuch, in wilden Strichen gezeichnet, fiel ihr auf. New York im Regen, tiefe schwarze und graue Wolken, durch die Möwen wie hineingeworfen taumelten. Auf dem Fluss schäumten die herumschlagenden Wellen mit weißen Kronen, Eltern hielten ihre Kinder mit beiden Händen fest. Obwohl es vom Regen handelte, wurde Lisa immer besser gelaunt.
Sie versuchte, sich Mr.Stanton und seine Frau Betsy vorzustellen, ihre Arbeitgeber. Mr.Stanton arbeitete nicht weit vom New York Hospital in einem Anwaltsbüro, war mit einigen Ärzten befreundet – so war es zur Vermittlung der Nannystelle für Lisa gekommen. Sie hatte lange nicht gewusst, was sie ihrem zukünftigen Schützling mitbringen sollte. Welche Ansprüche würde dieses Kind haben? Sie hatte den Gedanken an das Mädchen weggeschoben, von dem sie nicht einmal ein Foto besaß. Ein Halstuch mit Märchenfiguren hatte sie vor Kathi versteckt, in dem Papier eingeschlagen in der obersten Lade des Schranks, bei der Unterwäsche, die sie nie trug.
Lisa wollte ihrer Familie auf dem Briefpapier der Holland-Amerika-Linie schreiben. Das Firmenzeichen war ein sich aufschwingender Bug, nicht so imposant wie auf den Plakaten, die in Rotterdam im Hauptgebäude hingen. Dort warteten die Wolkenkratzer der Skyline von New York im Hintergrund, und im Schlund des Schiffs segelte ein altmodisches Boot mit sechs weißen Segeln mit, über einem dunkelgrünen Wellenmeer.
An Julian brauchte sie nicht mehr zu schreiben. Sie kam selbst, wenn auch nicht per Luftpost. In neun Tagen würden sie in Halifax sein, das war schon fast New York. Er hatte zwei Fotos geschickt, auf denen er mit seinem Chef und dessen Frau in einem Restaurant zu sehen war. Alle hoben die Gläser, wen ließen sie da hochleben, einen fotografierenden Gast?
Eine wohlwollende und gutgelaunte Gesellschaft, die Lisa auch aufnehmen würde. Wenn sie Julian in ihren Briefen nach New York gefragt hatte, wie er seine Abende verbringe, waren bloß knappe Antworten gekommen. Nachtdienste, Lesen in der Bibliothek. Sie dachte an die langen Briefe aus seinen Studienjahren in Wien. Ab 1946, fünf Jahre lang jeden Tag mindestens ein Brief, zwei volle DIN-A4-Seiten lang in seiner modernen Schrift, die ihr so imponiert hatte. Keine Spur des strengen Kurrent, das sie verwendete. Er machte Gedankenstriche statt Kommas zwischen den Sätzen, so flogen die Wörter geraden Wegs zu ihr und rissen sie mit. Und wie er Abkürzungen schrieb mit Punkten in halber Buchstabenhöhe. u·s·w., als sollten diese Punkte ebensowenig den Boden berühren.
Sie war dieser Schrift verfallen gewesen. Fünf endlose Jahre, Abend für Abend, wenn er von den Vorlesungen und Übungen in sein kleines Zimmer heimkam, erklärte er ihr seine Liebe und entwarf das gemeinsame Leben für sie. Eine Praxis daheim als Landarzt, der Menschheit dienen, und sie sollte sich pharmazeutische Grundkenntnisse aneignen, um ihm in der Ordination zu helfen. Er lud sie ein, ihn einmal in den Seziersaal zu begleiten, es würde ihr sicher gefallen.
Dein Warten ist ein großes Opfer, hatte er aus Wien geschrieben. Nie mehr getrennt sein!
Meine Lieben zuhause, Papa, Mama, Kathilein!
Ich bin auf dem riesigen Schiff und ihr fehlt mir alle fürchterlich. Das Meer ist wild, aber wir haben es gemütlich in unseren Kabinen. Die Mitreisenden sind sehr nett. Jetzt fällt mir ein, dass dieser Brief erst in Kanada aufgegeben werden wird. Die letzte Möglichkeit wäre Southampton in England gewesen. Hast du wieder Eierspeise gegessen, Kathilein, oder einen Kaiserschmarren? Hier gibt es eine lange Speisekarte. Die Vanillecreme würde dir schmecken. Ich sitze mit einer Frau aus Wien und ihren zwei Kindern im Speisesaal. Sie wandern nach Kanada aus, in den Westen (Vancouver). Ein sehr freundlicher Holländer sitzt auch bei uns. Es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Viele Bussi
Die Überfahrt blieb rauh. Lisa flüchtete vom Panoramadeck in die Bibliothek und weiter in ihre Kabine und in den Speiseaal, wenn es Zeit zu essen war, und starrte zu den Rettungsbooten, die am Oberdeck aufgereiht auf ihren Einsatz warteten. Manchmal saß der Holländer in der Bibliothek, schrieb, neben ihm lag ein aufgeschlagenes Buch. Einmal hob er den Deckel hoch, eine Biografie von Arturo Toscanini. Er war diesen Januar in New York gestorben.
Ein mutiger Mann, sagte der Holländer. Er weigerte sich, Mussolinis Faschistenhymne vor den Konzerten zu spielen. Einmal wurde er niedergeschlagen. 1937 emigrierte er nach New York.
Lisa wusste nicht, was sie sagen sollte.
Geht es Ihnen besser mit der Seekrankheit?
Sie verneinte.
Als sie Julian in der Menge der Wartenden erblickte, war alles anders. Er winkte ihr mit seinem Hut. Er hüpfte sogar ein bisschen hoch, um einen Blick von ihr zu erhaschen. Im Trubel nickte sie noch dem Holländer zu, der nicht weit von ihr einsam ankam. Sie verließ die Maasdam wie im Traum, die letzte Viertelstunde, bis alles erledigt war, dauerte ewig. Sie war in einem müden Überschwang. Julian nahm ihr den Koffer ab.
Endlich, mein Schatz. Endlich habe ich dich wieder. – Sein Blick fuhr zärtlich über ihr Gesicht. Er drückte die Nase auf ihre Wange, da war schon sein Kuss in ihrem Kuss.
Das Empire State war auch gekommen, ebenso das Chrysler Building mit seinem gespitzten Bleistift.
Julian hatte sich den Nachmittag freinehmen können, um sieben Uhr musste er zum Nachtdienst. Mr.Stanton würde sie nach Kanzleischluss vom Krankenhaus abholen. Es war Lisa nicht unrecht. Ein Warten war zu Ende, das andere hatte noch nicht begonnen. Ein paar Stunden zwischendrin wären schön.
Die weiße Front des Gebäudes mit seinen schmalen, hohen Bögen und Seitentürmen, seiner markanten, zum Himmel strebenden Längsstruktur strahlte eine Macht aus, der man nicht widersprechen durfte. Weil hier jeden Tag viele Menschenleben gerettet wurden, war es bedeutungslos, wenn man als Frau eines Gastarztes an die Tochter in Österreich dachte. Die kleine Maus würde wie eine echte kleine Maus in den endlosen Gängen dieses Spitals verschwinden.
Das hospital, sagte Julian stolz.
Sein Zimmer blickte auf den East River. Die Schiffe waren stehengeblieben. Sie wunderte sich über das schmale Bett. Selbst das Bett im Dienstzimmer des Ordenskrankenhauses daheim war freundlicher. Seine Hand wanderte ihren Rücken hinunter. Sein Geruch, den sie so vermisst hatte, der süße Geschmack, nicht vergangen. Das kann sonst niemand, dachte sie und erschrak.
Bist du hungrig? fragte Julian später. Es gibt eine Pizzeria nicht weit von hier. Wenn ich die Spitalsküche überhabe, gehe ich manchmal hin.
Lisa horchte in ihren Magen. – Ja, sagte sie.
Zuvor rief Julian bei Mr.Stanton in der Kanzlei an. Er würde Lisa in einer Stunde vom Krankenhaus abholen.
Stanton wird dir gefallen, sagte er, als sie in dem kleinen Lokal saßen. Nicht so. Er ist ausgesprochen nett und unkompliziert. Sie freuen sich sehr auf ihre Nanny. Bist du aufgeregt?
Überhaupt nicht, sagte sie.
Das glaube ich dir nicht. Dafür kenne ich dich viel zu gut.
Wie wars bei deiner Ankunft im Krankenhaus?
Die Chefsekretärin hat mir mit den Formalitäten geholfen, dann hat mich Dr.Brancusi durch die Station geführt, den Kollegen vorgestellt. Da gab es keine Vorbehalte, auch nicht bei den älteren. Willkommen in unserem amerikanischen Abenteuer, Schatz!
Mr.Stanton hatte seinen großen Schlitten auf dem Besucherparkplatz abgestellt.
Hi, Mrs.Shonfield, sagte er. I have practiced pronouncing your last name.
Not too bad, sagte Lisa. I know it’s difficult. – Sie schaute zu Julian. Er war schuld.
Brauner Anzug, brauner Hut, Anfang dreißig. Mr.Stanton, oder sollte sie ihn im Geist George nennen, verfrachtete ihren Koffer ins Auto, noch ein paar Sätze zwischen Julian und ihm, small talk ging es durch ihren Kopf, jetzt spürte sie, was das bedeutete, nämlich Wichtiges beiseitezulassen. Der erste Abschied von Julian nach dem vor drei Monaten, ohne Schrecken, bald sehen wir uns wieder.
Mr.Stanton steuerte seinen Wagen durch den Spätnachmittagsverkehr, mit einem Finger auf dem Lenkrad, den Hut hatte er aufbehalten. Er warf Lisa amüsierte Blicke zu, als sie den Kopf nach den Wolkenkratzern verrenkte. Auf ihrem deutschen Stadtplan war Uptown Manhattan als Obere Stadt verzeichnet.
Er wolle mit ihr am Central Park entlangfahren, obwohl es ein kleiner Umweg sei, sagte Mr.Stanton und bog bei der nächsten Ampel nach links ab. Sie überquerten die Second Avenue, die Third Avenue, die Namen blinkten kurz auf, eine Fourth Avenue gab es nicht, schließlich lag das braune Areal des Parks vor ihnen.
Er sagte, die New Yorker seien sehr stolz auf ihren Central Park gewesen, aber die Stadt vernachlässige ihn seit längerer Zeit. Gewisse Teile seien verkommen.
Keep to the entrances when you walk around. We won’t let you leave the house after dark.
Die Aussicht auf den unsicheren Park verschreckte sie. Sie würde sich trotzdem so viel wie möglich ansehen. Sie hoffte, die Kleine würde ihre Neugier teilen.
Die Stantons bewohnten die zwei unteren Stockwerke in einem Apartmenthaus im Norden der Upper East Side. Mr.Stanton stellte den Wagen auf einem Parkstreifen ab. Mrs.Stanton kam aus dem Haus, gefolgt von einem blonden Mädchen. Sie breitete die Arme aus und nahm Lisa in Empfang. Sie drückte ihre Ellbogen hinauf und hinunter, eine Szene aus einem Märchen der Brüder Grimm, Lisa kam nicht drauf, welches.
Welcome, welcome, sagte Mrs.Stanton.
Hi, Mrs.Lisa, sagte Suzy.
Der erste Brief ihres Vaters ließ nicht lange auf sich warten. Er hatte ihn am 10.September abgeschickt mit dem Sonderstempel Erster Polarflug Wien-London-Seattle-San Francisco. Sie wusste nicht, ob das einen rascheren Transport bedeutete. Der Brief war sieben Tage unterwegs gewesen, genauso lang wie Julians Briefe aus New York. Sie hatte nach ihrer Ankunft eine Ansichtskarte per Air Mail an die kleine Maus geschickt.
Lieber Papa! Die Familie ist sehr nett, Suzy – sie sprechen es mit einem U aus, das mehr nach Ü klingt, nicht wie unser Susi – gewöhnt sich rasch an mich. Ich bringe sie zum Lachen, erfinde Geschichten mit ihr. Oft muss ich mich zusammenreißen, der Gedanke an Kathilein ist unerträglich. Ich erzähle nie von ihr, die Stantons lassen mich in Ruhe und fragen nicht nach. Manchmal glaube ich, sie wissen gar nicht, dass ich eine Tochter im Alter von Suzy habe. Wahrscheinlich sind sie nur sehr diskret. Kommen die Schwiegereltern euch besuchen? Julian werde ich nächstes Wochenende sehen. Du glaubst nicht, was man hier alles fotografieren kann. Solche Menschen gibt es bei uns nicht. Nicht nur wegen der Kleinstadt. Ich umarme euch alle. Lisa
Nach ihren ersten Erkundungsgängen beschloss Lisa, sich der Wucht dieser Stadt auszuliefern, sich in den Rausch des Neuen zu verlieren. Die Zeit schien hier breiter, es hatte viel mehr Platz in einer halben Stunde, gar in einem Tag. Dauernd wechselnde Menschen auf der Straße, ein Schub nach dem anderen, als würden hinter den Riesenhäusern unaufhörlich Erwachsene geboren und losgelassen, von Kindern und Babys gar nicht zu reden. Passanten wurden auf die Gehsteige gespült und schritten wie selbstverständlich aus. Jeder wusste, wie man sich bewegte, um andere Fußgänger kurvte, Fahrzeugen auswich, seinen Hut nicht verlor. Die vielen Frauenbeine in Stöckelschuhen, die das Gehen in Tanzschulen gelernt haben mussten. Die unzähligen gelben Taxis und die anderen mit eierschalenfarbenem Dach und der schwarz-weiß-karierten Leiste, die die Fenster wie eine Bordüre einfasste.
Könnte sie doch mit einem Maßband Woche für Woche abmessen bis zum letzten Monat ihres Aufenthalts, schnell heruntermessen, unter ihren Daumen die verstreichende Zeit spüren und den Aufenthalt verkürzen.
Lisa beugte sich zu Suzy und knöpfte ihr den Mantel zu. Die Kleine reckte den Hals.
You take the scarf?
No.
Sie band die Masche von Suzys Mütze unter dem Kinn, zog ein paar Locken heraus. Sie tupfte ihren Zeigefinger an der Zunge an und fuhr die Augenbrauen der Kleinen nach. Das ließ das Kind geschehen, als wäre es eine Salbung, etwas Geheimnisvolles von dort, wo Lisa herkam. Wenn die Mutter des Kindes dabei war, vermied sie es. Mrs.Stanton könnte das unhygienisch finden.
Die Geldbörse war ein Geschenk ihres Vaters für New York. Sie hatten auf der Bank Dollarnoten bestellt. Zum Glück passten die langen Scheine in das Fach. Sie kaufte zwei Karten für den nächstbesten Bus.
Lisa hielt sich an einer Schlaufe fest, die von der Haltestange baumelte. Suzy saß einen halben Meter unter ihr auf dem einzigen freien Platz. Lisa stand so nahe bei der Kleinen, dass sie nicht vom Sitz fallen konnte.
Don’t kick me!
Suzy lehnte sich zurück und schaute zu den Erwachsenen hinauf, dem Mann neben Lisa. Lisa spürte seinen Körper an ihren anschlagen, wenn der Chauffeur bremste. Sie drehte sich zur Seite, schläfriger Blick zur Täuschung, ein Mann im grauen Anzug, glitzernde Kette am Handgelenk. Merkwürdig bei einem Mann. Die Kette schwang hin und her. Es war die linke Hand, der Knöchel des Gelenks, das weiche, fast weiße Fleisch. War das eine Narbe? Die Ader verzweigte sich wie Broadway und Sixth Avenue auf ihrem Stadtplan, quer darüber ein kleiner Strich, der den Verkehrsfluss störte. Eine Brücke aus Haut.
Sie war froh, Handschuhe zu tragen.
Der Bus wechselte die Spur, die Passagiere an den Schlaufen schwangen mit.
Lisa?
Liii-saaaa, maulte Suzy.
Whaa-at.
Suzy umklammerte ihr linkes Handgelenk mit der rechten Hand und schnalzte leise mit der Zunge. Dann umgekehrt. Nun streckte sie die beiden Hände wie an den Gelenken gefesselt vor sich hin. Ihre Augen rollten schräg zu dem Mann hinauf.
In diesem Moment drehte er seine Kette herum und rieb an der Stelle.
B-loood, formte sich auf Suzys Lippen.
Lisa warf einen Blick auf die Hand des Mannes. Natürlich blutete er nicht.
Sei dankbar, dass du am frühen Morgen nicht außer Haus musst, hatte Julian zu ihr gesagt. Du ja auch nicht, hatte sie gedacht.
Sie setzten sich auf eine Seitenbank. Suzy zog an den Bändern ihrer Mütze.
Hold still, sagte Lisa, während sie mit dem Zeigefinger nach dem Loch in der festgezogenen Schlaufe bohrte und sie auflöste.
Eine Frau nahm auf der gegenüberliegenden Bank Platz. Trotz ihrer massigen Oberschenkel, die einen dunkelgrauen Mantel zum Zerreißen spannten, legte sie die Beine übereinander. Sie hatte erstaunlich schlanke, elegante Unterschenkel. Mit einem Mal war sie eine andere Person. Die schwarzen Nylonstrümpfe sprachen von einem früheren Leben, die Laufmaschen waren zu kleinen Wülsten vernäht. Repassieren hieß das zuhause und war bis lange nach dem Krieg üblich gewesen. Sie trug halboffene Schuhe mit einem leichten Stöckel, in die sie gerade noch hineinpasste.
Der Kopf der Frau sank vornüber, ein Pfeifen ohne Ton. Ihr ärmlicher Leinenhut verdeckte Stirn und Augen, die Hände umklammerten den Griff ihrer Tasche, die auf den übereinandergeschlagenen Knien stand und wie in einem Gebetsritual vor- und zurücksank.
Lisa setzte die Kamera auf ihren Schoß und hustete leise, während sie knipste. Wenn die Frau bis zur nächsten Station schlief, könnte sie eine Aufnahme ohne Rütteln machen. Vorausgesetzt, Suzy hörte endlich auf, sich vor unterdrücktem Lachen zu schütteln. Sie presste ihren Schenkel gegen das Kind.
Im Wohnzimmer lagen die Magazine der letzten Monate. Das Septemberheft der Vogue zeigte auf dem Titelblatt die berühmte Suzy Parker, wie Mrs.Stanton ihr erklärte. Sie posierte in einem engen, blauen Kleid mit olivgrünem Gitter darüber. Keine Mode, mit der Lisa etwas anfangen konnte. Sie brauchte den Schutz und die Freiheit, die ein weiter, schwingender Rock gab. Da mochte Suzy Parker noch so siegesgewiss in die Weite schauen, die hohe Stirn, den Mund weit aufgerissen, so wollte sie nicht aussehen.
Suzy Parker lehnte an einer Reling, weiße Handschuhe, keine Angst vor Flecken (bei der Aufnahme hatte es nicht geregnet). Auf der Maasdam hatte Lisa nie so posiert, für wen auch? Für den netten Holländer vielleicht, aber nicht, solange sie gegen die Seekrankheit ankämpfen musste.
Parker habe als erstes Fotomodell mehr als hunderttausend Dollar im Jahr verdient. Letztes Jahr war sie in einer kleinen Nebenrolle in Kiss Them for Me mit Cary Grant und Jayne Mansfield zu sehen gewesen. Und in Funny Face mit Audrey Hepburn und Fred Astaire.
Lisa hörte genau zu, wie Suzys Mutter die Namen aussprach. Das waren nochmal aufregendere Namen, weil Betsy als native speaker sie anders aussprach. Sie fragte Lisa nach ihren Lieblingsschauspielern.
Gregory Peck in A Heart and a Crown?
Der Titel sagte Mrs.Stanton nichts.
With Audrey Hepburn. – Er spiele in Rom.
Oh, Roman Holiday!
Urlaub in Rom – das klang langweilig. Da war der deutsche Titel romantischer.
You don’t mind the rain? fragte Suzys Mutter.
I love rain, sagte Lisa.
Sie blickten beide auf Suzy hinunter, die sich nicht entscheiden konnte. Kurz darauf stand sie in ihren Gummistiefelchen, mit Dufflecoat und einem Regenschirm bei der Tür. Lisa hatte ihre Kamera unter der Regenhaut. Suzys neugierige Augen zeigten, dass sie über ihre Unlust gesiegt hatte. Sie stapften los, Suzy hüpfte in Pfützen, bis Lisa es ihr verbot. Eine Weile lang schmollte Suzy und schritt mitten durch die Pfützen, ohne große Spritzer zu erzeugen. Sie wanderten bis zu dem Platz, wo sie die Tauben fütterten. Lisa fragte, ob ihr etwas auffalle.
No.
Look at the pigeons.
Die nickten, schauten in die Pfützen hinein, legten den Kopf von einer Seite auf die andere, um ihr Aussehen zu kontrollieren.
Like ladies, sagte Suzy.
You know Venice?
Suzy schüttelte den Kopf.
Venice, Suzy, is the most beautiful city in the world. It’s in Italy.
Little Italy? fragte Suzy.
Am Markusplatz gebe es noch mehr Tauben. And a big church, St.Mark’s, the Markusdom.
Like a snow dome?
What’s a snow dome?
A glass ball: when you shake it, snow falls.
Real snow?
Yesss.
Lisa machte ihre Regenhaut auf und holte die Kamera heraus. Einstellen, Auslöser entsperren, die Kurbel der Rolleiflex drehen, vor, zurück, es musste schnell gehen. Schon war die Kamera an ihrem warmen Oberkörper vertaut.
Ein herrlicher Herbstmorgen. Weniger als einen Meter vor ihrem Fenster zeigte ein Ast des Ahornbaums zu ihr her. Er könnte ein Verbündeter werden, ihr Botschaften überbringen. Der Ahorn strotzte nur so von goldgelben Blättern. Die Linden zuhause am Ufer des Bachs waren verspielter, schwangen sofort mit, wenn der Wind in ihre langen, dünnen Zweige griff.
Im Dezember 1944 hatte eine Bombe das ein paar Häuser vom Wohnhaus entfernte Geschäft der Eltern getroffen. Gut zwei Drittel des Dachstuhls fehlten. Ihr Vater hatte den Schaden fotografiert, der Schnee zeichnete auf den verbliebenen Querlatten des Dachstuhls weiße Wellenlinien, als rutsche das Dach langsam aus großer Höhe zu Boden. Von den Dächern der Nachbarhäuser mit ihren unversehrten Schneedecken gafften die dunklen Luken der Dachfenster herüber. Warum es den Schnee dort nicht weggeblasen hatte, blieb ihr ein Rätsel.
Die Eltern sagten noch lange, was für ein Glück es gewesen war, dass die alliierten Bomber außerhalb ihrer Geschäftszeiten gekommen waren. Die Flotte befand sich, wie sie später erfuhren, auf dem Rückweg vom Protektorat Böhmen und Mähren Richtung Italien.
2
Hast du ihm von dem Teddybären erzählt? fragte Lisa.
Nein, sagte Julian.
Solltest du aber. Das imponiert deinem Chef sicher. Vielleicht rührt es ihn sogar. Hat er Kinder?
In seinem Büro stehen gerahmte Fotografien seiner Familie. An der Wand hängen Kollegenporträts, eins davon ziemlich schief.
Das finde ich sehr sympathisch. Wenn ich ihn kennenlerne, erzähle ich ihm die Geschichte mit dem Teddybären.
Wenn du meinst. Was gibt es für Neuigkeiten von zuhause? Was macht unser Liebling?
Lisa zog das Foto aus der Tasche, Kathi stand mit X- und O-Beinen zugleich auf einem Baumstumpf beim Bach.
Papa hat geschrieben, sie braucht orthopädische Schuhe.
Zeig her. – Julian besah sich das Bild. – Frag ihn, ob er bemerkt, dass sie schief geht, einen Haltungsfehler hat. Wie man nur die Beine so verdrehen kann.
Lisa nahm ihm das Foto aus der Hand. Die Frage, was mit Kathi geschehen würde, wenn sie ernsthaft erkrankte, hatten sie vor seiner Abreise natürlich besprochen. Auf Friedrich, den praktischen Arzt, war Verlass, und er hatte eine gute Art mit Kindern. Der Zahnarzt ebenso, und bei einer Verletzung oder Verdacht auf Blinddarm oder Mandelentzündung musste sie ohnehin ins Krankenhaus. Sein Chef auf der Chirurgie würde sie versorgen. Der Primarius war eitel, verlangte etwa von den Schwestern, sie sollten einen neuen Film mit seinem Doppelgänger O. W. Fischer ansehen. Julian strahlte etwas ganz anderes aus in seinem weißen Mantel. Freude an der Arbeit. Freude an den Patienten.
Und da ist ein Brief von der kleinen Maus für dich. – Sie gab ihm ein Kuvert.
Das dünne Stück Papier. Ein Schiff auf wildem Meer, Wellen mit blauem Buntstift. Zwei Tiere oder Flugzeuge schwammen hinter dem Schiff. LIEBER PAPI ICH SCHICKE DIR VIELE BUSSI. Am unteren Rand der Zeichnung eine Bordüre mit einer Windmühle, einem Mann, einem kleineren Schiff, einem Haus und einem Baum.
Bin das ich? fragte Julian.
Wer sonst?
Ich werde ihr bald schreiben, sagte er und steckte die Zeichnung in den Umschlag zurück.
Lisa trug ihr weißes Sommerkleid mit einer leichten roten Jacke darüber. Die Bank lag im Halbschatten. Er legte den Arm um ihre Schulter und küsste sie auf die Wange.
Keine Kamera heute?
Sie schüttelte den Kopf.
Warum nicht?
Lisa drehte sich weg.
Was ist?
Nichts, sagte sie.
Es war offensichtlich, dass er keine Lust hatte, das große Thema neuerlich anzusprechen. Am Ende ihrer Gespräche war jedesmal die grausame Wahl geblieben. Nach einigen Monaten nachkommen, weil er ohne sie nicht sein wollte, und auf Kathi verzichten – oder mit der Kleinen daheim ein ganzes Jahr warten. Das Krankenhaus bot ihm freie Unterkunft und Verpflegung für seine Ausbildung, eine gemeinsame Wohnung für die Familie war ein frommer Wunsch. Mit seinem geringen Verdienst konnte er nichts beitragen. Sie musste für sich selbst sorgen. Da blieb nichts übrig für ihrer beider Kind.
Es war eine schlimme Liebeserklärung. Für ihn gab es nichts anderes, als dass sie im September folgen würde. Er brauchte sie. Und er brauchte ihre Hilfe. Bereits zuhause hatte er sie gebeten, öfters einen Beitrag aus den Schweizer und deutschen medizinischen Zeitschriften zu lesen, die nicht einmal das Krankenhaus abonnierte, sondern er auf seine eigenen Kosten. So würde sie sich an die Ausdrucksweise und bestimmte Begriffe gewöhnen.
Dasselbe sollte sie nun mit den englischen Fachartikeln tun. Sie müsse nur die medizinischen, sprich lateinischen Fachwörter unterstreichen, die leicht zu erkennen seien, und dann im Umfeld Wörter suchen, die sich wiederholten.
Sie hatte im Gymnasium eine gute Englischlehrerin gehabt. Nach seinem Studium hatten sie miteinander Kurse belegt, sich Lektionen für medizinisches Englisch von einer Buchhandlung in Wien schicken lassen.
Im Frühjahr hatte eine amerikanische Sprachassistentin ein Zimmer für drei Monate gesucht. Beverley hatte ihr die Angst vor der Konversation genommen. Sie war ihr wie eine Nixe vorgekommen, ein bisschen frivol, die sie in das neue Wasser des Amerikanischen zog.
In den ersten Wochen nach Julians Abreise hatte sie ihn sehr vermisst, es war die erste lange Trennung seit seiner Studienzeit. Dann war die Erwartung gestiegen, die Vorfreude, Neugier, auch die Angst vor New York. Kathi war immer deutlicher hervorgetreten, als hätte ihre Präsenz zugenommen, je näher die Trennung rückte. Sie hatte Lisas Aufregung mitgelebt, hielt beim Einschlafen in Julians Bett ihre Hand. Wenn sie bei Julian wäre, könnte sie auf ihn aufpassen. Er könnte sie weniger leicht betrügen. Manchmal durchlief Kathi ein Schauer wie einen im Schlaf zuckenden Hund.
Zog sie den Körper ihres Mädchens an sich, fiel ihr der rettende Gedanke ein. Es ist ja nicht für lange. Sollten wir es nicht aushalten, du oder ich oder wir beide, komme ich zurück. Egal, was aus der gebuchten Schiffskarte wird.
Was machst du abends? fragte sie.
Der Chef sieht es gern, wenn man die Vorträge besucht. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, sich auf den neuesten Wissensstand zu bringen. Und wir stellen Fragen! Niemals wäre das in Wien möglich gewesen, das waren alles sture, arrogante Männer, die jede Frage als Angriff auf ihre Ehre betrachtet hätten. Wenn ich an diese Korporierten denke, mit ihren Schmissen auf der Wange und am Kinn. Die waren nicht eingezogen gewesen, das durften wir erledigen. Hier bläst ein anderer Wind, hier kannst du alles fragen. Ich habe nie eine dumme oder ironische Antwort erhalten. Team spirit.
Lisa hörte ihm zu. Wie lebendig er da wurde, als kreise ein anderes Blut in ihm, eines mit mehr roten Blutkörperchen, nicht das graue daheim.
Während der Hitzewelle im Juli sah ich einen kleinen Buben in den Springbrunnen hüpfen, erzählte er. Voll bekleidet, Hose und Hemd. Es wäre toll gewesen, wenn du das gesehen und fotografiert hättest. By the way … hast du wieder ein paar Filme voll? Mit zwölf Aufnahmen kommst du nicht weit. Ich verstehe, dass dir die Rolleiflex deines Vaters viel bedeutet, aber es gäbe bequemere Lösungen.
Ich würde die Filme am liebsten selbst entwickeln. Ich weiß, wie es geht.
Das kann man den Stantons nicht zumuten.
Nein? Tatsächlich nicht? Das kann man ihnen nicht zumuten? – Lisa war aufgestanden. Julian war sofort bei ihr und nahm sie in die Arme. Sie wollte ihn wegstoßen, aber er hielt sie fest, drückte ihren Kopf an seine Brust, unter seinen Kopf, in die Halsmulde, wo er so gut roch, wo sie sich aufgehoben und beschützt vorgekommen war. Es hatte sie nie gestört, wenn er nach Krankenhaus gerochen hatte, beim Heimkommen nach dem Dienst oder nach dem Nachtdienst.
Die Männer, die sie kannte, rasierten sich alle nass. Sie mochte den Geruch des Rasierschaums nicht. Er verband sich mit nassen Handtüchern, die nicht gewaschen wurden, mit Badekabinen, mit unsauberen Holzlatten, mit gestreiften, dünnen Frotteemänteln. Das Schlimmste war, wenn einer unter dem Ohr einen eingetrockneten weißen Fleck hatte. Sie hatte darauf gewartet, dass Julian sich in New York einen Rasierapparat anschaffen würde, für sein neues Leben, für das winzige Bad in seinem Ärztezimmer in diesem Krankenhaus. Das hatte er getan. Er roch nach einem neuen Aftershave.
Mein Schatz, sagte er inständig. Jetzt zeige ich dir, wie man Subway fährt, damit du nicht ständig den Bus nehmen musst.
Vor der Subway hatte sie sich am meisten gefürchtet. Lisa versuchte auszurechnen, wieviel 15Cents in Schilling waren. Julian löste die Karten und steckte seine bei dem Drehkreuz hinein, das wild nach vorn ausschlug. Sie zögerte. Sie schob das Ticket in den Schlitz, beinahe wäre es umgeknickt, die Stangen griffen ihr an die Oberschenkel. Julian zog sie weg, damit die Leute hinter ihr ungestört weiter drängen konnten.
Während der Woche komme ich praktisch nie hinaus, sagte Julian. Da muss es mindestens doppelt so voll sein, wenn rush hour ist.
Aus dem Tunnel hörte man das Quietschen eines herannahenden Zuges, ein zum Äußersten gereiztes Tier, das es auf sie abgesehen hatte. Mit Getöse fuhr der endlos lange Zug ein. Die Passagiere strömten aus den Waggons. Dieses ewige Fließen, keine Ruhe, kein Stillstand, als ob es allein darauf ankäme, in Bewegung zu sein. Worum sollte es sonst gehen in einer Subway, deren Zweck es war, möglichst viele Menschen von einem Ort an den anderen zu bringen. Statt über der Erde wie bei Straßenbahnen und Bussen eben unter der Erde, eine geniale Erfindung. In Wien würde es nicht so bald Untergrundbahnen geben, dafür war die Stadt zu klein.
Sie fielen beide auf eine Bank, als der Zug losfuhr.
Julian nahm einen schmalen Plan aus seiner Brusttasche und faltete ihn auf.
Wir sind hier, sagte er. Wir fahren die Eighth Avenue hinunter, steigen am Broadway um, dann bis zur 42nd Street, bei der Public Library steigen wir aus.
Ihnen gegenüber saß ein Paar etwa in ihrem Alter. Die Frau hatte einen schwarzen Mantel über ihrem weißen Kleid umgehängt. Sie betrachtete ihre rot lackierten Fingernägel. Der Mann neben ihr war amüsiert. Er redete leise zu ihr.
Lisa stieß Julian leicht mit dem Ellbogen an. Er beugte den Kopf zu ihr.
Die zwei, flüsterte sie.
Hübsch, sagte er.
Die sind glücklich.
Wir sind auch glücklich. Wenn die aufschauen, sehen sie uns und denken sich dasselbe.
Beim nächsten Halt stieg eine kleine Gruppe Jugendlicher in Sportbekleidung ein. Auf den Ärmeln ihrer grauen Jacken prangte ein großes blaues B. Die Taschen schoben sie auf dem Boden herum. Lisa zog die Beine an.
Das sind Brooklyn Dodgers, sagte Julian. Zumindest die Jugendmannschaft. Die haben den ersten schwarzen Baseballspieler verpflichtet. Schnell sind sie ja. Angeblich übersiedeln sie nächstes Jahr nach Kalifornien.
Geht das überhaupt? Dann sind sie keine Brooklyn Dodgers mehr. Das wäre so, als wenn die Wiener Philharmoniker nach Salzburg übersiedeln. Und diese Nachwuchsspieler, die können doch nicht alle ihre Eltern an der Ostküste zurücklassen?
Alles geht. Wir sind in Amerika, vergiss das nicht. Für die Karriere tut man hier sehr viel.
Würdest du unserem Sohn erlauben, an die Westküste zu ziehen, damit er dort seine Baseballkarriere startet?
Ich kann mir vorstellen, dass die Jungen hierbleiben, sagte Julian. – Die Public Library wird dir gefallen. Zwei mächtige Löwen sitzen auf Sockeln bei der Treppe. Es hat etwas Orientalisches. Dein Vater wäre begeistert. Ich habe seine Belesenheit immer bewundert. Das ist ein festes Bild, das ich von ihm habe. Er und Mama am Tisch in der Bauernstube, er mit einem aufgeschlagenen Buch, die Zigarette im Aschenbecher. Mama –
Lisa hoffte, die Stantons würden ihr für die Ausflüge in den Central Park nicht ein wöchentliches Maximum setzen, zweimal pro Woche etwa, obwohl so die Zeit schneller vergehen würde. Das Wichtigste für Suzys Eltern musste das Wohl des Kindes sein, und wenn es solchen Spaß hatte, sollte man ruhig ein bisschen lockerer damit umgehen. Lisa hörte sich argumentieren. Sie wusste, dass sie vom guten Willen der Stantons abhängig war. Suzy hatte im Sommer Mumps mit nachfolgender Gehirnhautentzündung bekommen. Auf Anraten des Kinderarztes hatten die Stantons beschlossen, sie erst ein Jahr später einzuschulen. Sie genoss den Aufschub.
Vor Lisa lag der Schatten einer Frau im Gras. Die Figur verjüngte sich von den Knien und der Kante ihres Rocks bis zum Hals hin. Der Kopf war zu klein. Suzy hüpfte hinein und heraus.
What’s this lady’s name today? fragte Lisa.
Today – she’s Mother Goose!
Why?
Suzy wanderte den Rand von Lisas Schatten ab.
You’re a goose, Lisa. – Sie rannte mit flappenden Armen herum und drehte sich wie ein Kreisel.
What does Mother Goose want to do today?
Visit the carousel.
Okay.
Das Karussell befand sich in der Mitte des Central Parks. Lisa wartete darauf, dass Suzy müde werden würde, aber das Mädchen schritt und tanzte munter vor sich hin. Bald wurde ihr der Mantel zu warm. Mrs.Stanton hatte darauf bestanden.
Die Leierkastenmusik drang an ihre Ohren. Zirkus auf dem Fußballplatz. Das geschlossene Zelt, in dem sich die Musik wälzt. Die Waggons mit den Tieren.
Come along, drängte Suzy.
Die buntbemalten Pferde glänzten, als wären sie frisch gestrichen. Sie waren größer als normale Karussellpferde. Ein Apfelschimmel mit kräftigem Hinterteil, mitten im Sprung, zog vorüber, die Nüstern weit aufgebläht, das Maul offen, sodass man die fleischrote Zunge sah. Kinder mit ebenso weit aufgerissenem Mund, ein Lärm, Gekreische, Juchzen, und fröhliche Erwachsene, die hinter den Kindern auf dem Sattel saßen und das Zaumzeug in den Händen hielten. Luftballons, von denen sich die Pferde nicht beirren ließen. Ein Vater mit Hut und leichter Jacke hatte besonderen Spaß, seine Brille war verrutscht, er jagte mit lauten Rufen auf seinem braunen Pferd dahin.
Ein fremdes Mädchen kam zum zweiten Mal vorbei. Es lachte verzerrt wie ein Kobold, und Lisa wusste, dass das auch seiner eigenen Stimme galt.
Das Karussell stand still. Lisa ließ sich von dem Betreiber, der als Zirkusdirektor verkleidet war, aufs Pferd helfen und nahm Suzy von ihm entgegen. Das Kind saß vor ihr, Lisa spürte den warmen, von der Sonne erhitzten Körper. Als sie gemeinsam die Zügel hielten, erstarrte Suzy. Lisa musste sie am Bauch festhalten. Sie hatte keine Ahnung, warum sich das Mädchen fürchtete, der ganze Übermut war auf dem Boden geblieben.
Isn’t the horsie wonderful? How he laughs? See his teeth? sagte Lisa.
Sie musste an die Bauernwirtschaft mit dem großen, hölzernen Drehkreuz auf der schiefen Wiese zuhause denken. Die Kinder hängten sich mit dem Oberkörper über die Querbalken und liefen mit, bis der Boden in der Abschüssigkeit verschwand.
Lisa winkte dem Zirkusdirektor, der die paar Schritte zu ihrem Pferd aufholte. Er wackelte mit dem Kopf und grinste.
My little princess, let’s go for another ride, the prince is waiting for you, the most beautiful prince.
Wirklich ließ sie sich beeindrucken von dem Mann, sie entspannte sich, hüpfte hoch, sodass Lisa Mühe hatte, sie zu halten.
See? sagte Lisa.
Where is the Prince? fragte Suzy zurück.
Lisa dachte, für den musste wohl sie sorgen, wenn sie das Karussell verließen.
Sie saßen im Café. In der hohen Glastür schien ein junger Mann zu stehen, der sich umdrehte und Lisa eindringlich ansah. Er trug ein weißes Hemd. Forderte er Lisa auf, ihm zu folgen? Die Lampen des Cafés, große Schüsseln, hingen hellblau im Himmel. Von der Seite strahlten Neonstäbe von den Häusern kaltes Licht ab.
What do you want?
Ice cream, strawberry. – Suzy winkte dem Kellner, der sofort zu ihnen an das Tischchen kam.
Yes, madam? fragte er die Kleine.
Ice cream, strawberry, sagte Suzy und begann zu kokettieren, Kopf hin und her, der Mund ein breites Grinsen. Lisa bestellte Kaffee.
Am Nebentisch lächelte eine ältere Frau begeistert über das neckische Mädchen. Das Lächeln versank bald danach in einer Traurigkeit. Würden ihre Enkelinnen, die widerspenstigen Gören, dem Vergleich nicht standhalten?
Kein guter Tag heute, dachte Lisa. Es wurde wieder warm, viel zu warm, stickig, große, schnelle Hitze der Stadt.
Der Kellner schob die zwei Tabletts auf den Tisch. Suzy grub mit ihrem Löffel in das Schlagobers und nahm, so viel darauf Platz hatte.
You like it?
Suzy nickte tief und hoch.
You look like a –
Horse? fragte Suzy.
No.
A donkey? Iiiiii-aaaah.
Yes. Yes.
An einem der Tische hielt eine Frau ihre weiße Teetasse an den Mund. Sie sah aus wie eine Ärztin mit Mundschutz. Schräg daneben ein Mann allein. Er aß einen Schokoladekuchen.
In ihrer Stadt gab es zwei Konditoreien, die sich in einem ewigen Konkurrenzkampf befanden. Die eine trumpfte mit dem Sohn der alten Besitzerin auf, einem echten Genie, der über Rezepte aus Frankreich verfügte. Er war dort in Kriegsgefangenschaft gewesen. Die andere hatte das gespachtelte Milcheis auf ihrer Seite. Das volle, aber nicht fette Haselnusseis, das Vanilleeis, das Schokoladeneis. Das Zitroneneis schmeckte, als sei es mit Wasser gemacht worden. Ein sogenanntes billiges Eis. Wie es billige Stoffe gab, billige Frauen.
Der Mann hatte seine Kuchengabel offenbar schon ein paar Sekunden in der Luft gehalten und schaute ihr zu. I was thinking about cheap ice cream, könnte sie sagen. Cheap ladies. Er ließ ihren Blick nicht los, auch nicht, als er seine Hand mit dem Tortenbissen zum Teller zurückführte. War das ein Flirtversuch? Ein wildfremder Flirtversuch? Die Männer, die bis jetzt mit ihr geflirtet hatten, waren alle mehr oder weniger gute Bekannte gewesen. Unverfängliche Begegnungen, unernste Plänkeleien, wer fand wen attraktiv, mit viel Gelächter, keine Nachtspaziergänge.
Das hier war – freie Wildbahn. Er sah nicht einmal einem Schauspieler ähnlich, was eine gute Ausrede wäre und eine Distanzierung. Dieser Mann schaffte das aus eigener Kraft. Schmunzelte über seiner Torte, nahm zart die Tasse, kein Ehering. Lieber wäre es ihr, er trüge einen. So konnte sie sich einbilden, er säße ihretwegen hier. Nicht ihretwegen, sondern er tat das aus Gewohnheit, in einem Café oder einer Bar zu warten, bis ihm eine Frau gefiel. Er wollte, dass sie ihn bemerkte. Er wischte seinen Mund mit der weißen Serviette ab, legte sie zurück und hob dabei seine Augenbrauen, aber nicht seine Augen, das tat er erst jetzt, nachdem sie darauf gewartet hatte. Ihrer beider Blicke trafen sich nun.
Are you the Prince? fragte Suzy.
Von den zwei neuen Fachartikeln handelte einer von der Renaissance der Hypnose in der Anästhesie, im anderen ging es um die sedative Wirkung des Antihistamins Promethazin bei einem chirurgischen Eingriff. Diesen würde sie zuerst in Angriff nehmen, weil er mehr Pflicht als Vergnügen darstellte. Hypnose klang interessanter, damit würde sie sich belohnen – und am Ende selbst bei der Lektüre einschlafen?
Außer wenn es um chemische Vorgänge ging, die kompliziert beschrieben wurden, verwendeten viele Autoren eine recht einfache, klare Sprache. Es gab beruhigende Sätze. Sedative – a good night’s sleep before the operation. During the operation – it reduces the need – for anesthetic agents. Agents. Narkosemittel. It may stop hiccupping – that develops during surgery. Hiccup? Schluckauf. Julian hatte nie vom Schluckauf eines Patienten während eines Eingriffs erzählt. Nach der Operation verhinderte Promethazin langandauernden Schwindel und Erbrechen. Höchst sympathisch.
Dann stieß sie auf den Begriff artificial hibernation. Künstlicher Winterschlaf. Ein Bär tauchte vor ihrem geistigen Auge auf, in einer Höhle zusammengerollt, die Pfoten über Schnauze und Augen, das geschützte Rund eines schlafenden Tierkörpers.
Antihistamine im Tierversuch. Im Experiment wurden Labortiere verwundet, die zuvor verabreichten Antihistamine erhöhten die Heilungsraten.
Lisa hatte Julian nie danach gefragt. Sie traute ihm zu, an solchen Versuchen teilzunehmen, unter dem Druck eines charismatischen Chefs allemal. Ein unvermeidlicher Aspekt seiner Ausbildung.
Trauma war ein anderes Wort für Schock.
Liebe Lisa! Gestern wollten wir uns den Film Tiere des Waldes ansehen, kein Disneyfilm. Als das Eichkätzchen in Gefahr geriet, begann Kathi zu zittern und zu schluchzen. Wir gingen natürlich sofort hinaus. Wir sind beide sehr deprimiert, weil das Geschäft seit heuer so schlecht geht. Ich werde mir ein größeres Darlehen auf das Haus aufnehmen müssen, wenn ich eines bekomme. – Bitte nicht Julian erzählen. Mama hat mir bis jetzt 6000 Sch gegeben für die allerdringlichsten Fakturen, aber jeden Monat wird etwas dringend, da die Eingänge zu klein sind. Schreib Mama bitte nichts über mein Lamento, sie ärgert sich sonst wieder und ihr Herz ist sowieso nicht sehr strapazfähig. Vielleicht wendet sich doch noch alles zum Besseren. Verzeih, wenn ich dir von meinen Sorgen abgab! Dein Papa
Am nächsten Tag fuhren sie ein paar Stationen mit dem Bus und spazierten ziellos herum. Die Sonne schien, vor einer Bar stand ein unbegleiteter Kinderwagen, der einen scharfen Schatten warf. Ein Luxuswagen in dunklem Marineblau. Das Dach war in drei Etagen aufgespannt, auf dem Bettkörper spreizten sich vier Finger einer goldenen Krone. Eine Froschkönigskrone, wie auf den Dosen des Erdal-Lederfetts im Geschäft des Vaters.
Weiße Wäsche, keine Decke, ein Kissen. Suzy versuchte so weit wie möglich in den Wagen zu schauen, kenterte beinahe. Kein Baby. Nur eine Babypuppe in der vorderen Ecke. Sie nahm sie heraus und küsste das Zelluloidkind auf den kahlen Kopf.
Poor baby, sang sie. Where’s your Mummy? In the bar?
Ein Neonschriftzug – Rheingold Extra Dry – hing von der Decke. Um diese Tageszeit war er nicht eingeschaltet. Suzy hob die Puppe hoch, sodass sie mitlesen konnte. – Rhine, what kind of gold?
Bloß kein Wagner, dachte Lisa. Zuhause drehte sie bei Wagner das Radio ab.
Ach, nothing special. Not gold really.
But the baby doll wants to know.
Während Suzy die Puppe tröstete, richtete Lisa die Kamera auf die Scheibe der Bar. Drinnen saßen Männer in Anzügen, die ihre Hüte nicht abgenommen hatten.