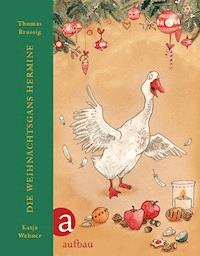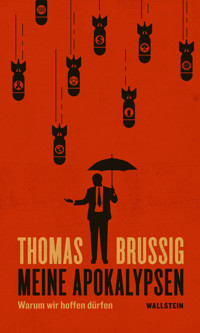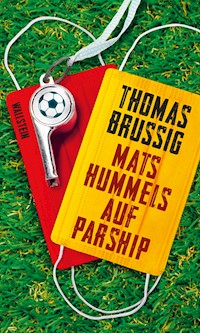8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sommer 1989 bis Sommer 1990 - als alle über Ungarn rübermachen, die Mauer fällt und Deutschland Weltmeister wird. Thomas Brussig erzählt von der rollschuhfahrenden Lena, die den Wendehit schreibt, von Lenas großem Bruder, dem einzigartigen Leica-Photographen, von Leo Lattke, dem Starreporter, der gerade jetzt in eine Schreibkrise kommt, erzählt von Alfred Bunzuweit, dem furzenden Direktor des Palasthotels, von Jürgen Warthe, dem Bürgerrechtler, von Gisela Blank, der begnadeten Rechtsanwältin, oder auch von dem 19-jährigen Albino, der für einen Weltkonzern die Volkswirtschaft sondiert. Thomas Brussig schildert eine Zeit des Aufbruchs, der neu gewonnenen Freiheit, der Unsicherheit, eine Zeit, in der alles möglich war, nichts undenkbar und mehr passierte, als man es je zu träumen wagte. Niemand hat bislang das Lebensgefühl dieser Zeit so farbig und so genau in Bilder und Worte gefasst wie Thomas Brussig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Ähnliche
Thomas Brussig
Wie es leuchtet
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
für Kirstin
Verschwommene Bilder
Alles, was ich über diese Zeit weiß, weiß ich von deinen Bildern, sagte Lena. Ja, es ist meine Bestimmung, dem Leben die Bilder zu entreißen. Das Leben zu knipsen bedeutet, Menschen zu knipsen. Ich habe sie alle geknipst, die Albaner und die Albinos, die Athleten und die Amputierten, Aktivisten und Adventisten, Astrologen und Astronauten, Alkoholiker wie Antialkoholiker, die Autoknacker, Asthmatiker, Ausländer, Abendschüler, Alpinisten, Angler, Armdrücker und Auktionatoren, die Augenklappenträger und deren Ansprechpartner, die Augenärzte, die Archäologen, die Anarchisten, Apfelpflücker, Akkordeonspieler, Attentäter, Altnazis, Autoren, Artisten, Anwälte, Asketen, die Abräumer, Abwäscher und Abzocker, die Aufreißer, die Analphabeten, die Asse aller Abteilungen sowie die Angsthasen, die Arschgeigen, die Arrivierten, die Atheisten, die Armleuchter, die Angestellten, die Aushilfen, die Arbeiterklasse und schließlich auch die Antisemiten. Der Rest des Alphabets ist ähnlich vertreten. Der einzige Grund, weshalb ich die unter dem Buchstaben A ansässigen Außerirdischen (die ich den Menschen zurechne; mein Herz ist groß) nicht geknipst habe, ist: Sie haben sich noch nicht blicken lassen.
Meine Kamera ist ein kleines, unscheinbares Ding mit einem lichtstarken Objektiv, das selbst bei Kerzenschein kein Blitzlicht braucht. Die legendäre Leica M3, ein Kleinod, ein Meisterwerk des Understatement. Gebaut in Zeiten, als Spione aus der Kälte kamen. Das gute Stück sieht fast alles und ist selbst fast unsichtbar. Und ist so leise, daß selbst in Kirchen ihr Knipsen die Grenzen der Pietät nicht berührt. Ein Apparat von sympathischer Bescheidenheit. Die Spiegelreflexkameras haben sich vermutlich nur deshalb durchgesetzt, weil der wegschnappende Spiegel dem Fotografieren ein eitles Erkennungsgeräusch verliehen hat. So wie die Harley verkündet: Hier kommt ein Motorrad, so insistiert die Spiegelreflex: Hier ist ein Fotograf.
Bei meiner Leica steht dem Licht kein Spiegel im Wege, der wegschnippen muß. Bei meiner Leica schnippt nur der Verschluß. Sie macht ein Geräusch, das niemand hört. Sie sagt: Macht weiter, laßt euch nicht stören, ich bin gar nicht da. Die Leute sollen meine Leica und mich vergessen. Sie müssen sich nicht abgelichtet fühlen, sie müssen in mir nicht den Fotografen sehen und schon gar nicht den Meisterknipser – sondern dürfen mich als Hinterwäldler abtun, der mit seiner hornalten Büchse hantiert. Ich lebe davon, unterschätzt zu werden.
Das gute Stück wird von meiner Rechten gehalten und bedient, die Linke habe ich immer frei, um mich von andrängendem Volk abzuschirmen. Die Arbeit ohne Blitzlicht und Stativ verlangt mir das Vermögen ab, für Momente in eine statuenhafte Starre zu fallen. Der rechte Zeigefinger bedient den Auslöser, der Mittelfinger betätigt die Ringskalen für die Belichtungsdauer, die Blende und die Entfernung. Mein Mittelfinger ist mit der Kamera so vertraut, daß er die richtige Einstellung erfühlt und in kürzester Zeit einstellen kann; selbst Puppenspieler sind verblüfft über meine rechtsseitigen Mittelfingerfertigkeiten. Meine Augen beschäftigen sich nicht mit den Skalen, sondern mit dem Geschehen, das Beute werden soll.
Diese seltene und in der Ausprägung vielleicht sogar einmalige Spezialisierung weniger Körperteile konnte ich bei keiner deutschen Berufsunfähigkeitsversicherung angemessen versichern. Die boten nur eine genormte Gliedertaxe, bei der jede einzelne meiner Zehen mit je zwei Prozent, jeder Finger für je fünf, die Daumen für jeweils zwanzig, Beine und Augen für je fünfzig Prozent der gesamten Versicherungssumme angesetzt wurden. Erst bei der altehrwürdigen und im Renommee unangefochtenen Lloyds konnte ich meinen Körper nach meinem Gusto portionieren: Der auslösende rechte Zeigefinger und der mit den Ringskalen betraute rechte Mittelfinger sind mit jeweils dreißig Prozent versichert, zehn Prozent für jedes Glied. Die Rechte ist mit zwanzig Prozent für ihre Befähigung versichert, für Momente absolut zu erstarren. Die fünfzig Prozent, mit denen ich bei der Lloyds Inc. jedes meiner Augen versichert habe, entsprechen dem Standard und sind nur insofern der Erwähnung wert, weil ein Fotograf seine Augäpfel nicht für wertvoller erachtet als jeder andere Berufstätige.
Neben meiner stillen Leica und den artistischen Fingern, mit denen ich das gute Stück bediene, muß noch von einem Dritten die Rede sein, das mir beim Knipsen nutzt: meinem Horoskop. Neptun steht im zwölften Haus. Die Sonne steht allein zum Uranus harmonisch im Trigon, und ihr Aszendent ist der Skorpion. Der Mond ist im Krebs. Dies alles sagt dem Laien nichts. Doch eine Tante prophezeite mir an meinem zwölften Geburtstag eine hellseherische Begabung, die sich in Gestalt von Geistesblitzen äußert. Wenige Jahre später verstand ich, was sie meinte: Als mich mein Vater das erste Mal mit auf die Jagd nahm.
Es war eine Weihe, die schweigend vollzogen wurde: Schweigend gingen wir durch den Wald, schweigend erklommen wir den Hochsitz, schweigend übergab er mir das Gewehr. Die Dämmerung brach an, und bereits bevor die Dunkelheit siegte, hatten die Augen begonnen, den Dienst an die Ohren zu übergeben. Und je mehr der Wald vor meinen Augen in der Nacht versank, desto deutlicher tauchte er als Klangkörper in meinen Ohren auf. Hellwach blieb ich; das Gewehr in meiner Hand machte selbst das Warten packend. Der Wald existierte in seinen Geräuschen, wabernd, gemächlich, und bald verschmolz ich mit ihm. Aber in einem Moment, der sich durch nichts ankündigte, hob ich mit größter Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit das Gewehr, die Schleuder des Todes, und schoß in das schwarze Loch der Nacht. Bis heute weiß ich nicht, warum. Ich hatte das Tier nicht mit den Augen gesehen, aber ich wußte, da war eins – ein großes schwarzes Tier. Mein Vater war ungehalten; er mußte glauben, ich hätte aus Langeweile, Übermut oder Unerfahrenheit geschossen. Wir gingen zum Waldrand, dort wo die Nacht im Mondschatten am schwärzesten war, und fanden das Wildschwein, das ich erschossen hatte. Ich war schockiert, doch ich wußte nun, was es bedeutet, hellsichtig zu sein.
Ich spürte, wohin ich das Gewehr halten und wann ich den rechten Zeigefinger krümmen muß. Ich wußte, ich werde treffen, ohne zu wissen, was. Fotografieren ist packend wie Töten – und bereitet keine Reue. Doch die Gabe des Hellsehens und das Vertrauen in die Inspiration sind mir beim Fotografieren zur Lust geworden. Als Sportfotograf bin ich am liebsten zum Fußball gegangen – ich stand immer hinter dem Tor, hinter dem das nächste Tor fiel. Mitten im Spiel folgte ich meiner Laune und wanderte um den Platz, von einem Tor zum anderen – und prompt fiel ein Tor. Wenn der Außenseiter den Favoriten schlug, war ich oft der einzige, der das Siegtor geknipst hatte. Die zwanzig anderen Fotografen warteten hinterm falschen Tor.
Auch als Theaterfotograf war ich gefragt. Während auf den Fotoproben ein Dutzend Fotografen vor der Bühne umherliefen und mit ihren riesigen, blitzenden und klackenden Apparaten das feine Gewebe der Inszenierung empfindlich verletzten, um schließlich nichtssagende Fotos zu machen, ahnte ich, wann ein Moment herangereift war. Ahnte auch, wo ich stehen muß, um ihn einzufangen. Ich machte nur drei, vier Fotos von einem Theaterabend, und gerade diese Fotos kaufte das Theater, fürs Programmheft und die Pressearbeit.
Ich spüre, wo ein Bild entsteht, und ich habe die – sogar bei Fotografen seltene – Begabung, aus dem Kontinuum der gleichmäßig verstreichenden Weltzeit den Augenblick herauszubrechen, der Verewigung lohnt. Ob ein Bild gelungen ist, weiß ich, wenn ich knipse, und nicht erst, wenn es im Entwickler entsteht. Einen Moment vor dem Knipsen schließe ich die Augen. Und gerade in diesem Augenblick, den ich sich selbst überlasse, steigert sich das Geschehen. Nur meine Leica schaut zu, wenn das gewisse Etwas geschieht, wenn sich der magische Moment ereignet. Wenn ich die Augen wieder öffne, dann habe ich bereits geknipst – aber trotzdem habe ich das schließliche Bild gesehen. Das mußte meine Tante gemeint haben, als sie mir an meinem zwölften Geburtstag deutete, was Neptun im zwölften Haus anrichtet, hoffnungsvoll unterstützt von einer trigonischen Sonnen-Uranus-Konjunktion, wenn dazu der Mond im Krebs das Seine beisteuert.
Vor zwei Jahren, am 16. August, hat das Hochwasser, welches eine Woche später Jahrtausendhochwasser genannt wurde, nahezu all meine Fotos vernichtet. Gern hätte ich ein Abschiedsbild gemacht: Tausende Fotos schwimmen auf der Oberfläche des träge weichenden Hochwassers. Die Bilderflut. Leider hat es dieses Motiv nie gegeben. Das Hochwasser drang zuerst in das Souterrain meines Hauses ein, dort, wo mein Archiv war. Es stieg bis zur Decke, strömte in Schränke, Schubladen und Kisten, durchweichte die Fotos und löste die Negative auf. Als nach vier Tagen das letzte Wasser aus dem Souterrain gepumpt wurde, blieben nur feuchte, stinkende Ballen zurück. Rekonstruktion unmöglich.
Meine Leica, das gute Stück, hatte ich bei mir. So ging ich, von einer hellseherischen Ahnung getrieben, zu meinen Nachbarn, der Musikalienhandlung Meißner. Dort hatte das eindringende Wasser den Konzertflügel angehoben und zum Schwimmen gebracht – inmitten von Klarinetten, Gitarren, Flöten, Oboen, Bratschen, Celli, Kontrabässen, Trommeln, Zithern und Rumbarasseln. Sogar das Blech hatte Schwimmen gelernt: In den Windungen der Posaunen, Trompeten und Waldhörner war genügend Luft verblieben, um die Instrumente leichter als Wasser werden zu lassen. Die Klaviere hingegen waren stehengeblieben: Ihr Resonanzraum war zu klein, um für den nötigen Auftrieb zu sorgen.
Tagelang trieben die Instrumente träge auf der Wasseroberfläche im großen Verkaufsraum. Dieses Bild, das an ein ersoffenes Orchester gemahnen würde, konnte ich leider nicht knipsen; als ich in die Musikalienhandlung kam, war es dafür zu spät. Doch mir bot sich ein anderes Motiv: Das zurückgehende Wasser hatte die Instrumente wie Spielzeug, dessen es überdrüssig wurde, liegenlassen, wobei es auch den Flügel dort abzusetzen beliebte, wohin ihn die launische Strömung getrieben hatte – und das war hoch auf den Klavieren. Dank meiner hellseherischen Ahnung war ich zur Stelle, als die Meißners in ihre Musikalienhandlung zurückkehrten, den Flügel erblickten, der wie der Schabernack eines Herkulesschen Eindringlings wirkte – und knipste das absurde Arrangement und ihre Verblüffung. Autos, die wegschwimmen, haben wir schon hundertmal gesehen, aber ein Flügel, der hochbeinig auf Klavieren steht – das ist eine spektakuläre Bebilderung für ein Jahrtausendhochwasser. Es wurde für das »Pressefoto des Jahres« nominiert und von meiner Agentur in vierundvierzig Länder verkauft.
Das Jahrtausendhochwasser hat auch Lenas Lieblingsfotos vernichtet. Auf diesen Bildern war sie »schön wie nie«, sagt sie, und es stimmt. Neunzehn war sie damals. Es war die aufregendste Zeit in ihrem Leben. Ihr Lied war Nummer eins der Hitparade, und sie war eine Volksheldin. Ich war immer stolz darauf, sie zu kennen, und damals besonders.
Lena verfügt über bemerkenswerte Talente, die sich nicht in Eignungstests, Prüfungen, Wettbewerben und vor Juroren beweisen lassen. Durch Lena habe ich immer in der Überzeugung gelebt, daß es gerade die nutzlosen Talente sind, die einen Menschen wertvoll und einzig machen. Eines von Lenas Talenten besteht darin, Behaglichkeit herzustellen. Wenn sie ein Hotelzimmer das erste Mal betritt, verharrt sie drei Sekunden in der Tür und läßt den Raum auf sich wirken. Dann geht sie an die Arbeit. Sie zieht einen Store zurück oder sorgt für eine gewisse Lichtstimmung, indem sie eine Lampe dreht oder ein Taschentuch über den Schirm legt. Sie rückt die Couch oder die Sessel eine Handbreit von der Wand ab. Sie schreckt auch nicht davor zurück, die Möbel neu zu arrangieren – im Rahmen dessen, was ihre Körperkraft hergibt. Innerhalb von zwei Minuten verwandelt sie ein schäbiges Appartement in eine wohnliche Bude – ohne Wissen um Feng Shui und andere Behaglichkeitstheorien. Auch in Warteräumen, Zugabteilen und Segelbootkajüten packt sie der Gestaltungsdrang. Sogar in Bergzelten, viertausend Meter über dem Meeresspiegel. Von hundert verlassenen Hotelzimmern kann ich das eine herausfinden, in dem Lena gewohnt hat. Lena ist wie die Sonne: Wo sie ist, wird es warm, und wenn sie geht, wärmt es nach.
Lena liebte meine Fotos, und ich liebte es, ihr zuzuschauen, wenn sie meine Fotos betrachtete. Ihr Blick erforschte so lange die Bilder, bis sie von den Fotos eingesogen wurde und zu dem Moment gelangte, an dem sie aufgenommen wurden. Es waren nur bestimmte Fotos, die auf sie solch starke Wirkung ausübten – jene vom Herbst 89 und dem Deutschen Jahr.
Lena ist längst nicht die einzige, für die jene Wochen und Monate eine einzigartige, aufwühlende Erfahrung waren. Trotzdem gibt es kein Buch, in dem die Erfahrungen jener Zeit für alle gleichermaßen gültig aufbewahrt sind, so wie »Im Westen nichts Neues« die Erfahrungen der Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs versammelte. Lena suchte nach Bestätigung, nach Reflexion des Erlebten – und fand sich letztlich immer über meinen Fotos wieder. »Alles, was ich über diese Zeit weiß, weiß ich von deinen Bildern.«
Die Bilder sind verschwommen, und die Geschichte beginnt von neuem.
Erstes Buch
Aus mit Lau
1
Am Mittag des 11. August im Jahre 1989 ging eine junge Frau durch den Eingang des Karl-Marx-Städter Hauptbahnhofes. Die Schalterhalle war fast leer, ein kurzes, extremes Quietschen der Aluminiumtür, die an ihrem Rahmen schabte, warf ein raumfüllendes Echo. Die junge Frau bekam eine Gänsehaut, obwohl schwüle Hitze über der Stadt lag.
Die junge Frau suchte einen Aushang mit den Fahrplänen, um herauszufinden, wo der Zug um 14.12 Uhr aus Dresden ankommt. Aha, auf Bahnsteig 14.
Die junge Frau trug eine weite Leinenhose und ein rotes T-Shirt. Sie hatte es gelernt, mit den Blicken und Kommentaren der Männer zu leben. »Ganz schön was drin im Tank«, hatte sie heute schon gehört – was sie daran erinnerte, daß sie das T-Shirt mit dem italienischen Motorroller aus den fünfziger Jahren trug. Auf dem Rücken baumelte ein kleiner Rucksack aus Leder.
Auf Bahnsteig 14 warteten nur wenige Leute auf den Zug. Sie stellte sich neben einen Papierkorb aus Waschbeton, dessen herausnehmbarer Plastikkübel mit geschmolzenem Eis verklebt war. Im Papierkorb lag eine Zeitung. Ein Mann kam langsam den Bahnsteig entlanggeschlendert. Die junge Frau wußte, daß sein Schlendern in ihrer Nähe zu Ende sein wird. Sie wußte auch, daß, wenn sie sich woanders hinstellt, ein anderer Mann in ihre Nähe schlendern wird. Also konnte sie auch dort bleiben, wo sie stand.
Die junge Frau war neunzehn und arbeitete als Physiotherapeutin im Neubau des Karl-Marx-Städter Bezirkskrankenhauses. Sie war keine Krankenschwester, obwohl das wenige Wochen später, als sie in der ganzen Stadt bekannt war, immer wieder behauptet wurde. Vielleicht galt sie als Krankenschwester, weil sie lange im Schwesternwohnheim wohnte. Oder weil sie bei ihrem Auftritt, der sie bekannt machte, eine Schwesterntracht trug. Aber sie war Physiotherapeutin, keine Krankenschwester.
Sie war mit einem Krankenwagenfahrer zusammen, der zehn Jahre älter war. Er hieß Paul, sie nannte ihn Paulchen. Sie ließ sich Liebesbeweise erbringen, indem sie ihm ihren Schichtplan gab und in den Pausen auf Station seine Anrufe erwartete. Paulchen enttäuschte sie nicht, doch bevor er beim Wählen der letzten Ziffer die Wählscheibe losließ, fragte er sich, worüber er mit ihr reden sollte. Paulchen war einer der Männer, denen das Reden nicht gegeben ist. Doch sie, erfreut über die Zuverlässigkeit seiner Anrufe, plauderte drauflos und gab Stichworte, auf die er reagieren konnte.
Paulchen war ein Radiobastler. Er verkörperte die Paradoxie aller Radiobastler: Sie machen in Kommunikationstechnik, ohne im geringsten kommunikationsbegabt zu sein. Er konnte stundenlang mit dem Lötkolben über eigens geätzten Leiterplatten sitzen und immer ausgefeiltere Schaltungen bauen. Mittlerweile war er Techniker einer Band, einer Band allerdings, die nicht wie jede ordentliche Rock’n’Roll-Band laute und schmutzige Lieder johlte, ihre Wut auspackte und gehörigen Lärm produzierte, nein, Paulchens Band machte etwas, das sich
Trickbeat
nannte. Trickbeat war eine Musik, die alles außerhalb von sich selbst als »zu konventionell« verachtete. Trickbeat war eine Musik, die experimentell klingen sollte und auch experimentell klang. Trickbeat war eine Musik, die mit schwerer intellektueller Fracht, ohne eine Spur von Aufsässigkeit, aus den Boxen und über die Bühne wankte. Klangdemonstrationen der ausgefeilten technischen Soundausstattung standen ungeniert im Vordergrund; es klang, als ob vier Instrumentenvertreter die revolutionären Möglichkeiten ihrer neuen Ware vorführen. Minimalistische Klangfiguren aus vielerlei Glucksen, Fauchen und Schwirren rangen, unterlegt von stolpernden Rhythmen, um die Vorherrschaft. Um dem Avantgardecharakter der konzertanten Performance nachzuhelfen, bestanden die Texte, die entweder in einem leiernden oder in einem monotonen Gesang dargeboten wurden, aus avantgardistischer Lyrik aller Völker und Epochen. Paulchens Radiobastlertum hatte die Band, in der sein jüngster Bruder Sebastian mitspielte, erst auf diesen Weg gebracht: Die Band, die mit sich nichts Rechtes anzufangen wußte, wurde von Paul mit immer raffinierterer Technik beliefert – bis sich schließlich die Technik verselbständigte und zum eigentlichen Gegenstand des Bandschaffens wurde.
Die Band nannte sich PlanQuadrat und bekam eines Tages sogar einen Plattenvertrag – wenn auch nur für eine »Kleeblatt-LP«. Kleeblatt bedeutet: Die Platte teilen sich vier Nachwuchsbands, von denen jede drei Titel liefert.
Der Plattenvertrag war ein kleines Wunder. PlanQuadrat hatte weder Manager noch Telefon. Es gab Dutzende Bands, die in den gleichen halbvollen oder halbleeren Kulturhäusern spielten wie PlanQuadrat und vergeblich von einem Plattenvertrag träumten, aber mit einem Manager, der natürlich telefonisch erreichbar war. PlanQuadrat wertete den Plattenvertrag als Indiz für ihr Genie.
Pünktlich um 14.12 Uhr hörte die junge Frau auf Bahnsteig 14 über sich das Lautsprecherbrummen eines – um sich darin auszukennen, war sie lange genug mit einem Radiobastler zusammen – nicht abgeschirmten Kabels, dann die Durchsage, daß der Zug aus Dresden ungefähr zwanzig Minuten Verspätung haben wird. Die Stimme aus dem Lautsprecher war mitleidslos, ihre Spielart des sächsischen Dialektes empfand die junge Frau als grob und dreckig. Und mit welchem Triumph das entscheidende Wort der Durchsage, Verspätung, betont wurde – es klang, als ob alle Utopisten, die noch immer an die Fahrpläne der Deutschen Reichsbahn glaubten, sich endlich an die rauhe Wirklichkeit gewöhnen sollten. Auch der letzte Satz der Durchsage, Wir bitten um Ihr Verständnis, ließ nicht die Spur von Bedauern anklingen, sondern kam im Kommandoton. Ohne die Person gesehen zu haben, die zu der Stimme gehörte, glaubte die junge Frau zu wissen, wie sie aussah: Ein Doppelkinn hatte sie gewiß, eine völlig mißratene Figur, eine Warze auf der Nase und rauhe, betongraue Haut.
Die junge Frau verließ den Bahnsteig und ging zu einem der Telefone, die in der Bahnhofshalle hingen. Sie warf ein Zwanzigpfennigstück in die Box und wählte die Nummer der Rettungsstelle des Krankenhauses. Sie fragte nach Dr. Matthies, und als der sich meldete, sagte sie: Hallo, ich bins. Ihre Stimme hatte etwas Weiches, Romantisches, und daß sie ihren Namen nicht sagte, war eine ihrer Eigenarten. Sie betrachtete es als eine Angelegenheit ihres Stolzes, sich niemals vorstellen zu müssen. Es sollte sich herumsprechen, wie sie heißt. Könntest du mir mal helfen? fragte sie Dr. Matthies. Das Telefonat dauerte keine zwei Minuten.
Die Titel für die Viertelplatte wurden in einem Rundfunkstudio aufgenommen. Regie führte eine Redakteurin namens Inessa. Am Mischpult saß ein Tonmeister, der Paulchen jegliche Kooperation verweigerte. »Ich mache das seit zwanzig Jahren.« Die Band war glücklich über die Viertelplatte und intervenierte nicht. Paulchen, der sonst alles in der Hand hatte, was den Sound anging, durfte sich gerade mal das Mischpult anschaun. Niemand bemerkte, wie gekränkt er war.
Als von der Plattenfirma AMIGA Fotos der Band angefordert wurden, hatte die junge Frau gesagt: »Mein großer Bruder.« – »Du hast einen großen Bruder?« sagte Paulchen erstaunt. »Klar«, sagte die junge Frau.
Ihr großer Bruder nannte die Band niemals PlanQuadrat. Er bezeichnete Band und Bandmitglieder als Trickbeatles, und ob er es spöttisch oder anerkennend meinte, blieb in der Schwebe.
Für die Fotosession hatten sich die Trickbeatles die Kellergewölbe der Petri-Kirche ausgesucht. Sie hatten sich in Wesen aus Alpträumen und expressionistischen Gruselfilmen verwandelt. Sie hatten spitze Ohren, weiße Gesichter, gierige, vorstehende Schneidezähne und antennenartig lange, knochige Finger mit knotigen Gelenken und krallenhaften Fingernägeln. Sie trugen ausgestopfte Kaftane, so daß sie wie bucklig verwachsene Gestalten wirkten. Ihre Schuhe waren viel zu groß und ungleich geformt. Geschickt positionierte Lampen warfen gespenstische Schatten.
Als die Trickbeatles eine halbe Stunde später im Probenraum spielten, hatten sie nur die Teile ihrer Kostüme abgelegt, die sie bei der Musikausübung behinderten, und es gefiel ihnen, in dieser Verwandlung zu spielen. Nach der Probe gingen sie in die Kneipe und redeten über Kostüm, Auftritt, Licht. Sie dachten an ein Video und entwarfen erste Sequenzen. Sie redeten nicht, wie sonst immer, über Klangarchitektur und Technik. Sie fragten die junge Frau, sie baten den großen Bruder um Rat – nur Paulchen zogen sie nicht hinzu. Als er sich verabschiedete, nahmen sie kaum Notiz von ihm.
Am nächsten Tag wurde die junge Frau nicht von Paulchen angerufen. Paulchen kam auch nicht zur Arbeit und zur Probe. Paulchen war verschwunden, wie auch sein gelber Trabant.
Die junge Frau kehrte nach ihrem Telefonat auf Bahnsteig 14 zurück.
Der Zug aus Dresden hatte nicht zwanzig Minuten Verspätung, sondern nur zwölf. Ein dunkelrotes Ungetüm mit einem tiefen Motor, der in raschen Amplituden grollte, schleppte sich langsam in den Bahnhof. Nicht nur die Lok war dreckig. Ein schwarzer Film aus Ruß hatte sich über den ganzen Zug gelegt und verdüsterte seine wahren Farben. Auch im Inneren der Züge war dieser Film; die junge Frau hatte nach Bahnfahrten immer den Wunsch, sich zu waschen. Sie hatte schon das Bedürfnis, sich zu waschen, wenn sie nur an Zugfahrten dachte.
Als der Zug zum Stehen gekommen war, gingen die Türen auf und die ersten Reisenden traten vorsichtig auf die eisernen Tritthilfen. Willkommen in Karl-Marx-Stadt, kam undeutlich aus dem Bahnhofslautsprecher, unterlegt von einem Wechselstrombrummen.
Für Paulchens Verschwinden gab es eine Erklärung: Er wollte rübermachen. Seit dem Mai, als die ungarische Regierung den Eisernen Vorhang in eine grüne Grenze verwandelt hatte, war das ganz einfach. Wer ein Visum für Ungarn hatte, konnte nach Österreich, und wer in Österreich war, hatte es geschafft. Der war im Westen, unwiderruflich.
Paulchen hatte sie nicht ins Vertrauen gezogen, war ohne Abschied verschwunden. Die junge Frau fühlte sich wie geohrfeigt. Sie fühlte sich wie öffentlich geohrfeigt, weil er sie – was im Krankenhaus auch auffiel – nicht mehr anrief. Sie wünschte, daß sich das bereinigen ließe, wie sie sich ausdrückte. Sie wußte selbst nicht, was sie damit meinte. Wenn er zurückkehren würde – das wäre am schönsten. Aber daran glaubte die junge Frau selbst nicht. Daß sie es zu hoffen wagte, behielt sie für sich.
Ihr großer Bruder, der mit der ganzen Angelegenheit nun gar nichts zu tun hatte, war zumindest im Besitz eines Visums. Er hatte es lange vor Paulchens Verschwinden beantragt, weil er sich in Ungarn einmalige Fotos erhoffte: Die Gesichter mit jenem eigentümlichen, starken Ausdruck, die gemeinsam mit den marmorierten Jeans den Sommer 89 für alle Zeiten markieren würden. Menschen, die ein neues Leben beginnen, über Ängste und Ungewißheit sich hinwegsetzend.
Er wollte im Samariter-Lager in Budapest-Csillebérc knipsen, wo zwei der Trickbeatles auch Paulchen vermuteten, weil sie ihn im Fernsehen gesehen zu haben glaubten: Der dünne Jakob hatte im ZDF Paulchen durchs Bild gehen sehen, allerdings nur von hinten, während Paulchens Bruder Sebastian glaubte, in der ARD Paulchens Turnschuhe gesehen zu haben. »Theoretisch könnte er es gewesen sein«, lautete die Formel der Trickbeatles, die alles am liebsten theoretisch betrachteten.
Obwohl Paulchen nicht auf der Bühne stand, war er doch das einzige unersetzbare Bandmitglied. Ohne Paulchen ließ sich weder die Bühnentechnik verkabeln noch ein neuer Titel entwickeln.
Die junge Frau hoffte, daß ihr großer Bruder Paulchen im Samariter-Lager trifft und in Paulchen etwas auslöst, mit dem ihr geholfen wäre: ein lieber Brief, eine übermittelte Erklärung, Pläne, in denen sie vorkommt. Wenn Paulchen gar zurückkäme … Damit ihr Wunsch möglichst stark bei Paulchen ankommt, hatte die junge Frau ihren großen Bruder vor fünf Tagen bis zum Zug begleitet. Er hatte eine Rückfahrkarte, sie wußte Tag und Stunde seiner Ankunft. Als die Verspätung des Zuges angekündigt wurde, rief sie Dr. Matthies an, der oft mit Paulchen ein Rettungsteam bildete und nach Pauls Verschwinden eine Nähe zu ihr aufzubauen suchte, die vorerst noch fürsorglich war, mittelfristig aber auf körperliche Ergänzung hoffte. Der klassische Witwentröster. Die junge Frau bat ihn, sie mit dem Krankenwagen vom Bahnhof abzuholen, der Bus zum Krankenhaus brauche zu lange, und die Lage am Taxistand sei hoffnungslos. Dr. Matthies, dem die Rolle des verständnisvollen Freundes keine Wahl ließ, setzte sich mit seinem neuen Partner unter den Rettungsfahrern, Paulchens Nachfolger, in einen Krankenwagen und fuhr los.
Die junge Frau auf Bahnsteig 14 war nicht sicher, ob sie nach einem oder zwei Männern Ausschau halten sollte. Ihren großen Bruder erwartete sie, Paulchen erhoffte sie zurück. Der Bahnsteig füllte sich mit Menschen. Paulchen war nicht dabei, auch nicht ihr großer Bruder. Die junge Frau wartete, bis sich das Gewimmel gelöst hatte.
Eine klammböse Ahnung stand wie eine Fratze vor ihr, und die konnte sie nicht einfach verscheuchen. Auf der Suche nach einer Person, die Auskunft geben konnte, fand die junge Frau ein kleines Zimmer mit einem Schreibtisch, einigen Telefonen und einem Mikrophon. Eine Reichsbahnerin versah hinter einer Schaufensterscheibe ihren Dienst. Eine Zigarette glomm auf dem Rand eines Aschenbechers, schnurgerade stieg Rauch empor. Die junge Frau erkannte sofort, daß diese Person für die Lautsprecherdurchsagen zuständig war. Allerdings war die Warze statt auf der Nase am Kinn.
Die junge Frau klopfte an die Glastür, in der an einer Kordel ein abgegriffenes Pappschild Dienstaufsicht hing. »Guten Tag«, sagte sie. »Der D-Zug aus Dresden von eben ist doch der Anschluß für den Zug aus Budapest, oder? Da sitzt ein Bekannter nicht drin, und nun frag ich mich, ob der Budapester in Dresden Verspätung hatte und der Anschluß vielleicht …« Die Dienstaufsicht unterbrach die junge Frau: »Der Budapester war pünktlich auf die Minute. Sie sehen ja selbst, das ganze Volk mit Rucksäcken, die kommen alle aus Ungarn, Bulgarien. Das mit Ihrem Bekannten hat andere Gründe. Die Deutsche Reichsbahn ist nicht an allem schuld, und aus den Nachrichten wissen wir ja, was im Moment los ist.«
Die junge Frau verabschiedete sich knapp und ging. Sie wollte die Tür werfen, sie wollte laut schreien. Wer war sie denn? Sie war doch kein Mensch, der einfach so verlassen wird. Jetzt war sie gleich zweifach verlassen worden. Sie hatte gehofft, zwei Rückkehrer zu begrüßen, statt dessen war keiner zurückgekehrt. Sie fühlte sich verraten und verlassen, und sie wußte, daß sie dieses Gefühl ohne Vorwurf gegen Paulchen und ihren großen Bruder fühlen mußte. Sollte sie ihnen wünschen, zu diesem Bahnhof zurückzukehren, mit seinen quietschenden Türen, seinen gesächselten Ansagen, seinem Dreck, seiner Tristesse? Und wenn das ganze Land nicht viel besser war als dieser Bahnhof – konnte sie ihnen das Weggehen verübeln? Nein, das konnte sie nicht. Und weil das so war, fühlte die junge Frau das erste Mal einen starken, umfassenden Haß, der zu ihrem eigenen Erstaunen, sogar gegen ihren Willen, eine durch und durch politische Empfindung war. Politik hatte sie nie interessiert. Politik ging los mit Zeitunglesen, und das war ihr schon zuviel. Politisch zu sein, um sich gegen ein Gefühl von Ohnmacht und Unglück zu wehren, war der jungen Frau nie in den Sinn gekommen. Ja, sie bekam Wut, und sie spürte eine helle, blanke Entschlossenheit, irgendwie zu handeln.
Vor dem Bahnhof wartete der Krankenwagen mit Dr. Matthies. »Na«, sagte er, als die junge Frau einstieg. »Alles klar?«
»Bist du eigentlich politisch?« fragte die junge Frau. »Ich bin nämlich gerade …« Sie winkte ab, den Satz mit politisch geworden zu vollenden erschien ihr zu pathetisch. Doch es reichte für Dr. Matthies, die Antwort zu erahnen, mit der er auf günstige Stimmung hoffen darf. »Weißt du, wann ich geboren wurde?« sagte er stolz. »Am 5. März 1953. Stalins Todestag! Politischer gehts nicht!«
Paulchens Nachfolger war so groß, daß sein schwarzer Lockenkopf kaum unter das Dach des Krankenwagens paßte. Als sie sah, wie er sich ducken mußte, um den Verkehr zu erfassen, war die junge Frau sicher, ihn früher oder später als Patienten auf ihrer Pritsche zu haben. »Schnall dich lieber an«, sagte der fürsorgliche Dr. Matthies zu der jungen Frau. »Das ist der wilde Willi.«
»Du mußt nicht denken, ich bin besoffen, weil ich so komisch spreche«, sagte der wilde Willi mit lauter, tiefer Stimme, die tatsächlich nicht die Reliefs der Konsonanten gestochen nachzeichnete, sondern die Wörter eher großzügig skizzierte – eine Artikulation, die landläufig als Lallen bezeichnet wird. »Ich hab einfach ne große Zunge. Hier!« Er streckte die Zunge aus dem Mund und präsentierte sie. Die junge Frau mußte lachen.
»Und du bist Lena?« fragte der wilde Willi. »Ist ja ein lässiger Name.«
2
Zur selben Stunde, in der heißen Mittagszeit, suchte in den Feriensiedlungen des Balatons Dr.-Ing. Helfried Schreiter seine Tochter Carola. Seit vier Tagen schon beobachtete er, wie sich Carola am Strand von Fonyód mit diesem Burschen traf. Er sprach einen rheinischen Dialekt. Dr.-Ing. Helfried Schreiter hatte schlimme Ahnungen.
Das soll mir das Mädel bloß nicht antun, dachte Dr.-Ing. Helfried Schreiter. Ich bin ein Mann in leitender Position, trage Verantwortung für den riesigen Sachsenring, die Produktion des Trabant. Aber wenn Carola rübermacht, dann bin ich die längste Zeit Generaldirektor gewesen.
Dr.-Ing. Helfried Schreiter war ja ohnehin gegen diesen Ungarn-Urlaub, von Anfang an. Warum nicht die Sächsische Schweiz? Oder die Ostsee. Oder die Kreuzfahrt auf dem Luxusliner »Kap Arkona«, von der sein Freund, der Hoteldirektor Alfred Bunzuweit, so geschwärmt hat. Wir hätten bequem einen Platz kriegen können. Alfred Bunzuweits Frau ist die rechte Hand des Gewerkschaftsvorsitzenden, und die »Kap Arkona« gehört der Gewerkschaft. Das wäre kein Problem gewesen. Ab einer gewissen Leitungsebene sind alle mit allen verklebt, das war Dr.-Ing. Helfried Schreiter schon längst aufgefallen, und er gehörte dazu. Er fuhr natürlich nicht Trabant, sondern Citroën. Ein Importmodell, offiziell bezogen, für achtunddreißigtausend Mark. Als Dienstwagen hatte er einen Lada, mit Fahrer. Daß die Citroëns importiert wurden, ging vermutlich sogar auf ihn zurück. Der mächtige, übermächtige Valentin Eich hatte ihn mal angerufen und um seine Meinung gebeten. »Sag mal, Chef vom Sachsenring«, sagte der nach einem Austausch allgemeiner Floskeln, »nenn mir mal ein schönes Auto. Eins, das du selber gerne fahren würdest.« Dr.-Ing. Helfried Schreiter dachte kurz nach und sagte: »Citroën.« Länger war das Gespräch nicht. Dr.-Ing. Helfried Schreiter konnte über den Hintergrund der Frage nur spekulieren. Er wußte eigentlich nichts über Valentin Eich. Er fand ihn dubios. Sag mal, Chef vom Sachsenring, nenn mir mal ein schönes Auto. Was für eine Frage.
Als Dr.-Ing. Helfried Schreiter ein halbes Jahr später an einer Bahnschranke warten mußte und den Zug langsam vorüberrollen sah, fiel ihm dieses seltsame Telefonat wieder ein. Plötzlich ergab es einen Sinn. Dutzende, ja Hunderte Citroëns paradierten an ihm vorbei. Alles Citroën GSA, alle hatten die gleiche Farbe, ein bleiches Grün. Eine Beklemmung machte sich in ihm breit; obwohl er sich bedeutend fühlen müßte, fühlte er sich extrem unbedeutend und an den Rand gestellt. Ausgenutzt und dumm gehalten. Chef vom Sachsenring, nenn mir mal ein schönes Auto, eins, das du selber gerne fahren würdest. Zehntausend Citroëns, erfuhr er später, wurden importiert.
Jedesmal, wenn er in sein Auto stieg, fand Dr.-Ing. Helfried Schreiter, daß er eine gute Auskunft gegeben hatte. Der Citroën war immer Avantgarde, und trotzdem wurde er mit den Jahren immer schöner. Der Citroën DS, die Göttin, war ihm das schönste Auto der Welt. Selbst dieser Student, mit dem sich Carola herumdrückte, fuhr Citroën. Eine Ente. Auch ein Klassiker, ein Auto, das Frauen schwach macht. Sogar die Tochter des Trabant-Generaldirektors.
Er hätte nicht in Ungarn Urlaub machen dürfen. Wer macht denn heutzutage noch Urlaub in Ungarn? Nur unzuverlässiges Gelichter. Und nun muß er, Dr.-Ing. Helfried Schreiter, seine eigene Tochter davon abhalten, rüberzumachen.
Dr.-Ing. Helfried Schreiter fuhr an die Strände, durchstreifte die Zeltplätze, ging zum Hafen und über die Märkte. Er hielt an den Cafés und Fischrestaurants, und am Abend suchte er seine Tochter im Autokino, in den Weinkellern, in den Bars und Diskotheken. Nachts um eins stand er auf einem Steg, ohne genau zu wissen, wie er dorthin gekommen war. Er rief seine Tochter, so laut er konnte.
»Caaarooolaaaa!«
Der Ruf verlor sich über dem See. Dr.-Ing. Helfried Schreiter hörte nur das Rauschen des Schilfes und ferne Musikfetzen. Er stieg in das Wasser. Es war wärmer als die Luft und ging gerade bis übers Knie. »Carola!« rief er und ging los. Er wollte gehen und rufen, gehen und rufen. Das Wasser wurde nicht tiefer. Er wollte so lange gehen, bis er nicht mehr rufen konnte.
Er brüllte den Namen seiner Tochter immer wieder, bis ihm das Wort leer wurde, bis er die Beziehung zu den Lauten verlor, die er benutzte. Bis ihm der Name ein eigenes, ein lächerliches Ding wurde. So geriet er in einen tranceähnlichen Zustand – wenn er den Namen rief, entstanden für Augenblicke Erinnerungsbilder mit seiner Tochter. Es war die große Revue seines Lebens als Vater. Helfried Schreiter provozierte diesen Effekt, nachdem er ihn entdeckt hatte, mit masochistischer Lust. Er sah Carola auf einer Schaukel sitzen, juchzend flog sie durch seinen kräftigen Schwung nach oben, er sah die vor Angst brüllende Carola, die beruhigt und getröstet werden mußte, als ein großer Schäferhund sie anbellte, und er hörte die Tür knallen, nachdem er ihr, als sie fünfzehn war, verboten hatte, ihren Freund mit den rot und grün gefärbten Haaren mit nach Hause zu bringen. Vergessenes tauchte auf, und Helfried Schreiter erlebte, wie reich es ihn machte und wie glücklich er war, Vater zu sein. Doch wenn er die Lunge leer gebrüllt hatte, stand er wieder im Wasser. Er hatte den Namen seiner Tochter hinausgeschrien, um sie zu suchen – und nun hatte er sie gefunden.
Ein Motorboot der Polizei brachte ihn an Land. Er setzte sich mit nassen Hosen in den Citroën. Die Sitzpolster sogen die dreckige Brühe ein. Die achtunddreißigtausend Mark waren ihm egal.
Als vor dem Ferienheim seine Frau das Auto hörte, riß sie das Fenster auf und schaute hinaus. Sie war die ganze Zeit wach gewesen. Wie konnte er nur ohne Carola nach Hause kommen?
Weg war sie, einfach weg, ohne ein Wort.
3
Der Reporter Leo Lattke ärgerte sich. Ein Leo Lattke sollte sich nicht dorthin schicken lassen, wo alle sind. Sollte kein Thema nehmen, das einen schon aus den Nachrichten anspringt. Ein Leo Lattke glänzt mit Reportagen, die ein Thema überhaupt erst entdecken.
Und wie sich dieses Samariter-Lager in Budapest-Csillebérc als humanitäres Problem zu präsentieren bemühte: Ein Zeltdorf auf lehmigem Grund, den der Regen in Pampe verwandelt hatte, in der Kinder spielten. Mittagessen, das mit großer Kelle aus Feldküchen aufgetan wurde. Lastkraftwagen, die Decken brachten. Kein Wunder, daß Fernsehteams, Reporter und Fotografen zum Lager gehörten. Hier gabs den Stoff, aus dem die Nachrichten sind. Aber einem Leo Lattke konnten sie damit nicht kommen.
Leo Lattke wünschte, er wäre nicht hier. Ein Leo Lattke sollte nicht die Geschichten erzählen, die alle erzählen.
Er hatte einen Gesprächspartner gefunden, der vielleicht eine Spur Originalität versprach: Einen Assistenzarzt, der es satt hatte, Lakai seines Professors zu sein. Im Gespräch ergab sich sein Spezialgebiet – die Sexualtransformation. Das verwunderte den Reporter: Transsexuelle im Arbeiter- und Bauern-Staat?
Die Antwort rauschte an Leo Lattke vorbei, denn er war mit seiner Aufmerksamkeit bereits woanders: Aus sicherer Distanz beobachtete er einen Fotografen bei der Arbeit. Ihm gefiel dessen unscheinbare, harmlos wirkende Arbeitsweise, ihm gefiel das Auge, der Instinkt dieses Fotografen. Wie nahe der an seine Motive herangelangte, ohne dabei aufdringlich und beutegeil zu wirken. Wie der eine Familie fotografierte, die Schokoriegel verzehrte – der ältere Sohn genüßlich, der jüngere trotzig, der Vater erschöpft und die Mutter selig. Sie saßen vor einer Wäscheleine, auf denen ihre vier marmorierten Jeans hingen. Als sie bemerkten, daß sie fotografiert werden, fragte der ältere Sohn, ob sie das Foto zugeschickt bekämen. »Wohin?« fragte der Fotograf, und in dem bestürzten Moment, als die vier begriffen, daß sie keine Adresse haben, knipste der erneut.
Je länger Leo Lattke zuschaute, desto mehr gefiel ihm der Fotograf. Der fotografierte nicht wie jeder. Der holte aus dieser Nachrichtensoße tatsächlich was Besonderes. Der knipste so, wie Leo Lattke gerne schrieb.
»Für wen sind denn die Fotos?« fragte Leo Lattke.
»Weiß ich nicht«, sagte der Fotograf. »Bis jetzt für noch niemanden.«
»Dann schick sie mir mal«, sagte Leo Lattke. Er überreichte dem Fotografen seine Visitenkarte, mit dem Signet seines Blattes. Dieses Blatt war eine Autorität, eine Instanz, es war der Inbegriff der Pressefreiheit überhaupt. Die Einladung, für dieses Blatt zu arbeiten, kam unter Journalisten einem Ritterschlag gleich.
»Wenn ich die nach Hamburg schicke«, sagte der Fotograf, »kommen die nie an.«
»Dann bring sie zum Ostberliner Büro«, sagte Leo Lattke.
»Und wo ist das?« fragte der Fotograf.
»In Ostberlin!« sagte Leo Lattke. Er zog die aktuelle Nummer seines Magazins aus der Tasche und gab sie dem Fotografen. »Steht im Impressum.« Er war sich nicht sicher. Aber da gehörte sie hin; er war schließlich kein Auskunftsbüro. Er hatte inzwischen – innerhalb der letzten zehn Sekunden – entschieden, seine Reportage doch nicht von diesem Fotografen bebildern zu lassen. Wer war er denn, einen Namenlosen zu protegieren? Er wollte die Bilder nur aus Prinzip: Er war es gewohnt, daß alles nur ihm zuarbeitete. Einem Leo Lattke steht das Privileg zu, Zeit und Hoffnungen anderer nach Belieben zu verschleißen.
Kurz darauf entdeckte Lenas großer Bruder ein Hemd, das ihm bekannt vorkam, ein derbes, rot und schwarz kariertes Flanellhemd, dazu paßten die schwarzen Haare. Dennoch erkannte er Paulchen kaum wieder. Lenas ruhiger, sanfter und hübscher Freund schien sich in einen Abenteurer verwandelt zu haben: Er war unrasiert, die glatte Haut seines zarten Gesichts war von kräftigen Barthaaren versteckt. Das Hemd hatte er halb aus der Hose gezogen, seine Jeans war auf der Seite des Hintern, die nicht vom heraushängenden Hemd verdeckt wurde, gerissen, und weiße Fäden fransten heraus. Auf seinen Haaren, die sonst immer gewaschen waren, lag jetzt eine Schicht aus Staub.
»Ach, hallo«, sagte Paulchen. An diesem überzeugend beiläufigen Ton merkte Lenas großer Bruder, wie sehr Karl-Marx-Stadt an die Peripherie von Paulchens Leben gerückt war. »Willst du auch rüber?«
»Nee«, sagte Lenas großer Bruder und hob leicht den Fotoapparat, um anzudeuten, weshalb er hier war.
»Ich mach rüber«, sagte Paulchen. »Ich war am Balaton, hab meine Forint aufn Kopp gehaun. Dann bin ich zu Samariters.« Er zeigte auf das Magazin, das Lenas großer Bruder von Leo Lattke bekommen hatte. »Gibst du mir das? Kannst das dafür haben.« Er holte die Autoschlüssel aus der Tasche.
»Deinen Wagen?« fragte Lenas großer Bruder.
»Im Tank ist aber kaum noch was drin«, sagte Paulchen.
Lenas großer Bruder gab Paulchen das Blatt und bekam den Schlüssel. »Ich zeig dir, wo der Wagen steht.«
Paulchen fragte weder nach Lena noch nach PlanQuadrat, und sein Desinteresse war echt. Paulchen wollte ganz neu anfangen. Wollte nicht mehr der sein, der er war. Wollte nicht mehr der Radiobastler sein, der einer Band das Profil verleiht, aber nicht aufs Foto darf. Wollte mit seinen neunundzwanzig Jahren nicht mehr Paulchen genannt werden. Wollte nicht mit einer Freundin zusammensein, die ihn nicht ranläßt.
Lenas Instinkt war auf Paulchen gefallen, weil der viel zu sanft war, um zu drängen und zu fordern. Doch nun war aus dem lieben, netten Paulchen ein böser, düsterer Paul geworden. Lenas großer Bruder knipste ihn. Dann ging er zu seinem neuen Auto, dem gelben Trabant.
Diese Lena, dachte er. Aus Paul macht sie Paulchen, und einen älteren Jungen aus ihrer Nachbarschaft brachte sie dazu, sich als ihr großer Bruder zu verstellen. Damit der gar nicht auf Gedanken kommt.
4
Carola Schreiter war tatsächlich mit Thilo, ihrer Urlaubsbekanntschaft aus dem Rheinland, durchgebrannt. Er hatte ihr von Berlin erzählt, von seinem Soziologie-, Ethnologie- und Publizistikstudium, von seiner Kreuzberger WG und von einer »Reise nach Amiland«, die er für das nächste Jahr plante. Er erzählte von einem Leben, das sich Carola Schreiter auch für sich vorstellen konnte. In Thilos WG war noch ein Zimmer frei. Die Grenze nach Österreich wurde nicht mehr scharf bewacht, und mit Thilo konnte sie riskieren, auf die andere Seite zu gelangen. Es war wie ein Spiel. Die Grenze war nur eine Autostunde entfernt. Thilos Ente war ein unverdächtiges Auto. Sie fanden eine Stelle, die geeignet erschien. Sie stiegen aus und liefen auf die andere Seite. Sie flohen in der Dämmerung. Sie mußten nicht die Nacht abwarten. Es gab viele Mükken. Es gab keine Grenzer, keine Wachtürme, keinen Zaun. Nur einen Grenzpfosten. Es war beleidigend einfach. Carola mußte lachen, laut lachen, während sie lief.
Thilo kehrte um und kümmerte sich um das Auto. Er mußte, um nach Österreich zu gelangen, einen Grenzübergang benutzen. Der schwierigste Teil der ganzen Flucht bestand darin, sich wiederzufinden.
Carola ließ sich auf der Konsularabteilung der bundesdeutschen Botschaft in Wien einen deutschen Paß ausstellen. Mit dem stand sie unter dem Schutz der Bundesregierung. Ihr wurde erklärt, daß der Staat, dem sie den Rücken kehrte, sie auf unabsehbare Zeit nicht wieder einreisen lassen wird. Carola glaubte, daß dieser Staat ihren Weggang noch gar nicht registriert hatte, und wollte mit dem Leichtsinn der Verliebten den Transit nach Berlin wagen, in der Ente von Thilo. Ihr Paß, in Wien ausgestellt, war so neu, daß er noch roch. Carola sächselte. Selbst der begriffsstutzigste Anfänger unter den Grenzern müßte erkennen, daß Carola eine Ungarnflüchtige war.
In der Raststätte vor dem Grenzübergang kamen sie mit einem Ingenieur ins Gespräch, der in seiner Studentenzeit einen Tunnel unter der Mauer gegraben hatte. Er kannte sich aus und warnte die beiden: Sie würden für Jahre ins Gefängnis kommen, trotz des Passes von Carola. Solange sie nicht aus der DDR-Staatsbürgerschaft entlassen sei, unterliege sie den Gesetzen der DDR.
Carola kam mit der PanAm nach Berlin. Sie bezog ein Zimmer in Thilos WG, groß genug für Bett, Kleiderschrank und Schreibtisch. Sie wollte fast dasselbe studieren wie Thilo: Psychologie, Publizistik und Ethnologie. Sie mußte sich nicht bewerben, wie sie es kannte. Sie mußte sich nur einschreiben, immatrikulieren – ein Verfahren, das sie faszinierte: Keine Bewerbung war nötig, keine Begründung, keine Beurteilungen, kein Lebenslauf, und es gab auch kein wochenlanges Hoffen auf die Zulassung – nein, man ging hin, schrieb sich ein und konnte studieren.
Doch so einfach war es nicht. Carola sollte ihr Abiturzeugnis vorlegen. Das konnte sie nicht, das war zu Hause geblieben. Wenn sie ihr Abitur nicht in dem Bundesland abgelegt habe, in dem sie studieren wolle, benötige sie zudem die Anerkennung der zuständigen Landesbehörde, in ihrem Fall des Berliner Senats. Das alles erfuhr sie im Immatrikulationsbüro. Carola erzählte die Geschichte ihrer Flucht und hob das Spontane der Aktion hervor. Auch wisse sie nicht, ob ihre Eltern ihr das Zeugnis zukommen ließen oder ob es auf dem Postweg abgefangen werde. Die Mitarbeiterin im Immatrikulationsbüro hörte sich die Geschichte geduldig an und blieb bei ihrer Entscheidung. Carola verlangte, den Chef zu sprechen. Der bestätigte die Entscheidung seiner Mitarbeiterin: Es gibt Vorschriften, die für alle gelten. Sonst müßte niemand mehr das Abitur ablegen, um zu studieren.
Carola fuhr in ihre Kreuzberger WG, setzte sich an den Schreibtisch und schrieb einen Brief an den Präsidenten der Freien Universität. Thilo sagte, ihr Versuch, mit ihrer persönlichen Geschichte Einfluß auf die Entscheidungen einer Bürokratie zu nehmen, sei dumm. Gerade daß die Entscheidungen unpersönlich sind, mache die Bürokratie so wertvoll. Die Bürokratie ist ein Instrument zur Vermeidung von Willkür. Die Bürokratie arbeitet kalt, berechenbar und regelhaft. Die Gleichgültigkeit gegenüber Schicksalen ist ein hohes Gut. Schöne Augen, eine anrührende Geschichte und die familiäre Herkunft interessiert die Bürokratie genausowenig wie die politische Einstellung der Antragsteller. Sie solle den Brief an den Präsidenten nicht zu Ende schreiben. Ausnahmen kommen in einer Bürokratie nicht vor. Würde die Bürokratie Ausnahmen machen, dann bräuchte man sie nicht. Sie sollte sich lieber ihr Zeugnis beschaffen. Oder das Westberliner Abitur ablegen.
Carola war von Thilo enttäuscht. Sie hatte gehofft, er würde mit ihr den Kampf zu Ende kämpfen.
Carola schrieb an ihre Eltern. Sie war davon überzeugt, daß ihre Eltern sie verstehen würden. Ihre Eltern waren schließlich keine Bürokratie. Carola hatte sich romantische Vorstellungen gemacht, als Thilo am Balaton erzählte, er lebe in einer Wohngemeinschaft. Sie hatte gedacht, eine Wohngemeinschaft sei etwas, wo sich dicke Freunde keinen Zwang antun, nackt durch die Wohnung spazieren und alles miteinander teilen. Eine Familie, nur ohne Machtverhältnisse. Tatsächlich war es nichts als eine Zweckgemeinschaft. Jeder hatte ein eigenes Fach im Kühlschrank. Jeder mußte seinen eigenen Abwasch sofort erledigen. Am Morgen gab es feste Badezimmerzeiten, zwanzig Minuten für jeden. Die Ausgaben für Putzmittel wurden auf eine Liste gesetzt und am Monatsende geteilt, »nicht gleichmäßig, sondern gerecht«, wie Thilo sagte. Die »gerechte« Teilung berücksichtigte die Anwesenheitsdauer des WG-Mitglieds.
Das Leben in der WG hat etwas Bürokratisches, fand Carola. Klar, sagte Thilo, die früheren Modelle sind alle gescheitert. Nur die Mieten sind immer gestiegen.
5
Fritz Bode liebte es seit neuestem, in seinen Briefkasten zu schauen. Er war sechsundsechzig Jahre, und wenn er eine bestimmte Sorte Briefe fand, summte oder pfiff er auf dem Weg in die vierte Etage Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an, mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spaß daran. Fritz Bode hatte den weiteren Text vergessen, so sang er den Anfang eben zweimal.
Fritz Bode hatte in der Tat das erste Mal Spaß am Leben. Er hatte harte, bittere Zeiten durchgemacht. Daß ein großer Verlag in Hamburg seine Memoiren gedruckt und als »Autobiographie« herausgebracht hatte, erfüllte sein Herz mit einem tiefen, ruhigen Stolz. Eine »Autobiographie« war etwas anderes als »Erinnerungen« oder »Lebenserinnerungen«. Autobiographie klang offiziell und bedeutend.
Fritz Bode bekam Einladungen zu Lesungen. Er nahm an. Er war Rentner und hatte das Bedürfnis, sich nützlich zu machen. Diese Lesungen waren eine verrückte Angelegenheit: Völlig fremde Menschen kamen und interessierten sich für sein Leben. Seine Meinung, so erlebte er immer wieder, war wertvoll. Das alles kannte Fritz Bode nicht, aber er fand es phänomenal. Und was das komischste war: Es gab sogar Geld dafür, 500 DM am Abend. Er liebte Lesungen.
Die Einladungen kamen fast immer aus dem Westen, was in der Post auf den ersten Blick erkennbar war: strahlend weiße Kuverts, oft sogar mit einem kleinen bunten Stadtwappen.
Auch an diesem Tag lag so ein Brief im Briefkasten, von der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung. Von wegen, im Westen nichts Neues, dachte Fritz Bode. Die Sozis hatten ihm noch nie geschrieben.
Die Briefkästen in seinem Haus waren eine Schande. Zehn rostige Blechkästen, verbeult und so schief nebeneinander, als bräuchten sie Zahnspangen. Schon daß sich in solch schäbige Blechbehältnisse so strahlend weiße Briefe verirrten, war für Fritz Bode ein Beweis des unangemessenen Glücks, dessen er jetzt, mit sechsundsechzig Jahren, teilhaftig wurde.
Einer der Briefkästen quoll über, seit Wochen schon. Post für die junge Frau aus der zweiten. Fritz Bode hatte sich immer gefreut, wenn er ihr auf der Treppe begegnet war, besonders im Sommer – sie war was fürs Auge. Und nun wird ihr Briefkasten nicht mehr leer gemacht. Trotzdem stopft die Briefträgerin Post rein. War bestimmt beliebt, die Kleine, dachte Fritz Bode, als er auf dem Weg nach oben an ihrer Wohnungstür vorbeikam. Die Tür war übersät mit Zetteln und Nachrichten. Der junge Mann in der Wohnung unter ihm war auch so ein Kandidat. Die Tür von dem wird vielleicht bald genauso aussehen, und der Briefkasten auch.
So etwas wie diese Fluchtwelle hatte selbst ein Fritz Bode noch nicht erlebt. Ein großes, namhaftes Magazin aus dem Westen hatte ihn um einen Essay gebeten, um einen Kommentar zu dem, was gerade stattfand. Fritz Bode spürte, daß er den Stil seines Reflektierens, der mit dem Schreiben seiner Autobiographie gewachsen war, nicht einfach abstellen konnte. Der Sommer neunundachtzig ist flekkig. Gescheckte Jeans sind Mode. Ungarn-Urlaube sind Mode. So könnte er anfangen. Er hatte noch nicht zugesagt, er wollte warten, ob der junge Mann in der Wohnung unter ihm auch einen überquellenden Briefkasten und eine zettelgespickte Tür zurückläßt. Dieser junge Mann war einen Nachruf wert. Noch war er da, unüberhörbar: Erregte Stimmen konkurrierten per Lautstärke um das Rederecht.
Noch im Treppenhaus überlegte Fritz Bode, weshalb ihm wohl die Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben hatte. Vielleicht wollten sie ihn einladen in eine Gesprächsrunde mit Willy Brandt und Günter Grass. Und sich entschuldigen, daß sie ihm nur tausend DM Honorar anbieten könnten. Fritz Bode lachte in sich hinein, ihn konnte, ein halbes Jahr nachdem sein Buch erschienen war, nichts mehr von den Socken hauen.
Fritz Bode schloß seine Wohnung auf, wechselte in Pantoffeln, ging in sein Arbeitszimmer und machte Licht am Schreibtisch. Er setzte sich und tat einen tiefen Seufzer des Wohlbehagens. Dann griff er nach dem Brieföffner aus Messing und schlitzte das feine Briefchen auf. Der Cognac stand in Reichweite. Nur für den Fall, daß tatsächlich Willy Brandt und Günter Grass …
Nein, die Friedrich-Ebert-Stiftung wollte ihn nur zu einer Lesung einladen, wie alle. Am 1. Dezember in Berlin, in der Wilmersdorfer Bibliothek. 500 DM bieten sie. Fritz Bode schaute in seinen Kalender: Der 1. Dezember war noch weiß. Als Rentner durfte er dreißig Tage pro Jahr in den Westen fahren; sein Kontingent war noch nicht ausgeschöpft. Er würde zusagen. Auf den Cognac wollte er nicht verzichten. Als er das Schlückchen auf dem Boden des Cognacglases in eine kreiselnde Bewegung versetzte, bemerkte er, daß es in der Wohnung unter ihm still war.
Der Hauptgast war gekommen: Ein bekannter Dichter, der immer auffiel, komischerweise weil er so klein war. Der kleine Dichter hatte einen Bart, der wie wild wuchs: Wenn er sich am Morgen rasierte, wirkte er abends bereits wieder unrasiert. Und nie wurde er mit Krawatte gesehen. Ein jungenhafter Abenteurer, dem die Sympathien in einem Maße zuflogen, daß andere an seiner Stelle, vom süßen Duft des Ruhms benebelt, längst dazu übergegangen wären, sich in der dritten Person wahrzunehmen.
Der kleine unrasierte Dichter war kein Veteran wie Fritz Bode, er war aber auch längst nicht so jung wie jene, die sich erkühnt hatten, ihn einzuladen. Der kleine unrasierte Dichter war ein verrückter Mensch: Ein Kriegskind, das den Ausbruch des Friedens erlebte wie ein Wunder – blauer Himmel über Trümmern, Blühen, Zwitschern. Er war in dieses Land mit seinen berauschenden Visionen hineingewachsen und hatte die Einladung zum Mittun wörtlicher genommen, als sie gemeint war. Die planvollen Mißverständnisse lagen ihm. Es gab eine Klaviatur, auf der er exzellent spielen konnte, ob lakonisch, lässig, spöttisch, selbstzweifelnd, klug oder scharf. Diese Klaviatur war politisch. Die Presse druckte Lügen, die das Radio sendete und das Fernsehen bebilderte, und gegen Wahrheit, Tatsachen, Fakten gab es -zig Paragraphen. In diesem Geschäft mischte der kleine unrasierte Dichter mit, allerdings bei den Guten. Seine Strategie war, der Zeit weit voraus zu sein – er wollte heute schon aussprechen, was morgen erst verboten wird. Diese Strategie machte seine Lyrik, die vor Talent nur so strotzte, zu intellektuellen Herausforderungen. Zu Plattformen, auf denen über den Stand der Dinge und den Gang der Geschichte gestritten wurde. Der kleine unrasierte Dichter hatte einst Philosophie studiert, und sein Lieblingsspielzeug war die Dialektik. Für ihn, ein Kind von Krieg und Nachkrieg, war es selbstverständlich, ein Spielzeug nicht kaputtzumachen.
Die Texte des kleinen unrasierten Dichters waren, wenn sie endlich erscheinen durften, Ereignisse. Die Bücher, nur in kleiner Auflage genehmigt, wanderten von Hand zu Hand, bis sie auseinanderfielen. Seine Hörspiele, die nur mitten in der Nacht gesendet wurden und nie eine Wiederholung erlebten, wurden auf Kassetten aufgenommen, mehrmals gehört und ausgelegt. Und wenn ein Stück von ihm auf den Spielplan kam, waren die ersten Theaterabende heftig ausverkauft – die Leute wollten es noch gesehen haben, bevor es verboten wird. Den ganzen Anspielungskosmos des kleinen Landes, all seine Debatten, Lügen und Tabus konnte der kleine unrasierte Dichter vor seinem Publikum wie ein animistischer Medizinmann ausbreiten. Das Publikum kam von weit her gereist, doch seinem Friseur blieb sein Schaffen fremd, sosehr der auch um den Rang seines kleinen unrasierten Kunden wußte.
Der junge Mann unter Fritz Bode, Daniel Detjen, ein um sein Abitur betrogener Pfarrerssohn, der seine hugenottische Abstammung unterstrich, indem er seinen Nachnamen auf der zweiten Silbe betonte und den Vokal der ersten Silbe stumm hielt, hatte dem kleinen unrasierten Dichter einen Brief geschrieben. Dieser Brief hatte eine Saite zum Klingen gebracht – der kleine unrasierte Dichter fühlte sich dem Briefschreiber nahe, obwohl der es gar nicht darauf angelegt hatte, diese Nähe zu erzeugen. Es war die »romantische Bereitschaft«, jener Charakterzug, den F. Scott Fitzgerald dem großen Gatsby zuschrieb, die der kleine unrasierte Dichter dank dieses hilfesuchenden Briefes an sich wiederentdeckte. Die war ihm im Zuge einer Überzüchtung Brechtscher Coolness abhanden gekommen. Seine gelegentlichen Anwandlungen von sardonischer Intellektualität bereiteten ihm ein seltsames Gefühl.
Daniel Detjen war ein lebhafter, geistvoller Mensch, der einen großen, einen unüberschaubaren Freundeskreis unterhielt. Er war von einer ozeanischen Großzügigkeit. Immer saßen Menschen auf seinem Sofa und diskutierten. Er schien nie müde zu werden, nie schlechte Laune zu haben. Ein blondes Prachtexemplar mit einem hellen, offenen Gesicht und einem ebensolchen Wesen. Daniel Detjen unterhielt Briefwechsel nach Nicaragua, Indien, Palästina, in die USA und nach Dänemark. Er sprühte vor Ideen, verschenkte anstrengungslos originelle Komplimente, teilte seine Zeit und seine Begeisterungen mit anderen. Auch sexuell war ihm jede Beschränkung fremd: Er hatte Freude an Frauen und Männern. Ehe er die Laken wechselte, hatte er darin mehr Sexualpartner geliebt, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben haben.
Zwei Wände seines Zimmers waren von der Scheuerleiste bis hoch zur Decke von Bücherregalen verbaut. An der Wand gegenüber den Fenstern stand ein Klavier, das schäbig, ja schrottreif aussah, aber über einen erstaunlichen, sogar konzertanten Klang verfügte. Doch der Mittelpunkt des Zimmers wie des Lebens von Daniel Detjen war die Teekanne. Er diskutierte immer zum Tee, nie beim Bier oder Wein. Daniel, sonst ein schlechter, ja miserabler Hausmann, befolgte mit geradezu orthodoxer Strenge die Regel, Teekannen niemals mit Seife auszuwaschen, sondern nur unter klarem Wasser zu spülen. Daß seine Teekanne aus Jenaer Glas war, ließ sich kaum noch erkennen: Über die Jahre hatte sich ein brauner, immer stärker dunkelnder Belag gebildet, der wie eine fabrikmäßige, unverwüstliche Beschichtung wirkte. Längst war sie schwarz und lichtundurchlässig. Aber selbst wenn die Kanne einst ganz von diesem Belag zugesetzt sein würde, wenn die Rückstände tausender Hektoliter Tee sie in einen Stein verwandelt haben würden, »dann« – so erklärte Daniel Detjen – »ist die erste Silbe der Welträtsel überhaupt erst gefragt«.
Daniel suchte nach Orientierung in diesen Zeiten. Die Diskussionen mit seinen Freunden, zu denen Theologiestudenten und rausgeschmissene Parteimitglieder, Westler und Künstlerkinder, Aussteiger und Ausländer gehörten, hatten ihn nicht weitergebracht. Nicht mal seine kluge Chefin, die prominente Rechtsanwältin Gisela Blank, hatte Erhellendes oder gar Ermutigendes mitzuteilen.
Daniel Detjen war ein Mensch, der zu leben verstand, aber dieses Land vertrieb ihm die Freunde, mißachtete seine Talente, verletzte sein Gerechtigkeitsempfinden, beleidigte seinen Geschmack und verhöhnte seine Intelligenz. Es engte ein und schrieb vor. Vom Wein bekam er Kopfschmerzen und von allem anderen auch. Warum aus dem Überraschungsei der Utopisten, Sozialismus genannt, ausgerechnet eine Echse kroch, war Daniel ein Rätsel. Die bessere Welt, wie sieht sie aus? Wann findet sie statt?
So schrieb er dem kleinen unrasierten Dichter, einem Experten in Fragen jetziger und besserer Welten – und der antwortete; er hatte ein wie angeborenes Sensorium für alle Arten von Kälte, und solidarische Reflexe regten sich gegenüber allen, die unter Kälte litten. Sie verabredeten sich für einen Freitagabend im August. Der kleine unrasierte Dichter kam direkt von seinem Urlaub auf Hiddensee, allerdings verspätet; er konnte von der überfüllten Insel erst mit der dritten Fähre runter. Die Bude von Daniel war längst verqualmt.
Die Freunde von Daniel Detjen verfolgten den kleinen unrasierten Dichter dabei, wie er tastend seine Gedanken verfertigte, wie er sich einen Weg durch den Verhau seiner Ideen bahnte. Es war ein Abenteuer, dem kleinen unrasierten Dichter, einem geübten und erfahrenen Denker, beim Nachdenken zuzuschauen. Nicht das, was er sagte, blieb haften, sondern sein Stil: Es schien ihm ein Greuel, Bekanntes zu wiederholen, sich auf gültige Gewißheiten zu berufen. Nur Neues, bislang Ungesagtes interessierte ihn. Der kleine unrasierte Dichter war davon überzeugt, daß sich unter Ausschluß der Öffentlichkeit eine Öffentlichkeit entwickelt hatte, welche die staatliche, offiziell stattfindende Öffentlichkeit an Bedeutung längst übertroffen hatte.
Einer der Gäste von Daniel war Waldemar Bude, ein vierundzwanzigjähriger Hotelportier, ein gebürtiger Pole, der als Zwölfjähriger mit seiner Mutter die Heimat verlassen hatte. Es war nicht sein Beruf, sondern seine Herkunft, die ihn für den Daniel-Detjen-Kreis legitimierte: Polen waren interessant. Sie konnten aus eigenem Erleben darüber berichten, wie ein Volk das Unglaubliche fertigbringt und die Macht der Partei abschafft. Waldemar avancierte zum Talisman der Umsturzphantasien. Daß er immer nur als Pole, als Exemplar seines Volkes angesprochen wurde, amüsierte ihn insgeheim und gab ihm ein heimliches Gefühl der Überlegenheit: Der Daniel-Detjen-Kreis wollte so unabhängig denken und war doch so beschränkt. Der deutsche Freiheitsdrang kam ihm immer herbeigeredet vor. Den polnischen Freiheitsdrang konnte Waldemar beim Wandern in den Beskiden und beim Zelten in den Masuren mit den Händen greifen. Die polnische Sprache, ein Dauerfeuer von Zisch- und Spucklauten, wurde beim Singen geschmeidig, bekam fast französischen Schmelz.
Góralu czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych
Świerkowych lasów i hal
I tych potoków przejrzystych
Gorale, bereust du es nicht
Deine Heimat zu verlassen
Tannenwälder und Almen
Und die klaren Bäche
Die Deutschen sangen am Lagerfeuer nie ihre eigenen Lieder, schon gar nicht zur Gitarre. Es gab immer nur einen, der das »House of the Rising Sun« oder »Blowin’ in the Wind« schändete.
Am Vortag hatte Waldemar in seiner Hotelhalle, wo ständig ein Fernsehapparat lief, zufällig einen Film über Wasserspinnen gesehen. Die Weibchen drücken ihre Eier zwar einzeln, doch in großer Zahl aus dem Hinterleib und formieren sie mit den Hinterbeinen zugleich zu einem Klumpen. Nur wenige der Spinnen, die aus einem solchen Eierklumpen schlüpfen, erleben den nächsten Sommer. Der Rest wird bis dahin gefressen oder auf zahllose Arten verendet sein. Das Nachdenken des kleinen unrasierten Dichters erinnerte Waldemar an die eierlegende Wasserspinne. Wenn er geht, bleibt ein großer Klumpen kleiner Gedanken liegen. Morgen wird er die Hälfte von dem, was er gesagt hat, vergessen haben und übermorgen die andere Hälfte. Eines Abends wird er auch mal eine Idee ablegen, die den nächsten Sommer erlebt.